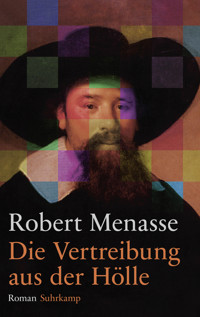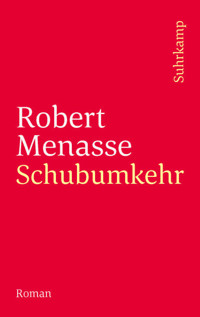14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mateusz und Adam, die gemeinsam im polnischen Untergrund gegen das kommunistische Regime gekämpft und sich dort »Blutsbrüderschaft« geschworen haben, gehen nach dessen Zusammenbruch getrennte Wege. Mateusz macht innenpolitisch Karriere und wird schließlich polnischer Ministerpräsident. Adam geht nach dem EU-Beitritt Polens nach Brüssel, wo er in der Europäischen Kommission in der Generaldirektion für Erweiterung arbeitet. Im Streit um den Beitritt Albaniens in die Europäische Union wird aus der einstmals tiefen Verbundenheit der beiden Männer eine unversöhnliche Feindschaft von schicksalhafter Dimension. Auf dem schwankenden Boden eines albanischen Kreuzfahrtschiffs kommt es zum Showdown.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 817
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cover
Titel
Robert Menasse
Die Erweiterung
Roman
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5361.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagabbildung: Tatsiana Tsyhanova/Shutterstock
eISBN 978-3-518-77398-7
www.suhrkamp.de
Widmung
Für meine Enkel Janek und Kamil. Irgendwann werden sie Fragen stellen. Ich werde nicht mehr antworten können, aber ich kann ihnen diese Erzählung hinterlassen, über »damals«, mein Jetzt.
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
Erster Teil. Das Ganze und seine Gegenteile.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Zweiter Teil. Als Tragödie, als Farce, als ob.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Dritter Teil. Fügungen.
Vierter Teil. Wenn das Lose abblättert vom Besinnungslosen.
Fünfter Teil. Der Exkurs ist die kürzeste Verbindung von zwei Fluchtpunkten.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Sechster Teil. Code Alpha.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Karten
Informationen zum Buch
Die Erweiterung
Prolog
Zwerge haben die Welt erobert. Tomislav »Tommy« Vysoky war verblüfft, als ihm das klar wurde. Er war ein zwei Meter fünf großer junger Mann, der Transkulturelle Kommunikation an der Universität Wien studierte, wo er auch bei den Uni Wien Emperors Basketball spielte. Um sein Studium zu finanzieren, nahm er immer wieder Halbtagsjobs an, seit einer Woche arbeitete er als Saalaufsicht im Weltmuseum, einer Dependance des Kunsthistorischen Museums in der Wiener Hofburg. Dienstag und Mittwoch am Vormittag, Freitag am Nachmittag, das konnte er gut mit Studium und Training verbinden. Diensteingeteilt war er in der Rüstkammer, der bedeutendsten historischen Waffensammlung Europas, deren Objekte alle im Zusammenhang mit hochpolitischen Ereignissen entstanden waren, wie Reichstagen, Krönungen, Feldzügen, und die vom Aufstieg und Fall von Dynastien und Wendepunkten der europäischen Geschichte »erzählten«, wie es im Katalog hieß. Tommy Vysoky fand, dass das eine unsinnige Formulierung war, die Objekte erzählten gar nichts, die Reihen von Rüstungen standen stumm da, man müsste jemanden danebenstellen, der erzählen konnte. Aber das war nicht seine Aufgabe. Er sollte nur aufpassen, dass niemand den Rüstungen zu nahe trat. Kernstück seines Aufsichtsbereiches war die »Heldenrüstkammer«, eine Sammlung von Schwertern, Hellebarden, Helmen, Harnischen, Rüstungen und Kriegstrophäen, vor allem Fahnen und Standarten, der berühmtesten Feldherrn des 15. und 16. Jahrhunderts, Eroberern und Verteidigern der abendländischen Welt. Aber für Tommy Vysoky strahlten diese glänzenden und schimmernden Objekte nicht die Aura von mächtigen, starken Männern aus, von Siegern in unzähligen Schlachten, von Herrschern über die damals bekannte Welt, ihn wunderte vielmehr, wie klein diese Männer gewesen waren. Sah man ihre Rüstungen, konnten sie kaum größer als einen Meter sechzig gewesen sein. Im Grunde Zwerge.
Würde man ihn einen Kopf kürzer machen, dachte Tommy, rein bildlich natürlich, er wäre immer noch größer als zum Beispiel dieser Kriegsherr namens Skanderbeg, vor dessen Helm, der wie für einen Kinderkopf gemacht schien, jetzt gerade mit großer Ehrfurcht ein deutscher Tourist stand.
Severin Osterkamp aus Darmstadt, Musiklehrer am dortigen Ludwig-Georgs-Gymnasium, war verblüfft. Er war nur deshalb in die Rüstkammer gegangen, weil es seinem Selbstverständnis und seinem Anspruch entsprach, beim Besuch eines bedeutenden Museums durch jeden Raum zu wandern, durch jeden! Schließlich hatte er Eintritt für das ganze Haus bezahlt. Und man konnte nie wissen, ob nicht irgendwo eine Überraschung wartete, auf die sein Reiseführer nicht hinwies. Und da war sie. Die Überraschung. Der Helm des Skanderbeg. In einer Vitrine, die ihn sofort bei Betreten des Raums angezogen hatte, weil sie, von innen beleuchtet, diesen Helm glitzern und strahlen ließ. Die anderen hier ausgestellten Helme lagen im Schatten, hinter Kordeln. An denen ging Professor Osterkamp einfach vorbei.
Er las die Legende und staunte. Als Musikprofessor kannte er natürlich die Vivaldi-Oper »Skanderbeg«. Erst vor wenigen Wochen hatte es eine konzertante Aufführung am Staatstheater Darmstadt gegeben. Aber Skanderbeg war für Professor Osterkamp einfach eine Figur der Opernliteratur, er hätte nie gedacht, eines Tages vor einem Helm zu stehen, den diese Figur wirklich in Schlachten getragen hatte.
Er zückte sein Smartphone, schaute fragend zur Saalaufsicht, die aufmunternd nickte, und fotografierte diesen eigentümlichen Helm mit dem Ziegenkopf auf dem Helmscheitel.
Dann hastete er weiter, es gab noch so viele Säle und Räume in diesem Museum.
So historisch bedeutend die Rüstkammer des Kunsthistorischen Museums auch war, ein Touristenmagnet war sie nicht. Tommy Vysoky konnte oft zwanzig oder dreißig Minuten ungestört mit seiner Freundin oder den Emperors whatsappen, bis der nächste Besucher kam. Aber heute, es war seltsam, da kam schon der nächste.
David Bryer aus London, Journalist der BBC im Ruhestand, machte, frustriert vom Brexit, eine ausgedehnte sentimental journey auf dem Kontinent.
Er war von der Ringstraße unterwegs über den Heldenplatz zur berühmten Konditorei Demel auf dem Kohlmarkt, vom Reiseführer dringend empfohlen, wo er diese köstlichen viennese Mehlspeisen probieren wollte, bevor er am nächsten Tag nach Prag weiterreiste. Ein Wolkenbruch, gerade als er am Weltmuseum vorbeiging, ließ ihn ins Museum flüchten. Beeindruckt von der imperialen Pracht der Hofburg, ging er die Marmorstiege hinauf, befand sich plötzlich in der Rüstkammer, ging an einer Armee von Rüstungen vorbei und stand schließlich vor der Vitrine, in der dieser seltsame Helm mit dem Ziegenkopf schimmerte. Das war im Unterschied zu allen anderen Helmen in diesem Raum sozusagen seine unique selling proposition. Wer setzt sich eine Ziege auf den Kopf, dachte David Bryer und las die Legende. Er staunte nicht schlecht.
Er wohnte in London in Inverness Terrace, wo er täglich an der Ecke zu Porchester Gardens am Skanderbeg-Denkmal vorbeikam. Zumindest wusste er, dass auf dem Sockel dieses Denkmals der Name Skanderbeg stand. Und vor vierzig Jahren, nein, noch länger her, hatte er sich dort mit Mädchen verabredet. Treffen wir uns beim Skanderbeg! Aber dass dieser Skanderbeg eine Art General Wellington des Spätmittelalters war, das hatte er nicht gewusst. Er wird, zurück in London, das Denkmal an der Ecke seiner Straße mit anderen Augen sehen. Oder überhaupt: sehen.
Tommy Vysoky war verwundert. Da kam schon wieder jemand. Eine zierliche Person, sie, ja sie, würde sogar in eine der hier ausgestellten Rüstungen passen. Eins sechzig, schätzte er. Sie hatte langes nasses Haar, das sie hin und her warf, dass die Tropfen nur so flogen, Tommy Vysoky machte sie auf Englisch darauf aufmerksam, dass sie das bitte unterlassen möge, die eisernen Rüstungen könnten durch Flugrost Schaden nehmen. Das war ein Gedanke von ihm, er wusste nicht, ob das wirklich so war, ob es das hier gab: Rost. Sie bat um Entschuldigung, yes, scusi, Tommy reichte ihr ein Papiertaschentuch, grazie, mit dem sie sich das Gesicht abwischte. Sie trug einen großen Rucksack, was hier eigentlich verboten war, aber Tommy dachte, wenn sie unten damit durchgekommen ist, was sollte er sich hier jetzt wichtig machen, sie wird schon keinen Helm stehlen wollen.
Patrizia Barella war eine Musikstudentin aus Rom, die nach Wien gekommen war, um ihr Violine-Studium durch Privatstunden bei Professor Höllerer zu krönen beziehungsweise durch den Eintrag in ihrer Biographie »Studium in Wien bei Professor Höllerer« ihre Zukunftschancen zu verbessern. Man sagte, dass jeder Violinist vor einer internationalen Karriere an diese Weggabelung kommt: »Zur Hölle oder zu Höllerer«.
Als sie an einer Reihe von Rüstungen, Schwertern und Helmen vorbeigegangen war, bei denen die schiere Menge faszinierend war, aber kein einzelnes Objekt als solches, stand sie vor diesem Helm mit dem Ziegenkopf, der definitiv anders war und anders präsentiert wurde, in einer eigenen Vitrine als Solitär, auf eine Weise beleuchtet, als würde ein Mann, der diesen Helm aufsetzte, dadurch auch einen Heiligenschein haben.
Patrizia las die Legende und rief so ekstatisch, dass Tommy erschrak: Mannaggia, non posso crederci! Ich glaub's nicht, Wahnsinn!
Scusi, scusi, alles gut! Patrizia wohnte in Rom bei ihren Eltern auf der Piazza Albania, und dort gab es ein Denkmal »Athleta Christi Skanderbeg«. Sie hatte keine Ahnung gehabt, wer das war, aber sie hatte seinerzeit in der Schule einen Aufsatz zum Thema »Ich erforsche mein Viertel« schreiben müssen, und da hatte sie geschrieben (woran sie sich jetzt erinnerte): »Auf dem Platz steht ein Denkmal von einem Mann mit Hörnern auf dem Kopf. Meine Eltern wissen nicht, wer das war, aber er muss wichtig gewesen sein, weil sonst würde er nicht auf unserem Platz stehen.« Sie machte ein Foto, das musste sie ihren Eltern schicken, und ihrer besten Freundin Lina, mit der sie so oft am Fuß des Denkmals gesessen hatte.
Da kam ein Mann zielstrebig in den Saal geeilt, es war eindeutig, dass er wusste, was er sehen wollte. Das war Fatos Velaj, ein bildender Künstler aus Albanien, der eine große Ausstellung in einer Wiener Galerie hatte. Er war an diesem Tag aus Tirana gekommen und wollte unbedingt noch vor der Vernissage den Helm des Skanderbeg sehen, aus purem Nationalstolz, für ihn war dieser Helm ein Symbol für die Bedeutung der Skipetaren für Europa. Er dachte –
In diesem Moment sagte Tommy Vysoky: Wir schließen in fünf Minuten. Bitte begeben Sie sich zum Ausgang. Wir schließen.
Aber –
Wir schließen in fünf Minuten!
Fatos Velaj machte noch in derselben Nacht im Hotelzimmer eine Gouache mit dem Titel »Europa: Wir schließen in fünf Minuten«.
Erster Teil
Das Ganze und seine Gegenteile.
1
Diesen Namen wird man sich merken müssen: Fate Vasa.
Am 6. September 2019 schrieb er Geschichte. Zumindest eine Geschichte, wie sie ein Dichter in der Welt, die den Staatenführern entglitt, schreiben konnte. Er hatte eine Idee – und keine Ahnung, welche Dynamik diese Idee entwickeln würde.
Er war dabei, als der albanische Ministerpräsident mit dem französischen Präsidenten telefonierte.
Avec respect, Monsieur le Président, brüllte der Ministerpräsident ins Telefon, Ta dhjefsha surratin!
Das war ein in Albanien gebräuchlicher, oft leichthin gesagter, aber zwischen Staatsmännern unfassbar zotiger Fluch, den man vorsichtig mit »Ich scheiße in dein Gesicht!« übersetzen kann. Dagegen war der nächste Satz, nicht mehr gebrüllt, sondern nur noch gezischt, geradezu kultiviert: T'u harroftë emri! – Dein Name soll vergessen werden!
Excusez. Je ne comprends rien à vos simagrées.
Dieses Telefonat führte allerdings zu keinen diplomatischen Verwicklungen, zumindest zu keinen, die größer waren als die Verstimmung zwischen den beiden Ländern, die ohnehin schon bestand. Das lag natürlich daran, dass der albanische Ministerpräsident in seiner Muttersprache fluchte, während der französische Präsident zu diesem Telefonat zwar den Sherpa, also seinen diplomatischen Berater, den Balkan-Experten des Außenministeriums, sowie den für Europapolitik zuständigen Minister zugezogen hatte, aber keinen Dolmetscher aus dem Albanischen. Schließlich war im Élysée bekannt, dass der albanische Ministerpräsident perfekt Französisch sprach, das war Standard in Albanien, wo man vom anarchistischen Künstler bis zum Diktator nichts werden konnte, ohne in Paris studiert zu haben.
Der Ministerpräsident, von seinem engeren Kreis ZK (Zoti Kryeministër) oder einfach Chef genannt, beendete das Telefonat abrupt und stellte mit großer Erregung sofort die Frage an die Runde seiner Berater, wie der Name des französischen Präsidenten laute. Sein Gesichtsausdruck und seine abwehrend nach vorn gestreckten Handflächen signalisierten, dass er keine Antwort wünschte. Alle im Raum Anwesenden schwiegen. Er nickte befriedigt. T'u harroftë emri!
Der französische Präsident hatte am Tag davor durch ein Veto im Europäischen Rat verhindert, dass die Union Beitrittsverhandlungen mit Albanien aufnahm. ZK hatte Wahlen mit dem Versprechen gewonnen, Albanien in die Europäische Union zu führen. Nun aber blieb Albanien Kandidat ohne konkrete Perspektive und sollte erst weitere Bedingungen erfüllen, Monitorings noch und noch, Evaluierungen von Reformen durch EU-Delegationen, konfrontiert mit neuen Listen mit Forderungen, denen nachzugeben von den Nationalisten heftig kritisiert werden würde.
Und dann fragte der Ministerpräsident, wie der Staatspräsident Chinas heiße, und er forderte mit aufmunternden Handbewegungen dazu auf, dessen Namen zu nennen. Eilfertig antworteten die Anwesenden im Chor:
Xi! Xi!!! Xi Jin! Ping!
Ja! China. Ganz richtig, sagte Pressesprecher Ismail Lani, Albanien habe da ja eine eigene Geschichte, eine gewisse Tradition –
»Tradition?«, rief der Ministerpräsident erregt, »Ich scheiße auch auf die Tradition. Die albanische Geschichte ist doch nur ein langer Albtraum von Fremdbestimmung und Unterdrückung, Besatzung durch Türken, Griechen, Italiener, Deutsche! Und kommunistische Diktatur. Ein Diktator, der chinesischer als Mao Zedong sein wollte, ist doch auch keine Tradition. Und dann die Mafia –«
Interessant, dass er auch die Mafia erwähnte, eigentlich ein Tabu. »Nein, wir haben keine Tradition«, setzte er fort, »wir sind aus einem langen Albtraum aufgewacht, nur um von Europa so vor den Kopf gestoßen zu werden, dass wir benommen gleich in den nächsten sinken. China ist jetzt einfach eine realpolitische Karte in diesem Spiel. Aber –«
Die Vertrauten von ZK, die in seinem Büro versammelt waren, sahen sich schweigend an.
Aber?
Bevor der Ministerpräsident weitersprechen konnte, warf Ismael Lani ein:
»Aber … aber … das können Sie so nicht sagen, Zoti Kryeministër … nicht laut sagen … keine Tradition … keine Geschichte … ich sage nur: Skanderbeg. Unser Nationalheld! Das ist doch unsere Geschichte, die Erinnerung an ihn, unsere Identität, die stolze Tradition, an der sich die Nation immer wieder aufrichtet!«
Der Chef machte eine verächtliche, wegwischende Handbewegung. »Skanderbeg. Aha. Lieber Ismail, geh bitte zum Fenster und schau hinaus.«
»Ja. Und?«
»Sag mir, was du siehst. Siehst du den Skanderbeg?«
»Ja, ich kann ihn sehen.«
»Und was macht er?«
»Nichts. Was soll er machen?«
»Er macht also nichts? Eben. Was soll er auch machen? Er ist doch nur ein Denkmal draußen auf dem Platz, an dem die Menschen vorbeirennen. Siehst du einen Passanten, der zu ihm aufschaut? Und sein Helm und sein Schwert liegen in einem Museum in Wien. Ein Mann aus dem 16. Jahrhundert –«
»15. Jahrhundert!«, warf Ismail Lani ein.
»Ein Mann aus dem 15. Jahrhundert – damit soll ich das Land in die Zukunft führen? Soll ich jetzt vielleicht noch ein Schwert erheben?«
Schweigen. Bis der scheue Fate Vasa, der weltweit erste Lyriker im Think-Tank eines Staatschefs (in seiner Personalpolitik war der Premierminister eigen, in seinem Beraterstab gab es fünf Künstler!), mit einem Einwurf befreites Gelächter und Beifall auslöste: »Schwert natürlich als Metapher! Skanderbegs Helm und Schwert, wofür steht das? Für die Idee eines geeinten Albaniens. Darum ist er ja unser Nationalheld: weil er der Erste war, der die albanischen Stämme geeint hat. Und jetzt geht es doch nur um dieses Signal, ich betone Signal: Wenn den Europäern Albanien heute zu klein ist, um es ernst zu nehmen, dann musst du sozusagen Skanderbegs Schwert zücken, symbolisch, verstehst du, als Gestus: Großalbanien! Die Deutschen durften sich vereinigen, und wir sollen es nicht dürfen? Mit den Albanern im Kosovo und den Albanern in Mazedonien … Wir stellen diesen Anspruch – und was wird passieren? Kann die EU das wollen? Eine neue Lunte am Pulverfass Balkan? Sie wird blitzschnell doch bereit sein, Zugeständnisse zu machen und Beitrittsgespräche mit uns aufzunehmen.«
Der Chef sah Fate nachdenklich an, diesen seltsamen Menschen, der die schönsten Gedichte schrieb, vollendete Kunst, und der so hässlich war, ein Missgeschick der Natur, lange sah er ihn an, dann nickte er.
Pressesprecher Ismail Lani sagte: Aber –
Der Chef schüttelte den Kopf und Ismail schwieg.
Das war der Beginn der Geschichte. Wenige Monate vor der großen europäischen Balkankonferenz in Poznań, Polen. Eine Lunte.
2
Bereits wenige Tage nachdem seiner Frau die Gottesmutter Maria erschienen war, wusste Jaroslaw, dass er sich scheiden lassen musste. Mit dieser Frau, das war ihm klar, konnte ein Mann nicht mehr glücklich werden – und nicht einmal in Polen politische Karriere machen. Aber just der Auslöser für seinen Wunsch, sich endlich scheiden zu lassen, war zugleich das Hindernis: die ehemals so zynische Frau, die jederzeit zu jedem Agreement bereit gewesen war, wenn es nur ihr Leben in Luxus garantierte, wollte nun, von der Gottesmutter erleuchtet, keine Zustimmung geben, die vor Gott in einem heiligen Sakrament geschlossene Ehe zu trennen.
Adam Prawdower schlug das Buch zu. Wollte er das weiter lesen? Der Roman war Tagesgespräch, ein Schlüsselroman über die politischen Eliten in der Hauptstadt. Ist ein gewisser Abgeordneter schwul und deshalb erpressbar? Es war nicht klar, wer dieser Abgeordnete war, aber jeder hatte seine Vermutung. Ist ein hochrangiger Beamter im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung wirklich korrupt? Leitete er EU-Fördergelder an eigene Firmen weiter, die von Strohmännern für ihn geführt wurden? Wer war damit gemeint? Hat ein Regierungsmitglied – welches? Jeder wusste: Der! Nein: Der! – ein Verhältnis mit einer Parteisekretärin, die plötzlich bei der polnischen Bahn einen hochdotierten Verwaltungsposten bekommen hatte?
Es war ein Schundroman voll von Verleumdungen, aber unangreifbar, weil die Verleumdeten nicht eindeutig identifizierbar waren, Fiktion, die sehr simpel weit verbreitete Vorurteile bediente, ein Spiel mit Phantasien, das weitergespielt wurde in den sozialen Netzwerken, blubbernden Blasen – wer ist der Politiker, dessen Frau eine Marienerscheinung hatte? Wer ist der schwule Abgeordnete?
Darüber diskutierte ganz Warschau? Über Gerüchte! Adam war fassungslos. Aber niemand sprach über den wirklichen Skandal, der sich doch vor aller Augen abspielte: nämlich den politischen Verrat des Ministerpräsidenten. Die Ideale ihrer Kampfzeit, alle verraten und verkauft. Was sie erkämpft, was sie errungen hatten, wird Schritt für Schritt wieder zurückgenommen und zerstört. Aber die Wähler diskutieren, wer der Politiker war, dessen Frau eine Marienerscheinung hatte. Es war deprimierend.
Dorota machte sich Sorgen. Adam war verschlossener und nachdenklicher als sonst. Fürst der Finsternis, sagte sie, aber er lachte nicht. Wann hatte sie ihn das letzte Mal lachen gesehen? Am Samstag vor drei Wochen, als er nach einem langen Spaziergang mit einem Hundewelpen nach Hause kam.
Was ist das?
Eine polnische Bracke, Ogar Polski. Du kennst doch diese Hundeboutique Une vie de chien in der Avenue de la Chasse. Ich bin vorbeigekommen, dort sah ich ihn in der Auslage.
Er setzte den kleinen Hund auf den Terrassenboden, schubste ihn und lachte. Er lachte, als der Hund umfiel und sich wieder aufraffte.
Dorota war wütend.
Ich bin nur noch drei Monate in Karenz, sagte sie. Und dann?
Der Jagdhund der Könige, sagte er. Er wird euch beschützen.
Euch? Wer ist euch? Unser Sohn und ich? Warum sagst du nicht uns?
Er schubste den Welpen und lachte.
Jetzt hatten sie auch noch einen Hund, der ins Haus pinkelte. Adam kümmerte das nicht, er kam spät von der Arbeit, dann saß er noch lange auf der Terrasse oder in seinem Zimmer, grübelte in seiner typischen Haltung, den Kopf gesenkt, die linke Hand auf sein verstümmeltes Ohr gelegt, oder er las und machte Notizen.
Dorota liebte ihren Mann. Seine distanzierte Art, selbst wenn er »Ich dich auch!« sagte, seine Schwierigkeiten mit unbeschwerter Vertrautheit – das musste sie verstehen. Und sie verstand es, aber manchmal fragte sie sich doch, warum? Warum musste sie das verstehen? Müssen, das ist doch keine Kategorie der Liebe. Aber dann kam wieder ein Moment, wo er Sätze sagte, die ihr das Gefühl gaben, ihrem Mann wieder nähergekommen zu sein, und schon war sie wieder gefangen in der Falle des Verstehens. Dann wieder sein Schweigen. Und was sie nicht verstehen wollte und nie verstehen würde, war sein Hass, in den er seit einiger Zeit geradezu vernarrt war. Er ließ nicht zu, dass er abkühlte, jedes Wort der Vernunft oder der Besänftigung wischte er weg.
»Nein, es ist nicht Hass. Es ist Treue. Wir haben einen Eid geleistet.«
Der Hass vergiftete seine Seele und würde womöglich noch ihre Ehe, wenn nicht gar ihre Existenz zerstören. Dieser ihrer Meinung nach völlig irrationale Hass auf seinen ehemals besten Freund Mateusz, den durch einen Eid in Kindertagen auf ewig mit ihm verbundenen »Blutsbruder« – den heutigen Ministerpräsidenten der Republik Polen.
Dorota fand es verrückt, sinnlos, völlig unnötig, eine Lebensfreundschaft zu zerstören wegen des Vorwurfs eines Verrats, der für sie nicht wirklich nachvollziehbar war. Ist es wirklich ein Verrat, wenn sich zwischen den politischen Idealen der Jugend und dann den Möglichkeiten der Realpolitik eine Differenz ergibt? Ist es wirklich erwiesener Verrat, wenn man einem Jugendfreund, der Karriere gemacht hatte, Absichten unterstellt, die nie von ihm geäußert wurden?
»Er hat sie geäußert! Er hat es klipp und klar gesagt!«
»Klipp und klar? Wahlkampfrhetorik!«
Sie hatten doch mit polnischer Innenpolitik nichts zu tun. Sie lebten in Brüssel, in einem komfortablen Haus mit einem schönen Garten nach hinten hinaus, in Merode, Rue d'Oultremont, große Rosenstöcke im Garten, der Verkäufer des Hauses ist besonders stolz auf die Rosen gewesen. Hier: die Rose »Doktor Kurt Waldheim«, benannt nach dem früheren UNO-Generalsekretär, der eine Botschaft an Außerirdische ins Weltall gesendet hat, erinnern Sie sich? Nein? War wohl vor Ihrer Zeit. Hier, diese Rose heißt »Doktor Wolfgang Schüssel«, die habe ich von daheim mitgebracht, aus Niederösterreich, leider sehr anfällig für Läuse, man kann sie zunächst ganz gut behandeln mit Brennnessel-Sud, aber dann braucht man stärkeren Tobak.
Haben alle Ihre Rosen einen Doktortitel?, fragte Dorota.
Diese hier nicht, mein absoluter Liebling, die Rose »Wiener Blut«, tiefrote Blüten, keine Dornen. In diese Rosen können Sie sich hineinlegen wie in ein weiches Bett.
Also in Blut schwimmen?
Der Verkäufer lachte. Er ließ noch einen Kanister Gift zurück, mit dem man Waldheim, Schüssel und Wiener Blut behandeln musste, »um immer eine Freude mit ihnen zu haben«, und Dorota liebte den Garten, die Rosen, die Waschbeton-Terrasse mit dem Grill, der im Brüsseler Regen verrostete, aber immer noch seinen Dienst tat, wenn Adam die Würste vom Boucher Lanssens mitbrachte, die besten Grillwürste Brüssels. Sie hatten nicht nur das Gefühl, Glück gehabt zu haben und ein gutes Leben zu führen, sondern auch ein sinnvolles Leben, weil sie nicht bloß irgendwelche Jobs hatten, sondern berufliche Aufgaben, mit denen sie sich identifizierten. Adam arbeitete in der Europäischen Kommission, in der Generaldirektion für Nachbarschaftspolitik und Erweiterung, wo sie ihn kennengelernt hatte, als sie nach ihrem Jura-Studium in Bologna und ihrem Master-Abschluss in European and Transnational Law an der Universität Göttingen als Trainee nach Brüssel gekommen war. Ihr Vater war Pole, der nach Verhängung des Kriegsrechts in den Westen geflüchtet war, ihre Mutter Italienerin. Dorota war knapp sieben Jahre alt, als der Eiserne Vorhang fiel. Ihre Großeltern in Polen hatte sie ein paar Mal besucht, zunächst mit ihren Eltern, später auch alleine, sie war Italienerin, fühlte sich allerdings irgendwie auch als »Herkunfts-Polin«, aber polnischer Patriotismus oder Nationalismus waren ihr völlig fremd. Sie erinnerte sich, mit welch großem Befremden sie ihrem Großvater gegenübersaß, als er eine Hasstirade auf »die Deutschen« geradezu spuckte, während sie in Göttingen studierte und einen Kommilitonen liebte, der Hermann hieß. Wie glücklich die Großeltern waren, als sie wenig später Adam heiratete, einen Polen aus einer berühmten Familie. Dass sie das noch erleben konnten.
Du bist europäischer Beamter! Du spielst keine Rolle mehr in Warschau! Was kümmert dich polnische Innenpolitik?
Innenpolitik? Dorota, bitte, wir bereiten die Balkankonferenz in Poznań vor. Das ist Europapolitik. Und Mateusz ist da natürlich der Gastgeber. Wenn du wüsstest, wie oft da interveniert wird. Anrufe, Mails …
Der Ministerpräsident ruft dich an?
Nicht er selbst. Er hat seine Leute. Er dirigiert sie wie eine Armee. Und eine Armee kommt nicht in friedlicher Absicht.
Adams und Mateusz' Familien waren seit Generationen eng miteinander verbunden. Schon seit dem Januaraufstand von 1863, als die Großväter ihrer Großväter gemeinsam in derselben Partisaneneinheit gegen die Russen gekämpft hatten. So weit gingen die Geschichten zurück, die in ihren Familien erzählt wurden. Dann waren ihre Großväter väterlicherseits im Untergrund, in der Armia Krajowa, der Heimatarmee, im Kampf gegen die Nazis. Dann die Väter, ab 1981 wieder im Untergrund, im Kampf gegen die Kommunisten, die das Kriegsrecht ausgerufen hatten und die Solidarność niederschlugen. Sie bauten die Untergrundarmee Kämpfende Solidarność auf, eine Waffenwerkstatt, einen Piratensender, einen Nachrichtendienst. Sie wechselten von Versteck zu Versteck, sie organisierten Sabotage-Akte, Sprengstoffanschläge, entführten und töteten Offiziere des Służba Bezpieczeństwa, des polnischen Geheimdiensts, in dessen Kellern gefoltert und gemordet wurde. Die fremden Väter. Adam und Mateusz waren beide dreizehn, als die Väter untertauchten, ihre Mütter sahen ihre Männer danach nur einige wenige Male, in konspirativen Wohnungen oder in einem Waldversteck, in das sie von Mitkämpfern gebracht wurden. Adams Mutter wurde schwanger, ein halbes Jahr später die Mutter von Mateusz. Beide brachten Töchter zur Welt, die wie Schwestern aufwachsen sollten. Adam und Mateusz aber wurden damals zu den Schulbrüdern in Poznań gebracht, das war der beste Schutz für die Söhne der mittlerweile vom SB identifizierten Untergrundkämpfer, ihre Überstellung in das Reich der heiligen römischen Kirche, in das auch der Geheimdienst nicht so einfach Zugriffsmöglichkeiten hatte, ihre Ausbildung zum Priesteramt. Adams jüdischer Vater wurde verschwiegen, Adam war getauft, so stand es in seinen Papieren, das genügte. Und hier begann, von beiden noch lange Zeit unbemerkt, die Entfremdung der beiden jungen Männer, die sich am Ende zu Hass steigern sollte. Aber rückblickend ging alles auf diese Periode zurück.
Als sie vierzehn wurden, sprachen sie den Eid der Kämpfenden Solidarność vor einem Vertreter des Untergrunds, den ihre Väter geschickt hatten. Nach einem Segen des Pater Prior wurden sie mit diesem Mann, der sich Konrad nannte, alleine gelassen.
Mit ihm stiegen sie hinab in die Katakomben der St.-Peter-und-Paul-Kathedrale, zum Sarkophag von Bolesław VI., Herzog von Großpolen. War es Zufall oder wusste Konrad von der jüdischen Herkunft Adams? Bolesław hatte 1264 das Statut von Kalisch erlassen, ein Toleranzpatent, das die Stellung der Juden in Polen definierte und die Grundlage für deren relativ autonome Existenz schuf, die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wirkte. Mit dem Statut wurden unter anderem Strafen für die Schändung von jüdischen Friedhöfen und Synagogen angedroht. Das Statut enthielt Vorschriften zur Bestrafung jener, die Juden des Ritualmords beschuldigten. Es regelte die Handelstätigkeit durch die Juden und sicherte ihnen die Unantastbarkeit des Lebens und des Besitzes zu.
Wenn Adam später daran zurückdachte, konnte er nicht glauben, dass es Zufall gewesen sein sollte, dass sie ihren Eid vor den Gebeinen dieses judenfreundlichen Herzogs von Großpolen abgelegt hatten. Die Männer des Untergrunds, die Kämpfer für ein freies Polen, überließen nichts dem Zufall. Wenn sie Waffen einsetzten, dann immer geplant und wohlüberlegt, niemals spontan, und genauso bewusst gingen sie mit Symbolen um, mit den Zeichen, die sie setzten. Diese Gewissheit war für Adam von größter Bedeutung.
Konrad eröffnete ihnen, dass sie natürlich nicht für das Priesteramt bestimmt seien, ihre Berufung sei eine andere.
Es war kalt, sehr kalt, und Adam und Mateusz hatten nur ihre weißen Seminaristenhemden an, aber sie glühten in ihrem Wunsch, hier im Untergrund des heiligen Polens in die Armee ihrer Väter aufgenommen zu werden. Sie legten einander die Arme um die Schultern, dann begann die Einschulung und Konrad sprach von – Mädchen.
Es sei nun die Zeit gekommen, sagte er, da sie vorbereitet sein müssten. Sie werden beginnen, sich für Mädchen zu interessieren, sie werden sich verlieben, erste Enttäuschungen erleben, hadern mit ihrer Unsicherheit, leiden unter Ängsten, aber all diese Schmerzen werden nichts anderes sein als die Geburtsschmerzen der Freiheit, die ihnen geblieben ist: der Freiheit zu lieben. Die Liebe hat vielerlei Gestalt, man muss sich dafür bereithalten, aber man kann sich nicht darauf vorbereiten, seine Reaktionen nicht planen, ausgenommen die eine: sich immer zu fragen, ob die Liebe ein Gefühlssturm ist, der zum Verlust von Kontrolle zu führen droht, oder die Grundlegung bedingungsloser Solidarität. Wie sicher kann ich sein, dass mich nicht ausgerechnet der Mensch, den ich liebe, verrät, aus Angst um das eigene Leben oder aus Enttäuschung oder aus Rachsucht wegen erlittener Kränkungen? Im Zweifelsfall müssen sie schweigen, auch wenn sie lieben. Dazu gibt es nichts anderes zu sagen. Worauf sie aber vorbereitet sein müssen –
Er machte eine Pause, sah sie an, stieß seinen Zeigefinger in Richtung Adam und fragte: Welche Farbe hat der Himmel?
Blau.
Falsch, sagte Konrad, ganz falsch.
Erstaunt, verwirrt drückten sich Adam und Mateusz fester aneinander.
Worauf ihr vorbereitet sein müsst, sagte Konrad, sind die Verhöre. Und wenn ihr verhört werdet, dann muss klar sein: Ihr wisst nichts. Das müsst ihr mit aller Konsequenz befolgen: Ihr wisst nichts. Welche Farbe hat der Himmel? Ihr wisst es nicht. Sie sollen aus dem Fenster schauen, aber ihr wisst es nicht. Vielleicht ist er blau, vielleicht ist er grau, vielleicht ist er schwarz, weil Gewitterwolken aufziehen, woher wollt ihr in der Verhörzelle wissen, welche Farbe der Himmel hat? Sie sollen aus dem Fenster schauen. Sie können sich die Antwort selbst geben. In dem Augenblick, wo ihr beginnt, ganz unschuldige Fragen zu beantworten, seid ihr schon dabei, Fragen zu beantworten, und bald auch solche, bei denen ihr euch in ihren Augen und ihren Protokollen schuldig macht. Das muss klar sein: Ihr wisst nichts. Und beginnt damit, dass ihr nicht einmal die Farbe des Himmels kennt, wenn sie danach fragen. Sollen sie aus dem Fenster schauen. Dann haben sie die Antwort. Wer sind deine Freunde? Na komm, sag schon, wer sind deine Freunde – er zeigte auf Mateusz.
Mateusz sagte: Meine Freunde …, er sah Adam an und –
Das weißt du nicht, sagte Konrad scharf. Das weißt du nicht. Wer weiß schon, wer seine Freunde sind, echte und treue Freunde, falsche Freunde, Verräter, die sich deine Freundschaft erschleichen, das alles wissen die besser. Du kannst und darfst keine Antwort geben. Sollen sie in ihren Akten nachschauen, sie haben Zuträger, Spitzel, sie wissen besser als du, wer deine Freunde sind. Du weißt es nicht. Du kannst keine Antwort geben. Keine Antwort, verstehst du? Das ist der Trick: Sie beginnen mit einfachen, ganz banalen Fragen, und du glaubst, ach, das ist doch einfach und unverfänglich, das beantworte ich und zeige gleich meinen guten Willen, den Anschein von Kooperationsbereitschaft, dann bin ich glaubwürdiger, und genau das ist der Fehler, das Hineintappen in die Falle der Kooperationsbereitschaft. Also, ihr müsst von allem Anfang an klarmachen: Ihr wisst nichts. Dann kommen Drohungen. Wir haben deine Schwester. Was sagst du?
Bitte –
Nein, du bittest nicht. Du sagst nichts. Nichts. Du musst klarmachen, dass du nichts sagst. Wenn du nichts weißt, warum sollst du etwas wissen, weil sie deine Schwester haben? Du musst klarmachen, dass du lieber tot bist, als zu sagen, welche Farbe der Himmel hat. Und dass auch die Ermordung deiner Schwester keine Frage beantwortet. Nur so machst du ihnen ein Problem. Wenn sie begreifen, dass dir der Tod nichts bedeutet. Dass sie also auch mit den größten Drohungen nichts erreichen werden. Sie wollen Antworten? Von einem Toten werden sie keine bekommen.
Meine Schwester –, sagte Adam.
Was ist mit deiner Schwester?, sagte Konrad. Ich erzähle euch eine Geschichte.
Es war eine Geschichte, die nach Adams Ansicht aus dem Helden ein Monster machte. Adam und Mateusz leisteten den Eid »aufs Leben«. Aber ein Rätselrest, ein schwarzes Loch in Adams Seele blieb zurück.
Da gab es einen Bauern namens Erasmus, erzählte Konrad. Es kam die Gestapo und fragte nach den Partisanen. Aber Erasmus schwieg. Vor seinen Augen brachten sie seinen Sohn um. Erasmus schwieg. Sie brachten seine Tochter um. Erasmus sagte kein Wort. Nicht einmal ein Seufzer war von ihm zu hören. Sie brachten seine Frau um. Erasmus schwieg.
Er hat Leben gerettet, schloss Konrad, das Leben seiner Kameraden.
Um diese Opferbereitschaft ging es. Das hatten die beiden Jungen verstanden. Hand in Hand sagten sie: Ich schwöre.
Aber –
Lange Zeit hatte Adam es sich nicht bewusst gemacht, wie sehr Zweifel in ihm nagten, Zweifel, deren Symptome seine Lehrer bemerkten, aber falsch verstanden. Sie dachten, dass er, so wie einige andere Seminaristen auch, an seiner Berufung zum Priesteramt zweifle, und sie begegneten ihm mit einem milden Lächeln. Wussten sie doch, dass er nicht zum Priester, sondern zum Soldaten bestimmt war. Aber in ihm arbeitete der Zweifel an dem Schwur, den er mit Mateusz geleistet hatte. Wie konnte man diesen Treueschwur leben, der zu solch unmenschlicher Kälte gegenüber dem Tod jener verpflichtete, denen man doch auch etwas geschworen hatte, nämlich Liebe und Treue? Könnte er zum Beispiel reglos und schweigend zuschauen, wie Mateusz vor seinen Augen hingerichtet wird? Könnte er das wirklich, solange er noch den Funken einer Hoffnung spürte, dessen Leben retten zu können, und sei es durch einen Verrat, der eine List sein konnte? Und umgekehrt: Würde sein bester Freund und Kampfgenosse Mateusz wirklich schweigend zuschauen, wenn –
Er stellte Mateusz diese Frage, eines Nachts, Bett an Bett. Könntest du das wirklich?
Es war eiskalt im Schlafsaal. An manchen Wintertagen wachten die Seminaristen in der Früh auf und hatten vor ihren Nasen Raureif auf den Decken und Kissen. Aber nie hatte er größere Kälte gespürt als in diesem Moment. Als Mateusz antwortete: Ich würde dich eigenhändig erschießen, wenn du auch nur sagen würdest, welche Farbe der Himmel hat.
Adam erschrak. Zugleich empfand er augenblicklich Scham, ein brennendes schlechtes Gewissen.
Natürlich verstand er, dass es um den Schutz der Mitkämpfer ging, nicht um das Glück des Freundes, sondern um die Freiheit Polens, das Glück des Volkes. Aber –
Damals hatte er keine Worte dafür, aber er spürte ein starkes Unbehagen, Ängste, Verwirrung, angesichts dieses unerträglichen Widerspruchs: Es brauchte Helden zur Herstellung einer menschengerechten Welt, aber wie menschlich würde die Welt sein, wenn sie Unmenschliches von den Helden verlangte?
Es durfte keine Verräter geben. Das war ihm klar. Daran durfte es keinen Zweifel geben, da gab es keinen Kompromiss. Er wusste damals, er würde Mateusz nie verraten. Aber er wusste auch, Mateusz würde nicht einen Groschen für ihn zahlen, falls er entführt und Lösegeld für ihn verlangt werden sollte, denn »man zahlt nicht für das Böse«.
Das hat er klipp und klar gesagt. Aber gäbe es da nicht doch einen Kompromiss? So verrückt es klingen mag, einen Kompromiss, der keinen Zweifel an ihrer Kompromisslosigkeit ließe?
Adam hatte schlaflose Nächte. Er stellte den Schwur nicht in Frage, aber zugleich spürte er, wie ihm Mateusz seit diesem Schwur, der sie auf Leben und Tod verband, immer fremder wurde.
Erst rund dreißig Jahre später verstand er. Oder glaubte zu verstehen. Nicht seine Ängste und Selbstzweifel sind das Problem gewesen, sondern Mateusz' Unfähigkeit zu zweifeln, sein Dogmatismus, seine geradezu heilige Selbstgerechtigkeit, seine Bereitschaft, Familie und Mitkämpfer zu opfern, mit dem großen Gestus, dadurch kein Verräter des Volks zu sein. So wie er damals, eiskalt und ohne ein Wort zu sagen, ja nicht einmal zu seufzen, zugeschaut hätte, wenn seine Schwester vor seinen Augen erschossen worden wäre, so würde er heute zuschauen, wenn ein antisemitischer Mob ihn, Adam, verprügelte und bespuckte.
Mateusz befeuerte als Ministerpräsident den Antisemitismus, »in Verteidigung des polnischen Volks«. Polen waren grundsätzlich unschuldig. Deutsche und Juden wollten dem polnischen Volk die Schuld am Holocaust anhängen, aber Juden seien Mittäter gewesen. Der Satz von den »jüdischen Mittätern«, das politische Spiel mit Antisemitismus, war für Adam ein Skandal. Das war der Moment, wo er merkte, dass er von dem Mann verraten wurde, dem er im Untergrund sein Leben geopfert hätte. Hatte Mateusz vergessen, an welchem symbolischen Ort sie ihren Schwur geleistet hatten? Vor dem Sarkophag des Judenbeschützers Bolesław VI. Und Adams Vater, ein Jude, hatte zusammen mit Mateusz' Vater in der Untergrund-Armee gekämpft. Hatte er das vergessen? Adam war jüdischer Herkunft, das hatte Mateusz gewusst, als er gemeinsam mit ihm den Eid der Kämpfenden Solidarność ablegte. Er hatte alles vergessen, alles verraten. Sie waren beschützt worden, damals bei den Schulbrüdern in Poznań, das Priesterseminar war Tarnung und nicht Einschulung in religiösen Fanatismus. Mateusz' militanter Katholizismus, seine Verachtung der Juden, sein Hass auf Moslems, auf alle Andersgläubigen zeigte nicht, dass er seinem Schwur treu war, sondern, dass er ihn verriet, seinen Schwur auf das Einstehen für Freiheit. Ja, sie hatten für die Freiheit gekämpft. Und jetzt, aufgestiegen zum Regierungschef, führte er das Land so, als wäre es noch immer oder wieder besetzt und fremdbestimmt. Von jüdischen Bankern und von Brüssel. Das war nicht Treue zum Schwur des Freiheitskampfs, das war Verrat an der Freiheit, die sie errungen hatten.
Er ist wahnsinnig, er ist gemeingefährlich!
Wer?
Da! Ein Interview mit Mateusz. Hör zu:
Ich möchte daran erinnern, die Polen waren die Ersten, die sich dem Faschismus aktiv entgegengesetzt haben. Die Polen haben als Erste den Kommunismus gestürzt, der Fall der Berliner Mauer ist auch unser Verdienst, und ich sage, wenn wir weiterhin von der Europäischen Kommission für unsere souveränen Entscheidungen gemaßregelt und in unserer Entwicklung behindert werden, dann wird Polen auch für das Ende der Europäischen Union sorgen.
Das Ende der Europäischen Union! Bitte, Adam! Er ist ein Großmaul! Wer nimmt das ernst?
Zum Beispiel diese Zeitung: die Financial Times.
Adam war wieder einmal spät nach Hause gekommen, sein Sohn Romek lag schon im Bett. Er setzte sich mit der Zeitung auf die Terrasse, sagte, dass er bereits bei Exki ein Sandwich »Gezond« gegessen und keinen Hunger habe. Aber ein Wyborowa täte ihm jetzt gut. Der Hund, den er Maladusza nannte, sprang auf seinen Schoß, Adam kraulte ihn hinter den Ohren und Dorota sagte: Willst du nicht noch bei Romek reinschauen? Er schläft schon. Gib ihm einen Kuss. Damit er wenigstens den Geruch seines Vaters nicht vergisst.
Dann saßen sie auf der Terrasse, es war einer der letzten lauen Abende des Jahres, beide wollten nicht aufstehen und reingehen, ins Bett, die Kerze im Windlicht ging aus, da sprangen die Lichtpünktchen am Himmel an, und Adam sagte:
Das Problem ist: Erasmus ist für Mateusz ein polnischer Bauer.
3
Dass sich die Entfremdung zwischen den Blutsbrüdern schließlich zu Hass steigerte, ging auf den 19. Oktober 2017 zurück.
An diesem Tag betrat ein Mann die Postfiliale Plac Defilad im Zentrum von Warschau, in der linken Hand trug er einen Kanister mit Brandbeschleuniger, in der rechten einen klobigen Ghettoblaster, an seiner Schulter hing eine Umhängetasche aus Leinen mit dem Aufdruck »Nikt nie ma prawa być posłusznym«, ein Werbegeschenk der Buchhandlung Tarabuk. Vor dem Schalter stellte er Kanister und Musikgerät bedächtig ab und zog ein Dutzend Briefe aus der Umhängetasche, die, zum Erstaunen des Postbeamten, an die Ministerpräsidentin, ihren Stellvertreter, an die Mitglieder der Rada Ministrów, der polnischen Regierung, und an die Chefredakteure von Gazeta Wyborcza und Rzeczpospolita und andere führende Journalisten adressiert waren. Der Schalterbeamte legte pedantisch jeden einzelnen Brief auf die Waage, obwohl sie eindeutig alle gleich groß und gleich schwer waren, und studierte die Namen der Adressaten.
Der Mann sah geduldig zu, wie die Briefe gewogen, mit Marken versehen und schließlich so sanft gestempelt wurden, als wollte der Beamte die hohen Empfänger der Briefe nicht verletzen.
Dass dieser Mann einen Benzinkanister mit sich trug, sei ihm nicht aufgefallen, sagte der Postbeamte später der Polizei. Als er am Schalter vor ihm stand, habe er den Kanister schon abgestellt gehabt, und als er dann gegangen ist, habe er ihm nicht nachgeschaut, auch weil er selbst dann sofort zu seinem Vorgesetzten gelaufen sei. Aber verdächtig, ja, verdächtig sei ihm der Mann natürlich gewesen, absolut, wegen der Empfänger der Briefe, die er aufgegeben habe. Wer schreibt schon Briefe an die Regierung, nicht wahr? Spinner oder Wichtigmacher, oder? Vielleicht gar ein Attentäter. Und seine Umhängetasche. Er habe nur das Wort posłuszny lesen können, gehorsam, und das habe er auch seltsam gefunden. Jedenfalls sei er mit den Briefen gleich zum Filialleiter, seit 2008 müssten sie ja in solchen Fällen Empfänger und Absender scannen und der Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dem Inlands-Geheimdienst, melden.
In welchen Fällen?
In solchen. Wenn etwas seltsam ist. Er sei ja nur ein kleiner Beamter, er könne das natürlich nicht beurteilen, darum sei er gleich zum Filialleiter, damit von höherer Stelle …
Sie fanden es also nicht notwendig, bei einem Mann, der mit einem Benzinkanister vor Ihnen steht, sofort den Alarm auszulösen?
Den Kanister habe ich nicht gesehen, ich schwöre, ich habe ihn nicht gesehen, bei der Heiligen Jungfrau Maria. Aber ich habe sofort bei höherer Stelle …
Die Briefe jedenfalls kamen nie an.
Der Mann, der laut Absender Piotr Szczęsny hieß, zahlte mit einem großen Geldschein, nahm aus seiner »Gehorsam«-Umhängetasche einige Blätter heraus, Flugblätter mit der Überschrift »Ich protestiere«, sagte: Für Sie!, nahm den Kanister und den Ghettoblaster und verließ das Postamt.
Er zahlte mit einem Zygmunt, so der Beamte, mit einem 200-Zlotych-Schein, und ließ das Wechselgeld einfach liegen. Er habe das natürlich sofort dem Vorgesetzten und dann in der Tagesabrechnung, natürlich …, er habe sich das wirklich nicht behalten …, beeilte er sich zu sagen. Jedenfalls –
Piotr Szczęsny stellte sich auf dem Defilad-Platz vor dem Kulturpalast auf und verteilte seine Flugblätter. Ich protestiere. In 15 Punkten warf er der regierenden PiS-Partei vor, Bürgerrechte einzuschränken, gegen Minderheiten zu hetzen, die Medien zu knebeln, die Verfassung zu brechen, die Gewaltenteilung aufzuheben und die unabhängige Justiz zu zerstören.
Piotr war fünf Jahre älter als Mateusz, damals der stellvertretende Ministerpräsident, der keine drei Monate später Ministerpräsident werden sollte. Er kannte ihn aus der Zeit der Kämpfenden Solidarność, den letzten Monaten des Untergrunds vor der Wende.
Dafür haben wir nicht gekämpft, Mateusz. Du warst mir, dem Älteren, anvertraut. Wir haben gegen ein autoritäres Regime für die Freiheit gekämpft. Als der Kommunismus besiegt war, hätte ich nie geglaubt, dass er jemals wieder zurückkommt. Jetzt habe ich begriffen, das autoritäre System kommt nicht als Kommunismus, sondern als Antikommunismus wieder.
Aber dieser Brief, wie auch alle anderen, die Piotr Szczęsny aufgegeben hatte, wurde nicht zugestellt und verschwand im Archiv des Geheimdiensts.
Piotr Szczęsny drückte auf die Play-Taste des Musikgeräts und drehte auf volle Lautstärke. Während das Lied Kocham wolność über den Platz dröhnte, »Ich liebe die Freiheit«, nahm Piotr Szczęsny den Kanister, schraubte den Verschluss auf, ließ den Kanister noch einmal sinken und wischte sich mit Handrücken und Unterarm übers Gesicht. Dann riss er den Kanister hoch und schüttete den Brandbeschleuniger über seinen Kopf, er hielt den Kanister vor seine Brust, ließ die Flüssigkeit an seiner Kleidung hinunterrinnen, er stemmte ihn wieder hoch, ein Schwall auf sein Gesicht, er spuckte und keuchte, tief Luft holend, schüttelte er den Kanister, die Flüssigkeit plätscherte und gluckerte, wie lange es dauerte, bis zwanzig Liter ganz herausgeronnen waren. »Ich kann so wenig machen / ich liebe und verstehe die Freiheit / ich kann sie nicht aufgeben«, er stemmte den Kanister in die Höhe, schüttelte ihn immer wieder, die Flüssigkeit ätzte seine Augen, seine Lippen, die Schleimhäute in seinem Mund, das waren jetzt seine Tränen, diese scharfe Flüssigkeit, die über sein Gesicht lief. »Ich hatte so wenig / ich habe so wenig / ich kann alles verlieren / ich kann –«, verschwommen und verzerrt sah er graue Gestalten in der Dämmerung, niemand schaute her, Piotr sang leise nur diese Zeile mit, »– alleine bleiben. Ich liebe die Freiheit«.
Er stellte den leeren Kanister ab. Die Menschen in der hereinbrechenden Dunkelheit nur dunkle Geister, die Konturen der Autos wie riesige schwarze Käfer mit leuchtenden, suchenden Augen. Plötzlich schimmerte der Platz rötlich violett, als würde sich ein giftiger Dunst über die Szene legen. Das kam von den Scheinwerfern, die nun den Kulturpalast mit violettem, blauem und rotem Licht anstrahlten. Der Kulturpalast, »Stalins Geschenk für die Polen«, in seinem Rücken. Und vor sich, am Ende des Platzes, die Neon-Lichter der geschäftigen Ulica Marszałkowska.
Sehr geehrter Herr Chefredakteur! Ich habe im Untergrund für die Freiheit Polens gekämpft. Dieser Kampf war selbstverständlich auch ein Kampf für die Freiheit der Presse. Es haben unzählige Menschen, die besten, ihr Leben dafür geopfert, und ich glaube nicht, dass sie dazu bereit gewesen wären, wenn sie gewusst hätten, dass am Ende dieses Kampfes die Freiheit der Lüge durchgesetzt ist, die sich noch dazu kaum unterscheidet von der gegängelten Parteipresse der Zeiten der Diktatur. Sie, Herr Chefredakteur, bezeichneten die Aufhebung der Gewaltenteilung als »patriotische Tat«, die Zerstörung der mit vielen Opfern erkämpften, unabhängigen Justiz als »Volkswille« – woran erinnert Sie das? Und was sehen Sie, wenn Sie in den Spiegel schauen? Noch können Sie kämpfen, und ich will Sie dazu ermutigen. Sie haben weniger zu befürchten als die Untergrundarmee, die für Ihre Freiheit gekämpft hat – die Sie nun verraten.
Auch dieser Brief wurde nicht zugestellt.
Das Lied endete mit einem leisen Rauschen, die Tonbandkassette lief leer weiter, Piotr hatte nur Kocham wolność aufgenommen. Das Geräusch der Stille, dann klickt ein Feuerzeug.
Nur wenige Menschen hatten den gellenden Schrei gehört, den kurzen, schrillen, sirenenartigen Ton, den Piotr Szczęsny ausstieß, während er sich in einen grotesk tanzenden kohleschwarzen Körper im Mantel wilder Flammen verwandelte. Wer ihn gehört hatte, sollte ihn nie wieder vergessen.
Die Passanten, die sich in der Nähe befanden, erstarrten, nur ein Mann versuchte, sich dem brennenden Menschen zu nähern, es war ein verrücktes Bild, wie dieser Mann nach vorn sprang, mit seiner Aktentasche zwei Mal auf den brennenden Menschen schlug, als könnte er die Flammen auf diese Weise niederschlagen, dann zurücksprang, nochmals nach vorn, wieder seine Aktentasche schwenkend, bis der Ärmel seines Mantels zu brennen begann, worauf er sich zu Boden warf und sich wälzend den Mantel auszog.
An diesem Tag war Adam Prawdower von Brüssel nach Warschau gekommen, um als Vertreter der Europäischen Kommission, Generaldirektion für Erweiterung, mit Regierungsvertretern und Vertretern der Opposition an einer Diskussionsveranstaltung teilzunehmen: »Die Zukunft der EU: Erweitern, vertiefen oder zurückbauen?«
Auf dem Weg zum Kulturpalast sah er den brennenden Menschen. Er sah die Menge, die da zusammengelaufen war, hörte Schreie und Sirenentöne, rotierendes Blaulicht wischte über die Szene, die Flammen loderten und züngelten in giftigen Farben auf einem schwarzen Körper, der sich aufbäumte und zusammensank. Nein, das war kein Mensch, konnte kein Mensch sein, das musste eine Puppe sein, die da verbrannt wurde. War das eine Demonstration, eine Protestveranstaltung? Opposition? Anarchisten? Wen stellte die Puppe dar? Den Präsidenten Polens? Oder die deutsche Kanzlerin? Oder wurde hier symbolisch der russische Ministerpräsident verbrannt?
Nein. Hier brannte tatsächlich ein Mensch. Die Sirene, das Blaulicht, nun waren sie da, die Feuerwehr, die Polizei. Er sah, wie andere versuchten, mit ihren Mänteln, mit einer Decke, mit Wasserflaschen den Mann zu löschen. Sie sprangen hin, wichen sofort zurück. Es war aussichtslos. Da lief Adam nach vorn, da war er wieder der Soldat, der bereit war, sein Leben … und warf sich auf den brennenden Mann, um mit seinem Körper die Flammen zu ersticken, just in dem Moment, als die Feuerwehr, die inzwischen herangerast war, die beiden mit einem Teppich von Löschschaum überzog.
So kam Adam mit versengten Haaren und Augenbrauen davon, die wieder nachwuchsen, dazu eine Brandwunde vom Ohr bis zum Hals, im Grunde eine größere Brandblase, so wie die Brandblasen an den Handflächen, die vollständig abheilten, »Restitutio ad integrum«, sagte Doktor Rensenbrink zufrieden, der Spezialist vom Europa-Spital Brüssel, der Adam nach seiner Rückkehr behandelte. Sie haben Glück gehabt, Meneer Prawdower. Und die Fläche, wo sich doch Narbengewebe gebildet hat, hier am Ohr und unter der Ohrmuschel – nun, lassen Sie es mich so sagen: Sensibilität am Ohrläppchen ist nicht unbedingt lebensnotwendig! Oder –
Adam sah den Doktor erstaunt an. Dieser lachte:
Jedenfalls ist es zu wenig, um Sie ein Schlitzohr zu nennen.
Flämischer Humor, dachte Adam milde, beinahe gerührt.
Adam hatte Piotr nicht erkannt, als er sich auf ihn geworfen hatte. Und auch in den nächsten beiden Tagen, die er im Spital zur Behandlung seiner Brandwunden verbrachte, erfuhr er nicht, wer der Mann war, dem er das Leben zu retten versucht hatte. Er erfuhr nicht, dass dieser in den Zeitungen nur mit seinen Initialen genannte Mann ein Mitkämpfer aus den Zeiten des Untergrunds war, der ihm, Adam, einmal das Leben gerettet hatte. Kann es eine stärkere Bindung an einen Menschen geben als diese: Er hat mein Leben gerettet!? Aber Adam wusste nicht, dass dieser Mann, auf den er sich geworfen hatte, um ihn zu retten, sein Kamerad Piotr war. Was er allerdings in den Zeitungen las, als er im Spital lag, erboste ihn. Piotr S., so stand zu lesen, sei ein »Geisteskranker« gewesen, amtsbekannt als »Irrer«, als »klinisch labil«. Und Mateusz, der kommende Regierungschef Polens, beschuldigte in einem Interview in der Gazeta Wyborcza die Opposition, »labile Menschen durch ihre Hysterie wegen einer drohenden Diktatur in den Tod zu treiben«.
Dann aber erfuhr Adam, wer der »Irre« war: Piotr Szczęsny, sein und Mateusz' Kampfgefährte aus den Zeiten des Untergrunds, und er konnte nicht glauben, dass Mateusz dies nicht wusste. Eine gute Bekannte Adams, die Stadtratsabgeordnete Paulina Piechna-Więckiewicz von der liberalen Partei, die gerade aus einer Sitzung gekommen war, als Piotr als lebende Fackel auf dem Platz brannte, hatte eines der Flugblätter aufgehoben, die da lagen, es auf Twitter veröffentlicht, und auch ein Foto von Piotrs Umhängetasche, auf der stand: »Keiner hat das Recht zu gehorchen. Hannah Arendt«, darunter das Logo der Buchhandlung Tarabuk.
Paulina besuchte Adam im Spital.
Du kanntest Piotr, sagte sie.
Ja. Wie geht es ihm? Wird er überleben?
Er lebt. Aber die Prognose ist nicht gut.
Was können wir tun? Aber komm mir nicht mit Phrasen: Wir müssen sein Andenken –
Wir können froh sein, wenn das bleibt, sein Andenken.
Nach zehn qualvollen Tagen starb Piotr Szczęsny. Zehn Tage, in denen die Medien täglich trommelten, dass er geisteskrank gewesen sei, unzurechnungsfähig, depressiv, manisch, von Verschwörungstheoretikern beeinflusst, die letztlich an seinem erschütternden Tod schuld seien …
Als Adam das Spital verließ, schrieb er einen Brief an den stellvertretenden Ministerpräsidenten, seinen alten Freund Mateusz. Eigentlich war es kein Brief. Er schickte ihm eine Zeitungsseite mit Mateusz' Interview, Adam hatte darauf eine Reihe von Sätzen unterstrichen und am Rand notiert: Glaubst du das wirklich? Oder: Hast du vergessen, was Piotr für uns getan hat, für mich? Oder: Das sagst du über einen mutigen Kämpfer? Und ganz am Ende des Interviews, wo Mateusz über Patriotismus spricht und darüber, dass Juden nicht wüssten, was das sei, sie aber auch durch Selbstverbrennung den Polen kein schlechtes Gewissen machen können, schrieb Adam an den Rand: Sag mir das ins Gesicht!
Er steckte das Blatt in einen Umschlag, ging zum Postamt Plac Defilad. Der Schalterbeamte nahm den Brief entgegen, las den Empfänger und zupfte sich nachdenklich am Ohr. Er machte dies nicht bewusst, aber es wirkte so, als parodierte er Adam, der am Verband seiner juckenden Brandwunde am Ohr vorsichtig zupfte und rieb. Sehr langsam legte der Beamte den Umschlag auf die Waage, klebte die Marke und stempelte sie vorsichtig. Er sah Adam lange an, während er den Betrag für das Porto kassierte. Dann schloss er den Schalter, stellte ein Schild hin: »Wenden Sie sich bitte an den nächsten geöffneten Schalter.«
4
Impossible, Monsieur, sagte Catherine, das System akzeptiert das leider nicht.
Wie? Akzeptiert das nicht. Was meinen Sie?
Wenn ich »Dienstreise nach Albanien« eingebe, dann kann ich in der Abrechnung kein Flugticket nach Griechenland eintragen, Monsieur, ohne Anschlussflug nach Albanien, dann kommt sofort – sehen Sie: Erreur! Eingabe nicht möglich. Abgesehen davon: Sie hatten auch keine Bewilligung, Sie hätten das Wochenende vorher bewilligen lassen müssen.
Ein privates Wochenende muss ich bewilligen lassen?
Im Zusammenhang mit einer Dienstreise ja, Monsieur Auer.
Sie sprach seinen Namen so aus, dass es, gemäß seinem österreichischen Ohr für das Französische, wie Gruyère klang – Auer mochte das gar nicht. Machte sie das mit Absicht? Fand sie das lustig?
Die Gespräche in Tirana fanden Montag bis Mittwoch statt, sagte er irritiert. Ich bin am Samstag davor nach Korfu geflogen, mit der Fähre hinüber nach Südalbanien, nach Saranda, ich dachte, das wäre eine Gelegenheit, ein Wochenende an der albanischen Riviera … privat …
Aber das war nicht bewilligt! Wenn Sie im Auftrag der Kommission zu politischen Gesprächen in ein bestimmtes Land reisen, dann können Sie dort nicht einfach ein Wochenende anhängen, das sind die Regeln. Wen treffen Sie, mit wem reden Sie dort, wie kann man ausschließen, dass Sie nicht Interessen verfolgen, die im Zusammenhang mit –
Privat, Catherine, ich bitte zu berücksichtigen, dass –
Ich erlaube mir, daran zu erinnern, dass –
Bitte freundlichst, zur Kenntnis zu nehmen, dass –
Mit ausgesuchter Höflichkeit und mühsam bewahrter Geduld insistierte er darauf, dass ein privates Wochenende am Meer nichts mit seiner Dienstreise zu tun hatte, die Anreise aber sehr wohl der Dienstreise angerechnet werden müsse.
Ich war einfach ein Wochenende am Strand! Alleine! Ich hätte auch über das Wochenende hier nach Knokke an den Strand fahren können und dann am Montag in der Früh von Brüssel nach Tirana fliegen, was wäre der Unterschied gewesen?
Karl Auer machte auch noch geltend, dass das Ticket nach Korfu billiger gewesen sei als ein Ticket nach Tirana, zumal es von Brüssel keinen Direktflug nach Tirana gab, und dass er die Fähre von Korfu nach Saranda, ebenso wie dann das Mietauto nach Tirana aus eigener Tasche –
Je suis désolée, Monsieur. Je n'ai pas fait les règles. Je ne peux pas changer le système de MIPS.
Es hatte sich einiges geändert. Und das Geringste war, dass Catherine seit dem Brexit mit den Kollegen, statt wie früher auf Englisch, jetzt auf Französisch kommunizierte – L'anglais est maintenant une petite langue en Europe, sagte sie, Qui d'autres que les rares Irlandais parlent anglais dans l'UE.
Ja, es hatte sich einiges geändert. Nach der letzten EU-Wahl, bei der Millionen Europäer ihre Stimme abgegeben hatten, wurde eine neue Kommissionspräsidentin, die bei der Wahl gar nicht kandidiert hatte, mit nur zwei Stimmen gewählt: einer des französischen Präsidenten und einer der deutschen Kanzlerin. Die Europawahl wurde dadurch zu einer Farce gemacht, und die neue Kommissionspräsidentin brachte sofort alles ins Rutschen, die Kommission glich einem Kaleidoskop, an dem beherzt gedreht wurde und das schließlich ein neues Muster zeigte. Kompetenzen wurden zwischen Ressorts verschoben, Aufgaben neu definiert, Generaldirektionen umbenannt, altgediente Beamte saßen in immer längeren Mittagspausen in den Restaurants in der Rue Stevin oder Rue Archimède, erzählten den »Eleven«, den neuen Beamten oder den jungen »Trainees«, von den goldenen Zeiten, als Jacques Delors Kommissionspräsident war, oder sie erzählten von der Barroso-Zeit, da war es manchmal zumindest unfreiwillig komisch, allerdings auch nur im sentimentalen Rückblick! Und Karl Auer fand sich nach Jahren in der Generaldirektion COMP, Wettbewerb, nun in der neu geordneten Kommission in der Generaldirektion NEAR wieder, Nachbarschaft und Erweiterung. Für ihn zunächst nicht unbedingt ein Wunschkonzert. Auch wenn natürlich erstklassige Juristen für das Monitoring der Justizreformen der Beitrittskandidaten benötigt wurden. Von der Position her war es für Auer allerdings ein Karrieresprung. Aber darum ging es ihm nicht. Er war kein Karrierist, er wollte sich mit seiner Arbeit identifizieren können. Das galt manchen als altmodisch.
Schaut euch nur seinen Anzug an, sagte Catherine einmal in der Kantine zu Kollegen. Monsieur Gruyère hat Anzüge, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Mit Bundfaltenhose, sie kicherte, und mit Kunstledergürtel. Und die breiten Revers, das ist, keine Ahnung, irgendwie grand-père. Und dann kommt er immer mit seinen grand-père-bonmots … Es schüttelte sie geradezu.
Karl Auer hatte nicht viel Zeit gehabt, sich einzuarbeiten, als schon diese Dienstreise anstand: Albanien, das halbjährliche Meeting von EU-Verhandlern mit dem Beitrittskandidaten auf höchster Ebene. Von Kommissionsseite der Direktor der NEAR mit drei hohen Beamten, von albanischer Seite der Ministerpräsident, die Fachminister (Außen, Innen, Justiz, Wirtschaft), und schließlich gab es auch Gespräche mit Vertretern der Opposition und von NGOs. Da hatte Auer die Idee, statt Montag schon Samstagmorgen anzureisen, um davor ein entspanntes, zugleich vielleicht interessantes Wochenende an einem albanischen Strand zu verbringen.
Just zu dieser Zeit eröffnete das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung OLAF Ermittlungen gegen den polnischen Kommissar Janusz Wojciechowski, wegen des Verdachts, dass er Reisen nicht korrekt abgerechnet hatte. Er soll 11 250,– Euro für nicht dokumentierte Reisekosten erhalten haben.
Es war läppisch. Dass ein Mann seiner Position und seines Einkommens das nötig hatte! Aber: Die Kommission ist sauber. Daran darf es keinen Zweifel geben!
Auer zahlte also den Flug aus eigener Tasche, bekam nur das Hotel in Tirana und den Tagessatz für drei Tage, Montag bis Mittwoch, überwiesen.
Er bemühte sich, keine Verärgerung zu zeigen, als er sich von Catherine mit einer leichten Verbeugung verabschiedete und zurück in sein Arbeitszimmer ging. Es ging ihm nicht um die vier- oder fünfhundert Euro, die er für eine Dienstreise aus formalen Gründen nun aus eigener Tasche zu zahlen hatte. Was ihn bedrückte, war, dass es da etwas gab, was er Catherine nicht sagen konnte, obwohl er das Gefühl hatte, dass sie etwas wusste oder zumindest ahnte. Hatte sie nicht eine Anspielung gemacht?
Nein, sie konnte nichts wissen, nicht einmal ahnen, wie auch?
Aber das Unausgesprochene war da, und er wusste, er konnte es Catherine nicht sagen, es keinem Kollegen erzählen, er konnte sich niemandem anvertrauen, er musste es einhegen in seinem Kopf, auch wenn er zunächst dachte: in seinem Herzen – aber das klang ihm zu pathetisch. Wenn er schon darüber nachdachte, dann war der Kopf zuständig. Da war er ganz Beamter: Zuerst kam die Zuständigkeit, erst dann die Frage der Kompetenz.
Karl Auer war nicht leichtlebig. Einmal vor langer Zeit, einen kurzen Moment, hatte das Bild eines sinnlichen, intensiv-romantischen Lebens vor seinen Augen geschimmert, bunt und doch dunkel, wie die Bleiglasfenster in der Stiftskirche. Er war damals sechzehn oder siebzehn Jahre alt, Zögling am Stiftsgymnasium Zwettl, und hatte die Aufgabe, wie jedes Jahr nach den Sommerferien einen Aufsatz »Mein schönstes Ferienerlebnis« zu schreiben. Neben der regelmäßigen Ohrenbeichte waren diese Aufsätze sozusagen die Cookies, mit denen die Erzieher seinerzeit an die Daten ihrer Zöglinge kamen. Völlig naiv berichtete der junge Karl Auer, dass er im Stadtkino, im Rahmen einer Fellini-Retrospektive, den Film »Das süße Leben« gesehen hatte.
Er ist sich nicht sicher gewesen, ob er den Film wirklich verstanden hatte, die Bilder waren an ihm vorbeigerauscht, aufgeregt hatte er sich an den Armlehnen seines Sitzes festgeklammert, als befände er sich im Wagen einer Hochschaubahn, aber Anita Ekberg im Trevi-Brunnen und überhaupt der Filmtitel: Das süße Leben – das war ihm sofort klar gewesen, da hatte er keinen Zweifel: Das stand in Opposition zu seinem strengen Leben.
Und so hatte er es in seinem Aufsatz berichtet, fast im Stil eines Besinnungsaufsatzes und zugleich in sehr bürokratischen Formulierungen, die den späteren Juristen ahnen ließen: dass es in Kenntnis von … unter Berücksichtigung von … in Abwägung der … und dann kamen zwei Begriffe, die er wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben in einem Aufsatz verwendete: Lebensentwurf und Faszination.
Das süße Leben, aha. Als Pater Gottfried die Hefte mit den benoteten Aufsätzen an die Schüler verteilte, ließ er Karl vortreten.
Du willst also ein süßes Leben, ja? Dann merke dir eines: Arbeit macht das Leben süß (dazu gab es einen Klaps auf den Hinterkopf), und nicht eine halbnackte Frau in einem römischen Brunnen! (Der Lehrer hatte den Film sicherlich nicht gesehen, aber diese Szene war so berühmt, dass selbst er sie sofort mit dem Filmtitel assoziierte.) Du musst Verantwortung für dein Leben übernehmen und nicht solchen Flausen nachhängen. Aber wenn du dich – er lächelte –, wenn du dich schon für römische Brunnen interessierst: Du lernst das Gedicht Der römische Brunnen von Conrad Ferdinand Meyer auswendig. Bis morgen. Die Meyer-Ausgabe findest du in der Schulbibliothek. Wenn ich mich recht erinnere, enthält sie die 7. Version des Gedichts. Du hast Glück, es ist die kürzeste.
Der Pater hatte gesprochen, und schon war der Trevi-Brunnen nichts anderes mehr als ein historisches Kulturdenkmal, entweiht durch Fellini, während der Brunnen Fontana dei Cavalli Marini in der Villa Borghese geadelt war durch Conrad Ferdinand Meyers Gedicht aus dem Jahr 1882, das Karl am nächsten Tag brav aufsagte.
Zurück in seinem Arbeitszimmer, er nannte es: die Zelle – die Arbeitsräume selbst der höheren Beamten waren relativ klein und billigst eingerichtet –, fiel sein Blick auf den Wandkalender mit dem Sinnspruch des Tages: »Lebe jeden Tag deines Lebens, als wäre er dein letzter!«