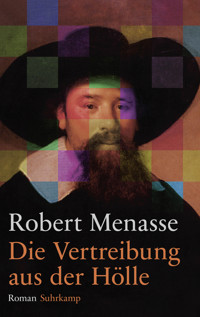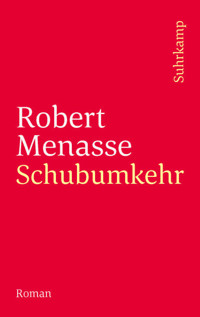9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jahrhunderte brauchen noch einmal rund eineinhalb Jahrzehnte, bis sie sterben. 1814/15, mit dem Wiener Kongress, starb das 18. Jahrhundert. 1914 starb das 19. Jahrhundert. 2014/15 ist es an der Zeit, dass endlich das 20. Jahrhundert stirbt – die Epoche, die von der Raserei des Nationalismus und seinen fortwirkenden Konsequenzen geprägt war. Die Welt ist längst ein transnationales Gebilde geworden, es gibt nichts mehr von Belang, das innerhalb nationaler Grenzen geregelt oder an nationalen Grenzen gestoppt werden kann. Auch wenn Deutschland 1989 seine nationale Wiedergeburt feierte, bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 den fröhlichen Patriotismus wiederentdeckte, und in Folge der griechischen Staatsschuldenkrise ab 2010 aggressiv und stolz alte nationalistische Klischees restaurierte – die Nationen werden sterben. Wenn die Wirklichkeit nicht standhält, wird diese Idee die Massen ergreifen. In einer Reihe von Vorträgen interpretiert Robert Menasse das Testament der sterbenden Epoche: Nationen sind Betrug, Regionen sind Heimat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jahrhunderte brauchen noch einmal rund eineinhalb Jahrzehnte, bis sie sterben. 1814/15, mit dem Wiener Kongress, starb das 18. Jahrhundert. 1914 starb das 19. Jahrhundert. 2014/15 muss endlich das 20. Jahrhundert sterben – die Epoche, die von der Raserei des Nationalismus und seinen fortwirkenden Konsequenzen geprägt war. Die Welt ist längst ein transnationales Gebilde geworden, es gibt nichts mehr von Belang, das innerhalb nationaler Grenzen geregelt oder an nationalen Grenzen gestoppt werden kann. Auch wenn Deutschland 1989 seine nationale Wiedergeburt feierte, bei der WM 2006 den fröhlichen Patriotismus wiederentdeckte und infolge der griechischen Staatsverschuldung ab 2010 aggressiv und stolz alte nationalistische Klischees restaurierte – die Nationen werden sterben. Wenn die Wirklichkeit nicht standhält, wird diese Idee die Massen ergreifen.
In einer Reihe von Vorträgen interpretiert Robert Menasse das Testament der sterbenden Epoche: Reden (wir) über Europa.
Robert Menasse, geboren 1954 in Wien, lebt als Romancier und Essayist in Wien. Zuletzt erschienen Die Vertreibung aus der Hölle. Roman (st 3493), Die Zerstörung der Welt als Wille und Vorstellung. Frankfurter Poetikvorlesungen (es 2464), Ich kann jedersagen. Erzählungen vom Ende der Nachkriegsordnung und Der EuropäischeLandbote. Die Wut der Bürger und der FriedeEuropas (2012).
Robert Menasse
Heimat ist die schönste Utopie
Für meine Tochter Sophie auf ihrem Weg in die Welt
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe der edition suhrkamp 2689.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Originalausgabe
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
Inhalt
Von der Schwierigkeit und der Notwendigkeit, aus der Geschichte eine Idee zu machen
Wohin der Wind den Schleier trägt
Anerkennung und Haltung
Neue Welt, alter Stier
Es gibt nichts Schöneres
Heimat ist die schönste Utopie
Die Heimat als Schweiz
Das Einzigartige und unser Eigentum
Bildung von Demokratie
Zukunftsmusik
Die Welt von morgen. Auswege aus der Krise
Europa Countdown
FAQ Europe
Textnachweise
Von der Schwierigkeit und der Notwendigkeit, aus der Geschichte eine Idee zu machen
Sehr geehrte Damen und Herren!
Unlängst hatte ich einen Albtraum.
Ich sah einen großen Saal, darin eine lange Tafel, an der etwa ein Dutzend Männer und eine Frau saßen. Es war der Saal eines Schlosses, aber er wirkte nicht prächtig und prunkvoll. Ich sah, dass es hier vor kurzem gebrannt haben musste: Eine seitliche Flügeltür hing verkohlt in den Angeln, die Wand daneben war rußgeschwärzt, in der Ecke lag Schutt. Die großen Spiegel an der Rückwand des Saals waren blind. Auf einem der Spiegel war mit Klebestreifen eine Landkarte von Europa befestigt, auf der wirre Linien eingezeichnet waren. An der Längsseite des Saals befanden sich gläserne Flügeltüren zum Schlosspark hin, aber dicke Eisblumen auf dem Glas verwehrten jeden Ausblick. Es gab kein elektrisches Licht, auf der Tafel standen drei Kandelaber, die Kerzen flackerten. Diese und die lodernden Flammen in einem offenen Kamin warfen tanzende Schatten in den halbdunklen Raum. Ich wusste im Traum sofort, dass dies der Festsaal des Château de Lunéville war – hier ist im Licht gleißender Lüster einer der zahllosen und nicht erst heute vergessenen Friedensverträge in der Geschichte Europas unterzeichnet worden. Warum wusste ich das? Ich verarbeitete im Traum Tagesreste. Ich hatte an diesem Tag eine Rede von Jacques Delors gelesen, die er im Jahr 1986 im Schloss Lunéville vor den Außenministern der EU-Mitgliedstaaten gehalten hatte. »Hier in diesem Saal«, hatte Delors damals gesagt, »ist im Jahr 1801 ein Friedensvertrag unterzeichnet worden, dessen Präambel lautet wie folgt:
Se. Majestät der Kaiser, König von Ungarn und Böhmen, und der erste Consul der Republik Frankreich, im Namen des Französischen Volkes, denen es beiden am Herzen liegt, den Uebeln des Kriegs ein Ende zu machen, haben sich entschlossen, zu der Abschließung eines Definitiv-Friedens- und Freundschafts-Tractats zu schreiten.«
»Ich bitte Sie«, setzte Delors fort, »Ihre Aufmerksamkeit auf den Begriff Definitiv-Frieden zu richten. Der Vertrag sollte ein Fundament für die weitere Befriedung des Kontinents bilden, aber« – und nun zählte Delors die Kriege auf, die danach in rascher Folge ausbrachen, und die Friedensverträge, die darauf folgten und die in ihren Präambeln alle mit den Adjektiven »definitiv« oder »immerwährend« geschmückt waren, bis hin zu den Verträgen, die noch kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs unter dem Baldachin »Peace for our time« unterzeichnet worden waren. »Definitiv«, sagte Delors schließlich, »war nur: dass so gut wie jede Generation in Europa einen Krieg erleben musste!«
Aber ich wollte von meinem Traum erzählen. Ich sah also diesen Saal, die Tafel, und am Kopfende sah ich ihn: Jacques Delors, den ehemaligen Präsidenten der Europäischen Kommission, jetzt beinahe neunzig Jahre alt, seit fast zwanzig Jahren ohne politisches Amt, gebrechlich, geradezu geschrumpft in einem Rollstuhl sitzend, sein Kopf aber wirkte riesig auf dem eingefallenen Körper. Hinter ihm standen ein Mann und eine Frau. Die Frau war Krankenschwester, der Mann war Arzt, ich wusste, das waren Schwester Christine und Doktor Grün, sie betreuten den alten Mann und standen bereit, falls er einen Schwächeanfall erleiden sollte. Nun erkannte ich auch die Tischgesellschaft: Es waren Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Jacques Delors war besorgt über die Krise der EU und den Siegeszug der Nationalisten und Anti-EU-Populisten bei der Wahl zum Europäischen Parlament. Er hatte alles aufgeboten, was ihm als Mann von historischer Bedeutung, geradezu als Legende, an Netzwerken und Autorität noch zur Verfügung stand, um die politischen Führer der EU-Mitgliedstaaten zu diesem informellen Treffen einzuladen, »zu einem Gedankenaustausch«, aber wohl eher, um sie ins Gebet zu nehmen. Nicht alle waren der Einladung gefolgt – »aber immerhin, Kerneuropa ist vertreten«, sagte der österreichische Kanzler. »Der Kern ist das, was man ausspuckt!«, sagte der Ministerpräsident von Ungarn. »Dann wächst ein neuer Baum draus«, sagte Delors.
Der Strom war ausgefallen. Man hörte kratzende und scharrende Geräusche. Ab und zu blitzte es. Das waren die Reporter, die das Eis an den Glastüren abschabten und dann versuchten, von draußen Fotos von der Gesellschaft in diesem Saal zu machen. »Wer hat die Presse informiert?«, fragte die deutsche Kanzlerin. »Die Presse ist nie informiert«, sagte der italienische Ministerpräsident, »man füttert sie, aber man informiert sie nicht!«
Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht erfinde. Was ich auf jeden Fall wirklich geträumt habe, ist Folgendes: Delors redet. Er erläutert die Idee des Europäischen Projekts. Immer wieder sagt er »Rekonstruktion der Idee« und »Wiederaufbau des Projekts«. Der offene Kamin kann den Saal nicht ausreichend heizen. Die Staatschefs frieren. Immer wieder steht einer auf, wenn die Flammen im Kamin kleiner werden, und wirft seinen Stuhl ins Feuer. Als alle ihre Stühle verheizt haben und um den Tisch herum stehen, ausgenommen Delors, der in seinem Rollstuhl sitzt, wird das Essen aufgetragen: Es ist ein Eintopf. Zugleich wird die Tür des Saals aufgestoßen, Journalisten strömen herein, berichten von Truppenbewegungen in der Ukraine, verlangen Erklärungen von den Staatschefs. Delors sinkt zusammen. Schwester Christine kann nicht verhindern, dass er vom Rollstuhl rutscht. Er liegt auf dem Boden, und Doktor Grün beginnt mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Das Holz der Stühle knattert und knallt im Kamin, die Flammen lodern auf. Doktor Grün stellt den Tod von Delors fest. »Wir müssen ihn endlich begraben«, sagt die deutsche Kanzlerin. Warum sagte sie »endlich«? Aber der Boden draußen ist allzu hart gefroren, also reißt man den Parkettboden auf. Darunter befindet sich Lehm, das Fundament ist weich. Als Delors schließlich in einer Grube inmitten des Saals mit den blinden Spiegeln liegt, tritt der österreichische Kanzler heran, nimmt einen Löffel, taucht ihn in die Schüssel, die auf dem Tisch steht, kippt den Löffel in die Grube und sagt pathetisch: »Eintopf aus Österreich!«
Einer nach dem anderen tritt vor, nimmt den Löffel:
»Eintopf aus Deutschland!«
»Eintopf aus Kroatien!«
»Eintopf aus Italien!«
»Eintopf aus Spanien!«
»Eintopf aus Ungarn!«
und so weiter, bis schließlich jemand Doktor Grün den Löffel in Hand drückt.
»Ich?« Und mit einem Zögern, aber nicht lächerlich, eher anrührend, sagt der jüdische Doktor: »Eintopf – aus – Eintopf aus Europa!«
Da läuft Schwester Christine davon, der französische Präsident versucht, sich ihr in den Weg zu stellen: »Wo wollen Sie denn hin? Bleiben Sie doch!«
Und die Krankenschwester sagt: »Ihr habt Eure Völker und Nationen, aber mich werden jetzt draußen die Menschen brauchen!«
Ich wachte auf und – warum erzähle ich das? Ich wollte vom europäischen Traum berichten und beginne mit einem Albtraum!
Vielleicht hatte ich diesen Albtraum, weil der Traum davor schon einmal in der Realität gescheitert ist.
Ich bin nie ein Nostalgiker des Habsburgerreichs gewesen. Die Nostalgie war ein Fall für die Germanistik. Als ich studierte, musste natürlich Claudio Magris' Arbeit über den Habsburgischen Mythos in der österreichischen Literatur, die wenige Jahre davor auf Deutsch erschienen war, auf der Leseliste stehen, wenn es um Autoren wie Robert Musil, Joseph Roth oder Stefan Zweig ging. Das war ein Zugang zu dieser Literatur. Natürlich war ich von Joseph Roths Romankunst begeistert, aber ich war auch von Dostojewski begeistert, ohne dass ich deswegen dem Zarenreich nachgetrauert hätte, oder von Theodor Fontane, durch den ich die Welt der deutschen Junker zu verstehen lernte, ohne ihr eine Träne nachzuweinen. Das Habsburgerreich war eine untergegangene Welt, und ich konnte sie mit meiner Welt nicht anders in Beziehung setzen als im Sinne eines einfachen Fortschrittsdenkens: Meine Welt war ein Fortschritt zu dieser, die zu Recht auf dem Misthaufen der Geschichte gelandet war. Da mochten sich Würmer durchfressen und schmatzend einen Humus produzieren, auf dem höchstens noch Stilblüten wuchsen: Der Präsident der Republik, die nun meine Lebensrealität war, wurde »Ersatzkaiser« genannt, der Kanzler der Republik war der »Sonnenkönig«, die beiden großen Parteien der Republik hießen »linke und rechte Reichshälfte«, das war alles nicht ernst. Die imperialen Kulissen der ehemaligen Residenz-Stadt Wien waren wichtig für die zeitgenössische Tourismus-Wirtschaft. Ich lebte abseits der Touristenpfade. Die Filme mit Sisi und Kaiser Franzl waren Märchen, die nicht von Großmüttern, sondern für Großmütter erzählt wurden. Alte Monarchisten und praktizierende Habsburg-Nostalgiker waren im politischen und öffentlichen Leben nicht auffällig, ich sah keine und kannte keine. Der Kaiser war ein toter Hund. Und ich glaubte an eine Geschichtslogik, an einen dialektischen Fortschritt der Geschichte im Geist der Freiheit, und im Sinn dieser geschichtlichen Teleologie war das Habsburgerreich vernünftigerweise untergegangen. Der Fortschritt bestand – zumindest in Österreich – in einer Überwindung feudaler Privilegien, der Abschaffung der Adelsprädikate, der Durchflutung der Gesellschaft mit mehr Demokratie, der Überwindung des größten Elends des Proletariats. Das alles war noch lange nicht genug, aber immerhin doch ein Fortschritt. Und dann gab es einen Begriff, den ich im Zusammenhang mit der Habsburgermonarchie immer wieder hörte oder las, einen Begriff mit der Wucht eines definitiven Verdikts – und ich wundere mich heute, dass auch ich diesen Begriff völlig kritiklos mit dem Habsburgerreich assoziierte –: nämlich »Völkerkerker«. Ich kann mir das heute nur noch auf simpelste Weise, also nicht befriedigend, erklären: Natürlich war ich der Meinung, dass kein Mensch und kein Volk in einem Kerker leben sollte. Aber rechtfertigt diese abstrakte und allgemeine Empathie mit allen Entrechteten die reflexhafte Adoption dieses Begriffs? Ich hatte doch als Student gerade dies gelernt: alle Begriffe kritisch zu hinterfragen, die Methoden, mit denen »Wahrheit« produziert wird, in Hinblick auf ihr ideologisches Interesse zu überprüfen. Der Begriff »Völkerkerker« war ein Kampfbegriff der Nationalisten gewesen – und Nationalist war ich nie, konnte es schon auf Grund meiner Familiengeschichte, meiner Welt, in die ich hineingeboren und in der ich sozialisiert wurde, gar nicht sein. Bin ich wirklich der Meinung gewesen, dass die Völker der Donaumonarchie nach dem Untergang des Reichs aus einem Kerker entlassen und befreit worden waren, zumindest im Sinn meines damaligen historischen Fortschrittsbegriffs?
Das kann nicht sein.
Ich weiß es nicht, kann mich nicht erinnern. Offenbar hat mich die Realgeschichte Kakaniens so wenig interessiert, dass ich nicht einmal merkte, wie ich durch meine desinteressierte Gedankenlosigkeit in Widerspruch zu mir selbst geriet.
Die Vorgeschichte, deren Nachwirkungen wir wirklich und wirksam in unserer Lebensrealität spürten – und ich glaube nicht unzulässig zu verallgemeinern, wenn ich mich da als exemplarisch für viele Menschen meiner Generation der Nachgeborenen sehe –, war für uns nicht die österreichische Monarchie, sondern erst die Geschichte ihres Rests, also der Ersten Republik Österreich, die im Nazireich aufging, und der Zweite Weltkrieg, aus dem dann die Zweite Republik hervorging, derselbe Rest, der nun aber das Beste aus sich machen musste: Darauf bezogen sich Mythenbildung und Nostalgie, Legenden und Geschichten, im Guten, Gutgemeinten, und im Schlechten, bei Lehrern, Gelehrigen und Unbelehrbaren, bei den Mitläufern des eigenen Lebens (und das sind immer die meisten) im Lauf der Zeiten, die eben zur Zweiten österreichischen Republik geführt hatten, zur Teilung Europas und dem starren Kräftespiel der Weltmächte.
Jetzt erst, hundert Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs, ist die Habsburgermonarchie allgegenwärtig, in Filmen, Dokumentationen und Ausstellungen wird die Geschichte ihres Untergangs und des Untergangs des alten Europas gezeigt. Und plötzlich steht uns die Habsburgermonarchie ganz anders vor Augen, als Gebilde, das mit seinen Vorzügen und mit den Gründen für sein Scheitern so vielfach und deutlich ins moderne Europa fortwirkt.
Es ist natürlich ein geschichtsphilosophisches Problem, dass wir, wenn wir in den Spiegel der Geschichte blicken, zunächst nur sehen, was ein Spiegel eben zeigt: nämlich nur den, der hineinblickt – wenn auch spiegelverkehrt und in einem alten Rahmen. Wir können erkennen, was wir wiedererkennen, mehr Lehre hat die Geschichte nicht zu bieten, aber das ändert nichts daran, dass sie wirkt.
Und so ist es zwar seltsam, aber doch logisch, dass ich die Geschichte des österreichischen Kaiserreichs anders sah, als ich nicht als Österreicher, sondern als Europäer in den Spiegel der Geschichte blickte, nachdem ich mich mit der Europäischen Union zu beschäftigen begonnen hatte.
Die Habsburgermonarchie erscheint nun als Vorläufer und geradezu als Modell der heutigen Europäischen Gemeinschaft. Denn es gibt eine Reihe von bemerkenswerten Ähnlichkeiten, und es ist kein Zufall, dass diese jetzt, im Gedenken an 1914, auch immer wieder beschrieben werden: Die Habsburgermonarchie war ein multiethnisches Gebilde, vielsprachig, zentral verwaltet von einem hochentwickelten Beamtenapparat in Zusammenspiel mit lokaler Autonomie, träge und oft blockiert durch seine inneren Spannungen, aber doch immer wieder zu großen, aufgeklärten Modernisierungsschritten fähig (so schaffte sie etwa die Leibeigenschaft zwanzig Jahre vor den USA ab). Sie hatte keine Nationsidee, auch nicht den Anspruch, sich zur Nation zu entwickeln, sie war bewusst ein transnationales Konstrukt, das als gemeinsamer Wirtschaftsraum mit gemeinsamer Währung prosperierte. Diese war übrigens stark und stabil trotz der großen Unterschiede in den ökonomischen Strukturen der Kronländer, weil es, anders als heute, eine gemeinsame Finanz- und Fiskalpolitik gab. Die Monarchie war religiös tolerant, Judentum und Islam waren staatlich anerkannte Religionsgemeinschaften und zumindest gesetzlich nicht diskriminiert. Sogar in der k. u. k. Armee gab es Heeres-Rabbiner und Imame und eigene Gebeträume für Juden und Moslems.
Die Habsburgermonarchie war im Grunde ein Netzwerk, das kleinen Ländern und ihren Bewohnern bei all ihren kulturellen Unterschieden Schutz und Entwicklungsmöglichkeiten bot, indem sie für Sicherheit in einem verbindlichen Rechtszustand und für gemeinsame Rahmenbedingungen sorgte und Ressourcen zur Verfügung stellte, die für alle wichtig waren: Straßen, Eisenbahnlinien, Parlamente, Gesetze und Polizei, Bildung, und eben den zentralen Beamtenapparat, um das alles zu verwalten. Alleine und jedes für sich hätten sich die kleinen Länder nicht behaupten können – wie sich später ja auch erwies. Und für die Juden, die einzige Ethnie ohne eigenes Territorium, war die Donaumonarchie der schönste Wartesaal bis zur Ankunft des Messias, so sie überhaupt noch daran glaubten.
Ich habe vorhin gesagt, dass ich nie ein Habsburg-Nostalgiker war. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich in gewisser Weise doch einer werde. Nicht, dass ich plötzlich Monarchist geworden wäre, aber ich stelle mir vor, wie Europa heute aussehen würde, wenn diese »Welt von gestern«, an die die heutige Welt ja doch wieder anknüpft, nicht in Schutt und Asche gelegt, wenn die Entwicklung, die sich ja doch wieder durchsetzt, nicht durch den grauenhaftesten Krieg und die größten Menschheitsverbrechen in der Geschichte unterbrochen worden wäre.
»Der Nationalismus«, schrieb Heinrich Mann im Jahr 1914, »hat aus dem Begriff ›Ausland‹, der früher bloß Redensart war, heute eine Bedrohung gemacht. Was wir teilen, wird nun in Teile zerschlagen, und was uns verbindet, wird zur Fessel erklärt und abgestreift, damit wir die Hände frei haben, um übereinander herzufallen!«
»Der Nationalismus«, resümierte Stefan Zweig im Jahr 1942, »hat die europäische Kultur, hat Europa zerstört.«
Und genau das war eben die prägende Erfahrung der Gründerväter des europäischen Einigungsprozesses, der zur heutigen Europäischen Union geführt hat: Es war der Nationalismus, der Europa und die halbe Welt verwüstet hat. Es war der Nationalismus, der zu einem zweiten Dreißigjährigen Krieg (von 1914 bis 1945) geführt hat, der ein europäischer Bürgerkrieg war, so monströs, dass er weite Teile der Welt ins Verderben gerissen hat. Und das war ihre Einsicht: Der Nationalismus muss überwunden werden. Es hat zahllose Friedensverträge und Bündnisse zwischen Nationen, alle erdenklichen diplomatischen Anstrengungen zwischen Nationen gegeben – das alles hat nichts genützt und wird nichts nützen, solange Politik nationale Macht- und Interessenpolitik ist. Das war die Erfahrung. Die Gründer des Europäischen Projekts haben deshalb bewusst einen Prozess eingeleitet, der nach und nach zur Schwächung nationaler Souveränität, schließlich zur Überwindung der Nationalstaaten führen soll. Ein klares Bild von der Zukunft, davon, wie ein nachnationales Europa am Ende verfasst und politisch organisiert sein sollte, hatten sie nicht – ihr Anspruch an die Zukunft war, dass sich die Geschichte, die Europa zerstört hatte, nicht wiederholen möge. Die Zukunft war also zunächst nichts anderes als ein »Nie wieder!« in Hinblick auf die europäische Geschichte, soweit sie geprägt war von nationalen Aggressionen.
Dabei konnten sie noch gar nicht wissen, dass die weitere globale Entwicklung ihnen Recht geben und damit Europa weltweit zur Avantgarde machen würde. Denn mittlerweile ist die ganze Welt zu einem transnationalen Netz geworden, alle Grenzen werden gesprengt, es gibt nichts von ökonomischer, sozialer und politischer Relevanz, das an nationalen Grenzen aufgehalten, oder souverän innerhalb von nationalen Grenzen geregelt werden kann. Es gibt Nationen, die politisch noch nicht in einen nachnationalen Gemeinschaftsprozess eingetreten sind, und die ihren Einfluss auf diese Entwicklung und die Verteidigung nationaler Interessen innerhalb der globalen Entwicklung immer noch durch militärische Macht aufrechtzuerhalten versuchen. Selbst wenn es in diesen Nationen formal funktionierende nationale Demokratien gibt – demokratisch ist deren Politik nicht. Denn die Verteidigung nationaler Interessen auf diese Weise verteidigt nur die Interessen nationaler Eliten, wodurch sich der größte Teil des Volksvermögens in den Händen eines immer kleineren Teils der Bevölkerung konzentriert. Es gibt halbautoritäre oder autoritäre Nationen, die von Kleptokraten regiert und ausgepresst werden, die diesen Prozess zu blockieren versuchen, indem sie ihre Nation abschotten, sogar Facebook und Twitter verbieten, um ihre Macht zu verteidigen. Es ist bedrückend für die Zivilgesellschaft, aber es ist letztlich lächerlich und aussichtslos. Es gibt Nationen, deren Führer ihre Gelüste und die Ideologie nationaler Großmannssucht zu befriedigen versuchen, indem sie andere bedrohen und erpressen, an Hegemonialkonzepten basteln und sogar wieder versuchen, Territorium zu annektieren. Es macht Unruhe, es führt zu Krisen, aber es ist aussichtslos, selbst wenn diese Politik Beifall innerhalb der Nation erhält. Man kann kleine, abhängige Länder erpressen, aber nicht die halbe Welt. Es gibt Nationen, die als geschlossene, archaische Gottesstaaten organisiert werden, aber sie sind chancenlos – der einzige Gottesstaat, der funktioniert, ist keine Nation, sondern ein multinationales Unternehmen: nämlich der Vatikan.
Es ist eine historische Tatsache: Nationalstaaten verlieren, wie immer sie es auch anstellen, ihre politischen Gestaltungsmöglichkeiten, sowohl in Hinblick auf globale Entwicklungen, als auch in Hinblick auf die Gewährleistung von innerem Frieden, Demokratie und sozialer Gerechtigkeit. Nationalstaaten sind historisch ein junges Phänomen, das sich schon wieder erschöpft hat und nur noch den Dümmsten ein herrisches Selbstwertgefühl gibt. Und was man den Nationen als Leistung zuschreibt, stimmt nicht generell, und ist, soweit es stimmt, historisch überholt: Sie haben, Provinzen und Kleinstaaten zu nationalem Territorium zusammenfassend, größere Binnenmärkte hergestellt, und sie haben innerhalb ihrer abgesteckten Grenzen den Bürgern politische Partizipationsrechte gegeben, also Demokratie eingeübt. Aber der Binnenmarkt ist über nationale Grenzen weit hinausgewachsen, die Märkte sind grenzenlos, und demokratiepolitisch gibt es in Hinblick auf unsere Lebensfragen erst recht keine abgesteckten Grenzen mehr. Die Nationalstaaten werden sterben. Das kann dereinst als die historische Rache der Habsburger interpretiert werden. Die nationale Demokratie wird sterben. Denn in transnationale Prozesse kann nur eine transnationale Demokratie gestaltend eingreifen.
In diesem Gefüge ist die Europäische Union heute tatsächlich Avantgarde, das einzige politische Gebilde weltweit, das bewusst und programmatisch versucht, den unvermeidlichen schrittweisen Verlust der Souveränität der Nationalstaaten in institutionalisierter Gemeinschaftspolitik und wachsender transnationaler Demokratie aufzuheben, und das bereits seit mehr als sechzig Jahren. Dieser Prozess erscheint im Licht der Geschichte doch so vernünftig, dass man seine Idee faszinierend erzählen und die notwendigen Schritte überzeugend argumentieren könnte. Tatsächlich aber wird die Weiterentwicklung der Europäischen Union heute wieder durch wachsende Renationalisierung der Politiken der Mitgliedstaaten und der Stimmung ihrer Bevölkerungen gebremst und zeitweise blockiert. Wie schon gegen Ende der Habsburgermonarchie wachsen nationale Spannungen. Rechtspopulistische Politiker wie Marine Le Pen oder H. C. Strache bezeichnen die EU gar als »Völkerkerker« – da ist er wieder, dieser Begriff, und er ist natürlich so falsch wie schon seinerzeit. Und den Parteien der bürgerlichen Mitte, den schrumpfenden Großparteien, die die Staats- und Regierungschefs stellen und die meisten Abgeordneten in das Europäische Parlament entsenden, also europapolitische Verantwortung tragen, fällt dazu nichts anderes ein, als diese Stimmung »mit mehr Sachlichkeit« zu fördern: Sie, als Pragmatiker, könnten die »nationalen Interessen« in Brüssel besser verteidigen als die Extremisten.
Hier sieht man, wie schwierig es ist, und zugleich wie notwendig es wäre, aus historischen Erfahrungen eine nachhaltige Idee zu machen.
Die Habsburgermonarchie hatte eine Idee – in Robert Musils Mann ohne Eigenschaften kann man nachlesen, wie die Idee am Ende verloren ging. Droht der EU dasselbe Schicksal? Wird sie wider alle Schlüsse, die aus historischen Erfahrungen bereits gezogen wurden oder gezogen werden können, am Nationalismus zerbrechen? Es sind Staaten in die EU und damit in den nachnationalen Einigungsprozess eingetreten, die sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erst wieder als Nationen neu gründen mussten. Die Tschechoslowakei und Jugoslawien sind in Nationalstaaten zerfallen, erst diese haben den Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt. Die Ukraine will in die EU, muss aber erst ihr nationales Territorium verteidigen. Großbritannien will aus nationalem Eigensinn raus aus der EU, während es als Nation selbst zu zerfallen droht. Deutschland, Mitbegründer des Europäischen Projekts und lange Zeit gemeinsam mit Frankreich Motor des Einigungsprozesses und der Entwicklung der supranationalen Institutionen, erlebte mitten in dieser nachnationalen Entwicklung durch die Wiedervereinigung seine nationale Wiedergeburt.
Dazu kommt der systemimmanente Konstruktionsfehler der Europäischen Union: Die Menschen, die in europapolitische Verantwortung kommen, können nur national gewählt oder national nominiert werden. Wenn sie wiedergewählt werden wollen, müssen sie also die Fiktion aufrechterhalten, dass es in der Union um die Verteidigung nationaler Interessen geht.
Das produziert natürlich Widersprüche und Krisensymptome. Und diese werden dem Ganzen angelastet und nicht den vielen Gegen-Teilen.
Und doch können selbst die glühendsten Nationalisten keinen Beweis dafür erbringen, dass die Rückholung der an Brüssel abgegebenen Souveränitätsrechte, die Rekonstruktion von voll souveränen Nationen, die Zerschlagung der EU, oder zumindest ihr Rückbau zu einer bloßen Wirtschaftsgemeinschaft, zu größerem Heil der Staatsvölker führen würde. Transnationale Wirtschaft braucht transnationale Wirtschaftspolitik, die Nationen können einzeln für sich die Globalisierungsprozesse nicht regulieren, können unmöglich, was ja demokratischer Anspruch wäre, gestaltend eingreifen. Vor allem die kleinen Nationen wären dem hilflos und schutzlos ausgeliefert, was übrigens auch die Erfahrung der Nachhabsburgerzeit war.
Und schon damit sind wir wieder bei der Notwendigkeit, die politische Union weiter auszubauen, statt sie zurückzustutzen. Der Nationalismus hat buchstäblich abgewirtschaftet, die Verteidigung der Nation als Idee und in Praxis hat vor der Geschichte jeden Vernunftgrund und Sinn verloren.
Jeden? Nein, eine Nation gibt es, die am Stand der Dinge verteidigt werden muss, eine einzige Nation, die ihren alternativlosen Daseinszweck aus derselben Geschichte ableitet, aus der nationalistischen Raserei des Zusammenbruchs der Welt von Gestern: Und das ist Israel.
Das Habsburgerreich war kein Paradies für Juden. Aber das Habsburgerreich und die Juden hatten einen gemeinsamen Feind: den Nationalismus. Als Religionsgemeinschaft anerkannt, waren Juden formal gleichgestellt mit der katholischen Kirche. Unter den Völkern des Vielvölkerreichs, die sich immer aggressiver als Nationen definierten, wurden die Juden als eigenes Volk, als eigene Ethnie angesehen, aber da sie kein Territorium hatten, in dem sie als Bevölkerungsmehrheit Vorrechte beanspruchen und den Anspruch auf einen Nationalstaat stellen konnten, wurden sie, die sich je nach ihrem Lebensort und ihrer Sprache als Deutsche, Tschechen, Ungarn, Polen oder Galizier fühlten und durch ihre Kaisertreue zugleich als Österreicher, als vaterlandlose Gesellen bezeichnet. Das war für sie, die eigentlichen Patrioten der transnationalen Monarchie, immer wieder bedrohlich und demütigend. Allerdings haben die grundrechtlichen Garantien des Reichs bis zum Schluss gehalten, wodurch sowohl orthodoxes jüdisches Leben als auch Assimilation und sozialer Aufstieg möglich waren. Um 1900 kam es zu einem Aufschwung in Wirtschaft, Kultur und Wissenschaften, der wesentlich durch assimilierte Juden befördert wurde. Das transnationale Österreich schien zu einer Heimat der Juden zu werden, der Antisemitismus war rhetorisch, die Lebenschancen und Möglichkeiten aber wirkten real. Deshalb waren die Juden am Ende auch die letzten, die größten Patrioten des österreichischen Vielvölkerreichs. Besonders eindrücklich und berührend hat dies Franz Theodor Csokor in seinem Stück »3. November 1918« verdichtet, in der Szene, in der es zum Begräbnis eines k. u. k. Offiziers kommt, der wegen des Zusammenbruchs des Reichs Selbstmord beging. Die Regimentskameraden treten an das offene Grab und werfen jeder nach und nach eine Schaufel Erde auf den Sarg, wobei jeder der Erde seine nationale Bestimmung mitgibt. »Erde aus Ungarn!«, »Erde aus Polen!«, »Tschechische Erde!« und so weiter. Nur der jüdische Regimentsarzt sagt am Ende: »Erde aus Österreich!«
Die weitere Geschichte von der Nationalität zur Bestialität ist bekannt. Und die Juden mussten die Erfahrung machen, dass in einer Welt der Nationen die Assimilierung keinen ausreichenden Schutz bot. Nur eine eigene, hochgerüstete und verteidigungsbereite Nation würde Schutz bieten können, und nach dem Holocaust war dies so einsichtig wie auch politisch durchsetzbar. So wurden die Juden, die Patrioten des transnationalen Österreichs, zu den Begründern einer Nation, die in der postnationalen Welt als einzige und als letzte eine begründbare Nationsidee und innere Notwendigkeit hat. Sie waren die ersten Europäer im zeitgenössischen Sinn des Begriffs. Aber ihre Verfolgung führte dazu, dass auch sie eine Nation bilden mussten – die das heutige, mittlerweile wieder nachnational sich entwickelnde Europa verteidigen muss –, sogar wenn die nationale Regierungspolitik Israels in Rassismus umschlägt.
Ich weiß nicht, ob es einen Weltgeist im Sinne Hegels gibt. Aber wenn, dann ist er ein Zyniker.