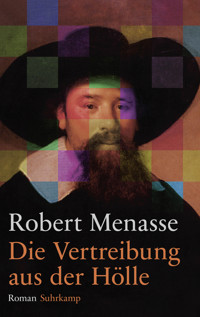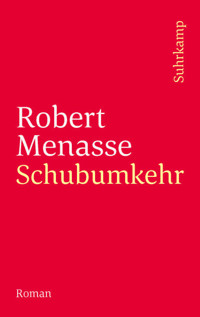17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Glückliches österreich – Kaum ein Land ist der kritischen Selbstbefragung so hartnäckig aus dem Weg gegangen wie die österreichische Zweite Republik seit dem Zweiten Weltkrieg. Vor der Erinnerung an die braune Vergangenheit flüchtete man sich in die rosige Zukunft.« (Neue Zürcher Zeitung) In rosiges Licht getaucht, wird österreich im Jahr 2005 gleich dreimal jubilieren. »60-50-10« lautet die Formel. Dahinter verbergen sich 60 Jahre Gründung der 2. Republik, 50 Jahre Staatsvertrag und 10 Jahre EU-Mitgliedschaft.
Robert Menasse, luzider Kritiker der österreichischen Verhältnisse, hat die Zweite Republik von ihren Anfängen an untersucht und kommentiert, seine »Essays machen einem das in seiner Nähe ferne Land einsichtig. Ein vergilbter Vorhang wird beiseite geschoben, ein Fenster geöffnet: Luft und Licht kommen herein« (Neue Zürcher Zeitung).
Mit den vorliegenden Essays, aktualisiert und um neue Beiträge ergänzt, legt Robert Menasse ein Standardwerk zur österreichischen Geschichte und Politik seit dem Zweiten Weltkrieg vor – jetzt fragt sich, was zu feiern ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Foto: Brigitte Friedrich
Robert Menasse
Das war Österreich
Gesammelte Essays zum Land ohne Eigenschaften
Herausgegeben von Eva Schörkhuber
Suhrkamp
»Österreich ist ein Land, so klein, daß du es mit dem kleinsten deiner Finger auf der Weltkarte verdecken kannst. Und doch besuchen viele Menschen aus aller Welt Österreich. Da kommt schon wieder einer!«
Die Kinderwelt von A bis Z,
Stichwort Österreich, Wien 1958
keine spannung vor der entspannung
exakt neutral
ohne höhe, ohne tiefe
exakt neutral
niemals leise, niemals laut
exakt neutral
nicht zu heiß, nicht zu kalt
exakt neutral
kein gefühl, kein gefühl
exakt neutral
kein gefühl, kein gefühl
exakt neutral
Stereo Total, EXACT NEUTRAL, 2001
Inhaltsverzeichnis
Exposition
Im Anfang war das Neue Österreich
SzeneSeinesgleichen geschieht
Das Land ohne Eigenschaften. Oder Das Erscheinen der Wahrheit in ihrem Verschwinden
SzenenwechselSeinesgleichen wird geschrieben: Die sozialpartnerschaftliche Ästhetik
Die Basis der österreichischen Gegenwartsliteratur
Der österreichische Überbau
Die Entwicklung des österreichischen Literaturbetriebes und seine Strukturierung im Geiste der Sozialpartnerschaft
Leitmotiv
Die Herausbildung sozialpartnerschaftlich-ästhetischer Strukturen in der österreichischen Literatur der Zweiten Republik
ProtagonistenMit- und Gegenspieler im Literaturbetrieb
Die Ohnmacht des Machers im Literaturbetrieb – Zu Tod und Werk von Gerhard Fritsch
Wien, die Hauptstadt des ausgehenden 20. Jahrhunderts – Zu Leben und Werk von Hermann Schürrer
Ende der Szene
Unheimlich statt öffentlich
Deus ex machina IKurt Waldheim
Der Name der Rose ist Dr. Kurt Waldheim
Die Verösterreicherung der Welt
Deus ex machina IIJörg Haider
Ein verrücktes Land
Pro- bzw. Analepse(Vor- bzw. Rückblende)
Rot – Weiße Rose – Rot
Die Geschichte vom Haus der Geschichte
Sterbensworte – Jenseits des Krieges
Retardierende Momente
Der Mitmacher
Die kleinen Vorsitzenden
Der Vormacher
Die Chefchen im Trockenen
Anagnorisis
Masse, Medium und Macht
Ad spectatores
Das war die Zweite Republik
KlimaxHöhepunkt der tragischen Vorstellung
(Un)erklärliches Österreich
Fallende HandlungZurück ins Bodenlose
Dummheit ist machbar
In 80 Tagen gegen die Welt
Kleines österreichisches Vokabelheft
Schlußoder: Da capo
Warum der Februar nicht vergehen will
Schlußfeier
Wende und Ende
Exposition
Im Anfang war das Neue Österreich
Die Erschaffung des österreichischen Überbaus
Die Tatsachen schienen zunächst für sich selbst zu sprechen, aber doch nur in der Sprache, die ihnen vorgeschrieben wurde. Allgemein bekannt, aber nicht erkannt, verflüchtigten sie sich in den Formulierungen, die für sie durchgesetzt wurden, und es fehlten dann allgemein die Worte für die Wahrheit, die als Geheimnis sozialer Besitz wurde: Man bezeichnete es als gelüftet, nur weil alle es gerne hüteten, an Festtagen der Rede, aber nie der Widerrede wert. Das verstand man darunter: »auf der Hut zu sein«, »nie wieder!« war eine Parole der Verdrängung.
Als die nächste Generation ihre Väter fragte: »Wie war es damals?«, antworteten selbst die, die nie im Konzentrationslager gesessen haben, daß das gemeinsame KZ-Erlebnis der »Vertreter der verschiedenen weltanschaulichen Lager« den Basiskonsens für die Zweite Republik geschaffen habe, was richtig und falsch zugleich war, bekanntes Faktum so sehr, wie eben auch Verschleierung, gehütetes Geheimnis. Denn den Konsens hatte der Faschismus tatsächlich hergestellt, aber eher insofern, als er den radikalen Widerspruch schon längst physisch liquidiert hatte.
Ein Schauspieler, der in einem Nazi-Propagandastück einen Riesenerfolg feierte, und dann, nach Zusammenbruch des Naziregimes, in einem Brecht-Stück, wird sowohl den Naziautor als auch Brecht für großartige Autoren halten, schließlich hatte er ja mit beiden Erfolg. Die Zeiten haben sich für ihn nur insofern geändert, als das eine Stück abgesetzt war und das andere auf dem Spielplan stand.
Ebenso wie dieser Schauspieler feierten auch gewisse Teile der Bourgeoisie (und diese Kategorie war vor dem Faschismus noch eine soziologisch ausweisbare) hintereinander zwei große, inhaltlich zwar widersprüchliche, aber je funktionale Erfolge: nämlich den Sieg des Faschismus und die Niederlage des Faschismus. (Daß die Kategorie Bourgeoisie nach dem Krieg nicht mehr selbstverständlich war, ja weitgehend gar nicht zu existieren schien, war eine Konsequenz dieses doppelten Erfolges.)
Sie erlebte den Sieg des Faschismus als Erfolg, weil dadurch der drohende Zusammenbruch des Kapitalismus schlagartig abgewendet war. Und die Niederlage des Faschismus war ein enormes Erfolgserlebnis, weil sich nun zeigte, daß der Faschismus seine Funktion offensichtlich erfüllt hatte: Seine Methoden waren desavouiert, aber der Kapitalismus brach trotzdem nicht zusammen.
Die Ordnung, die in der Anstrengung des »Wiederaufbaus« wiederaufgebaut wurde, blieb verordnet, ökonomisch keine neue, sondern die alte. Neu war nur der Überbau, der umformuliert werden mußte, nicht nur, weil »aus der Geschichte gelernt wurde«, sondern vor allem, weil die soziologischen Konsequenzen der faschistischen Ära dies verlangten: Der gesellschaftliche Widerspruch, nämlich eine bewußte, organisierte, kämpferische Arbeiterbewegung, war weitgehend liquidiert oder demoralisiert, und neue Formen sozialer Organisation waren notwendig, die darauf aufbauen konnten. Die zwei prinzipiellen Begriffe, die in Österreich in der Zeit nach Kriegsende vornehmlich strapaziert wurden, verraten schon, worum es ging: »Wiederaufbau« und »Neues Österreich«. »Wiederaufbau« bezieht sich auf die ökonomische Basis, die eben wieder-, das heißt, so wie vordem aufgebaut wurde; »Neues Österreich« bezieht sich auf den notwendig neuen Überbau, in den das Alte keinen Einlaß mehr finden durfte, hier mußten neue Formulierungen gefunden werden, die dem Sachverhalt entsprachen, daß vieles sich hatte ändern müssen, nur damit alles beim alten bleiben konnte.
Man hatte teuer bezahlt, physisch, materiell, gesellschaftsund staatspolitisch, buchstäblich in Ordnung war hier nichts mehr. Aber ökonomisch war die bislang schärfste Krise des Kapitalismus nachhaltig überwunden. Wiederaufbau: Das hieß ja auch Vollbeschäftigung und unbeschränkte Nachfrage, aber auf spezifische Weise, die zeigt, daß den »Sieg um jeden Preis«, den »Endsieg«, den die Faschisten beschworen hatten, die platzhaltende Bourgeoisie errungen hatte: Denn Faschismus hieß Militarisierung der Arbeit, tendenziell neue Sklaverei (Rückgang von der relativen zur absoluten Mehrwertproduktion, Lohndruck), Zerschlagung der organisierten Arbeiterbewegung und der Gewerkschaften, physische Liquidierung ihrer bewußtesten Vertreter. Hierin hatte der Faschismus ganze Arbeit geleistet, und dies wurde im Wiederaufbau der bürgerlichen Ordnung fulminant wirksam: So wurden etwa die ersten Unterlagen über die geltenden Löhne anhand der Lohntabellen der DAF (Deutsche Arbeitsfront) angefertigt, der im Dritten Reich geltende Lohnstopp wurde formell in Kraft gelassen und hieß ab 1947 »Lohn-Preis-Abkommen«. Eine solche Lohnpolitik etwa war vor dem Faschismus nicht möglich gewesen.
Die faschistische Militarisierung der Arbeit ließ sich nun widerspruchslos in die Wiederaufbauarbeit lenken, der von den Nazis brachial hergestellte Klassenkonsens konnte nun als notwendig und freiwillig vorausgesetzt werden, schien doch nach faschistischem Arbeitszwang und Krieg nun alles Notwendige geradezu als Freiheit. Bei der Ausstellung »Zwei Jahre Wiederaufbau«, 1947 im Wiener Rathaus, waren Fotos, auf denen Wiener bei »Wiederaufbauarbeiten« zu sehen waren, mit »Helden der Arbeit« übertitelt. 1946 sprach ein Bundesminister, der allerdings auch schon während des Austrofaschismus höchste Ämter innegehabt hatte, allzu deutlich aus, was nun vorging: »Erst da fast alle zu Sklaven geworden waren, wurden sie alle reif für die neue Freiheit« – frei als Sklaven statt Freiheit von Sklaverei? – »eine neue Freiheit mit einem neuen Glauben, mit einem neuen Geiste und mit neuen Methoden.« Glaube, Geist, Methoden – darum ging es eben: ein neuer Überbau, aber keine neue Basis.
Doch zunächst fehlte es an allem Notwendigen, es fehlten auch die Worte. Die neuen, in denen der neue Geist, die neuen Methoden glaubhaft artikuliert werden konnten. Ein Leitwort hatte man: »Neues Österreichbewußtsein«, es stieg auf wie ein Papierdrachen in einen wieder blauen Himmel, über den keine Bombenflugzeuge mehr flogen. Es zeigte sich aber, daß den kühnen Drachen in luftiger Höhe unten auf der Erde der Philister fest in der Hand hielt, der zunächst auch nur von den großen Komponisten und Dichtern, großen Baumeistern und Wissenschaftlern zu erzählen weiß, »die unser Land hervorgebracht hat«. Aber was war davon, nach einer entmenschten Zeit, noch übrig? Während man nach Worten suchte, die an dem Drachen hängen sollten, als sein bunter fröhlicher Schwanz, behalf man sich mit Bildern: Im Juli 1945 wurde im Wiener Rathaus unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Theodor Körner eine Fotoschau »Unser Österreich« organisiert; gezeigt wurden Fotos wie »Saualpe«, »Unholden gegen Karnische Alpen«, »Wilder Kaiser«, also das unzerstörbare Österreich, aber auch die heimische Fauna und Flora, »Lachmöwe«, »Tüpfelsumpfhuhn«. Inmitten der Kriegstrümmer wirkte diese Dokumentation eines Österreichs ohne Menschen, ohne Zivilisation zwar gespenstisch, aber heil.
Dieses Österreich wieder mit Menschen zu besiedeln hieß, ihnen eine Sprache zu geben. Dafür wurden sofort alle Kräfte mobilisiert: Noch bevor es das »Staatsamt für den Wiederaufbau« oder das »Staatsamt für Volksaufklärung« gab, schon vier Tage vor der Proklamierung der Wiedererrichtung der Republik durch die provisorische Regierung, erschien das Neue Österreich – Organ der demokratischen Einigung, das sich unter dem Vorwand, eine Zeitung zu sein, als »Staatsamt für die Errichtung eines neuen Überbaus« etablierte.
In den Seiten des Neuen Österreich, dessen redaktionelle Linie von den drei zugelassenen Parteien bestimmt wurde, spiegelt sich die Anstrengung und Widersprüchlichkeit, mit der der neue Überbau über der ökonomischen und politischen Restauration errichtet wurde.
Das Neue Österreich war natürlich nicht das einzige »Organ der öffentlichen Meinung«, das »in dem totalen Vakuum 1945 ins Leben trat«, aber es war das erste in doppeltem Sinn: chronologisch und von seinem Einfluß her.
Bereits zu Jahresende 1945 waren alle Kommunikationsmittel, die das Feld der öffentlichen Meinung die nächsten Jahre beherrschen sollten, etabliert, was »erstaunlich rasch« nur der offiziellen Geschichtsschreibung erscheint, der die Priorität, die die Errichtung eines neuen Überbaus in Österreich hatte, naturgemäß nicht bewußt sein kann. Die ersten Ausgaben des Neuen Österreich keuchten noch vor sprachlicher Unsicherheit und Hilflosigkeit, was sich nachgerade in einer Art Zweisprachigkeit der Zeitung ausdrückte: auf der einen Seite die Leitartikelund Programmsprache, die die neuen Aufgaben, Sehweisen, die neue Ideologie vorformulierte, mit einem Pathos, der sich, in Ermangelung der erst gesuchten neuen Worte, noch Anleihen bei der alten Sprache nehmen mußte, wenn das neue Programm nur wenigstens irgendwie damit formuliert werden konnte: von »Blutzoll« ist da die Rede, und vom »Volkskörper« und von »Volksgemeinschaft«, von »Blut und Tränen« und von »Hinwegfegen«. Erst sehr zögernd und sporadisch, aber deutlich bemüht mischen sich neue Wörter, Neuprägungen in diese Sprache, etwa wenn die Nazis »Weltuntergangster« genannt werden, freilich eine geniale Formulierung in einem Land, das vordem als Versuchsanstalt galt, in der der Weltuntergang geprobt werde.
Schon im Leitartikel der ersten Ausgabe des Neuen Österreich wird der Basismythos der Zweiten Republik formuliert: daß die Feinde von gestern durch das gemeinsame KZ-Erlebnis zu Partnern von heute geworden seien: »[…] sind die Anhänger verschiedener Weltanschauungen […] einander menschlich nahegekommen. […] Unser Volk braucht diese neue Einheit – […] eine feste und dauerhafte Einheit der Arbeiter, Bauern, Gewerbetreibenden, Intellektuellen, eine wirkliche Volkseinheit«.
Nicht nur, daß in der Liste »Arbeiter, Bauern, Gewerbetreibende, Intellektuelle« die Industriellen, also gerade diejenigen fehlen, die wesentlich der eine Teil jenes gesellschaftlichen Widerspruchs sind, der nun in der »Volkseinheit« versöhnt sein soll, ist auch ausgeblendet, daß die erwähnten »verschiedenen Weltanschauungen« gegensätzliche Klasseninteressen ausdrücken. Ihre Repräsentanten mögen sich menschlich nähergekommen sein, aber die sozialen Gegensätze, die sie repräsentieren, sind deswegen nicht beseitigt. Deshalb das Rekurrieren auf den Begriff, den der Nationalsozialismus, der ja ebenfalls die Aufhebung der gesellschaftlichen Widersprüche versprochen hatte, immer wieder beschworen hatte: »Volk«, worin alle sozialen Gegensätze einfach semantisch verschwinden.
Auf der anderen Seite – also neben der Leitartikel- und Programmsprache – die Glossen- und Reportagensprache in jenem Stil, der zuvor als zu »tief« für politische Artikulation gegolten haben mochte, augenzwinkernd, eh schon wissend, mit a bissl stilisierter Mundart, die ja im Vergleich zur Nazisprache jetzt als unbelastet galt. Diese Sprache sollte das Programmatische des Leitartikels illustrieren und machte im einzelnen deutlich, wie es im allgemeinen gemeint war. Wie zum Beispiel in jenem Artikel, in dem ein Reporter des Neuen Österreich von einer alten Frau berichtete, die auf der Straße die Hakenkreuz-Abzeichen einsammelte, die die Wiener weggeworfen haben. Auf die Frage des Reporters, warum sie das tue, antwortete sie: »Was soll’n denn die Russen denken, wenn alle Straßen mit den Abzeichen versaut sind! So viele Nazis hat’s ja in Wien gar net geb’n, als da Abzeichen herumliegen!« Und dabei »blitzte der Schalk in ihren Augenwinkeln«.
Die Einheit, der soziale Konsens, war nicht nur ein ideologisches Desiderat des »Wiederaufbaus«, sondern auch eine politische Notwendigkeit gegenüber den Alliierten. Schließlich wollte man nicht bloß die kapitalistische Ökonomie und eine ihr entsprechende Infrastruktur restaurieren, sie sollte ja auch in einem unabhängigen Staat aufgehen, in dem die Ausbeutung ein Problem der Souveränität und nicht das einer Kolonie werden sollte.
Solange an den Verhandlungstischen darum gerungen wurde, sollte das, neben der Arbeit an einer neuen Sprache zur Formulierung einer neuen Österreichideologie, die zweite große Anstrengung auf der Überbaustelle sein, nämlich die laufende Produktion von Leumundszeugnissen, die an die Alliierten adressiert waren.
Der Leser des Neuen Österreich befand sich daher immer auch in der Höhle des Leumunds, wo also nicht nur den Österreichern das neue Österreichbewußtsein vorgeschrieben wurde, sondern auch den Alliierten eine bestimmte Sehweise von Österreich nahegelegt wurde, indem man ihnen ununterbrochen zurief: »Vergeßt nicht, daß wir das erste Opfer der Naziaggression waren!« »Seht doch, wie konsequent wir Österreicher entnazifizieren!« »Beruhigt euch, wir haben aus der Geschichte gelernt und wissen nun, was not tut!«
Die Lügen, die dabei verbreitet wurden, waren so eklatant, daß sie selbst jenen österreichischen Lesern auffallen mußten, die über jene ungeheure Verdrängungskapazität verfügten, die die Zeitung voraussetzte, weshalb sie sich nicht scheute, ihren österreichischen Lesern geradeheraus zu sagen, daß diese Passagen ohnehin nicht für sie bestimmt waren: »Wir sind nicht allein auf der Welt«, schrieb das Neue Österreich, was im Österreich der vier Besatzungszonen wohl keiner geglaubt hätte, »heute mehr denn je haben wir auf unsere Reputation zu achten, auf die Meinung und das Urteil der Großen dieser Erde.«
Wir wollten den Nationalsozialismus nicht, wir wurden überfallen und dazu gezwungen! – wurde den Befreiern zugerufen, während man den Österreichern sagte: Wir verstehen schon, daß ihr der »raffinierten massenpsychologischen Goebbelspropaganda« unterlegen seid, die euch das Paradies auf Erden versprach, niemand wird euch deshalb einen Strick drehen! Keine Gnade für die Nazis! – wurde proklamiert und gleichzeitig beruhigt: Keine Bange, wir wissen, ihr habt um das wahre Wesen des Nationalsozialismus nicht Bescheid gewußt, ihr seid bloß dem »Rattenfänger aus München [!]« auf den Leim gegangen!
Die Versöhnung dieses Widerspruchs gelang in der täglich wiederholten Formel, daß Österreich als erstes Opfer der Naziaggression anzusehen sei: Einmal berichtete das Neue Österreich davon, wie »ein ehemaliger Gauleiter und Blutordensträger« von Wiener Polizisten verhaftet und über die Ringstraße ins Gefängnis eskortiert wurde, und »von allen Seiten wurde von den Passanten lebhaft Beifall geklatscht und gerufen: Bravo, Polizei!« Mit den Wienern freuten sich russische und jugoslawische Offiziere und Soldaten, die diesen Zug sahen und riefen: »Gut so, Österreicher!«
Nach innen ging es um die Einheit, nach außen um den Leumund. Entnazifizierung war keine Notwendigkeit für den »Wiederaufbau«, keine Notwendigkeit für das »Neue Österreichbewußtsein«, sondern lediglich eine Notwendigkeit für die Wiedererlangung der Souveränität. Was dafür erforderlich war, wurde entsprechend formuliert bzw. konstruiert und in die Auslage gestellt, aber eben in einer Weise, die die zügige sozioökonomische Restauration in keiner Weise behindern sollte. Das Verfassungsgesetz über das Verbot der NSDAP vom Mai 1945 macht das deutlich: Das Gesetz unterscheidet »Illegale« und »Mitläufer«.
Wer zwischen 1933 und 1938 der NSDAP oder einem ihrer Wehrverbände angehört hatte, wer also »Illegaler« gewesen war, war wegen Hochverrats mit schwerem Kerker in der Dauer von fünf bis zehn Jahren zu bestrafen; Kerker war auch vorgesehen für schwerbelastete Nationalsozialisten und Förderer. Wer aber zwischen 1938 und 1945 der NSDAP beigetreten war, galt als »Mitläufer«, der lediglich dem Druck des Naziterrors hatte nachgeben müssen, und unterlag bloß einer Registrierungspflicht, die keine weitreichenden Folgen hatte. Dazu kam noch, daß selbst gegenüber »Illegalen«, schwerbelasteten Nationalsozialisten und Förderern »Ausnahmen zulässig« waren, »wenn der Betreffende seine Zugehörigkeit zur NSDAP oder einem ihrer Wehrverbände niemals mißbraucht hat und aus seinem Verhalten noch vor der Befreiung Österreichs auf eine positive Einstellung zur unabhängigen Republik Österreich mit Sicherheit geschlossen werden kann«.
Die Entnazifizierung war »prinzipiell« (Leumund!), aber mit »Ausnahmen« (im Sinne des Wiederaufbaus). Bürgermeister Theodor Körner: »Nationalsozialisten gehören nicht auf gehobene Posten. Diesen Grundsatz werde ich prinzipiell durchführen und Ausnahmen nur dort machen, wo sie aus rein fachlichen Gründen absolut notwendig sind.« Bei den Nationalratswahlen 1949 wurde schon wieder kräftig um Nazistimmen gebuhlt, während Entnazifizierung und Glorifizierung des österreichischen Widerstands bloßes außenpolitisches Reputationsproblem blieb.
Unbelastet von einer Diskussion persönlicher oder nationaler Schuld, ging also der Wiederaufbau in Österreich zügig voran, geradezu in wahrem Sportsgeist, denn »dabeisein« sei schließlich alles gewesen.
Denn während das Naziproblem in einer raschen, kalkulierten Anstrengung zumindest interpretativ »aus der Welt geschafft« wurde, wurde das Problem der Kontinuität vom Austrofaschismus in der Zweiten Republik nicht einmal angeschnitten. Im Gegenteil, gerade die Tatsache, daß auch Austrofaschisten von den Nationalsozialisten verfolgt worden sind, ermöglichte es ihnen, als Opfer des Naziregimes sofort wieder jene Posten zu beziehen, die sie bis 1938 innegehabt hatten.
Die personelle Kontinuität vom Austrofaschismus in der Zweiten Republik verbürgte, daß all das, was der Nazifaschismus viel konsequenter durchgesetzt hat, als es der Austrofaschismus gekonnt hatte, wieder patriotisch umformuliert, aber nicht zurückgenommen wurde. Es blieb sozusagen als historische Errungenschaft der bürgerlichen Gesellschaft erhalten, wobei sich an den Schaltstellen des Geisteslebens eine pragmatische Allianz der Austrofaschisten mit jenen Emigranten bildete, die aus den USA als CIA-Verbindungsleute heimgekehrt waren.
Kritik wurde nur an den »unfaßbaren Verbrechen des Naziregimes« geübt, aber nicht grundsätzlich am Nationalsozialismus bzw. Faschismus. Vom Austrofaschismus übernahm man ja Personal für die höheren Ämter, vom Nationalsozialismus wesentliche Konsequenzen von dessen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, denen man es immerhin verdankte, daß man eben nicht an die Zeit vor den beiden Faschismen anknüpfen mußte, als eine starke Arbeiterbewegung noch die sozialistische Umwandlung der Gesellschaft eingefordert hatte.
Über die vernichtende Niederlage der Kommunisten bei den ersten Wahlen nach dem Krieg, im Herbst 1945, staunten daher nur die Heuchler. Die physische Liquidierung der bewußten Arbeiterschaft und der Arbeiterbewegung war ja eine der »Leistungen« des Nationalsozialismus gewesen, und dabei hatten die Kommunisten verhältnismäßig die meisten Opfer zu beklagen gehabt. Der »aufsehenerregende Konservativismus«, der sich in den ersten Wahlen 1945 manifestierte, war eine Konsequenz der radikalen gesellschaftlichen Umgestaltung, die die Nazis mit allen technischen Mitteln des 20. Jahrhunderts herbeigeführt hatten und auf der nun aufgebaut wurde, während der neue Überbau aus »Abscheu vor den Naziverbrechen« auf eine verklärende Pflege des österreichischen 19. Jahrhunderts zurückzugreifen sich entschloß.
Der Einfluß der Kommunisten wurde systematisch weiter zurückgedrängt, bis sie 1947 aus der Regierung und schließlich 1959 auch aus dem Parlament ausschieden. Sie waren insofern auch selber daran schuld, als sie nicht nur auf einer schon desavouierten stalinistischen Politik beharrten, sondern auch, von der bescheidenen Partizipation an der ersten Regierung verblendet, emphatisch mit den Wölfen geheuchelt und an der Ideologie der patriotischen Einheit mitgearbeitet hatten.
In den Jahren 1948 bis 1952 floß rund eine Milliarde Dollar in Form von Produktionsmitteln aufgrund des Marshall-Plans in die österreichische Wirtschaft. Es war das größte Einströmen ausländischen Kapitals, das je Österreich erreicht hat. In dieser Zeit wandelte sich Österreich, das nach dem Ersten Weltkrieg noch ein Mittelding aus Agrar- und Industriestaat gewesen war, zum modernen Industriestaat. Die Erfolgsmeldungen waren euphorisch und wurden konsequent propagandistisch eingebunden in den neuen Österreichpatriotismus, den das Neue Österreich täglich vorschrieb.
Hier war der Beweis gegeben, daß das kleine Österreich doch »lebensfähig« sei, seine Unabhängigkeit werde behaupten können. Daß für die stolzen Wirtschaftswachstumszahlen Faschismus in zwei Varianten, dann ein mörderischer Krieg und die Beibehaltung »faschistischer Errungenschaften« im »Wiederaufbau«, wie etwa der Lohnstopp, notwendig gewesen sind, das wurde naturgemäß politisch nie diskutiert, im Gegenteil: was man aus der Geschichte wirklich als »gelernt« vermitteln wollte, war gerade dies: daß politisch Lied garstig Lied sei.
Das Neue Österreich schrieb den Österreichern »zur Mahnung« hinter die Ohren: »Baldur von Schirachs Vater wurde gefragt, wie es käme, daß sein Sohn solche Greuel hätte verüben können. Schirachs Vater erwiderte: ›Mein Sohn war ein feinfühliger Lyriker. Er war ein vielversprechender junger Mann, er hätte die Finger von der Politik lassen sollen.‹« So stand es da, »zur Mahnung«, ohne weiteren Kommentar.
Doch so rigid der neue österreichische Überbau auch errichtet wurde – patriotisch rückwärts gewandt, hoffnungsfroh entpolitisiert in die Zukunft blickend, eine Einheit beschwörend, die es nach einer Diktatur, die so viele Täter und Opfer produziert hatte, in dieser Weise gar nicht geben konnte –, so fehlte doch lange Zeit ein Kitt, der die inneren Widersprüche dieser Konstruktion verbinden konnte (wie etwa die Formel von »Österreich als dem ersten Opfer der Naziaggression« zur staatstragenden Geschichtslüge auserkoren war). 1950 wurde die Lösung gefunden: die von der österreichischen Presse im allgemeinen Bewußtsein durchgesetzte Lüge vom kommunistischen Putschversuch. Mit dieser Lüge vom »Kommunistenputsch« war das Wiederaufgebaute im neuen Überbau in einer unverbrüchlichen Generalformel aufgehoben: Ab nun wurde es Mode, Kritik an der Gesellschaft durch Kritik an deren »Extremen« zu ersetzen. Der unpolitische Überbau hatte sein politisches Bewußtsein gefunden.
Bis 1955, bis zum Staatsvertrag, sollte nun Ruhe im Land herrschen, das ruhiggestellte soziale Klima und das – dank der Lohn-Preis-Abkommen – niedrige Lohnniveau ermöglichten einen kontinuierlichen Aufschwung der Wirtschaft. Durch die politische Kooperation der beiden großen gesellschaftlichen Lager war das Parlament, in das 1945 so pathetisch Einzug gehalten worden war, seiner Funktion beraubt, Kritik war durch Gemeinplätze ersetzt, die Tageszeitungen konnten sich in eine Dumpfheit zurücksinken lassen, die das aus den Gegebenheiten resultierende dumpfe intellektuelle Klima widerspiegelte und es dadurch auch erst so recht festsetzte. Die Errichtung des Neuen Österreich, das heißt die Errichtung des neuen österreichischen Überbaus, war in seinen wesentlichen Grundzügen abgeschlossen. Erst 1956, dem ersten Jahr der Selbständigkeit Österreichs, als der Zeitpunkt gekommen schien, in dem die Früchte des Konjunkturaufschwunges geerntet werden konnten, drohte die Stabilisierung durch aufflackernde Kämpfe um das Sozialprodukt »gefährdet« zu werden. Aufgrund der guten Erfahrungen, die während des Wiederaufbaus mit den Lohn-Preis-Abkommen gemacht worden sind, wurde diese Zusammenarbeit der Wirtschafts- und Gewerkschaftsspitzen nun in der »paritätischen Kommission« institutionalisiert.
Das war die Geburtsstunde des spezifisch österreichischen Systems der Sozialpartnerschaft.
Hervorgegangen aus dem faschistischen Lohndruck und der brachialen Versöhnung des gesellschaftlichen Widerspruchs, nach dem Krieg als freiwilliger Konsens durchgesetzt, war nun ein System entstanden, das sich zu einer Versuchsanstalt entwickeln konnte, in der vor den Augen der »Großen dieser Erde« nun die Vermeidung des Weltunterganges erfolgreich geprobt werden konnte. Vermeidung des Weltunterganges heißt: Keine Krise sollte die bürgerliche Gesellschaft mehr wirklich essentiell erschüttern können, die Erreichung des bürgerlichen Geschichtsziels ist, wie Österreich zeigte, möglich: ein paradiesischer Zustand, der sich in ungewöhnlichen Wachstumsraten, niedrigem Lohnniveau und dennoch absolutem sozialem Frieden ausdrückt.
Es war im Oktober 1950, als Günther Anders folgende Zeilen in sein Tagebuch notierte: »Der heutige Zustand verhöhnt den blutigen Ernst der vergangenen zwölf Jahre, er macht ihn ungültig und degradiert ihn zu einem Schauspiel. Und das Schauspiel ist eben abgesetzt, weil ein anderes auf dem Spielplan steht.«
Im Erfolg, den dieses Schauspiel nun hat, rauscht noch der Beifall mit, den das vorige eingeheimst hatte, bis es abgesetzt werden mußte.
SzeneSeinesgleichen geschieht
Das Land ohne Eigenschaften. Oder Das Erscheinen der Wahrheit in ihrem Verschwinden
1.
»Österreichische Identität« – dieser Begriff hat etwas von einem dunklen und muffigen Zimmer, in dem man, wenn man aus irgendeinem Grund eintritt, sofort die Vorhänge beiseite schieben und das Fenster öffnen möchte, um etwas Luft und Licht hereinzulassen. Doch wenn das Fenster keine Aussicht hat und sich der Raum daher nur wenig erhellen will?
Als ich begann, mein Buch über die »österreichische Identität« zu schreiben, verbrachte ich die meiste Zeit zunächst viel lieber im Kaffeehaus und las Zeitungen. Natürlich stellte ich diese Mußestunden als Teil meiner Arbeit aus, denn immerhin wurde in den Zeitungen, zumindest in den deutschen, eine intensive Identitäts-Diskussion geführt, eine breite Debatte über die neue Identität Deutschlands nach der sogenannten »Wiedervereinigung«. Da erreichte mich folgender Brief:
Sehr geehrter Herr Menasse!
Wir arbeiten zur Zeit im Auftrag des Bundeskanzleramtes am Projekt »Corporate Design«. Zur besseren Problemeingrenzung veranstalten wir dazu eine erste Diskussionsrunde. Wir erlauben uns, Sie sehr höflich zu einer Expertenanhörung ins Palais Schwarzenberg (Blauer Salon) am 26.3. einzuladen. In diesem Gespräch sollen Fragen über das Spannungsverhältnis »Staat – Verwaltung – Corporate Identity – Corporate Design« thematisiert werden. (…) Wir hoffen, Sie dort begrüßen zu können, und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Günter O. Lebisch (Lebisch, Werbeagentur)
Daß in einer Zeit, da Deutschland aufgrund des Falls der Berliner Mauer seine neue Identität diskutiert, sich eine Gruppe von Intellektuellen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens im Blauen Salon des Palais Schwarzenberg trifft, um die »Corporate Identity« der Republik Österreich zu entwickeln, läßt natürlich unmittelbar an die Musilsche Parallelaktion denken. Nun können wir in dem dunklen Raum, den der Begriff »österreichische Identität« darstellt, eine Bücherwand erkennen, einige vertraute Buchrücken, ein Lichtstrahl fällt auf Musils Roman, und schon haben wir den Eindruck, daß es doch etwas heller geworden ist, die Verhältnisse wirken ein wenig vertrauter, zumindest erscheinen uns die Aktivitäten des Bundeskanzleramtes als bedeutsam.
Tatsächlich zeigt die österreichische Realität Anfang der 90er Jahre eine deutliche Parallele zu dem Österreich, das Musil im Mann ohne Eigenschaften beschrieben hat: wieder eine Endzeit. Nicht nur deshalb, weil die Präsidentschaft Waldheims zu Ende ging. Aber wenn wir ihn als Symptom oder besser als Paradigma betrachten – und daß man dies tun kann, ja muß, darüber besteht Einhelligkeit –, dann muß man sagen: auch deshalb. Denn Waldheim war nicht nur der erste, der einzige Präsident der Zweiten Republik, der gesellschaftliche Aufklärung bewirkte – durchaus im Sinn der Dialektik der Aufklärung –, er ist auch und vor allem der letzte Präsident der Republik, die durch den Anspruch geprägt war, beweisen zu müssen, daß sie doch alleine lebensfähig sei. Was gemeinhin die »Erfolgsstory der Zweiten Republik« genannt wird, beruhte wesentlich auf diesem stolzen Selbstverständnis, daß die Zweite Republik die praktische Widerlegung des Selbstzweifels, des Grundirrtums der Ersten Republik ist. »Doch alleine lebensfähig« – erlebten wir in Waldheims Wahl mit ihrem Slogan »Wir Österreicher wählen, wen wir wollen« nicht ein letztes, geradezu karikaturhaftes Aufbäumen dieses Anspruchs? Es war dessen Ende, weil deutlich wurde, daß mit Waldheims Sieg dieser ideologische Konsens der Zweiten Republik den materiellen Interessen dieses Landes entgegenzustehen begann. Denn längst schon war die Entscheidung gefallen, Österreich wieder an einen größeren politischen und wirtschaftlichen Zusammenhang anzuschließen. So zeigte sich der Anspruch, alleine lebensfähig zu sein, schließlich an diesen einen Mann alleine delegiert, an den international isolierten Präsidenten in der nun »Bunker« genannten Hofburg, und dessen »Aussitzen« wurde nicht mehr stolz gemessen am Schicksal der Ersten Republik, sondern bange an den Erwartungen, die die politische Elite in Hinblick auf eine »Dritte Republik« zu haben begann. Noch ist dieser immer wieder in die Diskussion geworfene Begriff »Dritte Republik« nichts als eine nicht näher bestimmte Floskel, die nicht mehr und nicht weniger bedeutet als dies: Es kommt offenbar ein Gefühl davon auf, daß die Zweite Republik am Ende ist.
Natürlich wird nicht deshalb vom Ende der Zweiten Republik gemunkelt, der Begriff »Dritte Republik« in immer neuen Nullnummern vorgestellt und der EU-Beitritt vollzogen, weil sich irgend etwas grundsätzlich an der Einschätzung der politischen Stabilität und wirtschaftlichen Lebensfähigkeit Österreichs geändert hätte – es scheint vielmehr so zu sein, daß es in Österreich einen besonderen Hang zu Endzeiten gibt. Man muß Endzeiten sagen, also den Plural verwenden, weil es eine österreichische Erfahrungstatsache ist, daß am Ende einer Endzeit nie das Ende ist. Die zur Jahrhundertwende geborene Generation etwa hat dies bekanntlich viermal erleben können: Das Ende der Habsburger-Monarchie. Das Ende der Ersten Republik. Das Ende des Ständestaates. Das Ende der Ostmark als Bestandteil des Dritten Reiches. Diese Generation hat mit Fleiß und Hingabe die Zweite Republik aufgebaut, die nun strukturell mit dieser Erfahrung gesättigt ist, mit dieser praktischen Metaphysik, diesem weltlichen Katholizismus: Das Diesseits der Geschichte ist flüchtig, aber es gibt immer ein geschichtliches Jenseits, das erlöst.
Das definiert auch wesentlich unser Nationalgefühl. Ein Beispiel: Was wird in Österreich heute als Nationalliteratur empfunden und anerkannt? Robert Musil? Heimito von Doderer? Oswald Wiener? Bei Musil und Doderer wird man sofort einhellige Zustimmung erhalten, daß deren Werke tatsächlich Nationalliteratur sind.
Bei Wiener wird man im allgemeinen zunächst stutzen und dann abwehren. Dabei haben alle drei Autoren Wesentliches gemeinsam: Jeder von ihnen wollte den großen, totalen, definitiven Roman schreiben, und die Bedeutung und die literarische Qualität aller drei steht völlig außer Streit. Aber während Musils Mann ohne Eigenschaften das Ende der Habsburger-Monarchie beschreibt und Doderers Dämonen sich mit dem Ende der Ersten Republik auseinandersetzt, ist Wieners Verbesserung von Mitteleuropa in dieser Beispielreihe die einzige genuine literarische Reflexion der Zweiten Republik, weshalb dieser Roman – zur Zeit seiner Abfassung war noch kein Ende der Zweiten Republik absehbar – als einziger dieser drei nicht als deren Nationalliteratur empfunden wird.
Eine Diskussion darüber, wie repräsentativ ein literarisches Werk für die nationale Identität ist, sollte erst viele Jahre später von Thomas Bernhard ausgelöst werden, durch sein Stück Heldenplatz – das sich ebenfalls wieder auf einen historischen Untergang Österreichs bezieht.
Ein weiteres Indiz ist, daß es zu dieser Zeit, nachdem die Zweite Republik sich so lange jede grundsätzliche Selbstreflexion ersparen zu können glaubte, nun doch zu einer breiten Diskussion der eigenen Identität, zu einem Hinterfragen der Geschichte, zu öffentlichem Nachdenken und Bedenken gekommen ist. Es ist bekannt, daß die Eule der Minerva ihren Flug in der Dämmerung beginnt.
In der Zweiten Republik war allerdings, wie im folgenden auch gezeigt werden soll, alles von Anfang an in ein so eigentümliches Zwielicht getaucht, daß die Dämmerung nicht so einfach davon zu unterscheiden ist. Wir erkennen also nicht die Dämmerung und können schließen, daß die Eule der Minerva nun ihren Flug wohl beginnt, sondern wir sehen die Eule und wissen, daß die Dämmerung eingesetzt haben muß.
Die breite Auseinandersetzung über die Verfaßtheit Österreichs war aber von Anfang an nostalgisch, das heißt, es ging nur noch darum, daß wir, in Brüssel angekommen, wissen wollen, wer wir gewesen sind.
2.
Die Zweite Republik hatte von Anfang an besonderen Anlaß zur Selbstreflexion – aber deswegen hat sie sie möglichst vermieden. Selbst die Nationalfeiertage, anderswo Gelegenheit für programmatische Überlegungen der politischen Repräsentanten, wurden hierzulande bald nur noch für Aufrufe zu Fit-Märschen genützt, während weitgehend sogar vergessen wurde, woran der Nationalfeiertag erinnern sollte, ganz zu schweigen von den Konnotationen, die es gerade in Österreich hat, wenn das Volk aufgerufen wird zu marschieren. Intellektuelle und Künstler, die sich kritisch mit der politischen und gesellschaftlichen Verfaßtheit Österreichs auseinandersetzten, wurden von Gerichten verfolgt bzw. später, im Zuge einer Liberalisierung oder zumindest einer Erosion der versteinerten Verhältnisse, nur noch dazu aufgefordert, sich psychiatrieren zu lassen. Auch die schließliche Aufdeckung von politischen Skandalen befriedigte in keiner Weise das Bedürfnis nach wenigstens einem Minimum von politischer Aufklärung, sondern übersättigte mit einem Maximum an Aufklärung über das Fehlverhalten einzelner Menschen, was zu einer Moralisierung der Republik führte, statt zu ihrer Aufklärung.
Diese Abwehr gegenüber jeder grundsätzlichen Problematisierung der Republik wird gerne mit der traumatischen Erfahrung begründet, die mit der Ersten Republik gemacht worden war: daß ein Staat untergehen kann, wenn nicht an ihn geglaubt wird. An die Zweite Republik mußte daher bedingungslos und ohne Widerspruch geglaubt werden. Das programmatische »Nie wieder!« der Nachkriegspolitiker bezog sich nicht so sehr auf den Faschismus als auf die Konflikte, Widersprüche, Auseinandersetzungen und die Kritik, die erfahrungsgemäß einen Staat existentiell bedrohen können. Die Gründerväter der Zweiten Republik, die erlebt hatten, daß Menschen wegen ihrer Gesinnung verfolgt worden sind, beschlossen, damit dies nie wieder geschehe, ein System zu errichten, in dem man sich ohne Gesinnung zusammensetzen kann.
Dieses System, die Sozialpartnerschaft, bewirkte, daß alle gesellschaftlichen und politischen Widersprüche und Gegensätze mitsammen identisch wurden, wodurch österreichische Identität bald nichts anderes mehr bedeutete, als daß hier jegliche konkrete Identität obsolet geworden ist.
Erst allmählich begann sich das zu ändern. Die Erfolge österreichischer Schriftsteller, die sich konsequent mit der österreichischen Realität kritisch auseinandersetzten (wie etwa Bernhard, Turrini, Haslinger), sind ein Indiz dafür, daß ein gesellschaftliches Bedürfnis nach Selbstreflexion wuchs, die Entwicklung in Europa nach 1989 machte die Frage nach der Selbsteinschätzung Österreichs und seiner Stellung im nun völlig geänderten Kontext virulent, und die Perspektive des EU-Beitritts Österreichs verstärkte noch zusätzlich die aufkommende Diskussion um Österreichs Identität.
Es ist natürlich nicht verwunderlich, daß sich bei dieser Diskussion das historische Defizit, der Mangel an Tradition einer entsprechenden Auseinandersetzung und das Fehlen eines gewachsenen reflexiven Selbstverständnisses und daraus folgender Parameter, allzu deutlich bemerkbar macht. Die Beschreibung österreichischer Verhältnisse wurde gleich als Parodie oder zumindest als Übertreibung empfunden, eine einfache analytische Ableitung als zweifelhafte Spekulation, und das Denken in historischen Zusammenhängen, die manches an der eigentümlichen Gewordenheit der Zweiten Republik verständlich machen, galt als Provokation, als »Aufreißen alter Wunden«. Diese Wunden muß man natürlich mitdenken, um die vollständige Bedeutung des Satzes zu ermessen, daß Österreich ein Verbändestaat ist.
Die Art, wie aber von offizieller Seite mit österreichischer Geschichte und österreichischer Identität umgegangen wurde, schlug allerdings immer neue wirkliche Wunden – Wunden in jedes denkende Gemüt. Dazu zwei Beispiele:
Bundespräsident Waldheim bat am Nationalfeiertag des Jahres 1991 um Entschuldigung für seinen Satz, er habe als Leutnant der deutschen Wehrmacht nur seine Pflicht getan. Ist ihm also die inhaltliche Tragweite dieses Satzes doch noch zu Bewußtsein gekommen, hat er zu einem späten, aber letztlich doch noch akzeptablen Einsehen gefunden, was er mit diesem Satz eigentlich gesagt hatte? Nein. Er entschuldigte sich, sinngemäß zusammengefaßt, vielmehr dafür, daß er nach vielen Jahren im Ausland nicht habe wissen können, daß sich mittlerweile das geistige Klima in Österreich dahin gehend verändert habe, daß ein solcher Satz nicht mehr selbstverständlich von allen akzeptiert werde. Wäre ihm dies bekannt gewesen, hätte er diesen Satz gewiß nicht gesagt.
Mit anderen Worten: Der Präsident, der einen Großteil seiner Amtszeit mit dem Dementieren des Vorwurfes, daß er gelogen habe, zugebracht hat, erklärt am Ende seiner Amtszeit, daß er auch in diesem Punkt liebend gerne gelogen hätte, wenn er nur besser darüber informiert gewesen wäre, was die Öffentlichkeit in dieser Frage zu hören wünschte.
Bundeskanzler Vranitzky erklärte im Parlament, daß es eine österreichische Mitschuld an den Nazi-Verbrechen gegeben habe. Sechsundvierzig Jahre nach Kriegsende und drei Jahre nach dem sogenannten »Bedenkjahr« kommt ein solches Eingeständnis eigentümlich spät. Wer wollte Vranitzky dafür tadeln? Man könnte ja auch sagen: endlich ein Regierungschef, der ein jahrzehntelanges Versäumnis ausräumt, endlich eine offizielle Anerkennung der bekannten Tatsache, daß diese Republik auf einer Geschichtslüge begründet wurde, auf der Lüge, daß Österreich ausschließlich Opfer der Nazi-Aggression gewesen sei. Spät, könnte man sagen, aber endlich doch!
Nun war aber Vranitzkys Erklärung leider keine grundsätzliche Erklärung zu Österreichs Geschichte und Verfaßtheit, sondern gewissermaßen nur eine Fußnote zu einer Erklärung über die Situation in Jugoslawien. Und die »österreichische Mitschuld an den Nazi-Verbrechen« wurde in einer Weise zugegeben, die sie gleichzeitig einmal mehr dementierte: Es habe eine Mitschuld gegeben – aber nur von seiten einzelner Österreicher, jedoch nicht von seiten Österreichs. Mit anderen Worten, es bleibt dabei: Österreich war ein Opfer. Weil keiner damals die Republik wollte, und weil es sie dann auch gar nicht mehr gab. Nur die Staatsbürger waren Täter. Nicht einmal die Staatsbürger, da es ja den Staat nicht mehr gab, sondern die einzelnen, die da lebten, in dieser Gegend, in diesem Raum, wo erst später, als der Nazi-Spuk vorbei war, wieder ein Staat gegründet wurde, der daher als Staat als unschuldig zu gelten habe.
Es gäbe unzählige solche Beispiele. Aber schon diese beiden zeigen symptomatisch das Dilemma jeglicher österreichischen Selbstreflexion. Ihr Prinzip ist das Entweder-und-Oder, eine unerträglich sich spreizende Verrenkung, mit der versucht wird, von jeder Seite des Widerspruchs ein Zipfelchen zu erhaschen, von den historischen Notlügen einerseits, die man nicht wegdiskutiert haben will, und von der historischen Wahrheit andererseits, die man nicht mehr ganz wegdiskutieren kann. Es wäre ein Irrtum zu glauben, daß die strukturelle Homologie in den Argumentationen zweier so unterschiedlicher Charaktere wie Waldheim und Vranitzky ein Zufall ist. Beide Äußerungen sind logische Konsequenz einer Systemlogik, die jede offizielle oder offiziöse Äußerung der Repräsentanten dieser Republik affiziert. Daß Österreich das Land des Entweder-und-Oder ist, wurde bereits in der Gründung der Zweiten Republik und in der Begründung ihres nationalen Selbstverständnisses angelegt. Die Geschichte von den traumatischen Erfahrungen mit der Ersten Republik, aus denen die Gründer der Zweiten Republik ihre Lehren gezogen haben, ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Tatsache ist, daß die Gründer der Zweiten Republik Repräsentanten einer Generation waren, die, in der Geschichte höchst ungewöhnlich, um nicht zu sagen: einmalig, auf fünf verschiedene politische und staatliche Identitäten eingeschult wurde: von der Habsburger-Monarchie über die Erste Republik, Ständestaat, Nazi-Deutschland in die Zweite Republik. Diese Erfahrung mußte natürlich zu einem tiefen Mißtrauen gegenüber jeglicher eindeutigen, positiv formulierten Identität führen, weshalb alle Gründungspostulate der Zweiten Republik wesentlich negativ abgeleitet waren: Dies soll nie wieder möglich sein und jenes nie wieder passieren können! Und überall dort, wo doch inhaltlich konkrete, positiv bestimmbare Beschlüsse getroffen wurden, wurden sie sofort auch in der Praxis in ihr Gegenteil aufgehoben: Man behielt die nationalsozialistische Legislation weitgehend in Kraft, während man entnazifizierte. Man entnazifizierte und buhlte gleichzeitig unverhohlen um die Stimmen der ehemaligen Nazis. Man stellte die Widerstandstätigkeit österreichischer Kommunisten gegen den Nationalsozialismus gegenüber den Alliierten aus, während man gleichzeitig die Kommunistische Partei innenpolitisch ächtete. Man rekurrierte auf die Leistungen der Habsburger-Monarchie als identitätsstiftenden Faktor und beschloß die Habsburgergesetze. Und so weiter.
Der Staat war gegründet, und man könnte diese Politik des Entweder-und-Oder für eine konjunkturelle politische Pragmatik halten. Aber der Staat war noch nicht souverän. Und wenn man nun untersucht, wie Österreich seine staatliche Souveränität erlangte, wird man feststellen, daß dieses Lavieren zwischen Gegensätzlichem, dieses eklektizistische Verhältnis zu historischen Widersprüchen, diese Angst vor eindeutiger politischer Selbstdefinition aus tief verwurzelter Angst vor den Wechselfällen der Geschichte zum Fundament der Unabhängigkeit Österreichs wurde, und damit zur Basis jeder weiteren politischen Praxis bis heute. Die Politik des Entweder-und-Oder hatte System und wurde systembegründend.
Zur Erlangung der staatlichen Unabhängigkeit war der Nachweis unabdingbar, daß Österreich eine eigene Nation sei. Nur dadurch nämlich war der Wunsch nach staatlicher Souveränität wohlbegründet und jeder Verdacht auf weitere Anschlußgelüste an Deutschland ausgeräumt.
Meines Wissens ist die Zweite Republik Österreich der einzige Nationalstaat, der sich zu seiner Nationswerdung entschlossen hat und, das ist gewiß einmalig, dessen Nationswerdung wesentlich außenpolitische Gründe hatte. Innenpolitisch gab es keine zwingende Tendenz zur Selbstdefinition als eigene Nation. Noch 1956 waren bei einer Meinungsumfrage 46% der Bevölkerung der Meinung, daß Österreicher »zum deutschen Volk gehören«. Man kann sich vorstellen, wieviel höher der Prozentsatz zehn Jahre vorher, noch vor Einsetzen der massiven Nations-Propaganda, gewesen ist. Der Satz »Wir sind eine Nation« bedeutete also, ins österreichische Deutsch übersetzt, zunächst nichts anderes als: »Dürfen wir wohl so frei sein, frei zu sein?«
Um diese Freiheit zu erlangen, wollte sich Österreich nicht nur auf sein diplomatisches Geschick verlassen, sondern vergewisserte sich all seiner Ressourcen. Das ist zwar selbstverständlich, zeigt aber in der besonderen Form, wie dies geschah, eine weitere Eigentümlichkeit der österreichischen Nationswerdung: Im Jahr 1946 beschloß ein kleiner innerer Kreis der österreichischen Regierung (Bundeskanzler, Vizekanzler, Außen- und Innenminister), die wertvollsten österreichischen Kunstschätze aus allen Wiener Museen abzuziehen und in den Westen zu evakuieren. Der Grund für diese mit den westlichen Alliierten akkordierte Aktion war, daß noch zu befürchten stand, die Sowjetunion könnte versuchen, ihre österreichische Zone dem Ostblock einzuverleiben und Österreich dadurch zu teilen. In diesem Fall sollte eine österreichische Exilregierung durch den Verkauf dieser Kunstschätze über ausreichend Kapital verfügen, »um die nationalen Interessen Österreichs mit Nachdruck in der Welt vertreten und durchsetzen zu können«. Die Kunstschätze wurden zunächst in die Schweiz gebracht, unter dem Vorwand, sie würden dort als Dank für die Schweizer Nachkriegshilfe ausgestellt, in der Folge wurden sie auf Wanderausstellung durch Westeuropa und schließlich in die USA geschickt, von wo sie erst 1954 zurückkehrten, als der Abschluß des Staatsvertrages absehbar war. Diese Geschichte zeigt, daß Österreich, noch bevor es im politischen Sinn eine Nation wurde, bereits eine Kulturnation war – insofern, als man sich eines kulturellen Nationalvermögens bewußt war, nämlich der geerbten Kulturgüter und Kunstschätze, und auch bereit war, diese zur materiellen Basis der durchzusetzenden Staatsnation zu machen. Die entsprechenden vorsorglichen Aktivitäten der damaligen Regierung waren nicht nur sehr weitblickend, in ihrem notwendigen Changieren zwischen Kulturnation und Staatsnation sind auch schon alle Eigentümlichkeiten des Nationsbegriffs und der nationalen Identität angelegt, die Österreich in der Folge herausbilden sollte.
Es gab und gibt ja bekanntlich zwei »klassische« Nationsbegriffe: den aus der deutschen romantischen Tradition, der Nation wesentlich als Sprach- und Kulturgemeinschaft versteht, und den im Sinne der französischen revolutionären Tradition, der zufolge eine Nation nichts anderes ist als ein Staat, der vom kollektiven Wunsch gebildet wird, jedem einzelnen die bürgerlichen Freiheiten und Rechte zu garantieren.
Natürlich verbot sich der deutsche Nationsbegriff von selbst. Man setzte also zunächst massiv auf den französischen Nationsbegriff und propagierte die Idee einer österreichischen Nation, die wesentlich durch den kollektiven Willen der Bevölkerung zu Freiheit und Unabhängigkeit gebildet werde. Zugleich rekurrierte man, in Hinblick auf die Bundesrepublik Deutschland, von der man sich propagandistisch noch klarer unterscheiden wollte, auch wieder auf den deutschen Nationsbegriff, allerdings um ihn gegen die Deutschen zu wenden: Es wurden kulturelle Besonderheiten Österreichs im Unterschied zu Deutschland geltend gemacht, ein Argument, das innenpolitisch als »Mentalitätsunterschiede« wiederkehrte und durch die Anti-»Piefke«-Ressentiments, die es in Österreich nach 45 gab, verstärkt wurde. In den Schulen wurde damals sogar der Begriff »Deutsch« durch den Begriff »Unterrichtssprache« ersetzt.
Man spielte mit diesen Anti-»Piefke«-Ressentiments und propagierte die Idee einer österreichischen Nation, deren kulturelle Eigenart sich historisch aus dem Verschmelzen mannigfacher Einflüsse aus den ehemaligen österreichischen Kronländern entwickelt habe, und bestand gleichzeitig gegenüber den nun in Österreich lebenden Minderheiten auf der deutschen Sprachgemeinschaft als Basis für nationale Identität. Man gestand Sprache und Geschichte als konstitutiv für nationales Selbstgefühl zu und mußte das forcierte nationale Selbstgefühl ununterbrochen von sprachlichen Fallen und historischen Verbindlichkeiten reinigen: Die Propagierung der »österreichischen Nation« vermied tunlichst das zugehörige Adjektiv »national«, um nicht irrtümlich in den Anruch großdeutscher Propaganda zu kommen (es ist überaus lehrreich, die diesbezüglichen sprachlichen Windungen und Wendungen im Neuen Österreich, der damaligen Regierungszeitung, nachzulesen), und die Verweise auf die große österreichische Geschichte umgingen konsequent jegliche Auseinandersetzung mit den personellen und strukturellen Kontinuitäten aus der NS-Zeit.
Post festum kann man aber sagen: Es hat funktioniert. Österreich hat seine Souveränität erhalten, die Jahrzehnte der staatlichen Unabhängigkeit haben zweifellos eine zwar schwer bestimmbare, aber doch irgendwie deutlich empfundene eigenständige Mentalität hervorgebracht, und daß Österreich eine Nation sei, steht heute auch innenpolitisch so wenig in Frage wie außenpolitisch. Meinungsumfragen zufolge stimmen bereits rund neunzig Prozent der Österreicher dem Satz zu, daß Österreich eine eigene Nation sei. Damit übertrifft die allgemeine Zustimmung der Österreicher zu einer Nation Österreich prozentual sogar die Zustimmung der Franzosen zur Nation Frankreich. Zugleich aber zeigen die Meinungsumfragen, daß niemand in Österreich verbindlich zu sagen wüßte, was eine Nation eigentlich sei bzw. worin die nationalen Eigenheiten Österreichs konkret bestünden. Das ist, in Anbetracht des österreichischen Nationalgefühls, nicht verwunderlich: Es besteht ja tatsächlich aus nichts Bestimmtem, besser gesagt, es besteht aus der wechselseitigen Aufhebung der klassischen Nationsbestimmungen. Es besteht aus Entweder-und-Oder. Wir sind eine deutsche Sprachgemeinschaft, die sich von der deutschen Sprachgemeinschaft distanziert. Wenn wir im Ausland Deutsch sprechen, weisen wir darauf hin, daß wir Österreicher sind, und erwarten, daß wir besser behandelt werden als die Deutschen. Wir sind, von der Entstehungsgeschichte her, eine Kulturnation, die bereit war, ihre Kulturgüter zu verkaufen, falls dies notwendig gewesen wäre, um eine Staatsnation zu werden. Wir sind eine Staatsnation geworden, die auf den politischen Implikationen dieses Begriffs aber nicht besteht, sondern, da wir unsere Kunstschätze zum Glück doch nicht verkaufen mußten, sich lieber als Kulturnation präsentiert. Wir definieren uns zwar auch über unseren Willen zu den bürgerlichen Freiheitsrechten, messen ihnen aber zugleich nicht unbedingt Bedeutung zu, wenn es darum geht, sie anderen zuzugestehen. Wir sind daher solidarisch mit allen, die sie haben, wir sind also zum Beispiel solidarisch mit Südtiroler Hoteliers, demontieren aber die Ortstafeln der in Österreich lebenden Slowenen, bieten Grenzschutz auf gegen asylsuchende Rumänen oder erlassen Aufenthaltsgesetze, die es ermöglichen, Menschen, die seit vielen Jahren hier gelebt und gearbeitet haben, plötzlich auszuweisen. Wir definieren uns über unsere Kultur und unsere Geschichte, und unsere Kultur besteht aus einem selektiven Umgang mit Geschichte, und Geschichte ist für uns die herzeigbare geerbte Kultur. Wir sind neutral, aber wir haben unsere Verpflichtungen, weshalb wir über Nacht Gesetze ändern, um die Durchfuhr von Kriegsmaterialien durch unser Land zu ermöglichen, ohne unsere Neutralität zu verletzen. Wir sitzen vor dem Fernsehgerät und sehen im »Club 2« eine Diskussion, in der Jörg Haider unwidersprochen den Nationsbegriff ausschließlich im Sinn von »Sprach- und Kulturgemeinschaft« verwendet, bis er schließlich sogar Simon Wiesenthal dazu bringt »zuzugeben«, daß auch er, Simon Wiesenthal, der »deutschen Nation« angehöre, und wir wissen: Hier sind wir zu Hause. Wir halten Jörg Haider wegen seiner Aussagen zur österreichischen Nation und zum Nationalsozialismus als Landeshauptmann von Kärnten für untragbar, aber wir halten ihn schon am nächsten Tag als Landeshauptmannstellvertreter für tragbar. Kurz gesagt, Österreich ist ein Paradebeispiel für die Hegelsche Definition von Identität, der zufolge Identität nichts anderes sei als die Identität mit der Nicht-Identität. Mit anderen Worten: Wir sind ehrlich davon überzeugt, nicht zu lügen, solange wenigstens das Gegenteil wahr ist.
Allerdings: Durch diese wechselseitige Aufhebung der beiden klassischen Nationsbegriffe ist tatsächlich so etwas wie eine spezifische nationale Eigenheit entstanden: Österreichische Nation – das ist gleichsam der dritte Nationsbegriff.
Man kann empirisch belegen, daß es keine signifikante Anzahl von Österreichern gibt, die zum Begriff österreichische Nation die Implikationen des Begriffs Staatsnation assoziiert, etwa »kollektiver Wille zur Garantie der bürgerlichen Freiheitsrechte jedes einzelnen«. Andererseits ist durch die forcierte Abgrenzung von Deutschland nichts vom Deutschnationalismus, aber auch kaum etwas von den konstitutiven Elementen des deutschen romantischen Nationsbegriffs übriggeblieben. Der Satz etwa: »Wir sind eine Nation, weil wir alle dieselbe Sprache sprechen« kommt jedem Österreicher, egal auf welcher Seite des weltanschaulichen Spektrums, komisch vor. Jene Meinungsumfrage, die ein repräsentatives Sample von Österreichern bat, den Satz »Wir sind eine Nation, weil …« zu ergänzen, erhielt in überwältigender Mehrzahl bloß tautologische Antworten, wie zum Beispiel: »Wir sind eine Nation, weil wir alle Österreicher sind!«
Alle negativen Erfahrungen, die dieses Land in seiner Geschichte mit der Idee des Nationalstaates und dem Nationalismus gemacht hat – von den Nationalitätenkonflikten der Habsburger-Monarchie über den operettenhaft inszenierten Österreich-Patriotismus des Ständestaates bis zum Nationalsozialismus –, sind in diesem aus Aufhebungen zusammengesetzten neuen österreichischen Nationsbegriff erlöst. Andererseits: Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Geschichte erweist sich die inhaltliche Unbestimmtheit des österreichischen Nationsbegriffs als seine wesentliche inhaltliche Bestimmung: Wo nichts ist, kann auch keine Schuld sein.
Als Adolf Eichmann im Jahr 1960 vom israelischen Geheimdienst verhaftet wurde und seinem Prozeß entgegensah, machte sich die österreichische Regierung wegen der Konsequenzen Sorgen, die es hätte, wenn Eichmann als Österreicher verurteilt wird. Man fand eine einfache und schlüssige Lösung: Eichmann wurde die österreichische Staatsbürgerschaft, also seine Nationalität, aberkannt. Fünf Jahre nach der Erlangung der staatlichen Souveränität hat die Zweite Republik Österreich bereits die innovative Bedeutung seines Nationsbegriffs demonstriert: nämlich eine Staatsnation zu sein, die ihren Bürgern historische Unschuld garantiert.
Dieser Nationsbegriff prädestinierte Österreich nun in besonderer Weise für einen Beitritt in die EU. Er ermöglichte Österreich nämlich, in aller Unschuld diesen Schritt zu tun, der nach den geschichtlichen Erfahrungen dieses Landes so problematisch erscheint wie für keine andere Nation. Denn der Widerspruch zwischen den Allüren, etwas ganz Besonderes zu sein, und der Sehnsucht, in einem größeren Zusammenhang aufzugehen, hat Österreich schon einmal zerrissen. Das in der Zweiten Republik aber herausgebildete Nationalgefühl hat auch diesen Widerspruch nach dem Entweder-und-Oder-Prinzip synthetisiert, so daß er nicht mehr als Widerspruch empfunden wird: Bei einer Meinungsumfrage zum Thema »Österreichbewußtsein« im Jahr 1984 gaben sechzig Prozent der Befragten an, daß »Österreich eine besondere Rolle in Europa« spiele, während gleichzeitig sage und schreibe rund fünfzig Prozent schon damals glaubten, daß Österreich bereits EU-Mitglied sei.
3.
In einem Märchen erzählt der österreichische Dichter Joe Berger von einem Brathühnchen, einem Backhähnchen und einem Hirschrücken, die einander in einem Restaurant treffen. Die drei unterhalten sich miteinander und versuchen mit Geschichten aufzutrumpfen, die zeigen sollen, wie stark, selbstbestimmt und erfolgreich ihr Leben sei. Nach einer Weile aber ruft der Hirschrücken den Oberkellner und sagt: »Bitte, wenn Sie uns servieren würden; wir wollen unsere Hungrigen nicht warten lassen.«
In einem Land, in dem Märchen und Legenden konstitutiv für dessen politische und gesellschaftliche Verfaßtheit und für das Selbstverständnis und die Identität der Bevölkerung wurden, sind literarische Märchen natürlich genuin realistisch.
Deutlich wurde dies etwa bei der Diskussion über eine Änderung des österreichischen Staatswappens, die Ende 1991/Anfang 1992 Vertreter aller Parteien bis hin zu Bundespräsident und Bundeskanzler erfaßte, bis schließlich der Grün-Abgeordnete Peter Pilz den Vorschlag machte, den Adler im Wappen durch ein Backhendl zu ersetzen.
Natürlich war alles falsch, was in dieser Diskussion geäußert wurde, genauso unsinnig, wie die selbstgefälligen Lügen, die Brathühnchen, Backhähnchen und Hirschrücken einander im Restaurant erzählen.
Das Ausland – so wurde argumentiert – werde es nicht verstehen, daß Österreich, nach dem Bankrott der Sowjetunion und nachdem deren Nachfolgerepubliken alle kommunistischen Symbole aus ihren Wappen und Flaggen entfernt haben, als einziges Land der Welt an Hammer und Sichel in seinem Staatswappen festhalte.
Natürlich war nicht gemeint, daß die »kommunistischen Symbole Hammer und Sichel« im österreichischen Staatswappen durchaus dem österreichischen Selbstverständnis weiterhin entsprechen würden, wenn die Sowjetrepublik nicht bankrott gemacht hätte. Aber abgesehen davon, war auch falsch, was durchaus gemeint war: »Das Ausland« – ohne es jetzt näher bestimmen zu wollen – hat wahrlich andere Sorgen als das österreichische Wappen. Und das österreichische Wappen enthält keine »kommunistischen Symbole«; es besteht aus einem Adler, der mit den Symbolen der »drei Hauptstände« der Gesellschaft »gewaffnet« ist, wie es im österreichischen Staatswappengesetz heißt: Mauerkrone, Hammer und Sichel, die für Bürger, Arbeiter und Bauern stehen. Nun mögen Hammer und Sichel, so sie gekreuzt sind, ein kommunistisches Symbol sein, die Trias Mauerkrone, Hammer und Sichel ist gewiß kein kommunistisches Symbol. Zu behaupten, daß diese Trias ein kommunistisches Symbol enthalte, ist so absurd, als würde man sagen, daß die rot-weiß-rote österreichische Fahne zweimal die kommunistische rote Fahne und die österreichische Bundeshymne in der Zeile »Land der Hämmer« ein halbes kommunistisches Emblem enthielten.
Und doch enthüllt die Wappendiskussion eine tiefe österreichische Wahrheit, und zwar in der Tatsache, daß es ein äußerer Anlaß war, der diese Diskussion auslöste, und daß es das Ausland ist, auf das sie sich bezieht. Die Wahrheit ist, daß es in Österreich eine tiefverwurzelte Angst gibt, daß dem Ausland der Appetit auf Österreich plötzlich vergehen könnte. Österreichische Politiker sind daher immer wieder in der Situation des Hirschrückens, dem plötzlich einfällt, daß draußen die Hungrigen warten. Dieser Sachverhalt ist sogar im österreichischen Wappen enthalten, allerdings hat es keiner bemerkt. Und schon den Republikgründern ist offenbar entgangen, welch peinliche Wahrheit sich in diesem Wappen in Wahrheit versteckt:
Am 1. Mai 1945 beschloß das Parlament der neugegründeten Republik Österreich das Gesetz über Wappen, Farben, Siegel und Embleme, kurz: das sogenannte »österreichische Wappengesetz« (StGBl. 7). Artikel 1 (1) lautet: »Die Republik Österreich führt das mit Gesetz vom 8. Mai 1919, StGBl. Nr. 257, eingeführte Staatswappen …« Die Gründe dafür, daß die Zweite Republik das Staatswappen der Ersten Republik wiedereinführte, scheinen zunächst unmittelbar einsichtig: Die Zweite Republik war zwar ein neugegründeter Staat, aber er war nicht aus dem historischen Nichts entstanden. Die Wiedereinführung des Staatswappens der Ersten Republik sollte ausdrücken, worin sich dieser Staat historisch verwurzelt sah, nämlich im Besten der österreichischen Geschichte, seiner zwar kurzen, aber immerhin doch existierenden republikanischen Tradition. Tatsächlich war und ist dieses Staatswappen insofern ein genuin republikanisches, da es in dieser Form weder vor der Ersten Republik noch während des autoritären Ständestaates und natürlich auch nicht während der Nazi-Herrschaft existiert hatte. Die Symbole des Wappens sind zwar weder kühn noch originell, aber für die Republik durchaus sinnig: Der einköpfige Adler ist historisch das Symbol für republikanische Staatsgewalt, und er trägt Mauerkrone, Hammer und Sichel, die Bürger, Arbeiter und Bauern symbolisch darstellen.
Dieses Wappen erschien also als inhaltlich sinnvoll, in der österreichischen Geschichte verwurzelt und dennoch nicht belastet und wurde daher 1945 ohne weitere Diskussion wiedereingeführt, mit der bekannten kleinen Ergänzung, daß »zur Erinnerung an die Wiedererringung der Unabhängigkeit Österreichs und den Wiederaufbau des Staatswesens (…) eine gesprengte Eisenkette die beiden Fänge (des Adlers) umschließt«.
Natürlich ist es bedauerlich, daß es 1945, weil alles so unmittelbar logisch und einsichtig schien, zu keiner Diskussion über dieses Wappen gekommen ist. Dadurch hatte nämlich der Gesetzgeber, ohne es zu bemerken, der Republik gewissermaßen ein Ei gelegt, das Kuckucksei, auf dem der Adler heute noch brütet. Um dieses Ei im österreichischen Wappen zu sehen, müssen wir uns nun mit dessen verdrängter Entstehungsgeschichte beschäftigen.
Es wird behauptet, daß es auch 1919 keine Diskussion in Hinblick auf die Gestaltung des österreichischen Staatswappens gegeben habe. Die Erste Republik habe innenpolitisch unter dem Druck der Kommunisten und radikalen Sozialisten, außenpolitisch unter dem Druck der kommunistischen Räterepubliken in Bayern und Ungarn gestanden. Dies sei der Grund, warum Hammer und Sichel ins Wappen der ersten Republik, gleichsam in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, Eingang gefunden hätten. Diese Behauptung ist schlicht falsch. Es gab zwar keine Debatte nach Einbringung des Staatswappengesetzes im Parlament, aber es gab eine intensive, ja hitzige Diskussion vor der Einbringung und Lesung des Gesetzesentwurfes. Und diese Diskussion ist wahrlich interessant: In der Phase der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfes plädierte Wilhelm Miklas, der Verhandlungsleiter der christlichsozialen Fraktion, dafür, die österreichischen Landesfarben Rot-Weiß-Rot zu den Staatsfarben der Republik zu machen. Karl Renner, für die Sozialisten, war dagegen. Er argumentierte, daß die Republik mit dem programmatischen Namen Deutsch-Österreich alleine nicht lebensfähig und daher der baldmögliche Anschluß an Deutschland zu suchen sei. Es wäre daher sinnvoller, der Republik sofort die deutschen Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold zu geben, zumal »die Wahl der Farben Schwarz, Rot und Gold tatsächlich die nationale Zusammensetzung der Republik Deutschösterreich versinnbildlicht«, wie der österreichische Staatsrat bereits am 31. Oktober 1918 festgehalten hatte. Nach einiger Diskussion, in der natürlich auch außenpolitische Rücksichten eine Rolle spielten, einigten sich die Führer der beiden großen Parteien auf einen Kompromiß: Die österreichische Staatsflagge sollte Rot-Weiß-Rot, das österreichische Staatswappen aber Schwarz-Rot-Gold enthalten. Allerdings mußte Renner auch hier noch weiter, als ihm lieb war, zurückstecken. Sein ursprünglicher Antrag, daß also »das Staatswappen aus einem Stadtturm aus schwarzen Quadern, gekreuzten Hämmern in Rot, umgeben von einem goldenen Kranz von Ähren« zu bestehen habe, die zugleich auch »die drei Hauptklassen der Gesellschaft symbolisch darstellen« würden, konnte Miklas auch nicht begeistern. Er vermißte das Symbol für die Staatsgewalt – man einigte sich also auf den Adler. Die »drei Hauptklassen« machten Miklas auch nicht glücklich, er sprach von den »Hauptständen«, eine Formulierung, die er auch für die letzte Formulierung des Gesetzes durchsetzte. Zwei Hämmer fand Miklas zu viel, das würde die Stärke und Bedeutung der Arbeiterschaft überrepräsentieren – man einigte sich auf lediglich einen Hammer. Und der Ährenkranz sei, wie der Christlichsoziale Miklas wußte, Symbol lediglich für den Erntedank, nicht aber für die Arbeit der Bauern – weshalb er als Symbol für die bäuerliche Arbeit eine Sichel durchsetzte. Der Kompromiß sah also letztendlich so aus: »Das Staatswappen der Republik Deutsch-Österreich besteht aus einem freischwebenden, einköpfigen, schwarzen, rot gezüngelten und golden gewaffneten Adler«, und die »Waffnung« sind eben die drei bekannten Ständesymbole Mauerkrone, Sichel und Hammer.
Im Parlament gab es in der Folge keine Diskussion mehr, wie das immer so ist, wenn die Gesetzesvorlage ein schon vorher ausgehandelter Kompromiß der Fraktionsführer ist.
In der, dank Renner, schwarzrotgoldenen Farbsymbolik des österreichischen Wappens sind bis heute die österreichischen Anschlußgelüste an Deutschland enthalten – ohne daß dies jemals problematisiert, geschweige denn zu ändern vorgeschlagen wurde. Gegenüber der Farbsymbolik des österreichischen Wappens ist das offizielle Österreich offenbar blind. Aber die vom christlichsozialen Politiker Miklas gegen die Vorstellungen der österreichischen Sozialisten durchgesetzten Ständesymbole Sichel und Hammer sind den österreichischen Konservativen fünfzig Jahre später ein Dorn im Auge – wahrlich symbolisch für die aktuelle Verfaßtheit der Zweiten Republik und für das heute in Österreich herrschende Bewußtsein ist wohl erst dieser Sachverhalt. Er ist auf so rätselhafte Weise typisch österreichisch wie die Tatsache, daß es ausgerechnet der Ständestaat war, der die Ständesymbole aus dem österreichischen Wappen tilgte. Erscheint Vranitzky, Klestil, Waldheim und all den anderen, die sich für die Entfernung der Ständesymbole aus dem Wappen aussprachen, das Wappen des Ständestaats für die Zweite Republik gemäßer als das Wappen der Ersten Republik? Dann aber sollte man wirklich aufs Ganze gehen: Im Ständestaat wurde dem Adler auch ein Heiligenschein verpaßt – und der wäre ohne Zweifel für die heutige Verfaßtheit Österreichs stimmig, denn er würde symbolisieren: Wir sind nicht von dieser Welt.
4.
Als die Zweite Republik ihre staatlichen Symbole diskutierte, sich fragte, ob das eine oder andere überhaupt noch stimmig sei oder nicht besser entfernt bzw. durch anderes ersetzt werden sollte, wurde ein bestimmtes Symbol für die Verfaßtheit der Zweiten Republik nie in Frage gestellt. Wahrscheinlich zu Recht. Es ist zwar kein offizielles Symbol, aber doch ein allgemein bekanntes, und offenbar hat sich an dessen Stimmigkeit nichts geändert. Ich meine den Punschkrapfen. Was ist ein Symbol? Laut Wörterbuch ein einfaches Sinnbild, das auf einen komplexen Zusammenhang verweist. Der Punschkrapfen ist ein unmittelbar einsichtiges Beispiel. Er ist außen rosa, innen braun. Man könnte die Beschreibung noch durch den Hinweis sinnvoll präzisieren, daß der Konditor die braune Füllung in der Regel aus Resten gewinnt, die er durch Alkohol gewissermaßen neutralisiert. Daß der Punschkrapfen als Symbol für die Zweite Republik gelten kann, funktioniert nur auf der Basis von zwei Voraussetzungen: Erstens ist der Punschkrapfen tatsächlich ein zwar unwesentlicher, aber doch irgendwie typischer Bestandteil der österreichischen Lebensrealität. Zweitens muß dessen Beschreibung zumindest ein minimales historisches Wissen ganz selbstverständlich evozieren, in diesem Fall die historische Bedeutung der Farbe Braun. Natürlich weiß jeder, auch wenn er von österreichischer Geschichte nichts weiß oder nichts mehr wissen will, weil einmal Schluß sein muß, daß es dieses unrühmliche bzw. finstere Kapitel, den Faschismus, in der österreichischen Geschichte gegeben hat, und erst unter dieser Voraussetzung entfaltet der Punschkrapfen als Symbol sein Verweissystem auf die komplexeren aktuellen Realzusammenhänge.
Aus einem weiteren Grund kann der Punschkrapfen als ein besonders geglücktes Symbol gelten: Es kann von den einen als kritisches Symbol verstanden werden und dabei von den anderen immer noch eine augenzwinkernde Zustimmung erhalten. Der Punschkrapfen ist dadurch gewissermaßen ein Idealsymbol, weil es einen realen gesellschaftlichen Widerspruch und reale Polarisierung genauso ausdrückt wie die ebenso reale allgemeine einhellige Zustimmung zu Österreich.
Natürlich tun sich, wenn wir darüber nachdenken, Abgründe auf. Aber es wäre nicht Österreich, wenn nicht unten am Grunde des Abgrunds ein Kurhotel stünde.
Stellen wir uns nun vor, daß wir uns in einem Zimmer dieses Hotels befinden. Wir blicken aus dem Fenster. Es ist natürlich »ein Fenster ohne Aussicht«. Denn vor dem Fenster ragt die Felswand des Abgrunds empor. Was tun? »Man könnte zum Beispiel sich bemühen, der Felswand Anregungen zu entnehmen, Spuren zu entziffern, Analogien zu finden in den Rissen, Schrunden und Buckeln des Reliefs einer Landschaft. Die Felswand ist ungefähr einen Meter vom Fenster entfernt. Sie hat schimmelfarbene und rosa Flecken in feuchtem Braunschwarz wie die Füllung eines Punschkrapfens. Die Draperie des Fensters erinnert an Tortenpapier.«
So beginnt das Romanfragment Katzenmusik von Gerhard Fritsch. Er hat 1968/1969 daran gearbeitet und es blieb durch seinen Tod unvollendet. Es ist 1974 erschienen, aus dem Nachlaß herausgegeben von Alois Brandstetter.
Fritsch versucht sich eine Hauptfigur vorzustellen, er nennt sie Swedek, und sieht »Tortenpapier. Wie es an Punschkrapfen klebt, aus Sargfugen sich spreizt, um Altäre getan, von Serviermädchen umgebunden wird.« Er kann an Swedek nicht denken, ohne ihn sich vorzustellen, wie er in Punschkrapfen beißt. Und noch in der Felswand vor dem Fenster sieht er die Füllung eines Punschkrapfens. Diese Introduktion ist natürlich programmatisch. Aus ihr purzeln die Assoziationen und Verweise schneller heraus, als wir mit dem Lesen innehalten können. Wieso ist ein Fenster, vor dem sich eine Felswand befindet, ein »Fenster ohne Aussicht«? Ist der Blick auf eine Felswand keine Aussicht? Wieso gibt der Blick auf diese Felswand das Gefühl von Aussichtslosigkeit? Weil die Felswand an die Füllung eines Punschkrapfens erinnert, also daran, wo wir uns wirklich befinden, ohne Chance zu entkommen? Aber wie sehr kann eine Felswand tatsächlich an einen Punschkrapfen erinnern? Ist es möglich, daß die Geschichte, die wir aus unserem Bewußtsein gestrichen haben, sich hinterrücks in die Landschaft eingeschrieben hat? Oder doch nicht, und wir sehen sie nur in allem Unschuldigen, weil wir sie von uns abgestreift haben, um selbst als Unschuldige gesehen werden zu können? Wie lange kann die Kindheit oder Jugend einer Generation fortwirken, wie lange bleibt eine Vorgeschichte wirksam, wenn diese Generation in die besten Jahre gekommen ist und mittlerweile auf eine ganz andere Geschichte zurückblicken kann, auf eine, durch die alles, was davor war, aufgehoben wurde? »Aufgehoben« in welchem Sinn? Das Zimmer, in dem wir uns mit Swedek befinden, »riecht nach Naphthalin«, schreibt Fritsch. »Auch wenn man das Fenster aufmacht, riecht es so. In den Gängen riecht es so, in den Wiesen, im Wald. Hier ist Kindheit eingemottet.« Wie verläßlich ist dieser Eindruck? Eine andere Figur des Romans, Pepi Herzlich (»Eigentümer der Kuranstalt Dr. Herzlich, Kategorie B«), findet diesen Eindruck absurd. »Bei uns verwendet seit langem niemand mehr Naphthalin. Ein Wald, der nach Naphthalin riecht! Sie sollten einmal mit Kollege Frankl sprechen«, sagt er.
1969 geschrieben! – Aber die letzten Beispiele dafür, daß ein Fall von Kritik als kritischer Fall empfunden wird und zur Aufforderung führt, sich an einen Arzt zu wenden, sind nicht so lange her. Und Pepi Herzlich protestiert beim Autor: »Wollen Sie mich umfunktionieren? Das habe ich hinter mir, lieber Freund. Ich habe mich selbst umfunktioniert.«
Der Roman Katzenmusik