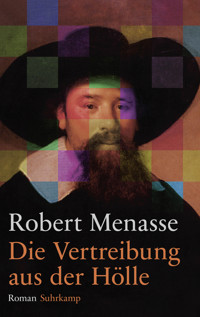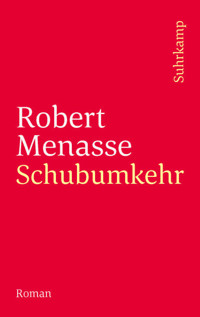16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die »Bar jeder Hoffnung« in São Paulo: Hier, beim Kneipier Oswald, einem Wiener, treffen sich regelmäßig deutsche und österreichische Emigranten, die redselig und zuckerrohrschnapssüchtig von ihren Erlebnissen erzählen, »so als hinge ihr Lehen davon ab, daß es erzählt werden könne«. Die Bewußtseinszustände der Trinker waren schon postmodern, als es den Begriff »Postmoderne« noch gar nicht gab. Ihre Erlebnisse und Erzählungen erweisen sich als Wiederholungen von so noch nicht Dagewesenem, sind Farben ohne vorangegangene Tragödien, gleichsam Originalkopien. Aber kann das, was einer wirklich erlebt hat, eine Fälschung sein? Oder sind es die Zusammenhänge, die gefälscht sind? Süchtig sucht Roman, der Ich-Erzähler, das Authentische: in den Abenteuern mit Frauen, in Alkoholexzessen, in den Vorträgen des »Bar-Professors« Singer. Aber alles, was bleibt, ist die Gewißheit, etwas vergessen zu haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Robert Menasse
Sinnliche Gewißheit
Roman
Suhrkamp
Este livro é dedicado a Judith Katz.
Espere-nos no Nada,
reserve uma mesa
e aí estaremos no grande bar da eternidade.
HIER IST nicht Einfried, das Sanatorium.
Mein Vater war kein Kaufmann.
Lange Zeit schon bin ich nicht mehr früh schlafen gegangen.
Draußen im Garten strichen die Palmenblätter sanft scharrend über den Wind, wie die langen Fingernägel einer Frau über ein bügelfreies Hemd. Von der Straße hörte man die tiefen, monotonen Pfiffe des Nachtwächters und das leise Scheppern seines alten Fahrrades. Ein Hund kläffte, ein anderer stimmte zornig oder verspielt ein. Irgendwo schrie jemand: »Still!«
Eine Grille imitierte das rhythmische Knarren eines alten Bettes, das ruhelos geisterhafte Echo auf alle Liebesmüh, die ohne Erlösung geblieben ist. Man hörte ein Auto mit quietschenden Reifen in die Straße einbiegen, ein Schuß fiel, und das Pfeifen des Nachtwächters erstarb.
Doch dann setzte es wieder ein, sich entfernend. Nur vage erinnerte die Fehlzündung eines Autos an den Krieg, der außerhalb dieses Viertels herrschte.
Granja Julieta, ein Villen- und Gartenbezirk in São Paulo, Mauern oder Gitter um die Häuser, Scherengitter vor den Fenstern, vergitterte Privatparkplätze, einige große weiße Apartmenthäuser mit Wächterhäuschen und wieder Mauern, ein dichtes Gittersystem, das zusammen mit den Gittersystemen anderer guter Viertel einen Käfig um die schäbigen, armen Teile der Stadt bildete, so daß nicht die Verschanzten, sondern die Ausgesperrten gefangen sind.
Hier wohnte ich, in einer Villa deutscher Einwanderer, in Untermiete.
Ich lag bekleidet auf dem Bett und rauchte, zu müde und zuwenig müde, um mich auszuziehen. Der Zigarettendunst erinnerte mich nicht besonders, aber doch ein wenig an die russische Literatur, vielleicht, vielleicht auch nicht, weil Rußland so weit weg war, wie der Ort, an dem ich mich befand.
Ich stand auf und schaute aus dem Fenster. Im Vorgarten vor dem Haus sah ich einen hellen Schatten, die Katze.
Auf der Straße, schräg gegenüber, sah ich Maria, die schwarze Empregada meiner Hausherren, unter einem Baum stehen mit einem Mann, der sie küßte, ohne dabei eine prall gefüllte Plastiktasche, die er in der Linken hielt, abzustellen. Vor einigen Tagen erst war Maria schreiend und weinend aus dem Haus gelaufen, des Diebstahls bezichtigt, heute war sie demütig mit niedergeschlagenem Blick zurückgekehrt, um, nochmals ihre Unschuld beteuernd, wieder um ihre Anstellung zu bitten. Großherzig hatte ihr die Hausfrau, Dona Ilse, meine Vermieterin, verschwiegen, daß sie den vermißten Gegenstand inzwischen wiedergefunden hatte. Der Mann trug einen grünen Pullover, der in der Dunkelheit wie Phosphor schimmerte. Er preßte nun die Faust, in der er noch immer diese Plastiktasche hielt, an die Hüfte Marias, die ihre schwarze Hand auf das weiße Plastik legte, so als wäre die Tasche etwas, das unabtrennbar zu ihrer Liebe gehörte, zumindest zu ihren Körpern, die zum Körper eines seltsamen Beuteltiers verschmolzen.
Ich beschloß, noch auszugehen.
Ich hatte einen mit Alkohol betriebenen VW Brasilia. Seine müden Alkoholausdünstungen stimmten mich langweilig auf die Bar ein, die ich nun aufsuchte. Ich hatte es nicht weit bis zur Avenida Adolfo Pinheiro zur Bar Esperança, die einem Österreicher gehörte und die von der Handvoll Österreicher, die dort verkehrte, Bar jeder Hoffnung genannt wurde.
Die Bar jeder Hoffnung war nur für den leicht zu finden, der sie kannte. Sie befand sich in einem von der Straße zurückversetzten Haus, einer scheinbar alten, aber eigentlich nur heruntergekommenen Villa, deren Kolonialstilmaskerade sie herrschaftlich erscheinen lassen sollte, während sie zugleich auch knechtisch wirkte, so klein, geduckt und zurückgezogen, wie sie dastand. Auf der Fläche zwischen dem Haus und der Straße befanden sich einige mächtige Bäume, die das Schild mit dem Namen der Bar verdeckten und die nur wenig von dem Licht durchschimmern ließen, das dieses Schild beleuchtete.
Ich trat ein in die Bar, so wie man auf ein Terrarium zutritt und hineinschaut.
Die Holztische mit den alten Thonetsesseln, auf denen die Gäste saßen, statisch wie Statisten.
Links stand die große, alte, verspiegelte und wieder erblindete Vitrine. Ein einstiger Stammgast, ein heute bekannter brasilianischer Maler, hatte einmal auf die Spiegel der Vitrine all das aufgemalt, was sich in ihnen eigentlich spiegeln müßte. Das Spiegel-Bild wirkte, wenn man nicht unmittelbar davor stand, täuschend echt, übte aber durch seine Statik eine regulative Wirkung auf die Gäste aus: wenn etwa einer aufstand und dabei den Stuhl verrückte, brachte er ihn wieder intuitiv in die Position, die mit dem Spiegel-Bild übereinstimmte. Und wenn er es nicht tat, dann machte es beiläufig ein anderer, immer jedoch waren es die Österreicher, die eine Diskrepanz zwischen dem Raum und seiner Abspiegelung am meisten beunruhigte.
Auf der rechten Seite stand der alte, große Bücherkasten, auf dessen Regalbrettern die Spirituosen standen, dazwischen auch einige dicke Bücher, die hier wie Flaschenstützen wirkten.
Davor die große runde Theke aus Altholz und Messing, hinter der Oswald stand, in seiner leicht gebeugten Haltung mit dem schräg gesenkten Kopf, als hätte er beschlossen, diesen, den er zum Aufnehmen der Bestellungen immer neigen mußte, nicht mehr aufzurichten.
»Bier?« fragte er, ich sagte ja, ich wolle eines, grüßte mit einem »Hallo« den Professor, der mir zunickte, während ein großer, blonder Deutscher, den ich noch nie hier gesehen hatte, mit – täuschte ich mich? – flehendem Blick auf ihn einredete. Judith gab mir einen Kuß auf die Wange und lächelte, um dann ebenfalls den Erzählungen des Deutschen zuzuhören.
»Was gibt es Neues?« fragte ich Oswald, der mir das Bier auf die Theke stellte, er sagte: »Gott sei Dank nix!«
Die Menschen an den Tischen sahen irgendwie hergereist, geradezu geflüchtet aus. Als wären sie soeben mit nichts, als was sie am Leibe tragen, hier im Exil angekommen.
»Sind das wirklich Gäste?« fragte ich Judith, die sich wieder mir zugewandt hatte. »Oder hat Oswald Komparsen für die Bar jeder Hoffnung engagiert, als stimmigen Hintergrund für die Stammgäste?«
Judith Katz war die am schönsten verblühende Frau, die ich je kennengelernt habe. Ihre Schönheit war keine, die sich in Fotogenität erschöpft und sich für diese frischzuhalten versucht, sondern beruhte auf einer intelligenten Komposition von Abweichungen vom fotogenen Schönheitsideal. Und die deutlichen Merkmale des Alterns und Verfalls wirkten wie Vandalenakte an einem Kunstwerk, so daß Judith historisch entrückt schien, buchstäblich überlebt, während wir anderen bloß sterblich sind.
Das fahle Schimmern ihres bleichen Gesichts. Sie lachte. Ein Friedhof im Mondlicht, ihre Zähne die Grabsteine.
»Es ist doch bekannt«, sagte sie und sog mit zusammengekniffenen Augen an ihrem Zigarettenstummel, der vor ihrem Gesicht aufflammte wie ein Irrlicht, »daß immer schon der Name eines öffentlichen Lokals vorherbestimmt, welche Art von Menschen es aufsuchen werden.«
Professor Singer wandte den Kopf und sagte:
»Du bestätigst meine alte Theorie, meine Liebe. In einer Bar und in wissenschaftlichen Untersuchungen behaupten wir alles mögliche.«
Mit hochgezogenen Augenbrauen und ins Haar geschobener Brille drehte er sich wieder zu dem blonden Deutschen um, der plötzlich so betroffen blickte, als wäre Professor Singers Satz auf ihn gemünzt gewesen.
Singer war ein schweigsamer Mann, der, wenn man ihn dazu brachte, mehr als einen Satz zu sagen, einen Hang zum Monologisieren hatte, wie fast alle schweigsamen Menschen. Seine Monologe, die manchmal, wenn er aus seinem Schweigen ausbrach, wie Lava aus ihm herausquollen, hatten ihm den Titel Professor eingetragen. Einmal, vor vielleicht zwei Jahren, soll ein Brasilianer hier an der Theke gestanden sein, der – auf die Frage nach seinem Beruf – »Professor« geantwortet habe, worauf sich dann herausgestellt habe, daß er Tennislehrer sei. Singer soll daraufhin, nachdem er ihn eine Weile gemustert hatte, unvermittelt einen langen Monolog gehalten haben, in dem er den »Tennis-Professor« mit Musils »genialem Rennpferd« verglichen habe, eine – wie erzählt wird – unvergeßliche Rede, die von den anderen Gästen als Antrittsvorlesung für seine eigene Professur in der Bar jeder Hoffnung akzeptiert wurde.
Er war ein Original-Professor im Sinne des Original-Genies, und Neulinge in der Bar jeder Hoffnung, die hörten, wie Singer stets als Professor angesprochen wurde, mochten ihn tatsächlich für einen Universitätsprofessor halten, wozu seine Erscheinung nicht unwesentlich beitrug: die korrekte, aber immer nachlässig getragene Kleidung und die große schwarze Hornbrille, die er manchmal in das glatte, schwarze, ein wenig fettig wirkende Haar schob, wenn sie ihn auf der kleinen Warze am linken Nasenflügel drückte.
Mir gefielen seine Augen, weil sie keine Verräter waren wie bei so vielen anderen, in deren Augen man lesen kann wie in einem offenen Buch, das aber stets ein Plagiat ist.
So wie die Augen dieses Deutschen, in denen gleichsam fettgedruckt der Satz stand: »Ich bin empfindsam«.
Als ich hinsah, sagte er gerade: »Verstehen Sie das? Ich nicht!« Und weil ich hinsah, trafen sich unsere Blicke, so als würde er mich auch gleich in diese Frage mit einbeziehen. Ich trank mein Bier und fragte Judith, was er da erzähle. Sie lachte und sagte: sein Leben. Dann kramte sie in ihrer Handtasche nach ihrem Päckchen Zigaretten, und plötzlich sah ich, wie eine kleine Pistole hervorrutschte, die sie rasch wieder zurücksteckte, worauf sie die Tasche schloß und bei Cleusa, der gerade vorbeikommenden Kellnerin, Zigaretten bestellte. Ich hätte jetzt gern den Zweck dieser Pistole gekannt, aber ich wußte nicht gleich, wie ich danach fragen sollte. Während ich dies dachte, ging Judith auch schon fort und verschwand auf der Toilette. Ich lehnte mich an die Theke, wo Judith gestanden hatte, und befand mich jetzt unmittelbar neben Professor Singer und dem Deutschen, der schon wieder »Verstehen Sie das? Ich nicht!« sagte.
Professor Singer schnaubte, und der fleischige Mund des Deutschen verzog sich zu einem schmerzhaften Lächeln, das besagte: Ich weiß, daß es lebenspragmatisch unverständlich ist, was ich von mir erzähle, aber ein sensibler Mensch wird mich verstehen! Und seine Augen flehten, daß es solch ein sensibler, feinsinniger Mensch sein möge, dem er das augenblicklich alles erzählte.
»Jeder normale Mensch wäre jetzt heimgefahren«, fuhr er fort, »aber ich nicht. Ich bin geblieben, und wissen Sie, was passierte? Ich lernte eine andere Frau kennen, und in die habe ich mich verliebt! Da habe ich beschlossen, eben wegen ihr hierzubleiben, und kaum war ich mit ihr zusammen, kommt Sonja und sagt, sie will zu mir zurück. Verstehen Sie das?« und so weiter, »man hätte sagen können: ist ja prima!« und so weiter, »aber ich habe das eben noch nicht so richtig verarbeitet gehabt, nach allem, was sie mir erzählt hat«, und so weiter, und »jetzt stehe ich Trottel zwischen zwei Frauen«, ich bestellte noch ein Bier, und da war es schon wieder: »Verstehen Sie das? Ich nicht!«
Judith kam vom Klo zurück und lächelte. »Na, padre, haben Sie schon die Absolution erteilt?« fragte sie Professor Singer, wandte sich mir zu und sagte: »Der Junge redet um sein Leben, so als hinge sein Leben davon ab, daß es erzählt werden kann. Ist dir schon einmal aufgefallen, daß die, die interessante Geschichten zu erzählen haben, nie was erzählen? He?« Sie fletschte die Zähne und tippte mit dem Nagel ihres linken Zeigefingers auf die obere Zahnreihe. Ich wollte etwas antworten, wenn ich auch nicht wußte, was, doch da sprach sie schon weiter, immer schneller werdend:
»Oswald, zum Beispiel. Hat er dir schon erzählt, wie er hierhergekommen ist?«
»Nein.«
»Der hat in Wien den Nedomansky, diesen Journalisten, der über den sogenannten Hörsaal-1-Skandal, du weißt, dieses Teach-in über Kunst und Revolution, also der Nedomansky hat darüber besonders hetzerisch geschrieben, und der Oswald hat ihn ein paar Tage später bei einer Vernissage entdeckt, vor die Galerie gezerrt, spitalsreif geschlagen, auf einen Müll-Container gesetzt und fotografiert. Mit diesem Foto hat der Oswald auf der Kunstakademie – er hat ja damals dort studiert – im Siebdruckverfahren ein Plakat produziert mit dem Titel: ›Der Journalist Nedomansky auf dem Misthaufen der Geschichte‹. Diese Plakate hat er – gell, Oswald …« sagte sie zu Oswald, der gerade vorbeikam.
»Was erzählst da für an Scheiß?« sagte er und ging weiter, »… diese Plakate hat er dann in derselben Nacht zum Teil wild plakatiert, zum Teil an Bekannte im Café Sport und so . weiter verkauft, und am nächsten Tag hat er die Stadt der Lemuren, wie er sagt, verlassen und ist nach Deutschland gegangen, ohne das drohende Gerichtsverfahren noch langmächtig abzuwarten. In Hamburg hat er sich auf einem Schiff verdingt und ist so nach Brasilien gekommen, und da ist er jetzt und redet nicht so einen Scheißdreck, verstehst du? Hast du das gewußt?«
»Nein!« sagte ich. »Das habe ich nicht gewußt.«
Sie drehte sich halb zu dem Deutschen um und sagte: »Verstehen Sie das? Sie nicht!« Und wieder zu mir: »Oder Leo, unser Professor Singer! Hat er dir schon sein Leben erzählt? Nein, dabei wäre–« Professor Singer nahm sie um die Schulter und sagte: »Du hast recht, wie immer, meine Liebe. Ich will Ihnen nun eine Geschichte erzählen, lieber Simmel«, sagte er zu dem Deutschen, der mit großen Augen ausgerechnet auf mich starrte, als wäre ich sein Verbündeter, und sich mit der Hand durch sein dünnes blondes Haar fuhr.
»Ah, ja?« Judith lachte auf. »Erzähl! Dann erzähl ich eine, dann er«, sie nahm mich um die Hüfte, »dann jeder hier eine, und draußen herrscht die Pest, und wir müssen uns Geschichten erzählen, ein Decamerone life, bis die Gefahr gebannt ist und wir in die Literaturgeschichte eingegangen sind.«
»Ich werde Ihnen eine kleine Geschichte erzählen«, fuhr Singer zum Deutschen gewandt fort, aber in einem Tonfall, der sich dozierend an uns alle richtete. »Würden Sie mich kennen, wären Sie jetzt überrascht. Ich erzähle nämlich tatsächlich höchst ungern Geschichten, vor allem die, die das Leben schreibt, wie es so schön heißt. Das Leben schreibt nämlich nicht, das Leben ist Analphabet, ich habe noch nie das Leben schreiben gesehen, und alle Versuche der Philosophie, dem Leben Lesen und Schreiben beizubringen, sind gescheitert. Aber ich will jetzt nicht abschweifen, auch wenn es zu etwas Wesentlichem hinführte. Ich wollte nur sagen, daß ich dieses bedingungslose Hererzählen von Geschichten, die man erlebt oder sonstwas hat, verabscheue, dieses soziale Beichtsystem, in dem nicht Interesse an Wissen, sondern nur an Mitwisserschaft herrscht. Aber ich wollte nicht abschweifen, auch wenn es jetzt noch näher zu etwas Wesentlichem hinführte. Ich wollte nur vorausschicken: – ach, egal. Hören Sie zu! Als ich eines Nachmittags, in Wien, zu meinem Stammcafé spazierte, stieß ich beinahe mit einer Frau zusammen, die unmittelbar vor mir aus einem sogenannten Hundesalon auf die Straße trat. Ihr stelzend unnatürlicher Gang verriet, daß sie alle Blicke auf ihre Schönheit gerichtet fühlte, die, als statistisches Durchschnittsmaß aller Illustriertenschönheiten, wohl wirklich einzigartig genannt werden mußte. Wie sehr dieser Dame das Gepflegte schlechthin am Herzen lag, sah man auch daran, daß sie einen jungen Pudel im Arm hielt, der offenbar soeben frisch geschoren worden war. Das bißchen Fell, das er hatte behalten dürfen, schien dem Hund wie eine extravagante Kleidung übergezogen, ein Triumph des menschlichen Formwillens über das Animalische. Ich war knapp hinter dieser Dame, als sie die Fahrbahn überqueren wollte, aber vor einem rücksichtslosen Autofahrer wieder zurückweichen mußte. Beinahe wurde sie noch gestreift von diesem Auto, das vor ihr durch eine Regenlache brauste, daß das Wasser aufspritzte. Reflexartig machte sie mit den Händen, den Pudel haltend, eine Abwehrbewegung und rief dem Auto nach: Du blöder Hund!
Wenig später saß ich im Café und hörte am Nebentisch einen Rocker – ein Rocker ist, wie Sie wissen, ein Rocker, weil er wie ein Rocker ausschaut – hörte also am Nebentisch einen Rocker sich mit jemandem unterhalten, er sprach Hochdeutsch, auf eine so natürliche und selbstverständliche Weise, so prägnant und zugleich musikalisch, daß ich meinen Mörike-Gedichtband aus der Hand legte und auch die Presse wegschob und zuhörte. Und plötzlich verstand ich zum erstenmal all jene, die die Welt heute nicht mehr verstehen, nicht mehr. – Glauben Sie mir diese Geschichte?«
»Ich weiß nicht«, sagte Simmel. »Ich weiß nur, daß ich nicht verstehe, was Sie damit sagen wollen …«
»Nun, mein Freund, dann wissen Sie alles, was notwendig ist, um die Welt nicht zu verstehen. Dieses Nicht-Verstehen ist ja, wie Sie nicht wissen, eine spezifische Bewußtseinsform des Wissens, die es Ihnen erlaubt, sich in Wirklichkeit auf die Welt zu verstehen. Sie wissen sich zu ernähren, Sie wissen sich zu kleiden, zu wohnen, Sie wissen Ihrer Arbeit nachzugehen, Sie wissen zu reden und sich mit anderen in Verbindung zu setzen, und Sie wissen zumindest von jenen Gesetzen, die in Ihr Leben hineinwirken und die Sie zu befolgen wissen, um nicht dem Leben, auf das Sie sich so gut verstehen, entzogen zu werden! Sie sehen: Sie wissen nicht, daß Sie etwas wissen, aber manche wissen nicht einmal das nicht!«
Judith lachte ekstatisch, und Simmel hatte es sehr eilig, zu zahlen und zu gehen.
Nun setzten wir uns zu dritt an einen Tisch. Es war ein alter Spieltisch mit einem eingelegten Schachbrett, auf dessen quadratischen Feldern die darauf abgestellten Gläser im Lauf der Zeit zahlreiche Ringe hinterlassen hatten, so daß es wie das Spielbrett eines ganz anderen, aber dennoch strategischen Spiels aussah.
Ich weiß nicht, warum ich später, als ich die Geschichte dieser Zeit aufschreiben wollte, so hartnäckig dachte, daß dieser Abend der Anfang gewesen ist. Natürlich war das kein Anfang, auch wenn alles so unbedeutend und unverständlich schien, wie bei jedem Anfang. Zumindest dachte ich damals zum ersten Mal: Ich habe die falschen Regeln gelernt.
Ich starrte auf das Spielbrett, sah, wie Leo Singer sein Glas hob und dann auf ein anderes Feld stellte. Im Gegenzug nahm Judith ihr Glas vom Brett.
Der nächste Tag war so heiß, daß man beim Gehen im Asphalt Spuren zurückließ. Ich mochte das nicht gern. Vor dem Haus stand Maria mit dem Wasserschlauch und spritzte den Vorplatz. Sie trug Plastiksandalen, eine abgeschnittene Jeans und ein T-Shirt, das so eng war, daß es auch in die Falten kroch, die ihr der Büstenhalter ins Fleisch schnitt.
Den Schlauch hielt sie mit einer eigentümlichen vergnügten Monotonie mal dahin, mal dorthin. Man hatte das Gefühl, daß das Wasser schon verdunstete, bevor es auf den Boden traf. Manchmal sah es aus, als würde Maria nur einen kleinen Regenbogen waschen, auf den sie mit ihrem Schlauch zielte. Das war eine schöne Kunst, die mich minutenlang interessierte.
Ich stand am Fenster.
Beim Haus gegenüber war das Garagentor geöffnet, in dessen Schatten saß ein privater Wächter auf einem Sessel, im Schoß hielt er ein Radio. Er grüßte den Briefträger. Er rief Maria etwas zu, ein Scherzwort, denn ich sah ihn lachen.
Der Wächter war müde, er hielt immer ein Auge offen.
Er trug auch bei größter Hitze eine Phantasieuniformmütze, die am ehesten noch an eine Kapitänsmütze erinnerte. Ab und zu lüftete er sie und wischte mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn.
Maria war verschwunden, der Schlauch lag am Boden, sich windend wie eine Schlange. Plötzlich lag er ruhig, das Wasser hörte auf zu rinnen. Maria kam wieder und trug den Schlauch weg.
Dona Ilse trat vor das Haus. Ihr mächtiger Körper steckte in einem sommerlichen, doch züchtigen Dirndl, das blonde Haar war wie immer zu einem Kranz geflochten, in ihrem weißen Gesicht hingen rund und rot die Wangen, tatsächlich wie Äpfel. Sie sah nach der Post. Die Deutsche Zeitung war gekommen. Warum ging Dona Ilse mit all ihrer Deutschtümelei nicht nach Deutschland zurück? Sie hatte immer jenes Lächeln, das man auf diesen Fotos in den Gesichtern der Mädchen sieht, denen der Führer die Wange streichelt. Vielleicht deswegen! Es war halb zwölf, und ich war noch im Morgenmantel. Ich zog mich an und ging in die Paderia, um Brot und Schinken zu kaufen. Als ich zurückkam, begegnete ich vor dem Haus Senhor Eurico, wie Dona Ilses Gatte Erich hier in Brasilien hieß. Manchmal aß er mittags zu Hause. Er stieg gerade aus dem Auto: ein hagerer Mann, schütteres Haar, eine klobige, dunkle Brille, ein weißes Hemd, das er der Bequemlichkeit wegen zwei bis drei Nummern zu groß trug, so daß der geschlossene Kragen an seinem Hals so weit herunterhing, daß man einige sich hervorkräuselnde schwarze Brusthaare sehen konnte, während sich ein winziger Krawattenknoten unter dem langen, spitzen Kragen versteckte. Ein leichtes mausgraues Sakko trug er über dem Arm, die Hose war zu kurz. Er warf die Wagentür zu und betrachtete den Wagen, als wundere er sich, daß er ohne Unfall heimgekommen war.
Er machte auf mich den Eindruck eines Mannes, der ein geheimes, ganz ausgefallenes Hobby hat, das er mit wissenschaftlicher Akribie betreibt, während ihm das tägliche Leben als ein System von geheimen Verabredungen und Übereinkünften erscheint, in die er nicht eingeweiht ist, das er aber zumindest mit den Erkenntnissen seiner Privatwissenschaft zu meistern versucht. Vielleicht hat er recht.
Wir grüßten einander.
»Viel zu tun?« fragte ich ihn höflich.
»Es ist unglaublich!«
Er nickte mir nochmals so aufmunternd wie geistesabwesend zu, ich ging in meine Wohnung und machte mir das Frühstück. Ich hielt es aber nicht aus, beim Essen am Tisch sitzenzubleiben. Kaum hatte ich ein pão francês aufgeschnitten und Schinken hineingelegt, stand ich schon auf und ging essend im Zimmer auf und ab, kehrte nur ab und zu zum Tisch zurück, um einen Schluck Kaffee zu trinken. Ich machte mir ein zweites Schinkenbrot, das ich auf und ab gehend oder am Fenster stehend aß, und ich aß so hastig, als hätte ich keine Zeit. Ich hatte aber Zeit. Ich ließ mechanisch und desinteressiert die Seiten einiger Bücher, die auf dem Schreibtisch lagen, durch die Finger gleiten, aß und bröselte dabei in die Bücher hinein. Ich ging zum Tisch zurück und trank Kaffee, schließlich zündete ich mir eine Zigarette an und stellte mich wieder ans Fenster. Die Straße, das Haus gegenüber, die Garage, der Wächter, die Mauern, Gitter, Gärten. Ein farbiges Dienstmädchen in blauem Kleid mit weißer Schürze ging vorbei, an der Hand hielt es ein kleines weißes Kind. Der Wächter grüßte, das Mädchen blieb stehen, sie begannen zu reden. Das Kind lehnte seinen Kopf an die Schürze des Mädchens. Eine schwarze Hand strich über das weißblonde Haar. Knatternd bog ein Go-cart-Auto in die Straße ein, das ein etwa zwölfjähriger Bub lenkte. Er ratterte die Straße entlang und verschwand wieder. Das Mädchen sagte etwas, und der Wächter schüttelte mißbilligend den Kopf.
Auf meinem Schreibtisch lagen achtundzwanzig Doppelbögen A 4, in denen mit immer anderer Handschrift immer dasselbe stand: Antworten.
Am Abend spielte ich mit Norbert Tennis. Norbert war ein Deutscher, der schon seit einigen Jahren in São Paulo lebte und hier im Export-Geschäft arbeitete. Ich hatte ihn bald nach meiner Ankunft kennengelernt, wir hatten uns angefreundet, ich wurde Mitglied in seinem Tennisclub, und wir spielten regelmäßig eine Partie.
Norbert bewegte sich selbstverständlich und flink auf dem Platz.
Ich beneidete Norbert, wie selbstverständlich er alles als das nahm, was es war – wenn es so wäre. Er hatte immer ein schelmisches Lächeln: er raubte dem Leben die Köder von den Fallen. Er war sensibel: er ließ sich graue Haare wachsen. Nicht der Schnee des Alters – er war zehn Jahre älter als ich –, nein, das Silber der Sorgen, durch die man auch hasten kann wie durch einen verwunschenen Wald, nur die Spinnfäden zerreißend. Immer auf die Lichtungen zu. Die Spinnfäden der zurückgelassenen Sorgen, die nun an den Lichtungen auf seinem Kopf glitzerten, waren diese grauen Haare. Immer auf die Lichtungen zu. Wenn er »gestern« sagte oder »vor einem Jahr« oder »früher« oder »damals«, dann wollte das nicht wie Fakten der subjektiven Geschichte erscheinen wie bei den anderen, sondern wirkte wie fremde Kulissen, vor denen er, so wie er ist, so wie man ihn sieht, nur einmal kurz aufgetreten ist. Nur kurz. Ist etwas schön, dann verweile nicht! Denn es könnte sich als das herausstellen, was es wohl sein muß: als ein Trugbild. Es könnte etwas fordern, das angesichts der bunten Widersprüchlichkeit und reichen Zusammenhanglosigkeit der Welt absurd wäre, nämlich eine allgemeine und dauernde Geltung, es könnte dich beanspruchen und dadurch von anderem ausschließen, und plötzlich bist du ganz ein Teil. Die Falle könnte zuschnappen. Haste weiter!
Norbert hastete über den Platz. Er spielte schnell, er war flink. Seine Aufschläge kamen schon, während ich mich noch umdrehte, nachdem ich zur Grundlinie zurückgegangen war. Er genoß es, zu spielen, aber nur, wenn das Spiel schnell war. Ganz schnell! Wenn er länger spielte, dann spielte er eben schnell etwas länger. Er zählte nur seine Punkte. Er schlug auf. Punkt. Dreißig – vierzig. »Dreißig!« rief er.
Im Gewölbe des Abends strahlten einige Neonreklamen wie bunte Kirchenfenster. Spielregeln sind die Exerzitien des Lebens. Sie zu kennen, sie auszurufen, die Handlungen von ihnen abzuleiten ist die geistige Übung in einem körperlichen Leben.
Spiel, Satz und Sieg. Wir schüttelten uns die Hände.
Norberts Augen waren tief und dunkel. Er war kompliziert. Wenn er ahnte, daß man es sah, lachte er ganz schnell.
»Und? Was jetzt?«
Duschen.
»Was ist? Bist du endlich fertig, hier?«
Ja. Ja.
»Hör mal, was machst du, hier? Bist du noch nicht fertig?«
Norbert trippelte ungeduldig vor dem Spiegel.
»Und?«
Ich bat ihn, inzwischen einen Orangensaft für mich an der Bar zu bestellen, gleich käme ich nach.
Als ich zur Bar kam, stand der Orangensaft schon auf der Theke. Norbert sprang vom Barhocker, als er mich sah, und hastete zum Ausgang. Ich stürzte den Saft hinunter und winkte dem Jungen hinter der Bar mit einem Geldschein, er rief, Norbert habe schon bezahlt. Ihm nach. Ich gab ihm das Geld, er steckte es achtlos ein und sagte: »Wir fahren mal auf einen schönen Aperitif in die Jardins. Da können wir uns überlegen, was wir machen, hier. Es ist ja noch früh, wir müssen noch warten.«
Er fuhr, wie immer, rasend schnell. In Brasilien nennt man seine Fahrweise costurar: nähen. Auf die rechte Spur, auf die linke Spur, auf die rechte, auf die linke, in jedes Loch auf die gerade schnellere Spur. Er griff auf den Rücksitz, holte eine Zeitung hervor, warf sie mir in den Schoß. »Hier. Schau nach!«
Ich schlug die Divirta-se-Seiten auf. Was ist heute los.
Ich versuchte kurz, mich im Angebot der Stadt zurechtzufinden, mich zu irgendeinem Interesse verführen zu lassen, schlug aber die Zeitung gleich wieder zu und warf sie auf den Rücksitz.
»Und? Nichts los, hier?«
Ich sagte, nein!
Dieses Herumsuchen im Veranstaltungskalender, um zu sehen, was man machen kann – ich mag es nicht. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht deshalb, weil der Reiz der Ereignisse vor allem in ihrer Vielzahl und deren Reiz in der Widersprüchlichkeit besteht, aber in dieser Form existiert das, was los ist, nur in der Zeitung. Im Grunde liest man nicht, was man erleben kann, man liest, was man versäumt.
Wir fuhren ins Sandwich, eine kleine Bar in den Jardins, die damals sehr beliebt war als Treffpunkt, wo man einen frühen Aperitif trank und mit einem Sandwich den Hunger noch ein wenig hinauszögerte, bevor man das eigentliche Abendprogramm begann. Sorgenlose Menschen, die nur die eine Sorge hatten, daß die sorglose Vergnügtheit nicht nachläßt, frequentierten dieses Lokal. Der schicke Witz der Bar bestand darin, daß man eigentlich nicht in einer Bar stand, sondern auf der Straße. Es war ein Gassenlokal von der Größe eines Badezimmers, in das keine Tür führte, sondern dessen Front einfach eine Theke war. Im Raum arbeiteten die beiden Barkeeper, auf der Theke stand das Glas, und man selbst stand schon auf dem Gehsteig. Es gab drei Tische, manche setzten sich auch auf die Kühlerhauben der hier parkenden Autos.
Norbert umarmte diesen, küßte jene, während ich mit einem Campari zwischen der Theke und den Tischen stand und immer wieder von den Passanten angerempelt wurde, die sich hier vorbeidrängten. Plötzlich stand Norbert wieder vor mir, an seiner Seite eine Frau, die er mir vorstellte: »Hier, das ist Beatriz!«
Sie sah mich freundlich, dabei aber so neugierig an, daß ich ihrem Blick nicht standhielt. Nur um ihm auszuweichen, sah ich an ihr hinunter, an ihrem Kostüm, das neben den hautengen Lycra-Collants der anderen Frauen hier besonders edel wirkte, bis zu ihren Schuhen, die aussahen, als hätte sie sie vor zwei Minuten gekauft. Keine einzige Falte!
Sie wird glauben, daß ich sie taxiere, dachte ich, und das war mir erst recht unangenehm. Mich irritierte das Selbstbewußtsein, das die anderen haben, während ich erst versuchte, mit meinem Bewußtsein klarzukommen.
»Roman«, sagte ich, »Roman Gilanian.«
»Very nice!«
Sie sprach natürlich Englisch. Norbert habe ihr erzählt, daß ich aus Wien komme, sagte sie fragend. Ja, sagte ich. Sie sei schon einmal in Wien gewesen, sagte sie, eine wunderschöne Stadt. Und wie ich hierher nach Brasilien gekommen sei und was ich hier mache? Ich sagte, daß ich Assistent an der Universität São Paulo sei, auf der Germanistik. Und wie ich diese Stelle bekommen habe?
Ich konnte mir nicht vorstellen, daß sie das alles wirklich interessierte. Sie stellte sicher nur aus Höflichkeit immer die nächstliegende Frage, um ein freundliches Gespräch abzuwickeln, bevor sie sich – da winkte sie auch schon rasch jemandem zu! – mit dem nächsten unterhielt. Ich wollte daher nur möglichst kurz sagen, daß ich mich darum beworben hatte, als ich schon stockte, noch bevor diese in meinem Kopf bereits formulierten Worte meinen Mund verließen. Sie würde dann fragen, dachte ich, wie ich davon gewußt habe, daß hier eine Stelle frei sei, und wo ich mich beworben habe, von Wien aus oder erst hier, und wieso ich hierher wollte, was ich von Brasilien gewußt habe, daß ich mich um eine Stelle hier bemüht habe, warum ich hier leben wollte, und so weiter.
Ich wollte so wenig wie möglich reden, und so kam ich immer mehr ins Reden, weil ich bei allem, was ich sagte, sofort auch gleich die Antwort auf mögliche Gegen-, Nach- und Zwischenfragen einbauen wollte. Diese Fragen sollten einmal aufhören. So erzählte ich ihr, daß ich nach Abschluß meines Studiums unbedingt an einer Universität hatte arbeiten wollen, ich erläuterte das mit meinem Bedürfnis nach Versöhnung von Lohnarbeit und Interessen – die Formulierung »Versöhnung von Lohnarbeit und Interessen« kam mir plötzlich seltsam vor, so fremd, ich hatte das ganz vergessen; es schien mir, als wären diese Worte, und nicht das Englisch, die Fremdsprache, eine Sprache aus einer alten, fremd gewordenen Zeit – nun sei aber in Österreich keine Universitätsstelle frei gewesen, sagte ich, weshalb mir geraten worden sei, zum Wissenschaftsministerium zu gehen, da dieses junge Wissenschaftler ins Ausland vermittle, wahrscheinlich damit sie weg seien und damit draußen aus den Arbeitslosigkeitsstatistiken – »Arbeitslosigkeitsstatistiken!« Was ich plötzlich alles sagte! – und so sei ich hingegangen, und tatsächlich habe es Ausschreibungen ausländischer Universitäten gegeben, Tokio, Seoul, São Paulo, also habe ich mich für São Paulo beworben – muß ich erklären, warum nicht für Tokio oder Seoul? – »Very nice!« sagte Beatriz, ich fühlte mich wie nach einer Prüfung, bei der ich nicht geglänzt habe, aber irgendwie über die Runden gekommen bin. Hat Beatriz jetzt nicht sogar »Setzen!« gesagt? Ja, ob wir uns nicht setzen wollen, aber es war kein Tisch frei. »Außerdem wollen wir gleich mal weiter«, sagte Norbert.
Beatriz war so höflich. Sie wußte schon wieder eine Frage. Ob es nicht schwierig sei, in ein Land zu kommen, dessen Sprache man nicht spricht, und dort an der Universität zu arbeiten? Well, sagte ich, an der Uni sollte ich ja auf deutsch unterrichten, wenngleich es wirklich schwierig sei, da die meisten Studenten nicht gut Deutsch könnten, und im übrigen sei ich dabei, Portugiesisch zu lernen. »Very nice!«
Und was machst du? Ich weiß nicht, ob ich »du« gesagt hätte, aber zum Glück sprachen wir Schulenglisch.
Sie habe eine Galerie, gleich hier um die Ecke!
Sie hatte ein interessantes Lächeln. Sie zog dabei ihre Lippen weit auseinander, aber ohne daß es angestrengt wirkte, und zeigte ihre Zähne. Zwischen ihren beiden Schneidezähnen befand sich ein kleiner Zwischenraum. Ich sah ihre Zähne, unschuldig weiß, als hätten sie noch nie gebissen. Die beiden Schneidezähne, der kleine Spalt dazwischen: das gefiel mir, wie eine kunstvoll durchbrochene elfenbeinerne Brosche. Nein, keine Brosche. Ein Einlaß, sauber und unfleischlich, Wände aus Elfenbein.
Meine Zunge strich über die Hinterwand meiner Zähne, ein Tick, in dem sich die in mir versperrte Erregung, die Angst, wiegte. Norbert fragte sie rasch mal was auf portugiesisch. Und während Beatriz auf englisch antwortete, vielleicht aus Höflichkeit, um mich nicht auszuschließen, fiel mir noch ein seltsamer Satz aus meiner Vergangenheit ein: »Hier kann ich mich nicht einbringen!« Muß ich erklären, was dieser Satz damals sagen wollte? Nein.
»Yesss!« sagte Beatriz, sich wieder mir zuwendend, es sei schade, daß sie jetzt nicht Deutsch mit mir reden könne, das wäre jetzt very nice gewesen. Und sie erläuterte diesen Satz mit dem ersten Kapitel ihrer Biographie: In ihrer frühen Kindheit sei nämlich bei ihr zu Hause nicht nur Portugiesisch, sondern auch Französisch und Deutsch gesprochen worden. Ihr Vater habe auf europäische Ausbildung und europäische Lebensformen, wie sie sagte, größten Wert gelegt. Die Kinder, also sie, ihre Schwester und ihr Bruder, hätten sogar Hauslehrer für Deutsch und Französisch gehabt. Als aber Deutschland den Zweiten Weltkrieg auslöste, habe ihr Vater von einem Tag auf den anderen nie wieder Deutsch gesprochen, die Sprache im Haus verboten und statt des deutschen Hauslehrers sei dann immer ein Englischlehrer gekommen. Obwohl ihr Vater angeblich perfekt Deutsch gesprochen habe und in der deutschen Literatur sehr belesen gewesen sein soll, habe er sich bis an sein Lebensende geweigert, auch nur noch ein einziges deutsches Wort zu sagen oder eines der deutschen Bücher in seiner Bibliothek aufzuschlagen. Es sei schade, sagte Beatriz, denn sie sei damals erst wenige Jahre alt gewesen und habe mit dem Deutsch-Lernen gerade erst angefangen gehabt, als es schon wieder aus war. Sie habe daher natürlich nichts davon behalten. Nur ihr acht Jahre älterer Bruder spreche heute noch etwas Deutsch, einige Brocken.
Und wie nett Beatriz sagte, daß sie es nun, wo sie mit mir spreche, wirklich schade finde, daß sie wegen des Abscheus ihres Vaters gegen die deutschen Faschisten doch nie Deutsch gelernt habe. It’s really a pity. Yesss.
Was sollte ich darauf sagen?
Beatriz hatte diese Geschichte zwar so erzählt, als hätte sie sie extra für mich aufbewahrt gehabt. Aber sie war doch auch so irritierend small-talk-geeicht: Deutscher Faschismus Bindestrich Abscheu Doppelpunkt Nie wieder Deutsch gesprochen Ausrufezeichen Gesinnung gezeigt Zwei Ausrufezeichen Das seine getan Drei Ausrufezeichen. Was darauf sagen? Ob ihr Vater aus Abscheu gegen den Vargas- oder den Salazar-Faschismus auch nie wieder Portugiesisch gesprochen habe? Nein, nein, das habe ich nicht gesagt, das war nur ein Gedanke und er war nicht so gemeint, immerhin: Antifaschismus, da hatten wir schon etwas Gemeinsames! Beatriz mußte, ihrer Geschichte zufolge, über vierzig Jahre alt sein, und sah man ihr dieses Alter auch nicht an, so reflektierten ihr Gesicht, ihre Augen doch irgendwie die Erfahrenheit einer Frau ihres Alters. Und ihre schlanke, frische Gestalt: die eines jungen Mädchens. Nur nicht so körperlich. Nicht wirklich. Nicht aus einer Rippe des Mannes gemacht, sondern, noch schlimmer, aus einer der männlichen Frauenidealphantasien: die erfahrene, intelligente Gefährtin und die junge Freundin in einer Person. Yesss. Sie lächelte. Der Spalt, der unfleischliche Einlaß. Ich fühlte mich wie ein Halbwüchsiger, linkisch und hilflos. Beatriz machte mir angst. Meine größte Angst war, daß sie erkennen und sich darüber amüsieren könnte, wie sehr ich sie begehrte, auch wenn dieses Begehren eigentümlich abstrakt war, so unvorstellbar wie etwas besonders Absurdes oder Verbotenes. Ich brachte kein Wort heraus, da sagte Norbert rasch mal einen launigen Satz und lachte, ich lachte und Beatriz lachte auch. Wie in der stereotypen Schlußeinstellung jeder Folge einer Fernsehfilmserie.
»Und?« sagte Norbert, als wir in die Alameda Lorena weiterfuhren, er meinte Beatriz. Er sagte noch irgend etwas, ich glaube: »Außergewöhnliche Frau«, worauf ich sagte, daß sie gar nicht wie eine Brasilianerin wirke, sondern eher wie eine Europäerin. Ich weiß nicht, ob ich mich richtiggehend vor mir selber schämte, aber ein flaues Gefühl breitete sich augenblicklich in mir aus – und wieviel Platz es fand, um sich auszubreiten! Was soll das sein, eine »Europäerin«? Was ist typisch »europäisch«, was »brasilianisch« oder »lateinamerikanisch« gar? Ich hörte gar nicht hin, was Norbert sagte, ich glaube, er gab mir recht, er mußte langsam und konzentriert fahren, wegen der valetas, tiefen Gräben quer über die Straße, die vor ungeregelten Kreuzungen in São Paulo Stop-Tafeln wirkungsvoll ersetzten.
Vielleicht macht Reisen dumm. Zumindest so dumm, wie man schon vorher war, »zu Hause«, wo man in denselben Strukturen dachte, allerdings vertrautere Gedanken, weshalb man sich nichts dabei dachte.
»Hier!« sagte Norbert und deutete mit dem Kopf nach rechts. Die Aspirina-Bar. Die Adresse ist leicht zu merken! Alameda Lorena 1968. Wirklich wahr, sagte ich: Hausnummer 1968.
Norbert hatte im Sandwich erfahren, daß es in der Aspirina in dieser Nacht ein Fest gebe. Von den Aspirina-Festen hatte ich schon gehört, es kursierten begeisterte Erzählungen, obwohl die Mittel dieses Erfolgs denkbar einfach waren. Es wurde ein Motto ausgegeben, und die meisten erschienen in entsprechender Maskerade. Es gab Live-Musik und ein bißchen Schnickschnack, Dekoration, die dem Motto des Festes entsprach, Videogeräte, die, ohne Ton, dazu passende Filme zeigten. Zwei Wochen zuvor, beim letzten Fest, so Norbert, sei es »knackevoll« gewesen von Mafia-Bossen, Killern, Gangsterbräuten, Drogenhändlern – »einige waren sogar echt!« sagte er nebenher, zugleich nebenher eilig vergnügt, es war auch nur eine bedeutungslose Skurrilität, die lustig zu wissen ist, aber kein Anlaß, dabei zu verweilen. Das Motto war »Gangstertreffen in Chicago 1930«, auf den Videoschirmen seien pausenlos amerikanische Gangsterfilme geflimmert, hier, die Band habe ausgesehen wie eine Gang, im Geigenkasten die Maschinenpistole. An den Wänden Steckbriefe, die Stammgäste karikierten.
»Ich wurde als Sexualverbrecher gesucht«, sagte er aufgeräumt, während er in die Parklücke stieß.
»Na ja, was ich hier schon abgeschleppt habe …«, sagte er, noch ein Stück zurückstoßend.
Er stellte den Motor ab und bedeutete mir ungeduldig, auszusteigen. Ich fragte ihn, ob es keine Rolle spiele, daß wir nicht kostümiert seien. Er war schon aus dem Wagen gesprungen, während ich erst die Tür auf meiner Seite öffnete, er beugte sich wieder rasch herein und schlenkerte mit dem Zeigefinger, um mir zu bedeuten, daß ich den Türriegler hinunterdrücken solle, warf die Tür zu, versperrte sie und hastete den Weg zur Bar vor. Ich verfolgte diese vielen hektischen Bewegungen wie einen alten Stummfilm, in dem irgendwann, nachdem Norbert rasch den Mund ein paarmal auf- und zugeklappt hatte, das Schriftinsert erschien:
»Es kommen doch nie alle kostümiert!«
Er sah zurück, wo ich blieb, indem er trippelnd eine halbe Drehung um sich selbst machte, sah, daß ich nachkam, vollendete die Drehung und eilte etwas langsamer weiter. Die dunkle Alameda, ein stummer Schwarzweißfilm, viel zu schnell abgespielt, Norberts Gehen war ein hektisches Zuckeln zwischen Tanz und Flucht.
»Und außerdem ist das Motto heute ›Die schöne Brasilianerin‹, hier! Was hättest du für eine Kostümierung genommen?«
Ach so! Nun sah ich ganz groß sein Lachen, dann sah ich mich selbst lachen, nun war ich mitten in diesem Film, ich sah uns beide lachen und schließlich Seite an Seite die letzten Schritte auf die Bar zugehen, ein paar Stufen den Eingang hinauf, nacheinander hinein.
Wir kamen in einen kleinen Vorraum, in dem sich eine Art Garderobe befand, mit einem Garderobenpult, hinter dem ein Mädchen stand, das uns freudig wie alte Bekannte begrüßte. Dann fragte sie uns nach unseren Namen und schrieb sie auf zwei Konsumationskarten, die sie uns gab. Wenn man bestellt, kreuzen die Kellner die entsprechenden Preise auf den vorgedruckten Rubriken dieser Karte an, wenn man gehen will, gibt man die Karte wieder hier ab, wo dann alles addiert wird.
Diese Garderobe war also vor allem die Kassa, die aber dennoch, wie ich sah, auch Garderobenfunktion übernahm, wenngleich auch nicht unbedingt im Sinn des Wortes: unmittelbar nach uns kam ein junges Paar, der Bursche hatte das Autoradio aus seinem Auto ausgebaut und mitgenommen, er gab es hier ab, wo es mit einer Nummer versehen wurde, die auch in seiner Karte eingetragen wurde. In dem Regal hinter dem Garderobe-Kassa-Mädchen lagen schon einige Autoradios, an denen Schildchen mit Nummern baumelten. Ungläubig starrte ich dieses Bild an.
»E aí, wie schaut es aus?« fragte Norbert.
Das Mädchen sagte, daß es noch ein bißchen früh sei.
»Siehste! Hab ich dir ja gleich gesagt!« sagte Norbert zu mir – aber sie versicherte freundlich, daß es sich gewiß auszahle, hierzubleiben.
Rechts am Ende des Vorraums kam man durch einen Durchgang ins eigentliche Lokal. Ein Raum voll von Tischen und Stühlen, der in einen größeren überging, in dem sich geradeaus die Bartheke befand und links ein niedriges Podium für die Live-Musik, in der rechten Ecke noch drei Tischchen, dazwischen freier Platz zum Tanzen.
Ich war enttäuscht. Ich hatte das Gefühl, in einem Museum die fade, sterile Rekonstruktion jener Bar zu besichtigen, von der ich einiges Geschichtliche erzählt bekommen hatte. Auf dem Podium der Band sah man nur die Instrumente, so drapiert, als wäre vor wenigen Minuten noch gespielt worden. Auf den Videoschirmen flimmerten nur Pünktchen. An den Tischen, auf denen Flaschen mit Kerzen standen, saßen einige Gäste, wie hingesetzte Wachsfiguren, die im Flackern des Kerzenlichts sich ein wenig zu bewegen und manchmal gar ein bißchen zu reden schienen. Die Dekoration erschöpfte sich phantasielos in einigen Posters weiblicher brasilianischer Stars.
Es war eigentümlich ruhig, keine Ausgelassenheit, ich war nahe daran, mich wie zu Hause zu fühlen. An der Theke lehnten einige Männer, die nach schönen Brasilianerinnen Ausschau hielten. In abgebrühter Geduld, denn bislang hatte das Fest mehr Brasilianer als Brasilianerinnen angelockt.
An einem Tisch saßen drei Mädchen beisammen, die sich angestrengt schöngemacht hatten, aber auf eine so herkömmliche Weise, daß ich nicht wußte, ob sie das Motto ernst nahmen oder parodieren wollten. Sonst waren fast alle Frauen in männlicher Begleitung. Eine Frau trug die weiße Tracht der Bahianerinnen aus dem Nordosten Brasiliens, eine andere lediglich Strumpfhose und Glitzerbikini, wie die Destaques der Samba-Schulen bei den Karneval-Umzügen, aber das genügte nicht, um den Eindruck zu vermitteln, daß hier ein Kostümfest stattfand.
Da diese Museums-Samtkordeln fehlten, die dem Besucher den Zutritt zu den Ausstellungsräumen versperren, setzten wir uns an einen der kleinen Tische auf der dem Podium gegenüberliegenden Seite, gleichzeitig begann irgendeine Konserven-Musik zu spielen, kurz darauf zeigten die Videogeräte stumm den Film über das Stones-Konzert in Altmont. Beides schien mir wenig zu tun zu haben mit dem Thema des Festes, ja überhaupt mit »Fest«, also mit etwas, was diesen Abend von einem herkömmlichen Abend in einer Bar unterscheiden sollte.
Vielleicht war das eine Fehlinformation mit dem Motto des Festes oder mit dem Fest überhaupt, mutmaßte ich, ohne daß es mir wichtig war. Norbert verneinte. In São Paulo beginne alles erst gegen Mitternacht, hier.
Plötzlich stand eine Japanerin vor uns, durch ein Schürzchen als Kellnerin kostümiert oder gekennzeichnet.
Ôba! Welche Überraschung! Norbert war entzückt, rutschte rasch auf seinem Sessel herum, sich ihr zuwendend, wobei er flüchtig die Geste des freudig-überraschten Hände-Auseinanderbreitens andeutete und lachend seinen Kopf seitlich neigte. Das Mädchen neigte sich zu ihm hinunter, küßte ihn und streichelte dabei seinen Oberarm.
»Pôxa!« sagte Norbert. »Arbeitest du jetzt hier?«
Sie nickte. Norbert machte uns mitsammen bekannt, dann fragte er: »Bier oder was?«
Ja, sagte ich, cerveja!
Yuki brachte das Bier, mit einem Lächeln, ging wieder weg, zu anderen Tischen, wir sahen ihr nach.
»Haste schon mal ’ne Japanerin gebumst?«
Ich mußte verneinen.
Norbert hatte recht gehabt. Gegen Mitternacht sah alles ganz anders aus, die Aspirina begann sich zu füllen und war bald brechend voll.
Da das Motto des Abends wie ein Versprechen klang, kamen natürlich viele Männer, zum Teil in Kostümen, die Beziehungen oder Bezüge zu »schönen Brasilianerinnen« herstellen sollten, sie kamen als Fazendeiros, Landarbeiter, Sklaven, die auf die Klassensolidarität der erwarteten weiblichen Gegenbilder hofften, sie kamen als Gestalten aus der brasilianischen Geschichte oder als moderne Berühmtheiten, wie zum Beispiel ein dicker Bursche in der absurden Fantasie-Uniform Chacrinhas, eines Fernsehstars, der sich in seinen Unterhaltungssendungen stets mit Dutzenden von um ihn herumtanzenden Frauen umgibt. Es kamen Frauen, die, kostümiert in patriotischen Klischees, einen Bezug zum Thema des Abends suchten, etwa eine Königin des Karnevals, oder die schlicht das Thema in Beziehung zu sich selbst setzten, wie ein Indio-Mädchen, das ein T-Shirt trug mit der Aufschrift: »Ureinwohnerin Brasiliens«.
Unmittelbar vor mir tanzte ein Mädchen im Nationaldress des brasilianischen Fußballteams, sie zappelte wild in der Musik, während eine andere vor ihr hin und her ruckelte, um mit einem großen Strohhut, auf dem Nachbildungen der tropischen Früchte Brasiliens üppig und bunt arrangiert waren, heil vorbei zur Theke zu gelangen.
Männer, die, an der Theke lehnend oder im Lokal zirkulierend, immer enthemmter Ausschau hielten nach möglichen Objekten ihrer Begierden, setzten immer wieder ihr Monopol des launigen ersten Wortes an das andere Geschlecht ein, sobald sie sich durch einen Blick oder ein Lächeln oder durch nichts als ihre sich entkrampfende Sehnsucht dazu ermuntert fühlten, der ewige Refrain, wenn die versteinerten Verhältnisse in Tanzlokalen zu tanzen beginnen.
Die Jazzmusik kostümierte sich ausgelassen mit den Konfektionen der musica popular brasileira, über dem Kontrabaß hing ein riesiger Kerl wie eine Spinne, die eine ins Netz gegangene Fliege zerlegt. Ich vergaß mich eine Zeitlang ganz in diesem Anblick einer dunkel-bedrohlichen Sache, der schöne heiter-verführerische Töne entströmten.
Ab und zu kam Yuki zu unserem Tisch, von selbst, um zu fragen, ob wir noch etwas trinken wollten, oder unter dem Vorwand, uns zu fragen, oder weil Norbert sie herwinkte, um noch etwas zu bestellen, oder unter dem Vorwand, noch etwas zu bestellen. Norbert, ein großer Bildhauer ihres Lächelns, machte dann eilig einen kleinen anzüglichen Scherz.
Ich verstand so gut wie nichts von dem, was Norbert sagte, aber ich sah, daß es anzüglich war und daß er es mit der interesselosen Leichtigkeit des Mannes machte, der das, was solche Scherze gemeinhin ersehnen und nur ersetzen, schon gehabt hatte, und Yuki lachte das Lachen einer Frau, die es eben deswegen besser wußte.
Wir gingen zu Caipirinhas über, ich trank hektisch, rauchte hektisch, warum nicht tanzen? Aber das verspielte, befreiende Herstellen nutzloser Bewegungen gerann mir zur anstrengenden Arbeit, die ich für einen anderen machte: für den, der ich sein wollte. Ich schwitzte, öffnete die Augen, wollte lieber alle anderen außer sich sehen, als mich selbst von außen.
Ich sah einen kleinen freien Platz an der Theke, dort lehnte ich mich hin und ruhte mich aus. Neben mir, mit dem Rücken zu mir, ein Mädchen in knappen Jeans und einem Tomara-que-caia, diesem hautengen, ärmel- und trägerlosen Oberteil. Sie drehte sich um und stieß dabei an mich an, sie lächelte um Entschuldigung, ich lächelte reflexartig zurück, statt einfach auch zu lächeln.
Ich stand an die Theke gelehnt und wippte umständlich in der Musik, da machte das Mädchen zwei Schritte von der Theke weg auf die Tanzfläche und zeigte mir, wie gut sie tanzte. War das eine Aufforderung? Ich folgte ihr und versuchte, die Bewegungen des Mädchens nachzuahmen. Ich kam mir so hölzern vor – mit den Füßen dem Boden verhaftet, sosehr ich sie auch immer wieder heben, sosehr ich diesen auch treten und zu verlassen versuchen mochte, kein Sich-Fortschwingen der Bewegung, die immer irgendwo bewußt hergestellt sein mußte, ohne daß ihr die übrigen Glieder automatisch folgten und ohne daß die Erschütterungen in eine rhythmische Bewegung des ganzen Körpers übergingen.
Mein Schwerpunkt rutschte mir in die Knie, die Schienbeine und die Füße, die zu heben mir beinahe unmöglich wurde, während die Bewegungen, die ich mit dem Oberkörper und den Armen anstrengte, eckig ausfielen. Ich konnte mir andere Richtungen und Möglichkeiten meiner Bewegungen ausdenken, aber ich vollzog sie ohne Ruhe, Leichtigkeit und Anmut, weil im bewußten Widerstand gegen das Gesetz der Schwere, anstatt meine Glieder rund und rhythmisch auszupendeln. Je mehr das Bewußtsein den Bewegungen Zusammenhang geben wollte, desto mehr zerstörte es ihn: Die Idee einer Bewegung trennte diese von den anderen Bewegungen, und der Versuch, die Glieder zu koordinieren, lähmte die gerade nicht bedachten. Jedes schien ein Eigenleben zu haben, das von den anderen wegstrebte. Worauf ließ ich mich da ein? Nun ertappte ich mich dabei, wie ich mir etwas Schweiß von der Stirn wischen wollte, so als würde ich mich beiläufig, eventuell nachdenklich, an der Stirn kratzen. Das reichte. Warum konnte ich nicht ganz normal selbstvergessen sein? Ich nahm die Hand des Mädchens, küßte sie, sie entzog sie mir in dem Moment, in dem ich sie losließ, ihre Hand hüpfte geradezu aus der meinen heraus.
»Tudo bem?« fragte sie befremdet amüsiert.
»Tudo bem!« versicherte ich und ging brennend vor Scham und erleichtert zum Tisch zurück.
»Und?« Die Mitternachtsstunde war überschritten. Die Kostümierten gefielen sich und forderten voneinander zu gefallen. Die Königin des Karnevals machte auf der Tanzfläche zur schnellen Musik die langsamen, leeren Repräsentationsgesten einer Königin des Karnevals und war sichtlich glücklich, zumal ein junger, gelenkiger Bursche in tiefer Hocke, den Oberkörper weit zurückgebogen, vibrierend sich immer wieder zu ihr hinschob, wobei er ein imaginäres Tamburin klopfte.
Ein Mann, der sich mit einem weißen, weitgeöffneten Hemd und einer großen goldenen Kette auf der behaarten und gebräunten Brust schöngemacht hatte, tanzte gemessen und wählerisch durch das Gewühl, ein Paris, der den Mädchen seiner Wahl seine Brust reichte, indem er sie immer wieder rhythmisch vor- und auf die Mädchen zuschob. Sein Tanz zeigte ein unglaubliches Ökonomiebewußtsein: er war kräftesparend und doch aussagekräftig. Dabei bürgten die geschlossenen Augen für ein tiefes Empfinden, denn sie sagten: Ich bin in diesem versunken!
Chacrinha drückte gelegentlich seine Hupe und forderte zu heiterem Lachen heraus, indem er einen dann so direkt anlachte, daß man nicht umhin kam, pflichtschuldig zurückzulachen.
Am besten gefielen mir die tänzerischen Bewegungen Yukis. Sie hingen von einem Zweck ab: volle Gläser und Teller ruhig zu balancieren, mit ihnen geschickt Hindernissen ausweichen und sich elastisch vorbeischmiegen zu müssen. Als sie wieder zu unserem Tisch kam, zog Norbert sie eng zu sich und sagte etwas, wobei er rasch zwischendurch zu mir schaute, schelmisch, und zugleich so, als würde er mit dem Kopf auf mich deuten.
Yuki lachte, schüttelte ungläubig den Kopf und sah mich an.
Wirklich wahr! hörte ich Norbert in gespieltem Ernst beteuern, er sagte noch etwas, wobei er sich im Sitzen näher zu ihrem Ohr streckte. Jetzt lachte Yuki auf, sah mich an, schmunzelnd, wechselte einen Satz mit Norbert, sagte, sich von ihm lösend, »Warum nicht?« und verschwand wieder in ihrer Geschäftigkeit.
»Und? Siehste!«
Norbert sah sich um, mit aufwendigen Drehungen seines Oberkörpers sah er mal dorthin, mal dahin.
»Unglaublich. Wollen alle nur bumsen, hier. Nur bumsen!«
Dann geschah etwas Unerwartetes. Die Frauen, schöngemacht oder kostümiert, die Männer, sich selbst oder Männerbilder darstellend, keiner von ihnen schien daran gedacht zu haben: daß eine Reihe von Menschen das Motto des Kostümfests wörtlich nehmen und in der nächstliegenden aller möglichen Verkleidungen erscheinen würde: nämlich tatsächlich als schöne Brasilianerin verkleidet.
Plötzlich schien das Lokal voll von Transvestiten zu sein, aber es waren nicht viele, es schien nur so, als sie plötzlich da waren und alles auf den Kopf oder vom Kopf auf die Füße stellten. Nun wurde das Versprechen des Festes, das im Motto nur versteckt sein wollte, nicht mehr hinter den Kostümierungen einzulösen versucht, sondern in ihnen dargestellt. Es waren vielleicht fünf oder sechs Transvestiten, in aufreizenden Kleidern, Stöckelschuhen, mit grell geschminkten Gesichtern. Zwei von ihnen hatten mächtig ausgepolsterte Busen und Po. Mit schwingenden Hüften wiegten sie durch das Lokal, tänzelnd, herausfordernd, Schmollmund, gehauchte Küsse, mit übertrieben femininen Gesten schafften sie sich energisch Platz, die versuchte Geilheit des Festes wich ängstlich zurück vor der höhnischen Laszivität der Transvestiten. Nun wurden die Ansprecher angesprochen. Wie wär’s mit uns, Süßer? – Aber ohne Antwort abzuwarten schwirrten die Transvestiten immer weiter, nie zufrieden, weitersuchend, sie verteilten Küßchen an Burschen und suchten richtige Männer. Es regte sich Widerstand. Am Nebentisch stand ein grobschlächtiger Schönling auf, verkündete etwas, mit nervösem Lachen angefeuert von seinen zwei Freunden.
Was hat er gesagt, fragte ich Norbert, er lachte:
»Ob die Titten echt sind, will er schauen!«
»Vamos ver!« feuerte sich dieser nochmals an. Mit einem kurzen tastenden Griff kontrollierte er seinen Helm eines Eroberers, sein präzise föngeformtes Haar. Er klirrte, wenn er ging, wie in einer Rüstung: An einer Gürtelschlaufe seiner Hose hing ein Schlüsselbund.
Die Großbusige, nur wenige Schritte von ihm entfernt, hatte eine Hand in die Hüfte gestemmt, mit der anderen schwang sie ihre lange Glasperlenkette und erwartete ihn mit vorgestrecktem Busen und neugierig zurückgeworfenem Kopf. Als der Ritter vor ihr stand, löste sie ihre Hand von der Hüfte, schlug ihre langen falschen Wimpern einige Male auf und nieder und griff ihm zwischen die Beine, zog ihre Hand wieder zurück, machte ein schmollendes, enttäuschtes Gesicht und ging hüftschwingend davon und suchte einen Mann.
Breitbeinig, die Daumen in den Hosenbund gehakt, kam der Schönling zum Tisch zurück und lachte lauter als seine Freunde. Sein gerötetes Gesicht glänzte wie ein kleiner runder Spiegel, der gelassen das verlegene Gesicht dieses Burschen zeigte.
Ein Transvestit begann zu tanzen, sanft und rhythmisch strich sie mit den Händen über die Konturen ihrer Rundungen, die sie in die Musik streckte und darin wiegte. Als würde sie in der Musik duschen, sich reinigen von den Blicken, die sie auf sich gerichtet sah, wenn sie erstaunt und fragend aufschaute.
Manche der Umstehenden lachten begeistert und klatschten anfeuernd im Takt, manche lachten verhalten, maskenhaft, manche Frauen hatten einen Gesichtsausdruck, als hätten sie ihre Männer in ein Striptease-Lokal begleiten müssen.
Plötzlich stand Yuki neben mir, sie schaute dem Treiben zu, sah dann mich amüsiert an und ging wieder weg.
Hier! … Siehste! … Da! … Sieh mal! … Und? Der Arsch? Was? … Verstehste … Norbert leitete meine Aufmerksamkeit an, mit dem Stolz und zugleich der zynischen Distanz, als wäre er der Direktor solcher Showproduktionen.
Die Show ging übrigens nicht weiter.
Der irritierende Auftritt der Transvestiten konnte überraschend schnell vom Fest absorbiert werden. Sie hatten ihre Show gehabt, die Spannung, die sie produziert hatten, löste sich auf in der heiteren Zufriedenheit darüber, daß etwas Außerordentliches geboten worden war. Der Hohn, den sie über das Fest geschüttet hatten, verdampfte als bizarres Duftwasser. Nun waren sie nur noch ein Bestandteil des Geschehens, bunte Vögel, wie sie eben zu einem Kostümfest gehören, und man ging wieder den normalen Festgeschäften nach.
Zwei Mädchen begannen zu tanzen, dann ein Bursche, und das Gedränge rund um die Tanzfläche lockerte sich rasch, weil die, die zurückgetreten waren, um dem tanzenden Transvestiten Platz zu machen und zuzuschauen, nach und nach wieder auf die Tanzfläche zurückströmten.
Norbert und ich besprachen die Ereignisse, aber wir besprachen sie auch schon als etwas, das abgeschlossene Geschichte war. Norbert trank seine Caipirinha aus und sagte, er sei müde und wolle gehen. Na gut, gehen wir! – Du nicht! sagte er, du kannst noch nicht gehen. – Warum nicht? – Na klar, du bleibst mal da, du willst doch die Yuki bumsen, oder nicht?
Ich sah ihn müde und angespannt an.
Er habe ihr doch vorhin gesagt, daß sie offenbar eine besondere Ausstrahlung auf uns Deutsche beziehungsweise Österreicher habe. Er habe sie ja schon gebumst, wie ich mir vorstellen könne!
Er habe dann also zu ihr gesagt, wie gut sie mir gefalle.
Ach so? Ja! Und? Sie will mit dir bumsen! Das hat sie einfach so gesagt? Na ja, das habe ich sie gefragt! Das hast du sie gefragt? Natürlich nicht so, sagte er, er habe sie gefragt, ob sie gern hätte, sagte er, daß ich nachher ihr »Katerchen« sei. Sie wolle. Das müsse ich doch mitbekommen haben! Also, viel Spaß! Tschau!
Norbert! rief ich ihm nach, während er, sich umdrehend, um wegzuhasten, gegen die Menschenmauer prallte, also drehte er sich wieder zu mir. Und? Ich fragte ihn, ob er das ernst gemeint habe und wie er sich das vorstelle.
Norbert lachte vergnügt und gütig, geradezu deus-ex-machistisch. Er erklärte, ich sollte bloß dableiben und warten, bis Yuki zu arbeiten aufhöre. Wenn sie vorbeikäme, solle ich sie freundlich anlächeln, ein bißchen zu mir herziehen, »lieb, verstehste!«, was Nettes sagen, »mal rasch ’nen Kuß geben« gar. Sie müsse ohnehin pausenlos herumschwirren. Was eben, wenn sie vorbeikomme, möglich sei, nur damit sie sehe, daß ich auf sie warte.
Mir war mulmig. Aber was mir gefiel, war, daß ich nichts erarbeiten mußte. Bloß dasitzen, schauen, in schöner Aussicht, trinken.
Es war halb zwei Uhr. Es entsprach vielleicht nicht ganz Norberts Anleitungen, aber als Yuki wieder vorbeikam, fragte ich sie, bis wieviel Uhr sie hier arbeiten müsse. Sie sagte, mais ou menos bis vier.
Es war halb fünf, als ich mit Yuki vor dem Lokal stand, fast dreiviertel fünf, als wir ein Taxi fanden.
Ihre Wohnung war näher, wir fuhren zu ihr.