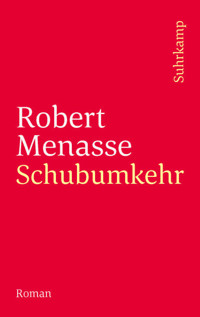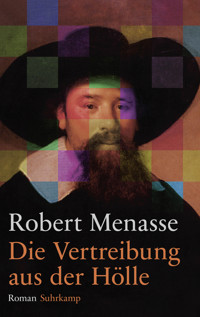
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was ist aus uns bloß geworden? Bei einem Klassentreffen, 25 Jahre nach dem Abitur, herrscht fröhliche Selbstzufriedenheit – bis Viktor seine ehemaligen Schulkollegen mit der Nazi-Vergangenheit ihrer Lehrer konfrontiert. Es kommt zu einem Eklat, der aus dieser Nacht eine Abenteuerreise in die Geschichte macht.
Viktor Abravanel, geboren 1955 in Wien, stammt aus einer Familie von Nazi-Opfern. Er wurde Historiker, Spezialist für Frühe Neuzeit. Bei einem Spinoza-Kongreß soll er einen Vortrag halten über das Thema »Wer war Spinozas Lehrer?«. Diese Arbeit und die damit verbundenen Recherchen mögen ihn auf die Idee gebracht haben, beim Klassentreffen, am Vorabend seiner Abreise nach Amsterdam, die Frage zu stellen: »Wer waren unsere Lehrer?« Der Lehrer von Baruch Spinoza war der Rabbiner Samuel Manasseh ben Israel, geboren 1604 in Lissabon, der als Kind mit seinen Eltern vor der Inquisition nach Amsterdam flüchtete. Die Rekonstruktion der Biographie dieses Rabbi und Viktors Erinnerungen an seine Schüler- und Studentenzeit zeigen verblüffende Parallellen. Wäre das die Erklärung dafür, daß unsere Biographien nach den Tragödien unserer Väter und Vorväter nur noch Farcen sind? Oder finden wir in der Geschichte immer nur Geschichten, die uns bekannt vorkommen? Im Grunde haben wir zu allen Zeiten immer dieselbe Lehrerin: die Geschichte. Und immer sind wir schlechte Schüler.
Robert Menasse hat einen großen Zeitroman geschrieben, der zwischen den Zeiten oszilliert. Die Erzählung, »wie es wirklich war«, zeigt am Ende: unseren Umgang mit Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 733
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Robert Menasse
Die Vertreibung aus der Hölle
Roman
Suhrkamp
Die Vertreibung aus der Hölle
»The Sphinx must solve her own riddle.
If the whole history is in one man,
it is all to be explained from individual experience.«
R. W. Emerson, Essays on History
»Nur eine Macht kann die Wahrheit besiegen:
Die Macht. Nur eine Macht
Kann die Macht besiegen: Die Wahrheit.
Am Ende sehen sich beide als Verlierer.«
Samuel Menasse, Uma Vida
»You arrive, confused, disoriented.
All you know is, you're looking for your partner.
All you carry with you is the knowledge
you've grown to accept as the truth.
But you're about to discover
that what the truth is depends
on what world you're in.«
OBSIDIAN. An incredibly challenging CD-ROMMystery, SegaSoft Inc.
»Gib acht, mein Augenlicht! Das ist ein Liebesbrief.
Lies ihn nicht, denn Du wirst mich verachten — Wegen der Hohlheit meiner Worte, wegen der unfreiwilligen Komik
meiner Empfindungen. Oder:
Du betrinkst Dich, langst kräftig dem Wein zu — Dann allerdings wirst Du mich lieben, wenn Du das liest, wegen der Tiefe meiner Empfindungen und
zugleich wegen des Schalks in meinen Worten.
Trink! Und dann erst lies, wie ich Dir meine Liebe gestehe!«
Uriel da Costa, Carta de dispedida
»Leicht würde ich sterben,
wäre ich unsterblich.
So aber werde ich jammern und schreien,
wenn sie das Feuer setzen.
Wie kann ich gefaßt sein,
wenn ich weiß:
soviel ist ungeschrieben geblieben —
auf ewig!«
Ephraim Bueno, Diario do inferno
»Ich habe auch die komische Vorstellung, daß ich das alles meinen Enkeln erzählen möchte. Obwohl ich gar nicht vorhabe, Kinder zu bekommen. Aber das ist in mir drinnen. So wie mir meine Tante erzählt hat. Sie ist schon sehr alt und könnte meine Oma sein. So werde ich dann erzählen, und für die Enkel wird es genauso weit weg und unfaßbar klingen … Alle Geschichten, die mir erzählt werden, sind immer nur kleine Teile. Es handelt sich um einen Tag, und von dem hört man zehnmal, es ist etwas, das sie eben besonders berührt hat. Jetzt ist es eben viel, weil — Man erlebt es selbst. Aber es wird genauso sein: Es werden nur ein paar Sachen bleiben …Und habe dann immer so, ich weiß nicht —
Ich hebe mir Zeitungen auf …Irgendwann werde ich mir das durchlesen, wie das war.«
Anja, 23 Jahre, in: »Gespräche in Wien«, Videofilm von J. Holzhausen, Wien 1999
»daß Baruch, der niemals
Weinende
rund um dich die
kantige,
unverstandene, sehende
Träne zurecht-
schleife«
Paul Celan
Sie werden das Haus anzünden. Wir werden verbrennen. Wenn wir hinauslaufen, werden sie uns erschlagen.
Er sah die Fackeln vor den Fensterläden aufblitzen, er hörte den Radau, den die Menschen draußen machten, sie sangen, schrien, grölten.
Das war ein Trauerzug. Durch die Straßen bewegte sich der größte Trauerzug, den das Städtchen Vila dos Começos je gesehen hatte, und der seltsamste: Ein Trauerzug, in dem niemand trauerte.
Zwei Rappen, geschmückt mit lila Stoffrosetten, zogen den Leichenwagen, auf dem ein so kleiner Sarg lag, daß er für ein neugeborenes Kind bemessen schien. Dahinter schritt, mit beiden Händen ein Kruzifix in die Höhe haltend, Kardinal João d'Almeida aus Evora, in blutrotem Talar und mit rotem Birett, über den Schultern die hermelinbesetzte Cappa Magna, deren Schleppe von vier Domherren in lila Talaren getragen wurde. Es folgten die Pfarrer von Começos und den umliegenden Gemeinden in schwarzen Soutanen, mit weißen Chorhemden und violetten Stolen. Die Adeligen, in purpurnem Samt mit breiten Ledergürteln, trugen ihre Degen gezückt, mit gesenkter Spitze. Die Vertreter der Gemeindeverwaltung und des Bürgerstands, in schwarzen Anzügen und großen schwarzen Hüten, trugen Fackeln, deren Rußfahnen einen Trauerflor um die Sonne zeichneten.
All dieser Pomp, der einem Staatsbegräbnis angemessen gewesen wäre, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Stimmung von Wut, Haß und Mordlust geprägt war. Fast ganz Começos befand sich auf den Beinen und reihte sich in diesen Umzug ein, mit dem eine Katze zu Grabe getragen wurde. Sie murmelten keine Gebete, sondern Verwünschungen, sie falteten nicht die Hände, sondern schüttelten ihre Fäuste. Ihre Gesichter waren nicht von der Sonne gerötet, sondern vom hochprozentigen Bagaço, und nicht von Trauer gezeichnet, sondern von der Gier nach Totschlag, Brandschatzung und Plünderung.
Der Klerus sang nun den Choral Martyrium Christi, der aber von den Menschen übertönt wurde, die, wenn sie an bestimmten Häusern vorbeizogen, nach vorne zu den Fackelträgern schrien: »Auf dieses Dach mit euren Fackeln!«
Der Trauerzug bog in die Rua da Consolação ein, in dem winzigen Sarg eine Katze, die nicht älter als acht oder neun Monate geworden war, eine kleine schwarze Katze mit weißen Flecken um die Augen wie eine Maske. »Los! Auf dieses Dach mit euren Fackeln!« Das war nun das Haus der Soeiros.
Antonia Soeira war eine der wenigen, die nicht auf der Straße waren. Sie stand mit ihren Kindern Estrela und Manoel hinter dem Fenster, schaute vorsichtig durch die Ritzen der geschlossenen Fensterläden, zog, als der Lärm draußen immer bedrohlicher anschwoll, die Kinder ins Innere des Zimmers zurück und sagte: »Diese Irren werden die Katze noch zu Gott erklären. Soll sie im katholischen Himmel die Taube fressen!«
Der Grund für die große Erregung, die Começos und Umgebung erfaßt hatte, war, daß diese Katze gekreuzigt worden war. Sie ist, mit schweren Eisennägeln auf ein Holzkreuz geschlagen, vor der Casa da Misericordia gefunden worden. Den Männern der Kirche war augenblicklich klar, daß sie mit einer groß inszenierten Bestattung, die der Kreuzigung ihre heilige Würde zurückgeben sollte, die Bevölkerung geschlossen und fanatisch auf den Kampf gegen Ketzer und Häretiker verpflichten würden können — zwei Wochen zuvor war die Inquisition in Começos eingezogen.
Der Gesang und das Geschrei draußen entfernten sich, und der Junge stand mitten in dem dunklen Zimmer, mit dem Impuls zu laufen, so schnell und so weit zu laufen, wie er nur konnte, aber er war völlig starr. Bevor er vom Fenster zurückgezogen worden war, hatte er gerade noch den Sarg auf dem Wagen erspäht, diesen winzigen Sarg, und dabei zum ersten Mal gedacht, daß er seinen Vater wohl nie wiedersehen würde. Der Vater war einer der ersten gewesen, die vom Heiligen Offizium verhaftet worden waren.
Gezogen von den nachtschwarzen Pferden, der Sarg im rötlichen Licht, als würde die Sonne untergehen und der Purpur des Kardinals auflodern. Ein letzter Sonnenuntergang, ein Weltuntergang.
Immer hatte Manoel vor Sonnenuntergang zu Hause sein müssen, einst, wenn er auf die Gasse gelaufen war, um seine Freunde zu treffen. Darauf hatte sein Vater unerbittlich Wert gelegt: Vor Sonnenuntergang. Wehe, er kam danach. Warum? Es hatte keine Erklärungen gegeben, und als er verstand, war es zu spät.
Sein Vater war ein fettleibiger Mann, ohne jede Eleganz, der sich immer sehr penibel, aber nie vornehm kleidete. Auf der Wange hatte er eine große halbmondförmige Narbe, die Manoel anwiderte und erschreckte. Immer wieder hatte er sich vor seinen Kindern aufgebaut, um sie zu maßregeln. Er sprach leise, fast rauh, ohne jede Klarheit. Abends las er still in einem Buch, über dem er vermoderte. Manoel war dazu angehalten worden, Senhor zu ihm zu sagen, aber er war für ihn kein Senhor, er empfand ihn als schlechten Senhor-Darsteller. Er schlug die Augen vor ihm nieder, aus Furcht, aber auch aus Verachtung: Er konnte nicht zu ihm aufschauen.
Jetzt aber war es der Gedanke, den Vater nie wiederzusehen, der ihm unermeßlich angst machte. Der Lärm des Trauerzugs war noch von fern zu hören, und Manoel spürte das Pochen seines Herzens bis in den Kopf, in einem so harten Rhythmus, als versuchte es verzweifelt, sich irgendwie mit dem Getrommel und rhythmisch skandierten Geschrei da draußen in Übereinstimmung zu bringen. Es gab keine Übereinstimmung mehr. Sie werden uns alle töten.
Nun hörte er, daß seine Mutter und Estrela miteinander sprachen, sie sprachen leise, aber ihre Stimmen klangen eigentümlich kalt und sachlich. Obwohl Estrela nur vier Jahre älter war als der achtjährige Mané, war sie doch schon eine kleine Erwachsene, ein getreues Ebenbild, wenn nicht gar ein Abklatsch der Mutter. Das spitze, verhältnismäßig kleine Gesicht mit den harten, verkniffenen Zügen, und der rundliche Körper, der aber, vielleicht wegen des Eindrucks, den das Gesicht machte, nicht weich wirkte, sondern energisch, unbeugsam, stark, jeder Muskel doppelt und dreifach dick, unter dem vielen schwarzen Tuch. Sie sprachen über Schutzmaßnahmen, die getroffen werden könnten und auch darüber, daß Flucht nicht in Frage käme, solange der Vater nicht zurück sei, sie sagten »zurück«, als ob der Vater bloß verreist wäre. Manoel irritierte dieses Gespräch, seltsamerweise war es ihm peinlich, so als würden sich seine Mutter und seine Schwester mit einem unangemessenen, grotesken Verhalten vor aller Augen lächerlich machen.
»Und dann haben wir auch noch das Problem mit —«, sagte Estrela in dem Moment, als Mané aufschaute, seine Schwester brach ab, und er starrte in die Gesichter der beiden Frauen, die schweigend auf ihn blickten. Er sah sich nun selbst mit deren Augen und hatte dabei das Gefühl, etwas zu sehen, was er nicht hätte sehen dürfen. Seine Angst, aber auch seine Ergebenheit: daß ihm so peinlich und unnütz erschien, wie die Mutter und Estrela reagierten. Wenn er bisher etwas gelernt hatte, dann dies: Man mußte in das Spiel passen, die Rolle, die man hatte, erfüllen. Das war kein klarer Gedanke, aber er war dennoch deutlich in ihm: Die Menschen da draußen konnten nicht anders, sie mußten das tun. Und er konnte nicht anders und mußte es hinnehmen. Er hatte die Konsequenzen dessen, was er getan hatte, nicht abschätzen können, und doch waren sie einkalkuliert. Er mußte sie hinnehmen. Alles andere würde den Zorn der Menschen und die Greuel nur steigern.
Er konnte kaum atmen vor Angst, und doch war es, wenn auch sehr übersteigert, nur die Angst eines Kindes vor einer Strafe, die es erwarten hatte müssen.
Er hatte gewußt, daß es einen Skandal geben werde, und er hatte ihn auch haben wollen, einen Skandal, der unvergeßlich bleiben sollte, im Gegensatz zu all den kleinen Gemeinheiten, die so klein nicht gewesen sind, jedenfalls jetzt vergessen waren oder aber wie Schnurren erzählt werden würden, mit verblödeter Altersmilde, grinsend, vielleicht lachend, sich auf die feisten Schenkel schlagend, alles vergeben und vergessen im Namen der Erinnerung.
Er hatte sich darauf vorbereitet. Er hatte versucht, sich vorher vorzustellen, wer wie reagieren werde. Er war bereit gewesen, alles hinzunehmen, alle Konsequenzen zu ertragen, für dieses Schauspiel, das er inszenieren, das er unbedingt sehen wollte. Und als es soweit war, alles wie vorhergesehen, war es doch viel bedrohlicher, als er es sich ausmalen hatte können. Er hatte Schweigen erwartet, und dann Geschrei, aber nicht diese Stille und dann diesen Schrei. Wut, Aggressionen, natürlich, er dachte, er sei gewappnet, aber gegen diese Wut aller, gegen diese einhelligen Aggressionen? Nein, so reiflich er alles bedacht hatte, er hatte doch nicht gewußt, was er tat.
Das fünfundzwanzigjährige Maturajubiläum. Viktor war nie zuvor zu einem Klassentreffen gegangen, hatte, wenn er sich richtig erinnerte, schon seit gut zwanzig Jahren nicht einmal mehr Einladungen bekommen. Vielleicht hatten sie akzeptiert, daß er ohnehin nicht hingehen würde, vielleicht aber hatte es auch gar keine Treffen mehr gegeben, weil wohl schon bei den ersten kaum einer erschienen war. Die Klasse war nie eine »Verschworene Schicksalsgemeinschaft« gewesen, wie ihre Erzieher das Ideal damals formuliert hatten. Nachdem sie alle die Maturaprüfung bestanden und die Abschlußzeugnisse in Empfang genommen hatten, waren sie einfach auseinandergegangen, auf kalte Weise froh, die anderen nie wiedersehen zu müssen. Diese Klasse hatte auch mit der alten Schultradition einer Maturareise gebrochen, in der Regel ein Flug mit dem Klassenvorstand und dem Griechischlehrer nach Athen, zur Akropolis, ein letztes Klassenfoto vor dem Parthenon, ein erster großer Rausch von Ouzo oder Retsina. Sie sind der erste Maturajahrgang gewesen, der einhellig und ohne lange Diskussion klargemacht hatte, daß an einer solchen Abschlußreise kein Interesse bestünde.
Und nun, fünfundzwanzig Jahre später, fanden sie sich im Hinterzimmer vom »Goldenen Kalb«, einem Restaurant fünf Minuten von der ehemaligen Schule entfernt, vollzählig ein. Sentimental und neugierig standen sie vor einer langen gedeckten Tafel, auf der Aperitifgläser, Weißweingläser und Rotweingläser auf eine Feier warteten, die dann gezählte fünfundzwanzig Minuten dauern sollte, aus anderer Perspektive die ganze Nacht bis zum Sonnenaufgang — aber beides war zu diesem Zeitpunkt von niemandem vorherzusehen.
Diese vielen Ausrufezeichen nach jedem Satz! Fünfundzwanzig Jahre!! Ein Vierteljahrhundert!!! Viktor hatte feiste Männer mit Glatzen, mollige Mütter erwartet, aber die meisten hatten sich physisch sehr gut gehalten, sie selbst waren entzückt davon, sprachen es immer wieder anerkennend aus und nahmen befriedigt Anerkennung entgegen. Im Grunde war Viktor der einzige, dessen Haar deutlich schütter geworden war und dessen Körper sichtlich begonnen hatte, sich zu entgrenzen. Aber so glücklich auch alle Gesichter glänzten, die Stimmung war verkrampft. Sollte man den Gymnasiasten hervorkehren, der man gewesen war, in die alte Rolle zurückfallen, die man vor so vielen Jahren im Kreis dieser Menschen innegehabt oder zugeschrieben bekommen hatte, oder einfach demonstrieren, was und wie man danach geworden war, wie weit man es im Leben gebracht hatte? Viktor konnte nicht entscheiden, ob gesetzte und biedere Menschen auf infantil oder infantil gebliebene Menschen auf gesetzt taten, während jeder neu Ankommende mit lautem Hallo begrüßt wurde. Er war auch überrascht, daß nicht nur der Schuldirektor, sondern auch viele ehemalige Lehrer gekommen waren. Nicht nur, weil er kaum glauben konnte, daß sie sich wirklich noch an Schüler erinnern konnten, die sie vor über einem Vierteljahrhundert unterrichtet hatten, — er wunderte sich schlicht darüber, daß sie noch lebten. Und es verwirrte ihn, mit welchen Gefühlen er sie nun beobachtete: Frau Professor Rehak zum Beispiel, ihre damalige Mathematiklehrerin, die er gehaßt und gefürchtet hatte, und die von allen immer nur als »der Giftzwerg« apostrophiert worden war, ist eine beeindruckend schöne alte Dame geworden, sehr wach, sehr neugierig, imstande, alle mit ihren Namen anzusprechen. Oder Frau Professor Schneider, Mädchenturnen, mit ihr hatte er natürlich nie zu tun gehabt, aber er konnte sich erinnern, daß sie einmal Hildegund geohrfeigt hatte, nur weil sie mit Jeans in die Schule gekommen war — jetzt saß sie da wie eine moderne Großmutter aus der Werbung, wie man sie sich selbst gewünscht hätte, die mit ihren Enkelkindern Radtouren unternimmt und ihnen die Markenjeans kauft, die den Eltern zu teuer sind. Professor Spazierer, Latein: Sein rotglänzendes heiteres Gesicht strahlte auf vorbildliche Weise eine Genußsucht aus, die von keinem Alter, sondern erst vom Tod gebrochen werden konnte. Wie hatte Viktor ihn gehaßt, als er ihm bei einer Versetzungsprüfung besonders gemeine Fragen stellte, so daß Viktor nicht bestand und die ganzen Sommerferien für eine Nachprüfung lernen mußte. Damals hatte Prof. Spazierer zu ihm gesagt: »Wenn du in einem humanistischen Gymnasium bestehen willst, dann mußt du endlich begreifen: Humanismus hat nichts mit human zu tun! Setzen!«
Sie setzten sich zu Tisch.
Vierzehn Burschen, acht Mädchen — wie selbstverständlich diese Männer und Frauen sich bereits wieder als Burschen und Mädchen bezeichneten! —, sieben ehemalige Lehrer und der Schuldirektor, dreißig Personen, die ein wenig steif dem Oberkellner in Schwarz und den beiden Piccolos in weißen Jacketts zuschauten, wie sie Aperitifs einschenkten. Die meisten akzeptierten den Prosecco, nur Eduard wollte einen frisch gepreßten Orangensaft, Thomas einen Kir Royal und Hildegund einen Campari — was erst eigens herbeigeschafft werden mußte. Das steigerte die allgemeine Anspannung, weil keiner es wagte, sein Glas zu heben und zu trinken, bis auch diese drei ihre Wünsche erfüllt bekommen hatten, Viktor sah, wie der Direktor Dr. Preuß unruhig mit Zeigefinger und Daumen am Stiel seines Glases auf- und abfuhr, er wollte offenbar einen vorbereiteten Toast loswerden, der den Abend sozusagen offiziell eröffnen sollte. Sonst Schweigen, Warten, ein grinsendes Hin- und Herblicken, als würde gleich ein Gongschlag ertönen und dann sollte grenzenlose Heiterkeit ausbrechen.
Endlich war es soweit. Der Direktor erhob sich, räusperte sich, begann zu reden. Viktor war peinlich berührt, wie unsicher, wie gekünstelt dieser Mann wirkte, der sie, als sie noch Halbwüchsige gewesen waren, so selbstverständlich hatte einschüchtern können. Er sei stolz und er freue sich und Dank und Anerkennung dem ehemaligen Klassensprecher Magister Fritsch für die Initiative zu diesem Treffen, das eine erfreuliche Verbundenheit der hier Versammelten mit ihrer ehemaligen Schule und er sei stolz und er hoffe und wünsche allen und Danke vielen Dank.
Wie Studenten klopften alle mit den Fingerknöcheln auf den Tisch Beifall, Direktor Preuß hob die Hände, sich bedankend, noch einmal um Ruhe bittend, er wollte noch etwas anfügen.
Die einzige Unwägbarkeit bei Viktors Plan war die Frage gewesen, wie es ihm gelingen würde, die Situation herzustellen, die er zur Umsetzung seines Plans benötigte. Er hatte zunächst abwarten und später, wenn schon einiges mehr getrunken worden war, mit dem Messer an sein Glas klopfen und um allgemeine Aufmerksamkeit bitten wollen, als wollte er einen Trinkspruch anbringen. Aber die Idee, die Direktor Preuß nun hatte, sollte alles auf unerwartete Weise erleichtern und beschleunigen. Er erlaube sich vorzuschlagen, sagte der Direktor, daß die Damen und Herren Ex-Schüler der Reihe nach »in groben Worten, ich meine in groben Zügen« ihren Lebensweg seit der Matura beschreiben mögen. Auf diese Weise würden alle in zumindest groben Zügen sofort das Wichtigste von allen anderen und nicht nur von ihren jeweiligen Tischnachbarn erfahren. Er stelle sich vor, daß dieses Verfahren die grundsätzliche Neugier aller hier Versammelten bedienen und vielleicht die weitere Kommunikation erleichtern würde. Er blickte um sich, und als einige Lehrer durch zustimmende Rufe diese Idee unterstützten, schlug er vor, am Ende des Tisches zu beginnen und dann der Reihe nach, so wie sie hier saßen, vorzugehen, und er bitte also den Herrn Doktor, den Dr. Horak, ja bitte, Herr Doktor, also zu beginnen.
Turek, sagte der Angesprochene, Eduard Turek, und Diplomkaufmann, er habe seinen Diplomkaufmann gemacht — am anderen Ende der Tafel rief man »Lauter! Lauter!«, und Eduard stand auf, wiederholte »Ich habe also meinen Diplomkaufmann gemacht und« — Viktor verkrampfte sich augenblicklich. Er würde, so wie er saß, der dritte sein, oder, wenn er der ihm gegenübersitzenden Maria »selbstverständlich« den Vortritt ließe, als vierter drankommen. Er hatte nicht erwartet, daß sich die Gelegenheit, seinen Coup zu landen, so schnell einstellen würde, nun suchte er nervös das vorbereitete Papier in seinen Sakkotaschen, in der rechten, in der linken — hatte er es vergessen? Eduards Rede rauschte an ihm vorbei, so rauh, daß es schmerzte, Sätze wie »Nun habe ich zweihundert Mitarbeiter unter mir« ließen ihn beinahe aufstöhnen, dann sprach schon Wolfgang, natürlich Rechtsanwalt geworden, natürlich die Kanzlei seines Vaters übernommen, aber nebenbei natürlich »als alter Herr« immer noch »in der Verbindung engagiert«, in der »Bajuvaria« und nicht, wie es heutzutage bei den Genossen schick sei, in der »Toskana«, Gelächter.
Nun blickten alle auf Viktor, der höflich auf Maria deutete und, während sie flüsterte »Nein, nein, rede du zuerst!«, plötzlich das Blatt Papier in der Brusttasche des Sakkos spürte. Viktor stand auf, er spürte, daß er mit einem Mal kalt wurde, er genoß es plötzlich, dazustehen und seinen Blick langsam von einem zum anderen wandern zu lassen, die Gesichter dieser vertrauten Fremden zu betrachten, die so freundlich auf ihn blickten, erwartungsvoll, auch wenn sie von ihm gewiß nicht erwarteten, daß er eine ähnlich beeindruckende Karriere wie die meisten anderen vorweisen konnte.
»Nach der Matura habe ich Geschichte studiert«, sagte er schließlich, »Geschichte und Philosophie.« Er spürte, daß nun alle nur noch wissen wollten, ob er mit Magisterium oder Doktorat abgeschlossen habe, ob er Lehrer oder Wissenschaftler geworden sei, ob er verheiratet sei und wie viele Kinder er habe. »Das Studium der Geschichte«, fuhr er fort, »ist ja nichts anderes als die Beschäftigung mit den Bedingungen der Gewordenheit unseres eigenen Lebens.« Dieser Satz war zu verkrampft, das war ihm augenblicklich klar, er machte eine kurze Pause, nahm das Blatt aus der Brusttasche und sagte, während er es auseinanderfaltete: »Wir sollen jetzt hier unsere Biographien erzählen, aber wir haben selbst nie etwas erfahren von den Biographien jener, die unsere Lehrer waren, die uns erzogen und zweifellos irgendwie geprägt haben, ich meine —«
Viktor schwitzte, und seine Brille rutschte ihm ein wenig die Nase hinunter, er drückte sie mit dem Mittelfinger zurück. Wie gern er Fußball gespielt hatte. Hätte. Aber als Brillenträger — »Ich finde, um zu verstehen, was ein Mensch geworden ist, kann es auch sehr lohnend, sehr erhellend sein, zu fragen: Wer waren seine Lehrer? Wer also waren in groben Worten, wie der Herr Direktor Preuß es formuliert hat, unsere Lehrer?« Er sah den langen Tisch hinauf zu den alten Lehrern, sie grinsten, erwarteten sie jetzt allen Ernstes etwas Launiges? Die fünfundzwanzig Jahre später nachgereichten dürftigen Witzchen der Maturazeitung, die damals keiner schreiben hatte wollen? Viktor schluckte, senkte den Blick auf seine Papiere und sagte: »Prof. Josef Berger, Parteimitglied bei der NSDAP mit der Mitgliedsnummer 7 081 217. Prof. Eugen Buzek, NSDAP-Mitgliedsnummer 1 010 912. Prof. Alfred Daim, NSDAP-Mitgliedsnummer 5 210 619. Frau Prof. Adelheid Fischer, hochrangige BDM-Führerin, ab 1939 Mädelring-Führerin in Wien —« Es herrschte eine so schockstarre Stille, daß er noch zwei Namen und NSDAP-Mitgliedsnummern vortragen konnte, ohne daß irgendeiner sich bewegte oder etwas sagte. Schließlich kam er zu »Prof. Karl Neidhardt, übrigens ein besonders interessanter Fall, er studierte nach Kriegsbeginn Englisch, die Sprache des Feindes — Wieso studiert ein überzeugter Nazi und Deutschtümler Englisch? Eben deshalb. Weil er so überzeugt war. Die Nazis brauchten besonders vertrauenswürdige Leute, die den Feind abhören konnten, und zu dieser Aufgabe wurde Prof. Neidhardt ab August 1943 im Rang eines Oberleutnants im Reichssicherheitshauptamt eingeteilt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, wie er, unser Englischlehrer, eines Tages im Jahr 1965 zu uns in die Klasse kam, um einen Nachruf auf den eben verstorbenen Winston Churchill zu halten. Alle Englischlehrer Österreichs mußten das damals tun. Das war ein Erlaß des Unterrichtsministeriums. Er verlas also diesen Erlaß, in dem Churchill für seine Verdienste um die Befreiung Österreichs gewürdigt wurde, aber ich kann mich bis heute an seinen Gesichtsausdruck erinnern, man sah, daß er sich nur mit Mühe zurückhalten konnte, zu rufen: Das Schwein ist tot!«
Plötzlich ein Knall. Ein Schuß? Ein Donnerschlag? Viktor sah, daß Direktor Preuß so abrupt aufgesprungen sein mußte, daß sein Stuhl umgefallen war, auch Prof. Spazierer und Frau Prof. Rehak standen. »Das Schwein ist tot!« sagte Viktor. »Das war es, was er eigentlich hinausschreien —« Er war erstaunlich weit gekommen, aber nun, das war deutlich, hatte er nur noch Sekunden. »Otto Preuß«, sagte er daher rasch, »NSDAP-Mitgliedsnummer —«
»Aus! Es reicht!« schrie der Direktor mit einer Lautstärke, die jedes Geräusch in diesem Hinterzimmer, jedes weitere Wort Viktors, das Stühlerücken, die ersten aufgebrachten Sätze der ehemaligen Lehrer und Schüler, das Hüsteln und sogar das Atmen niederkartätschte. Und nun, in diese geballte Stille hinein, noch einmal: »Es reicht! Sind Sie wahnsinnig geworden!« Er schnaufte, stand starr aufrecht da, mit angelegten Armen, wippte kurz auf den Fußsohlen vor und zurück, suchte nach Worten und sagte schließlich: »Sie erwarten wohl nicht, daß ich noch länger bleibe.« Er schob mit dem Fuß den umgestürzten Stuhl zur Seite und stürmte hinaus, ihm nach die Lehrer, mit roten Köpfen, starren Mienen, ohne nach rechts oder links zu blicken.
Viktor mußte plötzlich kichern, er stand da und kicherte, er wußte, daß das in diesem Moment fehl am Platz war und geradezu lächerlich wirken mußte, aber er konnte es nicht unterdrücken, es war Ausdruck seines Triumphes und zugleich Reflex seiner Angst, eines unkontrollierbaren, wachsenden Panikgefühls. Er hatte etwas ausgelöst, das er nicht mehr unter Kontrolle halten konnte, die Wogen würden über ihm zusammenschlagen — und das geschah dann auch, schlimmer als er es sich hatte ausmalen können.
Er setzte sich, saß da »so starr und bleich wie eine Wachsfigur«, wie Hildegund später sagen sollte. Direktor und Lehrer waren verschwunden. Außer Viktor hielt es keinen mehr auf seinem Stuhl, Viktor wurde umringt, von allen Seiten gestoßen und angeschrien. Er sah Gesichter, die sich zu ihm hinunterbeugten, Münder, die aufgebracht auf- und zuklappten, haßerfüllte Augen, das verwischte sich so, er saß einfach da und blickte auf, da war die große schwarze Brille von Wolfgang, der harte Mund von Edi, er spürte einen Schlag gegen seinen rechten Oberarm, sah Sätze, die ihm ins Gesicht geschrien — nein, hörte Sätze und sah die Speicheltröpfchen, die ihm zusammen mit den Worten entgegenflogen, wütende Kommentare, die er erst zeitverschoben auffaßte. Du Arschloch. Warum tust du das? Aus uns allen ist doch etwas geworden. Das haben wir doch auch denen zu verdanken. Was haben Mathematik, Griechisch, Latein mit den Nazis zu tun? Du frustrierter Arsch.
Die scheue Red-du-zuerst-Maria sagte: »Du bist wirklich blöd.«
Er sah, wie Toni Neuhold sich zu ihm hinunterbeugte: »Du selbstgerechter Idiot … Du, du bist beim heutigen Zeitgeist der Mitläufer … und du willst jetzt anderen vorwerfen, daß …«
»Was hast du in all den Jahren gemacht? Nur im Dreck gewühlt? Du Stinktier!« — Wer war das? »Du Stinktier!« sagte Karl Cerha noch einmal, ausgerechnet er, der als Schüler wegen hartnäckigen Bettnässens den Spitz- oder Schimpfnamen »Stinktier« gepachtet gehabt hatte.
Viktor sah, wie sich hinter Neuhold der kleine Feldstein vorbeidrückte, mit eingezogenem Kopf, ohne zu ihm herzuschauen, und zur Tür lief — nun verstand er gar nichts mehr. Alle liefen hinaus, den Lehrern nach, wieso? Und: Wieso auch der Feldstein?
Wie lange hatte das gedauert? Sie beschimpften ihn und gingen, andere gingen, ohne sich lange mit Beschimpfungen aufzuhalten, sie sagten nur im Vorbeigehen »Idiot« oder »Trottel« oder »Arschloch«. Das war nach wenigen Minuten vorbei. Was war das? Fühlten sie sich um diesen Abend betrogen? Oder ihre Ausbildung in den Schmutz gezogen? Oder fühlten diese Erben arisierter Anwaltskanzleien und arisierter Arztpraxen ihre Herkunft besudelt und ihre eigene Tüchtigkeit in Frage gestellt? Aber alle? Wieso war dieser Haß so einhellig? Viktor wollte aufstehen, fiel aber gleich wieder auf den Stuhl zurück. Er blickte sich um. Das Hinterzimmer war leer, keiner mehr da. Nein, doch. An der Wand hinter ihm, neben dem pinkfarbenen schweren Vorhang mit den aufgedruckten dunkelroten Rosen, lehnte Hildegund und grinste. Noch einmal sah er sich um, da waren nur Hildegund und er, sonst war keiner mehr da. In diesem Moment kamen dreißig Suppen.
Die Tür sprang auf, der Maître und die beiden Hilfskellner liefen herein mit großen Tabletts, die sie artistisch balancierten. Als sie den leeren Raum sahen, ein Mann saß am Tisch, eine Frau lehnte an der Wand — stoppten sie, stutzten, beinahe wären ihnen die Tabletts mit den Suppen zu Boden gefallen.
»Aber. Wo. Sind die Herrschaften?«
»Fort.«
»Fort. Aber. Wir haben. Es wurden dreißig Menüs bestellt. Und der Wein. Das muß. Wer wird das bezahlen?«
»Wer hat denn reserviert? Wer hat das bestellt?«
»Das muß. Das kann ich sofort. Nachschauen.«
Der Maître stellte sein Tablett auf dem Tisch ab und lief hinaus, die Piccolos hielten die ihren weiter in der Hand, unsicher, was sie tun sollten. Viktor sah Hildegund an, die nun herkam und sich ihm gegenübersetzte. Das war ein Kreuzungspunkt, der eine unvorhergesehene kleine Ewigkeit präjudizierte. Hätte sich Hildegund nicht in diesem Moment zu Viktor gesetzt, die Geschichte wäre nicht weitergegangen. Der Oberkellner kam zurück und las von einem Zettel ab: »Ein Herr Direktor Preuß vom Bundesgymnasium hier —«
»Na eben«, sagte Hildegund, »er hat bestellt, er wird das auch bezahlen. Tragen Sie das Essen auf und schicken Sie die Rechnung an das Gymnasium. Alle dreißig Menüs«, sagte sie und lächelte Viktor an. »Weil es wird natürlich nur bezahlt, was auch serviert worden ist.«
Drei Männer bedienten ein Paar an einer langen Tafel, auf der dreißig Suppen aufgetragen und wieder abserviert wurden, dreißig Portionen Tafelspitz mit den klassischen Beilagen, dreißig Sorbets mit Waldbeeren.
»Ein Digestif gewünscht? Vielleicht ein Vogelbeerschnaps? Sehr zu empfehlen!«
»Ja bitte. Dreißigmal.«
Hildegund legte Wert darauf, daß Viktor Hildegund zu ihr sagte. Als Schülerin hatte sie Hilli genannt werden wollen, später, als Studentin, als ihr das zu kindisch erschienen ist, wurde sie Gundl gerufen. Aber jetzt Hildegund. Unbedingt.
»Ich kann das nicht. Es klingt so —, ich meine, ich habe doch immer Hilli zu dir gesagt. Hildegund klingt so — germanisch. Arisch.«
»Du bist wirklich ein Arschloch.«
»Du hast doch selbst den Namen immer abgelehnt! Deine Eltern waren doch sicher — ich meine, was haben deine Eltern früher gemacht —?«
»Was meine Eltern früher gemacht haben? Sie haben gelebt. Zu ihrer Zeit. Jetzt sind sie tot. Und mein Name ist Hildegund.«
Das Kind hat viele Namen.
Manoel Dias Soeiro — ein ehrwürdiger portugiesischer Name. Manoel, wie jener portugiesische König, der auf besonders grausame Weise die Juden verfolgt und zur Taufe gezwungen hatte. Der beliebteste männliche Vorname bei den alten christlichen Familien des Landes. Ein Kind geheimer jüdischer Herkunft offiziell auf diesen Namen zu taufen war ein fast überdeutliches Zeichen der Anpassung, vielleicht auch der Versuch, die Gefahr im Namen der Gefahr zu bannen. Gleichzeitig versteckte sich in oder hinter diesem Tarnnamen ein alter jüdischer Name, der eigentliche, der wirklich gemeinte, der nur im engsten Familienkreis ausgesprochen wurde: Nicht Immanuel, von dem sich Manoel ableitete, von dem er sich aber bereits als eigenständiger christlicher Name völlig emanzipiert hatte, sondern — Samuel, der alttestamentarische letzte Richter Israels, der Seher und Prophet. So leise, so flüchtig gerufen, daß ein zufälliger Ohrenzeuge, oft sogar das Kind selbst, wieder nur Moel, ein schlampig ausgesprochenes Manoel verstehen konnte.
Das Kind hat viele Namen, nicht nur den der Vernichtung und den der erhofften Erlösung. Sie verschmelzen in den Liebkosungen der Eltern und im Spiel mit anderen Kindern zu Mané, ein doppelbödiger Rufname, denn Mané bedeutet im umgangssprachlichen Portugiesisch auch soviel wie Dummerchen, naiver Mensch — welches Kind ist das nicht? Aber kann ein Kind es sein unter der doppelten Bürde seines öffentlichen und seines geheimen Namens?
Das Kind hat viele Namen. In Mané schwingt auch schon der Name mit, den dieses Kind später erhalten sollte, in Amsterdam, in der Freiheit, als die geflüchteten Marranen ihre Tarnnamen ablegen und durch offen jüdische Namen ersetzen konnten: Manasseh.
Unter diesem Namen wurde er schließlich berühmt, als Schriftsteller und Intellektueller, als Rabbiner und Diplomat. Aber so gut der öffentliche Klang dieses Namens auch werden sollte, als Name eines freien und erfolgreichen Mannes, ein Name, der nichts anderes mehr bedeuten mußte als das, wofür der Träger dieses Namens einstehen konnte — in seinem Innersten sollten ewig Manoel, Samuel und Mané nachhallen, als Echo aus längst vergangener Zeit, aber auch als Echo noch des Rufs, den er sich erst erwarb. Manoel, der Angepaßte, Samuel, der Seher, und Mané, der Naive.
Bevor er Rabbi wurde, war er Antisemit. Das war damals, als Mané mit den Kindern seiner Gasse Edelmänner spielte. Edelmänner. Das war die Welt, in der er sich auskannte. Alles war ideal, und doch allgemeiner Besitz. Ein einfaches Regelsystem, und doch immer aufs neue abenteuerlich und erhebend. Und er bewunderte Fernando, den etwas älteren Knaben, der immer etwas wußte, das die anderen nicht wußten, und der zugleich der stärkste von ihnen war. Der geborene Anführer.
Wenn er Fernando gegenüberstand, spürte er, daß Respekt, ja Furcht, anders als zu Hause, lustvoll sein konnten. Fernandos Füße: lange, feingliedrige, aber starke Zehen, mit harten flachen Nägeln wie bei schönen Händen. Nicht so dickliche weiche Knollen, wie seine eigenen Zehen, die beim Laufen immerfort irgendwo anstießen und gleich schmerzten.
Wenn sie sich balgten, dann wehrte er sich nur zum Schein, nicht weil er ohnehin keine Chance gegen ihn gehabt hätte, sondern weil er nur mit etwas Gegendruck die Kraft voll auskosten und genießen konnte, mit der Fernando ihn niederzwang. Er lag dann da, unter dem auf ihm knienden Fernando, und bewunderte die starken blauen Adern, die sich so deutlich an den Innenseiten von dessen Armen abzeichneten.
Immer wieder kontrollierte er zu Hause, wenn er unbeobachtet war, ob bei ihm, wenn er die Armmuskeln anspannte, nicht auch endlich eine blaue Ader hervorspringen würde, aber es war, als versuchte er, durch die Milch auf den Boden eines Topfs zu blicken.
Die erregte Eilfertigkeit, mit der er sich Fernando unterwarf, machte ihn zu seinem Vasallen, aber war er als solcher nicht Teil der immer siegreichen, edlen Macht? Fernando, der Sohn des Tischlers, verkörperte für ihn das Ideal des Edelmanns. Er trug den Haselnußstecken so elegant wie einen Degen, bewegte sich ohne Schuhe, als hätte er Stiefel aus feinstem Leder an, und seine Muskeln, erworben an der väterlichen Hobelbank, schienen das Erbe des jahrhundertelangen unbeugsamen Kampfes gegen die Ungläubigen zu sein. Wie erbärmlich dagegen der eigene Vater, ein Eisenwarenhändler, im Grunde ein Nägelverkäufer, immer pedantisch, aber nie edel gekleidet. Und wie er redete. Im Geschäft devot, zur Familie wohl sehr bestimmt, aber leise, fast rauh, ohne jede Eleganz und Klarheit. Und immer so kleinlich. Bist du der Besen von Começos? hatte der Vater gesagt, als er keuchend vor ihm stand. An deiner Kleidung klebt der Staub der ganzen Stadt.
Er starrte auf die peinlich saubere, aber grobe Hose des Vaters, sagte nichts. Wie fadenscheinig sein Vater wirkte. Er sagte nichts. Er tat, was sein Vater wollte, aber er war sein Feind. Der Feind der Mutter nicht. Sie, mit ihrem vielen Tuch, erinnerte ihn irgendwie an die heilige Muttergottes Maria, wie sie überall dargestellt war, auf den großen Gemälden in der Kirche, eingestickt in Fahnen, aufgemalt auf Fliesen, mit ihrem weiten Umhang, unter dem sie Schutz bot. Aber der Vater —
Wenn er mit Fernando spielte, vergaß er, wie er selbst aussah, daß er der Sohn seines Vaters war, dieses feisten, vor sich hinfaulenden Mannes. Sag mir, warum, Senhor, einmal: Warum? Das gab es nicht. Keine Erklärungen. Das mußte so sein, und dies so.
Was Fernando alles wußte! Davon könne man ausgehen, sagte er, daß so gut wie alle Ärzte geheime Juden seien. Warum? Er blickte in die Runde, auf die Kinder, die erstarrt dasaßen und ihre Arme noch fester um ihre Knie drückten, als suchten sie Halt. Die Juden, sagte er, ließen eines ihrer Kinder immer Arzt werden, oder Apotheker, weil sie dadurch die beste Möglichkeit hatten, das Volk zu vergiften.
Auch die de Souzas?
Auch die de Souzas. Höchstwahrscheinlich. Es käme auf eine Probe an.
Aber sieht man sie nicht jeden Sonntag beim Gottesdienst und —
Fernando unterbrach mit einer groß ausgeführten wegwerfenden Handbewegung. Das bedeute gar nichts. Ob ihnen die Geschichte des Bischofs Ferdinand von Talavera nicht bekannt sei? Zierde der Kirche, Ratgeber des Königs, und doch: als geheimer Jude entlarvt. Er und alle seine Verwandten seien in den Kerker geworfen worden, immer wieder grinse der Hebräer unter der Maske des Christen.
Er hatte von diesem Bischof noch nie gehört. Er wußte auch nicht, wo Talavera lag, er wußte nur —
Wo ist denn Paulo de Souza? Rief Fernando. Sucht er die Gemeinschaft mit uns? Ist er einer von uns? Können wir auf ihn zählen?
Er wußte nur: Nein. Paulo war nicht bei ihnen. Er lief schon einige Zeit nicht mehr mit der Schar.
Sie liefen zu Paulos Elternhaus. Nein, Paulo sei nicht zu Hause, er würde aber bald kommen. Paulos Mutter war eine freundliche Frau. Sie lud die Kinder ein, etwas zu trinken. Aber Fernando bestimmte, daß sie weiterlaufen müßten. Sie liefen langsam. Mit sehr angespannten, gedrosselten Laufbewegungen. Diese seltsame Art des Laufens machte alles noch unheimlicher. In der Bewegung verhärtete ihre Anspannung.
Er wollte, daß sie Paulo fanden, er wollte wissen, was dann geschehen würde. Zugleich hoffte er, daß sie Paulo nicht begegneten, es herrschte eine Stimmung, die ihm angst machte, als würden sie etwas Verbotenes oder sehr Gefährliches tun, obwohl: er wußte, er war auf der Siegerseite.
Sie liefen langsam, sehr verhalten, sehr wachsam, sechs oder sieben Kinder, die sich einer gottlosen Macht, die die Welt bedrohte, einem einzelnen, gleichaltrigen Kind entgegenstellen wollten.
Da ging es zum Friedhof, und dort rüber zum Fischmarkt. Geradeaus kam man zu den Köhlern, und dann schon zur Stadtmauer, sie blieben unschlüssig stehen, aber sie blieben dabei in Bewegung, wie nervöse Tiere. Wohin sollten sie laufen? Sie blickten Fernando an, der plötzlich da! sagte. Sie sahen in die Richtung, in die er zeigte, und sahen Paulo de Souza, der auf sie zulief, langsamer wurde und schließlich stehenblieb, als alle auf ihn zustürmten. Sie umzingelten ihn, der sofort wußte, daß das nicht die Kinder waren, die er kannte.
Laßt mich, ich muß nach Hause.
Der mit Goldfarbe bemalte schmiedeeiserne Löwe über dem Portal der Pousada Leão d'Ouro wurde mattgrau, der Schatten rutschte an den azulejos der Fassade des Hotels hinunter, hinter dem Dach des gegenüberliegenden Hauses verschwand die Sonne.
Er wußte, daß er sofort nach Hause laufen müßte, aber das war jetzt unmöglich, er konnte nicht, das machte ihn fast blind und taub vor Angst. Er wurde ein weicher, sich irgendwie mitbewegender Teil dieser Gruppe, die jetzt nur ein Körper war, der zuckte und stieß und drängte und torkelte. Es war, als würde man mit geschlossenen Augen einmal da, einmal dort anstoßen, er wußte nicht, was geschah. Er hörte, wie Paulo immer wieder sagte, daß er nach Hause müsse, nach Hause, in Ruhe lassen, nach Hause. Dabei wurde Paulo zurückgedrängt, zurückgestoßen, die Kinder so nah beisammen, daß sie sich beim Gehen, beim Vorwärtsdrängen aneinanderrieben, aneinanderdrückten, ein Körper mit vielen Armen, die unausgesetzt stießen. Sie drängten Paulo in die Gasse, die zum Friedhof führte, dort vorn war die gekalkte Friedhofsmauer zu sehen, dunkelgrau, es war ganz still, auch die Nein!-Rufe Paulos, sein Betteln, ihn gehen zu lassen, waren nicht zu hören, das konnte man sich später wieder dazudenken, wenn man sich an diesen Moment zurückerinnerte. Wenn man sich erinnerte.
Zwei Kinder hielten Paulos Arme. Als er zu strampeln und zu treten begann, umschlangen zwei andere seine Beine. Wußten die Kinder von selbst, was jetzt getan werden mußte, oder hatte Fernando den Befehl gegeben? Fernando setzte die Spitze seines Degens auf Paulos Hosentür, machte einige tupfende, dann bohrende Bewegungen, suchte den Durchlaß zwischen den Knöpfen — wer aber hat dann die Hose geöffnet und mit einem Ruck runtergezogen?
Paulo war nicht beschnitten. Sie ließen ihn laufen. Sie verziehen ihm.
Das war die erste Schweinejagd.
Es gibt keinen Anfang. Jede Geschichte beginnt schon mit dem Satz »Was bisher geschah« und ist eine Fortsetzung, auch wenn ihr Titel lautet: »Dies soll nie wieder geschehen dürfen!« Am 15. Mai 1955 traten der österreichische Kanzler, der österreichische Außenminister und die Außenminister der vier Alliierten Siegermächte auf den Balkon des Schlosses Belvedere in Wien, der österreichische Außenminister hielt die soeben unterzeichnete Staatsvertragsurkunde in die Höhe und verkündete der wartenden Menschenmenge »Österreich ist frei!«.
Jubel brach aus, die Menschen sprangen, schrien, fielen einander in die Arme, begannen Walzer zu tanzen. Und mitten in dieser entfesselten, befreiten Masse ging eine hochschwangere Frau zu Boden, weil ihre Wehen eingesetzt hatten, zwei Wochen zu früh, ausgerechnet an diesem Tag, an diesem Ort. Wie oft hatten sie und ihr Mann in den Jahren und Jahrzehnten danach diese Geschichte erzählt? Ihre Angst, ihre panische Angst, das Kind zu verlieren.
– Aber doch wohl auch davor, zu Tode getrampelt zu werden, selbst zu sterben?
Nein, ich habe immer nur Angst davor gehabt, das Kind zu verlieren, immer nur den Gedanken: Das Kind.
Und dann war plötzlich der Mann mit dem weißen Mantel da. Er behielt die Nerven. Sie dachte: Ein Arzt. So ein Glück. Ein Arzt. Sie beruhigte sich. Vertraute diesem Mann.
Der Kreis, der sich um sie herum bildete — Der Kreißsaal Ha Ha (Viktors Vater) Und wißt ihr, wer der mit dem weißen Mantel war? Was der in Wirklichkeit war??
Warum sagst du das jetzt schon? Jedesmal machst du mir die Pointe kaputt. Viktor ist noch gar nicht auf der Welt, und du erzählst schon die Pointe! (Die Mutter)
Jedenfalls: Der vermeintliche Arzt half, er war der einzige, der Ruhe bewahrte, er paßte auf, daß der Kreis um sie herum intakt blieb, er gab Anweisungen, Befehle an die Umstehenden, Viktors Vater liebte bei dieser Stelle am meisten, daß der Mann geschrien habe: »Der Kreis soll sich im Kreis bewegen, der Kreis soll sich im Kreis bewegen …!«
Ist doch klar, daß in einer Menschenmasse, die ununterbrochen in Bewegung ist, einige wenige Menschen, die stehen, um einen einzelnen herum, der liegt, in Gefahr sind, niedergestoßen zu werden, schließlich zu Tode getrampelt — das hat er begriffen, also Bewegen! Bewegen! Immer weiter bewegen! Im Kreis, um die Kreißende herum …
Dann war wirklich Viktor da. Der Mann, der Arzt — Arzt! Ha Ha! — hob ihn hoch, nachdem er mit einem Taschenmesser die Nabelschnur durchtrennt hat, mit einem Taschenmesser!, und hat gesagt: Schrei! Das Kind muß einen Schrei machen! Aber da war so ein Geschrei, rundherum hat ja alles geschrien, Österreich ist frei!, und da hat der Arzt dem Viktor einen Klaps gegeben, noch einen, ein bißchen fester, und dann hat er geschrien, mein Gott, wie hat der Viktor geschrien, er hat gelebt, und er war gesund, und seine Lunge war stark, wenn er heute nur aufhören würde zu rauchen, er hätte so eine starke Lunge, ach, hat er geschrien. Er hat gar nicht mehr aufgehört, es war ein Geschrei, Abertausende Menschen haben geschrien, Österreich ist frei!, dazu die Musik, und Viktor hat geschrien, er hat nicht mehr aufgehört, ununterbrochen hat er geschrien, Österreich ist frei, und dann weiß ich nichts mehr, ich glaube —
Jedenfalls (der Vater), der Arzt, der vermeintliche, der im weißen Mantel, wißt ihr, was der war? Ein Fleischhauer. Das war der Fleischhauer von der Weyringergasse, gleich um die Ecke, das Geschäft gibt es heute noch.
Es gibt keinen Anfang. Viktor sah Hildegund an, ohne ein Wort zu sagen. Er versuchte zu verstehen, woher die Gewalt kam, die sie über ihn hatte, so stark, daß er bereit war, ihr alles zu verzeihen, und das war eine ganze Menge, sehr viel mehr, als er anderen jemals nachsehen hätte können. Warum konnte er ausgerechnet ihr alles verzeihen?
»Alle Achtung!« sagte sie. »Das hätte ich dir gar nicht zugetraut.«
»Was?«
»Was du getan hast. Es war überfällig. Diese ganze Geschichte wurde ja nie aufgearbeitet. Aber, auch wenn es so spät, viel zu spät geschehen ist, sie muß aufgearbeitet werden. Das war ein Anfang.«
»Das finde ich nicht!«
»Was findest du nicht?«
»Daß das aufgearbeitet werden muß. Im Gegenteil. Das gehört alles vergessen.«
»Das ist doch nicht dein Ernst. Warum hast du denn das heute getan, wenn du es vergessen willst?«
»Aus Rachsucht.«
»Dann hast du eben aus einem falschen Grund das Richtige getan.«
»Nein, ich habe aus einem beschissenen Grund etwas Beschissenes getan. Und wahrscheinlich ist deshalb jetzt sogar der Feldstein gegangen.«
Viktor hatte Feldstein mit der Faust mitten ins Gesicht geschlagen, er hatte das Krachen des Nasenbeins gehört, Feldsteins Zähne schmerzhaft an seinen Fingerknöcheln gespürt, nur ein einziges Mal hatte er zuschlagen wollen, nur einen Schlag, er würde ewig geschlagen werden, wenn er nicht zumindest einmal zeigte, daß auch er zuschlagen könne. Er ist schon zu oft verprügelt worden, um verhindern zu können, daß er doch einmal zurückschlug. Also schlug er, auf den Kleinsten, den wehrlosen kleinen Feldstein. Nur ein Schlag, und dann passierte etwas, das er nicht mehr vergessen konnte: Er sah, wie häßlich der Schmerz machte, wie fratzenhaft das Gesicht des Gedemütigten wurde, es war, als wäre der entmenschte Ausdruck desjenigen, dem Angst eingeflößt und Verletzungen zugefügt wurden, die Bestätigung dafür, daß man ihm angst machen, ihn verletzen, erniedrigen, treten, verhöhnen dürfe, in ihn hineinschlagen müsse. Viktor wollte plötzlich ununterbrochen weiter in diese Fratze hineinschlagen, weil sie ihn entsetzte, er wollte, daß sie verschwand. Er, der Schwache, hörte nicht auf zu schlagen, er prügelte den Schwächsten, er war von Sinnen, das war kein Mensch mehr, auf den er eindrosch, das war eine Kreatur, wie konnte ein Mensch so häßlich werden, so abstoßend, so primitiv das Flehen oder was immer das war in den Augen, so verzerrt seine Züge, das war plötzlich ein verschmiertes Ding, aus dem man nie eine Seele rausschlagen könnte, nur Schleim und Blut und Scheiße würde man rausprügeln können aus dieser Kreatur, man mußte auf ihr herumtrampeln, bis diese Scheiße verschwand, endlich verschwand in den Ritzen des Fußbodens. Das mußte verschwinden, das durfte nicht sein, das durfte keinen Platz haben auf der Welt, nicht solange es Augen gab, die das sehen mußten, Viktor versuchte mit Händen und Füßen, dieses Kind, dieses Zerrbild auszulöschen, bis er weggerissen, festgehalten wurde, sich immer noch windend, zuckend, in den Händen derer, die ihn zurückhielten.
»Ja, ich kann mich daran erinnern«, sagte Hildegund. »Wie alt waren wir damals? Vierzehn? Fünfzehn?«
»Sechzehn.«
»Wirklich? Du hast ihm das Nasenbein gebrochen, glaube ich, zumindest hat er wahnsinnig stark aus der Nase geblutet. Überall Blut. Komisch —«
»Komisch?«
»Ich wollte sagen, es war schon komisch, was da für ein Skandal daraus wurde, eine richtige Affäre. Ich meine, es hat doch so oft Raufereien gegeben, aber dieses eine Mal kam dann der Direktor in die Klasse —«
»Am nächsten Tag. Erst am nächsten Tag. Offenbar haben Feldsteins Eltern —«
»Ja, dann gab es Elternvorladungen, ein Disziplinarverfahren, und —«
»Damals habe ich selbst erst erfahren, daß —« Den letzten Satz hörte Hildegund nicht mehr, Viktor hatte zu leise, vielleicht ohnehin nur zu sich selbst gesprochen, und Hildegund, die gerade einen Löffel Suppe genommen hatte, war in diesem Moment aufgesprungen und hatte gesagt: »Sie ist kalt!« Sie lief die Tafel entlang, kostete da und dort von verschiedenen Tellern, während Viktor sie verwirrt beobachtete, und rief schließlich theatralisch: »Hat das nicht eben noch gedampft? Und schon ist es kalt. Du mußt dafür sorgen, daß alles aufgewärmt wird!«
Viktor mußte lachen. Das war Hildegund, nein: Hilli!
»Das ist deine Pflicht! Dafür zu sorgen, daß alles aufgewärmt wird!«
»Ja. Komm, setz dich wieder zu mir!«
»Und? Weißt du noch, wie die Geschichte weiterging?«
»Welche Geschichte?«
»Die Feldstein-Geschichte. Du bist nicht von der Schule geflogen, Feldstein hat nicht die Schule gewechselt, es wurde weiter gerauft und geprügelt — nur der Feldstein wurde ausgelassen. Er war tabuisiert. Neuhold hat natürlich weiterhin antisemitische Witze erzählt, aber sogar da hat er aufgepaßt, daß Feldstein nicht in der Nähe war.«
»Ja? Komm, setz dich wieder her!«
»Nein. Weißt du was?« Sie schlug vor, daß sie sich anders setzen sollten. Sie an dem einen Ende des Tisches, er gegenüber an dem anderen, wie in dem Film, wo dieses alte Ehepaar immer an den beiden Enden einer unendlich langen Tafel saß und den Butler mit Botschaften hin- und herschickte, weil sie zu weit voneinander entfernt saßen, um direkt miteinander reden zu können, wie hieß dieser Film? Viktor wußte es nicht und sagte, daß er allerdings wenig Lust habe, über den Kellner mit ihr zu kommunizieren.
»Dann reden wir eben lauter. Wir haben diesen Raum für uns allein. Wolltest du mich nicht immer schon einmal anschreien? Na komm schon!« Sie setzte sich an den Platz, an dem zuvor noch der Direktor gesessen hatte.
»Na komm schon! Die Situation ist so, so —«
»Grotesk.«
»Ja, grotesk, jedenfalls so, daß ich sie jetzt haben will, wie sie ist. Es sind nur wir zwei in diesem Hinterzimmer. Da ist diese enorm lange Tafel. Um das auszukosten, um das so richtig vor Augen zu haben, muß ich da sitzen, und du dort, am anderen Ende. Ist doch logisch. Überhaupt nach allem, was war.«
Nach allem, was war. Viktor setzte sich ihr gegenüber — hat ein langer Tisch eigentlich zwei Kopfenden, oder ein Kopfende und ein Fußende? Viktor saß am Fußende, das war sein Gedanke, und sah über die kalten Suppen und die vielen Gläser hinweg zu ihr hin.
Sie hatte ihr Haar blond gefärbt, es war seitlich sehr kurz geschnitten, stoppelig, fast geschoren, oben aber lang, ein Schwung Haare fiel ihr in die Stirn. Das war Hildegund. Hilli, die Schülerin, hatte ihr kastanienbraunes Haar schulterlang getragen, mit Mittelscheitel. Und Gundl, die Studentin, hatte es dann abschneiden lassen, so, daß es wie selbstgeschnitten wirkte, und hennarot gefärbt. So hatte er sie damals — »Mir fällt gerade ein«, sagte er.
»Was sagst du?«
»Portugal«, rief er, »weißt du noch?« Er schrie: »Portugal!«
Im Herbst 1974 hatte er sie auf der Uni getroffen, als sie gerade von Portugal zurückgekommen war. Im Sommer nach der Nelkenrevolution war bei den Studenten der Revolutionstourismus angesagt, Griechenland ging ja nicht mehr, Militärdiktatur, Eritrea interessierte keinen Menschen, außer den »Ali«, Alfred, Alfred — wie hieß er noch, der in Wien schlechtbesuchte Teach-ins über die eritreische Revolution organisierte. Im Sommer 74 fuhr man jedenfalls nach Portugal. Auch Gundl, und dann im Herbst die zufällige Begegnung auf der Uni, Wie geht es dir? Lange nicht gesehen. Gut, ich bin ein neuer Mensch, ich war gerade in Portugal.
Sie gingen ins Café Votiv hinter der alten Uni, tranken Rotwein, natürlich »kein Vergleich zum portugiesischen«, und Gundl erzählte von ihren Erlebnissen mit einer »Arbeiterklasse, die fest im Sattel saß«, von nächtelangen Diskussionen über »das qualitativ neue Phänomen, daß plötzlich das Militär als revolutionäres Subjekt auftritt«, aber natürlich gebe es auch Widersprüche, »Ungleichzeitigkeiten«, und sie erzählte von einem Erlebnis, das sie im Museu da Cidade in Lissabon gehabt hatte.
Im oberen Stock des Museums gab es einen Raum mit alten Radierungen, Darstellungen von Autos de Fé, Verbrennungen von Ketzern und Juden im siebzehnten Jahrhundert. Von diesen Bildern sei sie eigentümlich fasziniert gewesen, so Gundl —
»Warum?«
»Ich weiß nicht. Egal, ich habe diese Bilder jedenfalls sehr lang betrachtet, sehr lang. Der schockierende Realismus der Szenen, ich weiß nicht. Jedenfalls: ich habe das nicht gewußt.«
»Was?«
»Man denkt bei Auto de Fé einfach an einen Scheiterhaufen, auf dem ein Mensch verbrannt wird — aber das waren Dutzende, die da verbrannt, Hunderte, die in langen Reihen zu diesem Scheiterhaufen geführt wurden, und auf den Bildlegenden stand, daß sogar Tote exhumiert und auf die Scheiterhaufen gelegt wurden, wenn die Inquisition ihnen posthum etwas nachweisen konnte, und dann die riesige Menge der Schaulustigen, die den Platz füllte, auf dem das stattfand, das hatte eine Größenordnung …«
Plötzlich stand die Aufseherin dieses Saals neben ihr, sagte sehr aufgeregt etwas, das Gundl nicht verstand, aber sie glaubte »spontan«, wie sie sagte, die Erregung der Aufseherin angesichts dieser Bilder zu verstehen — bis diese auf englisch wiederholte, daß es verboten sei, das Glas zu berühren, unter dem die Radierungen lagen. Gundl trat sofort einen Schritt zurück und sagte, auf die Bilder deutend, gleichsam als Entschuldigung, irgend etwas in der Art von »Ist das nicht entsetzlich«.
Die Aufseherin gab ihr recht, ja, in der Tat, furchtbar — und jetzt kommt's! Hör zu! — die Aufseherin sagte: Sie habe in der Schule gelernt, daß bei bestimmten Windverhältnissen sich der Gestank von verbranntem Menschenfleisch über die ganze Stadt ausgebreitet habe, es müsse schauerlich gewesen sein, unvorstellbar, wie die Menschen das damals hätten aushalten können.
Portugal nach der Revolution —, sagte Gundl, und plötzlich steht man einer Frau gegenüber, die Mitleid empfindet mit jenen, die verbranntes Menschenfleisch riechen mußten, und nicht mit den verbrannten Menschen selbst. Und dann sagt sie noch, das habe sie in der Schule gelernt …
Es war ein kleiner Tisch im Café Votiv, sie sind so knapp einander gegenübergesessen, daß sich über ihren zwei Gläsern Rotwein ihre Köpfe beinahe berührt hatten. Aber das hatte keine Bedeutung. Es wurde keine Geschichte.
Die aufgehende Sonne brach in schrägen Lichtbahnen durch die Wolken. Es wirkte wie gemalt: der Hintergrund eines Altarbildes. Und es war ein Altar, zu dem in dieser frühen Stunde einhundertunddreiundzwanzig Männer und Frauen durch die Gassen Lisboas geführt wurden. In sacos benditos, gelben Kutten, mit einem schwarzen Andreas-Kreuz auf der Brust und einem auf dem Rücken. Auf den Köpfen trugen sie gelbe Mitras, hohe spitze Kopfbedeckungen in der Art der Bischofsmützen. In den Händen hielten sie Kerzen, die noch nicht angezündet waren. Sie gingen langsam und schweigend, einer nach dem anderen, in einer langen Schlange, geführt von Mitgliedern des Heiligen Offiziums, die ein Banner aus schwerem Brokat mit einem Bildnis der Muttergottes und hocherhobene Kruzifixe vorantrugen, eskortiert von Patres, die lautlos, nur die Lippen bewegend, beteten. Die Männer und Frauen in den gelben Kutten waren schwerer Sünden beschuldigt worden, der Hexerei, der Bigamie, der Homosexualität. Aber diese »Sünder wider die Natur« waren nur einige wenige. Die größte Gruppe dieser Prozession waren die Juden. Menschen, die in der dritten, oft schon vierten oder fünften Generation getauft waren, aber immer noch abfällig »die Konvertierten« oder »die Neuchristen« hießen, und nun angeklagt waren, im geheimen nach dem Gesetz Mose zu leben und versteckt jüdische Riten zu pflegen.
Es wurden Gebete gemurmelt, aber es war dieses Murmeln nicht zu hören, da waren angstschreigeöffnete Münder zu sehen, aber es waren keine Angstschreie zu hören und kein Klagen, weit über einhundert Paar Füße schlugen auf das Pflaster der Rua do Hospital, aber es schien keinen Widerhall der Schritte zu geben, als marschierten sie nicht auf Steinen, sondern bereits auf einer Wolke.
Der 5. Dezember 1604. Was verschluckte die Geräusche derer, die da gingen? Von irgendwoher kam lautes Geraune, ein leises Gedröhne, die acusados gingen darauf zu. Nicht wenige unter ihnen hatten zum ersten Mal einen Familiennamen auf einem Papier erhalten, im Gefängnis der Inquisition, einen Namen, den sie nur brauchten, um dann, aufgerufen, vortreten zu können und das Urteil zu erfahren: Und ausgelöscht soll dein Name sein!
Auf dieses Aufgerufen-Werden marschierten sie zu, auf ein Dröhnen, das sie lautlos im Kopf schon mitbrachten, auf eine Selektion, die wenig, aber entscheidenden Raum ließ zwischen Verderben und Tod — und da wurde es laut, da platzte die Stille, als der Zug in die Rua Lazaro einbog, die zur Praça Ampla führte, wo der Auto de Fé schließlich stattfinden sollte. Abertausende Schaulustige hatten sich bereits auf der Praça eingefunden, und noch immer strömten Menschen von allen Seiten herbei, Hunderte warteten in einem Spalier bereits in der Rua Lazaro mit Fackeln, begannen ekstatisch zu schreien, zu toben, als die Prozession einbog. »Rasieren!« schrien sie, »Rasieren!«, »Laßt uns die Neuchristen rasieren!«, und sie versuchten, mit ihren Fackeln die Bärte der Juden anzuzünden.
Der Zug, der trotz seines regelmäßigen Schreitens einen Eindruck von Selbstvergessenheit und Starrheit gemacht hatte, zeigte nun Panik. Die Juden schlugen die Ärmel ihrer sacos benditos vor das Gesicht, schrien Gott hilf!, sie schrien Gott hilf! und die anderen schrien Rasieren! und die Juden versuchten auszuweichen zur anderen Straßenseite, wo sie aber wieder mit Fackeln oder Stößen empfangen wurden. Die Patres, die keine Anstalten trafen, dem Publikum am Straßenrand in den Arm zu fallen, gingen vom lautlosen Murmeln des Rosenkranzes zu einem lauten Singsang über, ihre Schritte beschleunigend, darauf bedacht, daß ihre eigenen Kutten nicht beim »Rasieren« versengt werden.
Da erreichten sie schon die Praça. Die Schreie wurden zu Geheul, die acusados zogen die Köpfe ein, und Antonia Soeira bäumte sich stöhnend auf, tastete nach der Hand ihres Mannes Gaspar Rodrigues, drückte ihre Nägel in seinen Handrücken — Es geht los! Es ist soweit!
Sofort machte Gaspar Rodrigues sich auf, Dona Teresa zu holen. Konnte er die kleine Estrela inzwischen hierlassen? Oder sollte er sie nicht doch besser mitnehmen? Nein. Die Hebamme wohnte nur wenige Häuser weiter, er würde also sehr rasch zurück sein, viel schneller, als es ihm mit seiner vierjährigen Tochter möglich wäre.
Als er auf die Straße trat, wich er für einen Moment gleich wieder in den Hauseingang zurück. Noch nie hatte er in seiner Gasse so viel Bewegung gesehen, ein so großes Gedränge, ein so dichtes Geschiebe. Menschen zu Fuß und zu Pferd, in Kutschen sitzend, in Einspännern und in Sänften. Die enge Gasse hallte wider vom Gezeter, Gefluche und den Gesängen der Fußgänger, den Obacht-Rufen der Kutscher, den Pfiffen der Sänftenträger, dem Peitschengeknalle der Reiter und den schrillen Schreien der Pferde. Es roch so bestialisch wie noch nie nach Urin, Fäkalien und Schweiß.
Gaspar Rodrigues versuchte, sich gleich seitlich an der Hauswand entlangzudrücken, in Richtung zu Dona Teresas Haus. Aber schon nach wenigen Schritten mußte er, um nicht niedergestoßen zu werden, umdrehen und sich im Strom mitbewegen. Das waren zu viele, und alle drängten in dieselbe Richtung. Was war da los? Er wurde einfach mitgeschoben, in die falsche Richtung, nun wäre er bereits froh gewesen, wenn er nur wieder zurück bis zu seinem Haus gekommen wäre, von dem er sich immer weiter entfernte. Bald war er, im Versuch, den Stößen auszuweichen, in die Mitte des Geschiebes gedrängt worden, das ihn unausgesetzt weiterschob und nicht mehr freigab. Plötzlich spürte er einen Schlag gegen die Wange, spürte, daß die Wange aufplatzte, er torkelte und sah aus den Augenwinkeln seitlich einen braunen Pferdeleib, und hochblickend, während er mit der Hand das Blut an seiner Wange verschmierte, den Reiter, der schon wieder mit seiner Gerte ausholte und ihn anschrie: Wahnsinniger! Geh weiter geh! Willst wohl niedergetrampelt werden!
Gaspar Rodrigues war bereits sechsundvierzig Jahre alt. Er hatte zu Hause, so nahe und in diesem Moment doch so unerreichbar, eine vierjährige Tochter und eine Frau, die in den Wehen lag. Er hatte ein blutverschmiertes brennendes Gesicht und einen von Schlägen und Stößen schmerzenden Körper, einen unvorteilhaften Körper, zu breit und zu schwammig, um sich behende irgendwo durchschlängeln zu können, und zu schwach und weich in all seiner Massigkeit, um sich energisch Raum verschaffen zu können. In seinen Augen verschmierten sich Blut und Schweiß, er sah kaum mehr, was da vorging, und er wußte nicht mehr wirklich, was er tat, als er panisch noch einmal versuchte, seitlich auszubrechen, sich durchzuschlagen oder sich durchschlagen zu lassen zu jenem Portal, das er nur noch als großen leeren Hohlraum auffaßte, ein schwarzes Loch, das ihn anzog. Im Grunde hatte er das Bewußtsein bereits verloren, noch bevor er nach einem letzten Schlag gegen seinen Rücken und den Hinterkopf an der Schwelle dieses Hauseingangs stolperte und in das schwarze Loch hineinfiel.
Es blieb stundenlang dunkel. Und als Gaspar Rodrigues schließlich erwachte, war es fast so spät, daß es schon wieder dunkel werden sollte. Aber da wurde schon das große Feuer entzündet. Und es wurde Licht.
Das Hospital Real hatte den Grundriß eines Kreuzes. Die Hauptfassade blickte auf die Praça Ampla, wo sich auch, gleichsam am Fuß des Kreuzes, der Eingang der Spitalskapelle befand. In den beiden Seitenarmen des Kreuzes befanden sich die Männer- und die Frauenabteilung. Und dort, wo sich bei einem Kruzifix das dornenumrankte Haupt Jesu befindet, saß die Chirurgie. Die Männerabteilung, nach dem Grundriß der rechte Arm des Gottessohnes, hatte ihren Haupteingang nicht an der Praça, sondern an der Rückseite des Gebäudes, ein Portal in der Form einer riesigen offenen Gruft. In diese Gruft war Gaspar Rodrigues von der Menge getreten, geschoben, gestoßen und geschlagen worden. Hier, im kühlen leeren Dunkel, wurde er schließlich von Pflegern gefunden.
Seine Wunden waren gereinigt und verbunden. Man hatte keine Vorstellung vom Ausmaß möglicher innerer Verletzungen und befürchtete seinen Tod. Als er erwachte, fand er sich auf einer Pritsche in jenem Korridor des Spitals, durch den die Verstorbenen weggebracht werden. Er setzte sich auf, sah den langen Korridor, linker Hand Vorhänge, er wußte noch nicht, daß dies die Vorhänge waren, mit denen die Betten der Todgeweihten oder der Patienten mit ansteckenden Krankheiten von den anderen separiert wurden. Er sank zurück, versuchte, sich mit geschlossenen Augen zu sammeln, das Dröhnen und Heulen in seinem Kopf — war es in seinem Kopf? — wegzubekommen, und setzte sich stöhnend nochmals auf. Wie ein vielfaches schwaches Echo hörte er nun das leise Gestöhne und Geröchel hinter den Vorhängen.
»Willst du beichten, mein Sohn?«
»Wo bin ich, Pater?«
»Im Hospital Real de Todos os Santos. Es kann sein, daß dein Leib nicht gerettet werden kann, deine Seele aber kann gerettet werden. Willst du also die Beichte ablegen?«
Gaspar Rodrigues glitt vorsichtig von der Pritsche, machte ein paar Schritte und sagte: »Ich muß nach Hause!«
»Du kannst jetzt nicht gehen.«
»Ich muß nach Hause. Meine Frau —«
»Du kannst in deinem Zustand nicht gehen. Und selbst wenn du könntest — Schau hinaus! Da kommt jetzt keiner durch!«
Gaspar Rodrigues sah aus dem Fenster, schlug ein paarmal die Augenlider auf und zu, um sein Schwindelgefühl zu bekämpfen, und auch, weil er nicht glauben konnte, was er so verschwommen draußen auf dem Platz sah. Im Grunde sah er nichts, jedenfalls nichts, das er wiedererkennen konnte. Das hatte er noch nie gesehen. Er taumelte zurück zu der Pritsche, setzte sich, tastete seinen Kopf ab, den Verband, atmete tief durch und ging dann nochmals an das Fenster. In diesem Moment loderten die ersten Flammen hoch.
Gaspar Rodrigues sah den Tod. Er dachte an den Tod zu Hause, seine Frau im Kindbett, die kleine Estrela. Und er fühlte den Tod in sich. Wie war es um ihn bestellt? Es war ruhig in diesem Korridor des Todes. Der Lärm, der vom Platz hereindrang, wurde durch die schweren doppelten Fenster so sehr gedämpft, daß er buchstäblich außen blieb, ein Geräusch, gerade so stark, daß Gaspar Rodrigues es bloß als etwas hörte, das an den Hohlraum der Stille brandete, in dem er sich befand. Da, wo er war, war es totenstill.
Nun stand der Pater dicht neben ihm, legte ihm den Arm um die Schultern, »Mein Sohn, du solltest —«, »Ja, ich sollte —«, — die Flammen draußen schlugen höher, es wurde heller, ein grelles Bild in der sich herabsenkenden Dunkelheit. Daß er in sich gehen solle — Er nickte. Gehen. Daß er — Ja! Ja! Dann war er alleine.