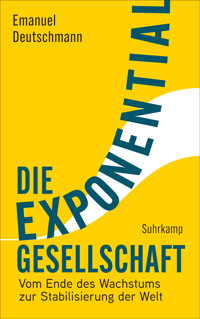
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie wir die Kurve(n) kriegen
Fortschritte bei der Künstlichen Intelligenz, Infektionswellen und die Klimakrise mögen auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben, sie sind aber häufig verknüpft. Und sie folgen einem ähnlichen, nämlich exponentiellen Muster: Eine Größe – Rechenpower, mit Corona infizierte Menschen oder CO2-Moleküle in der Atmosphäre – nimmt per Zeiteinheit um einen konstanten Faktor zu. Zunächst erscheint das oft harmlos, aber dann geht die Kurve plötzlich fast senkrecht nach oben, mit potenziell unkontrollierbaren Folgen.
Für sein hochaktuelles Buch hat Emanuel Deutschmann eine Unmenge von Daten analysiert. Er zeigt, dass Entwicklungen in einer verblüffenden Vielzahl von Bereichen diese steile Phase erreicht haben. Wir leben in einer Exponentialgesellschaft, und darum häufen sich die Krisen ebenso wie die sozialen Konflikte. Eigentlich müssten wir die Kurve kriegen und das Wachstum auf nachhaltigen Niveaus stabilisieren. Doch während sich das stabilisatorische Lager für entsprechende Maßnahmen einsetzt, drängen die Expansionisten auf mehr Tempo, mehr Autos, mehr Profit. Am Ausgang dieser Auseinandersetzung könnte sich die Zukunft der Menschheit entscheiden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
3Emanuel Deutschmann
Die Exponentialgesellschaft
Vom Ende des Wachstums zur Stabilisierung der Welt
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2025.
© Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Brian Barth, Berlin
eISBN 978-3-518-78205-7
www.suhrkamp.de
Motto
5»Die größte Schwäche der Menschheit ist ihre Unfähigkeit, die Exponentialfunktion zu verstehen.«
Albert A. Bartlett
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Ausführliches Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Motto
Inhalt
Vorwort
1 Der Aufstieg der Exponentialgesellschaft
Was ist exponentielles Wachstum?
Was ist die Exponentialgesellschaft?
Entwicklung aus vorherigen Gesellschaftsformen
Soziologie als Formsache
Aufbau des Buches
2 Exponentielle Trends im 21. Jahrhundert
Wirtschaft
Ökologie
Pandemische Krise
Information & Technik
Mobilität & Kommunikation
Demografie
3 Erkundungen der Exponentialgesellschaft
Mehr bringt mehr – der grundlegende Mechanismus
Das Syndrom der Exponentialität
Ökologie
Pandemische Krise
Mobilität & Kommunikation
Information & Technik
Eine neue gesellschaftliche Ordnungslogik
Stabilisierung als Kollektivgutproblem
Neue Konfliktachsen
Verdichtete Interdependenzketten
Die Exponentialgesellschaft als ärgerliche Tatsache
4 Stabilisierung als neues Ordnungsproblem
Wirtschaft
Ökologie
Pandemische Krise
Information & Technik
Mobilität & Kommunikation
Demografie
5 Warum Stabilisierung möglich ist
Exponentielles Wachstum ist nicht der »Normalzustand«
Drei Idealtypen von Stabilisierung
Stabilisierung auf hohem Niveau
Stabilisierung auf niedrigem Niveau
Stabilisierung auf mittlerem Niveau
Stabilisierung als vorläufiges, relatives und nichtautomatisches Phänomen
Stabilisierung normalisieren!
6 Die Psychologie der Exponentialgesellschaft
Die Missachtung des Maßstabs
Verdrängung und Leben in Widersprüchen
Fehlende Informationen und Desinformation
Kulturelle Vererbung und soziale Trägheit
Zukunftsdiskontierung und Longtermism
Gewöhnung und verschobene Grundlinien
Die Trägheit überwinden
7 Die Politik der Exponentialgesellschaft
Der politische Grundkonflikt der Exponentialgesellschaft
Ein ungleiches Kräfteverhältnis
Mögliche Handlungsstrategien stabilisatorischer Kräfte
Das Dreieck der Stabilisierungskapazität
Basteln an Utopien, Sägen an Luftschlössern
Das Progressivitätsparadox
Warum kollektive Steuerung wichtiger und die politische Auseinandersetzung härter wird
8 Die Soziologie der Exponentialgesellschaft
Die neue Kalkulierbarkeit
Substanzielles Wachstum schlägt Geschwindigkeit
Akkumulation des Immergleichen statt Logik des Besonderen
Ungleichheiten als Exponentialität hinter der Exponentialität
Warum der Begriff »Exponentialgesellschaft« nützlich ist
9 Auf dem Weg in die Post-Exponentialgesellschaft?
Das Gesamtbild: gleichförmige Ungleichzeitigkeit
Einladung zum nichtlinearen Denken
Exponentialität erklären!
Grenzüberschreitungen sichtbar machen!
Stabilisierungskapazität erhöhen!
Stabilisierung attraktiver machen!
Von Gaia und Medea zu Janus?
Wird alles gut?
Anmerkungen
1Der Aufstieg der Exponentialgesellschaft
2Exponentielle Trends im 21. Jahrhundert
3Erkundungen der Exponentialgesellschaft
4Stabilisierung als neues Ordnungsproblem
5Warum Stabilisierung möglich ist
6Die Psychologie der Exponentialgesellschaft
7Die Politik der Exponentialgesellschaft
8Die Soziologie der Exponentialgesellschaft
9Auf dem Weg in die Post-Exponentialgesellschaft?
Bibliografie
Glossar
Anhang
Informationen zum Buch
3
5
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
105
106
107
108
109
110
111
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
237
238
239
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
303
304
305
306
307
308
309
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
443
9
Vorwort
»Es ist gar nicht so leicht, in all dem Chaos ein wenig Ruhe zu finden«, schreibt meine Mutter mir 2022 in einer Weihnachtskarte. Sie berichtet aus der Apotheke, in der sie arbeitet:
Das dritte Corona-Jahr belastet uns nach Masken, Desinfektionsmitteln, Impfzertifikaten, Fälschungen und Corona-Testungen nun mit einer neuen Variante: der Nichtverfügbarkeit von Medikamenten. Unsere verwöhnte Gesellschaft bekommt nicht mehr alles, was sie will. Fiebersäfte, Antibiotika für Kinder usw. sind nicht mehr einfach verfügbar. Wir sind den ganzen Tag nur noch am Probleme lösen mit zu wenig Personal.
Ihre Erfahrung steht exemplarisch für etwas, das damals viele spüren. Die Verhältnisse sind erschüttert, die globalisierten Lieferketten: brüchig. Der über Jahrzehnte verlässlich gewachsene Wohlstand: gefährdet, die Gesundheit: bedroht. Das gesellschaftliche und das ökologische Klima: am Kippen, die Perspektiven: unklar. Multiple, ineinander verschlungene Krisen verlangen uns alles ab, die Verunsicherung ist groß, der Optimismus verflogen. Der Wunsch nach Lagedeutungen, Lösungsangeboten und positiven Zukunftsvisionen ist erdrückend. »Wie würdest du diese ganzen Probleme anpacken?«, fragt mich meine Mutter.
Wie soll man auf eine so große Frage eine überzeugende Antwort geben? Ich habe erst einmal keine, vertröste nur auf das Buch, an dem ich gerade arbeite. Darin versuche ich, die schwierige Situation, in der wir uns befinden, aus einer Makroperspektive – also mit Blick aufs große Ganze – zu beschreiben, zu analysieren und darüber zu reflektieren, wie es weitergehen könnte. Mittlerweile habe ich das Buch fertiggestellt. Es liefert wahrscheinlich keine endgültig befriedigenden Antworten, aber vielleicht hilft es, beim Nachden10ken über Lösungen einen kleinen Schritt voranzukommen. Meine Hoffnung wäre, dass es zumindest etwas zum Verständnis beiträgt, warum die multiplen Krisen so geballt auftreten. Die Grundannahme lautet: Wir leben in einer Exponentialgesellschaft, die an ihre Grenzen stößt und vor dem Problem der Stabilisierung steht. Aus dieser Konstellation ergeben sich schwerwiegende Spannungen und Konflikte.
Über den am Neujahrstag 2015 viel zu früh verstorbenen Soziologen Ulrich Beck wird erzählt, die besten Ideen seien ihm beim Spazierengehen am Starnberger See gekommen. Die Idee für dieses Buch (ob sie gut ist, wird sich zeigen müssen) kam mir in einer ganz ähnlichen Situation: beim Campen am Meer. Gut zwei Jahre vor dem Brief meiner Mutter, im Oktober 2020 – die erste Coronawelle lag hinter uns, und in den Medien war von einem erneut drohenden Anstieg der Inzidenzen die Rede –, dachte ich am dänischen Lillebælt über die sich zuspitzende Lage nach: über die Pandemie, die ökologischen Krisen, das Wirtschaftswachstum, die Staus und Abgase auf den Straßen, die internationale Mobilität, die ich in meiner Doktorarbeit untersucht hatte. Plötzlich fiel mir auf, dass diese Entwicklungen eine erstaunlich ähnliche Form aufwiesen: Sie alle verliefen exponentiell. Und nicht nur das, sie schienen sich auf vielfältige Art gegenseitig zu beeinflussen: die Klimakrise die Pandemie, die Pandemie das Wirtschaftswachstum, das Wirtschaftswachstum die Klimakrise usw. Mir kam der Gedanke, dass diese exponentiellen Trends zu oft für sich allein betrachtet werden, als Sujets der jeweiligen Spezialdisziplinen. Die Epidemiologie befasst sich mit der Pandemie, die Klimatologie mit der Klimakrise, die Volkswirtschaftslehre mit der Globalisierung, die Stadtplanung mit der Verkehrssituation. Aber wer kümmert sich eigentlich um die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge? Oft scheint unser Blick auf solche Trends auch zu kurzfristig: Man schaut auf die aktuelle Inflationsrate oder das Wirtschaftswachstum im nächsten Quartal, aber nicht auf die langfristigen Entwicklungen und wo sie uns potenziell hinführen. Die Idee, in einer großrahmigen Zusam11menschau darzulegen, wie Gesellschaft heute durch eine Vielzahl exponentieller Trends bestimmt wird, war da und ließ mich nicht mehr los.
Der Erfinder des Wortes »Soziologie«, Auguste Comte, stellte sich die neue Disziplin im 19. Jahrhundert als die »Königin der Wissenschaften« vor, die so umfassend sein sollte, dass sie alle anderen Fächer unter sich versammelte. Der Gedanke hat eine charmante Vermessenheit, die angesichts der deutlich höheren Autorität anderer Disziplinen fast komisch wirkt. Aber möglicherweise liegt eine Stärke der Soziologie tatsächlich darin, dass es gerade ihr gelingen kann, ganz unterschiedliche Bereiche zusammen zu betrachten. Immerhin hat alles, was in diesem Buch thematisiert wird – auch scheinbar primär chemische, medizinische oder materialwissenschaftliche Gegenstände (von CO2-Molekülen und Viruspartikeln über Alterung und Sterbewahrscheinlichkeiten bis hin zu Beton und Zwanzig-Fuß-Standardcontainern) –, direkt mit Gesellschaft zu tun. Natürlich hat eine solche hoch aggregierte Makroperspektive auch ihren Preis: Wer auf das große Ganze blickt, verliert unweigerlich den Blick für Nuancen, die mit einem spezialisierteren Zugriff besser sichtbar sind und nur in den jeweiligen Fachgebieten angemessen analysiert werden können. Aber ich glaube, dass es manchmal durchaus sinnvoll ist, ein paar Schritte zurückzutreten und sich einen Überblick zu verschaffen: Wo stehen wir insgesamt, wie sind wir dort gelandet, und wo könnte es hingehen?
Das Buch basiert auf umfassenden empirischen Daten zu mehr als achtzig exponentiellen Trends. Ich danke allen Menschen, die diese Informationen in mühevoller Arbeit zusammengetragen und zur Verfügung gestellt haben. Hervorheben möchte ich die von Max Roser an der University of Oxford entwickelte Plattform Our World in Data (OWiD), die bei der Recherche eine große Hilfe war. Ich danke außerdem Michael Biggs und Dashun Wang, die mir freundlicherweise unveröffentlichte Daten zugänglich gemacht haben, sowie Justin Connolly für die Erlaubnis, seine Skizze zur Vision einer 12stabilisierten Wirtschaft abzubilden. Steffen Mau hat früh Teile des Manuskripts gelesen, mich in wichtigen Punkten beraten und das Projekt großzügig unterstützt. Bernd Sommer hat ebenfalls bereits am Anfang Lesezeit investiert, wichtige Anmerkungen gemacht und Ratschläge gegeben, für die ich sehr dankbar bin. Ich danke auch den Teilnehmenden des von Sighard Neckel und Cordula Kropp organisierten Plenums »Die ökologische Krise: Polarisierungen moderner Demokratien« auf dem 41. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Bielefeld sowie den Teilnehmenden der Vortragsreihe »Gewalt und Macht in der Gesellschaft« an der Hochschule Niederrhein, der Flensburger Ringvorlesung an der Phänomenta sowie des Jour fixe am Norbert Elias Center for Transformation Design & Research der Europa-Universität Flensburg für wichtige Kommentare und Anregungen. Ein Forschungsfreisemester, das ich am Institute for Analytical Sociology der Linköping University in Schweden verbringen durfte, hat mir im Herbst 2023 die Freiräume verschafft, mich ganz der Fertigstellung des Manuskripts widmen zu können. Ich danke Maria Brandén für die freundliche Einladung und allen Mitgliedern des Instituts vor Ort, insbesondere Selcan Mutgan, Alexandra Rottenkolber und Jacob Habinek, sowie Rebecca Ye, Erik Nylander und ihrem Sohn Noa, die den Aufenthalt noch angenehmer gemacht haben. Außerdem danken möchte ich Enis Bicer, Maike Böcker, Caterina Bonora, Sebastian Büttner, Michaela Christ, Janina Deutschmann, Monika Eigmüller, Lorenzo Gabrielli, Jürgen Gerhards, Jean-Yves Gerlitz, Solveig Gleser, Florian Hertel, Moritz Hess, Katharina Hoppe, Nepomuk Hurch, Anne Klingenmeier, Jonas Lage, Lara Minkus, David Petersen, Thore Prien, Céline Teney, Stefan Wallaschek, Nils Witte und Monika Verbalyte, die mir bei verschiedenen Aspekten durch wichtige Gedanken und Kommentare weitergeholfen haben. Beim Suhrkamp Verlag hat Heinrich Geiselberger das Buch hervorragend betreut und fantastisch lektoriert; durch seinen genauen Blick hat das Manuskript am Ende noch einmal einen Riesensatz nach vorne gemacht. Auch der produktive Austausch mit Eva Gilmer 13und Christian Heilbronn war eine Bereicherung für das Projekt. Nicht zuletzt danke ich Elli für zahllose wertvolle Gespräche und Hinweise sowie meiner Mutter und meiner Oma Ruth, die mir die richtigen – und die richtig schwierigen – Fragen gestellt und dadurch das Buch geprägt haben. Es ist mir nicht leichtgefallen, nicht nur zu analysieren, was war und ist, sondern auch über das zu schreiben, was sein könnte und sein sollte. Wer wie ich weberianisch sozialisiert wurde, also mit der Vorstellung, dass Wissenschaft und Politik idealerweise getrennt bleiben sollten, bewegt sich mit dem Spekulieren über mögliche Zukünfte und dem Argumentieren, warum eine davon – eine stabilisierte – besonders wünschenswert ist, auf ungewohntem Terrain. Aber vielleicht sind die Zeiten zu ernst, um sich hinter Werturteilsfreiheitspostulaten zu verstecken.
Flensburg, Januar 2025
15
1
Der Aufstieg der Exponentialgesellschaft
Mein Vorschlag, die globale Gesellschaft heute als Exponentialgesellschaft zu begreifen, beruht auf der Beobachtung, dass im 21. Jahrhundert exponentielles Wachstum zentrale Bereiche1 dergestalt prägt, dass es den Fortbestand dieser Gesellschaft nicht nur in ihrer bisherigen Form, sondern überhaupt infrage stellt. Von Klima- und Umweltkrise über Pandemie, Inflation, Globalisierung, Migration und Verkehr bis hin zu Künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Alterung – viele bedeutende Entwicklungen unserer Zeit folgen exponentiellen Mustern. Mehr als das: Scheinbar getrennte Bereiche sind durch ein engmaschiges Geflecht von Wechselwirkungen zwischen diesen Entwicklungen miteinander verwoben. Während frühere Gesellschaften durch wiederkehrende Zyklen oder allenfalls mäßigen Wandel mit begrenzten Folgen geprägt waren, erleben wir heute eine Vielzahl gleichzeitig stattfindender zugespitzter Veränderungen, die öffentliche Debatten bestimmen und neue soziale Konflikte schüren.
Doch lange kann es so nicht weitergehen, droht mit der unweigerlichen Explosion der Bestandsgrößen – seien es Treibhausgase, Infektionen oder Plastik im Ozean – doch das zukunftsgefährdende Desaster. Stabilisierung ist daher das zentrale Ordnungsproblem unserer Zeit. In wichtigen Bereichen müssen exponentielle Trends rechtzeitig gebrochen werden, um stabilisierte Verhältnisse auf nachhaltigen und kollektiv wünschenswerten Niveaus herbeizuführen. Je nach Bereich kann dies eine Stabilisierung auf niedrigem (z.B. Infektionszahlen, CO2-Emissionen), hohem (z.B. Information, Technologie) oder mittlerem Niveau (z.B. Wohlstand, Temperatur) sein. Wie wir sehen werden, denkt die Gesellschaft 16zunehmend über Wege in diese Richtung nach, sie streitet über mögliche Stabilisierungsniveaus, Umsetzungsstrategien, Folgen und Nebenwirkungen. Der Wechsel von einer wachstumsbasierten Exponentialgesellschaft zu einer stabilisierten postexponentiellen Gesellschaft ist offenkundig kein leichter und höchst kontrovers. Dieses Buch versucht, die Rolle exponentieller Trends, die Suche nach Stabilisierungsmöglichkeiten und die sich aus dieser Situation ergebenden Konflikte zu beschreiben und zu analysieren.
Was ist exponentielles Wachstum?
Die »Unfähigkeit, exponentielles Wachstum zu verstehen«, bezeichnete Al Bartlett immer wieder als »die größte Schwäche der Menschheit«.2 Daher versuchte der 2013 verstorbene US-amerikanische Physiker sein Forscherleben lang, über dieses Phänomen aufzuklären. Dabei ist es – trotz einiger Tücken – eigentlich gar nicht so schwer zu durchschauen. Wenn im Alltag von exponentiellem Wachstum die Rede ist, denken wir meist an besonders schnellen Wandel. Das ist jedoch ein Irrtum, denn exponentielles Wachstum kann sowohl mit hohem als auch mit niedrigem Tempo stattfinden. Exponentielles Wachstum liegt dann vor, wenn sich eine Bestandsgröße in jeweils gleichen Zeitabschnitten um einen konstanten Faktor verändert oder, einfacher ausgedrückt: Exponentielles Wachstum zeichnet sich durch gleichbleibende Wachstumsraten aus. Anders als bei linearem Wachstum, bei dem pro Zeiteinheit eine konstante absolute Menge hinzukommt (bei manchen Stalagmiten, den Tropfsteinen, die in Höhlen von unten nach oben wachsen, pro Jahr zum Beispiel eine Menge des Minerals Calcit, die etwa 0,1 Millimetern Höhe entspricht – ein Prozess, der sich über Jahrtausende linear fortsetzen kann),3 geht es bei exponentiellem Wachstum also um eine konstante prozentuale Veränderung. Diese kann 0,1 Prozent pro Jahr oder 200 Prozent pro Monat betragen – entscheidend ist 17nur, dass die jeweilige Rate über längere Zeit konstant bleibt (wobei ein höherer Prozentsatz natürlich steilere Anstiege zur Folge hat, wie wir gleich sehen werden).
Dieses zentrale Merkmal gleichbleibender Wachstumsraten hat weitreichende Auswirkungen: Weil sich die prozentualen Veränderungen stets auf die im vorherigen Zeitabschnitt bereits gewachsene Bestandsgröße beziehen, kommt es zu immer größeren absoluten Zunahmen. Erst fällt die Steigerung noch moderat aus, doch irgendwann schießt die Kurve immer steiler nach oben, »explodiert« regelrecht. Genau diese brachiale Veränderung – obwohl die Rate sich nicht verändert hat! – ist die schwer zu fassende Eigenschaft, die Bartlett mit seinem Satz meint.
Die Abbildungen 1.1a und 1.1b illustrieren den fundamentalen Unterschied zwischen linearem und exponentiellem Wachstum am Beispiel einer fiktiven Tropfsteinhöhle.4 Ein linear wachsender Stalagmit, der am Anfang nur einen Millimeter misst und pro Jahr um 0,1 Millimeter wächst (was, wie gesagt, größenordnungsmäßig tatsächlich realistisch ist), hätte es nach 10000Jahren auf eine bescheidene Höhe von einem Meter geschafft. Ein sehr viel unrealistischerer, da exponentiell wachsender Tropfstein, der pro Jahr um 0,1 Prozent zulegen würde, wäre hingegen nach der gleichen Zeitspanne schon 22 Meter groß. Interessant ist, dass das lineare Wachstum in diesem Fall – wie in Abbildung 1.1a ersichtlich – zu Beginn des Prozesses einen Vorsprung hat. Da sich der Prozentwert beim exponentiellen Wachstum zunächst auf eine sehr kleine Bestandsgröße bezieht, geht es anfänglich nur langsam voran (1 Millimeter × 0,1 Prozent = 0,001 Millimeter Zuwachs). Ab einem bestimmten Punkt überholt der exponentielle Prozess jedoch den linearen und zieht schließlich uneinholbar davon. Die Diskrepanz wird noch deutlicher, wenn wir ein doppelt so hohes exponentielles Wachstum annehmen. Bei 0,2 Prozent Zuwachs pro Jahr schießt die Kurve schon viel früher nach oben (und sprengt in der Detailansicht Abbildung 1.1a buchstäblich den Rahmen). Dieser magische Fels hätte nach 10000Jahren eine sagenhafte Höhe 18von 476 Kilometern erreicht. Zum Vergleich: Die Internationale Raumstation ISS kreist in einer Höhe von etwa 400 Kilometern um die Erde (Abbildung 1.1b)! So absurd diese Vorstellung scheint: Unsere Gesellschaft hat heute kaum etwas mit tatsächlichen linear wachsenden Tropfsteinen gemein, sondern gleicht eher einem solchen exponentiell wachsenden Turbostalagmiten.
Abb. 1.1aExponentielles versus lineares Wachstum
Eigene Darstellungen, inspiriert von Smil 2019, S. 12f. Die ISS-Silhouette ist symbolisch und nicht auf eine realistische Größe skaliert.
19Abb. 1.1bExponentielles versus lineares Wachstum
Eigene Darstellung.
20Abb. 1.2Die logarithmierte Darstellung
Eigene Darstellung.
Je länger sich eine exponentielle Entwicklung fortsetzt und je höher die jeweilige Wachstumsrate, desto steiler wird also die Kurve (dabei verhalten sich diese beiden Faktoren entgegengesetzt proportional: Der halb so schnell exponentiell wachsende Tropfstein hätte die fantastische Höhe von 476 Kilometern nach der doppelten Zeit, also exakt 20000Jahren erreicht). Da die im weiteren Verlauf des Buches untersuchten realen exponentiellen Trends unterschiedlich langlebig sind und unterschiedliche Wachstumsraten aufweisen, sehen die Kurven mal steiler und mal flacher aus. Außerdem sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass bereits in der scheinbar flachen Phase zu Beginn exponentielles Wachstum vorliegt (wie Abbildung 1.1a gezeigt hat) und nicht erst, wenn die Kurve fast wie eine Wand nach oben ragt. Und selbst wenn wir es in diesem Buch ganz überwiegend mit exponentiellem Wachstum zu tun haben, werden auch mehrere Beispiele von exponentiellem Zerfall thematisiert (etwa der durch Umweltzerstörung verursachte Rückgang der Tierpopulationen). Dieser liegt vor, wenn die gleichbleibende Wachstumsrate negativ ist. In diesem Fall vollzieht sich die größte Abnahme am Anfang, bevor der Schwund dann, absolut 21gesehen, immer geringer wird (weil die konstante Schrumpfungsrate eine kleiner werdende Bestandsgröße betrifft).
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man exponentielles Wachstum auf zwei Arten darstellen kann. Einerseits gibt es die »normale« Darstellung, die sich besonders gut eignet, um die substanziellen Änderungen der Bestandsgröße aufzuzeigen. Die steilen Anstiege sind hier in ihrer ganzen Radikalität erkennbar (siehe Abbildung 1.1a). Andererseits kann auch eine alternative Darstellungsform sinnvoll sein, bei der die vertikale Achse logarithmiert wird (Abbildung 1.2). Der Abstand zwischen zwei Punkten auf der Y-Achse entspricht dann nicht mehr einem festen absoluten Unterschied (gleiche Abstände zwischen 0, 1, 2, 3, 4 usw.), sondern einem festen Verhältnis. Zum Beispiel ist der Abstand zwischen 5 und 50 nun gleich groß wie der zwischen 50 und 500, wobei es sich in diesem Fall jeweils um eine Verzehnfachung handelt. Wenn die Wachstumsrate konstant ist, wird der vormals extrem steile Anstieg durch diese Transformation zur schnurgeraden Linie (die bei positivem exponentiellem Wachstum von links unten nach rechts oben verläuft und bei negativem von links oben nach rechts unten; je höher die Wachstumsrate, desto steiler). Diese Darstellung hat den Vorteil, dass man auf den ersten Blick sieht, ob exponentielles Wachstum vorliegt (gerade Linie = ja!). Bei dem linear wachsenden Tropfstein ist dies offensichtlich nicht der Fall, die entsprechende Kurve in Abbildung 1.2 wird nun immer flacher, weil der, absolut gesehen, gleich bleibende Zuwachs (1 mm pro Jahr) relativ gesehen immer weniger zur Gesamtgröße beiträgt (Jahr 1: 1 mm + 0,1 mm = 10 Prozent Zuwachs; Jahr 10000: 1 m + 0,1 mm = 0,01 Prozent Zuwachs). Gleichzeitig hat die logarithmierte Darstellung den Nachteil, dass die Radikalität der Entwicklung, die ein exponentieller Trend substanziell mit sich bringt, nicht mehr direkt ersichtlich ist,5 wie man in Abbildung 1.2 deutlich erkennt: Der absurd hohe Gipfel des am schnellsten exponentiell nach oben schießenden Tropfsteins auf fast 500 Kilometer Höhe ist rein visuell sehr nah an den des nur einen Meter kleinen linear wachsenden Stalagmiten herangerückt. 22Weil die zwei Darstellungsformen somit Vor- und Nachteile haben, lohnt sich manchmal der vergleichende Blick auf beide.
Zu berücksichtigen ist außerdem, dass bei realen Trends die Wachstumsrate in der Regel nicht exakt, sondern nur annähernd konstant ausfällt. In der logarithmierten Darstellung wird die Linie bei allen folgenden Abbildungen daher nie hundertprozentig schnurgerade verlaufen, sondern eben nur ungefähr. Um uns nicht auf unser bloßes Auge verlassen zu müssen, wenn wir feststellen wollen, ob eine fast gerade Linie mit annähernd konstanten Wachstumsraten als exponentiell gewertet werden sollte oder nicht, können wir auf statistische Tests zurückgreifen. Dabei wird der empirische Verlauf mit einem idealtypischen Verlauf verglichen. Durch ein Maß namens R² wird festgestellt, wie gut die beiden zusammenpassen (R² = 0: gar nicht, R² = 1: perfekt). Um das Buch nicht zu sehr mit statistischen Kennzahlen zu überfrachten, sind diese Werte erst im Anhang aufgelistet. Es kann allerdings vorweggenommen werden, dass alle empirischen Entwicklungen, die im weiteren Verlauf als exponentiell beschrieben werden, sehr nah an idealtypischen exponentiellen Verläufen sind (mit R²-Werten fast immer über 0,95, meist sogar über 0,99). Im Anhang findet sich außerdem ein Überblick über die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten und Dopplungszeiten der untersuchten Phänomene. Die Dopplungszeit gibt dabei an, wie lange es dauert, bis sich die Bestandsgröße verdoppelt. Genau wie die Wachstumsrate ist sie bei exponentiellem Wachstum konstant, was in der folgenden Infobox »Technischer Exkurs« genauer erläutert wird. Doch keine Sorge: Der Inhalt dieses Buches lässt sich auch ohne die in dem Kasten oder im Anhang präsentierten Formeln und Zahlen gut nachvollziehen.
23Technischer Exkurs: Die Exponentialfunktion
Die Exponentialfunktion sei »ohne Zweifel die wichtigste Funktion der Mathematik«, schreibt Walter Rudin im ersten Satz seines klassischen Lehrbuchs Real and Complex Analysis.6 Sie soll hier daher nicht unterschlagen werden. Formal lässt sich die Exponentialfunktion folgendermaßen ausdrücken:
BZB0 × wZ
Hierbei steht BZ für die Bestandsgröße zum Zeitpunkt Z, B0 für die Bestandsgröße zum Zeitpunkt 0 und w für den Wachstumsfaktor pro Zeiteinheit. Wenn w > 1, dann hat man es mit exponentiellem Wachstum zu tun; wenn hingegen 0 < w < 1, mit exponentiellem Zerfall. Ein klassisches Beispiel ist der Zinseszins: Wenn die Zeit in Jahren angegeben ist und w = 1,02, dann wächst die Bestandsgröße BZ um 2 Prozent pro Jahr. Nehmen wir an, man hätte anfangs B0 = 1000 Euro auf ein Sparkonto mit 2 Prozent Zinsen eingezahlt, so hätte man nach Z = 35Jahren sein Guthaben fast verdoppelt: B35 = 1000 Euro × 1,0235 = 1999,89 Euro. Weil die Zeit im Exponenten steht, potenziert sich der Effekt des exponentiellen Wachstums (in diesem Beispiel der Zinseszins), je länger der Trend anhält.
Ein weitere wichtige Kennzahl ist die Dopplungszeit. Sie gibt an, wie lange es dauert, bis sich die Bestandsgröße B verdoppelt hat. Im Fall von exponentiellem Wachstum berechnet man sie folgendermaßen:
Dopplungszeit =
log 2
log w
Näherungsweise lässt sich die Dopplungszeit (zumindest bei moderaten Wachstumsraten zwischen etwa 1 und 15 Prozent pro Jahr) auch durch die sogenannte 70er-Regel errechnen, indem man einfach die Zahl 70 durch die prozentuale Wachstumsrate teilt. Bleiben wir 24bei dem Beispiel von 2 Prozent Wachstum pro Jahr (bzw. w = 1,02), so wäre, wie wir gesehen haben, nach 70/2 = 35Jahren die Dopplung der Bestandsgröße erreicht. Die präzise Version (d.h., log 2/log 1,02 = 35,002788… ergibt annähernd das gleiche Resultat. Wenn man die Dopplungszeit weiß, nicht jedoch die Wachstumsrate, kann man die 70er-Regel umkehren und 70 durch die Dopplungszeit teilen, um die prozentuale Wachstumsrate zu ermitteln. Im Beispiel also 70/35 = 2. Bei höheren Wachstumsraten (z.B. 100 Prozent pro Jahr) liefert die 70er-Regel leider sehr ungenaue Ergebnisse, sie hat also nur einen begrenzten Geltungsbereich.
Im Fall von exponentiellem Zerfall gibt es statt der Dopplungszeit die sogenannte Halbwertszeit. Sie bezeichnet die Zeit, die nötig ist, damit sich die Bestandsgröße halbiert, und berechnet sich folgendermaßen:
Halbwertszeit =
log ¹²
log w
Wenn die Bestandsgröße B also zum Beispiel jedes Jahr um 2 Prozent schrumpft (w = 0,98), so hätte sie sich nach log ½ / log .98 = 34,3Jahren halbiert.7
Die charakteristischen Eigenschaften des exponentiellen Wachstums entfalten bei realen sozialweltlichen Prozessen ihre Tücken (ein Punkt, auf den ich in Kapitel6 zurückkommen werde): Am Anfang einer Entwicklung ist das exponentielle Wachstum oft recht unscheinbar und wird – wenn überhaupt – als steter Fortschritt (bei wünschenswerten Phänomenen) beziehungsweise als nicht weiter tragisch (bei ungünstigen) wahrgenommen. Wenn eine Volkswirtschaft sich zum Beispiel selbst das Ziel vorgibt, jährlich mit zwei Prozent zu wachsen, hat sie dabei keine explosionsartige Entwicklung vor Augen, sondern einen kontinuierlichen, aber doch eher maßvollen Anstieg des allgemeinen Wohlstands. Ähnlich verhält es sich bei der Geldpolitik von Zentralbanken. Das Ziel von zwei Prozent Inflation pro Jahr ist 25in der Eurozone gesellschaftlich bekannt und akzeptiert. Die Zahl wird auch hier als klein wahrgenommen, ja oft wird sie diskursiv sogar gleichgesetzt mit einer Politik, welche die Währung stabil hält (und gleichzeitig kleine Anreize schafft, Geld auszugeben, statt es zu horten). So wird es allgemein nicht als Widerspruch empfunden, dass die Europäische Zentralbank (EZB) das »vorrangige Ziel« hat, »die Preisstabilisierung zu gewährleisten«, und gleichzeitig das Ziel verfolgt, die Inflationsrate »unter, aber nahe 2 % zu halten«.8
Der Fokus liegt stets auf der Wachstumsrate, die ja in der Tat konstant ist und somit Stabilität vermittelt. Außen vor bleibt die Bestandsgröße, die auch in diesem Stadium bereits exponentiell wächst – und zwar zehnmal so stark wie der schnellste Tropfstein aus Abbildung 1.1b! Es dauert gerade einmal 35Jahre, bis sich bei zwei Prozent jährlichem Wachstum die Wirtschaftskraft verdoppelt hat beziehungsweise bis sich bei zwei Prozent Inflation die Preise verdoppelt haben (siehe Infobox »Technischer Exkurs«). Beides findet jedoch gesamtgesellschaftlich weitgehend unbeobachtet statt. Die Bestandsgröße wird in ihrer mittelfristigen Entwicklung medial kaum verfolgt, während die jährliche Änderung der Wachstumsrate stets große Aufmerksamkeit erfährt.
Dies ändert sich oft erst, wenn das exponentielle Wachstum unverhofft endet (etwa wenn das Wirtschaftswachstum einbricht oder die Inflationsrate steigt) oder – und dies ist im Kontext dieses Buches der interessantere Fall – wenn die exponentielle Entwicklung weiter fortschreitet und ihre »vertikale« Phase erreicht, in der die Bestandsgröße in immer größeren Sprüngen nach oben schießt. Der Begriff »vertikale Phase« ist hier freilich nur als grobe Behelfskategorie zu verstehen, denn strukturell hat sich ja gar nichts geändert, und so lässt sich kein genereller Punkt bestimmen, ab dem diese anbrechen würde. Es hängt ganz vom jeweiligen Gegenstand und den ihn Beobachtenden ab, ob und wann die Situation subjektiv als aufmerksamkeitswürdig und disruptiv empfunden wird. Doch wann immer genau nach subjektivem Empfinden die vertikale Phase erreicht wird: Plötzlich zieht die explodierende Bestandsgröße Auf26merksamkeit auf sich, weil die Konsequenzen der immer stärkeren Steigerung nicht mehr ignoriert oder als »konstant« oder »stabil« interpretiert werden können. Im ersten Beispiel könnte es etwa sein, dass die Wohlstandsentwicklung ein Niveau erreicht, auf dem es großen Teilen der Bevölkerung ökonomisch so gut geht, dass ihre Lebensgrundlagen hinreichend gesichert sind und sich ein Wandel hin zu postmateriellen Werten vollzieht. Oder aber die Nebenwirkungen des in die Höhe schießenden Konsums führen zu unübersehbaren ökologischen Schäden. Die Crux exponentieller Entwicklungen liegt also darin, dass eine bereits geraume Zeit vorhandene und bisher nicht weiter auffällig gewordene Tendenz plötzlich völlig andere, manchmal schwerwiegende, ja oft extreme Folgen haben kann, ohne dass sich das grundsätzliche Muster strukturell verändert hätte.
Was ist die Exponentialgesellschaft?
Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, dann von einer Exponentialgesellschaft zu sprechen, wenn drei Kriterien erfüllt sind: wenn erstens gleich mehrere zentrale Bereiche stark von exponentiellen Entwicklungen geprägt sind; wenn diese Entwicklungen zweitens so weit fortgeschritten sind (»vertikale Phase«), dass die massiven Veränderungen der Bestandsgrößen fundamentale Bedeutung erlangen und den Status quo herausfordern; sei es, dass sie schwere Krisen auslösen, fundamentale Qualitäten wie Wohlbefinden, Sicherheit sowie das alltägliche Zusammenleben oder gar die ökologischen Lebensgrundlagen und damit den Fortbestand menschlicher Zivilisation überhaupt bedrohen, sei es, dass sie Potenziale für soziale Veränderungen bergen, die zur Lösung ebendieser Probleme beitragen können (man denke an Solarpanels oder Wissenszuwächse); und wenn schließlich drittens die exponentiellen Veränderungen in den einzelnen Bereichen nicht unabhängig voneinander stattfinden, sondern in einem engmaschigen Geflecht von Wechselwirkungen 27miteinander verbunden sind, wenn also explodierende Bestandsgrößen in einem Bereich direkt oder indirekt Einfluss auf andere Bereiche haben, die ihrerseits Einfluss auf wieder andere ausüben – ein Phänomen, das ich als Syndrom der Exponentialität bezeichne (mehr dazu unten in Kapitel3).
Ob die Gesellschaft die den Transformationsdruck erzeugenden Entwicklungen mit ihren gleichbleibenden Wachstumsraten als exponentielle Trends wahrnimmt, ignoriert oder leugnet, ist dabei sekundär. Häufig wird gerade der innergesellschaftlich divergierende Umgang mit diesen Entwicklungen im öffentlichen Diskurs zentral: Aus der Gemengelage unterschiedlicher und oft gegensätzlicher Reaktionen ergeben sich neue, bedeutsame Konfliktlinien; soziale, politische und ökonomische Kämpfe drehen sich zunehmend um das Finden von Antworten auf exponentielle Veränderungen.
Wichtig dabei ist, dass es sich bei der Exponentialgesellschaft um ein graduelles Phänomen handelt. Die beschriebenen drei Grundbedingungen lassen sich nicht einfach als erfüllt oder nicht erfüllt abhaken, sondern können mehr oder weniger stark ausgeprägt sein. Je mehr exponentielle Entwicklungen aus unterschiedlichen Bereichen gleichzeitig in dieser Form Einfluss nehmen, je größer die resultierenden Probleme sind und je enger die Wechselwirkungen verlaufen, desto eindeutiger trifft die Definition zu.
Nach Maßgabe dieser Kriterien leben wir heute unverkennbar in einer globalen Exponentialgesellschaft. Egal ob Wirtschaft, Ökologie, pandemische Krise, Wissen, Information, Technik und Digitalisierung, Mobilität & Kommunikation, Alterung oder Demografie, etliche Bereiche sind geprägt von entsprechenden Entwicklungen. Wir werden diese im zweiten Kapitel ausgiebig erkunden, aber einen ersten Eindruck liefert bereits Abbildung 1.3. Gezeigt werden exemplarische Trends, die über unterschiedlich lange Zeiträume exponentiell verlaufen sind und meist immer noch verlaufen: der Anstieg des Energieverbrauchs, der zirkulierenden Geldmenge (hier beispielhaft die Geldmenge M1 in Deutschland),9 der anthropogenen Masse (das heißt des von Menschen produzierten Materials, das in Gebäuden 29oder Verkehrsinfrastruktur verarbeitet wird), der Kohlenstoffdioxidkonzentration in der Atmosphäre, der kumulativen Menge der Infektionen mit Corona zu Beginn der Pandemie, der Zahl der internationalen Reisen etc. – immer haben wir es mit exponentiellem Wachstum zu tun, das in den letzten Jahr(zehnt)en eine steile, fast vertikale Phase erreicht hat. Bei vielen der über achtzig in diesem Buch untersuchten Trends passiert dies, ohne dass bisher ein Abbremsen, eine Brechung oder gar eine Stabilisierung sichtbar wäre. Gleichzeitig ist die radikale Veränderung der Bestandsgrößen zum Kern gesellschaftlicher Probleme geworden: Todesfälle und Langzeiterkrankungen in der Coronapandemie, wirtschaftliche Krisen und Lieferengpässe, Klimazerstörung und die resultierende Häufung von Hochwassern und Dürren, steigende Mietpreise und mangelnder Wohnraum durch Übertourismus etc. (mehr dazu in den Kapiteln 3 und 4). Insbesondere die ökologischen Auswirkungen stellen eine existenzielle Bedrohung dar. Gelingt es nicht, diese Trends zu stabilisieren, droht ein Abrutschen in eine »hothouse earth« (eine Heißzeit mit verselbstständigter Erhitzungsdynamik) und damit das Ende menschlicher Zivilisation, wie wir sie kennen.10
Abb. 1.3Beispiele exponentieller Entwicklungen von gesellschaftlicher Relevanz
Eigene Darstellung, basierend auf Daten von Worldometer 2022; Smil 2017 und BP Statistical Review of World Energy via OWiD 2024a; Werte vor 1700 ergänzt aus Smil 2008, S. 397, dabei Konvertierung von Exajoule in Petawattstunden durch E.D.; OWiD 2022a (es handelt sich um internationale Dollar, die an das Preisniveau von 2011 angepasst und damit inflationsbereinigt sind); Trading Economics 2022; Elhacham et al. 2020; Geyer et al. 2017; EEA 2019; Dangendorf et al. 2019; Dong et al. 2020; Rupp 2020; Sinatra et al. 2015; UNWTO via OWiD 2019.
Auch das dritte Definitionskriterium ist erfüllt, denn die einzelnen exponentiellen Prozesse – so wild zusammengewürfelt das Ensemble in Abbildung 1.3 zunächst vielleicht erscheinen mag – finden nicht jeweils autonom statt, sondern sind durch vielschichtige Interdependenzen miteinander verknüpft: Das exponentielle Wirtschaftswachstum befördert die diversen (Fehl-)Entwicklungen im Bereich der Ökologie und ist durch die Zerstörung natürlicher Lebensräume auch für die Übertragung des Coronavirus auf den 30Menschen mitverantwortlich. Die globale Ausbreitung des Virus wiederum wurde durch den exponentiellen Anstieg grenzüberschreitender Mobilität erleichtert. Die expansive Geldpolitik vieler Länder hat über Jahrzehnte das Wirtschaftswachstum befördert und wurde ihrerseits von der Pandemie angeheizt. Wie in der Medizin, wo das Wort »Syndrom« seinen Ursprung hat als Ausdruck für eine Kombination gleichzeitig auftretender Krankheitsanzeichen, ist es auch hier nicht immer einfach, die Kausalitäten zu entflechten oder einen eindeutigen Ursprung auszumachen. Dennoch werde ich in Kapitel3 versuchen, ein möglichst systematisches Bild des Syndroms der Exponentialität zu skizzieren.
Was diese Exponentialgesellschaft zusammenhält, sind nicht gemeinsame Werte oder ein Gefühl der Verbundenheit, auch keine allseitige Kommunikation oder Interaktion. Man könnte die Exponentialgesellschaft eher als Schicksalsgemeinschaft beschreiben, wenn ihr nicht aufgrund der fehlenden persönlichen Bezüge aller Menschen zueinander das Zeug zur »Gemeinschaft« fehlte. Vielleicht ist sie deshalb besser als Schicksalsgesellschaft charakterisiert: Sie bildet schlicht dadurch eine Einheit, dass sich niemand ihren Folgen entziehen kann. Da sich kein Mensch auf diesem Planeten ganz von den Problemen der Exponentialgesellschaft abkapseln kann, ist diese Schicksalsgesellschaft eine globale Angelegenheit. Da auch zahllose nichtmenschliche Lebewesen (von Korallen bis Mangroven) betroffen sind und ihr Überleben wortwörtlich von der Stabilisierung exponentieller Trends abhängt, gehören auch sie zur Exponentialgesellschaft. Dass die Betroffenheit und der Einfluss dabei ungleich verteilt sind – und zwar auf quasiexponentielle Art (dazu mehr in Kapitel8) –, tut dem keinen Abbruch. Alle Lebewesen, die die Exponentialgesellschaft bewohnen, egal wie viel Handlungsmacht sie haben, sind der Exponentialität in der ein oder anderen Form ausgeliefert. Dem dichten Geflecht langer Interdependenzketten kann niemand gänzlich entkommen.
Die heutige Exponentialgesellschaft ist also global, eine Gesellschaft im Singular. Gleichzeitig bleibt sie jedoch räumlich, politisch, 31kulturell und sozial stark fragmentiert. Kommunikations- und Interaktionsnetzwerke, Macht- und Herrschaftsstrukturen sind in ihrer Ausdehnung weiterhin begrenzt. Dabei handelt es sich um einen wichtigen Punkt, denn während die Wirkmächtigkeit vieler exponentieller Entwicklungen unbegrenzt ist, stellt sich das Problem ihrer Stabilisierung vor dem Hintergrund limitierter Steuerungsmacht. Genau darin liegt der organisatorische Haken, auf den ich in Kapitel7 ausführlicher zu sprechen kommen werde.
Entwicklung aus vorherigen Gesellschaftsformen
Wenn es stimmt, dass wir heute in einer Exponentialgesellschaft leben, liegt die Frage nahe, seit wann dem so ist. Hat es exponentielle Entwicklungen nicht schon immer gegeben? Um das Neue der gegenwärtigen Lage herauszuarbeiten, versuche ich nun, sie gegenüber der Vergangenheit abzugrenzen.
Will man eine historische Entwicklung in Epochen gliedern, hängt das Ergebnis auch von dem Kriterium ab, das man zugrunde legt. Karl Marx zum Beispiel nahm Herrschaftsverhältnisse zur Grundlage und unterschied auf Versklavung basierende, feudalistische und bürgerlich-kapitalistische Gesellschaften – sowie eine zukünftige klassenlose. Da das zentrale Merkmal der Exponentialgesellschaft ihre spezifische Form des Wachstums ist, scheint es mir sinnvoll, auch frühere Epochen an genau diesem Kriterium zu messen. Tut man dies, lassen sich ebenfalls drei bisherige Phasen der Menschheitsgeschichte unterscheiden – und über eine potenziell kommende spekulieren: erstens eine sehr lange Epoche der Stagnation, zweitens den Take-off im Zeitalter der Industrialisierung, drittens die Exponentialgesellschaft und viertens eine mögliche stabilisierte Post-Exponentialgesellschaft in der Zukunft.
Frühe menschliche Gesellschaft, von ihren Anfängen vor etwa 300000Jahren bis ins vorindustrielle Zeitalter der Frühen Neuzeit, 32war großteils von Stagnation, zyklenhaftem Auf und Ab und – wenn überhaupt – minimalen Wachstumsraten geprägt. Über sehr, sehr lange Zeit war der Wechsel der Jahreszeiten das dominante, streckenweise vielleicht sogar einzige Veränderungsmuster.11 Werkzeuge und Produktionsmittel blieben von Generation zu Generation die gleichen. Die allermeisten Menschen waren mit Jagen und Sammeln und später in der Subsistenzlandwirtschaft beschäftigt. Innovationen waren extrem selten, Erträge wurden meist sofort verzehrt oder zur Überlebenssicherung verwendet und konnten kaum in eine Steigerung der Produktion investiert werden.12 Wirtschaft war damit in dieser langen ersten Epoche der Menschheitsgeschichte eine »Kraft des Stillstands, nicht des Wandels«.13 Auch viele andere Bestandsgrößen (von Bevölkerungs- und Siedlungsgrößen über die Lebenserwartung bis hin zu Nutztierpopulationen und Wohlstand) veränderten sich über viele Jahrtausende so langsam, dass Wachstum allenfalls im Zeitraffer zu erkennen ist.14
Dies bedeutet natürlich nicht, dass nichts passierte. Es wäre falsch, die Vergangenheit als leeren, ereignislosen Raum zu begreifen. Auch in vormodernen Zeiten gab es Expansions- und Akkumulationsprozesse – insbesondere ab dem Beginn der neolithischen Revolution vor etwa 12000Jahren, als Menschen begannen, Ackerbau zu betreiben und größere Bauwerke zu errichten. Das Wachstum der Weltbevölkerung zum Beispiel lässt sich schon über mehrere Jahrtausende vor der Industrialisierung zumindest grob (je weiter wir in die Vergangenheit gehen, desto ungenauer werden natürlich die Daten) als exponentieller Anstieg beschreiben – wenn auch freilich die Wachstumsrate sehr viel niedriger war als später (die vorindustrielle Dopplungszeit betrug mehr als 800Jahre, die nach dem Take-off weniger als 40, siehe Kapitel2 und Anhang). Insgesamt gab es in vielen Bereichen immer wieder Rückschläge, Phasen der Schrumpfung, Fluktuation und vor allem: Stagnation. Ein Beispiel aus dem Bereich der Mobilität ist die Geschwindigkeit der Beförderung von Post auf dem Landweg. Da keine neuen, nicht auf die Nutzung von Muskelkraft angewiesenen Fortbewegungsmittel 33erfunden wurden, war diese sehr lange auf die 18 bis 25 Kilometer limitiert, die Pferde zwischen zwei optimal positionierten Relaisstationen (also den Orten, wo die Pferde gewechselt wurden) ohne Probleme am Stück zurücklegen können. Schon zu Zeiten Kyros des Großen (540 v.u.Z.) fand man in Persien heraus, dass diese Strecke der effizienteste Kompromiss zwischen Geschwindigkeitsmaximierung und einer kostspieligen Überlastung der Tiere war, und so blieb dieses Stafettensystem über Jahrtausende erhalten. Noch in den 1860er Jahren kam es in den USA auf der 3000 Kilometer langen Route des Pony-Express zum Einsatz.15
Für diese lange erste Phase der Menschheitsgeschichte ist außerdem charakteristisch, dass der Bevölkerung die materiellen, technologischen und wirtschaftlichen Verhältnisse als unveränderbar erschienen. Sie machte sich keine Illusionen darüber, dass die diesseitige Zukunft radikale Verbesserungen der Lebensumstände mit sich bringen könnte. »Allgegenwärtig anzutreffende Erwartungen von Veränderungslosigkeit« nennt der Historiker Robert Heilbroner dieses Phänomen, das er in der frühen Phase der Menschheitsgeschichte für kulturübergreifend und universell anzutreffen hält.16
Man unterschätzt, wie lange diese erste Phase andauerte. Zur Veranschaulichung fordern die niederländischen Soziologen Hans van der Loo und Willem van Reijen dazu auf, sich die Menschheitsgeschichte als einen Tag mit 24Stunden vorzustellen. Wenn wir dies tun, »sehen wir, dass über 23Stunden dieses Tages auf Jäger- und Sammlergesellschaften entfallen, Ackerbau und Viehzucht setzen vier Minuten vor Mitternacht ein, von urbanen Zivilisationen lässt sich erst drei Minuten vor Mitternacht sprechen, und die Geburt der modernen Gesellschaft […] tritt 30Sekunden vor Mitternacht ein«.17 Dies bedeutet, dass Stagnation und zyklische Rhythmen fast immer der Normalzustand waren. Länger anhaltendes, globales Wachstum ist, historisch betrachtet, die große Ausnahme.
Die Dinge ändern sich (und genau dies ist der Punkt!) mit der beginnenden Industrialisierung im 18. Jahrhundert. Unter dem Einfluss technologischer und wissenschaftlicher Innovationen kommt 34es zum Wandel von subsistenz- zu akkumulationsbasierten Wirtschaftsformen, namentlich dem Kapitalismus.18 War bisher kaum mehr generiert als verbraucht worden, beginnt nun die systematische Abschöpfung von Mehrwert, der investiert werden kann, um zu expandieren, was wiederum den Grundstein für weiteres Wachstum legt.19 Eine selbstverstärkende Steigerungslogik etabliert sich, die von der geballten Energie der fossilen Brennstoffe wortwörtlich zusätzlich angeheizt wird.20 Es kommt auch zu Differenzierung und Spezialisierung; immer mehr Personen tauschen immer spezifischere Güter, Dienstleistungen und Informationen untereinander.21 Beschleunigung wird zum zentralen Merkmal der Industriegesellschaft: Handel, Wohlstand, Bevölkerung, Mobilität – plötzlich geht es in vielerlei Hinsicht immer schneller bergauf. Auch die Rate, mit der neue Erfindungen die Gesellschaft umgestalten, erhöht sich. Doch wo sich Raten erhöhen, ist der Wandel nicht exponentiell – die relative Geschwindigkeit der Veränderung ist nicht konstant, sondern nimmt erst einmal zu. Dies ergibt ja auch Sinn, denn um von einer Phase der Stagnation (oder sehr geringer Wachstumsraten) zu einer Phase konstant hohen Wachstums zu kommen, muss es dazwischen eine Übergangsphase geben, in der das Tempo steigt.
In dieser Take-off-Phase haben wir es also noch nicht mit einer Exponentialgesellschaft zu tun. Zwar gibt es durchaus die ein oder andere langlebige Entwicklung, die Jahrhunderte mit konstanter Wachstumsrate zu überdauern scheint (die wachsende Menge produzierter Bücher wird uns in Kapitel2 als Beispiel begegnen), aber dies sind eher Einzelfälle. Und selbst als zentrale Trends (etwa das Wachstum von Weltwirtschaft und Bevölkerung) schließlich auf ihre exponentielle Endgeschwindigkeit einschwenken (typischerweise zwischen 1950 und 1970, siehe auch hierzu Kapitel2), können sich die Bestandsgrößen erst einmal noch frei entfalten, denn es gibt weiterhin Luft nach oben. Es fehlt also zunächst die Zuspitzung (»vertikale Phase«); die schwerwiegenden Konsequenzen kommen noch nicht geballt zum Vorschein. Das bedeutet nicht, dass die Take-off-Phase keine Probleme oder Konflikte kannte, im Gegen35teil: Das Wachstum vollzieht sich teils äußerst gewaltvoll, vernichtet als koloniale Expansion indigene Gemeinschaften, verheizt durch katastrophale Arbeitsbedingungen menschliche Körper in den Fabriken und zerstört Umwelt in nie dagewesenem Ausmaß. Aber diese Probleme betreffen noch vorwiegend jene, die der Beschleunigungsmaschinerie im Weg stehen oder ihr als Treibstoff dienen. Konflikte eskalieren auch dort, wo der Expansionstrieb regionaler Mächte auf den Widerstand räumlich ebenso begrenzter Konkurrenten trifft. Steigende Ungleichheit ist eine weitere Kehrseite des Wachstums; es tun sich größere soziale Kontraste auf als je zuvor.22 Doch Probleme der globalen Steigerungsdynamik selbst sind bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts allenfalls schemenhaft am Horizont erkennbar. Die planetaren Grenzen sind (scheinbar) weit entfernt, die Straßen frei, der Himmel leer. Das Problem der Stabilisierung stellt sich noch nicht. Im Gegenteil, gesellschaftlich überwiegen ganz andere Fragen, etwa wie man die Wohlstands- und Wissensgewinne so weiter ausdehnen könnte, dass breitere Schichten von ihnen profitieren; wie wachsende Ungleichheiten zu bewältigen sind oder wie sich die Fortschritte verstetigen und ausbauen lassen. Der Motor ist endlich am Laufen, und nichts läge ferner, als ihn sofort wieder abzuwürgen. Vielerorts gibt es satte Steigerungen: des Wohlstands, der Gesundheit, der Alphabetisierung. Der Alltag wird über die Generationen und sogar innerhalb individueller Biografien spürbar angenehmer. Entsprechend positiv schlägt sich dieser Wandel auch im Zukunftsbild der Gesellschaft nieder. Die ehemals vorherrschende Erwartung von Veränderungslosigkeit hat dem Fortschrittsglauben Platz gemacht – zumindest in jenen Teilen der Welt (und den sozialen Schichten), die am meisten vom Wachstum profitieren.23 Bisher unvorstellbare Möglichkeiten tun sich auf, die Natur erscheint plötzlich beherrschbar, der Mensch durch die gestiegene Handlungsmacht als seines Glückes Schmied. Eltern arbeiten emsig daran, dass es ihren Kindern »einmal besser geht« – eine zu diesem Zeitpunkt realistische Erwartungshaltung. Geschichte wird gemacht, es geht voran.
36Die Lage ändert sich erneut, als sich in den verschiedensten Bereichen immer mehr exponentielle Trends so weit verschärfen, dass die aus dem Ruder laufenden Bestandsgrößen zu schwerwiegenden Problemen führen. Weil die Trends nicht alle in exakt demselben Moment auf ihre konstante Wachstumsrate einschwenken und es sich, wie oben erwähnt, um eine graduelle Zuspitzung handelt, ist es nicht einfach, hier einen spezifischen Startpunkt zu nennen. Klar ist, dass in den 1960er und 1970er Jahren viele zentrale Trends ihr »finales« exponentielles Tempo aufgenommen haben, dass bereits Indizien für die kommende Eskalation sichtbar sowie gesellschaftlich erkannt und diskutiert werden: Seit 1970 übersteigt der jährliche Ressourcenverbrauch die Menge dessen, was eigentlich zur Verfügung steht (genauer hierzu in Kapitel4), und auch die Tierpopulationen sind zu diesem Zeitpunkt bereits im Schrumpfen begriffen (siehe Kapitel2). Insbesondere in den Grenzen des Wachstums, dem berühmten Bericht an den Club of Rome aus dem Jahr 1972, wird auf exponentielle Entwicklungen und ihre katastrophalen Auswirkungen vehement hingewiesen (auch hierzu mehr in Kapitel4). Gleichzeitig verpuffen diese frühen Warnungen trotz breiter Rezeption relativ wirkungslos, 1988 schießt die CO2-Konzentration in der Atmosphäre über ihre planetare Grenze (also das, was nachhaltig wäre) hinaus – ein exponentieller Trend, der sich bis heute ungebremst fortsetzt. Man könnte auch sagen, dass erst die Tatsache, dass die frühen Warnungen kein konsequentes Umsteuern zur Folge hatten, dazu geführt hat, dass wir heute in einer zugespitzten Exponentialgesellschaft (mit all ihren Problemen) leben. Klar ist allerdings, dass zumindest seit 2019, als die Klimabewegung mit weltweiten Massendemonstrationen ihren (vorläufigen?) Höhepunkt erreicht und SARS-CoV-2 die Weltbühne betritt, verschärfte exponentielle Trends und die von ihnen ausgelösten Krisen gesellschaftlich allgegenwärtig sind.
Spätestens jetzt wandelt sich die Wahrnehmung von Wachstumsprozessen: Was eben noch als erfreuliche Wohlstandssteigerung erschien, ist plötzlich zur planetaren Gefahr geworden. Das Auto 37ist nicht länger freiheitsgenerierendes Distinktionsmerkmal aufstrebender Mittelschichten, sondern vielen ein Symbol rücksichtslosen Egoismus in einer Welt vor dem ökologischen Kollaps. Das Flugzeug, vor Kurzem stolze Errungenschaft der Ingenieurskunst und Ermöglicherin von Weltbeziehung, ist nun Vehikel todbringender Zirruswolken, Treibhausgase und Viruspartikel. Das Wort »Wachstum« hat seinen Glanz verloren, ist ambivalent geworden, genau wie die Zukunft selbst. Wie Robert Heilbroner konstatiert, haben Triebkräfte der Veränderung nun positive und negative Vorzeichen.24 Sie wirken gleichzeitig bedrohlich und Halt gebend, oder, wie der Philosoph Nick Bostrom es ausdrückt, »ebenso vielversprechend wie brüchig, gefährlich und ominös«.25
Das Neue an der Exponentialgesellschaft ist also nicht die Präsenz einzelner exponentieller Trends, denn die gab es durchaus schon in früheren Zeiten. Neben den oben genannten Beispielen des vorindustriellen Bevölkerungswachstums oder der seit Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert exponentiell steigenden Anzahl der Bücher könnte man hier etwa an die holländische Tulpenmanie von 1637 denken, als die Zwiebeln dieser Blumen zum Spekulationsobjekt wurden und ihr Preis in kürzester Zeit exponentiell in ungeahnte Höhen schoss. Oder an die Great Plague, als sich die Pest zwischen Mai und September 1665 in London exponentiell ausbreitete und 20 Prozent der Bevölkerung das Leben kostete. Vielleicht könnte man die Niederlande beziehungsweise England in diesen Phasen sinnvollerweise als zeitlich und räumlich begrenzte »Exponentialgesellschaften« betrachten; die heutige Situation unterscheidet sich jedoch grundlegend von derartigen historischen Beispielen. Während solche früheren exponentiellen Entwicklungen entweder sehr langsam vonstattengingen und (erst einmal) keine krisenhafte »vertikale Phase« erreichten (z.B. vorindustrielle Steigerungen bei Bevölkerung und Buchproduktion) oder nur vereinzelt auftraten und dann für sich alleine (und relativ kurze Zeit) im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit standen (»nur« die Preisentwicklung in der Tulpenmanie oder »nur« die Londoner Gesund38heitslage während der Großen Pest), zieht heute eine Vielzahl miteinander verwobener exponentieller Trends in mehreren Bereichen fundamentale Probleme mit weltweiter Wirkung nach sich. Aus dieser bereichsübergreifenden Zuspitzung und der neuen globalen Vernetztheit ergibt sich auch ein völlig anderer Grad von Fragilität. Probleme in einem Bereich haben – direkt oder über Umwege – potenziell Auswirkungen auf andere. Auch räumlich können sich weitreichende Kettenreaktionen, sogenannte Ripple-Effekte, inzwischen überall hin ausbreiten, die systemischen Risiken sind gestiegen.26 Ständig drohen Krisen: Erderhitzung, Pandemien, Wirtschaftskollaps, Ressourcenknappheit. Die Exponentialgesellschaft hat sich zunächst in luftige Höhen aufgeschwungen und droht nun jäh abzustürzen. Im Raum steht die Frage, wie es weitergehen soll.
Wie wir in Kapitel4 sehen werden, stellt sich in jedem der untersuchten Bereiche das Problem der Stabilisierung. Wenn eine unkontrollierte Ausweitung negativer Konsequenzen verhindert werden soll, müssen exponentielle Trends rechtzeitig gebrochen und ein Einpendeln der Bestandsgrößen auf gesamtgesellschaftlich wünschenswerten Niveaus eingeleitet werden. Gelänge dies umfassend, könnte man von einer stabilisierten Post-Exponentialgesellschaft sprechen. Diese potenzielle vierte Phase der Menschheitsgeschichte ist jedoch nur ein Szenario unter mehreren denkbaren. Eine weitere potenzielle Zukunft ist die des unkontrollierten Desasters.27 Hier würden sich exponentielle Trends so lange fortsetzen, bis es zum Zusammenbruch kommt – wie oben beschrieben mit katastrophalen Folgen. Dies könnte passieren, weil die Stabilisierungsaufgaben zu halbherzig angegangen werden, weil andere, kurzfristig dringlicher erscheinende Probleme (etwa Kriege) alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder weil sich Prozesse zunehmend verselbstständigen und jeglicher Eingriffsmöglichkeit entziehen.
Die stabilisierte Post-Exponentialgesellschaft ist jedenfalls der Fluchtpunkt dieses Buches: eine Gesellschaft, die ein Niveau an Stabilisierungskapazität erreicht, das es ihr erlaubt, wo notwendig, exponentielle Prozesse zum Wohle aller – auch zukünftiger Gene39rationen – in geregelte Bahnen zu lenken. Eine solche Gesellschaft würde die Voraussetzung schaffen, nachhaltige und sozial gerechte Verhältnisse auch über längerfristige Zeithorizonte zu sichern. Das mag utopisch klingen, ist aus meiner Sicht jedoch vorstellbar und potenziell realisierbar. Der unkontrollierte Zusammenbruch wiederum wäre der dystopische Konterpart. Zwischen Utopie und Dystopie gibt es ein breites Spektrum möglicher Zukünfte. Nur ein exponentielles Weiter-so ist zunehmend undenkbar.
Soziologie als Formsache
Sucht man nach Büchern zu exponentiellen Trends, stößt man vor allem auf Ratgeberliteratur mit Tipps, wie man persönlich von exponentiellem Wachstum profitieren kann: »Machen Sie sich und Ihr Unternehmen zukunftssicher im Zeitalter der exponentiellen Veränderung«, lautet der Untertitel eines solchen Buches.28 Andere berichten von extrem ertragreichen »exponentiellen Innovationen«.29 Ein religiöses Buch stellt gar einen »zukunftssicheren Glauben im Zeitalter des exponentiellen Wandels« in Aussicht.30 All diesen Titeln ist gemeinsam, dass sie aus einer partikularistischen Perspektive auf das Thema blicken: Wie kann ich von exponentiellem Wachstum profitieren? Exponentialität ist hier immer persönliche Chance, nie systemische Gefahr.
Der Ansatz dieses Buches ist offenkundig ein anderer. Es versucht, das Gesamtbild in den Blick zu nehmen. Zu einer solchen Perspektive gehört auch, die Umwelt, in die gesellschaftliches Leben eingebettet ist, als essenziellen Bestandteil der Analyse zu begreifen. Will man Gesellschaft verstehen, lassen sich ökologische Fragen nicht ausklammern, schon gar nicht heute. Das mag selbstverständlich klingen, doch lange herrschte in Bezug auf Umweltthemen eine »soziologische Abstinenz« vor, wie schon Niklas Luhmann konstatierte.31 »Der Klimawandel, das drängendste Problem dieses 40Jahrhunderts, spiegelt sich in der Soziologie kaum wider«, schreibt noch 2024 sein Fachkollege Andreas Diekmann.32
Durch die Berücksichtigung sozialer, ökonomischer, technologischer, energetischer, demografischer, politischer, psychologischer und ökologischer Prozesse soll hier zu einem besseren Verständnis beigetragen werden – inklusive prognostischen Nachdenkens über mögliche stabilisierte Zukünfte und Handlungsstrategien auf dem Weg dorthin. Dieser Einbezug der Naturverhältnisse bringt uns in die Nähe der Soziologie von Bruno Latour und anderen, die ökologische und technischer Artefakte, nichtmenschliche Lebewesen sowie »mehr-als-menschliche Verbünde« ganz allgemein als wichtige gesellschaftliche Aktanten betrachten.33 Wenn ich in den folgenden Kapiteln etwa auf Kohlenstoffdioxidmoleküle eingehe, die sich in der Atmosphäre sammeln, Transistoren, die sich auf Mikroprozessoren drängen, Viren, die sich vermehren, oder Container, die um die Welt reisen – jeweils einer exponentiellen Steigerungslogik folgend –, dann tue ich das, weil viel dafür spricht, dass Latour & Co. richtigliegen: All dies ist soziologisch höchst relevant. Die Form, in der sich all diese Dinge entwickeln, ist prägend für die Exponentialgesellschaft.
Form ist ein wichtiges Stichwort, denn ein weiterer Anknüpfungspunkt dieses Buches ist die formale Soziologie Georg Simmels. Der deutsche Soziologe argumentierte Anfang des 20. Jahrhunderts, wo andere Disziplinen einen festen Gegenstandsbereich hätten und sich inhaltlich mit diesem beschäftigten (die Rechtswissenschaft mit Gesetzen und richterlichen Entscheidungen, die Politikwissenschaft mit politischen Verhältnissen usw.), setze sich die Soziologie unabhängig von konkreten Inhalten mit den Formen des Zusammenlebens auseinander. Bei Simmel meint »formal« dabei nicht förmlich oder offiziell, sondern auf soziale Formen beziehungsweise Strukturen und Muster abzielend. Beispiele für solche sozialen Formen sind bei ihm Kooperation oder Konflikt. Die Soziologie kann sich mit Konflikten in ganz unterschiedlichen Kontexten beschäftigen: zwischen Liebespaaren, Koalitionspartnern oder bewaffneten Bür41gerkriegsparteien. All diese Fälle haben strukturelle Gemeinsamkeiten, die es rechtfertigen, sie auf einer höheren Abstraktionsebene gemeinsam zu verhandeln.
Was mir hier vorschwebt, ist eine Fortentwicklung dieser Idee Simmels hin zu einer formalen Soziologie im wörtlichen Sinne, die tatsächlich auf geometrische Formen rekurriert und nicht nur auf soziale, die ja eigentlich eher Konzepte sind. Schon bei Simmel selbst gibt es mit der berühmten Kreuzung sozialer Kreise ein Beispiel für die Verwendung einer solchen geometrischen Form (in einem gleichnamigen Buchkapitel beschrieb er die soziale Position eines Menschen als einzigartigen Schnittpunkt verschiedener Zirkel – und legte so elegant die Gleichzeitigkeit von Individualität und gesellschaftlicher Bindung offen).34 Auch in aktuellen soziologischen Debatten spielen geometrische Konturen immer wieder eine wichtige Rolle. Etwa wenn diskutiert wird, ob Ungleichverteilungen der Silhouette eines Elefanten gleichen oder ob Meinungsmuster in der Bevölkerung eher die einhöckrige Form eines Dromedars oder die polarisierte zweihöckrige eines Kamels annehmen.35 Daran anknüpfend, könnte man sich verallgemeinernd eine »geometrische Soziologie« denken, welche die soziogeometrischen Muster hinter aggregierten gesellschaftlichen Strukturen systematisch untersucht.36 Die spezifische soziogeometrische Form, die im Fokus dieses Buches steht, ist die Exponentialkurve. Wie bei Simmel vorgedacht, geht es nicht um eine bestimmte exponentielle Kurve in einem konkreten inhaltlichen Feld, sondern darum, dass Exponentialkurven, die denselben grundlegenden Mechanismen folgen (dazu mehr in Kapitel3), in ganz unterschiedlichen Bereichen wichtig geworden sind. Diese wiederkehrende Struktur unter die Lupe zu nehmen kann helfen, Gesellschaft besser zu verstehen. Soziologie wird zur Formsache.
Für eine formale Soziologie in diesem wörtlichen Sinne ist ein hohes Maß an Abstraktion nötig, was Vor- und Nachteile mit sich bringt. Zu den Nachteilen gehört, dass Feinheiten verschwimmen können, die in Spezialstudien sichtbar blieben. Außerdem besteht die Gefahr des übermäßigen In-eine-Form-Gießens: Wer als einzi42ges Werkzeug einen Hammer hat, sagt ein geflügeltes Wort, sieht überall nur noch Nägel. Übertragen auf unseren Fall würde das bedeuten, überall nur noch exponentielle Kurven zu entdecken, weil wir nach ihnen suchen, und dabei andere Entwicklungen, die nicht ins Bild passen, außer Acht zu lassen. Im Grunde ist dies aber kein Problem. Denn dieses Buches behauptet ja gar nicht, dass heute alle gesellschaftlichen Entwicklungen exponentieller Natur sind, sondern nur eine gewisse Zahl, deren Relevanz in Summe schwer abzustreiten ist. Wenn man versuchen wollte, die These von der Exponentialgesellschaft zu widerlegen, genügte es also nicht, Entwicklungen zu finden, die nicht exponentiell verlaufen. Es wäre nötig nachzuweisen, dass diejenigen exponentiellen Trends, die ich hier beschreibe, nicht gesellschaftsprägend sind. Darüber hinaus argumentiert das Buch ja gerade, dass es keinen Zwang zu allgegenwärtigem exponentiellem Wachstum gibt, sondern dass Bruch und Stabilisierung ebenso möglich sind (Kapitel4 und 5).
Umgekehrt gehört zu den Vorteilen, dass man mit einer solchen Herangehensweise Dinge erkennt, die erst durch den Blick aufs große Ganze sichtbar werden. Konzentriert man sich auf eine Form, kann man Gemeinsamkeiten und Unterschiede offenlegen, indem man zunächst scheinbar unverbundene Themen in vergleichbare Einheiten konvertiert (hier konkret: Wachstumsrate und Dopplungszeit). Diese »Universalisierungskraft« ist bereits bei Simmel ein wichtiger Gedanke und aus meiner Sicht auch in unserem Zusammenhang ein großer Gewinn.
Aufbau des Buches
Das Buch ist in weitere acht Kapitel unterteilt. Im zweiten durchforste ich – basierend auf umfangreichem Datenmaterial – sechs zentrale Gesellschaftsbereiche, um zu belegen, wie wirkmächtig exponentielle Entwicklungen heute sind: (1) Wirtschaft, (2) Ökologie, 43(3) pandemische Krise, (4) Information & Technik, (5) Mobilität & Kommunikation sowie (6) Demografie. Das Spektrum reicht von der globalen Müllproduktion über Künstliche Intelligenz (KI) bis hin zu dem Risiko, im Lebensverlauf an Diabetes zu erkranken oder einen Schlaganfall zu erleiden. Dabei wird auch ersichtlich, warum diese Tendenzen zunehmend gesellschaftliche Debatten prägen und neue Probleme aufwerfen.
Auf diese empirische Basis aufbauend, erkunde ich im dritten Kapitel einige Eigenschaften der Exponentialgesellschaft genauer und untermauere diese Besonderheiten theoretisch. Zunächst beschreibe ich den Mehr-bringt-mehr-Mechanismus hinter quasi allen exponentiellen Trends: Bestandsgrößenwachstum schafft die Grundlage für weiteres Bestandsgrößenwachstum. Anschließend versuche ich, die komplexen Wechselwirkungen zwischen exponentiellen Trends etwas zu entwirren. Dabei wird deutlich, dass es sich eben nicht um disparate Einzelphänomene handelt, sondern um ein größeres Netzwerk kausaler Beziehungen – das besagte Syndrom der Exponentialität. Es folgt unter anderem die Feststellung, dass aus individueller Sicht oft ein Interesse an Handlungen besteht, die weiteres Wachstum antreiben, während aus kollektiver Sicht Stabilisierung optimal wäre – eine vertrackte Lage, wie sie typisch ist für sogenannte Kollektivgutprobleme. Hinzu kommt die Binnendifferenzierung der Exponentialgesellschaft in Milieus mit unterschiedlichen Interessen und Wertvorstellungen. Eine Reihe neuer sozialer Konflikte bricht auf, die sich gerade an der Frage des Umgangs mit exponentiellen Trends entzünden. Als einen Grund für diese gestiegene Konflikthaftigkeit mache ich verdichtete Interdependenzketten aus: Jede Handlung ist durch weit fortgeschrittene exponentielle Trends viel stärker als früher in ein engmaschiges Geflecht von Wechselwirkungen eingebunden. Dies führt dazu, dass die Exponentialgesellschaft für viele zur »ärgerlichen Tatsache« wird, wie ich in Anlehnung an den deutsch-britischen Soziologen Ralf Dahrendorf konstatiere.
Das vierte Kapitel wendet sich dem Thema Stabilisierung zu. 44Warum ist sie nötig, und wie könnte sie konkret aussehen? Diese Frage beantworte ich nacheinander für die sechs Gesellschaftsbereiche, die schon Kapitel2 strukturiert haben. Im Bereich der Ökologie zum Beispiel geht es um eine effektive Steuerung des Erdsystems (»Earth system stewardship«), die uns ökologisch zurück auf den nachhaltigen Pfad einer »stabilisierten Erde« führt. In der pandemischen Krise geht es um die Stabilisierung von Inzidenzen und Todesfällen auf möglichst niedrigem Niveau; im Bereich von Wissenschaft & Technik um ethisch-rechtliche Grenzen, die gezogen werden müssen (etwa bei KI und biomedizinischen Techniken wie dem Klonen); im Bereich der Mobilität um die Vermeidung von Treibhausgasen, Feinstaub, Lärm, Energie- und Materialverschwendung sowie um Platzmangel, etwa in begrenzten urbanen Räumen. Im Gesamtbild zeigt sich: In allen diskutierten Gesellschaftsbereichen stellt sich das Problem der Stabilisierung mit großer Dringlichkeit.
Im fünften Kapitel argumentiere ich, dass eine solche Stabilisierung auch möglich





























