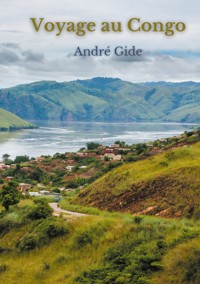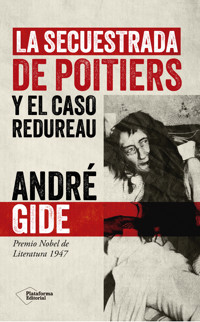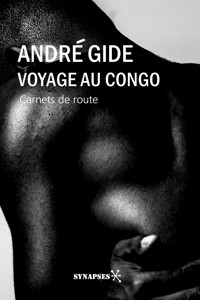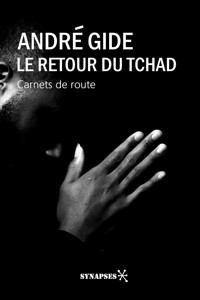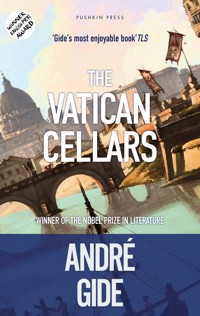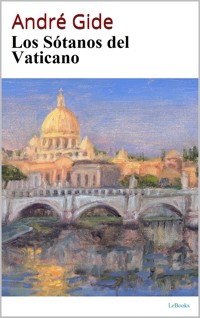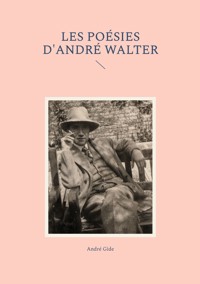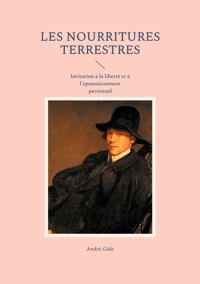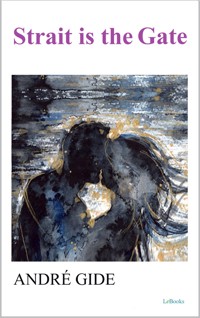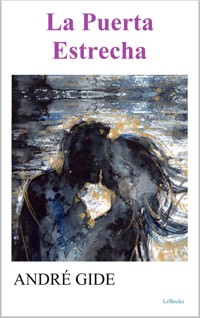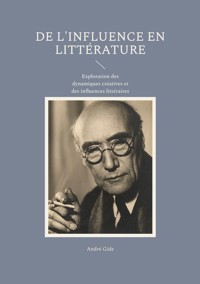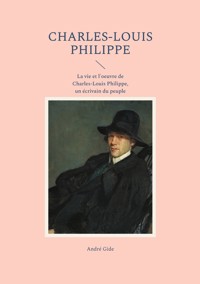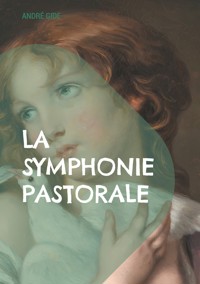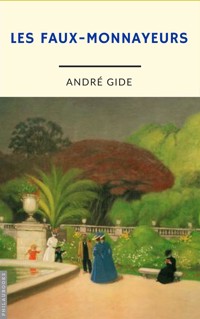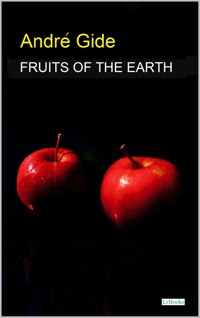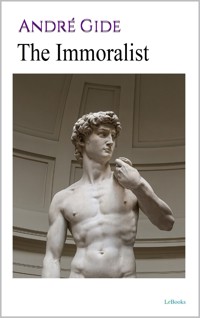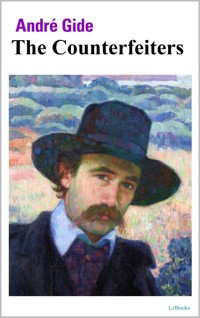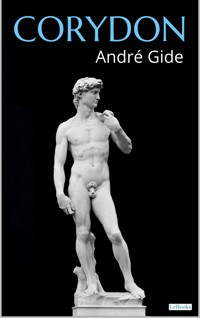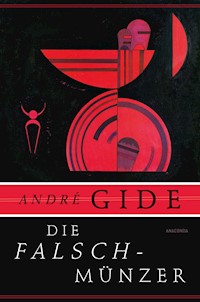
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den Fallstricken des Lebens und des Erzählens
Paris um 1900: Drei junge Gymnasiasten suchen das Leben jenseits der großbürgerlichen Fassade ihrer Elternhäuser. Die Welt der Literatur und Kunst, der Verführung und homosexuellen Erotik erwartet sie, und sie verstricken sich zunehmend in einem Geflecht aus Täuschung, Falschheit und Manipulation. So vertrackt und wendungsreich wie die Handlung dieses Romans ist seine literarische Form, denn er spielt virtuos mit den verschiedensten Erzählverfahren. Der Literaturnobelpreisträger André Gide hat mit den 1925 erschienenen Falschmünzern ein zeitloses Meisterwerk der modernen Literatur geschaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
André Gide
Die Falschmünzer
Tagebuch der Falschmünzer
Aus dem Französischen von Christine Stemmermann
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
André Gides Roman »Les Faux-monnayeurs« sowie das »Journal des Faux-monnayeurs« erschienen zunächst 1925/1927 in der Nouvelle Revue française in Paris. Die Übersetzung von Christine Stemmermann erschien erstmals 1993 in Band IX der Werkausgabe »Gesammelte Werke in zwölf Bänden«, Deutsche Verlags-Anstalt. Orthografie und Interpunktion wurden unter Wahrung von grammatischen Eigenheiten auf neue Rechtschreibung umgestellt.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe 2023 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
© der Übersetzung 1993 Deutsche Verlags-Anstalt
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: Wassily Kandinsky (1866–1944) »Starr« 1931 © Bridgeman Images
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
Satz und Layout: Fotosatz Amann, Memmingen
ISBN 978-3-641-29228-7V002
www.anacondaverlag.de
Die Falschmünzer
ROGERMARTINDUGARD widme ich meinen ersten Roman zum Zeichen tiefer Freundschaft.
A.G.
ERSTER TEIL
Paris
I
»In solch einem Augenblick vermeint man immer, Schritte vom Gang her zu hören«, dachte Bernard. Er hob den Kopf und lauschte. Alles still: Sein Vater und sein großer Bruder hatten heute länger im Justizpalast zu tun; seine Mutter machte Besuche; seine Schwester war in einem Konzert; und Caloub schließlich, sein kleiner Bruder, wurde jeden Tag nach dem Unterricht in einer Schülerpension verwahrt. Bernard Profitendieu war zu Hause geblieben, um aufs Abitur zu pauken; er hatte nur noch drei Wochen Zeit. Die Familie ließ ihm seine Ruhe; aber der Dämon nicht. Bernard erstickte fast, obwohl er die Jacke ausgezogen hatte. Von der Straße drang durch das geöffnete Fenster nichts als Hitze herein. Seine Stirn war schweißnass. Ein Tropfen rann an seiner Nase herunter und fiel auf einen Brief, den er in der Hand hielt:
»Sieht wie eine Träne aus«, dachte er. »Doch es ist allemal besser zu schwitzen, als zu weinen.«
Ja, das Datum gab den Ausschlag. Ohne Zweifel: es ging um ihn, Bernard. Ein siebzehn Jahre alter Liebesbrief; an seine Mutter gerichtet; nicht unterschrieben.
Stattdessen ein Buchstabe. »Ein V, oder vielleicht auch ein N … Darf ich meine Mutter um Auskunft ersuchen? … Nein, ich setze lieber auf ihren guten Geschmack. Dann steht es mir frei, mir vorzustellen, es sei ein Prinz gewesen. Was hätte ich davon zu erfahren, dass ich der Sohn eines Proleten bin! Nicht zu wissen, wer der Vater ist, erlöst von der Angst, dem Vater zu gleichen. Nachforschungen verpflichten nur. Behalten wir das Befreiende im Auge. Lassen wir den Rest auf sich beruhen. Für heute habe ich jedenfalls genug.«
Bernard faltete den Brief zusammen. Er hatte das gleiche Format wie die anderen zwölf. Der Stoß wurde von einem rosa Seidenband zusammengehalten, das Bernard nicht hatte aufknoten müssen; er schob es an den alten Platz zurück, und die Briefe waren wie vorher gebündelt. Dann verstaute er das Bündel wieder in dem Kästchen und dieses wieder in der Schublade des Konsoltisches. Die Schublade war verschlossen geblieben; er hatte ihr Geheimnis von oben her gelüftet. Bernard befestigte die losen Brettchen der Holzabdeckung, über die eine schwere Onyxplatte gelegt werden musste. Er ließ sie langsam, vorsichtig herunter, stellte die zwei Kristallleuchter wieder darauf und daneben die sperrige Pendeluhr, die er repariert hatte, um sich ein wenig zu zerstreuen.
Die Pendüle schlug viermal. Jetzt ging sie richtig.
»Der Herr Untersuchungsrichter und sein Sohn, der Herr Anwalt, werden nicht vor sechs Uhr zurück sein. Ich habe noch Zeit. Der Herr Untersuchungsrichter soll bei seiner Rückkehr einen schönen Brief auf seinem Schreibtisch vorfinden, mit dem ich mich empfehle. Doch bevor ich ihn schreibe, brauche ich unbedingt frische Luft – und will mit meinem lieben Olivier sprechen, um mich einer vorläufigen Bleibe zu versichern. Olivier, mein Freund, es ist so weit, dass ich deine Zuneigung auf die Probe stellen muss und du mir beweisen musst, was du wert bist. Unsere Freundschaft war bisher so schön, weil wir uns nie ihrer bedient haben … Ach was! Es kann doch nicht schlimm sein, um einen unterhaltsamen Gefallen zu bitten. Unangenehm ist nur, dass ich mit Olivier nicht allein sein werde. Egal! Es wird mir schon möglich sein, ihn beiseitezunehmen. Ich will ihn durch meine Ruhe beeindrucken. Außergewöhnliche Situationen sind ganz nach meiner Natur.«
Die Rue de T., in der Bernard Profitendieu bisher wohnte, liegt ganz in der Nähe des Jardin du Luxembourg. Dort, in der Allee oberhalb des Medici-Brunnens, trafen sich einige seiner Bekannten regelmäßig jeden Mittwoch zwischen vier und sechs. Man unterhielt sich über Kunst, Philosophie, Sport, Politik und Literatur. Bernard war bis dorthin sehr schnell gelaufen; doch als er vom Parktor aus Olivier Molinier erkannte, verlangsamte er seine Schritte.
Es hatten sich diesmal, wohl wegen des schönen Wetters, ungewöhnlich viele Leute eingefunden. Einige neue Gesichter, die Bernard nicht kannte, waren dazugekommen. Und all diese jungen Leute verfielen, sobald sie in Gesellschaft waren, in eine Rolle, verloren ihre Natürlichkeit.
Olivier errötete, als er Bernard näher kommen sah, und ließ, um ihm auszuweichen, die junge Dame, mit der er sich gerade unterhalten hatte, ziemlich unvermittelt stehen. Bernard war sein engster Freund; gerade deswegen achtete Olivier darauf, dass es nicht so aussähe, als käme er nur seinetwegen her; ja, manchmal tat er so, als bemerke er ihn nicht.
Bernard musste auf dem Weg zu ihm an mehreren Gruppen vorbei und hielt sich, da auch er verbergen wollte, dass er wegen Olivier gekommen war, länger bei ihnen auf, als ihm lieb war.
Vier seiner Freunde umringten einen kleinen Herrn mit Bart und Kneifer, der deutlich älter war als sie und ein Buch in der Hand hielt. Das war Dhurmer.
»Es ist einfach nichts zu wollen«, sagte er, sich besonders an einen aus der Runde wendend (aber sichtlich glücklich, dass alle zuhörten), »ich habe mich bis Seite dreißig durchgekämpft, ohne auch nur eine einzige Farbe zu finden, ein einziges malerisches Wort. Er spricht von einer Frau – und ich weiß nicht einmal, ob ihr Kleid rot oder blau ist! Da kann ich nur sagen, wo keine Farben sind, sehe ich auch nichts.« – Und er beharrte, desto mehr übertreibend, je weniger er sich ernst genommen fühlte: »Absolut gar nichts.«
Bernard hörte dem Schwätzer nicht länger zu; er hielt es für ungeschickt, allzu schnell weiterzugehen, verfolgte aber bereits den Wortwechsel einer anderen Gruppe in seinem Rücken, zu der Olivier sich gesellt hatte, als er die junge Dame stehenließ; hier las einer, auf einer Bank sitzend, die Action Française.
Wie ernst Olivier Molinier neben den anderen wirkt! Dabei ist er einer der Jüngsten. Der Ausdruck seines beinahe noch kindlichen Gesichts und sein Blick verraten, wie reif er schon ist. Er ist empfindsam, errötet leicht. So liebenswürdig er auch gegen alle ist, irgendeine innere Zurückhaltung, eine Scheu sorgt zwischen ihm und seinen Kameraden für Distanz. Er leidet darunter. Wäre nicht Bernard, würde er noch mehr darunter leiden.
Genau wie dieser hatte Molinier sich kurz zu jeder Gruppe gesellt; aus Höflichkeit, denn nichts von dem, was gesprochen wird, interessiert ihn.
Er beugte sich über die Schulter des Zeitungslesers: »So was solltest du nicht lesen; es steigt dir bloß zu Kopf.«
Der andere entgegnete scharf: »Und du fällst gleich in Ohnmacht, wenn man nur Maurras erwähnt.«
Dann fragte ein dritter spöttisch: »Findest du Maurras’ Artikel so umwerfend?«
Der erste antwortete: »Sie sind schwer verdaulich; aber recht hat er, finde ich.«
Ein vierter, dessen Stimme Bernard nicht erkannte, sagte: »Du glaubst immer, alles, was nicht unverdaulich ist, kann nichts Gescheites sein.«
Der erste gab zurück: »Wenn du glaubst, du brauchst nur blöd daherzureden, um lustig zu sein!«
»Komm«, sagte Bernard leise, fasste Olivier schnell am Arm und zog ihn ein paar Schritte mit sich fort. »Antworte schnell; ich bin in Eile. Du hast mir doch gesagt, dass du nicht auf der gleichen Etage schläfst wie deine Eltern?«
»Ich habe dir ja meine Zimmertür gezeigt; sie geht direkt auf das Treppenhaus, auf halber Treppe, bevor man zu unserer Wohnung kommt.«
»Du hast gesagt, dein Bruder schläft auch dort?«
»Georges, ja.«
»Seid ihr zwei allein?«
»Ja.«
»Kann der Kleine den Mund halten?«
»Wenn es sein muss. Warum?«
»Hör zu. Ich will von zu Hause weg; oder besser gesagt, ich werde heute Abend gehen. Ich weiß noch nicht, wo ich bleiben werde. Könntest du mich für eine Nacht bei dir aufnehmen?«
Olivier wurde sehr blass. Er war so bewegt, dass er Bernard nicht ansehen konnte.
»Ja«, sagte er. »Aber komm nicht vor elf Uhr. Mama wünscht uns jeden Abend gute Nacht und schließt die Tür ab.«
»Aber dann …«
Olivier lächelte: »Ich habe einen zweiten Schlüssel. Klopf leise, um Georges nicht zu wecken, falls er schläft.«
»Wird mich der Concierge vorbeilassen?«
»Ich werde ihm Bescheid geben. Oh, ich verstehe mich gut mit ihm. Er hat mir auch den zweiten Schlüssel gegeben. Bis später.«
Sie trennten sich, ohne einander die Hand zu geben. Während Bernard nach Hause lief, in Gedanken schon bei dem Brief, den der Richter beim Heimkommen vorfinden sollte, ging Olivier, damit es nicht so aussähe, als sondere er sich nur mit Bernard von den anderen ab, auf Lucien Bercail zu, den man immer etwas links liegenließ. Olivier könnte ihn liebgewinnen, hätte er sich nicht für Bernard entschieden. So kühn Bernard ist, so ängstlich ist Lucien. Man sieht ihm an, wie zart er ist und ganz in seine Empfindungen und Gedanken versponnen. Er wagt niemanden anzusprechen, gerät jedoch ganz außer sich vor Freude, wenn Olivier das Wort an ihn richtet. Dass Lucien Gedichte macht, vermutet jeder; Olivier ist aber, glaube ich, der Einzige, dem Lucien seine Pläne offenbart. »Was ich gern möchte«, sagte Lucien, als die beiden sich dem Ende der Terrasse näherten, »ist, eine Geschichte erzählen, in der es nicht um einen Helden geht, sondern um einen Ort – nimm zum Beispiel eine Parkallee wie diese hier –, ich möchte erzählen, was hier vom Morgen bis zum Abend geschieht. Zuerst kämen die Kindermädchen, mit wehenden Bändern die Ammen … Halt, nein … erst ganz graue, alters- und geschlechtslose Gestalten, die die Wege fegen, den Rasen sprengen, die welken Blumen auswechseln, kurz, Szenerie und Dekoration, verstehst du, bevor die Tore geöffnet werden. Dann also der Einzug der Ammen. Die Kleinen backen Sandkuchen, zanken sich; die Kindermädchen verteilen Ohrfeigen. Die unteren Jahrgänge kommen aus der Schule – danach die Arbeiterinnen. Arme Leute setzen sich auf eine Bank und essen etwas. Später junge Leute, die sich treffen; andere, die einander meiden; wieder andere, die allein sein wollen, Träumer. Dann die Menge, nach Ladenschluss, wenn Musik gespielt wird. Junge Leute wie wir. Und abends Verliebte, die sich umschlungen halten; andere, die unter Tränen voneinander scheiden. Schließlich dann, in der Dämmerung, ein altes Paar … Da, plötzlich, ein Trommelwirbel: Der Garten wird geschlossen. Alle treten ab. Das Stück ist aus. Verstehst du, ich würde das Ende allen Lebens vor Augen führen, den Tod … aber natürlich ohne dass der Tod je erwähnt würde.«
»Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen«, sagte Olivier, der an Bernard dachte und gar nicht zugehört hatte.
»Und das ist noch nicht alles; das ist noch nicht alles!«, fuhr Lucien enthusiastisch fort. »In einer Art Epilog möchte ich die gleiche Allee bei Nacht zeigen, menschenleer, verlassen und viel schöner als bei Tag. Tiefe Stille steigert jeden Laut der Natur: das Plätschern des Brunnens, das Rascheln des Windes in den Bäumen, den Gesang der Nachtigall. Ursprünglich hatte ich gedacht, dass sich Schatten in der Dunkelheit bewegen sollten, vielleicht Statuen … aber ich glaube, das wäre weniger gelungen, was meinst du?«
»Nein, keine Statuen, keine Statuen«, protestierte Olivier zerstreut; doch als er Luciens traurigen Blick bemerkte, rief er begeistert aus: »Du, wenn dir das gelingt – das wird großartig!«
II
In Poussins Briefen findet sich nirgends eine Spur davon, dass er sich seinen Eltern gegenüber verpflichtet gefühlt hätte. Mit keinem Wort bedauerte er je, sie verlassen zu haben. Nach Rom verpflanzt, verlor er jede Lust zur Rückkehr, ja, man könnte sagen, jede Erinnerung.
Paul DESJARDINS(Poussin)
Monsieur Profitendieu hatte es eilig, nach Hause zu kommen, und fand, dass sein Kollege Molinier, der ihn auf dem Boulevard Saint-Germain begleitete, doch recht langsam ging. Albéric Profitendieu hatte im Gericht einen besonders arbeitsreichen Tag gehabt; beunruhigt spürte er auf der rechten Seite ein leises Druckgefühl; Anstrengungen schlugen sich bei ihm auf die Leber, die etwas empfindlich war. Zu Hause wollte er ein Bad nehmen; durch nichts erholte er sich besser von den Mühen des Tages als durch ein warmes Bad – weshalb er seit dem Mittagessen nichts mehr zu sich genommen hatte, da er es für unvernünftig hielt, mit vollem Magen in die Wanne zu steigen, selbst bei lauwarmem Wasser. Vielleicht war das im Grunde genommen nur ein Vorurteil; doch Vorurteile sind die Grundpfeiler der Zivilisation.
Bemüht, mit Profitendieu Schritt zu halten, ging Oscar Molinier, so schnell er konnte, doch waren seine Beine viel kürzer und weniger kräftig; auch ließ ihn das kleine Fettpolster an seinem Herz leicht außer Atem geraten. Der hochgewachsene, rüstige Profitendieu, gut zu Fuß für seine fünfundfünfzig Jahre, wäre ihn gerne losgewesen; doch er wusste, was sich gehört; sein Kollege war älter als er und hatte eine höhere Stellung inne: Er war ihm Respekt schuldig. Hinzu kam, dass Profitendieu um Nachsicht für sein Vermögen werben musste, das seit dem Tod seiner Schwiegereltern beträchtlich war, hatte doch Monsieur Molinier bloß sein Gehalt als Präsident der Kammer, eine lächerliche und völlig unangemessene Entlohnung für das hohe Amt, das er zum Ausgleich für seine Mittelmäßigkeit mit desto größerer Würde bekleidete. Profitendieu zügelte seine Ungeduld; er wandte sich nach Molinier um und sah, dass dieser sich den Schweiß abwischte; was Molinier gerade äußerte, interessierte ihn auch sehr; allerdings sah er alles unter einem anderen Blickwinkel, wodurch sich das Gespräch belebte. »Lassen Sie das Haus überwachen«, hatte Molinier gesagt. »Nehmen Sie zu Protokoll, was der Concierge und das angebliche Dienstmädchen aussagen, das ist alles sehr gut. Aber seien Sie vorsichtig; wenn Sie die Untersuchung auch nur etwas zu weit vorantreiben, wird Ihnen die Angelegenheit entgleiten … Ich fürchte, dies könnte unabsehbare Folgen nach sich ziehen.«
»Derlei Bedenken haben nichts mit Recht und Gesetz zu tun.«
»Aber, aber, lieber Freund; wir wissen beide nur zu gut, wie die Rechtsprechung sein sollte und wie sie ist. Wir tun selbstverständlich unser Bestes; doch was wir auch unternehmen, wir können unser hohes Ziel nur annähernd erreichen. Die Sache, die Sie gerade beschäftigt, ist besonders heikel: Von den fünfzehn Beschuldigten, denen auf ein Wort von Ihnen schon morgen eine Anklage ins Haus steht, sind neun minderjährige Kinder. Und einige unter ihnen stammen, wie Sie wissen, aus sehr angesehenen Familien. In ihrem Fall halte ich jedweden Haftbefehl für äußerst ungeschickt. Die Parteiblätter würden sich der Sache bemächtigen, und damit sind allen Formen von Erpressung und Verleumdung doch Tür und Tor geöffnet. Sie können sich noch so sehr bemühen: Bei aller Vorsicht wäre nicht zu verhindern, dass Namen fielen … Mir steht es nicht an, Ihnen Ratschläge zu erteilen, und Sie wissen, wie viel lieber ich mir raten ließe von Ihnen, dessen Weitblick, Klarsicht und Geradheit ich stets zu schätzen wusste … Doch an Ihrer Stelle würde ich folgendermaßen vorgehen: Ich würde versuchen, diesem skandalösen Treiben ein Ende zu setzen, indem ich die vier oder fünf Anstifter dingfest machte … Ja, ich weiß, dass sie schwer zu fassen sind; aber, zum Teufel, das ist unser Beruf! Ich würde die Wohnung, den Schauplatz dieser Orgien, schließen lassen und es so einzurichten wissen, dass die Eltern dieser Früchtchen gewarnt wären, ein leiser, diskreter Wink, einfach um Rückfälle zu vermeiden. Ach ja, die Frauen, die können Sie einsperren lassen; da bin ich ganz dafür; wir scheinen es hier mit ein paar abgrundtief verdorbenen Frauenzimmern zu tun zu haben, von denen die Gesellschaft gesäubert werden muss. Aber noch einmal, schonen Sie die Kinder; erteilen Sie ihnen eine tüchtige Verwarnung, legen Sie dann alles unter der Rubrik ›Schuldunfähigkeit‹ zu den Akten, und lassen Sie die Kleinen in heilsamem Zweifel darüber, ob sie mit dem Schrecken davonkommen werden. Bedenken Sie, drei von ihnen sind noch unter vierzehn und werden von ihren Eltern zweifellos für reine und unschuldige Engel gehalten. Aber im Vertrauen, mein lieber Freund, einmal ehrlich, wer von uns hätte in diesem Alter schon an Frauen gedacht?«
Er war stehengeblieben, außer Atem, weniger vom schnellen Gehen als vom vielen Sprechen, und zwang Profitendieu, den er am Ärmel hielt, ebenfalls stehenzubleiben.
»Oder wenn wir daran dachten«, begann er wieder, »dann auf eine ideale, mystische, ja religiöse Weise, wenn ich so sagen darf. Die Kinder von heute, sehen Sie, diese Kinder haben keine Ideale mehr … Übrigens, wie geht es denn Ihren eigenen? An Ihre denke ich dabei natürlich nicht. Ich weiß, dass unter Ihrer Aufsicht und dank der Erziehung, die Sie ihnen angedeihen ließen, derartige Verirrungen nicht zu befürchten sind.«
In der Tat hatte Profitendieu bisher mit seinen Söhnen nur zufrieden sein können; doch er machte sich keine Illusionen: Die beste Erziehung der Welt vermag nichts gegen niedere Instinkte; Gott sei Dank hatten seine Kinder keine Veranlagung zum Schlechten, ebenso wenig wie offenbar die Kinder von Molinier; so würden sie von selber schlechten Umgang und schlechte Lektüre meiden. Was hatte es auch für einen Sinn zu verbieten, was man nicht verhindern kann? Untersagt man einem Kind, gewisse Bücher zu lesen, liest es sie heimlich. Er wusste ein besseres System: Schlechte Bücher verbot er nicht; er sah zu, dass seine Kinder gar keine Lust hatten, sie zu lesen. Was jene Angelegenheit betraf, so wollte er darüber nachdenken und versprach jedenfalls, nichts zu unternehmen, ohne Molinier zu verständigen. Man würde einstweilen die unauffällige Überwachung aufrechterhalten; da der Missstand nun bereits seit drei Monaten herrschte, konnte man ihn auch noch einige Tage oder Wochen dulden. Zudem würden die Ferien die Missetäter in alle Winde zerstreuen. »Also, auf Wiedersehen.«
Profitendieu konnte endlich schneller gehen.
Kaum zu Hause, lief er in sein Badezimmer und ließ sich eine Wanne einlaufen. Antoine hatte der Rückkehr seines Herrn voller Ungeduld geharrt und richtete es so ein, dass sich ihre Wege im Gang kreuzten.
Der treue Diener war seit fünfzehn Jahren im Haus; er hatte die Kinder heranwachsen sehen. Er hatte in vieles Einblick bekommen, hatte anderes geahnt, gab sich jedoch den Anschein, als bemerke er nichts von dem, was man vor ihm geheim zu halten suchte. Bernard hing an Antoine. Er hatte nicht aufbrechen wollen, ohne ihm adieu zu sagen. Vielleicht setzte er auch nur vor lauter Ärger über seine Familie einen einfachen Dienstboten von seinem Aufbruch in Kenntnis, während keiner der Angehörigen davon wusste; doch muss man zu Bernards Entschuldigung sagen, dass ja keiner der Seinen zu Hause war. Außerdem hätte Bernard sich hier nicht verabschieden können, ohne dass man versucht hätte, ihn zurückzuhalten. Er wollte sich nicht zu Erklärungen genötigt sehen. Zu Antoine konnte er einfach sagen: »Ich gehe.« Doch dazu reichte er ihm so feierlich die Hand, dass der alte Diener stutzte.
»Ist Monsieur Bernard nicht zum Abendessen zurück?«
»Auch nicht zum Schlafen, Antoine.« Und als der andere unschlüssig schien, nicht recht wusste, wie das zu verstehen war, zu fragen aber zögerte, wiederholte Bernard mit größerem Nachdruck: »Ich gehe«, und fügte noch hinzu, »ich habe einen Brief hinterlassen auf dem Schreibtisch von …« Er konnte sich nicht entschließen, »von Papa« zu sagen, und verbesserte sich: »… auf dem Tisch im Büro. Adieu.«
Und indem er Antoines Hand ergriff, war es ihm, als nehme er Abschied von seiner Vergangenheit; er stieß ein zweites »Adieu« hervor und ging dann schnell, da er ein Schluchzen nicht unterdrücken konnte, aus dem Haus.
Antoine fragte sich, ob er es verantworten könne, ihn einfach ziehen zu lassen – doch wie hätte er ihn zurückhalten sollen?
Dass Bernards plötzlicher Weggang der ganzen Familie als eine Ungeheuerlichkeit erscheinen musste, spürte Antoine nur zu deutlich, doch die Rolle des perfekten Dieners schrieb ihm vor, seine Verwunderung nicht zu zeigen. Er hatte nicht zu wissen, was Monsieur Profitendieu nicht wusste. Natürlich hätte er einfach fragen können: »Weiß Monsieur, dass Monsieur Bernard fortgegangen ist?«, doch damit verschenkte er seinen Trumpf, und dazu war er ihm zu schade. Nein, wenn er seinen Herrn mit Ungeduld erwartete, so weil er sich folgenden Satz zurechtgelegt hatte, den er wie eine ganz gewöhnliche Bestellung Bernards in einem unbeteiligten und ehrerbietigen Ton fallenlassen wollte: »Bevor er ging, hat Monsieur Bernard einen Brief für Monsieur im Büro hinterlassen.« Ein so unscheinbarer Satz, dass er womöglich gar keine Beachtung fände; vergebens hatte er nach etwas Gewichtigerem gesucht, das gleichzeitig natürlich klänge. Doch da Bernard zu den Essenszeiten niemals abwesend war, konnte Monsieur Profitendieu, den Antoine aus den Augenwinkeln beobachtete, ein Auffahren nicht unterdrücken: »Wie? Bevor er …«
Er fasste sich sofort wieder; er durfte sich seine Verwunderung vor einem Untergebenen nicht anmerken lassen; sein Standesbewusstsein verließ ihn nicht. Er fügte in einem sehr ruhigen, gebieterischen Ton hinzu: »In Ordnung.«
Und bereits auf dem Weg ins Arbeitszimmer: »Wo, sagst du, ist dieser Brief?«
»Auf dem Schreibtisch von Monsieur.«
Schon von der Tür aus sah er tatsächlich einen Umschlag, der deutlich sichtbar an dem Platz lag, wo sein Arbeitssessel stand. Antoine aber ließ seine Beute nicht so schnell fahren: Monsieur Profitendieu hatte noch keine zwei Zeilen gelesen, da klopfte es an die Tür: »Ich vergaß, Monsieur zu sagen, dass zwei Herren im kleinen Salon auf ihn warten.«
»Was für Herren?«
»Das weiß ich nicht.«
»Gehören sie zusammen?«
»Es hat nicht den Anschein.«
»Was wollen sie von mir?«
»Das weiß ich nicht. Sie möchten Monsieur sprechen.«
Profitendieu merkte, dass ihm die Geduld ausging: »Ich habe schon mehrmals gesagt, dass ich zu Hause nicht gestört werden will – vor allem um diese Zeit; ich bin tagsüber im Gericht zu erreichen und habe meine Sprechzeiten … Warum hast du sie hereingelassen?«
»Sie sagten alle beide, sie hätten Monsieur etwas Dringendes mitzuteilen.«
»Sind sie schon lange da?«
»Seit beinahe einer Stunde.«
Profitendieu ging einige Schritte im Zimmer auf und ab und fuhr sich mit einer Hand über die Stirn; in der anderen hielt er Bernards Brief. Antoine blieb in der Tür stehen, würdevoll, ungerührt. Zu seiner Freude verlor der Richter nun endlich die Beherrschung, und er hörte ihn zum ersten Mal in seinem Leben mit dem Fuß aufstampfend schimpfen: »Man soll mich in Ruhe lassen! Ich will meine Ruhe!! Sag ihnen, dass ich beschäftigt bin. Sie sollen ein andermal wiederkommen.«
Kaum war Antoine zum Zimmer hinaus, lief Profitendieu zur Tür: »Antoine! Antoine! … Und geh das Wasser abstellen.«
An ein Bad war nicht zu denken! Er trat ans Fenster und las:
»Monsieur,
wie ich einer zufälligen Entdeckung entnehme, die ich heute Nachmittag machte, kann ich Sie nicht länger als meinen Vater betrachten, und dies ist mir eine ungeheure Erleichterung. Da ich so wenig Zuneigung zu Ihnen empfand, hielt ich mich lange für einen aus der Art geschlagenen Sohn; nun weiß ich, dass ich Ihr Sohn gar nicht bin, und das ziehe ich vor. Vielleicht meinen Sie, ich sei Ihnen Dank schuldig, weil Sie mich wie ein eigenes Kind behandelt haben; doch erstens habe ich bei Ihrer Zuwendung immer einen Unterschied zwischen mir und den anderen gespürt, und zweitens kenne ich Sie gut genug, um zu wissen, dass ich alles nur der Angst vor dem Skandal verdanke – Sie wollten kaschieren, was Ihnen keine besondere Ehre machte. Anders zu handeln wäre schließlich gegen Ihre Natur. Ich gehe lieber, ohne meiner Mutter adieu zu sagen, weil mich Rührung überkommen könnte, wenn ich für immer von ihr Abschied nähme – auch könnte ihr die Situation peinlich sein, was ich nicht möchte. Ihre mütterlichen Gefühle für mich dürften nicht sehr innig sein; da ich die meiste Zeit in der Pension zubrachte, hatte sie kaum Gelegenheit, mich kennenzulernen, und da mein Anblick sie stets an etwas erinnerte, das sie am liebsten aus ihrem Leben gestrichen hätte, wird sie mich, wie ich denke, gern und erleichtert ziehen sehen. Sagen Sie ihr, wenn Sie den Mut aufbringen, dass ich ihr nicht übelnehme, mich zum Bastard gemacht zu haben; im Gegenteil, es ist mir lieber, als denken zu müssen, dass ich Sie zum Vater habe. (Entschuldigen Sie diese Redeweise, ich will Sie nicht beleidigen; doch was ich sage, wird Ihnen erlauben, mich zu verachten, und das wird Ihnen eine Erleichterung sein.)
Wenn Sie möchten, dass ich Schweigen bewahre über die geheimen Gründe, die mich dazu brachten, Ihr Haus zu verlassen, so machen Sie bitte keinerlei Anstalten, mich zurückzuholen. Mein einmal gefasster Entschluss, Sie zu verlassen, ist unwiderruflich. Ich weiß nicht, wie viel Sie mein Unterhalt bis zum heutigen Tag wohl gekostet hat; ich konnte Ihnen zur Last fallen, solange ich von nichts wusste, doch es versteht sich von selbst, dass ich von nun an nichts mehr annehmen will. Die Vorstellung, Ihnen irgendetwas schuldig zu sein, ist mir unerträglich, und ich glaube, käme ich noch einmal in die Lage, ich würde lieber Hungers sterben, als an Ihren Tisch zurückzukehren. Zum Glück war meine Mutter, wie sie, glaube ich, einmal sagte, bei der Heirat der vermögendere Teil. Ich kann mir also vorstellen, nur von ihrem Vermögen gelebt zu haben. Ich danke ihr, halte damit alles für beglichen und bitte darum, mich zu vergessen. Sie werden sich schon etwas einfallen lassen, um denen, die sich wundern könnten, mein Verschwinden zu erklären. Ich erlaube Ihnen, mich zu belasten (wenn ich auch weiß, dass Sie nicht auf meine Erlaubnis warten).
Ich zeichne mit Ihrem lächerlichen Namen, den ich Ihnen am liebsten zurückgeben würde und dem ich keine Ehre machen möchte.
BERNARDPROFITENDIEU.
P.S.: Alle meine Sachen lasse ich bei Ihnen. Caloub hat, wie ich für Sie hoffe, einen legitimeren Anspruch darauf.«
Monsieur Profitendieu wankte zu einem Sessel. Er hätte nachdenken wollen, doch er konnte keinen klaren Gedanken fassen. Überdies spürte er an seiner rechten Seite ein leichtes Stechen, da, unterhalb der Rippen; es war kein Zweifel möglich: die Leberkrise. War wenigstens Vichy im Haus? Wenn seine Frau doch nur zurück wäre! Wie sollte er ihr Bernards Flucht beibringen? Sollte er ihr den Brief zeigen? Dieser Brief ist ungerecht, entsetzlich ungerecht. Er sollte sich vor allem darüber empören. Er sollte entrüstet und nicht traurig sein. Er japst nach Luft, und bei jedem Ausatmen stößt er ein »Oh, mein Gott!«, aus, schnell und leise wie ein Seufzen. Der Schmerz an der Seite paart sich mit seiner Traurigkeit, lokalisiert und beweist sie. Er hat gewissermaßen Leberkummer. Er lässt sich in den Sessel fallen und liest Bernards Brief noch einmal durch. Traurig lässt er die Schultern hängen. Sicherlich ist dieser Brief grausam für ihn; doch welche Kraft, wie viel Trotz und Stolz aus ihm spricht! Niemals wäre er selbst oder eines der übrigen Kinder, ein wirkliches Kind von ihm, in der Lage, so etwas zu schreiben; dessen ist er sicher, denn an seinem Nachwuchs findet sich nichts, das er nicht zur Genüge von sich selbst her kennt. Zwar glaubte er immer, das Neue, Eigenwillige und Ungezügelte an Bernard missbilligen zu müssen; doch was er sich auch einreden mochte, er spürt, dass er ihn gerade hierfür so liebte, wie er keines der anderen je geliebt hat.
Im Zimmer nebenan hatte sich Cécile, vom Konzert zurückgekehrt, ans Klavier gesetzt und spielte hartnäckig immer die gleiche Phrase einer Barkarole. Schließlich ertrug es Albéric Profitendieu nicht mehr. Er öffnete die Tür zum Salon einen Spaltbreit und sagte mit klagender Stimme, beinahe flehentlich, denn die Leberkolik begann ihm heftig zuzusetzen (und zudem war er seiner Tochter gegenüber schon immer etwas schüchtern): »Meine kleine Cécile, würdest du nachsehen gehen, ob Vichy im Haus ist; und wenn keines mehr vorrätig ist, welches besorgen lassen. Und wenn du so lieb wärest, jetzt nicht Klavier zu spielen.«
»Was ist denn mit dir?«
»Nichts, nichts. Ich muss nur über etwas nachdenken vor dem Abendessen, und dabei stört mich deine Musik.« Aus Liebenswürdigkeit, denn sein Leiden stimmt ihn sanft, fügt er hinzu: »Es ist hübsch, was du da spielst. Was war es denn?«
Doch er zieht sich zurück, ohne die Antwort abzuwarten. Seine Tochter, die weiß, dass er nichts von Musik versteht und Viens Poupoule mit dem Marsch aus dem Tannhäuser verwechselt (zumindest sagt sie das), hat ohnedies nicht die Absicht, ihm zu antworten. Abermals öffnet sich die Tür: »Ist deine Mutter nicht heimgekommen?«
»Nein, noch nicht.«
Es ist absurd. Vor dem Abendessen würde er nicht mehr mit ihr sprechen können. Was sollte er nur erfinden, um Bernards Abwesenheit vorläufig zu erklären? Er durfte schließlich nicht die Wahrheit sagen, seinen Kindern das Geheimnis jener flüchtigen Verirrung ihrer Mutter preisgeben. Ach, all das war doch vergeben und vergessen, behoben gewesen. Die Geburt des letzten Sohnes hatte ihre Versöhnung besiegelt. Und plötzlich taucht dieser böse Spuk wieder aus der Vergangenheit auf, speien die Fluten diesen Kadaver aus …
Also, was ist denn das nun wieder? Die Tür seines Büros hat sich leise geöffnet; schnell lässt er den Brief in seine innere Rocktasche gleiten; sachte hebt sich die Portiere. Es ist Caloub.
»Papa, sag … Was könnte dieser lateinische Satz bedeuten? Ich verstehe ihn einfach nicht …«
»Ich habe dir doch gesagt, dass du nicht hereinkommen sollst, ohne anzuklopfen. Und außerdem will ich nicht, dass du mich alle Augenblicke störst. Es wird dir zur Gewohnheit, dir von anderen helfen zu lassen und mit den anderen zu rechnen, statt dich selbst anzustrengen. Gestern war es eine Geometrieaufgabe, heute ist es ein … von wem ist er denn, dein lateinischer Satz?«
Caloub hält ihm sein Heft hin: »Das hat er uns nicht gesagt; aber, sieh selbst: Du, du wirst ihn wiedererkennen. Wir haben es diktiert bekommen, aber vielleicht habe ich schlecht mitgeschrieben. Wenn ich wenigstens wüsste, ob es so richtig ist …«
Monsieur Profitendieu nimmt das Heft, doch er hat zu große Schmerzen. Er schiebt das Kind sanft beiseite: »Später. Es ist Zeit zum Abendessen. Ist Charles heimgekommen?«
»Er ist noch einmal ins Büro hinuntergegangen.« (Der Anwalt empfängt seine Klienten im Erdgeschoss.)
»Lauf schnell und sage ihm, er möchte zu mir kommen.«
Es klingelt! Madame Profitendieu ist endlich zurück; sie entschuldigt sich für ihre Verspätung; sie hatte viele Besuche zu erledigen. Es betrübt sie, dass ihr Mann Schmerzen hat. Was kann man für ihn tun? Er sieht wirklich angegriffen aus. – Er könne nichts essen. Man solle sich ohne ihn zu Tisch setzen. Doch nach dem Abendbrot möchte sie zu ihm kommen mit den Kindern. – Bernard? – »Ach, stimmt ja; sein Freund … du weißt schon, der, bei dem er in Mathematik Stunden nahm, hat ihn zum Abendessen eingeladen.«
Profitendieu fühlte sich besser. Er hatte erst befürchtet, vor Schmerzen nicht sprechen zu können. Doch er musste für Bernards Verschwinden eine Erklärung geben. Er wusste jetzt, was es zu sagen galt, so unangenehm es sein mochte. Er fühlte sich stark und entschlossen. Seine einzige Befürchtung war, seine Frau könnte in Tränen ausbrechen, einen Schrei ausstoßen; ohnmächtig werden …
Eine Stunde später kommt sie mit den drei Kindern herein; tritt näher. Er fordert sie auf, an seiner Seite Platz zu nehmen. »Versuche, dich zu beherrschen«, sagt er leise, doch in gebieterischem Ton zu ihr, »und sag kein Wort, hörst du. Wir beide werden uns nachher unterhalten.«
Und während er spricht, hält er ihre Hand zwischen den seinen. »Nun, Kinder, setzt euch. Es ist mir unangenehm, wenn ihr so vor mir steht wie bei einer Prüfung. Ich muss euch etwas sehr Trauriges mitteilen. Bernard hat uns verlassen, und wir werden ihn nicht mehr wiedersehen … in nächster Zeit. Ich muss euch heute etwas eröffnen, worüber ich anfänglich geschwiegen hatte, damit ihr Bernard liebtet wie einen Bruder; denn eure Mutter und ich liebten ihn wie ein eigenes Kind. Er war nicht unser Kind … und ein Onkel von ihm, ein Bruder seiner wahren Mutter, die ihn uns am Sterbebett anvertraute … hat ihn heute Abend wieder zu sich genommen.«
Ein drückendes Schweigen folgt seinen Worten, man hört nur Caloub schniefen. Alle warten, in der Annahme, er werde noch mehr sagen, doch er entlässt sie mit einer Handbewegung: »Geht nun, Kinder. Ich muss etwas mit eurer Mutter besprechen.«
Als sie hinausgegangen sind, sagt Monsieur Profitendieu lange kein Wort. Jene Hand, die Madame Profitendieu ihm überlassen hat, ist wie tot. Mit der anderen hat sie ihr Taschentuch an die Augen geführt. Sie stützt sich mit dem Ellenbogen auf den großen Tisch und wendet sich ab, um zu weinen. Unter Schluchzern, die sie schütteln, hört Profitendieu sie sagen: »Oh! Wie grausam Sie sind … Oh! Sie haben ihn fortgejagt …«
Er war entschlossen gewesen, ihr Bernards Brief nicht zu zeigen; doch angesichts dieser so ungerechten Beschuldigung reicht er ihn ihr: »Da; lies.«
»Ich kann nicht.«
»Du musst das lesen.«
Er hat seine Schmerzen vergessen. Er folgt ihrem Blick, Zeile für Zeile, bis zum Schluss. Vorhin bei seiner Rede hatte er kaum die Tränen zurückhalten können; jetzt fällt alle Erregung von ihm ab; er beobachtet seine Frau. Was denkt sie? Mit derselben klagenden Stimme, unter denselben Schluchzern sagt sie noch: »Oh! Warum hast du mit ihm gesprochen … Du hättest es ihm nicht sagen dürfen.«
»Aber du siehst ja, dass ich ihm nichts gesagt habe … Sieh dir doch seinen Brief an.«
»Ich habe ihn schon gelesen … Aber wie hat er es dann entdeckt? Wer hat es ihm gesagt …?«
Was! Das beschäftigt sie! Das ist ihr ganzer Kummer! Er dachte, jenes Leid mit ihr gemeinsam zu tragen. Doch leider hat er das unbestimmte Gefühl, dass ihre Gedanken verschiedene Wege gehen. Während sie klagt, während sie beschuldigt und fordert, versucht er, ihren widerstrebenden Sinn auf fromme Gedanken zu lenken: »Es ist die Sühne«, sagt er.
Er hat sich erhoben, aus dem unbewussten Bedürfnis zu dominieren; jetzt steht er in voller Größe vor ihr, die Schmerzen sind vergessen; ernst, zärtlich und gebieterisch legt er die Hand auf Marguerites Schulter. Er weiß wohl, dass sie das, worin er bis heute nur eine kleine Verirrung hatte sehen wollen, stets nur sehr unvollständig bereut hat; er möchte ihr sagen, dass diese Trauer, diese Prüfung ihrem Seelenheil dienen werden, doch er sucht vergebens nach einer Formulierung, die ihn zufriedenstellt und Gehör finden könnte. Die Schulter Marguerites versucht, dem sanften Druck seiner Hand auszuweichen. Marguerite weiß nur zu gut, dass immer irgendeine moralische Belehrung herauskommen muss, die ihr Mann bis zur Unerträglichkeit noch dem geringfügigsten Ereignis abgewinnt; alles sieht und deutet er von seiner dogmatischen Warte aus. Er beugt sich über sie. Folgendes möchte er ihr sagen: »Meine arme Freundin, du siehst: Aus Sünde erwächst nichts Gutes. Es hat nichts genützt, deinen Fehltritt geheim zu halten. Leider! Ich habe für dieses Kind getan, was ich konnte; ich habe es gehalten wie mein eigenes. Gott zeigt uns nun, dass es ein Irrtum war, sich anzumaßen …«
Doch schon nach dem ersten Satz hält er inne.
Sie scheint diese wenigen, so bedeutungsschweren Worte verstanden zu haben; sie scheinen ihr zu Herzen gegangen zu sein, denn sie, die schon zu weinen aufgehört hatte, wird heftiger noch als zuvor von einem Schluchzen geschüttelt; dann sinkt sie nach vorne, als wolle sie auf die Knie fallen vor ihm, der sich zu ihr hinabbeugt und sie hält. Was flüstert sie unter Tränen? Er bückt sich bis zu ihren Lippen hinab. »Siehst du … Siehst du …«, hört er, »Oh! Warum hast du mir vergeben …? Oh, ich hätte nicht zurückkommen sollen!«
Fast muss er erraten, was sie sagt. Sie schweigt. Mehr vermag auch sie nicht zu sagen. Wie hätte sie ihm erklären sollen, dass die Tugend, die er von ihr forderte, sie lähmte; dass sie erstickte; dass sie inzwischen weniger ihren Fehltritt bereute, als bereut zu haben. Profitendieu hatte sich wieder aufgerichtet: »Meine arme Freundin«, sagt er in würdevollem und strengem Ton, »ich fürchte, du bist heute Abend etwas eigensinnig. Es ist spät. Wir sollten besser zu Bett gehen.«
Er hilft ihr auf, geleitet sie bis zu ihrem Zimmer, drückt ihr einen Kuss auf die Stirn, kehrt dann in sein Büro zurück und lässt sich in einen Sessel fallen. Seltsam, seine Leberschmerzen sind abgeklungen; doch er fühlt sich zerschlagen. Er verbirgt sein Gesicht in den Händen, zu traurig, um zu weinen. Er hört es nicht klopfen, doch beim Knarren der sich öffnenden Tür hebt er den Kopf: Es ist sein Sohn Charles.
»Ich wollte dir gute Nacht sagen.«
Charles tritt näher. Er hat alles begriffen. Er will es seinem Vater zu erkennen geben. Er möchte sein Mitgefühl, seine Zärtlichkeit, seine Ergebenheit zum Ausdruck bringen, doch – wer hätte das von einem Anwalt gedacht – er stellt es denkbar ungeschickt an; vielleicht wird er gerade dann ungeschickt, wenn seine Gefühle aufrichtig sind. Er umarmt seinen Vater. Die ostentative Art, mit der er seinen Kopf an die Schulter seines Vaters legt, sich anlehnt und dort verharrt, überzeugt jenen davon, dass er verstanden hat. Er hat so gut verstanden, dass er nun, den Kopf ein wenig hebend, linkisch, wie alles, was er tut – denn es quält sein Herz so sehr –, die Frage stellt: »Und Caloub?«
Die Frage ist absurd, denn so wenig Bernard den anderen gleicht, so stark ist bei Caloub die Familienähnlichkeit. Profitendieu tätschelt Charles die Schulter: »Nein; nein; sei beruhigt. Nur Bernard.«
Daraufhin Charles, dozierend: »Gott verjagt den Eindringling, um …«
Doch Profitendieu fällt ihm ins Wort; was muss er so mit sich reden lassen?
»Schweig.«
Vater und Sohn haben sich nichts mehr zu sagen. Verlassen wir sie. Es ist bald elf Uhr. Lassen wir Madame Profitendieu in ihrem Zimmer auf dem kleinen, unbequemen Stuhl sitzen. Sie weint nicht; ihr Kopf ist leer. Auch sie möchte am liebsten fliehen; doch sie wird es nicht tun. Nachdem sie ihrem Geliebten gefolgt war, Bernards Vater, den wir nicht zu kennen brauchen, sagte sie sich schon bald: »Du, du kannst machen, was du willst; du wirst immer nur eine biedere Frau sein.« Die Freiheit, die Illegalität, die Ungebundenheit hatten sie geängstigt; so dass sie nach zehn Tagen reuevoll zu Mann und Kind zurückkehrte. Ihre Eltern hatten ja immer zu ihr gesagt: »Du weißt nicht, was du willst.« Verlassen wir sie. Cécile schläft schon. Caloub wirft einen verzweifelten Blick auf seine Kerze; sie wird nicht reichen, um damit den Abenteuerroman fertig zu lesen, der ihn von Bernards Weggang ablenken soll. Ich wäre neugierig gewesen, was Antoine seiner Freundin, der Köchin, erzählt; aber man kann nicht überall sein. Für Bernard ist es nun Zeit, zu Olivier zu gehen. Ich weiß nicht recht, wo er zu Abend aß, noch ob er überhaupt etwas zu sich nahm. Ungehindert ist er an der Concierge-Loge vorbeigekommen; leise schleicht er die Treppe hinauf …
III
Plenty and peace breeds cowards; hardness ever
Of hardiness is mother.
SHAKESPEARE
Olivier war zu Bett gegangen, um den Kuss seiner Mutter entgegenzunehmen, die ihren beiden Jüngsten jeden Abend gute Nacht sagen kam. Er hätte sich für Bernards Besuch wieder ankleiden können, doch er zweifelte noch an dessen Kommen und wollte bei Georges keinen Verdacht erregen. Sein kleiner Bruder schlief meistens gleich ein und wachte spät auf; vielleicht würde ihm gar nichts Ungewöhnliches auffallen.
Als er an der Tür ein leises Kratzen hörte, sprang Olivier aus dem Bett, schlüpfte schnell in seine Pantoffeln und lief öffnen. Man kam ohne Licht aus, denn der Mond schien ins Zimmer. Olivier schloss Bernard in seine Arme.
»Wie ich auf dich gewartet habe! Ich konnte nicht glauben, dass du wirklich kommst. Wissen deine Eltern überhaupt, dass du heute Nacht nicht zu Hause schläfst?«
Bernard sah an ihm vorbei, ins Dunkle. Er zuckte die Achseln. »Meinst du vielleicht, ich hätte sie um Erlaubnis fragen sollen?« Der kühle und ironische Klang von Bernards Stimme verrät Olivier, dass seine Frage absurd war. Doch dass Bernard »ein für alle Mal« weggegangen ist, erfasst er noch nicht; er glaubt, Bernard werde nur diesen einen Abend auswärts schlafen, und kann sich den Grund für dieses Abenteuer nicht vorstellen. Er erkundigt sich, wann Bernard wieder nach Hause gehen will.
»Niemals!«
Olivier geht ein Licht auf. Er will sich der Lage unbedingt gewachsen zeigen und sich seine Überraschung nicht anmerken lassen; dennoch rutscht es ihm heraus: »Das ist ja sagenhaft, was du da machst.«
Die Überraschung seines Freundes bereitet Bernard Vergnügen; besonders empfänglich ist er für die Bewunderung, die in diesem Ausruf liegt; doch zuckt er nur abermals die Achseln. Olivier hat seine Hand genommen; er ist sehr ernst; angsterfüllt fragt er: »Aber … warum gehst du weg?«
»Das, mein Freund, sind Familienangelegenheiten. Darüber kann ich nicht sprechen.« Und um die Situation aufzulockern, stupst er mit der Schuhspitze den Pantoffel herunter, der an Oliviers Fuß baumelt, seit sie sich auf der Bettkante niedergelassen haben.
»Wo wirst du denn leben?«
»Ich weiß nicht.«
»Und wovon?«
»Das wird sich zeigen.«
»Hast du Geld?«
»Genug für das Frühstück.«
»Und dann?«
»Dann muss ich mir etwas suchen. Pah, ich werde schon etwas finden. Du wirst es ja sehen; ich werde dir berichten.«
Olivier bewundert seinen Freund ungeheuer. Er kennt sein entschlossenes Wesen; trotzdem zweifelt er noch: Wird Bernard nicht, wenn er kein Geld mehr hat und in Not gerät, wieder nach Hause wollen? Bernard versichert ihm: er wird alles andere tun, nur nicht zu den Seinen zurückgehen. Angst schnürt Olivier das Herz zusammen, als Bernard ihm mehrmals, immer heftiger versichert: »Alles andere«. Er möchte sprechen, doch er wagt es nicht. Schließlich fasst er Mut, sagt mit unsicherer Stimme, den Kopf gesenkt: »Bernard … du hast doch immerhin nicht die Absicht …« Er stockt. Sein Freund hebt den Blick und bemerkt, ohne Oliviers Gesicht zu sehen, wie verwirrt er ist.
»Was?«, fragt er. »Was meinst du? Sprich doch. Zu stehlen?« Olivier schüttelt den Kopf. Nein, das ist es nicht. Plötzlich bricht er in Tränen aus; er presst Bernard an sich.
»Versprich mir, dass du dich nicht …«
Bernard umarmt ihn und macht sich dann lachend wieder frei. Er hat verstanden: »Das verspreche ich dir. Den Zuhälter mache ich nicht.« Dann meint er noch: »Du musst doch zugeben, dass es das Einfachste wäre.« Aber Olivier ist beruhigt; er weiß, dass Bernard das letztere mit gespieltem Zynismus dahingesagt hat.
»Und dein Abitur?«
»Das ist der Haken. Durchfallen will ich nicht. Ich glaube, ich kann alles; aber es ist wichtig, an dem Tag gut ausgeschlafen zu sein. Ich muss eben schnell etwas finden. Es ist ein bisschen riskant; aber … ich werde es schon schaffen; du wirst sehen.«
Sie sagen eine Weile lang nichts. Der zweite Pantoffel ist heruntergefallen.
»Du wirst dich erkälten«, erklärt Bernard. »Leg dich wieder hin.«
»Nein, du musst dich hinlegen.«
»Mach keine Witze! Komm schon«, und er nötigt Olivier wieder ins Bett zurück.
»Und du? Wo willst du schlafen?«
»Irgendwo. Auf dem Boden. In einer Ecke. Ich werde mich daran gewöhnen müssen.«
»Nein, hör zu. Ich muss dir etwas erzählen, aber ich kann es nur, wenn du ganz nah bei mir bist. Komm mit in mein Bett.« Und als Bernard, der sich im Nu ausgezogen hat, neben ihm liegt: »Weißt du noch, wovon wir neulich sprachen … es ist passiert. Ich bin dort gewesen.«
Bernard versteht ihn gleich. Er drückt seinen Freund an sich, der fortfährt: »Ich kann dir sagen, es ist ekelhaft. Es ist fürchterlich … Danach hätte ich am liebsten ausgespuckt, mich übergeben, mir die Haut heruntergerissen, mich getötet.«
»Du übertreibst.«
»Oder sie getötet …«
»Wer war es? Du bist doch wenigstens nicht unvorsichtig gewesen?«
»Nein, nein; eine, die Dhurmer gut kennt und der er mich vorgestellt hat. Vor allem ihr Geschwätz war mir so zuwider. Sie hörte nicht auf zu reden. Wie blöd sie sein muss! Ich verstehe nicht, dass man in einem solchen Moment nicht still sein kann. Ich hätte sie am liebsten geknebelt, erwürgt …«
»Du Armer! Du hättest dir aber doch auch denken können, dass Dhurmer dir nur eine dumme Kuh anbringen konnte … Sah sie wenigstens gut aus?«
»Wenn du meinst, dass ich sie mir angesehen habe!«
»Du bist ein Dummerchen. Du bist ein Herzchen. Jetzt wird geschlafen … Hast du es wenigstens richtig …«
»Das ist es ja gerade, was mich am meisten anwidert: dass ich trotzdem … als hätte ich sie begehrt.«
»Na also, alter Freund, das ist doch prima.«
»Sei still. Wenn das die Liebe ist, bin ich erst einmal bedient.«
»Was für ein Kind du bist!«
»Ich hätte dich sehen wollen.«
»Oh! Ich, weißt du, ich habe es nicht so eilig. Wie ich dir gesagt habe: Ich lasse es auf mich zukommen. Einfach so, bloß aus Neugier, reizt es mich nicht. Aber wenn ich natürlich …«
»Wenn du …?«
»Wenn sie … Nichts. Schlafen wir.« Und unvermittelt dreht er sich auf die Seite, von dem Körper abrückend, dessen Wärme ihm unangenehm ist. Doch Olivier beginnt wieder: »Sag … glaubst du, dass Barrès gewählt wird?«
»Meine Güte! … Zerbrichst du dir den Kopf deswegen?«
»Es ist mir ganz egal. Du … Hör mal …« Er drückt gegen Bernards Schulter, bis dieser sich umdreht. »Mein Bruder hat eine Geliebte.«
»Georges?«
Der Kleine, der sich schlafend stellt, aber alles belauscht hat, spitzt die Ohren in der Dunkelheit und hält den Atem an, als sein Name fällt.
»Du bist verrückt! Ich spreche von Vincent.« (Der Älteste, Vincent, hat gerade sein erstes Examen in Medizin abgelegt.)
»Hat er dir das erzählt?«
»Nein. Er ahnt nicht, dass ich es in Erfahrung gebracht habe. Meine Eltern wissen von nichts.«
»Was würden sie sagen, wenn sie es erfahren?«
»Ich weiß nicht. Mama wäre verzweifelt. Papa würde ihn vor die Wahl stellen: Trennung oder Heirat.«
»Meine Güte, die ehrenwerten Bürger verstehen nicht, dass man auch auf andere Weise ehrenwert sein kann als sie. Wie hast du davon erfahren?«
»Das kam so: Seit einiger Zeit geht Vincent jede Nacht aus, nachdem meine Eltern sich schlafen gelegt haben. Beim Hinuntergehen versucht er jedes Geräusch zu vermeiden, aber ich erkenne seinen Schritt auf der Straße. Vorige Woche, am Dienstag, glaube ich, war es nachts so heiß, dass ich es nicht mehr im Bett aushielt. Ich ging ans Fenster, um Luft zu schöpfen. Da hörte ich unten die Haustür gehen. Ich beugte mich hinaus, und als er an der Laterne vorbeiging, erkannte ich Vincent. Es war nach Mitternacht. Das war das erste Mal. Ich meine: das erste Mal, dass ich ihn bemerkte. Doch seitdem ich Bescheid weiß, achte ich darauf – ganz unwillkürlich … und fast jede Nacht höre ich ihn weggehen. Er hat einen eigenen Schlüssel. Meine Eltern haben ihm unser altes Zimmer, das von Georges und mir, als künftiges Sprechzimmer eingerichtet. Das Zimmer liegt doch links vom Eingang und der Rest der Wohnung rechts. Er kann also kommen und gehen, wann er will, ohne dass man etwas merkt. Für gewöhnlich höre ich ihn auch nicht heimkommen, aber vorgestern, Montagabend, ich weiß nicht, was mit mir los war; ich dachte an die Zeitschrift, die Dhurmer gründen will … Ich lag lange wach. Ich hörte Stimmen im Treppenhaus; es musste Vincent sein.«
»Um wie viel Uhr war das?«, fragt Bernard, nicht, weil er es wirklich wissen will, sondern um Interesse zu bekunden.
»Es muss gegen drei Uhr gewesen sein. Ich bin aufgestanden und habe an der Tür gehorcht. Vincent unterhielt sich mit einer Frau. Oder vielmehr, nur sie sprach.«
»Woher weißt du dann, dass er es war? Alle Hausbewohner kommen an deiner Tür vorbei.«
»Das ist manchmal sogar verdammt unangenehm: Je später es ist, desto mehr Krawall machen sie beim Hinaufgehen; die Leute, die schlafen wollen, sind ihnen vollkommen egal! … Es konnte nur er sein; ich hörte, wie die Frau ihn mehrmals anredete. Sie sagte zu ihm … oh, es ist mir zuwider, es zu wiederholen …«
»Nun sag schon.«
»Sie sagte: ›Vincent, mein Leben, mein Geliebter, oh, verlassen Sie mich nicht!‹«
»Sie siezte ihn?«
»Ja. Ist das nicht eigenartig?«
»Erzähl weiter.«
»›Sie haben nicht mehr das Recht, mich zu verlassen. Was soll aus mir werden? Wohin soll ich gehen? So sagen Sie doch etwas. Oh, sprechen Sie mit mir.‹ Sie nannte ihn wieder bei seinem Namen und wiederholte: ›Mein Geliebter, mein Geliebter‹, mit immer traurigerer und leiserer Stimme. Und dann hörte ich ein Geräusch (sie mussten auf halber Treppe sein) – ein Geräusch, als fiele etwas zu Boden. Ich glaube, sie warf sich auf die Knie.«
»Und er antwortete nicht?«
»Er muss die letzten Stufen hinaufgegangen sein; ich hörte, wie die Wohnungstür ins Schloss fiel. Die Frau blieb dort noch lange, ganz in der Nähe, beinahe vor meiner Tür. Ich hörte sie schluchzen.«
»Du hättest aufmachen sollen.«
»Ich habe mich nicht getraut. Vincent wäre wütend, wenn er erführe, dass ich mich in seine Angelegenheiten einmische. Und dann hatte ich Angst, es könnte ihr peinlich sein, wenn man sie beim Weinen überraschte. Ich weiß nicht, was ich ihr hätte sagen sollen.«
Bernard hatte sich Olivier zugewandt.
»An deiner Stelle hätte ich aufgemacht.«
»Meine Güte, du traust dich immer alles. Jeden Einfall führst du gleich aus.«
»Soll das ein Vorwurf sein?«
»Nein, ich beneide dich.«
»Hast du eine Ahnung, wer diese Frau sein könnte?«
»Wie soll ich das wissen? Gute Nacht.«
»Sag … bist du sicher, dass Georges uns nicht gehört hat?«, flüstert Bernard Olivier ins Ohr. Sie lauschen einen Moment.
»Nein, er schläft«, meint Olivier, mit normaler Stimme, »und er hätte auch nichts verstanden. Weißt du, was er Papa neulich gefragt hat? … Warum die …«
Da hält es Georges nicht mehr aus; er setzt sich in seinem Bett auf und fällt seinem Bruder ins Wort: »Du Blödian«, schreit er, »hast du denn nicht begriffen, dass es Absicht war? … Meine Güte, ja, ich habe alles gehört, was ihr gesagt habt; oh, regt euch nur nicht auf. Das von Vincent wusste ich schon lange. Nur, ihr Süßen, versucht jetzt, euch etwas leiser zu unterhalten, denn ich bin müde. Oder seid still.«
Olivier dreht sich zur Wand. Bernard, der wach liegt, sieht sich im Zimmer um. Im Mondlicht erscheint es größer. Er kennt es nur flüchtig. Olivier hält sich unter Tags nie dort auf; die wenigen Male, die Bernard bei ihm eingeladen war, blieben sie oben in der Wohnung. Der Mondschein hat inzwischen das Fußende des Bettes erreicht, in dem Georges endlich eingeschlafen ist; er hat fast alles gehört, was sein Bruder erzählte; nun hat er genügend Stoff zum Träumen. Über seinem Bett kann man ein kleines Regal aus zwei Brettern erkennen, auf dem Schulbücher stehen. Auf einem Tisch, neben Oliviers Bett, sieht Bernard ein großes Buch; er streckt den Arm aus und nimmt es, um den Titel zu lesen: Tocqueville; doch als er es auf den Tisch zurücklegen will, fällt das Buch hinunter, und das Geräusch weckt Olivier.
»Liest du jetzt Tocqueville?«
»Dubac hat mir das geliehen.«
»Gefällt es dir?«
»Es ist ziemlich langatmig. Aber es sind einige gute Gedanken drin.«
»Hör zu. Was machst du morgen?«
Morgen, Donnerstag, haben die Gymnasiasten frei. Er fragt sich, ob er seinen Freund noch einmal treffen könnte. In die Schule will er nicht mehr gehen; er meint, sich die letzten Stunden sparen und sein Examen allein vorbereiten zu können.
»Morgen«, sagt Olivier, »gehe ich um halb zwölf zur Gare Saint-Lazare, an den Zug aus Dieppe, um meinen Onkel Édouard zu begrüßen, der aus England zurückkommt. Am Nachmittag, um drei, treffe ich Dhurmer am Louvre. Den Rest des Tages muss ich lernen.«
»Deinen Onkel Édouard?«
»Ja, den Halbbruder von Mama. Er war sechs Monate fort, und ich kenne ihn eigentlich nur flüchtig; aber ich mag ihn sehr gerne. Er weiß nicht, dass ich zum Bahnhof komme, und ich habe ein bisschen Angst, ihn nicht wiederzuerkennen. Er hat mit meiner übrigen Familie überhaupt keine Ähnlichkeit; er ist so in Ordnung.«
»Was macht er?«
»Er ist Schriftsteller. Ich habe fast alle seine Bücher gelesen; aber er hat schon lange nichts mehr veröffentlicht.«
»Romane?«
»Ja; eine Art Romane.«
»Warum hast du mir nie von ihm erzählt?«
»Weil du seine Bücher hättest lesen wollen; und wenn du sie nicht gemocht hättest …«
»Nun, sag schon.«
»Es hätte mir wehgetan. Ganz einfach.«
»Woher willst du wissen, dass er in Ordnung ist?«
»Ich kann es auch nicht erklären. Ich habe dir ja gesagt, dass ich ihn kaum kenne. Es ist eher ein Gefühl. Ich merke, dass er sich für viele Dinge interessiert, die meine Eltern nicht interessieren, und dass man mit ihm über alles sprechen kann. Einmal, kurz vor seiner Abreise, hat er bei uns zu Mittag gegessen. Während er sich mit meinem Vater unterhielt, spürte ich, dass er mich ständig ansah, und es begann mir unangenehm zu werden, ich wollte schon hinausgehen – es war im Esszimmer, wo wir nach dem Kaffee noch saßen –, da fing er an, meinem Vater Fragen über mich zu stellen, was mir noch unangenehmer war; und plötzlich ist Papa aufgestanden, um das Gedicht zu holen, das ich gerade geschrieben und ihm blöderweise gezeigt hatte.«
»Ein Gedicht von dir?«
»Ja doch; du kennst es; es erinnerte dich an den Balcon. Ich wusste, dass es nichts taugte oder jedenfalls nicht viel, und war furchtbar wütend, dass Papa davon anfing. Während Papa das Gedicht holen ging, waren Onkel Édouard und ich eine Weile allein im Zimmer, und ich merkte, dass ich knallrot wurde; ich wusste nicht, was ich sagen sollte; ich sah weg – er übrigens auch; er drehte sich eine Zigarette; dann erhob er sich – wahrscheinlich, um mir die Situation zu erleichtern, denn er hatte gesehen, dass ich rot wurde – und sah zum Fenster hinaus. Er pfiff vor sich hin. Plötzlich sagte er zu mir: ›Es ist mir noch viel unangenehmer als dir.‹ Aber ich glaube, er sagte es nur aus Höflichkeit. Schließlich kam Papa zurück; er überreichte das Gedicht Onkel Édouard, der zu lesen begann. Ich war so außer mir, dass ich ihn beschimpft hätte, wenn er mir etwas Schmeichelhaftes gesagt hätte. Papa wartete ganz offensichtlich darauf – auf etwas Schmeichelhaftes; und da mein Onkel nichts sagte, fragte er: ›Und? Was hältst du davon?‹ Doch mein Onkel erwiderte lachend: ›Es ist mir unangenehm, mit ihm darüber in deiner Gegenwart zu sprechen.‹ Da musste Papa auch lachen und ging hinaus. Und als wir wieder allein waren, sagte er mir, er fände mein Gedicht sehr schlecht; und ich war froh, dass er das sagte; doch am glücklichsten war ich, als er dann auf zwei Verse deutete, die einzigen, die mir an meinem Gedicht gefielen; er hat mich angelächelt und gesagt: ›Die, die sind gut.‹ Ist das nicht in Ordnung? Und wenn du wüsstest, in welchem Ton er es gesagt hat! Ich hätte ihn am liebsten umarmt. Dann hat er mir gesagt, es sei ein Fehler, von einer Idee auszugehen, ich ließe mich nicht genügend von den Worten leiten. Ich habe zuerst nicht viel damit anfangen können; aber ich glaube, ich begreife jetzt, was er sagen wollte – und dass er recht hat. Ich erkläre dir das ein andermal.«
»Jetzt verstehe ich, dass du ihn begrüßen willst.«
»Dabei habe ich dir kaum etwas erzählt, und ich weiß nicht, warum ich gerade das erzählt habe. Wir haben noch über so viele andere Dinge gesprochen.«
»Halb zwölf, sagst du? Woher weißt du, dass er mit diesem Zug kommt?«
»Weil er Mama eine Postkarte geschrieben hat; und dann habe ich im Fahrplan nachgesehen.«
»Geht ihr zusammen Mittag essen?«
»Nein, nein, ich muss um zwölf wieder hier sein. Ich kann ihm nur schnell guten Tag sagen; aber das genügt mir … Ah, sag mir noch, bevor wir schlafen: Wann sehe ich dich wieder?«
»Erst in ein paar Tagen. Erst, wenn ich was gefunden habe.«
»Wirklich … Wenn ich dir nur helfen könnte.«
»Mir helfen? Nein. Das gilt nicht. Das wäre gemogelt. Schlaf gut.«
IV
Mein Vater war ein Dummkopf, meine Mutter aber hatte Geist; sie war Quietistin, war eine sanfte kleine Frau, die immer zu mir sagte: »Mein Sohn, Ihr seid in alle Ewigkeit verdammt.« Und sie machte sich keinerlei Sorgen deswegen.
FONTENELLE
Nein, nicht zu seiner Geliebten war Vincent Molinier jede Nacht unterwegs. Wenn er sich auch rasch entfernt, folgen wir ihm. Von der Wohnung am Anfang der Rue Notre-Dame-des Champs läuft Vincent bis zur Rue Saint-Placide hinunter, die deren Verlängerung bildet; dann in die Rue du Bac, in der zu so später Stunde noch einzelne Bürger unterwegs sind. In der Rue de Babylone macht er vor einer Einfahrt halt, und das Tor öffnet sich für ihn. Es ist das Haus des Comte de Passavant. Käme Vincent nicht häufiger hierher, beträte er solch ein prachtvolles Palais nicht mit dieser Selbstverständlichkeit. Der Lakai, der ihm öffnet, durchschaut im Übrigen das Gehabe, hinter dem Vincent seine Schüchternheit verbirgt. Vincent händigt ihm seinen Hut nicht aus, sondern wirft ihn in großem Bogen auf einen Sessel. Und das, obwohl er noch gar nicht lange in diesem Haus verkehrt. Robert de Passavant, der sich neuerdings als sein Freund bezeichnet, ist der Freund aller möglichen Leute. Ich weiß nicht genau, woher Vincent und er sich kennen. Aus dem Gymnasium vielleicht, auch wenn Robert de Passavant deutlich älter ist als Vincent; sie hatten sich einige Jahre aus den Augen verloren, sich dann, kürzlich, eines Abends im Theater wiedergetroffen, als Olivier seinen Bruder ausnahmsweise begleitete; während der Pause hatte Passavant sie beide zu einem Eis eingeladen; bei dieser Gelegenheit hatte er auch erfahren, dass Vincent gerade sein Praktikum abschloss und noch zögerte, sich als Assistenzarzt zu bewerben; die Wissenschaft reizte ihn eigentlich mehr als die praktische Medizin; doch die Notwendigkeit, sich seinen Unterhalt zu verdienen … Kurz, Vincent war bald darauf bereitwillig auf Passavants Vorschlag eingegangen, gegen Bezahlung jeden Abend nach dessen altem Vater zu sehen, der noch an den Folgen einer schweren Operation litt: Es handelte sich um das Erneuern von Verbänden, um heikle Sondierungen, Spritzen, allerlei, das fachkundige Hände erforderte. Abgesehen davon hatte der Vicomte aber Vincent auch noch in ganz anderer Absicht angesprochen, und Vincent hatte ebenfalls noch andere Gründe, das Angebot anzunehmen. Roberts geheimen Absichten wollen wir später nachspüren; was Vincent anbelangt, so ging es um Folgendes: Er war in großer Geldverlegenheit. Wenn man das Herz am rechten Fleck hat und eine anständige Erziehung schon früh ein gewisses Verantwortungsgefühl geweckt hat, dann hängt man einer Frau kein Kind an, ohne sich ihr gegenüber verpflichtet zu fühlen, vor allem, wenn diese Frau ihren Mann verlassen hat, um dem Geliebten zu folgen. Vincent war bisher ein recht unbescholtener junger Mann gewesen. Sein Abenteuer mit Laura erschien ihm daher, je nach der Tageszeit, bald monströs, bald ganz natürlich. Viele kleine Vorfälle, die jeder für sich ganz harmlos und natürlich wären, können sich allzu leicht zu einer monströsen Summe addieren. Das führte er sich unterwegs immer wieder vor Augen, doch half es ihm nicht aus seinen Schwierigkeiten heraus. Gewiss hatte er nie daran gedacht, ein Leben lang für diese Frau zu sorgen, sie nach einer Scheidung zu heiraten oder sie, ohne sie zu heiraten, bei sich zu behalten; er musste sich eingestehen, dass er für sie keine tiefe Neigung empfand; doch er wusste, dass sie in Paris völlig mittellos dastand; er hatte ihr Unglück herbeigeführt: Also schuldete er ihr zumindest Hilfe in der größten Not – doch nicht einmal dazu war er in der Lage, heute weniger als gestern und weniger noch als vor ein paar Tagen. Denn vorige Woche besaß er noch die fünftausend Francs, die seine Mutter mühsam und geduldig zusammengespart hatte, um ihm den Aufbau seiner Praxis zu erleichtern; diese fünftausend Francs hätten doch genügt für die Niederkunft seiner Geliebten, ihre Unterbringung in einer Klinik und die erste Versorgung des Kindes. Auf welchen Dämon hatte er nur gehört? Dieser Geldbetrag, den er ihr übereignen wollte, dieser ihr zugedachte, für sie bestimmte Betrag, den er niemals hätte antasten dürfen – welcher Dämon nur flüsterte ihm eines Abends ein, der reiche nicht? Nein, Robert de Passavant war es nicht. Robert hatte nie dergleichen gesagt; doch sein Vorschlag, Vincent in einen Salon zum Glücksspiel mitzunehmen, fiel gerade auf diesen Abend. Und Vincent war darauf eingegangen.
Das Gefährliche an dieser Spielhölle war, dass die vornehme Welt dort auf freundschaftlichem Fuß verkehrte. Robert machte seinen Freund Vincent bald mit diesem, bald mit jenem bekannt. Vincent konnte an seinem ersten Abend nicht viel setzen, weil er nicht darauf vorbereitet war. Er trug fast nichts bei sich und nahm auch die paar Scheine nicht an, die der Vicomte ihm leihen wollte. Doch da er gewann, reute es ihn, nicht höher gesetzt zu haben, und er schwor sich, am nächsten Abend wiederzukommen.
»Jetzt kennt man Sie; nun können Sie ohne mich hingehen«, sagte Robert.