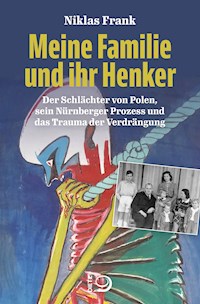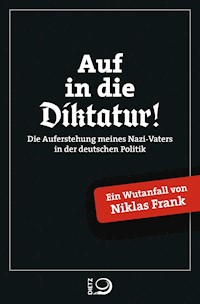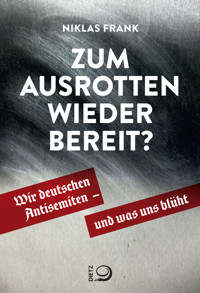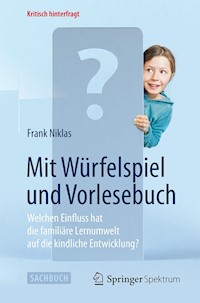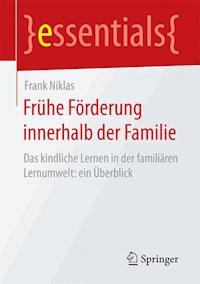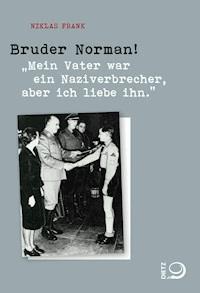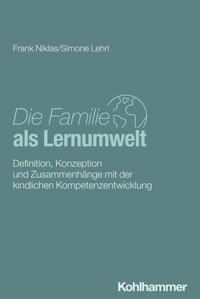
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die häusliche Lernumwelt stellt den Kontext dar, in dem die allermeisten Kinder weltweit aufwachsen und in dem sie wesentliche Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben. Dieses Lehrbuch gibt eine fundierte Einführung in das Konzept der häuslichen Lernumwelt und stellt Definitionen, Theorien, Modelle und Erfassungsmethoden vor. Auch die Zusammenhänge mit weiteren familiären und kindlichen Hintergrundvariablen und mit der kindlichen Entwicklung über die ersten Lebensjahre bis in die Grundschulzeit hinein werden ausführlich behandelt. Erziehende und Lehrkräfte sowie Eltern erhalten zudem einen Überblick zu Fördermaßnahmen und Familienprogrammen und zur Rolle der zunehmenden Digitalisierung der häuslichen Lernumwelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort und Danksagung
1 Die häusliche Lernumwelt – eine Begriffsbestimmung
1.1 Einleitung
1.2 Familie – was ist darunter zu verstehen?
1.3 Historische Entwicklungslinien zur Lernumweltforschung und der Bedeutung der Familie
1.4 Beschreibungs- und Definitionsversuche zur häuslichen Lernumwelt
1.5 Häusliche Lernumwelt und Erziehungsstil – zwei verwandte und doch unterschiedliche Konstrukte
1.6 Fazit
2 Theoretischer Bezugsrahmen und Konzeptionen
2.1 Einleitung
2.2 Theoretische Grundlagen
2.2.1 Bronfenbrenners ökologische Theorie
2.2.2 Der soziologische Ansatz von Bourdieu
2.2.3 Vygotskis soziokulturelle Theorie
2.2.4 Banduras sozial-kognitive Lerntheorie
2.3 Theoretische Konzepte und Modelle
2.3.1 Struktur-Prozess-Orientierungs-Modell
2.3.2 Home-Literacy- und Home-Numeracy-Modelle
2.3.3 Modelle zu formellen und informellen Lernaktivitäten in der Familie
2.3.4 Integrierende Modelle
2.4 Fazit
3 Operationalisierungen
3.1 Einleitung
3.2 Fragebögen
3.2.1 Erfassung der schriftsprachlichen häuslichen Lernumwelt
3.2.2 Erfassung der mathematischen häuslichen Lernumwelt
3.2.3 Erfassung der generellen häuslichen Lernumwelt
3.2.4 Fernseh- und Medienkonsum im Familienkontext
3.3 Erfassung der häuslichen Lernumwelt über Checklisten
3.3.1 Englische Kinderbuch- und Kinderbuchautorenlisten
3.3.2 Deutsche Kinderbuch-Checklisten
3.3.3 Checklisten für Spiele mit mathematischem Inhalt
3.4 Beobachtungsverfahren
3.5 Weitere Formen der Datenerfassung
3.6 Fazit
4 Bedingungen häuslicher Lernumwelten
4.1 Einleitung
4.2 Sozioökonomischer Status und Bildungshintergrund
4.2.1 Einteilung in Klassen und Schichten
4.2.2 Sozioökonomischer Status und häusliche Lernumwelt
4.3 Migrationshintergrund
4.4 Familienstruktur
4.4.1 Geschwister
4.4.2 Familienform
4.5 Elterliche Orientierungen und Einstellungen
4.6 Fazit
5 Die häusliche Lernumwelt von der Geburt bis ins Grundschulalter
5.1 Einleitung
5.2 Die häusliche Lernumwelt in den ersten Lebensjahren
5.2.1 Das Konzept der Sensitivität
5.2.2 Kognitive Aktivierung und gemeinsame Aktivitäten
5.3 Die häusliche Lernumwelt im Kindergarten- und Vorschulalter
5.3.1 Sprachliche Anregung und informelle Home Literacy Environment
5.3.2 Schriftsprachliche Aktivitäten und formelle Home Literacy Environment
5.3.3 Zusammenfassung zur informellen und formellen Home Literacy Environment
5.3.4 Mathematische Aktivitäten – die Home Numeracy Environment
5.3.5 Zusammenfassung zur informellen und formellen Home Numeracy Environment
5.3.6 Die frühe Home Learning Environment und weitere Kompetenzbereiche
5.4 Die häusliche Lernumwelt im Grundschulalter
5.4.1 Auswirkungen schulischen elterlichen Engagements
5.4.2 Qualität der elterlichen Hausaufgabenunterstützung
5.4.3 Gemeinsame und interaktive Effekte der HLE und Kindergarten-/Schulqualität
5.5 Fazit
6 Die digitale häusliche Lernumwelt
6.1 Einleitung
6.2 Verfügbarkeit und Nutzung von Medien bei Kindern und Jugendlichen
6.3 Befunde zur Bedeutung der digitalen häuslichen Lernumwelt
6.4 Digitale Lernapplikationen (Lernapps) für Kinder
6.5 Fazit
7 Interventionen im Kontext der häuslichen Lernumwelt
7.1 Einleitung
7.2 Begriff, Ziele und Aufgaben von Familienbildung
7.3 Befunde aus Familienbildungsprogrammen im Vorschulalter
7.3.1 Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters (HIPPY)
7.3.2 Opstapje
7.3.3 Chancenreich
7.3.4 Dialogic Reading
7.3.5 Learning4Kids
7.4 Fazit
8 Grenzen der häuslichen Lernumwelt
8.1 Einleitung
8.2 Genetische Determination
8.3 Der Einfluss anderer Lernumwelten und Kontexte
8.4 Kindliche Motivation und Autonomie
8.5 Die Bedeutung des Zeitpunkts von Fördermaßnahmen
8.6 Fazit
Fazit und Ausblick
Literatur
Stichwortverzeichnis
Die AutorInnen
Prof. Dr. Frank Niklas ist Entwicklungs- und Pädagogischer Psychologe und forscht zur Kompetenzentwicklung von Kindern im Familienkontext und zu (digitalen) Fördermaßnahmen. Er studierte, promovierte und habilitierte an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg und arbeitete von 2013 bis 2015 als Post-Doc an der University of Melbourne in Australien. Seit März 2019 ist er Professor für Pädagogische Psychologie und Familienforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Prof. Dr. Simone Lehrl ist Erziehungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt frühkindliche Bildung und forscht zu Bildungsprozessen und Kompetenzentwicklungen von Kindern im familiären und instutionellen Kontext. Sie studierte und promovierte an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Seit Januar 2022 ist sie Professorin für Elementarbildung an der Pädagogischen Hochschule Weingarten.
Frank NiklasSimone Lehrl
Die Familie als Lernumwelt
Definition, Konzeption und Zusammenhänge mit der kindlichen Kompetenzentwicklung
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-033036-8
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-033038-2epub: ISBN 978-3-17-033039-9
Vorwort und Danksagung
Dieses Lehrbuch gibt eine Einführung und eine Übersicht zum Konzept der häuslichen Lernumwelt und zu ihrer Bedeutung für die kindliche Entwicklung. Die häusliche (oder auch familiäre) Lernumwelt – im Englischen als »Home Learning Environment« (HLE) bezeichnet – stellt den Kontext dar, in dem die allermeisten Kinder weltweit aufwachsen und in dem sie wesentliche Fähigkeiten und Kompetenzen erlernen. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass seit Jahrzehnten international (und zunehmend auch national) zu dieser Thematik geforscht wird. Erstaunlich ist hingegen, dass es bislang noch kein (deutschsprachiges) Fachbuch gab, das diese Erkenntnisse aufgreift und in einen Gesamtzusammenhang stellt. Diese Lücke wurde nun mit »Die Familie als Lernumwelt« geschlossen.
Das vorliegende Buch integriert nicht nur zentrale Theorien und Modelle zur Thematik aus den Bereichen der Psychologie, Erziehungswissenschaften und Soziologie, sondern greift auch Befunde sowohl der internationalen als auch der nationalen Forschung auf. Wie auch die Forschung zur HLE fokussiert das Buch dabei die frühe Kindheit bis ins Grundschulalter, ohne detailliert auf das Jugend- oder Erwachsenenalter einzugehen. Der Überblick ist aus unserer Sicht sehr umfassend und führt nicht nur in das Konstrukt der HLE ein, sondern beantwortet zentrale Fragen zur Definition, theoretischen Einbettung, Operationalisierung, dem Zusammenhang mit anderen familiären Faktoren und der kindlichen Kompetenzentwicklung, zur digitalen Lernumwelt und zu Grenzen der HLE.
Deshalb eignet sich dieses Buch sowohl für alle wissenschaftlich Tätigen und für die Hochschullehre als auch für alle interessierten Personen aus der Praxis in Kindertageseinrichtungen und Schulen oder auch für Eltern. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine spannende und gewinnbringende Lektüre, die sie in ihrer (praktischen) Arbeit und auch im Alltag inspiriert und letztlich dazu führt, dass das erworbene Wissen denen zugutekommt, die die Inhalte in erster Linie betreffen: allen Kindern.
Wir möchten uns an dieser Stelle auch noch herzlich und ausdrücklich bedanken – zunächst beim Kohlhammer Verlag und hierbei insbesondere bei unserer Lektorin Kathrin Kastl für die immer sehr gute und offene Kommunikation sowie die sehr hilfreiche Unterstützung! Auch möchten wir uns bei unseren Familien bedanken, die uns nicht nur immer wieder anschaulich gemacht haben, was wir hier in der Theorie verfasst haben, sondern uns auch das Schreiben (und die dafür nötigen Auszeiten) ermöglicht haben. Wir haben Euch lieb und sagen Danke!
München und Weinheim, im Januar 2025Frank Niklas und Simone Lehrl
1 Die häusliche Lernumwelt – eine Begriffsbestimmung
1.1 Einleitung
Bei dem Terminus »häusliche Lernumwelt« handelt es sich keineswegs um ein einheitliches, klar abgrenzbares Konzept. Vielmehr subsumiert dieser Terminus eine breite Palette an Forschungsrichtungen und Forschungsbefunden, die auch unter den Begrifflichkeiten »familiale« oder »familiäre« Lernumwelt zu finden sind. Das folgende Kapitel hat daher zum Ziel, zu klären, was unter der häuslichen Lernumwelt eigentlich zu verstehen ist. Dazu wird zunächst auf den Begriff der Familie allgemein eingegangen. Anschließend werden die historischen Entwicklungslinien der Lernumweltforschung im Kontext der Familie nachvollzogen, um in einem dritten Schritt auf Definitionsansätze einzugehen, die eine Verortung des Begriffs »häusliche Lernumwelt« oder im englischen »Home Learning Environment« ermöglichen.
1.2 Familie – was ist darunter zu verstehen?
»Es ist müßig, darüber zu streiten, seit wann der bürgerliche Familienbegriff zum dominanten Modell von Familie in unserer Gesellschaft geworden ist.« (Erning, 1997, S. 47) Das Zitat macht deutlich, dass der Begriff Familie einem historischen Wandel unterliegt, der aber nicht eindeutig einzelnen Zeitabschnitten zugeordnet werden kann. Mitterauer (1989, S. 179) hält fest, dass schon immer »nebeneinander eine bunte Vielfalt von sehr unterschiedlichen Familientypen, in ihrer Verschiedenheit wohl differenzierter als in der Gegenwart« gab. Nichtsdestotrotz kann eine gewisse Dominanz von Familienformen im historischen Rückblick bis in die Gegenwart ausgemacht werden (Gestrich, 2013). In Folge des industriellen Fortschritts im 18. und 19. Jahrhundert fand im europäischen Raum ein Wandel des Familienlebens statt. Es entwickelte sich ein Idealtypus des familiären Zusammenlebens: die bürgerliche Kernfamilie, die durch eine starke emotionale und intime Ehe- und Eltern-Kind-Beziehung, eine klare geschlechts- und generationenspezifische Rollenaufteilung, eine starke Privatheit und Abgrenzung gegenüber Außeneinflüssen auf das Familienleben gekennzeichnet ist (Reyer, 2004). Demgegenüber steht die klassische Arbeiterfamilie, die sich dadurch auszeichnet, dass meist beide Elternteile (und die Kinder) einer Erwerbsarbeit nachgingen und starken finanziellen Repressionen ausgesetzt waren. Die bürgerliche Kernfamilie galt bis in die 70er Jahre der Bundesrepublik als Ideal des familiären Zusammenlebens (Peuckert, 2019). Seit dem Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts lassen sich aber auch eine Reihe familiärer Wandlungsprozesse feststellen, z. B. die zunehmende Zahl an nichtehelichen Lebensgemeinschaften, sinkende Geburtenzahlen, erhöhte Scheidungsquoten und eine erhöhte Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben (Schneewind & Schmidt, o. J.). Solche Entwicklungen werfen die Frage auf, was unter Familie heute verstanden werden kann. Im Allgemeinen kann der Familienbegriff auf einer biologischen, rechtlichen, soziologischen und psychologischen Grundlage definiert werden (Jungbauer, 2022). Schneewind (2010, S. 35) schlägt einen umfassenden Familienbegriff vor, der den verschiedenen Bedingungen, unter denen Familien heute leben, gerecht wird:
»Familien sind biologische, soziale oder rechtlich miteinander verbundene Einheiten von Personen, die – in welcher Zusammensetzung auch immer – mindestens zwei Generationen umfassen und bestimmte Zwecke verfolgen. Familien qualifizieren sich dabei als Produzenten gemeinsamer, u. a. auch gesellschaftlich relevanter Güter (wie z. B. die Entscheidung für Kinder und deren Pflege, Erziehung und Bildung) sowie als Produzenten privater Güter, die auf die Befriedigung individueller und gemeinschaftlicher Bedürfnisse (wie z. B. Geborgenheit und Intimität) abzielen. Als Einheiten, die mehrere Personen und mehrere Generationen umfassen, bestehen Familien in der zeitlichen Abfolge von jeweils zwei Generationen aus Paar-, Eltern-Kind- und gegebenenfalls Geschwister-Konstellationen, die sich aus leiblichen, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefeltern (Parentalgeneration) sowie leiblichen, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkindern (Filialgeneration) zusammensetzen können.«
Im Kontext der häuslichen Lernumwelt, bietet es sich an, von einem psychologischen Konzept auszugehen. Hofer (2002, S. 6) bezeichnet dementsprechend die Familie als »[...] eine Gruppe von Personen, die durch
nahe und dauerhafte Beziehungen miteinander verbunden sind, welche sich auf
eine nachfolgende Generation hin orientieren und
einen erzieherischen bzw. sozialisatorischen Kontext sowie
einen Ort der informellen Bildung für die Entwicklung der nachkommenden Generation bereitstellen.«
Diese sehr breite Definition beinhaltet nicht nur den Aspekt der biologischen Generationenfolge, sondern umfasst auch die für die häusliche Lernumwelt relevanten Aspekte der informellen Bildungsprozesse, die sich im Kontext der Familie vollziehen. Beide Definitionen bilden daher die Grundlage für die weiteren Ausführungen zur häuslichen Lernumwelt.
1.3 Historische Entwicklungslinien zur Lernumweltforschung und der Bedeutung der Familie
Historisch betrachtet sind schon im beginnenden 17. Jh. Hinweise zu finden, dass der Familie eine besondere Bedeutung bei der Unterstützung der kindlichen Entwicklung beigemessen wurde (Minsel, 2007). Zu nennen sind hier zum Beispiel das Werk »Informatorium der Mutterschul« von 1633 (Comenius, 1962), das die Bedeutsamkeit des familialen Kontextes, insbesondere der Mutter, für die kindliche Entwicklung betont oder die Veröffentlichungen von Salzmann 1770 (Krebsbüchlein), Pestalozzi 1804 (Buch der Mütter) und Fröbel 1840 (Mutter und Koselieder), die deutlich machen, dass die Familie als wichtiger Kontext für die kindliche Entwicklung wahrgenommen wurde, der durch gezielte Maßnahmen verbessert werden kann, um Kinder bestmöglich zu fördern (Überblick bei Minsel, 2007).
Die empirische Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Familie für die kognitive Entwicklung von Kindern wurde später maßgeblich durch die Arbeiten von Hunt (»Intelligence and Experience«, 1961) und Bloom (1964) beeinflusst. Mit der Definition von Umwelt liefert Bloom einen wichtigen Beitrag zum heutigen Begriff der häuslichen Lernumwelt. Unter Umwelt versteht Bloom (1964)
»[...] die Bedingungen, Einflüsse (forces) und äußeren Reize, die auf Menschen einwirken. Dies können psychische, soziale, aber auch intellektuelle Einflüsse und Bedingungen sein. Nach unserer Auffassung reicht Umwelt von den unmittelbarsten sozialen Interaktionen bis zu den entferntesten kulturellen und institutionellen Einflüssen. Wir glauben, dass die Umwelt aus einem Netzwerk von Einflüssen und Faktoren besteht, die den Menschen umgeben. Wenn auch einige Menschen diesem Netzwerk widerstehen können, werden nur äußerst selten (in extremen Fällen) Individuen völlig ausweichen oder entkommen können. Umwelt ist eine formende und verstärkende Kraft, die auf Menschen einwirkt« (Bloom, 1964, S. 187).
Blooms Arbeiten sowie die seiner Schüler (z. B. Marjoribanks, 1974), regten dazu an, die Bedeutung der Familie nicht nur in sozialen Statusvariablen zu betrachten, sondern stattdessen eine differenzierte Erfassung häuslicher Lernumweltmerkmale vorzunehmen, bei der auch Aktivitäten und spezifische Interaktionen eine Rolle spielen sollten. Diese Ideen griff auch eine Forschergruppe um Betty Caldwell und Robert Bradley auf und entwickelte ein Instrument, das die häusliche Lernumwelt in den früheren Jahren abdeckt, die »Home Observation for Measurement of the Environment (HOME)« (Bradley & Caldwell, 1984) genannt (vgl. auch ▸ Kap. 3.4). Ziel war die Konstruktion eines reliablen, einfach einzusetzenden, auf Beobachtung basierenden Messinstruments zur Erfassung der Qualität und Quantität der sozialen, emotionalen und kognitiven Unterstützung innerhalb der häuslichen Lernumwelt (Elardo et al., 1975, S. 71).
Mit ihren Arbeiten etablierte sich auch der Begriff der »Home Learning Environment« und ermöglichte mit der Entwicklung dieses umfassenden Instruments eine breite Erforschung der häuslichen Lernumwelt.
1.4 Beschreibungs- und Definitionsversuche zur häuslichen Lernumwelt
Der Begriff der »häuslichen Lernumwelt« stellt eine Übersetzung des englischen Begriffs »Home Learning Environment« dar und hat neben der Arbeit von Wolf (1980; »Zuwendung und Anregung«) insbesondere durch Tietze et al. (1998; »Wie gut sind unsere Kindergärten?«) Einzug in die deutsche Forschungslandschaft gehalten. Mit der Verwendung dieser Begrifflichkeit ist auch eine Verortung in der angloamerikanischen, eher quantitativ ausgerichteten Forschungstradition verbunden. Dem gegenüber steht der eher in der qualitativen Sozialforschung verhaftete Begriff der Familie als »Bildungsort« (Büchner & Brake, 2006) oder »Bildungswelt« (Rauschenbach, 2009, S. 121). Einige Definitionsversuche versuchen den Terminus näher zu beschreiben, um festlegen zu können, was die häusliche Lernumwelt genau beinhaltet.
Eine sehr allgemeine Definition findet sich bei Bäumer et al. (2011, S. 91), welche die häusliche Lernumwelt als die Anstrengungen der Eltern bezeichnen, mit der sie die Entwicklung ihrer Kinder unterstützen. Als ähnlich weiten Rahmen definiert Bradley (2015, S. 382) die HLE als Quantität und Qualität der Anregung, Unterstützung und Struktur innerhalb der häuslichen Lernumwelt, wobei der Fokus auf das Kind als Rezipienten verschiedener Angebote gerichtet wird, die sich auf Objekte, Ereignisse und Interaktionen beziehen: »[...] the quantity and quality of stimulation, support, and structure available to a particular child in the child's home environment. The focus is on the child as recipient of inputs from objects, events, arrangements, and transactions.« Sehr allgemein umfasst die häusliche Lernumwelt damit sämtliche Aspekte, die das kindliche Lernen im häuslichen Kontext unterstützen. Eine weitere, ähnliche Definition findet sich bei Burgess (2011). Diese Definition bezieht sich zwar auf die »Home Literacy Environment« – also die schriftsprachliche Lernumwelt zu Hause, kann jedoch auch auf die gesamte häusliche Lernumwelt übertragen werden: »The HLE can be characterized by the variety of resources and opportunities provided to children as well as by the parental skills, abilities, dispositions, and resources that determine the provision of these opportunities for children« (Burgess, 2011, S. 413).
Niklas (2015, S.107) definiert die häusliche Lernumwelt als diejenigen Aspekte, »die dem Kind im Rahmen der Familie die Möglichkeiten bieten und es darin unterstützen, spezifische Vorläuferfertigkeiten und zusätzliche Fähigkeiten im Bereich Schriftsprache und Mathematik zu erwerben und zu üben und damit auch weiterführende schriftsprachliche und mathematische Kompetenzen zu entwickeln.« Damit wird erneut eine allgemeine Definition gegeben, die jedoch den Bezug der häuslichen Lernumwelt zu spezifischen mathematischen und schriftsprachlichen Kompetenzen fokussiert. Dementsprechend kann die häusliche Lernumwelt weiter differenziert werden, in die weiter oben schon erwähnte »Home Literacy Environment«, welche diejenigen Aspekte umfasst, die in besonderem Maße auf die sprachlich-/schriftsprachliche Förderung im häuslichen Umfeld zielen, und die »Home Numeracy Environment«, welche Aktivitäten und Anregungen umfasst, die die frühe numerische/mathematische Entwicklung unterstützen sollte (für weitere und genauere Ausführungen dazu ▸ Kap. 3 und 4).
Home Literacy Environment
Die Home Literacy Environment umfasst alle Aspekte und Facetten der häuslichen Lernumwelt, die sich auf die Sprache und Schriftsprache sowie die kindliche Kompetenzentwicklung in diesem Bereich beziehen. Hierzu gehören beispielsweise die Anzahl an Büchern im Haushalt, die Häufigkeit des Vorlesens und Lesens oder auch die Einstellung zum Lesen und damit Objekte, Tätigkeiten und Verhaltensweisen, die potentiell die (schrift-)sprachliche Kompetenzentwicklung unterstützen können.
Home Numeracy Environment
Die Home Numeracy Environment (HNE, neuerdings auch manchmal Home Mathematics Environment, ▸ Kap. 2.3.2) umfasst alle Aspekte und Facetten der häuslichen Lernumwelt, die sich auf Zahlen, Rechnen und allgemein Mathematik sowie die kindliche Kompetenzentwicklung in diesem Bereich beziehen. Hierzu gehören beispielsweise Mathematik im Alltag (z. B. Zählen von Treppenstufen, Rechnen beim Einkaufen), das Spielen von Spielen mit mathematischem Inhalt oder auch die Einstellung zum Rechnen. Damit umfasst sie Objekte, Tätigkeiten und Verhaltensweisen, die potentiell die mathematische Kompetenzentwicklung unterstützen können.
Insgesamt wird deutlich, dass die Definitionen einen breiten Spielraum dafür lassen, was genau unter der häuslichen Lernumwelt zu verstehen ist. Grundsätzlich können sämtliche Aktivitäten dazu gehören, die Kinder im häuslichen Kontext durchführen, wie z. B. singen, malen, lesen, Brettspiele spielen, aber auch sämtliche Materialien, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, wie Spielsachen, Musikinstrumente und Medien. Eine Herausforderung der Forschung zur häuslichen Lernumwelt ist es daher, genau jene Aktivitäten zu bestimmen, die sich als tatsächlich förderlich für die kindliche Entwicklung erweisen, sprich »stimulierend« sind. Hierzu werden sowohl theoretische als auch konzeptionelle Überlegungen herangezogen, welche in den folgenden Kapiteln 2 und 3 vorgestellt werden. In diesem Zusammenhang wird aber auch deutlich, dass nicht nur die Häufigkeit einer Aktivität stimulierend sein kann, z. B. die Häufigkeit des gemeinsamen Vorlesens, sondern auch dessen Qualität entscheidend ist, z. B. wie lese ich vor (Lehrl, 2018).
1.5 Häusliche Lernumwelt und Erziehungsstil – zwei verwandte und doch unterschiedliche Konstrukte
Ein zwar verwandtes, da ebenfalls im häuslichen Kontext angesiedeltes, aber anders zu verortendes Konstrukt stellt das Erziehungsverhalten in der Familie dar. Anders als bei der häuslichen Lernumwelt, bei der die Versorgung des Kindes mit entwicklungsförderlichen Aktivitäten und Ressourcen im Vordergrund steht, geht es bei der Beschreibung des Erziehungsverhaltens von Eltern um den allgemeinen Umgang mit dem Kind zur Veränderung von kindlichen Verhaltensweisen. Als Erziehungsstile werden »interindividuell variable, aber intraindividuell vergleichsweise stabile Tendenzen von Eltern bezeichnet, bestimmte Erziehungspraktiken zu manifestieren« (Krohne & Hock, 1994, S. 54).
Erziehungsstil
Erziehungsstile stehen für eine spezifische Art der Erziehungspraxis, mittels derer Eltern das Verhalten ihrer Kinder entsprechend der intendierten Vorstellung zu verändern versuchen. Es gibt verschiedene Klassifizierungen von Erziehungsstilen, wobei häufig unterschieden wird, inwieweit jeweils eine Lenkung des Kindes und die emotionale Zugewandtheit vorliegen (gering/hoch).
Nach der Klassifizierung von Baumrind (1996) können vier Typen elterlichen Erziehungsverhaltens unterschieden werden, die hinsichtlich ihres Grades an Lenkung und emotionaler Zugewandtheit variieren: autoritär (Lenkung hoch, emotionale Zugewandtheit gering), autoritativ (Lenkung hoch, emotionale Zugewandtheit hoch), permissiv (Lenkung gering, emotionale Zugewandtheit hoch) und vernachlässigend (Lenkung gering, emotionale Zugewandtheit gering). Die Befunde zahlreicher Forschungsarbeiten belegen, dass der autoritative Erziehungsstil mit Blick auf die psychosoziale Entwicklung von Kindern überlegen ist: Autoritativ erzogene Kinder weisen eine höhere Sozialkompetenz und einen höheren Selbstwert auf, sind leistungsorientierter, zeigen seltener Problemverhalten und sind beliebter bei Gleichaltrigen (Baumrind, 1991; Schwarz & Silbereisen, 1996; Steinberg, 2001; Steinberg et al., 1995).
Gegenüber dem elterlichen Erziehungsstil handelt es sich bei der häuslichen Lernumwelt jedoch um ein spezifischeres Konstrukt, welches das kindliche Lernen im Kontext der Familie fokussiert und nicht primär allgemeine Verhaltensänderungen bei einem Kind fokussiert.
1.6 Fazit
Schon seit Jahrhunderten beschäftigen sich Gelehrte mit der Bedeutung der Familie für die kindliche Entwicklung. Eine zentrale Rolle nehmen hierbei die Verhaltensweisen und Praktiken des häuslichen Umfeldes ein. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich der Begriff der häuslichen Lernumwelt (im Englischen »Home Learning Environment«) auf die Funktion der Familie richtet, ihr Kind intellektuell zu unterstützen und zu stimulieren. Damit untersucht die HLE eher die Bildungsfunktion der Familie. Eine einheitliche Definition zur HLE besteht nicht. In Abgrenzung dazu bezieht sich die der HLE-Forschung nahestehende Erziehungsstilforschung auf die Funktion der Familie, allgemeinere Verhaltensänderungen beim Kind hervorzurufen, was eher der Erziehungsfunktion der Familie zugeordnet werden kann.
2 Theoretischer Bezugsrahmen und Konzeptionen
2.1 Einleitung
Wie im Rahmen des vorhergehenden Kapitels deutlich wurde, handelt es sich bei der häuslichen Lernumwelt um keine einheitliche Konzeption, der eine eindeutige Definition zugrunde liegt. Eine vergleichbare Heterogenität zeigt sich auch bei der theoretischen Fundierung, denn Forschungsarbeiten, die sich mit der häuslichen Lernumwelt auseinandersetzen, nehmen teilweise Bezug auf sehr unterschiedliche theoretische Ansätze. Ähnlich verhält es sich mit Konzeptualisierungen und Modellen zur häuslichen Lernumwelt, die je nach Forschungsinteresse verschiedene Aspekte fokussieren, beinhalten oder auch bewusst ignorieren und nicht der häuslichen Lernumwelt zurechnen.
Im folgenden Kapitel sollen daher zunächst die zentralen Theorien erklärt werden, die häufig als theoretische Grundlage für die Erforschung der häuslichen Lernumwelt herangezogen werden. Daran anschließend werden aktuelle englisch- und deutschsprachige Konzepte und Modelle der häuslichen Lernumwelt vorgestellt.
2.2 Theoretische Grundlagen
Die im Folgenden behandelten Theorien von Bronfenbrenner, Bourdieu, Vygotski und Bandura sind nicht als grundsätzliche Theorien zur häuslichen Lernumwelt zu verstehen. Vielmehr handelt es sich um allgemeine Theorien der menschlichen Entwicklung, des menschlichen Lernens bzw. zur Erklärung sozialer Ungleichheiten und der Entwicklung in sozialen Kontexten. Sie finden bei verschiedenen Thematiken Anwendung wie beispielsweise als Erklärungsansätze für Lernen aus soziologischer Sicht oder aus Sicht der Entwicklungspsychologie. Diese vier Theorien eignen sich aber dahingehend als sehr guter theoretischer Bezugsrahmen für die häuslichen Lernumwelt, da sie ebenfalls soziale Kontexte fokussieren, die Entwicklung und Lernen ermöglichen. Sie können damit auch als Erklärung herangezogen werden, warum Lernen im Rahmen der häuslichen Lernumwelt funktioniert und warum diese eine so wichtige Rolle einnimmt.
2.2.1 Bronfenbrenners ökologische Theorie
Die ökologische Theorie von Bronfenbrenner (z. B. 1979) unterscheidet auf verschiedenen Ebenen mehrere Einflussfaktoren für die kindliche Entwicklung und nimmt »eine ineinander geschachtelte Anordnung konzentrischer, ineinander gebetteter Strukturen« (Bronfenbrenner, 1990, S. 76) an. Diese Strukturen interagieren miteinander und wirken gemeinsam auf das Individuum ein, das in dessen Mitte lokalisiert ist (▸ Abb. 2.1).
Abb. 2.1:Modell zu Bronfenbrenners ökologischer Theorie mit dem Kind im Zentrum der verschiedenen Systemebenen
Das Mikrosystem stellt dabei die zentrale Bezugsgröße des sich entwickelnden Kindes dar. Es umfasst
»[...] ein Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschlichen Beziehungen, das die in Entwicklung begriffene Person in einem gegebenen Lebensbereich mit seinen eigentümlichen physischen und materiellen Merkmalen erlebt. Ein Lebensbereich ist ein Ort, an dem Menschen leicht direkte Interaktion mit anderen aufnehmen können, Tätigkeit (oder Aktivität), Rolle und zwischenmenschliche Beziehung sind die Elemente (oder Bausteine) des Mikrosystems« (Bronfenbrenner 1981, S. 38).
Zum Mikrosystem gehören somit die engsten Vertrauten des Kindes, mit denen es täglich interagiert. In erster Linie handelt es sich dabei um die Eltern und Geschwister. Es könnte sich daneben aber auch um andere im Haushalt lebende Personen wie die Großeltern oder um sehr enge Freunde des Kindes handeln. Allerdings zählen auch Institutionen wie Krippe, Kindertagesstätte oder Schule zu den eigenen Mikrosystemen.
Die verschiedenen Lebensbereiche bzw. Mikrosysteme stehen meist nicht unverbunden nebeneinander, sondern interagieren, indem z. B. Eltern mit pädagogischen Fachkräften der Kita hinsichtlich der Förderung ihres Kindes kooperieren. Bronfenbrenner bezeichnet diese Wechselbeziehung zwischen den einzelnen Mikrosystemen als Mesosystem. »Ein Mesosystem ist somit ein System von mehreren Mikrosystemen« (Bronfenbrenner 1981, S. 41). In den äußeren Schichten, die als Makro- bzw. Exosysteme bezeichnet werden, finden sich neben gesellschaftlichen Aspekten wie beispielsweise medialen und kulturellen Einflüssen auch die erweiterte Familie oder die Nachbarschaft, die meist nicht unmittelbar auf das Kind einwirken, aber z. B. über den Kontakt mit den Eltern des Kindes indirekt Einfluss nehmen können (vgl. Lohaus & Vierhaus, 2015).
In ökologischen Modellen wird angenommen, dass distale Faktoren, die weiter vom Individuum entfernt sind, eine weniger wichtige Rolle einnehmen als proximale und damit näher positionierte Faktoren. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass der Einfluss der distalen Faktoren durch proximale Faktoren vermittelt wird. Somit schlagen sich die distalen Faktoren in den proximalen nieder, welche dann wiederum unmittelbar Einfluss auf die kindliche Entwicklung nehmen. Diese Annahme trifft nicht nur auf die Beziehung der verschiedenen Ebenen untereinander zu, sondern auch auf die Beziehungen innerhalb des Mikrosystems Familie.
Distale und proximale Faktoren
Distale und proximale Faktoren in der ökologischen Theorie unterscheiden sich durch ihre Nähe zu einer Person und damit auch in ihrer Bedeutung für sie. Während distale Faktoren eine größere Distanz aufweisen und somit meist nur indirekt auf die Person einwirken sind proximale Faktoren sehr nahe an der Person und nehmen häufig direkt und unmittelbar Einfluss auf die Person und ihre Entwicklung.
Auch innerhalb des Mikrosystems Familie lassen sich distale Hintergrundmerkmale (wie beispielsweise der sozioökonomische Status, SÖS) von proximalen Prozessmerkmalen (wie beispielsweise den unmittelbaren Eltern-Kind-Interaktionen) abgrenzen. Bronfenbrenner hat sein Modell im sogenannten Process-Person-Context-Time-Modell (PPCT-Modell) weiterentwickelt (Bronfenbrenner & Morris, 2006), welches davon ausgeht, dass die proximalen Prozesse die »Motoren der Entwicklung« darstellen.
Process-Person-Context-Time-Modell (PPCT-Modell)
Das PPCT-Modell greift die ökologische Theorie auf und erweitert diese um den Kontext Zeit und Entwicklung, was sich in sogenanten Prozessmerkmalen widerspiegelt.
Diesen proximalen Prozessmerkmalen lässt sich die häusliche Lernumwelt zuordnen, da es sich bei ihr im Schwerpunkt um tagtägliche Interaktionen zwischen Haushalts-/Familienmitgliedern und dem Kind handelt, die die kindliche Kompetenzentwicklung unterstützen (Niklas, 2015; Lehrl, 2018).
2.2.2 Der soziologische Ansatz von Bourdieu
Ein weiterer wichtiger Bezugsrahmen im Kontext der HLE geht auf den soziologischen Ansatz von Bourdieu (z. B. 1983) zurück. Er unterscheidet drei verschiedene Arten von Kapital, die einem Menschen in unterschiedlichem Ausmaß zur Verfügung stehen und von ihm genutzt werden können:
1.
ökonomisches Kapital, welches unmittelbar und direkt in Geld umwandelbar ist, z. B. Besitztümer wie Wohnungseigentum,
2.
soziales Kapital, bestehend aus sozialen Netzwerken, Beziehungen und Verpflichtungen, die eingegangen wurden,
3.
kulturelles Kapital, worunter alle Kulturgüter sowie die kulturellen Ressourcen einer Familie verstanden werden.
Das kulturelle Kapital lässt sich wiederum nach Bourdieu (1983) noch einmal in drei unterschiedliche Bereiche untergliedern:
1.
inkorporiertes Kapital als dauerhafte Dispositionen, wie kulturelle Fähig-, und Fertigkeiten sowie Kenntnisse und Wissensformen, die über Zeitinvestitionen angeeignet wurden;
2.
objektiviertes Kapital in Form von kulturellen Gütern wie Büchern, Lexika, Instrumenten oder Maschinen. Eng verbunden mit dieser Form des kulturellen Kapitals ist dabei die Fähigkeit, diese Güter auch effektiv anwenden und nutzen zu können;
3.
institutionalisiertes Kapital in Form von schulischen oder akademischen Titeln, die wiederum für bereits erworbene und erlernte Fähigkeiten und Kenntnisse stehen.
Im Kontext der Forschung zur häuslichen Lernumwelt ist insbesondere das objektivierte Kapital hervorzuheben, das einen wichtigen Aspekt der häuslichen Lernumwelt darstellt (vgl. z. B. McElvany et al., 2009; Niklas et al., 2013).
Kulturelles Kapital
Kulturelles Kapital bezeichnet nach Bourdieu verschiedene Formen von Kapitel, das sich auf Kulturgüter, kulturelle Ressourcen, aber auch kulturelle Fähigkeiten bezieht, welche von einer Person bereits dauerhaft erworben wurden. Damit umfasst es also sowohl Güter wie Bücher oder Instrumente als auch akademische Titel und kulturelle Fähigkeiten, die eine Person sich über Zeitinvestition angeeignet hat und die ihr nun zur Nutzung zur Verfügung stehen.
Neuere Arbeiten, die die Ideen Bourdieus und Colemans rezipieren, trennen Aspekte der kulturellen Ressourcen (oder bei Baumert & Schümer, 2002 »kulturelle Besitztümer«) von Merkmalen der kulturellen Praxis (z. B. McElvany et. al, 2009).
Kulturelle Praxis
Unter kultureller Praxis können proximale und prozessuale Merkmale einer Familie verstanden werden, die die Häufigkeit und auch die Qualität von kulturellen Aktivitäten umschreiben. Hierzu können beispielsweise (Vor-)Leseaktivitäten oder das Spielen von Würfel- und Rechenspielen in der Familie gezählt werden.
Damit tragen sie dem Umstand Rechnung, dass es kulturelle Ressourcen in der Familie gibt, die sich in eher strukturelle Merkmale, wie z. B. Buchbesitz, und in prozessuale Merkmale, wie die Häufigkeit gemeinsamer kultureller Aktivitäten untergliedern lassen (z. B. Lesen und Vorlesen, Geschichten erzählen, Wort-, Würfel- oder Zahlenspiele spielen, Büchereibesuche oder auch die Kommunikation über Gelesenes oder im Kontext von Zahlen; vgl. Niklas et al., 2013; Niklas & Schneider, 2012; Retelsdorf & Möller, 2008). Eine zentrale Annahme ist dabei, dass Effekte der sozialen Herkunft auf die Kompetenzentwicklung durch diese Ressourcen vermittelt werden (McElvany et al., 2009).
2.2.3 Vygotskis soziokulturelle Theorie
Vygotskis soziokulturelle Theorie (z. B. 1978) erachtet gelungene interpersonelle Interaktionen als zentrale Voraussetzung für die kindliche Denkentwicklung. Kindliche Kognitionen werden hierbei v. a. dann gefördert, wenn Individuen mit Wissensvorsprung (z. B. Eltern) gemeinsame Aktivitäten mit Individuen mit geringerem Wissen (z. B. Kindern) so organisieren, dass Letztere davon profitieren und Lernen initiiert wird. Diese Art der Organisation von gemeinsamen Aktivitäten wird in den Konzepten »Guided Participation (gelenkte Partizipation)« (Rogoff, 1998), »Scaffolding« (Wood et al., 1976) und »Sustained Shared Thinking« (Siraj-Blatchford et al., 2003) deutlich.
Guided Participation
Guided Participation erweitert die Gedanken Vygotskis und stellt eine symmetrische Interaktion in den Mittelpunkt (Rogoff, 1986). Dieser Interaktion liegt eine Intersubjektivität zugrunde, die einen gemeinsamen Fokus und ein gemeinsames Ziel der beiden am Interaktionsprozess beteiligten Akteure umfasst (Rogoff, 1990). Im Mittelpunkt steht dabei die Teilhabe des Kindes an einer kulturellen Praxis, die durch die Lenkung eines kompetenten Anderen unterstützt wird. Beide Akteure sind jedoch an dieser Lenkung beteiligt und beide gestalten auch diesen Prozess.
Scaffolding
Scaffolding (engl. »Gerüst«) bezeichnet allgemein die Unterstützung von Lernenden bei der Bewältigung von (Entwicklungs-)Aufgaben. Diese Unterstützung liegt idealerweise eine Ebene über derjenigen, auf der sich der Lernende aktuell befindet. Nach Wood und Middleton (1975) verfügen Kinder über einen »Sensibilitätsbereich«, der als Grad der »Bereitschaft« für verschiedene Inputs definiert ist und im Wesentlichen den Unterschied zwischen den beobachteten und den potenziellen Fähigkeiten der Kinder darstellt. Wood et al. (1976) beschreiben sechs Schritte, die idealerweise im Prozess des Scaffolding vorkommen: Wecken von Interesse, Vereinfachung der Aufgaben, Aufrechterhaltung der Richtung, Markierung kritischer Merkmale, Frustrationskontrolle und Demonstration. Die Unterstützung ist nur vorübergehend: Mit steigender Kompetenz der Lernenden wird das »Gerüst« sukzessive reduziert und entfällt schließlich.
Sustained Shared Thinking
Sustained Shared Thinking bezeichnet eine pädagogische Interaktion, bei der zwei oder mehr Personen auf intellektuelle Weise »zusammenarbeiten«, um ein Problem zu lösen, ein Konzept zu klären, Aktivitäten zu bewerten oder eine Erzählung zu erweitern. Dies kann auch zwischen Peers erreicht werden (Siraj-Blatchford et al., 2003).
Eltern fungieren als Unterstützer der kindlichen Lernprozesse, indem gemeinsame Gespräche, Spiele, Interaktionen optimalerweise so gestaltet werden, dass Kinder eine leicht über ihrem Kompetenzniveau angesiedelte Unterstützung erfahren, die ihnen eine Erweiterung ihres Wissens, ihrer Fähig- und Fertigkeiten ermöglicht.
Im Rahmen der soziokulturellen Theorie spielen zudem die folgenden Konzepte eine wichtige Rolle für das kindliche Lernen:
Intersubjektivität, also das wechselseitige Verstehen und Interagieren in der Kommunikation zwischen Menschen. Kinder können nur dann etwas von anderen lernen, wenn die Aufmerksamkeit gemeinsam auf den gleichen Lerninhalt gerichtet wird. Dabei wird eine geteilte Aufmerksamkeit hergestellt. Wichtig, insbesondere in den ersten Lebensjahren, ist in diesem Zusammenhang auch das soziale Referenzieren, bei dem versucht wird, die Aufmerksamkeit des Gegenübers durch entsprechende Gesten auf einen bestimmten Gegenstand oder eine bestimmte Situation zu lenken.
Soziale Unterstützung, also der unterstützende Rahmen, den Erwachsene ihren Kindern während der Interaktion zur Verfügung stellen. Bildlich gesprochen bieten Eltern dabei ihren Kindern das Gerüst während des Hausbaus. Die eigentliche Lernleistung wird zwar vom Kind vollbracht, aber dazu benötigt es die Unterstützung der Eltern, die beispielsweise Hinweise zur Bewältigung der Aufgabe geben. Bei solchen Aufgaben kann es sich sowohl um motorische Leistungen wie das Fahrradfahren lernen als auch um kognitive Leistungen wie das korrekte Abzählen einer Menge handeln.
Zone nächster Entwicklung (Zone of proximal development): Dieses Konzept umschreibt den Bereich einer Aufgabenanforderung, der zwischen der Schwierigkeit liegt, die das Kind gerade noch ohne Unterstützung vs. mit optimaler sozialer Unterstützung erfolgreich bewältigen kann. Verdeutlicht wird dies in Abbildung 2.2.
Abb. 2.2:Modell zu Vygotskis »Zone of proximal development« am Beispiel der Abzählleistungen von zwei Kindern
Die Abbildung verdeutlicht die »Zone of proximal development« für die Abzählleistungen zweier Kinder A und B. Während Kind A beispielsweise Bauklötze bis zu einer Menge von 10 korrekt und ohne Unterstützung abzählen kann, gelingt es dem gleichen Kind mit Hilfe eines Erwachsenen, der die Bausteine gemeinsam mit ihm abzählt, diesen Vorgang bis zum 15. Baustein korrekt auszuführen. Dieser Unterschied zwischen der maximalen Leistung ohne Unterstützung und der maximalen Leistung mit optimaler Unterstützung bezeichnet Vygotski als »Zone der nächsten Entwicklung«. Wenn in diesem Bereich geübt und gelernt wird, lassen sich die größten Wissenszuwächse erreichen. Die »Zone der nächsten Entwicklung« ist dabei nicht stabil und unveränderlich, sondern variiert zwischen verschiedenen Kindern auf unterschiedlichem Entwicklungsstand (z. B. Kind A und Kind B in ▸ Abb. 2.2) und verändert sich auch für ein einzelnes Kind, wenn dieses neue Kompetenzen erwirbt.
Zone der nächsten Entwicklung