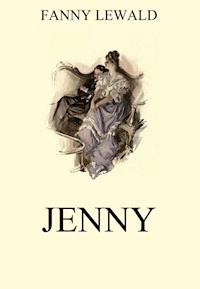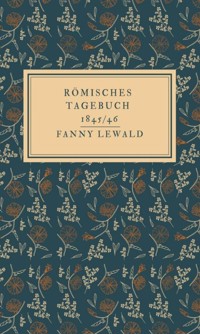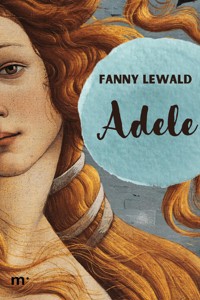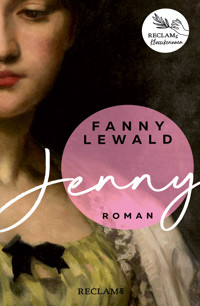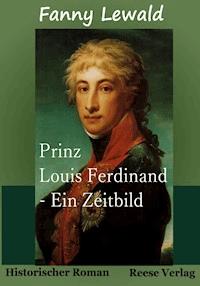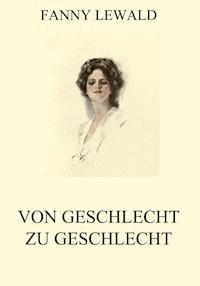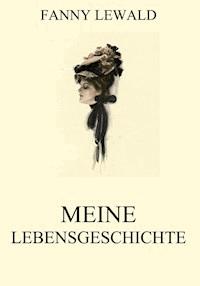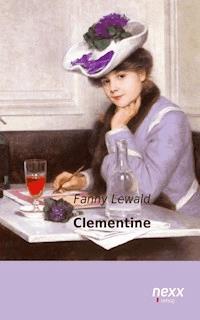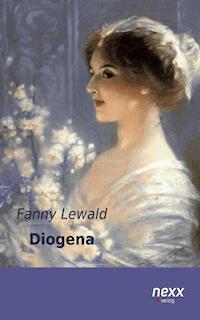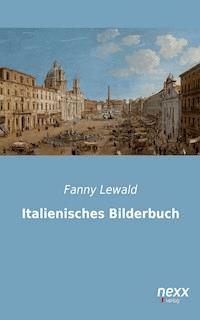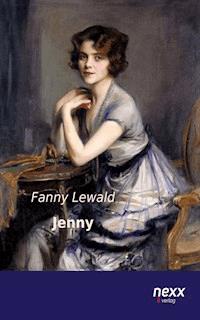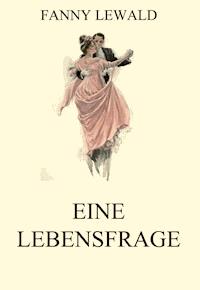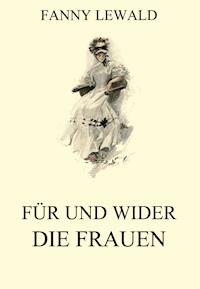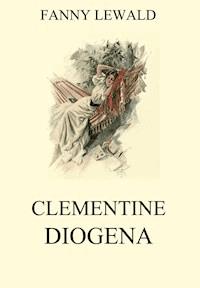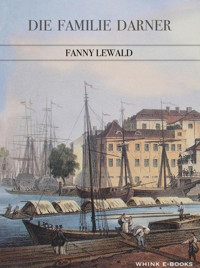
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: whink e-books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
FannyLewalds Roman»Die Familie Darner«(1887) spielt in derZeit der Napoleonischen Kriegeund handelt vom Leben der gleichnamigen Kaufmannsfamilie in Königsberg. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen der Krieg gegen die Franzosen, die konfliktreiche Beziehung zwischen Adel und Kaufleuten, die Rolle der Frau und der tief verwurzelte Antisemitismus. In diesem umfangreichen Altersroman — rund tausend Seiten in der Druckfassung — erreichtLewaldwohl den Höhepunkt ihrer Romankunst, wie Heinrich Spiero damals feststellte. – Mit einem Nachwort von Wolfgang Hink.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Familie Darner
Roman in drei Bänden
Fanny Lewald
Berlin: Verlag von Otto Janke 1887
IMPRESSUM | COPYRIGHT
whink e-Books unterliegen (außer in den gemeinfreien Teilen) den Urheber- und Leistungsschutzrechten, insbes. dem § 70 des UrhG. Die Nutzung dieses e-Books ist ausschließlich zu privaten Zwecken erlaubt; es darf ansonsten weder neu veröffentlicht, kopiert, verteilt, vertrieben noch irgendwie anders verwendet werden ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung. © 2025 whink e-Books10555 Berlin | Elberfelder Str. 12whink44@posteo.de
Inhalt
Band 1
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebenzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Band 2
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebenzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Sechsunddreißigstes Kapitel
Siebenunddreißigstes Kapitel
Achtunddreißigstes Kapitel
Neununddreißigstes Kapitel
Vierzigstes Kapitel
Einundvierzigstes Kapitel
Band 3
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Anmerkungen
Nachwort
Zu diesem E-Book
Band 1
[1-I]
SeinerKöniglichen HoheitdemGroßherzog Karl Alexandervon Sachsen.
[1-II]
Königliche Hoheit!
Nahezu vier Jahrzehnte sind vergangen, seit Sie im Herbste des Jahres 1848 mir die Ehre erwiesen, mich aufzusuchen, als ich mich für ein paar Tage in Ihrem Weimar aufhielt, und gleich jenes erste Begegnen hat in Ihnen wie in mir, die Theilnahme an einander und jenes Zutrauen zu einander erweckt, die vorgehalten haben und gewachsen sind in dem langen Laufe der Zeit.
Weit von einander abgetrennt durch unsere äußeren Lebensverhältnisse, haben wir, jeder auf seinem Platze, in den Wandlungen, welche sich in dem Vaterlande und in der ganzen Welt vollzogen, auch eigene Wandlungen in uns mit durchzumachen gehabt; aber über diese hinaus, haben wir uns stets zusammengefunden in dem ehrlichen Streben nach Erkenntniß des Rechten, im Trachten nach dem Guten und dem Schönen, in der Liebe zu dem deutschen Vaterlande.
[1-III] So lege ich denn, Königliche Hoheit! diesen Roman mit Ihrer Erlaubniß, jetzt als eine Erinnerung an diese lange gegenseitige Theilnahme in Ihre Hände. Er bewegt sich in Tagen, die weit hinter uns liegend, der Vergangenheit angehören, in denen aber jene Saat gestreut worden, aus welcher endlich das deutsche Reich erwachsen ist.
Möchte es mir gelungen sein, das Leben und die Gesinnung der Menschen in den Jahren von 1805–1813 zur klaren Anschauung zu bringen, und möchten mir auch für diese Dichtung Ihr Antheil und Ihre Zustimmung nicht fehlen. Was dieselben mir werth sind, wissen Sie Königliche Hoheit!
In tiefer, herzlicher Verehrung Ihrer Königlichen Hoheit! Berlin 1887. Fanny Lewald-Stahr.
[1-1]
Erstes Kapitel
Im Jahre 1803 erschien an einem Donnerstag, der ein Posttag war, unter den anderen Fremden ein Herr Lorenz Darner an der Königsberger Börse, den kein Geringerer einführte als Konrad Samuel Kollmann selber, der erste und reichste Handelsherr der Stadt und der Provinz.
Die Zeiten für den Kaufmann waren damals schwierig und drohend. Die Welt war seit den amerikanischen Freiheitskämpfen durch die französische Revolution und die ihr folgenden Kriege in ihren Tiefen aufgeregt, und Ruhe war nirgend mehr zu finden, selbst da nicht, wo man, wie in Preußen, augenblicklich noch in Frieden lebte.
Die Schifffahrt war unsicher geworden. Der Landverkehr war heute hier, morgen dort durch die Kriege gehindert, während doch eben der Krieg bald sehr große, unvorherzusehende Bedürfnisse erzeugte, also große, unerwartete, gewinnbringende Geschäfte nöthig machte und bald wieder wohl berechtigte Unternehmungen plötzlich über den Haufen warf. Die eigentliche Regelmäßigkeit des Geschäftsbetriebes hatte aufgehört, und die Verhältnisse wurden noch schwieriger durch die damalige Mangelhaftigkeit der Verkehrsmittel.
[1-2] Von täglich abgehenden Posten war noch keine Rede. Die Zeitungen, welche zweimal wöchentlich mit der Post von Berlin nach Königsberg gelangten, waren immer viele Tage alt, und häufig waren ihre Nachrichten durch die rasch einander folgenden Ereignisse überholt, abgesehen davon, daß sie unter strenger Zensur keineswegs verläßlich waren.
Dem Glauben, dem Vermuthen war damit ein weites Feld gelassen. Wer einigermaßen sicher gehen wollte, mußte sich von dem Stande der Dinge an Ort und Stelle überzeugen, mußte sich durch Estafetten Nachrichten verschaffen, und es waren also damals mehr Kaufleute und mehr Vertrauenspersonen derselben unterwegs und an den Börsen der Handelsstädte anzutreffen, als jemals in früheren Jahren.
Wie verschieden die Einzelnen aber die Zustände auch ansehen mochten, je nachdem ihre politische Meinung oder ihr persönlicher Vortheil ihnen dieses oder jenes Ereigniß wünschenswerth erscheinen ließ, und je nachdem sie die auswärtigen Verhältnisse durch den Augenschein kannten oder nicht kannten, darin stimmten Alle überein, daß selbst die ausgesprochene Friedensliebe des jungen Königs von Preußen den großen Weltenbrand, den Napoleon angefacht hatte, nicht werde verhindern können, auch Preußen zu ergreifen, und daß man schon jetzt wie auf einem Vulkan lebe.
Mit Spannung trat man an der Börse den Großhändlern entgegen, von denen man wußte, daß sie durch Estafetten mit ihren Geschäftsfreunden verkehrten; und jeder von auswärts, sei es von Westen oder Osten kommende Reisende war ein Gegenstand der Beachtung, um der Nachrichten willen, die er haben, der Auskunft wegen, die man von ihm zu erlangen hoffen konnte.
[1-3] Unbestimmte Gerüchte von neuen Zerwürfnisse zwischen England und Frankreich, von bevorstehend Veränderungen in der französischen Staatsverfassung, von der Wahrscheinlichkeit, daß man den ersten Konsul zum Kaiser ausrufen werde, gingen eben an jenem Donnerstag an der Börse von Mund zu Mund, als Lorenz Darner an Konrad Kollmanns Seite in die Börse eintrat, und von diesem verschiedenen seiner Freunde vorgestellt wurde.
Kollmann nannte leichthin die großen Amsterdamer und Londoner Firmen, durch welche Darner bei ihm eingeführt worden, und dieser fand eine um so bereitwilligere Aufnahme, als Kollmann bemerkte, daß jene Häuser Herrn Darner als einen sehr weitsichtigen, sehr gewiegten Mann bezeichnet, mit welchem sie durch eine Reihe von Jahren in bedeutender und erfolgreicher Geschäftsverbindung gestanden hätten.
Die Art jener Geschäfte war jedoch nicht bezeichnet. Ebensowenig war es ausgesprochen, zu welchem Zwecke sich Darner nach Preußen begeben und an Kollmann hatte empfehlen lassen. Auch ob er selbständig etablirt oder zu einem jener auswärtigen Häuser gehörend sei, und wo er bisher gelebt hatte, war aus den Empfehlungsbriefen nicht ersichtlich.
Ein Haus Lorenz Darner war in der Handelswelt nicht bekannt. Bei solchen Empfehlungen, wie sie ihm zur Seite standen, wäre aber ein dringendes Fragen unter Kaufleuten, die sich respektiren, nicht am Platze gewesen. Kollmann nahm also an, daß Darner dem Hause Hope in Amsterdam, auf das er sich besonders bezog, bisher als schweigender Partner angehört habe, und wartete mit schicklicher Zurückhaltung auf das, was Darner selber von sich aus [1-4] sagen oder was man zu fragen berechtigt sein werde, sobald es sich um den wirklichen Abschluß von Geschäften handeln würde.
Sein Name bezeichnete ihn als einen Deutschen, obschon er die Haltung und die Manieren eines Engländers hatte und das Deutsche mit fremdländischem Anklang sprach. Als man dies, nachdem er einige Tage die Börse besucht, gegen ihn bemerkte, erwiderte er, das sei leicht möglich. Er habe Deutschland jung verlassen, sei erst vor wenigen Jahren wieder einmal auf deutschen Boden gekommen, um in Karlsbad eine Kur zu gebrauchen. Darnach habe er sich eine Weile in Deutschland umgesehen, sei auch in Preußen und sogar ein paar Tage in Königsberg gewesen, jedoch ohne die Börse zu besuchen.
Wie dann sich Jemand die Frage erlaubte, was ihn so weit gen Nordosten geführt, hatte er mit Achselzucken entgegnet:
»Eine Grille oder nennen Sie es eine Selbsttäuschung. Ich hatte mich in Karlsbad von den Folgen eines Fiebers zu erholen, das mich in der Havanna befallen und stark mitgenommen hatte. In meiner Hypochondrie war ich auf den Gedanken gekommen, mich nach langer, ruheloser Arbeit ganz von den Geschäften zurückzuziehen und es mit dem Landleben zu versuchen. Preußische Gutsbesitzer, mit denen ich in Karlsbad bekannt geworden, hatten mir den Rath gegeben, mich für diesen Fall in Ostpreußen umzuthun, und mich dabei auf die Güter der erloschenen Familie von Wiekau aufmerksam gemacht. Diese nur sechs Meilen von Königsberg in der Nähe von Pillau am Meere gelegenen Güter, die Ihnen wohl bekannt sein werden, habe ich damals an mich gebracht und eine Weile in Strandwiek gelebt.«
[1-5] »Und Sie haben sie wieder verkauft?«, fragte Kollmann, der hinzugetreten war.
»Nein«, entgegnete Darner gleichmüthig, »ich besitze sie noch. Sie haben den Vorzug, in angenehmer Umgebung nahe am Meere zu liegen, dessen Anblick ich auf die Länge nicht entbehren kann, und sie rentiren doch einigermaßen. Es würde unter gewissen Bedingungen eine hübsche Kolonie dort zu gründen sein. Aber ich habe dem Landleben auf die Dauer keinen Geschmack abgewinnen können. Ich bin eben Kaufmann, bin an eine anspannende Thätigkeit gewöhnt, und ich möchte mich darüber unterrichten, ob Königsberg für mich ein geeigneter Platz sei. Falls sich das herausstellt, könnte ich hier arbeiten und meine Absichten mit Strandwiek doch als eine Liebhaberei zur Ausführung bringen; denn die Strecke von sechs, sieben Meilen, von hier bis dorthin, ist mit untergelegten Pferden leicht zu bewältigen.«
Nun hatte man plötzlich einen festen Anhalt, und Darner gewann dadurch noch an Bedeutung. Die Güter, deren er als einer unbedeutenden Sache, als einer Liebhaberei, erwähnte, waren ein großes herrschaftliches Besitzthum. Man entsann sich, vor ein paar Jahren gehört zu haben, daß ein Fremder, ein Engländer, sie gekauft, der einige Monate dort in dieser Einsamkeit verlebt hatte, dann fortgegangen, nicht wiedergekehrt war, und die Güter durch einen Inspektor verwalten lasse, der seinen Herrn als einen Sonderling bezeichne.
Nach einem Sonderling sah jedoch Lorenz Darner ganz und gar nicht aus.
Er war ein Mann gegen das Ende der vierziger Jahre. Groß, breitbrüstig, von starkem Knochenbau, war er unverkennbar auf ein langes Leben [1-6] angelegt. Dem tüchtigen, wohlgetragenen Körper entsprach das kluge, wettergebräunte Gesicht mit der hohen, von schwarzem Haar umrahmten Stirne, mit dem starken Backenbart, mit den dunklen, mächtigen Augen. Die kräftige Nase, das starke Kinn und der wohlgeformte Mund, hätten Darner das Recht gegeben, für einen schönen Mann zu gelten, wäre der Ausdruck seiner Mienen nicht ein so stolzer und kalter gewesen. Zu übersehen war der Mann jedoch nie und nirgends; und weil er sich nach diesen Mittheilungen in seiner Zurückhaltung beständig gleich blieb, während man sah, daß er in Königsberg festen Fuß zu fassen beabsichtigte, beschäftigte sich die Neugier um so mehr mit ihm.
Er war durch Kollmann in die Kaufmannsressource eingeführt, war, als im Herbste die Geselligkeit wieder in den Familien ihren Anfang nahm, in den besten Häusern bekannt und aufgenommen worden. Er selber hatte in dem ersten Gasthofe der Stadt eine ansehnliche Wohnung inne, hielt einen eigenen Diener, und hatte sich ein paar englische Reitpferde von Strandwiek kommen lassen, die er in den Stallungen des Hotels sorgfältig untergebracht. Man sah ihn täglich ausreiten, täglich an der Börse. Man wußte, daß er über den Sonntag regelmäßig auf sein nahe bei Pillau gelegenes Gut oder gelegentlich auch nach Pillau selbst, dem Seehafen von Königsberg, hinausfuhr, wo er ebenfalls wohl empfohlen und akkreditirt war und wo er mit Rhedern, Schiffsmaklern und Kapitänen in Verkehr trat.
Da man sich aber von den Leuten, mit denen man zu thun hat und gesellschaftlich umgeht, ein festes Bild zu machen liebt, hätte man Genaueres von Darner wissen mögen als das, was man seinen Aeußerungen im Gespräch zu entnehmen vermochte.
[1-7] Es war klar, er kannte fast das ganze Europa. Er war in Afrika gewesen, hatte in Nordamerika, in Mexiko, in Brasilien und in Westindien verschiedentlich gelebt, und das wollte im Anfang dieses Jahrhunderts mehr als jetzt bedeuten. Ob er von Hause aus ein reicher Mann gewesen, ob er sein Vermögen in Handelsgeschäften während seiner Reisen erworben, welche Arten von Geschäften er gemacht; habe, darüber ließ er sich nur selten, nur flüchtig aus, wenn es darauf ankam, den Erfolg eines geplanten Geschäftes nach seiner Einsicht zu beurtheilen. Da die große kaufmännische Allianz, in welcher in jener Zeit die Häuser von Francis Baring in London, von Hope und Labouchere in Amsterdam, von Parish in Hamburg arbeiteten, ihn zu ihren Geschäftsfreunden zählten, mußte er ebenso sicher mit den Kolonial- wie mit den Getreide- und Bankgeschäften in ihrem größten, den ganzen Welthandel umfassenden Stile vertraut sein. Indeß auf die sehr natürliche, an ihn persönlich gerichtete Frage, in welchem Zweige er denn in Königsberg zu arbeiten beabsichtige, hatte er erklärt, daß er darüber selber noch gar keine Meinung, geschweige denn eine Entschließung haben könne. Er sei ja vorläufig nur gekommen, sich umzusehen, in wie weit Königsberg als Zwischenstation zwischen dem Osten und dem Westen zu, benützen sei; und nach der Einsicht, welche er darüber sich bilden werde, werde er entscheiden können, ob er bleiben oder ob er sich in Memel oder Riga das Feld für eine ersprießliche Thätigkeit zu suchen haben werde.
Die Frauen ihrerseits machten sich mit seinem Privatleben zu schaffen. Aus manchen kleinen Provinzialismen meinten sie folgern zu dürfen, daß er aus dem Norden von Deutschland stammen müsse. [1-8] Gegen Frau Kollmann hatte er einmal von einem Sohne gesprochen, den er in England habe, von Töchtern, die er in der Schweiz erziehen lasse. Aber auch über diese Kinder erfuhr man nichts Bestimmtes; und da er seiner Frau niemals gedachte, so hatte sich schließlich, man konnte nicht sagen wie, der Glaube in der Gesellschaft herausgestellt, daß Darner von deutschen Eltern, vermuthlich von kleinen Leuten, wahrscheinlich von Hanseaten, abstamme und daß er ein selbstgemachter Mann und Wittwer sein müsse. Damit gab man sich vorläufig zufrieden und ließ auch ihn in Ruhe.
Zweites Kapitel
Während dessen ging Darner im Laufe des Herbstes und Winters vorsichtig und gelassen seinen Weg. Er war zweimal an der Grenze, war über diese hinaus, in Riga, Petersburg, Moskau und in Warschau gewesen, war wieder zurückgekommen und hatte darnach gegen Kollmann erklärt, daß er in Königsberg zu bleiben gedenke.
Um das Frühjahr hin ward es bekannt, daß er seine Niederlassung betreibe und das Bürgerrecht wie die Aufnahme in die Kaufmannschaft nachsuche. Kollmann, der großes Wohlgefallen an Darner hatte und Zutrauen zu ihm hegte, weil er selber ein bedeutender und im Großen arbeitender Mann war, freute sich des und war ihm dabei behilflich. Weit entfernt, wie die kleineren Firmen die Konkurrenz eines solchen Großhändlers zu scheuen, war er der Meinung, daß das Etablissement großer Häuser, daß selbst die Anwesenheit von bedeutenden Kom[1-9]manditen solcher Häuser dem Platze eine Förderung seien; und da man für die Zuvorkommenheit eines Mannes gegen den andern immer nach einem Grunde verlangt, sagte man bald, Kollmann sei durch Darner in engeren Verkehr mit jenen Weltfirmen getreten und biete ihm deshalb die Hand, was Kollmann abzulehnen keinen Anlaß hatte, da es seinem ohnehin großen Kredite nur zu statten kommen konnte.
Kurz vor der Eröffnung der Schifffahrt hörte man, daß Darner den »großen Christoph«, den größten am Pregel gelegenen Speicher der Stadt, zu einem sehr hohen Preise erstanden habe, während er noch um drei andere Speicher in Unterhandlung stehe, die er zu miethen beabsichtige; und damit war es auch noch nicht genug. Denn wenige Tage nach Ostern erzählte an der Börse Kollmann einem seiner näheren Bekannten, daß er am verwichenen Abende das Haus seines verstorbenen Schwagers, das alte Willberg’sche Stammhaus, mit der ganzen Einrichtung an Lorenz Darner verkauft habe.
»Viel auf einmal«, sagte man an der Börse, »aber der Mann muß wissen, was er thut!« Und da Darner seine Ankäufe sofort mit Wechseln erster Qualität bezahlte, war man doppelt geneigt, seiner richtigen Einsicht zu vertrauen.
Nur der alte Makler, mit welchem Kollmann am meisten arbeitete, erlaubte sich scherzend die Frage, ob Darner in der Hast seines Kaufens vielleicht auch die bisherige Besitzerin und Bewohnerin des Hauses, des seligen Gotthard Willberg Tochter und deren Erzieherin, Mademoiselle Willbern und Madame Göttling, mit dem übrigen Inventarium an sich gebracht habe.
Kollmann, der an dem Morgen gut aufgelegt war, ließ sich den Scherz gefallen.
[1-10] »Theilweise«, entgegnete er dem Makler, »theilweise, und, wenn Sie wollen, auf meinen Antrieb, denn wir machen Beide ein gutes Geschäft dabei. Darner wollte das Haus haben und hatte darin Recht, denn er gewinnt damit gleich einen anständigen Boden unter den Füßen, das respektabelste Haus im ganzen Kneiphof, das beste Komptoir mit großen Nebenräumen. Die Göttling aber, die bei ihm bleiben wird, habe ich ihm zugeschanzt. Er bekommt in ihr eine verläßliche Person, die zu dem Hause hält wie die gelben Katzen, die man anderwärts auch nicht so schön findet wie in dem Hause; und ich werde die Hausverwaltung und die Göttling los!«
»Und wo bleibt Mamsell Willberg?«, fragte der Makler.
»Meine Nichte ist sechzehn Jahre, sie muß unter Menschen, in die Gesellschaft, sie kommt also zu uns. Die Göttling wäre bei uns das fünfte Rad am Wagen gewesen, und wir hätten sie doch nicht gut entfernen können, obschon sie von meinem verstorbenen Schwager wohl versorgt ist. Mit Darner ist das etwas Anderes. Will der Mann sie einmal nicht mehr haben, so schickt er die Göttling eben fort wie jede andere bezahlte Person; und das hätte ich, da sie die sechzehn Jahre neben meiner Nichte gewesen ist, nicht so ohne Weiteres thun können.«
»Freilich, freilich«, meinte der Makler, »solche alte Inventarienstücke sind immer unbequeme Möbel! Ich habe da in meiner Familie …«
Er brach ab, denn Kollmann hatte ihn stehen lassen und sprach mit einem andern. Was sein Makler in seiner Familie hatte oder nicht hatte, war ihm einerlei. Er hatte für sein Mündel und für sich ein gutes Geschäft gemacht, hatte Alles eingeleitet, wie’s ihm paßte. That das nur ein Jeder [1-11] mit Besonnenheit am rechten Platze und zur rechten Zeit, so brauchte man die Anderen nicht, brauchte sich auch nicht um sie zu kümmern, konnte sie ihres Weges gehen lassen und den seinen gehen, sein Makler so wie er.
Aber die Nachricht, daß das alte Willberg’sche Haus, und noch obenein an Darner, an einen Fremden, verkauft sei, sprach sich als eine unerwartete Neuigkeit an der Börse rasch herum, denn es war in der That das schönste unter den alten Königsberger Häusern. Hätte man an die Möglichkeit gedacht, daß Kollmann es verkaufen könne, daß er nicht wenigstens es abwarten wurde, ob Justine sich nicht später den rechten Mann zu dem Hause wählen würde — und der und jener dachte dabei an seine Söhne oder Enkel und Neffen — so würde mancher es gern gekauft, mancher seine Frau gern hinter den großen, vielscheibigen Fenstern haben sitzen sehen; denn das Haus stellte an und für sich etwas vor, und das war kein Wunder.
Es bestand aus einem Vorder- und einem Hinterhause. Das erstere lag mit seiner drei Fenster breiten Front in der Langgasse, in der Hauptstraße des Kneiphofs, an der Ecke der Kaistraße, deren ganze Länge der Seitenflügel des Hauses einnahm, welcher das Vorderhaus mit dem am Pregelkai gelegenen Hinterhause verband, das niedriger, viel breiter und in späterer Zeit als das Vorderhaus gebaut, mit seinen sieben Fenstern nach dem Fluß hinaussah. Kein anderes Haus im Kneiphof hatte, wie dieses, einen kleinen Garten am Kai vor seiner Thüre, keines solche zwei Linden vor seinen Fenstern in der Langgasse; und wenn das Hinterhaus modischer erschien, so stellte das Vorderhaus sich in seiner alten Bauart würdiger dar. Fünfstöckig stieg es [1-12] mit hohem, vielgebogtem Giebel von dem steinernen, breit aufgetreppten, offenen Vorsprung stolz empor, über den man von der Straße in das Haus gelangte, und Alles an und in dem Hause war ebenso reich als tüchtig.
Die steinernen Einfassungen der Fenster, das Bildwerk zwischen den verschiedenen Stockwerken, die mit Köpfen gezierten Medaillons zwischen den Fenstern, die steinernen Vasen auf dem Giebel und zu seinen beiden Seiten waren unversehrt. Ueber der schweren Thür von Eichenholz, deren Messingklopfer blank wie Gold erglänzte, lagen der Merkur mit seinem Stabe und die Abundantia mit ihrem Füllhorn da, die Steinplatte beschützend, welche den Namen des Erbauers: Justus Gotthard Willberg über der Zahl des Jahres 1620 zeigte.
Schon die beiden vorhin erwähnten mächtigen Linden, die den Vorsprung beschatteten — sie waren die letzten in der ganzen Straße übrig gebliebenen — gaben kund, daß es lange her sein mußte, seit der Erbauer dieses Hauses sie davor gepflanzt hatte; und gleich den Bäumen konnte das Gebäude noch neue Jahrhunderte überdauern, sofern nicht die menschliche Willkür Hand daran legte.
Auch die innere Einrichtung des Hauses entsprach, wenn nicht mehr ganz der Zeit seiner Erbauung, so doch seiner Stattlichkeit. Die Jahre hatten das kunstvolle Schnitzwerk an den Treppengeländern und an den Wandschränken gebräunt; die Oelmalereien, welche über den Thüren und in die Thüren und Schränke eingefügt waren, hatten natürlich beträchtlich nachgedunkelt. Sie stimmten aber gut zusammen mit dem Holzwerk wie mit den schwerfälligen Stuckverzierungen an den Decken; und obgleich die Zimmer des Vorderhauses, in welchem Willberg hauptsächlich [1-13] gewohnt, nicht so ineinander gingen, wie es die neuen Ansprüche gern hatten, so mußte doch ein Jeder, der das Haus besuchte, eingestehen, daß es ein schönes Haus und recht dazu geeignet sei, einer zahlreichen Familie ein angenehmes Unterkommen darzubieten. Der einzelne konnte sich in den einzelnen Stuben der verschiedenen Stockwerke absondern nach Bedürfen, und die Empfangszimmer waren groß genug, den Hausbewohnern und ihren Gästen ein fröhliches Beisammensein zu ermöglichen.
Es war eben das Willberg’sche Haus gewesen, seit nahezu zweihundert Jahren und sollte nun mit einem Male das Darner’sche Haus werden. Das wollte den Leuten nicht in den Kopf!
Indeß gerade die Erbin und bisherige Besitzerin des Hauses, Justine Willberg, kam mit der Sache leichter zurecht als ihre Mitbürger. Nur die Trennung von der Frau, welche bei ihr Mutterstelle vertreten, da ihre rechte Mutter wenige Monate nach ihrer Geburt gestorben war, ging dem Mädchen nahe zu Herzen. Es hatte seit seines Vaters auch schon vor sechs Jahren erfolgtem Tode ganz allein mit Madame Göttling gelebt, und die Beiden hingen aneinander wie Mutter und Kind. Madame Göttling, eine verständige und gebildete Kaufmannswittwe, hatte sich aber stets gerühmt, daß sie Justine zu einem verständigen Mädchen erziehe, daß ihre Pflegebefohlene von der modischen Ueberspanntheit und Schwärmerei gar nichts abbekommen habe, und daß man sich zu ihr, wie sie zuversichtlich behaupten dürfe, alles Vernünftigen versehen dürfe. Nun hatte Justine zu beweisen, daß die Göttling sie nicht zu sehr gerühmt habe, und sie bewies es.
Sie fand Alles ganz in der Ordnung, wie ihr Onkel es eingerichtet, denn ohne daß man bestimmt [1-14] mit ihr von gesprochen, war sie in dem Gedanken erzogen worden, daß sie einmal ihres Vetters John Kollmanns Frau zu werden habe, der in Riga in dem dortigen Kollmannschen Geschäft arbeitete, an dessen Spitze er nach erfolgter Mündigkeit gestellt werden sollte.
John hatte ihr auch ganz gut gefallen, als er das letzte Mal in Königsberg zum Besuch gewesen war; und obschon es im Kollmann’schen Hause nicht mehr so gesellig und heiter herging als in den Zeiten, da die beiden nach Lübeck und Kopenhagen verheiratheten Töchter noch dort gelebt hatten, gab es in demselben doch immer noch viel Fremde und einen ganz andern Verkehr als in Justinens eigenem stillen Hause.
Justine hätte es also von sich nicht verständig gefunden, sich mit unnöthigen Gefühlen über das Scheiden aus dem alten Hause in Kosten zu setzen. Sie konnte in die beiden schönen, früher von ihren Cousinen bewohnten Zimmer, welche der Onkel ihr darbot, von ihren Sachen mit hinübernehmen, was ihr wohl gefiel. Sie wußte, daß eine reiche Waise, wie sie, sich zeitig zu verheirathen, daß ein schönes Mädchen, wie sie, wenn John ihr schließlich vielleicht nicht gefallen sollte, unter den Besten nur zu wählen habe; und wenn es ihr auch leid that, daß sie ihre gute Göttling künftig nicht mehr würde besuchen können, weil dieselbe in dem Hause eines unverheiratheten Mannes zu leben hatte, so stand dafür des Onkels Haus der mütterlichen Freundin zu allen Stunden offen. Und mehr sich selber überlassen zu sein, etwas mehr Freiheit zu haben als bisher, das kam Justinen auch nicht ungelegen.
Acht Tage nach dem Verkauf ihres Hauses siedelte sie also wohlgemuth zu ihrem Onkel über. [1-15] Obschon sie ihr Vaterhaus sehr lieb gehabt, machte es ihr doch Spaß, sich nun einmal in einer neuen, fremden und ihr doch eigenen Umgebung eingerichtet zu finden. Es belustigte sie, wenn die Göttling sie besuchen, wenn sie sehen kam, was Justine treibe, welche Kleidung sie angelegt. Es war ihr wunderlich, daß sie und ihre Göttling jetzt ganz Verschiedenes erlebten, daß sie sich so viel zu erzählen hatten. Und wie großer Kunstwerth einzelnen, alten Stücken und Geräthschaften in ihrem Vaterhause von den Besuchern desselben auch zugesprochen worden war, so hatte sie für ihr Theil dieselben altmodisch gefunden und oftmals gedacht, daß ihre Großmutter mit ihrer großen Dormeuse weit mehr dahinein gehört habe, als sie mit ihren weißen Kleidern und mit ihrem schönen, blonden, freiflatternden Gelock.
»Es hat eben Alles seine Zeit!«, sagte sie sich mit Behagen, wenn sie sich mit einem Lafontaine’schen Roman auf ihr Sopha legte, sich an den schönen Empfindungen der Liebenden zu erbauen. Die Zeit, welche sie unter Madame Göttlings ängstlicher Obhut verlebt hatte, war nun vorüber. Justine war flügge geworden und trotz all ihrer gerühmten Verständigkeit, hatte sie doch nicht übel Lust, nun endlich auch die farbigen Schwingen zu gebrauchen, mit welchen die jungen Herzen in den Romanen sich hinweghoben über die Alltäglichkeit des Lebens.
Daß es darnach Herrn Darner, dem sie bei ihres Onkels Gastgeboten und auch an dritten Orten oft begegnete, in ihrem ehemaligen Hause wohl gefiel, daß er ihre Göttling lobte, daß diese ihn als einen Mann bezeichnete, der niemals kleinlich sei, sondern wisse, was sich schicke, das Alles freute sie.
In der That aber hätten auch beide, Herr Darner und Frau Göttling, nicht besser für einander [1-16] passen können. Er war der rechte Herr für die auf Dienstbarkeit gestellte wackere Frau; und sie wiederum war ganz dazu geschaffen, bei den Leuten die gute Meinung zu erhöhen, welche Darners selbstgewisses Verhalten ihm einzutragen begann. Wer ihr zu befehlen verstand, den verehrte sie. Wer ihm unbedingt gehorchte, den wußte er zu schätzen, zu belohnen. Es machte sich Alles ganz vortrefflich.
Kaum ein Jahr nach seiner Ankunft war das Geschäft von Lorenz Darner bereits in vollem Gange, sein Name respektirt in der Leute Munde, und er betrieb das Geschäft mit einer Raschheit und Großartigkeit, von welcher man bisher in Königsberg noch kein Beispiel gehabt hatte. Er schien sich für seine Leistungen verdoppeln zu können.
Heute erfuhr man, er sei auf dem Wege nach Paris, und es währte nur einige Wochen, so kam er wieder zurück und hatte noch London und Amsterdam während seiner Abwesenheit besucht. Er erhielt und beförderte mehr Estafetten als die anderen alten Häuser sammt und sonders. Trotz der wachsenden Kriegsunruhen empfing er fortdauernd Nachrichten von allen Ecken und Enden, die sich immer als verläßlich erwiesen. Er zuerst hatte die Kunde von Napoleons Erhebung zum Kaiser erhalten. Er hatte von dem Einrücken der Franzosen in Hannover zuerst gewußt, und man konnte ihn sagen hören, daß die kaiserliche Eroberungspolitik nicht nur gegen England gerichtet sei, sondern daß sie viel weiter gehe, und daß ihre letzten Ziele immer deutlicher erkennbar würden.
Ueberall war man in der größten Aufregung und Spannung. Wie eine Geißel Gottes, wie ein zweiter Attila jagte Napoleon über die Erde hin, warf ihre Fürsten von den Thronen, würfelte neue [1-17] Staatenbildungen zusammen, hetzte die Völker, die in gutem Frieden arbeitsam gelebt, zu wildem Kampfe gegen einander, wie sein Ehrgeiz es erheischte; und verwirrt oder überwältigt und gelähmt staunten die einzelnen, wenn sie nicht sehr festen Sinnes waren, zu dem dämonischen Kaiser wie zu einem Meteor hinauf, von dem man nicht voraussehen kann, wohin es sich in seinem rasenden Fluge wenden, ob es vorüberziehen oder niederfallend zerschmettern werde, was der Fleiß der Menschen, was lange Jahre an Besitz geschaffen und als geheiligt anerkannt hatten.
Bewunderung und Haß gegen Napoleon wie gegen das Land, das er sich unterjocht und das in ihm das Sinnbild seiner neuen Größe feierte, erfüllten je nach ihrer Natur die Herzen der Menschen. Nirgends war man des nächsten Tages sicher. Jeder Augenblick konnte den Ausbruch eines Krieges auch für Preußen mit sich bringen.
Immer schneller einander folgend, passirten Kuriere, Feldjäger, diplomatische Agenten Königsberg und die Grenze. Vom Ausland in ihr Vaterland heimkehrende Russen, und viele vornehme Polen, die, mit Pässen auf falsche Namen gestellt, nach Frankreich gingen, verweilten flüchtig in Königsberg, ihre Geldgeschäfte zu ordnen. Sie trugen durch ihre Berichte nicht dazu bei, die Stimmung zu beruhigen. Bis in die engsten Kreise des Familienlebens hatte sich das Gefühl eingedrängt, daß große Umwälzungen vor der Thür stünden, daß man am Tage den Tag zu leben und ihn noch in Frieden möglichst zu genießen habe, da man des nächsten Tages so gar wenig sicher sein könne.
Selbst die Frauen, die sich sonst um die Zeitereignisse nicht viel zu kümmern, sondern still in ihrem Hause zu schalten oder ihren Vergnügungen [1-18] nachzugehen gewohnt waren, lernten es jetzt empfinden, was das Vaterland und seine Ehre für den Menschen zu bedeuten habe. Es war trotz der außerordentlichen Geschäftsthätigkeit und dem reichen Gewinn doch Niemand in den Kaufmannshäusern mehr geheuer. Man litt unter den Demüthigungen, welche Preußen schon seit Jahren erduldet hatte, man dachte mit Sorgen an die Verluste, die man erleiden konnte, man schauderte vor der Gefahr eines Krieges mit Frankreich und wünschte ihn schließlich doch herbei zur Ehre Preußens, da man in Erinnerung des alten Waffenruhmes auf einen glücklichen Ausgang desselben vertraute.
Kollmann, ein friedliebender Mann und wie ein gewiegter Mann gemessen in seinen Aeußerungen, weil er wußte, daß seine Worte beachtet wurden, hatte seines Zornes gegen den Korsen niemals hehl, wenn Darner bisweilen sich in Bewunderung Bonapartes zu ergehen liebte; denn Darner hob es gern hervor, wie im Leben Einheit des Willens und der Herrschaft die Hauptsache und die bewegenden Kräfte wären, und wie ganz anders die Welt sich gestalten würde, wenn eine einzige klare Einsicht ihr die Gesetze vorschriebe, so daß sie, in sich beruhend, nicht durch hunderte von unverständigen Sondergelüsten in ihrer Thätigkeit behindert würde.
Man schalt Darner wegen dieser gelegentlichen Bewunderung Bonapartes und legte sie ihm zur Last, da er sich doch selber als einen Deutschen gab und preußischer Unterthan und Bürger geworden war. Man machte Kollmann absichtlich auf diese bedenkliche Gesinnung Darners aufmerksam. Der wies solche Anschuldigungen jedoch zurück.
»Laßt ihn gehen, es hat Jeder die Fehler seiner Eigenschaften«, sagte er, »Jeder seinen Sparren! [1-19] Ein Mann, der in seinem ganzen Wesen etwas so Gewaltsames und Selbstgewisses hat wie dieser Lorenz Darner, macht sich seinen Götzen zurecht wie jeder Andere. Dafür wird er ihm vielleicht am härtesten fluchen, wenn dieser Götze ihm das Gewerbe durchkreuzt und nicht leistet, was er von ihm erhofft. Ich wollte, Bonaparte störte uns so wenig als Lorenz Darners Bewunderung für ihn.«
Wer aber Herrn Kollmann kannte, machte sich doch seinen Vers daraus, daß er sich das Kaufgeld für Justinens Haus bis auf den letzten Thaler hatte zahlen lassen und daß er es, wie das ganze Vermögen seiner Nichte und das Vermögen seiner Frau, im Auslande, in England, angelegt hatte.
Drittes Kapitel
Darner war klug genug, aus den an ihn gerichteten Fragen der Leute wie an ihren Bedenken die Meinung zu erkennen, welche sie von ihm hegten. Beeinflussen oder gar behindern und zurückhalten ließ er sich durch dieselbe nicht.
Man arbeitete in seinem Komptoir die halben Nächte durch. Neben dem Königsberger Hause hatte er in Pillau eine Filiale errichtet und einen von auswärts herübergekommenen Disponenten an deren Spitze gestellt. Er ging buchstäblich mit vollen Segeln vorwärts.
Die Verschiffungen, welche sein Haus in Getreide und anderen russischen Produkten nach England machte, waren außerordentlich groß; noch größer die Einfuhr von Manufaktur- und Kolonialwaaren, die [1-20] er unternahm. Speicher um Speicher, selbst leerstehende Häuser und Stallungen wurden gemiethet und belegt. Waarenmassen, welche über den bisherigen höchsten Bedarf des Landes hinaus, zugleich den jemals erhörten Absatz nach Polen und Rußland bedeutend überstiegen, wurden aufgestapelt; und wenn man Darners staunenswerthe Thätigkeit auch lobte, bei der er übrigens seine äußere Gemessenheit nie verlor, wenn man seine glänzende Gastfreiheit auch bereitwillig annahm, fing es doch an, den und jenen seiner Standesgenossen zu verdrießen, sich in der kaufmännischen Welt wie in der Gesellschaft durch einen fremden Eindringling, durch einen in Königsberg eben erst etablirten Mann in die zweite Linie, in den Schatten gestellt zu finden.
Man kam sich neben diesem Großhändler krämerhaft vor, wenn man es gegen einander auch nicht aussprach; aber als der Krieg immer sicherer herannahte, als vorsichtige Kaufleute ihre Unternehmungen einzuschränken, ihre Kapitalien so weit als möglich sicher zu stellen suchten, während Darner völlig sorglos zu sein und seine Geschäfte nur immer rascher auszudehnen schien, konnte man es von dem Einen oder Andern wohl vernehmen, Darner sei entweder ein Genie oder ein Narr, wenn nicht etwas Schlimmeres. Er spielte sein großes Spiel zwischen einem Millionär und dem Bankerott, denn nicht allein die Speicher, auch die Schiffe, die leichten Bordinger, nehme er, so weit er ihrer habhaft werden könne, in Beschlag, um das Lichten aus den großen Seeschiffen in Pillau und die Rückfracht nach den Schiffen ganz in seiner Hand zu haben; und ebenso sei es mit den Frachtfuhrleuten, mit denen er einen regelmäßigen Verkehr von und nach der Grenze eingerichtet habe. Wenn in dem einen Monat all seine Räume voll Kalikos [1-21] und Tuchen, voll Zucker und Kaffee gelegen hatten, so schüttete man im nächsten Monat die Böden hoch mit Roggen und Weizen auf, lagerte man Flachs, Hanf und Oel in den Räumen und entleerte sie wieder in die Bordinger, welche englische Fayence und Eisenwaaren von Pillau herübergebracht hatten.
Englische, holländische und russische Geschäftsfreunde, der Franzosen nicht zu vergessen, kamen und gingen unablässig. Es wurde im Darner’schen Hause unter Madame Göttlings bewährter Leitung fast offene und glänzende Tafel gehalten, und trotz Darners Bewunderung für Napoleons alles zusammenfassenden Herrschergeist wurden, ohne daß man das würdige Ansehen des Willberg’schen Hauses damit aufhob, englische Bequemlichkeit, englische Lebensweise und englischer Luxus in demselben so unmerklich eingeführt, russische Ausfuhrartikel so vielfach benützt, daß sogar Madame Göttling sich selbst und ihre bisherige Kleidung und Gewohnheiten allmälig umgemodelt fand, ohne recht sagen zu können, wie sich das an ihr vollzogen habe.
Das aber war es, was die Achtsamkeit und den Antheil der Frauen erregte und Darner immer wieder und unablässig zum Gegenstand der Unterhaltung und der Neugier für sie machte.
Die Göttling, welche bis dahin in bescheidener Stellung neben Justinen gelebt, wurde plötzlich gesucht, seit Darner es gewagt, zu seinen Mittagsbroden nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen einzuladen; und auch hier war es Kollmann gewesen, der seine Frau zuerst zu einem kleinen Essen zu Vieren mitgebracht.
Wenn dann die Göttling bei ihrer Justine vorsprach oder den weiblichen Gästen Darners den nöthigen Besuch erwiderte, so hatte man Mühe, in [1-22] der Dame, welche den feuerfarbenen englischen Shawl, wie es sich gehörte, in schönen Falten über den linken Arm geschlagen hatte, welche den feinen englischen Strohhut mit weißen Federn auf dem Kopf und zur Winterszeit den russischen Blaufuchspelz trug, die frühere Göttling wiederzuerkennen. Dafür aber wußte Madame Göttling es sehr wohl, welchen Beweggründen sie die plötzliche Beachtung der reichen Frauen zu verdanken habe.
Die Darner’sche Einrichtung, seine Service von Sèvres, sein Vermeille, seine russischen Silbergeräthe, sein englischer Wagen, für den der Kutscher und die Pferde und der Stallknecht mit einem der Schiffe gekommen waren, machten die Unterhaltung in den Kaffee- und Theegesellschaften der Mütter, wurden von diesen wie von ihren Töchtern nach Gebühr geschätzt, besonders, da ein reicher Mann sie zu bieten hatte, der, obschon nicht mehr jung, doch noch in den besten Jahren war und ganz vortrefflich aussah. Freilich war er Wittwer, hatte Kinder, und Stiefkinder sind keine angenehme Zugabe für junge Frauen. Indeß, es hatten ja so viele Frauen Stiefkinder in ihre Ehen mitbekommen und waren damit fertig geworden, selbst wenn die Verhältnisse nicht so glänzend gewesen waren, wie die Darner’schen sich boten.
Manch einer, welcher nicht selber mit einer heirathbaren Tochter oder Nichte gesegnet war, also freie Hand besaß, hatte es Darner wohl gelegentlich angedeutet, wenn man in guter Laune beim Wein gesessen, daß eine junge Frau aus gutem Hause bei seinen Mittagsbroden sich ihm gegenüber in der Mitte der Tafel sehr wohl ausnehmen würde. Andere hatten ihm zu bedenken gegeben, daß eine Arbeit, wie er sie sich zumuthe, des Ausruhens [1-23] neben einer hübschen Frau bedürfe. Er hatte dazu nicht ja, nicht nein gesagt, und man hatte angefangen es zu bemerken, daß er öfter und öfter das Theater besuchte, daß er es niemals unterließ, in die Loge von Madame Kollmann einzutreten, und das machte denn auch wieder von ihm sprechen.
Dachte Darner wirklich an eine Heirath mit der schönen Justine? Hatte Kollmann sich so weit mit ihm eingelassen, hatte er solche Vortheile durch ihn, daß er darüber seinen Plan aufgegeben, Justine mit seinem John zu verbinden? Fragen, geradezu fragen, konnte man darum weder Kollmann noch Darner, und von der Göttling war nichts herauszubringen.
Sie sei nicht des Herrn Vertraute, sagte sie, und Herr Darner spreche überhaupt von sich, von seinen Plänen und von den Seinen nicht. Was er wolle, das wolle und thue er. Sie sehe das an jedem Tag, und das schätze sie an ihm. Nur das eine glaube sie: ganz so jung, als man sich seine Kinder denke, könnten sie nicht sein.
Es ließ den Müttern und den Töchtern keine Ruhe mehr! Was wußte die Göttling und was wußte sie nicht? Betrieb vielleicht gerade sie die Heirath mit Justine, um sich damit für immer im Darner’schen Hause festzusetzen wie früher in dem Willberg’schen? Und was dachte Justine?
Abgeneigt war sie dem jetzigen Besitzer ihres Hauses keineswegs; mit ihrem Vetter John hatte sie immer gut gestanden, doch nie eine besondere Vorliebe für ihn gehabt, und sie zeigte allen ihren Freundinnen, ohne daß sie darum gebeten wurde, das goldene Nähkästchen, das ihr Darner zum Geburtstag aus England, den schönen gemalten Fächer, den er ihr aus Paris zum Neujahr hatte kommen lassen.
[1-24] Sèvresporzellan, eine englische Equipage waren etwas gar zu Schönes! Türkische Shawls, englische Strohhüte und russisches Pelzwerk kleideten so vortrefflich! Darner hielt die Frauen sehr in Athem, und das Geheimniß, das ihn umschwebte oder in das es ihm gefiel, sich zu hüllen, gab ihm nur einen größeren Reiz für ihre Phantasie.
Viertes Kapitel
Ganz andere Fragen und Sorgen aber als jene, mit denen die Frauen sich beschäftigten, nahmen den Sinn der Männer in Anspruch, denn die siegreichen Heere des französischen Kaisers rückten mit ungeahnter Schnelle in Deutschland vorwärts. Die feindlichen Absichten gegen Preußen wie gegen England lagen zu Tage; man mußte auf eine Gewaltthat gefaßt sein, und wie lange das Meer frei bleiben werde, war nicht zu berechnen.
Es galt jetzt, von der Nothwendigkeit gedrängt, es womöglich Darner nachzuthun. Was man über See in das Land einzuführen oder ebenso aus demselben noch fortzubringen dachte, das mußte in aller Eile geschehen, und man hatte daneben doch auf die in Aussicht stehenden Bedürfnisse großer Truppenmassen zu rechnen und Vorräthe bereit zu halten, die einen ungewöhnlichen Gewinn bringen, ebenso gut aber durch feindliche Beschlagnahme verloren gehen konnten. Zuversicht und Befürchtung, wagende Unternehmungslust und zaghaftes Bedenken arbeiteten in allen nordischen Seestädten mit gleichem Eifer an der Ausführung ihrer Absichten.
[1-25] Der Hafen lag voll Schiffe; alle Arbeiter, die Lastträger, die Fuhrleute, die Schiffer verdienten schweres Geld, die Kapitäne waren an der Börse wichtige Leute, und selbst die vornehmen alten Kaufleute, wie der Kommerzienrath Berkenhagen, der sonst nur durch seinen Disponenten mit den Kapitänen verkehren ließ, verschmähten es nicht, jetzt selber mit ihnen darüber zu verhandeln, ob es möglich oder nicht möglich sei, mit Bugsiren bis ins Haff hinauszukommen und dann mit halbem Winde vorwärts zu gehen, um ein paar Stunden zu gewinnen.
So stand denn der Kommerzienrath eines Tages gerade mit Kapitän Schwenten, der das Briggschiff »Anna Luise« führte, unter der Mittelthür der Börse, als Darner von der Brücke in das Gitter derselben eintrat und die breiten Stufen hinaufstieg.
Der Kapitän wandte sich zufällig um, und sichtlich überrascht, als er Darners ansichtig wurde, rief er:
»Ja, freilich, Ihr seid’s ja! Habt Euch gut gehalten!«
Darner jedoch achtete des Anrufs nicht, sondern ging, ohne sich umzusehen, in das Haus.
Der Kapitän lächelte:
»Hatte schon davon gehört! Arbeitet auch hier im Großen! Ist vornehm geworden! Kennt mich nicht mehr! Kenn’ ihn um so besser!«, setzte er, ihm nachblickend, hinzu.
Ein dritter, der nicht weit davon stand, hatte bemerkt, daß etwas vorgegangen war; aber was der eine gefragt, was der andere berichtet, das hatte der dritte nicht vernommen. Der Kommerzienrath und Kapitän Schwenten hatten sich auch nicht lange dabei aufgehalten. Sie hatten Wichtigeres zu be[1-26]sprechen gehabt, und Nachmittags war die Anna Luise schon aus dem Hafen hinaus und auf ihrem Weg zur See.
Ein paar Tage später erzählte man sich jedoch an der Börse und ebenso am Abend in der Kaufmannsressource, Kapitän Schwenten solle sonderbare Dinge über Darner ausgesagt, schließlich aber hinzugefügt haben, ein Geschäftsmann sei Darner dabei freilich, wie es keinen zweiten gebe. Er sei der Napoleon unter den Kaufleuten, und die holländischen und englischen Häuser, welche ihn benützt und ihm seiner Zeit die Hand geboten, hätten wohl gewußt, weshalb und wem sie das gethan. Er habe von je eine Umsicht und Voraussicht gehabt wie die Propheten oder wie der Gottseibeiuns. Auch an Thatkraft und Entschlossenheit komme ihm keiner gleich. Als er noch Superkargo für ein holländisches Haus gewesen, das viel zwischen der Goldküste und Brasilien gearbeitet und im Sklavenhandel Millionen gewonnen, habe er einmal die ganze Fracht Menschenwaare allein durch seine Energie, unter dem Kugelregen eines Kapers, in den Hafen gebracht. Das sei der Anfang zu seinem Glücke gewesen, das man ihm ja gönne, denn er habe was durchgemacht im Leben. Nur den Hochmüthigen müsse er nicht spielen gegen Leute, die viel reden könnten, wenn sie wollten.
Wie das Gerede von der Börse in die Komptoirs, so drang es aus der Ressource in die Wohnstuben der Familien und natürlich auch zu Madame Kollmann. Sie hatte gerade eine Kaffeegesellschaft bei sich, und man war im vollsten Erzählen und Vermuthen, im Deuten und Ergänzen, als Herr Kollmann eintrat, um mit gewohnter Höflichkeit den versammelten Damen sein Kompliment zu machen. Bei seinem Erscheinen ward es plötzlich still.
[1-27] Dieses Schweigen verrieth ihm, wovon man sich unterhalten hatte; die Frau des schwedischen Konsuls ließ ihn darüber auch in keinem Zweifel. Sie war eine norwegische Predigerstochter, die sich zu den Stillen im Land hielt, die großen Gesellschaften und jeden Luxus vermied, was bei dem beschränkten Einkommen der Familie sehr zweckmäßig war. Aber eben deshalb maßte sie sich das Recht an, den Sittenrichter in dem Kreise ihrer Bekannten vorzustellen.
»Gut, daß Sie kommen, Herr Kollmann«, rief sie ihm entgegen, »denn von Ihnen wird man am zuverlässigsten erfahren können, was man von den Gerüchten über den Herrn Darner zu glauben und wie man sich darnach gegen ihn zu verhalten haben wird.«
Und nun schwirrten die Fragen und die Erzählungen in einer solchen Hast durcheinander, daß ein Antworten darauf geradezu unmöglich war.
Man sprach von Darners geringer Herkunft, von dem schlechten Namen seiner Eltern, und was die eine der Damen nur vermuthete, das wußte die andere ganz bestimmt und das überbot die dritte durch selbstgezogene, ihr für unfehlbar geltende Schlüsse.
Endlich, da das Herumgeben einer neuen süßen Speise den Redefluß für eine kleine Weile hemmte, fragte Kollmann: »Und das alles soll der Kapitän dem alten Berkenhagen kundgegeben haben?«
»Freilich!«, versicherte die Konsulsfrau. »Alle Welt spricht davon, und mein Mann sagt, Kapitän Schwenten sei ein verläßlicher Mann.«
»Das ist er!«, bekräftigte Kollmann. »Er ist, ehe er sein eigenes Schiff hatte, früher für mich mit [1-28] dem ›Nordstern‹ gefahren. Ich kenne ihn genau. So viel auf einmal hat der Mann aber sein Lebtag nicht gesprochen, am wenigsten, wenn er wie vorgestern gleich in See zu gehen hatte.«
»Daß Darner von schlechter Herkunft ist, daß er einen schlechten Namen auf die Welt gebracht hat und daß er aus seinem Vaterland hat flüchten müssen, das hat Schwenten ganz bestimmt gesagt!«, wiederholte die Armfield, die nicht leicht aus dem Feld zu schlagen und über des Hausherrn Abweisung empfindlich war.
Kollmann aber war, da er wie jeder hervorragende und vornehme Mann von Neid und Uebelwollen sein Theil im Leben zu tragen gehabt, ein Feind alles Geredes und Geklatsches.
»Hat Herr Darner sich denn einer vornehmen Herkunft jemals schon gerühmt?«, fragte er.
»Ich möchte wissen, wie er das machen sollte, wenn er keinen ehrlichen Namen hat!«, meinte eine der Frauen, deren Mann es vergebens versucht hatte, mit Darner in Geschäftsverbindung zu treten.
»Nun«, entgegnete Kollmann, wenn seine Eltern ihm einen schlechten Namen hinterlassen haben, was doch in keinem Falle seine Schuld gewesen sein kann, so ist ihm freilich nichts übrig geblieben als sich einen guten Namen zu machen, und das hat er gethan!«
»Also die Sache mit dem Sklavenschiff und von dem Superkargo glauben Sie auch nicht?«, fragte eine dritte.
»Daß er drei Jahre lang als Superkargo für ein holländisches Haus engagirt gewesen ist, das weiß ich von ihm selbst«, entgegnete Kollmann.
»Ja«, fiel Justine ein, »und er hat es uns hier erzählt, daß er zwischen Guinea und Brasilien [1-29] gefahren ist und daß er einmal sein Schiff nur mit genauer Noth vor Seeräubern geborgen hat. Erinnere Dich, Tante, er beschrieb es, daß man’s mit erlebte, und der Onkel sagte nachher: Darner kann wirklich, was er will. Auch als Reisebeschreiber würde er Glück machen!«
Die Gäste von Madame Kollmann sahen einander an und dachten sich dabei ihr Theil. Zu verdenken war es Justinen nicht, wenn sie Lust hatte, in ihr Vaterhaus zurückzukehren, nun es so prachtvoll eingerichtet war. Aber wo blieb denn des Onkels Absicht mit Justine und mit John?
Weil man das nicht fragen konnte, bemerkte eine der Frauen:
»Mein Mann hat Recht, wenn er immer sagt, Sie wären im höchsten Sinn der Freund Ihrer Freunde, Herr Kollmann! Das zeigen Sie auch jetzt, Herr Kollmann; aber wenn denn Darner doch wirklich auch Sklaven überführt hat —«
Kollmann wurde ungeduldig.
»Lassen Sie uns zu Rande kommen, meine Damen«, sagte er, »gleichviel, was Schwenten gesagt hat oder nicht gesagt hat! Lassen Sie uns nicht die Kleinstädter spielen und Nachgrabungen in einem fremden Lande halten und Splitterrichterei treiben in einem Fall, der uns nichts angeht, wenn wir uns nicht ganz absichtlich mit ihm beschäftigen wollen. Was verlangt der Mann denn von uns? Er hat sich hier niedergelassen und macht Geschäfte. Wollen wir sie nicht mit ihm machen, nicht mit ihm verkehren, so haben wir’s nicht nöthig. Das ist unsere Sache, das andere die seine. Wer keinen Namen mit auf die Welt bringt, muß sich einen machen! Wer kein Geld hat, muß sehen, wie er durch seine Arbeit dazu kommt, als Kaufmann, als Gelehrter, [1-30] als Handwerker oder als Superkargo, gleichviel! Und welcher Superkargo hat darnach zu fragen, womit das Haus, in dessen Dienst er für so und so viel Zeit gebunden ist und für das er geht, sein Schiff befrachtet? Er hat die ihm konsignirte Fracht, ob Pulver oder Roggen, ob Elfenbein oder Schwarze, vor Schaden zu bewahren, intakt abzuliefern und damit gut! Hat er auf dem Schiff, das er geborgen, Menschenleben gerettet, so waren das gerettete Menschenleben, gleichviel ob weiße oder schwarze. Blicken Sie doch um sich, meine Damen! Fragt Napoleon seine Marschälle nach ihren Vätern? Dürfen sie ihm sagen, wohin sie gehen, und was sie thun wollen oder nicht thun wollen? Er nimmt sie, wo er sie findet, giebt ihnen Namen, wenn sie keine haben, braucht sie, wozu ihm’s paßt. Er hat zu befehlen, sie haben zu gehorchen. Er und sie haben zu wagen und zu sehen, was sie erlangen können. Das ist jetzt der Lauf der Welt! Wer, wie wir alten Firmen hier, besser sein will als unsere Zeit, der thut’s — freilich auch auf auch seine Gefahr und Kosten. Aber wer erst emporzukommen hat, der muß mit dem Strom schwimmen, und das thut Darner mit all seiner Kraft. Lassen Sie ihn schwimmen, bis er auf Ihrem Grund und Boden an das Land gehen will!«
Es waren das Aussprüche, wie man sie von Männern von Kollmanns Schlag wohl gelegentlich aussprechen hören konnte, obschon er und mancher andere mit ihm im betreffenden Fall gewissenhafter zu handeln pflegte, als jene Aussprüche es erwarten ließen, und obschon dieselben Männer sehr peinlich auf das Herkommen hielten, sobald es sie und ihre Familien betraf. Kollmann hatte indeß heute seinen Gefallen an dem Erstaunen, das er erregte, während [1-31] er doch gleichzeitig darauf bedacht war, sich den Rückzug für alle Fälle offen zu halten.
»Die Emporkömmlinge sind jetzt Herren der Welt mit ihrem Franzosenkaiser an der Spitze«, sagte er. »Wer darf ihn jetzt noch daran erinnern, daß er der Advokatensohn aus Korsika ist, der sich das Tuch zum Lieutenantsrock borgen mußte? Die Potentaten beugen sich vor ihm, der dem Murat seine schöne Schwester zur Frau gab, ohne sich darum zu kümmern, ob Murat vorher Koch oder Kellner gewesen ist. Und ihn zu heirathen hat ja Darner hierorts, soviel ich weiß, noch von Niemand begehrt; es hat’s auch Niemand nöthig. Die Hauptsache ist, wenn Baring Brothers und Hope mir sagen, der Mann ist gut, so ist er gut! Im übrigen lassen wir ihn gehen, bis er — ich wiederhole es — in unsern Weg kommt!«
Damit gab er den ihm zunächst sitzenden Damen noch mit freundlichen Worten die Hand und verließ den Saal.
Das Heirathen aber, das war es gerade! Das war die Ursache, aus welcher das Gerede über Darner nicht recht aufkam und trotzdem doch nicht einschlief unter den Frauen und der Kaufmannswelt. Darner war eine gar zu gute Partie!
Was bedeutete es, daß Justine ihn so warm vertheidigte? Weshalb zögerte man, sie mit John Kollmann zu verbinden, nun er die Rigaer Kommandite des Hauses selbstständig führte? Er war vierundzwanzig Jahre, Justine hatte zwei Winter hindurch alle Bälle mitgemacht und war bald neunzehn Jahre alt. Weshalb hatte man die Verlobung nicht vollzogen, als John nach beendeter Schifffahrt in Königsberg gewesen war? Wollte Justine beide an der Hand behalten, wollte sie sich das Vergnügen [1-32] machen, ihres Vetters Dank dadurch zu steigern, daß sie um seinetwillen Darner ausschlug?
Dazu war der Mann in reifen Jahren doch zu schade! Ihn zum Spielzeug zu benützen, war ein schweres Unrecht, war eine schlimme Koketterie von Justine, die sich Alles erlauben zu dürfen glaubte, weil sie so schön, weil sie die reiche Erbin war!
Mit einem Vorurtheil gegen Darner war man bei Madame Kollmann angelangt; mißtrauisch gegen sie, gegen ihren Mann und eingenommen gegen ihre Nichte, verließ man sie; denn der Wind springt in Sturmeszeiten oft rasch und unerwartet um, die Meinung der Menschen noch weit schneller! Und stürmisch war die Zeit.
Fünftes Kapitel
Krieg und Friedensschlüsse und neue Kriegserklärungen folgten einander in einer Eile, wie man dergleichen nie erlebt hatte. Oesterreich war besiegt, Hannover, an Preußen gefallen, war ihm wieder genommen worden. Preußen und Sachsen hatten sich gegen Napoleon vereinigt, die Schlachten bei Saalfeld und Auerstädt waren verloren, der preußische Hof nach Königsberg geflüchtet, Napoleon im November des Jahres 1806 in Berlin eingezogen und von dort aus der furchtbare Schlag gegen England von ihm geführt worden: die Kontinentalsperre war erklärt.
Das Preußen Friedrichs des Großen schien niedergeworfen für alle Zeit. Von Westen und Süden zogen die Heere Napoleons heran, die in [1-33] Polen Fuß gefaßt hatten. Die preußischen Festungen waren in der Hand der Franzosen. Was von dem preußischen Heere noch übrig war, hatte sich in Ostpreußen zusammengefunden, und wie unter dem Druck schwerer Gewitterwolken sah man dem Ausbruch des Unheils entgegen, das nicht lange auf sich warten lassen konnte.
Der Winter war früh hereingebrochen, die Schifffahrt, die im Norden stets zeitig eingestellt werden muß, hatte ohnehin durch die Kontinentalsperre ihre freie Bewegung verloren. Der Handel war plötzlich gelähmt.
Das Bestehen der ältesten Firmen stand überall in Frage. Die größten wie die kleinsten Häuser, sofern sie direkte überseeische Geschäfte betrieben oder mit ihren Kapitalien in denselben betheiligt waren, hatten schwere Verluste zu beklagen. Selbst der vorsichtige Kollmann, der das Vermögen seiner Frau und Nichte in England angelegt, war doch in seiner Rigaer Kommandite von beträchtlichen Einbußen nicht verschont geblieben. Darner allein stand sicher und unangetastet da.
Er allein in Königsberg mußte offenbar auf irgend eine Weise von der Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit der bevorstehenden Kontinentalsperre Kunde gehabt haben, und das machte ihn mit einem Schlage zum Millionär.
Er hatte keine Ladung mehr auf See. Sein Getreide, all seine russischen Produkte waren noch zur rechten Zeit verschifft. Der große Christoph, ebenso wie seine anderen Speicher, lagen bis auf den letzten Boden voll von Kolonialwaaren. Mit holländischen Schiffen und Frachtbriefen rechtzeitig eingegangen, waren sie vor einer Beschlagnahme, wie sie in Hamburg erfolgt war, gesichert, und konnten [1-34] bei dem vorauszusehenden großen Bedarf eben dieser Produkte zu nie dagewesenen Preisen verwerthet werden, so daß Darner dadurch rasch die Waare in die Hand bekam, welche ihm für seine eigentlichen Pläne und Spekulationen neben seinen großen Krediten jetzt die nöthigste war: das baare Geld für seine Bankgeschäfte.
Er beherrschte die ganze Thätigkeit des Platzes. Ueberall sprach man nur von ihm, bewunderte man seine Erfolge. Weil das Bewundern aber eine schweigende Erklärung der Unterordnung in sich schloß, welche auf die Länge manchem immer unbequemer erschien, fing man an, erst leise, dann lauter darüber zu reden, daß diesem Herrn Darner doch auch von französischer Seite besondere Wege offen gestanden, daß er besondere Verbindungen gehabt, besondere Mittel angewendet haben müsse, um so gut unterrichtet und vorbereitet gewesen zu sein, als es sich erwiesen.
Man betonte dies Besondere in besonderer Weise. Man nahm sich aber doch in acht, irgend etwas Bestimmtes gegen Darner auszusprechen, denn man hatte einen Mann von so außerordentlicher Wirksamkeit zu schonen, hatte auch nicht nöthig, gewissenhafter und bedenklicher zu sein als Kollmann, der wohl von Darners Nachrichten und von seiner Freundschaft manchen Vortheil gezogen haben mochte. Man fragte Kollmann nur öfter und öfter, was er denn von Darner und von all seinen ausländischen Nachrichten halte; und die Art und der Blick, mit denen man es that, sprachen aus, was die Fragenden nicht über ihre Lippen gehen ließen.
Es sei doch eine eigene Sache, meinte man, mit einem landfremden Manne, wenn er von dem Vorhaben der Landesfeinde so lange im voraus und so [1-35] auffallend gut unterrichtet sei, wie Darner es gewesen sein müsse. Es bleibe fraglich, ob und welche Gegendienste er vielleicht bei seiner Kenntniß der inländischen Zustände dafür zu leisten gehabt habe. Den einzelnen Bürger gehe das zunächst allerdings nichts an, so setzte man vorsichtig hinzu, es sei jedoch befremdlich, daß die Behörden in so kritischen Zeiten auf einen Mann wie Darner nicht ein wachsames Auge hätten. Vielleicht hätten sie es aber auch, und ließen ihn nur bis zu einem entscheidenden Augenblick gewähren.
Andere wieder nannten es die natürlichste Sache von der Welt, daß Darner durch seine Verbindungen mit den großen Londoner und Amsterdamer Firmen und durch deren Beziehungen zu den großen französischen Häusern, zu Ouvrard und den Laboucheres, von den gegen England geplanten Unternehmungen Kenntniß besessen, und seinen Vortheil davon gezogen habe. Aber es wäre in dem Falle freilich die Pflicht eines Ehrenmannes gewesen, bemerkte man daneben, sein Wissen nicht für sich allein zu behalten, sondern es seinen Mitbürgern und der Regierung des Landes kund und nutzbar zu machen, in welchem er als Grundbesitzer und als Kaufmann ansässig, als Bürger vereidigt war!
Man sagte dies und das! Nur daß viel Muth dazu gehöre, auf politisch mögliche Ereignisse hin, die doch immer eine Aenderung erfahren konnten, ein großes Wagniß zu unternehmen, das allein sagte man sich nicht. Man dachte auch nicht darüber nach, was man von Darners Mittheilungen gehalten und wie man über ihn geurtheilt haben würde, wenn die politischen Verhältnisse einen andern Lauf genommen, wenn der Sieg den französischen Waffen nicht treu geblieben und die Kontinentalsperre nicht zur Aus[1-36]führung gekommen wäre, wenn Darner in dem Maße verloren hätte, in welchem er jetzt gewonnen, und wenn man durch seine Mittheilungen Schaden erlitten hätte. Man wollte dem Manne, der alle überflügelt, gerne etwas anhaben, um ihn herabzuziehen. Indeß er hatte nirgends sich eine Blöße gegeben, denn noch während der Neid ihn als einen Emissär der Franzosen zu verdächtigen trachtete, erfuhr man, daß er dem Hofstaat des Königs durch die betreffenden Behörden aus seinen Vorräthen alles, was für die geflüchtete Königsfamilie aus denselben nützlich oder erwünscht sein konnte, mit großer Freigebigkeit zur Verfügung gestellt hatte.
Noch ehe man es gefordert, hatte er sich erboten, außer der Einquartierung, welche jedem Bürger auferlegt werden mußte, in seinem Hause ein paar Zimmer zur Unterbringung von solchen Beamten herzugeben, welche aus den höchsten Behörden dem Könige gefolgt waren; und seine Zuvorkommenheit für diese Gäste hielt, was man infolge des freiwilligen Anerbietens irgend nur erwarten konnte.
So war der Herbst zu Ende gegangen, die Weihnachtszeit herangekommen. Nur die harmlosen Kinder hatten sich ihrer zu erfreuen vermocht. Das Jahr hatte nur wenige Tage noch zu dauern, und diese kurzen, lichtlosen Tage mit ihren langen Nächten drückten und lasteten schwer auf den Menschen, vor denen noch keine Aussicht auf eine bessere Zukunft sich aufthun wollte.
[1-37]
Sechstes Kapitel
Die Börsenzeit war lang vorüber. Man hatte im Darner’schen Hause bereits zu Mittag gegessen. In dem großen, dreifensterigen, nach dem Pregel gelegenen Zimmer seines Hinterhauses, das Darner bewohnte, begann es dämmerig zu werden, aber man sah noch deutlich die Masten und Raagen der Schiffe, die nun bis zum Frühjahr im Hafen vor Anker lagen, und die Aeste der kahlen Bäume in dem kleinen Garten vor dem Hause, die sich unter dem Druck des Nordwestwindes knarrend bewegten, so daß der Schnee von ihnen, durch das Halblicht sichtbar, niederfiel. In dem englischen Kamin brannte ein starkes Feuer.
Darner ging, eine Cigarre rauchend, die damals, im Gegensatz zu den Tabakspfeifen, noch eine neue Mode in Preußen war, langsam in dem Raum auf und nieder, die Göttling erwartend, die er hatte rufen lassen. Als sie eintrat, blieb er stehen.
»Sind Sie davon unterrichtet«, redete er sie an, »daß Oberst von Kranzler morgen in der Frühe das Haus verläßt?«
Sie verneinte es.
»Er hat es mir eben gesagt«, fuhr Darner fort. »Sie haben vor ein paar Stunden Marschordre erhalten. Er und seine Leute haben sich gut betragen. Er ist ein formvoller Mann. Sorgen Sie dafür, daß seinem Diener morgen ein schicklicher Imbiß für ihn mitgegeben werde. Es trifft sich übrigens gut, daß er uns heute verläßt, denn ich erwarte übermorgen gegen Mittag die Ankunft meiner Kinder und wollte Ihnen ohnehin sagen, daß die Eintheilung der Zimmer darnach geändert werden muß.«
[1-38] Die Göttling, plötzlicher Entschließungen und Anordnungen von seiten Darners sehr gewohnt, war trotzdem überrascht und konnte dies nicht verbergen. Darner beachtete es nicht, ließ ihr auch zu einer Frage keine Zeit.
»Ich habe meine Töchter durch meinen Sohn aus dem Pensionat abholen lassen, um sie fortan bei mir zu behalten«, sagte er. »Für die Mädchen richten Sie gefälligst die beiden Stuben neben der Ihren ein, für Herrn Frank die Stube und das Kabinet im Vorderhause, welche der Adjutant inne gehabt hat, und sehen Sie darauf, daß die Zimmer einen wohnlichen Eindruck machen. Ich verlasse mich in dem allem auf Sie und rechne natürlich darauf, daß Sie fortan für meine Töchter wie für Mademoiselle Justine eine sorgsame Führerin sein werden.«
Die Göttling versicherte, sie werde ihr Bestes thun, erlaubte sich aber, zu fragen, ob die jungen Damen oder der Herr Sohn eine Bedienung bei sich hätten.
Darner verneinte das.
»Der Kurier, der sie begleitet«, sagte er, »geht sofort zurück!« Dann aber setzte er hinzu: »Sollte es sich übrigens herausstellen, daß Sie eine Person mehr im Hause zur Bedienung meiner Töchter brauchen, so suchen Sie dafür ein Mädchen, das kein schlechtes Deutsch spricht. In den Pensionen wird das Deutsch fast immer hintangesetzt, und ich will, daß sie sich frei darin bewegen lernen. Meinem Sohn ist es ganz geläufig.«
Die Unterhaltung war damit beendet. Darner ging in das Komptoir hinunter, die Göttling nach den Zimmern des zweiten Stocks, um in denselben gleich die geforderten Vorkehrungen treffen zu lassen, so weit das während der Anwesenheit der militärischen [1-39]