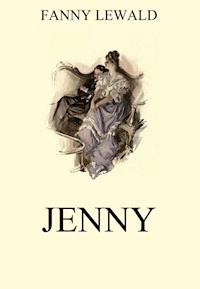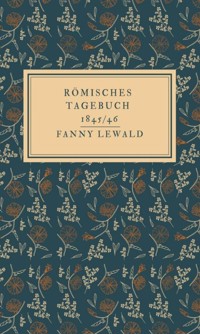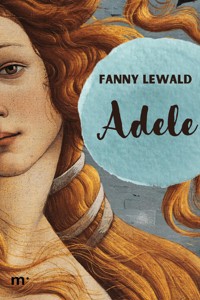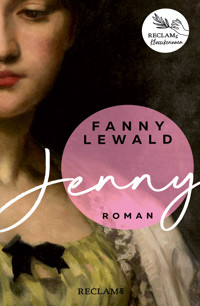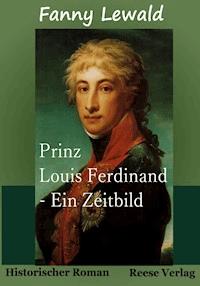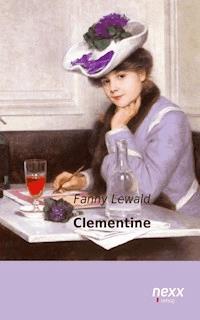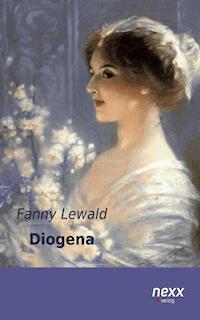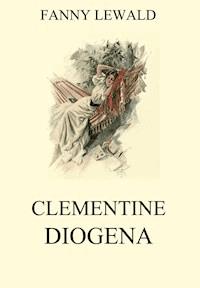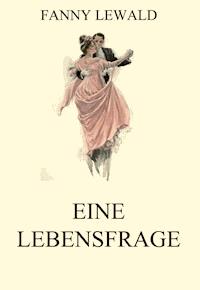
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In dem Roman "Eine Lebensfrage" thematisiert Lewald das Thema Scheidung, das Mitte des 19. Jahrhunderts einer gravierenden Reform unterzogen werden sollte und nach der die Frauen entschieden benachteiligt gewesen wären.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine Lebensfrage
Fanny Lewald
Inhalt:
Fanny Lewald – Biografie und Bibliografie
Eine Lebensfrage
Erster Theil
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Zweiter Theil
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
Eine Lebensfrage, F. Lewald
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849630607
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Fanny Lewald – Biografie und Bibliografie
Schriftstellerin, geb. 24. März 1811 zu Königsberg i. Pr. von israelitischen Eltern, gest. 5. Aug. 1889 in Dresden, trat in ihrem 17. Jahre zur evangelischen Kirche über, begleitete 1831 ihren Vater auf einer Reise durch Deutschland und Frankreich und lebte sodann längere Zeit in Breslau und Berlin. Nachdem sie schon 1834 zur Unterhaltung einer kranken Schwester Märchen geschrieben hatte, betrat sie 1841 die schriftstellerische Laufbahn mit der Novelle »Der Stellvertreter« (in der »Europa«). Es folgten ohne ihren Namen: »Klementine« (Leipz. 1842); »Jenny« (das. 1843); »Eine Lebensfrage« (das. 1845); »Das arme Mädchen« (in der »Urania«). Im Frühjahr 1845 bereiste sie Italien und nahm sodann ihren Aufenthalt in Berlin, wo sie sich 1854 mit Adolf Stahr (s. d.) verheiratete, mit dem sie in der Folge eine Reihe von Reisen unternahm. Ihre literarische Produktivität steigerte sich, ohne an innerem Wert zu verlieren. Nacheinander erschienen: »Italienisches Bilderbuch« (Berl. 1847); »Diogena, Roman von Iduna Gräfin H.-H.«, eine anonym erschienene Persiflage der Gräfin Hahn-Hahn (2. Aufl., Leipz. 1847); »Prinz Louis Ferdinand« (Bresl. 1849, 3 Bde.; 2. Aufl., Berl. 1859); » Erinnerungen aus dem Jahre 1848« (Braunschw. 1850, 2 Bde.); »Liebesbriefe« (das. 1850, schon 1845 entstanden); »Dünen- und Berggeschichten« (das. 1851, 2 Bde.); »England und Schottland«, Reisetagebuch (das. 1852, 2 Bde.); »Wandlungen«, ein Roman (das. 1853, 4 Bde.), »Deutsche Lebensbilder« (das. 1856); »Die Reisegefährten« (Berl. 1858); »Das Mädchen von Hela« (das. 1860); »Meine Lebensgeschichte« (das. 1861–63, 6 Bde.); »Bunte Bilder« (das. 1862, 2 Bde.); »Von Geschlecht zu Geschlecht«, Roman (das. 1863–65, 8 Bde.); »Osterbriefe für die Frauen« (das. 1863); »Erzählungen« (das. 1866–1868, 3 Bde.); »Villa Riunione« (das. 1863, 2 Bde.); »Sommer und Winter am Genfer See«, ein Tagebuch (das. 1869); »Für und wider die Frauen«, Briefe (das. 1870, 2. Aufl. 1875); »Nella, eine Weihnachtsgeschichte« (das. 1870); »Die Erlöserin«, Roman (das. 1873, 3 Bde.); »Benedikt« (das. 1874, 2 Bde.); »Benvenuto«, Roman aus der Künstlerwelt (das. 1875, 2 Bde.); »Neue Novellen« (das. 1877); »Reisebriefe aus Italien, Deutschland und Frankreich« (das. 1880); »Helmar«, Roman (das. 1880); »Zu Weihnachten«, drei Erzählungen (das. 1880); »Vater und Sohn«, Novelle (das. 1881); »Vom Sund zum Posilipp«, Reisebriefe (das. 1883); »Stella«, Roman (das. 1884, 3 Bde.); »Die Familie Darner«, Roman (das. 1887); »Zwölf Bilder nach dem Leben« (das. 1888) u.a. Von ihren Schriften erschien eine Auswahl u. d. T.: »Gesammelte Werke« (Berl. 1871–74, 12 Bde.); aus ihrem Nachlaß veröffentlichte L. Geiger »Gedachtes und Gefühltes, 1838–1888« (Mind. 1900). F. Lewalds Romane sind durch eine außerordentlich scharfe Beobachtung, durch energische Plastik der Gestaltung und klare Durchbildung des Stils ausgezeichnet. Die Grundlage ihrer Anschauung aber ist ein herber und harter Realismus, der im rechnenden Verstand und in der leidenschaftslosen Nüchternheit eine Art Ideal erblickt, von ihr die Lösung aller Rätsel des Daseins erwartet und begreiflicherweise nur in einzelnen Fällen eine poetische Wirkung hervorzurufen vermag. Vgl. K. Frenzel, Erinnerungen und Strömungen (Leipz. 1890).
Eine Lebensfrage
Erster Theil
I
Alfred von Reichenbach, ein Mann in der Mitte der dreißiger Jahre, saß eifrig arbeitend vor dem Schreibtische in seinem Studirzimmer, das, nach den aufgestellten Bücherschränken, Büsten und Bildern zu urtheilen, auf einen Besitzer schließen ließ, der Wissenschaften und Künste liebte und über die Mittel gebot, seinen Neigungen Befriedigung zu verschaffen.
Die mächtigen Bäume, welche sein Schloß umgaben, die geschlossenen Jalousien, verbreiteten eine milde Dämmerung in dem Zimmer und trotz der drückenden Wärme eines Sommerabends war es hier frisch und luftig. Eine tiefe Stille herrschte in dem Gemach, nur unterbrochen von dem leisen Geräusch, welches Alfred's Feder auf dem Papier verursachte. Er schrieb mit wachsender Schnelle und sein Gesicht zeigte den Ausdruck jener freudigen Begeisterung, den das Gelingen einer Arbeit hervorruft.
Da öffnete eine stattliche blonde Frau die Thüre und sagte: es ist drüben so warm in den Stuben, daß man es nicht ertragen kann, ich werde mich mit meiner Arbeit zu Dir setzen.
Es war die Frau des Schloßherrn. Er schreckte aus seinen Gedanken empor, sah sie zerstreut einen Augenblick an, nickte mit dem Kopfe und arbeitete emsig weiter.
Frau von Reichenbach beachtete das nicht. Sie schob mit Geräusch einen Tisch an das Fenster, rückte einen Stuhl zurecht und zog eine Tapisserie-Arbeit aus ihrem Nähkorbe, wobei Scheere und andere Geräthschaften klappernd zur Erde fielen. Alfred fuhr beunruhigt mehrmals mit der Hand über die Stirn, hielt im Schreiben an, überlas das Fertige, wollte weiter arbeiten, aber er war zerstreut worden, konnte dieselbe Gedankenreihe nicht finden und das Schaffen schritt langsamer vorwärts.
Nimm's nicht übel, Alfred! rief die Nähende nach einer kurzen Pause, es ist aber förmlich Nacht in Deiner Stube, ich muß die Jalousien öffnen, ich kann das Muster hier nicht zählen.
Die Jalousien, von ihr losgehakt, flogen zurück, das blendende Licht der untergehenden Sonne fiel plötzlich strahlend in das Zimmer, und mißmuthig sagte Alfred: Du weißt, Caroline, wie peinlich und störend mir solch grelles Licht ist, wenn ich arbeite.
Was soll ich aber thun, wenn ich die Stiche nicht zählen kann? wiederholte sie, und fragte bald darauf: Hast Du davon gehört, daß des Inspectors Tochter eine Liebschaft mit einem Studenten hat, seit sie den Winter in der Stadt war?
Laß mich arbeiten, meine Liebe! bat Alfred, ich möchte das Kapitel gern beendigen.
Caroline schwieg einige Zeit, Alfred's Feder bewegte sich wieder schneller, da bog seine Frau sich weit aus dem geöffneten Fenster hinaus, und rief einem im Hofe beschäftigten Mädchen in scheltendem Tone die Worte zu: Die Röcke sollen ein für allemal nicht mit Nadeln an den Trockenschnüren befestigt werden; wie oft soll ich das sagen?
Alfred stand ungeduldig auf, murmelte leise: Ganz unerträglich! nahm sich dann aber zusammen und fragte ruhig: Wo ist Felix?
Er spielt im Garten.
So laß uns auch hinabgehen.
Jetzt? in dieser Hitze?
In den Alleen ist's schon schattig.
Aber Du wolltest ja arbeiten? meinte Caroline. Wie kann man so launenhaft sein! Du hattest mir beim Kaffee ausdrücklich gesagt, wir sollten Dich nicht stören.
Deshalb kamst Du wohl herein und plaudertest unaufhörlich? sagte Alfred im Tone eines freundlichen Vorwurfs. Sie schickte sich zu einer Entgegnung an, aber er wiederholte seinen Wunsch, zu dem Sohne hinabzugehen, und bald darauf finden wir die Eheleute in den stattlichen Alleen des Gartens wieder.
Der schöne, zehnjährige Felix sprang den Eltern froh entgegen, ward von dem Vater geliebkoset und fing an, von seinen Spielen, von seinen Hunden und von dem Kutscher zu erzählen, während sie durch den Laubgang vorwärtsschritten. Plötzlich hielt der Knabe in seinen Berichten inne, sah dem Vater prüfend in das Gesicht und ging dann schweigend und ruhig neben ihm her. Alfred bemerkte dies Schweigen nicht und schien auch eine gleichgültige Frage seiner Frau zu überhören, so daß sie unmuthig ausrief: Aber wenn Du mich nur hier haben wolltest, damit ich neben Dir hergehe, so hättest Du mich im Hause lassen können, wo ich zu thun hatte.
Alfred erwachte aus seiner Zerstreutheit. Vergib! sagte er, ich habe so plötzlich zu arbeiten aufgehört, da weilt die Seele unwillkürlich noch bei den Vorstellungen, die sie beschäftigten. Ich dachte in diesem Augenblick mehr an die Vergangenheit und an mein Gedicht, als an Euch und an die Gegenwart.
Das sah ich, Vater! bemerkte Felix, und darum war ich lieber still. Ich weiß es gleich, wenn Du an Deine Arbeiten denkst. Dann sehen Deine Augen ganz anders aus, als könntest Du nicht mit ihnen sehen, was um Dich her vorgeht. Bist Du vergnügt, wenn Du Dir Deine Gedichte und Geschichten ausdenkst?
Ja, mein Sohn, und recht vergnügt! Ich wollte, auch in Deine Brust hätte die Natur den schöpferischen Funken gelegt, der in uns eine neue Welt voll Freuden und Leiden hervorruft. Indeß selbst in den Leiden liegt noch Glück und Schönheit, und wohl Dem, der jenes doppelte Leben kennt, das den Dichter in den Momenten des Schaffens zum glücklichsten Menschen macht, sagte Alfred, zu seiner Frau gewendet.
Das ist aber ein sehr einseitiges Glück, meinte diese, von dem Niemand etwas genießt, als nur Du selbst. Für Deine Umgebung bist Du verloren, wenn Du so in das Arbeiten hineinkommst. Ob ich mich mit den Leuten plagen muß, ob ich Verdruß und Aerger habe, danach fragst Du nicht; Du dichtest! Und gerade heute habe ich Verdruß gehabt, denn ich habe der neuen Wirthschafterin den Dienst gleich wieder aufkündigen müssen.
So! sagte Alfred gleichgültig und theilnahmlos.
Und Du fragst nicht einmal weshalb?
Gewöhnlich, Beste, scheinen mir Deine Gründe für diese sich oft wiederholenden Gewaltmaßregeln nicht ausreichend. Du weißt, ich habe dabei früher stets zu vermitteln, einzuschreiten versucht, jetzt bin ich es müde geworden. Du willst nicht einsehen, daß Du Dir all den Verdruß durch Deine Ungeduld mit den Leuten selbst bereitest; deshalb lasse ich Dich nach Belieben schalten und ertrage die Unbequemlichkeit, fortwährend neue Dienstboten um uns zu haben.
Als ob Dich auch nur Etwas von diesen Unbequemlichkeiten träfe! als ob ich nicht Alles auf mich nähme! Ich denke, Du kannst Dich nicht darüber beklagen, daß Du je Deine gewohnte Bequemlichkeit entbehrst, daß ich es Dich je empfinden lasse, welche Plage die schlechten Leute sind! rief Caroline empfindlich, und Alle schwiegen, bis Felix den Vater bat, den Garten zu verlassen, um durch die Felder auf den Berg zu gehen.
Der Vater war es gern zufrieden, indeß die Mutter machte Einwendungen. Sie fürchtete die Wärme, den weiten Weg, ließ sich aber dennoch überreden, ihres Mannes Arm zu nehmen und die Ihrigen zu begleiten. Der Knabe lief fröhlich voran und bald hatte man die Höhe erreicht, von der aus sich ein weiter Blick über die großen Reichenbach'schen Besitzungen eröffnete.
Mäßige Hügelketten durchzogen das Land, bald mit üppigen Laubwäldern, bald mit wogenden Getreidefeldern geschmückt, die in goldiger Fülle der Ernte entgegenreiften. Dazwischen schlängelte sich von der Höhe ein Flüßchen hinab, das im Thale einen Kupferhammer trieb und weiter hin einen hellen Teich bildete, der, wie die blaue Wunderblume der Märchenwelt, funkelnd und strahlend aus der Tiefe hervorleuchtete. Glitzernd zitterten die letzten Sonnenstrahlen auf dem ruhigen Gewässer und färbten mit bräunlichem Golde die Spitzen der Bäume, die sich leise unter dem erfrischenden Wehen der Abendluft zu regen begannen. Die ersten langgezogenen Finkenschläge tönten aus den Büschen, Säulen von schwärmenden Mücken sonnten sich in der Luft, und Alles was lebte, schien sich der schönen letzten Tagesstunde mit Glück bewußt zu sein.
Alfred blickte lange entzückt umher, schwelgend in Anbetung und Freude. Caroline hatte sich auf einen Stein niedergesetzt, sie war mit den Bändern ihrer Schuhe beschäftigt. Ihr Mann ließ sie ruhig gewähren. Plötzlich, als die Farben immer tiefer wurden, als es überall heller leuchtete, rief er wie im Selbstgespräch: Wie verdient man diese Welt? wie genießt man all diese Herrlichkeit? Felix! siehst Du denn, mein Sohn, wie schön es hier ist? Siehst Du, wie dort, wo Dein Schwan durch den Teich zieht, lange, lange Goldstreifen sich spiegeln, als Widerschein des Lichtes? Da streichelt die Sonne mit goldener Hand die feuchte, heiße Wange der müden, entschlummernden Erde, und wünscht ihr gute Ruhe und selige Träume, wie wir es mit Dir machen. Und die Erde wird still und ruhig und träumt von Glück und Frieden! Wollte Gott, daß morgen, wenn sie erwacht, der Traum Wahrheit geworden wäre, daß – –
Hier ist's aber vor Mücken nicht zu bleiben! fiel seine Frau ihm in das Wort, und überhaupt möchte ich zurückgehen, mich drücken die Schuhe und ich will auch der Haushälterin noch etwas sagen.
So komm! sagte Alfred seufzend und, eine düstere Wolke des Unmuthes auf der Stirne, trat er den Rückweg an, seine Frau am Arme führend, die sich fest und schwer darauf lehnte und unablässig über ihre unbequemen Schuhe klagte.
II
Alfred war der Sohn adliger und edler Eltern. Den Vater hatte er wenig gekannt, die Mutter, welche ihn mit vollster Hingebung erzogen, war gestorben, als er kaum das Jünglingsalter erreicht hatte und Offizier geworden war. Von dieser trefflichen Frau an ein geistiges Zusammenleben mit ihr gewöhnt, fand er nach ihrem Tode sich einsam und verlassen. Die lauten, wüsten Kreise seiner Kameraden zogen ihn nicht an und, in ein kleines Garnisonstädtchen versetzt, führte er ein zurückgezogenes freudloses Dasein, bis ihm in der Liebe neue Hoffnung erblühte.
Er hatte eine Wohnung in dem Hause eines adligen Subalternbeamten gemiethet, dessen einzige Tochter, Caroline, für das schönste Mädchen der Stadt galt, das von den Launen einer jungen Stiefmutter viel zu dulden hatte. Alfred bedauerte sie, wollte sie trösten, sie durch seine Theilnahme für ihre Leiden entschädigen. Während dieser Bestrebungen verwandelten sich allmälig sein Mitgefühl und des Mädchens Dankbarkeit in Liebe, die sie sich mit der Befangenheit der ersten Jugend gestanden.
Beide waren neunzehnjährig und schön. Alfred's Seele schmachtete liebedurstig nach einem Ideale, und freigebig schmückte er in seinem Geiste das junge Mädchen mit allen Vorzügen, die er in ihm ersehnte, die es nicht besaß. Kleine Mißhelligkeiten, die oftmals vorfielen, wurden durch die Küsse und Schwüre der Versöhnungsstunden ausgeglichen; es war ein Verhältniß, wie viele andere, das sich gleichblieb, bis Alfred die Garnison verließ, um die Kriegsschule in Berlin zu beziehen. Eine Trennung, ohne sichere Aussichten für künftiges Wiedersehen, schien den Liebenden unmöglich. Man entdeckte sich den Eltern und, da dem Vater der stattliche Schwiegersohn, der Stiefmutter die Verheirathung der Tochter willkommen war, erlangte das junge Paar die Einwilligung der Eltern mit dem Versprechen, der begüterte Vater wolle die Verheirathung Carolinen's möglich machen, sobald der Lieutenant seine Studien beendet haben würde.
In Berlin fand Alfred einen greisen Großonkel, der sich väterlich des strebsamen Jünglings annahm. Er war Domherr, hatte an verschiedenen größeren Höfen gelebt und zeichnete sich ebenso sehr durch Geist und feine Sitten, als durch ein starres Festhalten an den Grundsätzen der katholischen Kirche aus. Von ihm ward Alfred in die gebildeten, kunstsinnigen Kreise der Hauptstadt eingeführt; unter seiner Leitung suchte er auf jede Weise seinen Geist zu bilden, und der Neigung für Künste und Wissenschaft zu genügen, die er in seinen früheren Verhältnissen nicht befriedigen können.
Nachdem dies beglückende Verhältniß ein paar Jahre gedauert hatte, starb der Greis plötzlich und Alfred sah sich, unerwartet zu dessen alleinigem Erben ernannt, in dem Besitze eines bedeutenden Vermögens. Freudig ward die Nachricht der Braut verkündet und die Hoffnung baldiger Hochzeit daran geknüpft; aber in der Freude seines Herzens hatte der junge Mann eine Bedingung des Testaments nicht beachtet, welche jene Aussicht noch in weite Ferne hinausschob.
Das Testament verlangte, daß Alfred sich nicht vor vollendetem vierundzwanzigsten Jahre verheirathen, bis dahin in Berlin bleiben oder reisen, und seine Braut nicht wiedersehen dürfe, bis er nach erlangter Großjährigkeit die Erbschaft angetreten haben würde, welche bis dahin für ihn von den Domherren des geistlichen Stiftes verwaltet werden sollte.
Nur mit Widerstreben fügte sich das Brautpaar in das Unabänderliche. Carolinen's Klagen über ihre traurigen Verhältnisse zur Stiefmutter suchte Alfred mit Schilderungen der glücklichern Zukunft zu beschwichtigen; während er jetzt schon mit zärtlicher Großmuth bemüht war, ihr Loos erträglich zu machen und dem sinkenden Wohlstande ihrer Eltern wieder empor zu helfen. Die reichsten Geschenke, die ausführlichsten Briefe, die feurigsten Liebeslieder wurden ihr gesendet; aber Nichts vermochte sie zu erheitern, Nichts sie von dem Verdachte zu befreien, Alfred vergesse ihrer, und sein Wille müsse die Hindernisse überwinden können, die sich ihrer Verbindung im Augenblicke entgegenstellten. Das sprach sie mit Bitterkeit in jedem ihrer Briefe aus und verminderte dadurch die Sehnsucht, mit welcher er ihnen sonst entgegengeharrt hatte.
Bald darauf trat er seine Reisen an. Er sah Länder und Völker und lernte den Menschen verstehen, von dem Palaste des Herrschers bis hinab in die Hütte des Armen. Die Natur hatte ihm eine poetische Auffassungsgabe und eine schöne gestaltende Kraft verliehen. Es trieb ihn also, was er gefühlt und gedacht, für sich und Andere in bleibender Form fest zu halten und auf Zureden eines Freundes gab er einen Band von Liedern und Gedichten heraus, die er in begeisterten Stunden geschrieben hatte.
Als er nach Verlauf einiger Jahre in die Heimath zurückkehrte, begrüßte ihn das Mitgefühl des deutschen Vaterlandes, das die Versuche des jungen Dichters wohlwollend willkommen hieß; aber er entriß sich schnell dem verlockenden Treiben der großen Welt, um zu seiner Verlobten zu eilen.
Wer jedoch beschreibt seine Empfindungen, als er die Ersehnte wiedersah? In den beständigen Reibungen mit der Stiefmutter, in den kleinlichen Verhältnissen eines Landstädtchens war der mädchenhafte, jugendliche Reiz, der auch die weniger begabten Frauen liebenswürdig macht, gänzlich entschwunden, und Alfred fühlte sein Herz erstarren in dem Begegnen mit der Braut.
Der Gedanke, mit ihr zu brechen, regte sich in ihm, aber er unterdrückte ihn schnell; denn er hatte ihr sein Wort verpfändet, sie hatte ihre Jugend im Vertrauen darauf durchlebt und ihr Vater war verarmt. Daneben wachte auch die Erinnerung an die erste Zeit ihrer Liebe mächtig in ihm auf. Er wähnte, Caroline bilden, sie zu sich erheben zu können. In dieser Erwartung ward ihre Ehe geschlossen, und noch am Hochzeitstage führte er die junge Gattin in sein Schloß, das mit gebildetem Schönheitssinn für ein poetisches Zusammenleben eingerichtet worden war.
Aber seine Hoffnungen täuschten ihn. Carolinen's Herz war nicht böse, es fehlte ihr nicht an Verstand, sie liebte ihren Mann auf ihre Weise, aber sie war kalt und herb, und Alfred entdeckte bald eine Kluft zwischen sich und ihr, die sie weit von einander trennte. Die Weise, in der er, bei großer praktischer Tüchtigkeit, Welt und Leben geistig erfaßte, seine Bestrebungen für Menschenwohl im Großen, sein ganzes Wollen und Wirken lagen außer den engen Grenzen, in denen der Geist seiner Frau sich bewegte. Seine ganze Richtung erschien ihr phantastisch, sie fühlte, daß sie ihm nicht folgen, ihm nicht genügen könne, daß er mehr verlange, als sie ihm sei. Das machte sie eifersüchtig, launenhaft und reizbar, und selbst die Geburt eines Sohnes brachte keine vollständige Annäherung zuwege, obgleich beide Eltern mit gleicher Liebe an dem Kinde hingen.
Häusliches Unbehagen führte die Gatten vom Lande nach der Stadt, wo sie eine Weile zu leben versuchten; Carolinen's Eifersucht trieb sie wieder auf das Land zurück. In immer neuen Verstimmungen flossen die Jahre dahin, und die Mißhelligkeiten steigerten sich, seit die Erziehung des zehnjährigen Sohnes die religiösen Ansichten der Eltern einander gegenüberstellte. Alfred und seine Frau waren beide katholisch; während aber Jener einem reinen Deismus huldigte, hing Caroline streng an dem äußern Kultus der römischen Kirche und suchte, unter Anleitung ihres Beichtvaters, eines Kaplan Ruhberg, vom Domstifte zu Maria-Gnad, das in der Nähe des Schlosses lag, auch Felix zu dem äußern Gottesdienste anzuhalten, was ganz gegen die Ansicht ihres Mannes verstieß.
Caroline, an beständigen Streit mit der Stiefmutter gewöhnt, war gegen das Verletzende der oft wiederkehrenden Zerwürfnisse zwischen sich und ihrem Manne nicht allzu empfindlich, während sein feineres Gemüth beständig darunter litt und bei jedem neuen Anlasse schmerzlicher blutete, so daß das Leben an der Seite seiner Frau ihm bald zu einer drückenden Bürde wurde, gegen die er nur in rastloser Thätigkeit Trost und Zerstreuung fand. Schulen und Fabriken wurden auf seinen Gütern gegründet, Noth und Elend schwanden von seinen Besitzungen, er sah sich nach wenig Jahren von frohen, dankbaren Menschen umgeben und sein großer, ererbter Reichthum nahm mächtig zu. Er wußte, daß er seine Pflicht that, und er that sie gern.
Aber je mehr er es fühlte, wie er in dem Gelingen dieser Bestrebungen, in seinen dichterischen Erfolgen und vor Allem in dem fröhlichen Heranwachsen seines Sohnes, alle Mittel zu dem vollkommensten Glück besitze, um so schmerzlicher entbehrte er in der Mutter dieses Knaben die gleichfühlende Gefährtin, die all das Gute mit ihm theilen sollte, und um so größer ward die Entfernung, die ihn geistig von ihr trennte. Was blieb ihm also übrig, als sich endlich vor dem Unerreichbaren entsagend zu bescheiden? Alles, was er erlangen konnte, war eine verhältnißmäßige Ruhe, und diese strebte er also an. Er gab den Launen Carolinen's so weit als möglich nach, ließ sie in ihrer Neigung für Luxus gewähren, er aber lebte seinen Pflichten, seinen Arbeiten und seinem Sohne.
III
Noch klang die Erinnerung an die letzten Streitigkeiten in Alfred's mißmuthiger Stimmung fort, als schon ein neues Unwetter an seinem Ehehimmel heraufzog. Er hatte eine bestimmte Menge von Lebensmitteln festgesetzt, welche allwöchentlich an diejenigen Gutsinsassen vertheilt werden sollten, die durch Alter oder Krankheit zur Arbeit unfähig geworden waren. Jahre lang hatte diese Maßregel ruhig fortbestanden, jetzt aber trat plötzlich der Verwalter mit der Frage an ihn heran, wie er es künftig mit der Austheilung dieser Unterstützung zu halten habe, da er mit dem dazu bewilligten Quantum nicht mehr auszureichen vermöge.
Woran liegt das, fragte Alfred, grade jetzt, wo der Gesundheitszustand bei dem schönen Wetter vortrefflich und alle Welt bei der Ernte beschäftigt ist? In dieser Zeit pflegte doch sonst die Nothwendigkeit der Unterstützung sehr gering zu sein und die Sommermonate mußten den Winter übertragen helfen.
Gnädiger Herr! wendete der Verwalter ein, sonst hatten wir die wöchentlichen Sendungen in's Kloster Maria Gnad nicht zu machen.
Nach Maria Gnad? In's Kloster? Was soll das heißen?
Ich meine die Sendung, die ich seit einigen Wochen dort hin schaffen muß.
Alfred sah den Verwalter überrascht an, faßte sich aber schnell, den Zusammenhang errathend, und sagte: Ja so! – nun, ich will das überlegen. Ich werde Ihnen morgen den Bescheid geben, wenn Sie in der Frühe zu mir kommen.
Mit dieser Weisung empfahl sich der Verwalter und Alfred eilte zu seiner Frau. Hast Du den Befehl gegeben, fragte er, regelmäßige Lieferungen von Lebensmitteln nach Maria Gnad zu machen?
Ich sehe nicht ein, entgegnete Caroline, die gerade Antwort umgehend, weshalb Du allein Dir das Recht aneignest, Wohlthaten zu spenden; weshalb ich nicht Theil an den guten Werken haben soll, auf meine Weise?
Daß Du nicht Theil daran nahmst auf vernünftige Weise, hat mich oft genug verdrossen! entgegnete er ihr. Wie häufig habe ich Dir gesagt, Du könntest wahre Wohlthaten thun auf unsern Gütern, wenn Du Deinen Einfluß auf die Frauen der Leute verständig geltend machen wolltest. Du könntest mir die Hälfte der Arbeit abnehmen, die mir die Gewöhnung der Einwohner zu verständigem Gebrauch ihrer Mittel verursacht! Ich wollte Dich so gern als die Schöpferin des Guten verehren lassen, das hier allmälig geschieht. Immer bist Du mir dann aber mit kleinlicher Sparsamkeit, mit pietistischen Bedenken entgegengetreten; und nun befiehlst Du, ohne mich zu fragen, plötzlich Sendungen in das Kloster zu machen, die meinen arbeitsamen Leuten entzogen werden, um drüben die faulen Mönche fett zu füttern!
Um von den frommen Herren an fromme, gottgefällige Christen vertheilt zu werden, die sich durch christlichen Wandel des Beistandes würdig machen, fiel ihm Caroline fest ins Wort. So lange Du Deine Leute in dem unkirchlichen Leben bestärkst, so lange Du sie ermunterst, an den heiligen Tagen zu arbeiten und die Messe zu versäumen, so lange kann Deine Wohlthätigkeit nicht die meine sein; und sie wird auch keinen Segen bringen weil ihr der Segen des Himmels fehlt.
Immer das alte Einerlei! rief Alfred verdrießlich. Daß ich doch endlich die Mittel begreifen lernte, durch die alle Lehren der Pfaffen Eingang bei Dir finden, während Du bei meinen Vorstellungen, meinen dringendsten Bitten taub bleibst!
Warum bleibst Du taub bei meiner flehentlichen Bitte, Felix, wenigstens im Christenthum, von dem würdigen jungen Manne unterrichten zu lassen, den Kaplan Ruhberg uns vorschlägt?
Weil ich nicht will, daß man den gesunden Verstand des Knaben mit unklaren Begriffen verdunkle; weil er ein verständiger Mensch werden soll und kein Heuchler, wie Ruhberg und sein Gehilfe es sind. Ehe ich diesen jungen Mann in meinem Hause dulde, lieber –
Lieber? – fragte Caroline spöttisch.
Zwinge mich nicht, das Härteste zu sagen! rief Alfred, als der Diener erschien und den Besuch einer adligen Dame von dem Nachbargute meldete.
Sehr willkommen! sagte Caroline und ging freundlich, als ob nichts Unangenehmes sie berührt hätte, der Gemeldeten entgegen, die gleich darauf eintrat. Alfred hatte das Zimmer verlassen, er fühlte sich nicht gestimmt zu gleichgültig heiterem Gespräch.
Mit dem Gaste zugleich kam aber auch Felix herein. Sein glühendes Gesicht strahlte vor Freude und er wollte eilig durch das Zimmer laufen, als die Mutter, nachdem sie die Baronin begrüßt, ihn bei der Hand nahm und, ihn betrachtend, ausrief: Aber um Gottes willen, Felix! wie siehst Du aus? Wo hast Du Schuhe und Strümpfe gelassen? Wie hast Du Deine Blouse zugerichtet!
Ich habe Ihren Sohn eine tüchtige Strecke vom Schlosse gefunden, bemerkte die Baronin, während sie dem verlegen schweigenden Knaben die Wange streichelte, und ich habe ihn in meinem Wagen hierher gebracht, da er es doch wohl nicht gewohnt ist, ohne Schuhe und Strümpfe einher zu gehen.
Der ganze Unmuth Carolinen's, den der Streit mit ihrem Manne in ihr zurückgelassen hatte, wendete sich nun gegen den Knaben. Was ist das wieder für ein gottloser Streich! rief sie heftig. Du machst mir nichts als Verdruß und Schande, Du folgst nie! Sehen Sie, Beste, wie er aussieht! Es ist der ungerathenste Knabe von der Welt!
Mutter! sagte Felix leise, der arme Junge sah so elend aus, er hat das Fieber und einen lahmen schlimmen Fuß. Ich dachte, der Vater würde nicht böse sein, es war wirklich nicht weit von hier, und er hatte bis nach Heindorf mit dem schlimmen Fuß.
Und ich sage Dir, Du sollst Deine Sachen nicht jedem Bettelbuben schenken und nicht barfuß umherlaufen wie ein Bauernjunge! Mache, daß Du hinauskommst, und lasse Dich ankleiden, Du ungerathenes Kind! – Damit schob sie den Knaben nach der Thüre, mit so unvorsichtiger Heftigkeit, daß er auf dem glatten Fußboden stolperte und gefallen wäre, hätte nicht Alfred ihn in seinen Armen aufgefangen, der hinzueilte, als er die keifende Stimme der Mutter in dem Nebenzimmer hörte.
Er hieß die Baronin in gewohnter edler Form willkommen, aber Caroline unterbrach ihn: Da siehst Du nun selbst einmal die Folgen Deiner genialen Erziehung an dem Knaben! sagte sie. Fast eine Stunde vom Schlosse hat ihn die gute Baronin gefunden und ihn in dem saubern Aufzuge hierhergebracht. Hieltest Du ihm den Lehrer, den ich Dir heute wieder vorschlug, dann kämen solche Dinge auch nicht vor.
Der zurecht gewiesene Vater versuchte die Sache lächelnd und leicht aufzunehmen. Ich finde in der That nicht, daß der Knabe ein so großes Unrecht gethan hat, sagte er. In der Umgegend umherzulaufen, haben wir ihm stets erlaubt, da er für seine Jahre selbstständig und vernünftig ist; und daß er einmal seine Schuhe aus Mitleid fortgab und eine halbe Stunde barfuß einherging, das wird ihm gar nichts schaden. Mag er sehen, wie es dem Armen thut.
Ich meine auch, versetzte begütigend die Baronin, der dieser Auftritt natürlich sehr unangenehm sein mußte, Sie nehmen die Sache viel zu streng, liebste Freundin! Ihr Felix darf mehr noch als andere Knaben eine gewisse Ungebundenheit zeigen und seinen augenblicklichen Eingebungen folgen. Er ist ja der Sohn eines Dichters und seine Augen sehen aus, als ob viel von dem väterlichen Genius auf ihn übergegangen wäre.
Aber die versöhnenden Worte der Baronin brachten eine ganz entgegengesetzte Wirkung hervor. Caroline nahm es übel, daß sie ihr nicht beistimmte, daß, wie gewöhnlich, die Meinung der Fremden sich für ihren Mann entschied.
Wenn ich nur nicht dies ewige »ein Dichter!« hören müßte! rief sie in einem Tone, der nun ihrer Seits auch scherzhaft klingen sollte, während er die äußerste Gereiztheit verrieth. Wenn die Leute nur wüßten, wie unbequem solche poetische Naturen im täglichen Leben sein können, wie die prosaische Umgebung von der Poesie, von ihrer Freigeisterei, und von ihren Ueberspanntheiten bisweilen leiden muß.
Du schmeichelst mir eben nicht, Caroline! unterbrach sie Alfred, und die Baronin bemerkte, man höre wohl, daß Frau von Reichenbach nur scherze; aber sie beachtete die Weisung nicht.
O, ich schmeichle und heuchle nie! rief sie, und es ist, wie ich es sage, glauben Sie mir das! Die Menschen werden durch die Poesien eines Dichters entzückt; aber während er dichtet, fällt alle Sorge für Haus und Hof, alle Noth mit der Erziehung, alle häusliche Plage auf die Frau, denn für solche Kleinigkeiten hat ein Dichter nicht Sinn und nicht die Zeit. Kommt er dann endlich aus dem Studirzimmer heraus, so soll die poetische Welt auch im Leben ausgeführt werden; Alles, was nicht damit in Uebereinstimmung ist, heißt ungroßmüthig, kalt und kleinlich. Gewiß, Sie kennen das nicht.
Caroline war so heftig erregt, daß ihre Stimme zitterte, die Baronin, welche es nicht wissen konnte, daß vor ihrer Ankunft ein lebhafter Streit stattgefunden hatte, war in der peinlichsten Verlegenheit. Alfred's Farbe wechselte während dieser Scene mehrmals schnell, doch versuchte er seinen Zorn niederzukämpfen und der Sache eine schicklichere Wendung zu geben. Mit erzwungenem Lächeln sagte er: Da sehen Sie, gnädige Frau! wie unsere kleine poetische Glorie bei näherer Betrachtung ein Feuer ist, das alles häusliche Glück verzehrt! Indeß ist es wohl nicht so arg. Es wäre ja zu traurig, wenn Das, was unser Glück ist, zur Plage unserer Lieben würde. Meine Frau fällt mir ins Fach, sie dichtet heute ein wenig und übertreibt dabei wohl etwas.
Die Baronin ging auf diese Wendung ein, aber die quälende Spannung der Einzelnen lähmte jede Unterhaltung. Alfred war verstimmt, Caroline blieb gereizt und bitter, und die Baronin entfernte sich, sobald es in guter Weise möglich war.
Alfred eilte auf sein Zimmer, nachdem er sie zu ihrem Wagen geleitet, und ging in stürmischer Bewegung umher, wie es seine Art war, wenn ein Ereigniß ihn schmerzlich beschäftigte. Mehrmals blieb er stehen, den Kopf gegen die Fensterscheiben gestützt, und sah sinnend in die Gegend hinaus. Dann setzte er die frühere Bewegung wieder fort, ging an die Thüre, um die Glocke zu ziehen, aber plötzlich zögernd ließ er die Schnur aus der Hand entgleiten, trat zurück und warf sich in den Sessel, der vor seinem Schreibtische stand.
Hier saß er, in Gedanken verloren, lange Zeit, bis er sich plötzlich aufraffte, die Klingel zog, dem Diener befahl, die gnädige Frau zu ihm zu bitten, und dann, sie erwartend, auf's Neue in tiefes Nachdenken versank.
Carolinen's Erscheinen machte ihn erbleichen. Du hast mich rufen lassen, was willst Du von mir? fragte sie mit Eiseskälte.
Habe die Güte, Dich zu mir zu setzen, bat er sie.
Die äußere Ruhe ihres Mannes bei sichtlicher innerer Erregtheit erschreckte sie, und theils, um sich Muth zu machen, theils auch ihr früheres Betragen bereuend, rief sie: Um Gottes willen, lieber Alfred, nur keine Ermahnung, sage einfach, was Du willst, und mach' es kurz!
Dabei legte sie ihren Arm um seinen Nacken und neigte sich zu ihm, als ob sie ihn küssen wollte, aber er wehrte es ihr leise und sagte sehr ernsthaft: Die Zeiten sind vorüber, in denen eine Liebkosung mich mit Deinen Fehlern versöhnte. Ich bin es herzlich müde, mich und den Knaben von Dir tyrannisiren zu lassen, ich bin es müde, jeden Freudenbecher, den das Leben mir bietet, durch Dich in Wermuth verwandeln zu sehen. Wir werden uns trennen!
Sie sah ihn in sprachloser Erstaunung an. Sein Ernst ließ sie das Schlimmste fürchten, aber sie wünschte von Herzen, sich zu täuschen, und sagte mit erzwungenem Lächeln: Soll das ein Kapitel aus Deinem neuen Roman sein? Es klingt sehr traurig.
Scherze nicht! entgegnete er ihr, es ist das entscheidende Kapitel unseres Ehestandes.
Aber was ist denn geschehen? rief sie, was bringt Dich gerade heute mit einem Mal so plötzlich auf?
Die Ungerechtigkeit und die Härte, welche Du heute wieder gegen den Knaben und gegen mich begangen hast. Sage selbst, was hatte ich Dir gethan? Warum hast Du das Kind, und obenein im Beisein einer Fremden, so hart gescholten?
Weil er wieder wie ein Bauernjunge mit zerrissenen Kleidern nach Hause kam, weil er gar nicht mehr zu bändigen ist, gegenredete die Mutter, den ersten Theil der Frage geschickt umgehend. Aber das sind die Folgen Deiner ewigen Lehren von der allgemeinen Gleichheit der Menschen, von der wahren Barmherzigkeit. Nun siehst Du selbst, wohin das führt. So mitten unter allem Gesindel läßt kein Edelmann seine Kinder aufwachsen, so verkennt Niemand als Du, was er seiner Stellung schuldig ist.
Und das sagst Du mir?
O! Du brauchst mich nicht zu erinnern, daß ich Dir eine glänzendere Stellung verdanke, als ich sie zu Hause gehabt; ich weiß wohl, daß es Dich oft genug gereut hat, die arme Registratorstochter geheirathet zu haben. Obgleich mein Vater so gut ein Edelmann war, als Du, hast Du Dich meiner doch von je geschämt.
Caroline! das sagst Du mir? fragte Alfred nochmals. Dann nahm er sie bei der Hand, führte sie zu dem Sopha, setzte sich neben sie und sagte mit befehlendem Ernst: Jetzt unterbrich mich einmal nicht! – Ja! Du hast wahr gesprochen, wahrer als Du weißt. Ja! ich schäme mich Deiner, ich habe mich Deiner oft geschämt, aber nicht um Deines armen, wackern Vaters willen, den ich hochgeschätzt, wie alles Tüchtige, das weißt Du wohl. Ich habe mich Deiner geschämt, wenn Du in ungezügelter Heftigkeit den Unfrieden unserer traurigen Ehe fremden Blicken preisgegeben hast, wie heute; wenn Du in blinder Eifersucht Dich und mich dem Spotte unserer Bekannten aussetztest.
Weiß es nicht längst alle Welt, daß Du und ich nie gleicher Ansicht sind? Wo steckt das große Verbrechen, daß ich dies heute halb im Scherze der Baronin sagte, und Felix einen Verweis gab, den er reichlich verdient hat! unterbrach sie ihn trotz seiner Warnung. Das thut jede Mutter; das thäten all die geistreichen Damen auch, die mir mit ihrer Anbetung für Dich, als wir in der Residenz waren, Dein Herz entfremdeten. Das hätte auch Deine Freundin, das hätte jene Baronin auch gethan, die Dir vor unserer Verheirathung wie ein Ideal erschien, im Gegensatz zu mir, und deren Bruder Dich zu allen Deinen poetischen Thorheiten verleitete.
Alfred fuhr auf und seine Hand ballte sich krampfhaft zusammen, doch sagte er ruhig: Therese Brand, die Du vermuthlich meinst, war eben so wenig Baronin als Du, aber eine sehr edele Natur, die mit lebhaftem Gefühl die Dichtungen begriff, welche ich Dir aus vollem Herzen weihte, und die Du nicht empfandest. Daß ihr Bruder Julian mich zum Drucke jener Gedichte überredete, war keine Thorheit; aber von dem Allen ist jetzt die Rede nicht.
Und hat er Dich nicht mit Gewalt bereden wollen, mit mir zu brechen? Habe ich nicht selbst den Brief gelesen, als Du einmal Deine Brieftasche bei uns hast liegen lassen? Er meinte, wir paßten nicht für einander, Du seist zu jung zum Heirathen, Du solltest mich aufgeben, mir eine reiche Mitgift aussetzen, damit ich bald einen andern Mann fände. Daran hätte es mir auch ohne eine Mitgift nicht gefehlt, und vielleicht wäre es besser für mich gewesen.
Alfred entgegnete ihr keine Sylbe; es entstand eine lange Stille, denn Caroline fand nicht den Muth, das Schweigen zu brechen, das drückend auf ihr lastete. Endlich that es Alfred.
Nach dieser Aeußerung, Caroline! sagte er sehr ruhig und bestimmt, obschon in seinem Antlitz seine innere Erregung klar zu lesen war, nach dieser Aeußerung und nach den Vorgängen der letzten Tage und Stunden, hoffe ich bei Dir auf keine Einwendungen zu stoßen, wenn ich Dir mittheile, was ich für uns beschlossen habe. Ich gehe noch heute nach der Stadt, werde dort bleiben und Felix, dessen Erziehung dies ohnehin erheischt, nachkommen lassen. Du magst über Deine Zukunft bestimmen, Dich einrichten, wie es Dir wünschenswerth scheint, nur nach Berlin komme für das Erste nicht. Darum bitte ich Dich, es würde uns die nothwendige Trennung nur erschweren.
Alfred! schrie Caroline im Tone des wahrsten Schmerzes auf, ist es denn möglich, Du willst mich verlassen? Habe ich Dir je Anlaß gegeben, an meiner Liebe zu zweifeln? Bin ich Dir nicht stets ein treues Weib gewesen?
Erniedrige Dich nicht durch solch ein Lob! versetzte er. Was frommte Treue, was galt Liebe, wo jeder Tag, jede Stunde mir Leid gebracht hat? Wir sind unglücklich gewesen durch einander, so wollen wir uns trennen, um fern von einander wenn nicht Glück, doch Ruhe und Frieden zu finden; um Felix dem üblen Einflusse zu entziehen, den unser Unglück auf ihn ausüben muß, je mehr er es begreifen lernt.
Alfred! flehte sie weinend und warf sich an seine Brust, Alfred! ich bin die Mutter Deines Kindes! Um unseres Felix willen vergib, vergib nur noch dies eine Mal, und bleibe!
Er aber machte sich sanft von ihr los und antwortete mit Thränen in den Augen: Ist es das erste Mal, daß solche Auftritte zwischen uns vorfallen? Ich weiß, Du bist an mich gewöhnt, Du liebst den Knaben, Du bist nicht böse, aber wie oft hast Du mir schon gelobt, Dich zu ändern? Wie oft hast Du mir versprochen, Deine Heftigkeit zu überwinden, Dich von dem Einfluß des Kaplan Ruhberg loszusagen, meinen Ansichten, meinen Wünschen Gehör zu geben, wie ich es stets mit den Deinen that? Ist es anders geworden trotz aller Deiner Versprechungen?
Sie schwieg, getroffen von der Wahrheit in den Worten ihres Mannes, und dieser fuhr fort: Glaubst Du, daß mir nicht das Herz blutet, jetzt, da ich von Dir scheide? Mit wie viel gutem Willen, mit wie redlichen Vorsätzen führte ich Dich in mein Haus! – Vielleicht war es unrecht, daß ich es that, obgleich ich fühlte, daß Manches störend zwischen uns lag. Ich habe vielleicht zu viel von Dir verlangt; verlangt, was Du nicht leisten konntest, und Du wärst glücklicher mit jedem andern Manne geworden, wie Du vorhin sagtest – das könnte sein und das wäre hart!
Eine neue Pause entstand. Caroline weinte laut, Alfred ging wieder im Zimmer umher, endlich blieb er vor seiner Frau stehen und sagte mit gepreßter Stimme: Der Verwalter hat meine Befehle für die nächste Zeit. Felix werde ich nicht sehen in diesem schweren Moment, sei nicht zu streng gegen ihn. Dann schritt er der Thüre zu, kehrte zurück, bot seiner Frau die Hand und sprach: Vergib mir, wenn Du so viel gelitten hast als ich, und versuche es, glücklicher zu werden.
Damit verließ er das Zimmer, sein harrender Kammerdiener warf ihm den Mantel über, er stieg in den Wagen, seine raschen Pferde brachten ihn zu der nächsten Station, von dort wollte er mit Postpferden nach der Residenz fahren.
Caroline blieb betäubt zurück; dann holte sie ihren Sohn, den sie mit Zärtlichkeit überhäufte. Auf seine Fragen, ob der Vater ausgefahren, ob er bald wiederkomme, antwortete sie bejahend, denn sie glaubte zuversichtlich an die Rückkehr ihres Mannes. Sie kannte sein weiches Herz, und sie hatte nicht so schwer durch ihre unglückliche Ehe gelitten, als er.
IV
Alfred fuhr die ganze Nacht hindurch. Er konnte nicht schlafen, denn sein Gemüth war zu aufgeregt durch das Scheiden von seiner Frau; all seine Gedanken wendeten sich der Heimat zu. Er sah seine Frau weinen, seinen Sohn nach dem Vater verlangen, das kleine Arbeitscabinet leer. Eine tiefe Wehmuth überfiel ihn, und wieder und immer wieder gedachte er prüfend der letzten Jahre, um sich zu überzeugen, daß der Schritt nothwendig, ja daß er unerläßlich gewesen sei, den er am Abende gethan hatte.
Diese Ueberzeugung beruhigte ihn allmälig, so daß er mit einer Art von Heiterkeit und mit einem Gefühl von Freiheit in die Natur hinausblickte, als ein frischer Windhauch seine Stirne kühlte und der junge Morgen die Erde beleuchtete. Es war ihm, wie in jenen Tagen erster Jugend, in denen man bei jedem Schritte aus dem gewohnten Kreise besondere Begebenheiten erwartet und Abenteuer träumt; und wirklich bereitete sich, während er über sich lächelte, ein ganz artiges Ereigniß für ihn vor.
Eine halbe Stunde näher zur Residenz fuhr ebenfalls ein eleganter, von Postpferden gezogener Reisewagen auf der Chaussee. Die Fenster desselben waren geschlossen, Postillon und Diener waren eingeschlafen, die Pferde gingen ruhig den oft gemachten Weg. Plötzlich, als die Straße sich senkte, trat das eine Pferd über die Deichsel und fiel nieder. Das erweckte den Postillon, er zerrte an den Zügeln, um das Thier zum Aufstehen zu bewegen, das sich in vergeblichen Bestrebungen hin und her warf. Man hörte ein leises Knacken und der Postillon erklärte fluchend dem indeß erwachten und abgestiegenen Diener, daß die Deichsel zerbrochen sei.
Da fielen zu beiden Seiten des Wagens die Fenster nieder und aus jedem sah ein Frauenkopf hervor. Während aber die eine Dame verwirrte Fragen an den Postillon richtete, befahl die andere, ihr den Wagenschlag zu öffnen, und stieg aus. Sie überzeugte sich bald von der Unmöglichkeit, den Wagen zur Weiterreise herzustellen, erfuhr, daß man etwa in der Mitte der Station, also eine Meile von den beiden nächsten Posthäusern entfernt sei, und faßte den Entschluß, in Begleitung des Dieners bis in das nächste Dorf zu gehen und nachzufragen, wie man sich dort helfen könne.
Während dessen hatte sich die andere Dame ganz ruhig in die Wagenecke zurückgelehnt und schien wirklich noch zu schlummern, als die Ausgestiegene sie freundlich zu ermuntern strebte. Komm Eva, komm! sagte sie, wir wollen uns auf den Weg machen! Wir müssen vorwärts! Es hilft uns Nichts.
Auf den Weg machen? – Gehen? – fragte Eva, wir Beide allein, hier in der fremden Gegend, das ist ja unmöglich!
Der Wille ihrer Freundin mußte aber wohl bestimmenden Einfluß auf sie üben, denn trotz ihrer Einwendungen schickte sie sich an, den Wagen zu verlassen, nachdem sie sich fest in den rothen Plaidmantel gehüllt, die seidene Capotte aufgesetzt und sich überzeugt hatte, daß das Spitzenhäubchen nicht vom Schlafe gelitten hätte. Die ältere der Beiden ließ darauf den Wagen schließen, befahl dem Postillon zur Bewachung desselben zurückzubleiben und schritt dann ruhig, Eva's Arm in den ihren legend, von dem Diener begleitet, die Poststraße hinan.
Sie schien mit rechter Wonne des schönen Morgens zu genießen, während Eva über den Thau, über Ermüdung und über tausend andere Unbequemlichkeiten klagte, und endlich ganz vergnügt ausrief: Ach Gott sei Dank! da höre ich ein Posthorn, da kommt gewiß die Schnellpost, da können wir mitfahren, hoffe ich!
Es fragt sich, ob Plätze für uns frei sein werden, wendete die Freundin ein.
Nun, wenn die Post voll ist, so sind doch gewiß auch Herren darin, die uns ihre Plätze abtreten. So ungalant wird doch kein Mann sein, daß er in dem großen Wagen vorüberfährt und uns auf der staubigen Chaussee zurückläßt.
Schnellpostreisende pflegen Eile zu haben, entgegnete Therese, und kein Gewerbe von ritterlicher Galanterie zu machen. Zudem scheint mir das nicht das Signal der Schnellpost, sondern das einer Extrapost zu sein, und damit werden Deine Hoffnungen noch ungewisser.
Das wäre aber schrecklich! Ich bin so müde von dem Fahren in der Nacht. Ich kann so weit nicht gehen, klagte Eva, von der plötzlichen Heiterkeit wieder in ihre frühere Verstimmung zurücksinkend.
Therese sprach ihr Muth ein, Eva hörte es schweigend mit an, und sie gingen auf's Neue vorwärts, als das Posthorn abermals und ganz in ihrer Nähe ertönte. Alfred's Wagen hielt vor ihnen, er stieg aus und begrüßte sie.
Ich habe Ihren Wagen auf dem Wege liegen gefunden, sagte er, und von dem Postillon gehört, daß Sie, meine Damen, mit mir dasselbe Ziel verfolgen. Wollen Sie mir die Ehre erzeigen, meinen Wagen zu benutzen?
Sie sind sehr liebenswürdig, sagte Eva.
Sie haben aber in Ihrer Kalesche nur für zwei Personen Platz, was wird aus Ihnen? fragte Therese.
Ich werde mich neben den Postillon setzen, mein Diener mag mit dem Ihrigen uns bis in das nächste Dorf zu Fuß nachkommen. Es würde mir eine Freude sein, Ihnen zu dienen. Mein Name ist von Reichenbach.
Der Name schien Therese sehr angenehm zu überraschen. Sie sah Alfred mit sichtlichem Vergnügen an und sagte dann: Wie wäre es, wenn wir Alle bis in das nächste Dorf gingen, dessen Thurm wir schon deutlich sehen? In der großen Stadt wird uns nicht leicht ein so frischer Morgen zu Theil werden. Finden wir im Dorfe nicht die Möglichkeit, weiter zu kommen, ohne Herrn von Reichenbach zur Last zu fallen, so wollen wir dankbar seinen Wagen bis zur nächsten Station benutzen. Plötzlich, sich an Eva's Klagen erinnernd, fragte sie diese: Aber Du möchtest wohl lieber gleich einsteigen, Eva? Du warst ermüdet.
Ich? Nicht im geringsten! antwortete diese ganz fröhlich und munter, und in Reichenbach's Begleitung machte man sich auf den Weg.
Neben den Damen einhergehend, hatte er die Gelegenheit, sie näher zu betrachten. Die ältere von Beiden war groß und schlank, aber nichts weniger als schön. Weiches blondes Haar umgab in breiten Flechten eine edle Stirn, die mit großen, dunkeln Augen dem Gesicht einen anziehenden Charakter gab. Ihr Teint war zart doch farblos. Sie mochte fast dreißig Jahre alt sein und sah ruhig und verständig aus. Ihre sehr einfache Kleidung paßte ganz zu ihrer Erscheinung und fiel deshalb nicht als etwas Besonderes an ihr auf. Alfred war gewiß, eine Frau aus den höhern Ständen in ihr zu sehen, denn in ihrem Betragen gegen ihre jüngere Freundin lag das sichere Bewußtsein einer Selbstständigkeit, die dieser zum Schutze diente.
Eva war sehr klein und das rosigste Bild der Jugend. Noch heller blond als Therese, hatte sie schöne blaue Augen, die übermüthig froh in die Welt blickten. Ihre kleine Stumpfnase, die üppigen Lippen waren nicht gerade regelmäßig schön, aber das ganze Gesicht so voll blühenden Lebens, daß man es, mit den tiefen Grübchen in Wange und Kinn, höchst reizend finden mußte.
Auch war die muntere Eva es, die zuerst eine Unterhaltung begann. Es bleibt immer ein mislich Ding, sagte sie, wenn Frauen allein reisen. Wie leicht entsteht ein Unfall und dann steht man hilflos da.
Und doch warst Du es gerade, die sich sehr darauf freute, ohne männliche Begleitung zu sein, die sogar mit der Schnellpost und ohne Diener reisen wollte, entgegnete Therese.
O! das war nur ein Einfall, eine Laune, weil mein Mann immer behauptete, Frauen könnten und dürften sich nicht allein auf Reisen begeben.
Ihr Mann? fragte Alfred verwundert, der sie für ein Mädchen gehalten hatte.
Mein verstorbener Mann, ich bin Witwe! erklärte Eva mit so viel Wehmuth und Würde, als sie in sich erzwingen konnte. Sie sah dabei aber so schalkhaft aus, daß Alfred und ihre Freundin wider ihren Willen lächelten.
Sie haben, nahm die Letztere das Wort, uns Ihren Beistand angeboten, Herr von Reichenbach, dessen wir, wie ich besorge, nöthig haben werden; Sie müssen also doch erfahren, wer wir sind. Meine Freundin ist Frau von Barnfeld, die Wittwe des Majors von Barnfeld, und ich – sie hielt inne, sah Alfred freundlich an und fragte: Erinnern Sie sich meiner nicht, habe ich mich denn so sehr verändert?
Therese, Fräulein von Brand! rief Alfred lebhaft. Es ist mir unerklärlich, daß ich Sie nicht gleich erkannte; mir war der Ausdruck Ihrer Augen doch so deutlich in der Seele geblieben, und ich hatte Ihrer erst neuerdings sehr oft gedacht.
Ich erkannte Sie gleich, sagte Therese, indem sie dem alten Freunde die Hand bot, obgleich wir uns mehr als zehn Jahre nicht gesehen haben; denn so lange ist es sicher her, seit wir uns in Berlin einst trennten.
Gewiß, antwortete er. Als ich drei Jahre später dorthin zurückkehrte, war Ihre verehrte Mutter schon gestorben, Julian an den Rhein versetzt und Sie ihm dorthin gefolgt. Nun hoffe ich ihn in Berlin zu finden.
Er ist augenblicklich nicht dort. Er hat diesen Sommer eine große Reise gemacht, von der er erst in diesen Tagen wiederkehren soll. Deshalb habe ich Frau von Barnfeld überredet, mit mir aus dem Seebade auch etwas früher nach Berlin zu gehen, damit Julian mich, wenn er kommt, schon wieder häuslich eingerichtet und in Ordnung findet.
Von beiden Seiten freute man sich des unerwarteten Begegnens. Fragen und Antworten folgten einander schnell. Sie waren so lange getrennt gewesen, daß sie viel nachzuholen hatten. Therese fragte, was Alfred nach Berlin führe, ob er lange dort verweilen werde? Er antwortete, daß sein Sohn in dem Alter sei, in welchem Schulbesuch für ihn zum Bedürfniß werde, und daß die Erziehung seines Knaben es ihm wünschenswerth mache, künftig in Berlin zu leben.
Das ist schön, Herr von Reichenbach, das wird Julian sehr glücklich machen, sagte Therese. Hoffentlich kehren uns dadurch die guten Stunden wieder, in denen wir uns zuerst Ihrer Arbeiten erfreuen durften. Ich war freilich damals kein zuverlässiger Richter, bin es wohl auch jetzt noch nicht, doch machte es mir große Freude, wenn Sie mich fragten: Ist es so gut? habe ich's so recht gemacht?
Und Sie haben mir immer den rechten Weg gewiesen, weil Ihr angeborner Schönheitssinn immer das Wahre und Schöne herausfand! Es war mit die glücklichste Zeit meines Lebens, und ich habe nie mit größerer Lust neue Arbeiten gelesen, als vor Ihrer Mutter, vor Ihnen und vor Julian. Wir haben recht frohe Stunden miteinander verlebt, sagte Alfred freundlich.
Bis dahin hörte Eva ruhig zu, dann aber ertrug sie es nicht länger, untheilnehmend bei einer Unterhaltung sein zu müssen, und rief: O, bitte! kommen Sie ein wenig aus der alten Vergangenheit in die Gegenwart zurück, zu der ich auch gehöre. Ich möchte Ihnen danken, Herr von Reichenbach, für den Genuß, den mir Ihre Werke gewährt haben. Mir ist, obgleich ich Sie nie vorher sah, als ob ich in Ihnen auch einen alten Bekannten wiederfände.
Das ist das Schöne in dem Leben eines Dichters, daß er sich Freunde erwirbt in weitester Ferne, wenn es ihm gelingt, jene Saiten zu berühren, die in jeder Brust wiederklingen. Wir senden die Empfindungen unseres tiefsten Innern als Gruß der Menschheit zu, und sie beantwortet ihn mit offnem Herzen, mit freundlichem Willkommen, wie Sie, meine gnädigste Frau! Das ist eine große Freude, haben Sie Dank dafür, sagte Alfred.
Bald darauf erreichte man das Dorf, fand, wie man es erwartet hatte, kein genügendes Fuhrwerk und fügte sich mit guter Art in Alfred's Anerbieten. Die Diener beider Herrschaften blieben zurück; man legte ein drittes Pferd vor die Kalesche, das der Postillon bestieg, die Damen nahmen die Plätze in der Kalesche, Alfred den Kutschersitz ein. Das Ungewohnte der Lage stimmte die drei Reisenden sehr heiter. Unter Scherzen mancher Art erreichte man die Station und ließ sich von Alfred überreden, in derselben Weise seine Begleitung nach Berlin anzunehmen, das nur noch ein paar Stationen entfernt war.
Als die Damen einige Stunden mit Alfred zusammengewesen waren und abwechselnd mit ihm und untereinander geplaudert hatten, sagte Eva zu ihrer Freundin: Mir ist selten ein liebenswürdigerer Mann vorgekommen, als es Reichenbach zu sein scheint; selbst Dein Bruder ist nicht so angenehm.
Bist Du schon wieder wankelmüthig? fragte Therese neckend. Gestern erklärtest du mir, Julian sei, obschon er nichts weniger als hübsch, ja eigentlich sogar häßlich sei, der liebenswürdigste Mann, den Du noch je gekannt hättest.
Das ist auch wahr! denn daß Dein Bruder häßlich ist, das schadet nichts, sagte Eva lebhaft, ich liebe ihn dennoch. Er ist so geistreich, so liebenswürdig, so herablassend – – Siehst Du, das ist es, das ist das Schlimme! rief sie, sich plötzlich unterbrechend. Julian ist oft so gut, daß man sich ganz sorglos ihm gegenüber gehen läßt. Er gibt sich jedem Scherz, jeder Persönlichkeit freundlich hin, aber er thut es, wie Jemand, der sich aus Gnade dazu herabläßt. Während er ganz freundlich ist, zucken plötzlich seine Lippen, er kann den innern Spott nicht mehr verbergen, er lacht über die Andern und über seine Herablassung, und dann ist er mir unerträglich.
Du solltest ihm das einmal sagen, liebe Eva!
Ich habe ihm das oft gesagt, als ich ihn kennen lernte und er sein Vetterrecht, ich weiß nicht im wievielten Grade, dazu benutzte, mich häufig zu besuchen. Ich mußte mir Muth gegen Euch schaffen, ich hatte kindische Furcht vor Julian's Spott und vor Deiner Ruhe. Ich konnte nicht begreifen, warum meine selige Mutter, als auch sie mir starb, durchaus verlangte, daß ich in Deiner Nähe leben und Julian der Verwalter meines Vermögens werden sollte. Jetzt freilich weiß ich, daß du mein guter Engel bist! – schloß sie, der Freundin die Hand bietend, die sie herzlich drückte.
In dem Augenblick wendete Alfred sich um und machte seine Schützlinge darauf aufmerksam, daß man die Stadt schon sehen könne. Therese, die wie ihr Reisegefährte ein sehr scharfes Auge hatte, entdeckte gleich ihm die Thürme am Horizonte. Die kurzsichtige Eva nahm ihr Glas zu Hilfe und klagte dann: Es ist ein Unglück, daß ich so klein bin, der große Kutschersitz raubt mir die Aussicht. Ich bin der ländlichen Freuden längst satt gewesen, ich denke mit Wonne an Berlin und nun kann ich es nicht einmal sehen.
Alfred, um sie zufrieden zu stellen, bot ihr seine Hände, sich daran zu erheben und festzuhalten, falls sie aufstehen wollte. Das nahm sie an und wußte sich vor Freude nicht zu lassen, als auch sie die Stadt erblickte.
Ach, rief sie der Freundin zu, mir ist unglaublich froh zu Sinne! Als ob uns jetzt lauter Liebes und Gutes in Berlin begegnen müßte und ganz Unerhörtes obenein. Ich habe noch nie einen Winter in Berlin verlebt, ich denke mir diese Bälle, Feste und Concerte gar zu prächtig! Ich wollte nur, die Bäume wären nicht mehr so sommerlich grün und der Winter wäre schon da!
Sie Glückliche! sagte Alfred, und es war Eva, als ob er ihre Hände leise in den seinen drückte. Wer so wie Sie nur Freude erwartet und Feste träumt, dem muß das Leben seine rosigste Seite gezeigt haben. Möge es immer so bleiben!
Und Sie erwarten nichts? fragte sie ihn.
Ich erwarte das Leben zu finden, wie es ist. Ernst mit gebieterischen Anforderungen, mit viel Leid und Elend, viel Jammer und Schlechtheit, und doch voll Freude und voll Großem und Erhabenem.
Eva sah ihn befremdet an. Dann setzte sie sich nieder und versank schweigend in Nachdenken, bis man die Stadtmauer erreichte. Alfred fuhr Therese erst nach ihrer Behausung in der Wilhelmsstraße, dann ging es nach Eva's Wohnung unter den Linden. Mit Freude hörte sie, daß ihr Begleiter ganz in ihrer Nähe wohnen werde. Er mußte versprechen, sie gleich am nächsten Morgen zu besuchen, und man trennte sich herzlich, wie alte Bekannte, weil die gemeinsame Reise die Fremden einander näher gebracht und über manche Förmlichkeiten fortgeholfen hatte.
V
Am nächsten Morgen ließ sich Alfred bei Frau von Barnfeld melden. Er fand sie in einem Zimmer, das nach den Forderungen der Mode auf das glänzendste eingerichtet, voll von gepolsterten Sopha's und Sesseln und so mit Bildern, Kleinigkeiten, Blumen und Epheuwänden überfüllt war, daß es dem Spielzeugschränkchen eines verwöhnten Kindes glich.
Eva selbst lag in weißem, mit rosa Bändern geziertem Negligée auf einem dunkelgrünen Plüschsopha, das von einer Epheulaube beschattet war. Unwillkürlich mußte Alfred lächeln. Sie sah aus, wie jene Wachspüppchen, die man in Nuß- oder Eierschalen verbirgt, und die uns, wenn wir die Hülle öffnen, aus grünem Blätternetz rosig entgegenlächeln.
Bei Alfred's Eintritt richtete sie sich ein wenig empor und sagte: Ich weiß wohl, Herr von Reichenbach, daß ich Sie, als einen neuen, werthen Gast, mit mehr Form empfangen müßte; ich bin aber müde von der Reise und so froh, mich auf einem ordentlichen Sopha von den ländlichen Divans des Seebades zu erholen, daß Sie Nachsicht haben müssen.
Alfred bat sie, sich nicht stören zu lassen. Eine bejahrte Frau, die im Zimmer mit weiblicher Arbeit beschäftigt war, rückte ihm einen Sessel zurecht und, nachdem er Platz genommen hatte, fragte ihn Eva: Wissen Sie es denn schon, daß der Präsident von Brand auch gestern und noch früher angekommen ist als wir? Therese hat es mir heute sagen lassen. Damit ist ihr nun die Freude verloren gegangen, den Bruder zu überraschen.
So darf ich vielleicht hoffen, ihn bald bei Ihnen zu sehen? fragte Reichenbach.