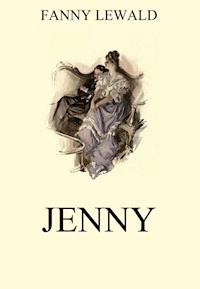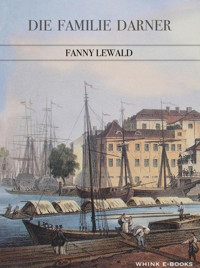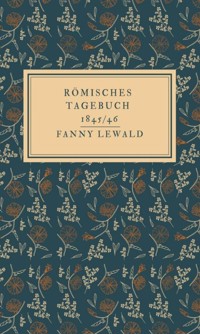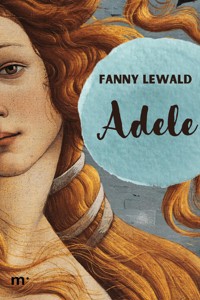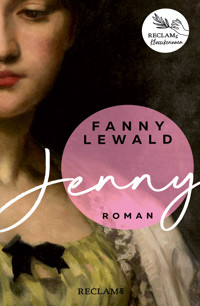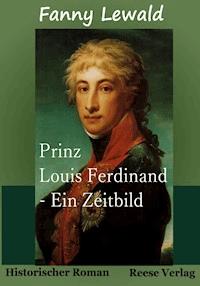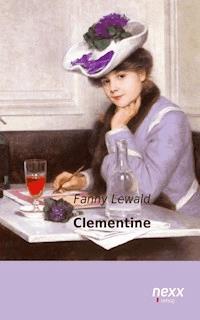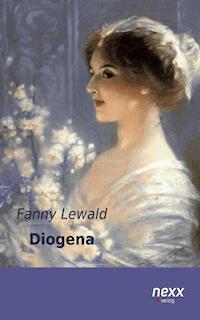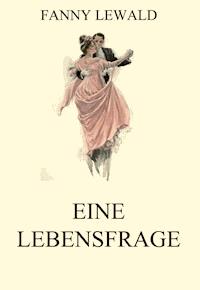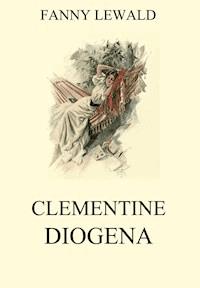Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Band umfasst die vierzehn Briefe, die Lewald, eine Vorreiterin der Frauenemanzipation, an John Stuart Mill in England schickte.
Das E-Book Für und wider die Frauen wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für und wider die Frauen
Fanny Lewald
Inhalt:
Fanny Lewald – Biografie und Bibliografie
Für und wider die Frauen
An John Stuart Mill
Erster Brief
Zweiter Brief
Dritter Brief
Vierter Brief
Fünfter Brief
Sechster Brief
Siebenter Brief
Achter Brief
Neunter Brief
Zehnter Brief
Elfter Brief
Zwölfter Brief
Dreizehnter Brief
Vierzehnter Brief
Für und wider die Frauen, F. Lewald
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849630560
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Fanny Lewald – Biografie und Bibliografie
Schriftstellerin, geb. 24. März 1811 zu Königsberg i. Pr. von israelitischen Eltern, gest. 5. Aug. 1889 in Dresden, trat in ihrem 17. Jahre zur evangelischen Kirche über, begleitete 1831 ihren Vater auf einer Reise durch Deutschland und Frankreich und lebte sodann längere Zeit in Breslau und Berlin. Nachdem sie schon 1834 zur Unterhaltung einer kranken Schwester Märchen geschrieben hatte, betrat sie 1841 die schriftstellerische Laufbahn mit der Novelle »Der Stellvertreter« (in der »Europa«). Es folgten ohne ihren Namen: »Klementine« (Leipz. 1842); »Jenny« (das. 1843); »Eine Lebensfrage« (das. 1845); »Das arme Mädchen« (in der »Urania«). Im Frühjahr 1845 bereiste sie Italien und nahm sodann ihren Aufenthalt in Berlin, wo sie sich 1854 mit Adolf Stahr (s. d.) verheiratete, mit dem sie in der Folge eine Reihe von Reisen unternahm. Ihre literarische Produktivität steigerte sich, ohne an innerem Wert zu verlieren. Nacheinander erschienen: »Italienisches Bilderbuch« (Berl. 1847); »Diogena, Roman von Iduna Gräfin H.-H.«, eine anonym erschienene Persiflage der Gräfin Hahn-Hahn (2. Aufl., Leipz. 1847); »Prinz Louis Ferdinand« (Bresl. 1849, 3 Bde.; 2. Aufl., Berl. 1859); » Erinnerungen aus dem Jahre 1848« (Braunschw. 1850, 2 Bde.); »Liebesbriefe« (das. 1850, schon 1845 entstanden); »Dünen- und Berggeschichten« (das. 1851, 2 Bde.); »England und Schottland«, Reisetagebuch (das. 1852, 2 Bde.); »Wandlungen«, ein Roman (das. 1853, 4 Bde.), »Deutsche Lebensbilder« (das. 1856); »Die Reisegefährten« (Berl. 1858); »Das Mädchen von Hela« (das. 1860); »Meine Lebensgeschichte« (das. 1861–63, 6 Bde.); »Bunte Bilder« (das. 1862, 2 Bde.); »Von Geschlecht zu Geschlecht«, Roman (das. 1863–65, 8 Bde.); »Osterbriefe für die Frauen« (das. 1863); »Erzählungen« (das. 1866–1868, 3 Bde.); »Villa Riunione« (das. 1863, 2 Bde.); »Sommer und Winter am Genfer See«, ein Tagebuch (das. 1869); »Für und wider die Frauen«, Briefe (das. 1870, 2. Aufl. 1875); »Nella, eine Weihnachtsgeschichte« (das. 1870); »Die Erlöserin«, Roman (das. 1873, 3 Bde.); »Benedikt« (das. 1874, 2 Bde.); »Benvenuto«, Roman aus der Künstlerwelt (das. 1875, 2 Bde.); »Neue Novellen« (das. 1877); »Reisebriefe aus Italien, Deutschland und Frankreich« (das. 1880); »Helmar«, Roman (das. 1880); »Zu Weihnachten«, drei Erzählungen (das. 1880); »Vater und Sohn«, Novelle (das. 1881); »Vom Sund zum Posilipp«, Reisebriefe (das. 1883); »Stella«, Roman (das. 1884, 3 Bde.); »Die Familie Darner«, Roman (das. 1887); »Zwölf Bilder nach dem Leben« (das. 1888) u.a. Von ihren Schriften erschien eine Auswahl u. d. T.: »Gesammelte Werke« (Berl. 1871–74, 12 Bde.); aus ihrem Nachlaß veröffentlichte L. Geiger »Gedachtes und Gefühltes, 1838–1888« (Mind. 1900). F. Lewalds Romane sind durch eine außerordentlich scharfe Beobachtung, durch energische Plastik der Gestaltung und klare Durchbildung des Stils ausgezeichnet. Die Grundlage ihrer Anschauung aber ist ein herber und harter Realismus, der im rechnenden Verstand und in der leidenschaftslosen Nüchternheit eine Art Ideal erblickt, von ihr die Lösung aller Rätsel des Daseins erwartet und begreiflicherweise nur in einzelnen Fällen eine poetische Wirkung hervorzurufen vermag. Vgl. K. Frenzel, Erinnerungen und Strömungen (Leipz. 1890).
Für und wider die Frauen
An John Stuart Mill
Wenn ich es mir erlaube, Ihnen eine Reihe von Briefen vorzulegen, welche ich in deutschen Zeitungen und Zeitschriften, zu Gunsten der Erwerbthätigkeit und der allmählichen Emancipation der Frauen, veröffentlicht habe, so geschieht dies in der Hoffnung, daß der tiefsinnige Denker, der sich warmen Herzens und gerechten Sinnes zum Vertreter der bisher niedergehaltenen Frauen machte, Theilnahme haben müsse für jedes Streben nach dem gleichen Ziele.
Ich lebte an den Ufern des Genfersees, als ich im Frühjahr von achtzehnhundertachtundsechszig die sechs ersten dieser Briefe schrieb. Die andern sind im Laufe dieses Jahres theils hier in unserer Heimath, theils auf der Reise, durch äußere und innere Anregungen hervorgerufen worden, und erst vor wenig Tagen ist mir bei unserer Rückkehr nach Berlin Ihre großsinnige Arbeit über die Hörigkeit der Frauen bekannt geworden.
Haben Sie Dank für dieses Werk, Dank für den hoffnungsreichen Zuspruch, welchen Sie auch mir damit bereitet haben, und lassen Sie mich es Ihnen ausdrücken, wie sehr es mich erhoben hat, mich mit meinen bescheidenen Bestrebungen den großen und tiefen Gedanken eines Mannes, wie Sie, so nahe verwandt fühlen zu dürfen.
Was Sie der Eigensucht und dem Vorurtheil, was Sie den ungläubig Zweifelnden, auf dem sonnenklaren Wege Ihres Denkens deutlich und einleuchtend zu machen trachten, das habe ich, bei den verschiedensten Anlässen, an dem praktischen Beispiel darzuthun versucht – und in Ihrem Vaterlande, wie in dem meinen, haben Sie und ich einen mächtigen Bundesgenossen zu gewärtigen, an der geistigen Verkümmerung und an der leiblichen Noth, in welcher nur zu viele Frauen schmachten.
In Deutschland hat diese wachsende Noth in den letzten Jahren siegreich wie ein Aufklärer gewirkt. Sie hat Viele, die nicht sehen wollten, gezwungen, das Auge zu öffnen. Noch vor wenig Jahren wurde man von den meisten Männern, und nicht minder von den wohlversorgten Frauen, mit einem überlegenen Lächeln abgewiesen, wenn man auch nur von der Berechtigung der Frauen zur Selbstständigkeit und zu selbstständigem Erwerbe sprach; – und jetzt, in dieser letzten Woche, haben hier in Berlin eine beträchtliche Anzahl von Frauen aus allen Theilen von Deutschland, als Abgeordnete der Vereine für die Erhebung und die Gewerbthätigkeit der Frauen, eine Conferenz abgehalten, bei welcher einer unserer verdientesten Männer, Professor von Holzendorf, mit Fräulein Louise Büchner aus Darmstadt, mit Frau Scheppler Lette aus Berlin, und mit Frau Kate Doggett aus Chicago den Vorsitz geführt hat.
Die Conferenz ist würdig und für die Zukunft fördersam verlaufen, und sie würde Ihnen den besten Beweis dafür geliefert haben, daß Sie, verehrter Herr! den geistigen Standpunkt der deutschen Frauen in Ihrem Werke bedeutend unterschätzten.
Ich kenne keine Nation, die englische und die amerikanische nicht ausgenommen, in welcher das Mittelmaaß der allgemeinen Bildung unter den Frauen höher stände, als bei uns. Und wenn ich auch in den Briefen, welche ich Ihnen hiermit übersende, die gerechte Klage ausgesprochen habe, daß bei uns den Frauen eine gründliche wissenschaftliche Bildung ebenso fehle, wie eine solide Anleitung für praktische Thätigkeit, so ist doch dieser Mangel, so weit ich es erfahren und selbst beobachtet habe, heute fast noch überall vorhanden, bei Ihnen sowohl als hier bei uns – wenn wir auch hüben und drüben ehrenvolle Ausnahmen verzeichnen dürfen. Keines Falles stehen aber die deutschen Frauen auf dem Standpunkte der in Klöstern erzogenen Frauen der romanischen Stämme. Schon die freudige und verständnißvolle Zustimmung, mit welcher Ihr Werk zu Gunsten der Frauen, von so vielen meiner Landsmänninnen aufgenommen worden ist, muß Ihnen ein Beweis dafür sein, daß die deutschen Frauen sich zu denjenigen Frauen zählen dürfen, welche es verdienen, in John Stuart Mill ihren Vertreter gefunden zu haben.
Genehmigen Sie die Versicherung hoher Verehrung für Sie, und des Dankes für Ihr Werk, von einer Frau, die seit nahezu einem Menschenalter in ihrer literarischen und privaten Thätigkeit dieselbe hochwichtige Aufgabe in ihrem Vaterlande nach Kräften zu fördern, nicht ohne Erfolg bestrebt gewesen ist.
Berlin, 1869 am 10. November,
dem Geburtstage Schiller's.
Fanny Lewald-Stahr.
Erster Brief
Montreux, im Frühjahr 1868.
Sie haben mir nur Gerechtigkeit widerfahren lassen, meine werthen Freunde! wenn Sie annehmen, daß der Fortgang der Hamburger Schule für die Gewerbthätigkeit der Frauen meine lebhafte Theilnahme erregen müsse. Ich darf mir sagen, daß ich zu denen gehöre, die in Deutschland vielleicht am frühesten auf die unerläßliche Emancipation der Frauen zur Arbeit hingewiesen haben, und zwar zuerst aus sittlichen Gründen.
Ich hielt es nämlich von jeher für geboten, daß man die Frauen in einer Weise erziehe und unterrichte, welche es ihnen möglich mache, sich selber ausreichend zu ernähren, um sie damit vor der entehrenden Nothwendigkeit zu sichern, sich ohne Neigung zu verheirathen, oder mit andern Worten, die die Sache bei ihrem rechten Namen nennen, sich für den Preis einer lebenslänglichen Versorgung zu verkaufen. Ich habe das, selbst noch leidlich jung, vor jenen achtundzwanzig Jahren in meiner ersten ziemlich schüchternen Dichtung, in dem kleinen Roman »Clementine« ausgesprochen; und ich bin später bei jedem Anlaß in meinen Arbeiten darauf geflissentlich zurückgekommen. Die Novelle »Die Hausgenossen« war demselben Gegenstande gewidmet, und endlich habe ich »Meine Lebensgeschichte« und die »Osterbriefe für die Frauen« nur mit der bestimmten Absicht geschrieben, es den Frauen und den Männern, Beiden, klar zu machen, was für die Erziehung der Frauen geschehen müsse, um ihnen in der menschlichen Gesellschaft den Platz und die Wirksamkeit einzuräumen, auf die jedes vernünftige Wesen einen Anspruch hat, sofern es nämlich überhaupt ein selbständiges Dasein führen kann.
Seit dem Erscheinen meiner Lebensgeschichte und der Osterbriefe habe ich nun eben durch diese Veröffentlichungen Gelegenheit gefunden, noch weit ausgedehntere Blicke als früher in die Lage der Frauen in unserem Vaterlande zu thun. Wohl an hundert Briefe sind an mich in dem Verlauf dieser Jahre aus den verschiedensten Theilen von Deutschland gerichtet worden, und in allen sprachen Frauen oder Mädchen mir ihren Dank dafür aus, daß ich mich der Sache unseres Geschlechtes angenommen hätte, und Alle verlangten Rath und Förderung für ihr Fortkommen und für ihre Lebensführung von mir.
Sie gehörten, wie ich eben jetzt bei dem Durchblättern des Buches ersehe, in welchem ich die an mich eingehenden Briefe zu notiren gewohnt bin, zumeist den bürgerlichen Mittelständen, theils aber auch den sogenannten höheren Ständen an; und wie ich mich sehr deutlich erinnere, liefen die Briefe fast sammt und sonders auf ein und dasselbe hinaus, wenngleich die Nebenumstände verschieden waren. Nur einige der Schreiberinnen waren Wittwen, die sich allein, oder sich und ihre Kinder, nicht zu ernähren vermochten. Meist waren es jüngere oder ältere Mädchen, die sich, mit ihrem Loose nicht zufrieden, die sich, wie es der Ausdruck dafür ist, »unausgefüllt« und »überflüssig« in der Welt fühlten. Häufig kamen mir auch Gouvernanten und Gesellschafterinnen vor, denen die Aussicht, »ewig in dieser Abhängigkeit zu leben«, sehr niederschlagend dünkte.
Ließ ich mich dann näher auf die Verhältnisse der Klagenden und auf ihre Beschwerden und auf ihre Wünsche ein, so kam ich – einzelne Fälle ausgenommen – meist zu dem immer gleichen Resultate. Die Einen hatten gar nichts Ordentliches gelernt und nur allerlei bunte Lectüre getrieben, aus der sie ein unbestimmtes Verlangen nach einer glückbringenden Selbständigkeit in sich aufgenommen hatten; die Anderen besaßen die eben auch nicht übermäßigen Kenntnisse, welche das Gouvernanten-Examen erfordert. Alle aber hielten, hinter mehr oder weniger verschleiernden Worten, die geheime Ueberzeugung zurück, daß sie zu Schriftstellerinnen geboren wären, daß ich sie ermuthigen würde, sich als solche zu versuchen, und daß, wenn sie nur erst ihren Namen unter dem Titel einer Novelle in irgend einem Journale gedruckt gesehen hätten, auch gleich die ersehnte Selbständigkeit und alle Genüsse des Lebens ihren Anfang nehmen und dann in immer reicherer Fülle auf sie herniederregnen würden.
Sie haben mir oft recht leid gethan, die guten Seelen, wenn ich in das feine und künstliche Spinngewebe ihrer Hoffnungen und in alle die rosigen Erwartungen, welche sie auf mich und meinen Beistand gerichtet hatten, mit der groben Frage hineinfahren mußte: was haben Sie denn gelernt? welche Fähigkeit oder Fertigkeit besitzen Sie, auf die sich die Aussicht einer ersprießlichen Thätigkeit bauen ließe? – In der Regel spielten sie Clavier und konnten, wie sie glaubten, so viel englisch oder französisch, um aus diesen Sprachen übersetzen zu können, wobei sie nur leider meist das Eine übersahen, daß ihre Kenntniß der Muttersprache unvollkommen und daß sie des deutschen Styles lange nicht in dem Grade Meister waren, um wirklich brauchbare Uebersetzungen liefern zu können.
Ging ich dann endlich noch näher in ihre Bedürfnisse und auf meine Ansicht ein, wie man diese Bedürfnisse befriedigen könne, so that sich gleich eine Kluft zwischen mir und ihnen auf, und wir waren in der Regel bald geschiedene Leute. Mündlich und schriftlich haben sie bisweilen es ausgesprochen, daß ich sie und das innerste Bedürfniß ihres Herzens und Geistes nicht verstanden hätte, daß sie sich in mir und in dem Glauben an meine Menschenliebe, wie in der Hoffnung betrogen gefunden hätten, daß ich wirklich Theilnahme für das traurige Schicksal der Frauen innerhalb unserer jetzigen gesellschaftlichen Verhältnisse hege. Sie wollten eben »auf ihre Façon selig werden« und nicht auf die meine, und ich bin ihnen immer sehr prosaisch vorgekommen, wenn ich ihnen den Rath gegeben habe, es doch mit einem bürgerlichen Gewerbe zu versuchen, da man Schriftsteller und Dichter nicht wie Graveur oder Putzhändler werden könne.
Ich fand keinen Glauben bei ihnen, wenn ich ihnen versicherte, daß ich für mein Theil mit freiem Sinne und leichtem Herzen in einem Thee- oder Wäscheladen gestanden haben würde, wenn mein dichterisches Vermögen in einer Zeit erloschen wäre, in welcher ich es noch nöthig gehabt hätte, für mein Brod und meine Zukunft zu sorgen; und während sie Alle über ihre Abhängigkeit, sei es von zu beengten Familienverhältnissen oder über die Abhängigkeit von den Familien klagten, denen sie als Lehrerinnen oder Gesellschafterinnen dienten, meinten sie, daß ich ihnen eine Selbsterniedrigung zumuthe, wenn ich ihnen den Rath ertheilte, tagüber in einem Gewerbe zu arbeiten, um Abends das unschätzbare Gefühl der Selbstständigkeit zu genießen und sich sagen zu können, daß sie sich mit ihrer Gewerbthätigkeit wohl am Ende ein sorgenfreies und völlig unabhängiges Leben erringen könnten.
Böser Wille lag in diesem Gebahren der Mädchen keinesweges. Sie waren häufig wirklich zu beklagen und sie wollten sich redlich helfen; aber sie waren durch das Vorurtheil befangen, welches bisher die Frauen der mehr oder weniger gebildeten Stände zu lebenslänglicher und oft sehr kümmerlicher Abhängigkeit verdammte.
Wir Alle sind noch auferzogen und erwachsen unter dem Banne gewisser Redensarten, die sehr gut klangen, die aber den Frauen, wenn sie in Noth geriethen, wenig oder gar nichts halfen. An allen Ecken und Enden konnte man es aussprechen hören, daß »die Frau durch ihre Natur und durch die Verhältnisse der civilisirten Staaten nur für das Leben innerhalb der Familie bestimmt sei!« – daß »die Frau fraglos die beste sei, von welcher man niemals etwas höre!« – daß »der keusche Dämmer des Hauses die eigentliche und einzige Heimath des Weibes sei!« – und wie die schönen landläufigen Phrasen alle hießen, mit welchen ein großer Theil der Männer uns von einer ehrenvollen Selbständigkeit zurückzuhalten und uns gelegentlich eben dadurch in große Noth zu stürzen, für geboten, ja für eine Art von männlichem Rechte und männlicher Pflicht erachtete.
Man hätte wirklich glauben sollen, daß in unserer europäischen und speciell in unserer deutschen bürgerlichen Gesellschaft – wie in Californien und in Australien – Tausende von Männern umherschmachteten, denen zu ihrem vollständigen Glücke gar nichts fehle als eine Frau, die sich von ihnen ernähren zu lassen die Güte hätte. Es wäre auch gegen jene Aussprüche über unsern sogenannten wahren Beruf gar nichts einzuwenden gewesen, wenn die Männer, von denen sie ausgingen, sich nur stets geneigt gezeigt, oder immer in der Lage befunden hätten, sämmtliche Frauen und Mädchen diesem ihrem eigentlichen Berufe, das hieß in ihrer Sprache, der Ehe und der Versorgung durch die Ehe, zuzuführen.
Aber von den Männern, welche es mit großer Energie behaupteten, daß »die Frau nur für die Ehe und für die Familie bestimmt sei,« stand doch eine recht beträchtliche Anzahl – und mit großem Rechte – ganz entschieden an, sich ein armes Mädchen zur Frau zu nehmen; und da zur Gründung einer Familie immer zwei Personen gehören, so sah es denn mit der »Naturbestimmung und dem durch die staatlichen Verhältnisse einzig geheiligten Berufe« für diejenigen Frauen oft gar mißlich aus, welche jene Verfechter unseres eigentlichen Berufes zu heirathen nicht gerathen gefunden hatten. Zu verdenken, ich wiederhole es, war es den Männern nicht. Denn bei all dem Herren- und Herrschaftsbewußtsein der Männer, ist es für sie in vielen Fällen keine Kleinigkeit, lebenslang eine ganze Familie ganz allein zu ernähren und mit der Sorge um ihre Hilflosigkeit noch in der Todesstunde beladen zu sein.
Man brauchte nur – und wenn ist das nicht einmal begegnet? – in ein Haus zu kommen, in welchem der Ernährer die Augen geschlossen hatte. Ob er Kaufmann, Krämer, Regierungsrath, Doctor oder Major gewesen – gleichviel! Er war der Ernährer gewesen und war gestorben. Mit Mühe, oft auch mit ungeheuren Anstrengungen hatte er die Summe alljährlich erworben, deren die Seinen zu ihrem Unterhalte benöthigt gewesen waren. Die Frau, die er als echt weibliches und ganz häuslich gewöhntes Mädchen vor jenen fünfundzwanzig oder dreißig Jahren geheirathet, hatte es wohl verstanden, das Geld, welches der Mann erwarb, zu Rathe zu halten und aus dem Thaler sogar mehr als manche Andere mit den dreißig Groschen zu machen, und man hatte von ihr auch – nach der Vorschrift – nichts gehört, als daß sie so und so viel Kinder geboren, und was sie etwa selber ihren Bekannten von ihren häuslichen Leiden und Freuden zu sagen und zu klagen für gut befunden hatte. Nun aber war der Ernährer todt; die Mutter saß da, die Töchter, die auch alle für die Ehe und für den keuschen Dämmer des Hauses erzogen worden, saßen daneben. Sie würden gern immer weiter gespart haben wie sonst, zusammengehalten haben wie sonst; es kam nur nichts mehr in das Haus, was zusammengehalten werden konnte; und der rechte, tiefe, geheiligte und reine Schmerz um den Gatten und den Vater ward entweiht durch den Gedanken, daß der Ernährer gestorben sei. Die reine Empfindung ward durch die Nahrungssorge erstickt. – Statt mit liebenden Erinnerungen sich in die Vergangenheit versenken zu können, saßen die Mutter und die Töchter beisammen und fragten sich, vorwärts blickend: »Aber was nun?«
Da bekommt man denn von diesen Frauen, von denen man allerdings bis dahin vielleicht nichts gehört, nur um so mehr zu hören, und zwar Klagen über ihre Hilflosigkeit, bittere Klagen über ihre Unfähigkeit, auch nur zehn Thaler zu erwerben; und mit dem »keuschen Dämmer des Hauses« ist es dann auch in der Regel bald vorbei. Man muß zu berechnen anfangen, was von dem Mobiliar dieses keuschen Dämmers verkauft werden soll, um die Kosten der Trauerkleider und des Begräbnisses zu bezahlen; und man ist dann immer nur zu froh, wenn man die eine der Töchter mit dem ersten besten Mann verheirathen und die andere in die erste beste Familie bringen kann, in welcher sie mit sechzig Thalern Gehalt als Gesellschafterin einer vielleicht sehr launenhaften Frau ein wenig näht und flickt und vorliest und Clavier klimpert, und nebenher mit der standesmäßigen keuschen Ungeduld Tag und Stunden zählt und immer wartet und wartet und hofft und hofft, ob sich nicht Jemand finden werde, sie – wie einst der Vater die Mutter – auch in den keuschen Dämmer des Hauses, in die Ehe und in die Versorgung einzuführen. Jedes Jahr macht sie unzufriedener, jedes Jahr wird sie weniger anspruchsvoll, und zuletzt heirathet sie im glücklichsten Falle gleichviel welchen Mann, wenn er sie zu ernähren übernimmt.
Darin, und dies Bild ist lebenstreu und nicht in seinen Farben übertrieben, darin liegt aber weder der Beruf der Frau, noch das wahre Gedeihen des Familienlebens, noch wahre Keuschheit, noch die deutsche Gemüthlichkeit oder gar die Frauenwürde und der wahre Seelenadel eines Menschen! – Oder wissen die Männer, die nur von den stillen Frauen in der heimlichen Kemnate träumten, die nur die sogenannten kindlichen Seelen in uns schätzen wollten und die von der einfältigen Hilflosigkeit des weiblichen Geschlechtes so entzückt waren, als wären wir Paradiesvögel, die nie die Erde zu berühren brauchen und von bloßem Sonnenschein leben können, wissen diese Männer es etwa anders?