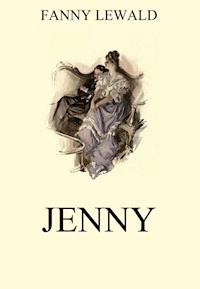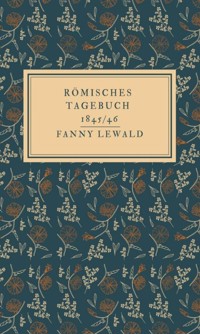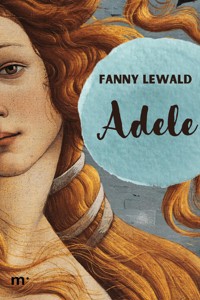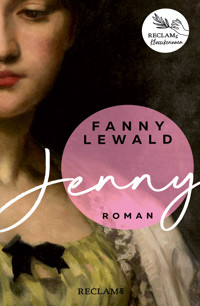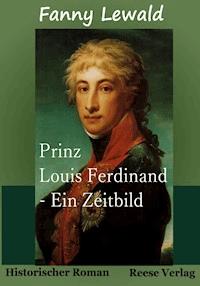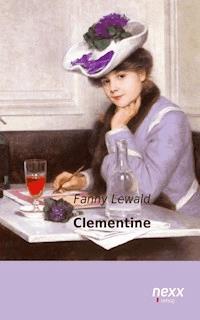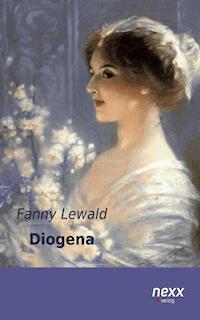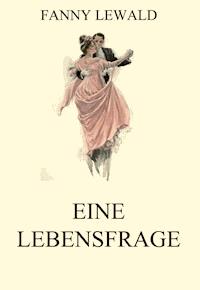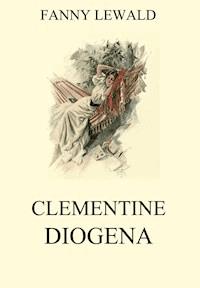Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Autobiografie der bekannten Frauenrechtlerin. Fanny Lewald war eine Vorkämpferin der Frauenemanzipation und forderte das uneingeschränkte Recht auf Bildung und auf gewerbliche Arbeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1448
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meine Lebensgeschichte
Fanny Lewald
Inhalt:
Fanny Lewald – Biografie und Bibliografie
Meine Lebensgeschichte
Im Vaterhause
Einleitung
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechszehntes Kapitel
Siebenzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Leidensjahre
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechszehntes Kapitel
Siebenzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Befreiung und Wanderleben
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Eilftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechszehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Meine Lebensgeschichte, F. Lewald
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849630591
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Fanny Lewald – Biografie und Bibliografie
Schriftstellerin, geb. 24. März 1811 zu Königsberg i. Pr. von israelitischen Eltern, gest. 5. Aug. 1889 in Dresden, trat in ihrem 17. Jahre zur evangelischen Kirche über, begleitete 1831 ihren Vater auf einer Reise durch Deutschland und Frankreich und lebte sodann längere Zeit in Breslau und Berlin. Nachdem sie schon 1834 zur Unterhaltung einer kranken Schwester Märchen geschrieben hatte, betrat sie 1841 die schriftstellerische Laufbahn mit der Novelle »Der Stellvertreter« (in der »Europa«). Es folgten ohne ihren Namen: »Klementine« (Leipz. 1842); »Jenny« (das. 1843); »Eine Lebensfrage« (das. 1845); »Das arme Mädchen« (in der »Urania«). Im Frühjahr 1845 bereiste sie Italien und nahm sodann ihren Aufenthalt in Berlin, wo sie sich 1854 mit Adolf Stahr (s. d.) verheiratete, mit dem sie in der Folge eine Reihe von Reisen unternahm. Ihre literarische Produktivität steigerte sich, ohne an innerm Wert zu verlieren. Nacheinander erschienen: »Italienisches Bilderbuch« (Berl. 1847); »Diogena, Roman von Iduna Gräfin H.-H.«, eine anonym erschienene Persiflage der Gräfin Hahn-Hahn (2. Aufl., Leipz. 1847); »Prinz Louis Ferdinand« (Bresl. 1849, 3 Bde.; 2. Aufl., Berl. 1859); » Erinnerungen aus dem Jahre 1848« (Braunschw. 1850, 2 Bde.); »Liebesbriefe« (das. 1850, schon 1845 entstanden); »Dünen- und Berggeschichten« (das. 1851, 2 Bde.); »England und Schottland«, Reisetagebuch (das. 1852, 2 Bde.); »Wandlungen«, ein Roman (das. 1853, 4 Bde.), »Deutsche Lebensbilder« (das. 1856); »Die Reisegefährten« (Berl. 1858); »Das Mädchen von Hela« (das. 1860); »Meine Lebensgeschichte« (das. 1861–63, 6 Bde.); »Bunte Bilder« (das. 1862, 2 Bde.); »Von Geschlecht zu Geschlecht«, Roman (das. 1863–65, 8 Bde.); »Osterbriefe für die Frauen« (das. 1863); »Erzählungen« (das. 1866–1868, 3 Bde.); »Villa Riunione« (das. 1863, 2 Bde.); »Sommer und Winter am Genfer See«, ein Tagebuch (das. 1869); »Für und wider die Frauen«, Briefe (das. 1870, 2. Aufl. 1875); »Nella, eine Weihnachtsgeschichte« (das. 1870); »Die Erlöserin«, Roman (das. 1873, 3 Bde.); »Benedikt« (das. 1874, 2 Bde.); »Benvenuto«, Roman aus der Künstlerwelt (das. 1875, 2 Bde.); »Neue Novellen« (das. 1877); »Reisebriefe aus Italien, Deutschland und Frankreich« (das. 1880); »Helmar«, Roman (das. 1880); »Zu Weihnachten«, drei Erzählungen (das. 1880); »Vater und Sohn«, Novelle (das. 1881); »Vom Sund zum Posilipp«, Reisebriefe (das. 1883); »Stella«, Roman (das. 1884, 3 Bde.); »Die Familie Darner«, Roman (das. 1887); »Zwölf Bilder nach dem Leben« (das. 1888) u.a. Von ihren Schriften erschien eine Auswahl u. d. T.: »Gesammelte Werke« (Berl. 1871–74, 12 Bde.); aus ihrem Nachlaß veröffentlichte L. Geiger »Gedachtes und Gefühltes, 1838–1888« (Mind. 1900). F. Lewalds Romane sind durch eine außerordentlich scharfe Beobachtung, durch energische Plastik der Gestaltung und klare Durchbildung des Stils ausgezeichnet. Die Grundlage ihrer Anschauung aber ist ein herber und harter Realismus, der im rechnenden Verstand und in der leidenschaftslosen Nüchternheit eine Art Ideal erblickt, von ihr die Lösung aller Rätsel des Daseins erwartet und begreiflicherweise nur in einzelnen Fällen eine poetische Wirkung hervorzurufen vermag. Vgl. K. Frenzel, Erinnerungen und Strömungen (Leipz. 1890).
Meine Lebensgeschichte
Erster Band: Im Vaterhause
An Adolf Stahr
Du und ich, mein geliebter Mann! haben unsere einzelnen Arbeiten, wenn wir sie der Oeffentlichkeit überantworteten, immer gern einem oder dem andern, der uns besonders werthen Menschen zugeschrieben, um Ihnen damit ein Zeichen der Liebe, oder ein Zeichen des Dankes für die Theilnahme zu geben, welche sie uns und unserm Schaffen angedeihen lassen.
Nun stehe ich vor der Herausgabe meiner gesammelten Werke, eine dreißigjährige Thätigkeit überblickend, und ich kann getrosten Herzens und mit gutem Gewissen die Worte wiederholen, mit denen ich vor acht Jahren die vierte Abtheilung meiner Lebensgeschichte abschloß.
»Ich bin mit einer großen Vorstellung von der Macht des Dichters auf den Geist seines Volkes, und von der Gewalt des Wortes über das Herz der Menschen, in die literarische Laufbahn eingetreten. Und weil ich die Wahrheit suchte, und die Wahrheit über Alles schätzte, wo ich sie erkannt zu haben glaubte, nahm ich mir vor, ihr in keiner Zeile und mit keinem Worte jemals abtrünnig zu werden, und wie groß oder wie gering mein Einfluß jemals werden könnte, ihn nie anders als im Dienste desjenigen zu verwenden, was mir Schönheit, Freiheit und Wahrheit hieß. Und dies Versprechen habe ich mir treu gehalten.«
Ich war noch ein Neuling auf dem neuen Wege, als wir, ich und Du, geliebter Mann! uns vor fünfundzwanzig Jahren in Italien zusammenfanden. Seit dem Tage bist Du der treue Zeuge meiner Arbeit gewesen, und an Dein Urtheil, an Deine Zustimmung habe ich bei derselben seitdem stets zunächst gedacht. Seit fünfundzwanzig Jahren haben wir beide, Jeder auf seine Weise, einem gemeinsamen Ziele zugestrebt, und danach getrachtet, unser Leben und Schaffen zu einem Einklang zu gestalten: denn der Mensch kann nicht leisten und wirken, was er nicht selber ist. Dein sittlicher Ernst und Dein unbeirrbarer Idealismus waren mir eine starke Stütze. Dein Zuspruch hat mich aufgerichtet, wenn mich oft genug, mitten in der Freudigkeit der Arbeit, die Entmuthigung und der Zweifel überfielen, denen kein Schaffender entgeht. Wie oft hast Du mir zugerufen: »Man muß das Höchste erstreben, redlich und gewissenhaft arbeiten, und sich dann vor seiner Leistung bescheiden. Die Arbeit hat Dich innerlich aufgeklärt, hat Dich gefördert, hat Dich oft gefreut; sie wird auf Den und Jenen also auch die gleiche Wirkung haben. Was willst Du denn noch mehr?« – Und ich habe mich dann zurecht gefunden und bin frohen Herzens weiter fortgegangen.
Nimm denn diese Gesammt-Ausgabe meiner Arbeiten, von denen der bei weitem größte Theil unter Deinen Augen entstanden ist, als Liebes-, als Dankesgabe hin, und laß uns hoffen, daß Dein Wort zur Wahrheit werde: daß Andere fördere, was während dem Schaffen mich selbst gefördert; daß sie erfreue, was mich über manche Stunde gemeinsam getragener schwerer Sorge flügelkräftig fortgehoben; und daß die Leser das Gute, das Wahre, das Schöne auch da herausfühlen mögen, wo es mir nicht gelungen ist, es klar zur Erscheinung zu bringen, wo mein Können hinter meinem Wollen, meine Leistung hinter meinem Ideale zurückgeblieben ist.
Und somit in Liebe und gemeinsamem Streben hoffentlich noch eine Weile weiter fort!
Berlin, im Mai 1870.
Die DeineFanny Lewald-Stahr.
Dem
Andenken meines Vaters
David Markus Lewald
sei die Erzählung meiner Lebensgeschichte
in
dankbarer Liebe gewidmet.
Einleitung
Wie der Reisende sich Empfehlungen von verehrten Personen zu verschaffen sucht, um sich einen freundlichen Empfang und gütige Theilnahme unter den Fremden zu sichern, so schicke ich dieser Arbeit eine Bemerkung Goethe's über die Bedeutung des Individuellen voran, die mich seit lange beschäftigt und mir während des Arbeitens oft im Sinne gelegen hat.
»Das Individuum, sagt Goethe, geht verloren; das Andenken desselben verschwindet; und doch ist ihm und andern daran gelegen, daß es erhalten werde.
Jeder ist selbst nur ein Individuum und kann sich auch eigentlich nur für's Individuelle interessiren. Das Allgemeine findet sich von selbst, dringt sich auf, erhält sich, vermehrt sich. Wir benutzen's, aber wir lieben es nicht.
Wir lieben nur das Individuelle; daher die große Freude an Vorträgen, Bekenntnissen, Memoiren, Briefen und Anekdoten abgeschiedener selbst unbedeutender Menschen.
Die Frage: ob Einer seine eigene Biographie schreiben dürfe, ist höchst ungeschickt. Ich halte den, der es thut, für den höflichsten aller Menschen.
Wenn sich Einer nur mittheilt, so ist es ganz einerlei, aus was für Motiven er es thut.
Es ist gar nicht nöthig, daß Einer untadelhaft sei, oder das Vortrefflichste und Tadelloseste thut; sondern nur, daß Etwas geschehe, was dem Andern nützen oder ihn freuen kann.«
Ein andermal, als er die Entstehung seiner biographischen Annalen schildert, spricht er sich, auf das Urtheil Cellini's gestützt, dahin aus, daß man sich nicht zu spät daran machen dürfe seine Erinnerungen aufzuzeichnen, wenn man überhaupt die Neigung fühlt, dieses zu thun.
»Es ist keine Frage, heißt es dort, daß uns die Fülle der Erinnerung, womit wir jene ersten Zeiten zu betrachten haben, nach und nach erlischt, daß die anmuthige Sinnlichkeit verschwindet, und ein gebildeter Verstand durch seine Deutlichkeit jene Anmuth nicht ersetzen kann.
Hierbei ist aber noch ein bedeutender Umstand wohl zu beachten: wir müssen eigentlich noch nahe genug an unsern Irrthümern und Fehlern stehen, um sie liebenswürdig und in dem Grade reizend zu finden, daß wir uns lebhaft damit abgeben, jene Zustände wieder in uns hervorrufen, unsere Mängel mit Nachsicht betrachten und mancher Fehler uns nicht schämen mögen.«
An diese Aussprüche habe ich oftmals gedacht, wenn ich bei meinen dichterischen Arbeiten, im Gestalten der einzelnen Figuren, den Boden zeichnete, dem sie entstammten, die Einflüsse welche zu ihrer Entwicklung beitrugen, und den Weg auf dem sie an ihr Ziel zu gelangen hatten. Dann ist mir häufig die Lust gekommen, mir einmal mein eigenes Leben und meine eigene Entwickelung in solcher Weise übersichtlich und zusammenhängend darzulegen, und seit Jahren habe ich die Neigung gehabt, meine Erinnerungen aufzuzeichnen.
Meine Freunde haben mich in dem Gedanken bestärkt, mich zu dem Unternehmen angetrieben, und nun ich mir endlich einmal die Muße dazu geschafft, nun ich mich an den Schreibtisch setze um an das Werk zu gehen, bewegt es mir feierlich das Herz. Denn wie man in der Jugend ahnungs- und hoffnungsvoll in die ungewisse Zukunft hineinblickt, so schaue ich in diesem Augenblick ruhig und befriedigt auf den Pfad zurück, der jetzt hinter mir liegt.
Es ist etwas Besonderes um das Festhalten und Aufschreiben seiner eigenen Schicksale, um das Wiedererwecken seiner eigenen Vergangenheit. Man ist Darsteller und Zuschauer, Schöpfer und Kritiker, jung und alt zugleich. Man empfindet alle seine genossenen Freuden mit der Kraft der Jugend, man blickt auf seine vergangenen Leiden mit dem Gefühle eines Ueberwinders zurück. Man durchlebt das Leben noch einmal, aber ruhig und mit unverwirrtem Bewußtsein. Und was uns im Affekte des Erlebens einst räthselhaft, was uns getrennt und zusammenhanglos, was uns zufällig, unwesentlich oder auch gewaltsam und ungerecht erschien, das gestaltet sich vor dem überschauenden Blicke zu einem übersichtlichen Ganzen, in welchem eigenes und fremdes Handeln, in welchem Irrthümer und Schmerzen, in welchem unser Denken und Streben, unser Mißlingen und unsere Erfolge uns nur noch als eben so viele Ursachen und Wirkungen entgegentreten. Jedes Menschenleben trägt eben seinen vernünftigen Zusammenhang in sich, und mehr oder weniger habe ich in dem Schicksal aller mir bekannt gewordenen Menschen das alte Sprichwort bestätigt gefunden, das mein theurer Vater uns von Jugend auf als Lehre und Warnung auszusprechen pflegte: es ist Jeder seines Glückes Schmied!
In diesem Sinne haben Biographien, und vor allen Dingen ehrlich gemeinte Selbstbiographien, mich immer lebhaft angezogen. Sie sind mir bedeutsam gewesen als Bilder einer bestimmten Zeit und ihrer Kulturverhältnisse, sie sind mir lehrreich, tröstlich und erhebend gewesen. Der Hinblick auf das arbeitsvolle Ringen Anderer hat mich im Arbeiten und Beharren bestärkt. Bevorzugte, glückliche Lebensläufe haben mir Hoffnung auf Erfolg und Streben nach ähnlicher Befriedigung gegeben; und wenn ich Menschen, die ich über mich zu stellen hatte, mit Mißgeschicken kämpfen oder gar den sie umgebenden Verhältnissen unterliegen sah, so hat mich das vor thörichten Anforderungen an ein sogenanntes unbedingtes und müheloses Glück behütet, hat mich auf thätige Geduld verwiesen und mich gelehrt, sowohl das Gute, das mir durch meine angeborenen Verhältnisse geworden, als dasjenige, welches mir durch eigene Kraft zu erringen gelungen ist, in jedem Augenblicke doppelt bewußt zu genießen, doppelt dankbar anzuerkennen.
Und so mögen diese Aufzeichnungen, die ich im Gedenken an meine theuren verstorbenen Eltern und an mein liebes Vaterhaus beginne, allen Denen eine freundliche Erinnerung bereiten, denen es einst wohl geworden in dem gastlichen Hause meiner Eltern, oder die mir sonst theilnehmend auf dem Lebenswege begegnet sind. Kommen sie nebenher einem oder dem andern Menschen hier und da aufklärend und beruhigend zu statten, so würde mich das von Herzen freuen. Gelingt das diesen Erinnerungen nicht, nun so bereiten sie doch vielleicht den Lesern einen Theil des Vergnügens, welches ich selbst bei dem Niederschreiben immerfort empfunden habe.
Berlin, im Juni 1858.
Erstes Kapitel
Ich bin am vierundzwanzigsten März des Jahres achtzehnhundert und eilf zu Königsberg in Preußen geboren, und stamme von väterlicher und mütterlicher Seite aus jüdischen Familien ab. Auch meine beiden Eltern waren geborene Königsberger.
Meine Mutter gehörte einer reichen Familie an. Sie war das jüngste von zwölf Kindern. Ihr Vater war aus dem Posen'schen, ihre Mutter aus Kurland nach Preußen gekommen. Sie hielten fest an dem Glauben und an den Sitten des Judenthums, waren ununterrichtete Leute, scheinen aber, nach allen Erzählungen meiner Mutter, viel auf eine wohlanständige äußere Form des Lebens gehalten und bei strenger häuslicher Oekonomie die Benutzung und Schaustellung ihres Reichthums für besondere Fälle geliebt zu haben.
Meine Mutter erzählte uns, als wir erwachsen waren, gern von dem großen Saale in ihrem Vaterhause mit seinen gelben Damastmeubeln und zahlreichen Spiegeln, der an den Feiertagen geöffnet wurde, von der gastfreien Aufnahme aller Fremden, welche sich zum jüdischen Karneval, dem Purimsfeste, maskirt und unmaskirt in ihrem Hause einfanden, von der ernsten Begehung der großen Feiertage, des Passah, des Laubhütten- und des Versöhnungsfestes; und es machte immer einen fremdartig feierlichen Eindruck auf uns, wenn wir hörten, wie die Großeltern am Vorabende des Versöhnungsfestes alle ihre Kinder zusammen gerufen und sie gesegnet hätten. Wie dann die Großmutter in einem weißen, mit kostbaren Kanten besetzten Kleide den Großvater in die Synagoge begleitet habe, wie sie darauf erst spät Abends nach Hause gekommen wären, wie man der Großmutter schweigend das modische Entre deux von schwarzem Taffet mit strohgelbem Futter abgenommen, wie man am folgenden Tage gefastet und erst am Abend desselben bei dem Hervortreten der Sterne den ersten Imbiß gehalten habe, wonach das Leben dann wieder in seinen gewöhnlichen Lauf zurückgekehrt sei.
Gute Miniaturbilder dieser Großeltern hingen in unserem Wohnzimmer. Die Großmutter war eine bleiche Frau mit ruhigem klugen Blick, ganz weiß gekleidet, ein Spitzentuch um Brust und Hals gebunden, einen tiefgehenden Aufsatz mit weißen Spitzen auf dem Kopfe, der kein Haar hervorscheinen ließ und sich fest an Stirn und Schläfen anlegte. Sie trug auf dem Bilde schöne große Perlen in den Ohrgehängen und eben solche Perlen um den Hals. Der Großvater hatte ein sehr feines Gesicht mit hellblauen Augen, eine kleine gepuderte Perrücke, einen blauen Rock mit großen Knöpfen, und die alten Leute sahen Beide wie Bilder der behaglichsten Sauberkeit und Ruhe aus. Sie hatten etwas Feierliches in ihren Physiognomien, das mir immer einen großen Eindruck machte, wenn ich sie ins Auge faßte.
Was mein Großvater in seinen früheren Jahren für ein Handels-Geschäft getrieben haben mag, weiß ich nicht. So weit die Erzählungen meiner Mutter reichten, hatte er sich schon vom Handel zurückgezogen und als ein reicher Mann von seinen Zinsen gelebt. Die Großeltern bewohnten sechsunddreißig Jahre lang das Eckhaus in der Kneiphöfischen Langgasse, welches der Königlichen Bank gegenüber dicht am grünen Thore liegt und die Ecke der Magistergasse bildet; und es wurde von unserer Mutter immer hervorgehoben, wie der Bankdirektor und eine Menge anderer angesehener Leute den Großvater mit besonderer Achtung behandelt hätten und wie selbst der Professor Kant ihn immer freundlich gegrüßt, wenn er im Sommer bei seiner täglichen Promenade den Großvater auf seinem gewohnten Platze am Fenster oder auf der Bank vor der Thüre sitzen gesehen habe. Es war damals in Königsberg noch eine Ehrensache für einen Juden, von Christen achtungsvoll behandelt zu werden.
Die geistige Bildung im Hause dieser Großeltern muß im Ganzen gering gewesen sein, obschon man den Söhnen, es waren ihrer fünf, eine gute Erziehung geben ließ. Zwei von ihnen haben Medizin studirt. Der Aeltere war ein in Königsberg geachteter Arzt, Doktor Assur, der Jüngste, David mit Namen, ging später zum Christenthum über. Es war der in Hamburg verstorbene, und mit Rosa Marie von Varnhagen verheirathete, Doktor Assing.
Die älteren Töchter meines großväterlichen Hauses waren in der französischen Sprache, in der Musik, im Tanzen und derlei äußerlichen Dingen unterrichtet worden. Sie hatten auch einen »Complimentirlehrer« gehabt, der ihnen beigebracht, was man in der Gesellschaft und im Verkehr mit jungen Männern zu sagen, und wie man es zu sagen habe. Aber mit dem Tode meiner Großmutter hatte das Alles aufgehört, und für die Erziehung der jüngeren Töchter war fast Nichts geschehen, weil der Großvater die Bildung der Frauen als etwas Ueberflüssiges betrachtete. Meine Mutter, sein jüngstes Kind, beklagte dies durch ihr ganzes Leben als ein Unglück. Sie trug ein großes Verlangen nach Kenntnissen, aber ihr fehlte die Vorbedingung der ersten Grundlagen, sich dieselben noch in späterer Zeit anzueignen; denn sie schrieb und rechnete nur nothdürftig und hatte nicht das Geringste von wissenschaftlichem Unterricht gehabt.
Weder mein Großvater noch seine Frau hatten, nachdem sie sich einst in Königsberg ansässig gemacht, den Ort jemals verlassen, und die ganze Existenz in ihrem Hause scheint eine sorgenfreie und zufriedene, aber in jedem Betrachte wenig bewegliche und geistig sehr beengte gewesen zu sein.
Ganz anders waren die Verhältnisse in meinem großelterlichen Hause väterlicher Seits. Die Familie hatte seit vier Generationen von Vater auf Sohn in Königsberg gelebt, und mein Großvater hatte als ein vermögender junger Mann zu seiner Ausbildung einen Theil von Deutschland bereist, und später auch eine Berlinerin geheirathet.
Mein väterlicher Großvater war ein schöner und sehr geistvoller Mann. Er und seine Frau besaßen jenen Grad der allgemeinen Bildung, den die Berliner Juden schon früher erlangt hatten, und Beide fühlten sich im Ganzen in Königsberg nicht glücklich. Namentlich die Großmutter gefiel sich in der Provinz nicht. Sie wurde dort nie recht heimisch, auch der Großvater hätte lieber in Berlin oder in Hamburg leben mögen. Aber er hatte sein ererbtes Vermögen, einige Jahre nach seiner Verheirathung, in unglücklichen Spekulationen eingebüßt, und obschon er auch unter seinen Standesgenossen als ein sehr gescheuter Kopf geachtet wurde, gelang es ihm doch nicht, sich ein neues Vermögen zu erschaffen. Er führte immer ein sorgenvolles, in spätern Jahren sogar eine Zeit lang ein kümmerliches Leben, und grade darum verargte man ihm eine gewisse Zurückhaltung und Abgeschlossenheit seines Wesens um so mehr. Er und seine Frau galten für stolz, er pflegte wenig Verkehr mit andern Menschen, hatte aber eine große Vorliebe für Studien aller Art, besonders für die Mathematik, mit der er sich viel beschäftigte, und brachte alle seine freien Stunden mit Lesen und Schreiben zu, wie er sich denn schriftlich und mündlich vortrefflich ausgedrückt haben soll. Bei seinem Tode fand man eine Anzahl logarithmischer Tafeln vor, die er ausgerechnet und für die Herausgabe vorbereitet hatte. Sie blieben damals liegen und sind dann verschwunden. Seine Lieblingslektüre waren die Werke der französischen Encyklopädisten, und er wie seine Frau waren äußerst aufgeklärte Leute. Das jüdische Ritualgesetz wurde daher von ihnen auch nur so weit beobachtet, als es eben nothwendig war, um in den damals noch eng zusammenhängenden Gemeinden keinen Anstoß zu geben. Die Söhne wurden also auch im Hebräischen unterrichtet, und mein Großvater besuchte die Synagoge, weil das geschehen mußte, aber im ganzen häuslichen Leben ward keine religiöse Ceremonie irgend einer Art geübt, und es herrschte in allen religiösen Dingen dort die größte Freiheit.
Diese Großeltern väterlicher Seits, die Familie führte damals den Namen Markus, hatten sieben Kinder, vier Söhne und drei Töchter. Ohne diese Kinder christlichen Schulen oder öffentlichen Lehranstalten zu überantworten, hielt man sie zum Selbstunterricht an, und die Richtung auf geistige Interessen, die Theilnahme an dem Allgemeinen, wie ein gewisser Zug fester und ernster Selbstbestimmtheit ward Allen durch die Erziehung eingeprägt. Mein Großvater haßte es, wenn man von leeren Dingen sprach oder unnöthig viel Worte machte. »Erzähle in die Länge und nicht in die Breite!« ist eine Redensart, welche sich aus seinem Munde unter uns fortgeerbt hat; und eine Unüberlegtheit, eine Thorheit sprechen zu hören, war ihm so widerwärtig, daß er es an seinen Kindern streng bestrafte.
Als ein alter Diener des Hauses einmal nach mehrmonatlicher Abwesenheit zurückkehrte, und einer meiner Onkel, damals noch ein acht- oder neunjähriger Knabe, die unvernünftige Bemerkung machte: »Skatt sei recht gewachsen«, gab ihm der Großvater für diese Aeußerung, ohne weiter ein Wort darüber zu sprechen, augenblicklich eine Ohrfeige. Im gleichen Sinne befahl er seinen Kindern, wenn sie einmal etwas Kluges oder Witziges gesagt hatten, das Beifall gefunden, regelmäßig still zu sein, damit sie nicht, in der Freude über ihren Erfolg, demselben eine Dummheit hinzufügten.
Die Familie meiner väterlichen Großeltern war irgendwie mit den Familien Itzig und Ephraim in Berlin verwandt, welche von Friedrich dem Großen für seine Finanzoperationen benutzt wurden, und es herrschte in dem Hause meiner Großeltern, wenn die Zeiten dort besonders sorgenvoll waren, immer die Hoffnung, von diesen Berliner Verwandten werde ihnen einmal mit einer Betheiligung an irgend einem großen finanziellen Unternehmen eine dauernde Hülfe kommen. Indeß statt dieser Hülfe erwuchs ihnen, als eine solche Betheiligung ihnen endlich dargeboten wurde, nur ein schweres Unglück daraus.
Friedrich der Große hatte nämlich die jüdischen Bankiers und namentlich auch Ephraim dazu benutzt, die englischen Subsidiengelder in schlechte Münze, in Zweigutegroschen-Stücke umprägen und verbreiten zu lassen, und bei diesem auf königlichen Befehl ausgeführten Geschäfte war mein Großvater als einer der Agenten der Königsberger Münze, denn die Provinzen hatten damals noch besondere Münzen, thätig gewesen. Er hatte dazu eigens eine Silberschmelze erbauen lassen müssen, die mein Vater noch besaß und in der ich selbst noch vielmals gewesen bin. Als nun unter Friedrich Wilhelm dem Zweiten die Beschwerden über die Münzverfälschung im Lande immer lebhafter wurden, wählte die Regierung den Ausweg, die Juden, welche einst auf ihren Befehl gehandelt hatten, für die Münzverfälschung verantwortlich zu machen. Man sperrte also, um der öffentlichen Meinung ein Genüge zu thun, oder ihr doch mindestens ein Zugeständniß zu gewähren, an den verschiedenen Orten einige Juden, und unter diesen auch meinen Großvater, in das Gefängniß. Er für sein Theil, wie viele andere seiner Glaubens- und Leidensgenossen, verlangten eine Untersuchung. Indeß zu einer solchen konnte die Regierung es nicht kommen lassen, und nachdem man die Beschuldigten längere Zeit gefangen gehalten hatte, gab man sie ohne Urtheil und Recht, wie man sie eingezogen, auch wieder frei. Man hatte damit den Zweck erreicht, die Rechtlichkeit dieser Männer zu verdächtigen, die Anklagen, welche sich gegen die Regierung erhoben, auf die Schultern der Juden zu wälzen, und dabei ließ man es bewenden.
Aber diese Gefangenschaft hatte für den Großvater, abgesehen davon, daß sie ihm durch den Makel, den sie auf ihn warf, für den Rest seines Lebens sein Gewerbe als Geldwechsler den Christen gegenüber erschwerte, auch den Nachtheil, seine damals schon sehr schwankende Gesundheit völlig zu untergraben. Er war in den letzten Jahren der Vierziger, als man ihn verhaftete, in Folge einer Unterleibskrankheit von schwerem Augenleiden heimgesucht, und der Pflege der Seinen durchaus bedürftig. Ihn deshalb frei zu geben fühlte man sich nicht geneigt; die Familie erlangte es jedoch, daß man ihm seine älteste, damals fünfzehnjährige, Tochter Minna als Pflegerin mit in das Gefängniß gab, und von ihr, einer der bedeutendsten Frauen, welche ich gekannt, habe ich es oftmals mit bewegtem Herzen erzählen hören, wie ruhig und würdig unser Großvater sein Mißgeschick getragen. Sie erinnerte sich immer mit Rührung daran, wie der Großvater sich auch im Gefängniß täglich auf das Sauberste gekleidet habe, wie er getrachtet einen kleinen Spiegel herbeizuschaffen, damit auch sie sich in ihrem Aeußeren nicht vernachlässige, und wie er streng darauf gehalten habe, daß sie sich täglich mehrere Stunden mit Lesen und Schreiben von Französisch, und mit ernster Lektüre beschäftigte, damit diese Unglückszeit mindestens doch für ihre Bildung gute Früchte trage. Die Tante hing mit tiefster Verehrung an dem Vater, und alle seine Kinder hegten eine fast abgöttische Liebe für ihn. Noch in ihrem späten Alter gedachte seiner fast keines derselben ohne Wehmuth und ohne Thränen.
Mein Vater war der dritte Sohn des Hauses. Er kann zu der Zeit, in welcher mein Großvater im Gefängniß war, nicht über acht Jahre alt gewesen sein. Der älteste Sohn war kränklich und mußte, da er in der Jugend bisweilen an heftigen Krämpfen litt, geschont werden. Der zweite Sohn war weniger thätig, und da der Großvater nach seiner Gefangenschaft immer leidender wurde, verwendete er meinen Vater, sobald derselbe dafür irgend brauchbar war, in seinem Handelsgeschäfte, das die Familie nur sehr mühsam ernährte. Aus meines Vaters Munde habe ich es erzählen hören, wie bitter schwer er den Druck dieser Verhältnisse empfunden habe. Als er einmal, kaum fünfzehnjährig, in's Vaterhaus zurückgehen mußte ohne ein Geschäft abgeschlossen zu haben, von dem mein Großvater sich für lange Zeit Hülfe für die Seinen versprach, waren Traurigkeit und Verzweiflung in dem Herzen des Knaben so stark geworden, daß er bei dem Uebergange über eine Brücke die größte Versuchung gefühlt hatte, sich in das Wasser zu stürzen, weil es ihm so furchtbar schien, dem schwerkranken und schwerbekümmerten Vater einen ungünstigen Bescheid und die Vereitelung seiner Hoffnungen zu melden.
Wann mein Großvater gestorben ist, weiß ich nicht genau, doch muß es etwa sieben oder acht Jahre nach seiner Gefangenschaft und ganz zu Anfang dieses Jahrhunderts gewesen sein. Nach seinem Tode, er ist nur einundfünfzig Jahre alt geworden, nahmen die Verhältnisse der Familie eine günstigere Wendung. Die älteste Tochter, welche zu ihren mütterlichen Verwandten nach Berlin gegeben worden war, verheirathete sich an einen gebildeten und wohlhabenden Kaufmann in Breslau; sie ward die Mutter des in unserer politischen Geschichte rühmlichst bekannt gewordenen Heinrich Simon aus Breslau. Meine Großmutter mit dem jüngsten Sohne siedelte in Folge dieser Verbindung ebenfalls nach Breslau über, und ihr zweiter Sohn folgte ihr dorthin nach, wo er in das kaufmännische Geschäft eines Mutter-Bruders eintrat. Nur der älteste Bruder, Beer Markus, und mein Vater blieben in Königsberg zurück. Sie etablirten das Handlungshaus von Beer Markus u. Comp., und die beiden jüngeren Schwestern, Johanna und Rebekka, übernahmen die Besorgung des Haushaltes für die beiden Brüder.
Auf sich selbst und den Erwerb für sich und die Ihrigen gewiesen, verließen die zurückgebliebenen vier Geschwister, von denen selbst der älteste kaum zweiundzwanzig Jahre alt war, die Bahn des Vaterhauses nicht. Keiner von ihnen hatte, wie ich erwähnt, eine folgerechte regelmäßige Schulbildung erhalten; aber sie waren Alle geistig sehr begabt, sehr strebsam, äußerst beharrlich und unverzagt, und dem ganzen Charakter nach ein Geschlecht, dem anzugehören ich immer als einen Vorzug empfunden habe.
Meine beiden Eltern kannten sich, wie das damals, als die jüdischen Gemeinden noch kleiner waren, nicht fehlen konnte, dem Ansehen nach von ihrer Kindheit an. Meine Mutter erzählte uns, daß sie als zwölfjähriges Mädchen einmal mit ihrem Vater am Fenster saß, als mein Vater, der nur drei Jahre älter war als sie, an ihrem Hause vorüberging. Sie hatte immer viel Gutes von ihm gehört, und wenn man das Mißgeschick der Markus'schen Familie beklagte, die gar nicht vorwärts kommen konnte, so hatte man die braven Kinder, und namentlich den Fleiß und die Treue des kleinen David Markus gerühmt, der von früh bis spät für seine Eltern thätig war. Das hatte meine Mutter gerührt und die große Schönheit meines Vaters hatte solchen Eindruck auf sie gemacht, daß sie an jenem Tage in kindischer Lebhaftigkeit plötzlich den Ausruf that: »Ach Papa! Den David Markus möchte ich heirathen!« womit sie natürlich unter ihren Geschwistern großes Lachen erregte. – Es fand aber gar kein Verkehr zwischen den beiden Familien statt, und meine Eltern lernten sich erst später persönlich kennen, als meine Mutter etwa siebzehn und mein Vater zwanzig Jahre alt war.
Damals waren sie Beide schon elternlos. Meine Mutter lebte im Hause einer Schwester, die an einen Kaufmann Nathan verheirathet war, und mein Vater befand sich bereits in der Lage, eine Frau zu ernähren, selbst wenn sie nicht, wie meine Mutter, Vermögen gehabt hätte.
Indeß zu jenen Zeiten war es mit dem Heirathen der Juden in Preußen keine leichte Sache, denn jede jüdische Familie hatte nur für eines ihrer Kinder das Ansiedlungsrecht in den preußischen Landen, und ohne dieses waren Heimath und Niederlassung eine Unmöglichkeit für die Juden. In meiner mütterlichen Familie war dies Recht zu Gunsten der ältesten, sehr unschönen Tochter benutzt worden, der man damit einen Mann geschafft hatte; und da die älteste Schwester meines Vaters einen niederlassungsberechtigten Juden in dem Breslauer Kaufmann Simon geheirathet, so besaß mein Onkel Beer Markus das Niederlassungsrecht der Markus'schen Familie, das er um so weniger geneigt sein konnte an meinen Vater abzutreten, als er selbst in meine Mutter verliebt war und sich um sie bewarb.
Alle meine mütterlichen Onkel und Tanten waren auf seiner Seite. Meine Mutter war die einzige noch unverheirathete und unversorgte Schwester in ihrer Familie. Zwei Brüder und zwei Schwestern waren nach Hamburg übergesiedelt und dort verheirathet, zwei andere Brüder hatten sich in Berlin etablirt, drei Schwestern waren bereits in Königsberg ansässig, und der älteste Bruder praktisirte dort als Arzt. Es war ihnen allen daher das Bequemste, die jüngste Schwester ohne weitere Schwierigkeiten und ohne besondere Bittgesuche bei der Regierung, ebenfalls in Königsberg zu verheirathen, und mein Onkel Beer war obenein ein eben so tüchtiger als gebildeter Mann. Aber er war sehr kränklich, und obschon, wie die Schwestern meines Vaters später erzählt haben, meine viel umworbene Mutter Anfangs Beer's Bewerbung annahm und ermunterte, wendete sich später ihre Neigung doch dem jüngern und viel schönern Bruder zu, und diese Neigung wurde, weil sie sowohl in der Familie als in den äußern Verhältnissen überall auf Hindernisse stieß, zu der lebhaftesten Leidenschaft von beiden Seiten.
Meine mütterlichen Verwandten verargten es meinem Vater, daß er ihnen die bequeme Verheirathung ihrer Schwester erschwere, und die Schwestern meines Vaters nahmen es ihm und meiner Mutter äußerst übel, daß sie dem ältern und kränklichen Bruder noch Herzenskummer machten. Die beiden armen jungen Leute standen also ziemlich verlassen und angefeindet in der Familie da. Nur meine Tante Nathan und der Doktor David Assing, der Lieblingsbruder und Vertraute meiner Mutter, der auch ein Freund meines Vaters war, hielten treu zu ihnen, und meine Mutter hat ihnen das immer dankbar nachgerühmt.
Wäre meine Mutter ihr eigener Herr, d. h. wäre sie großjährig gewesen, so hätte das junge Paar wohl den Ausweg gewählt, zum Christenthume überzutreten. Meine Mutter hatte einen großen Zug dafür, und meinem Vater war alles Dogmatische und Confessionelle der verschiedenen Religionen gleichgültig; aber die ganze Familie meiner Mutter, vor Allem der Bruder und der Schwager, welche ihre Vormünder waren, wollten von einem solchen Schritte durchaus nichts hören. Die üblichen Bedrohungen mit Fluch und Verstoßung wurden nicht gespart, meine Mutter fühlte sich solchen Zerwürfnissen nicht gewachsen, und es blieb den Verlobten also kein Ausweg übrig, als mit Eingaben bei der Regierung, mit Geldopfern, wo diese thunlich waren, und mit persönlichen Bittgesuchen sich die Erlaubniß zur Niederlassung in Preußen zu verschaffen, deren Bewilligung immer schwerer gemacht wurde, je wohlhabender und heirathslustiger die jüdischen Gemeinden geworden waren. Darüber gingen Jahre hin, und dieser Kampf erzeugte in meiner Mutter, einer sehr milden und weichen Natur, eine lebhafte Abneigung gegen das Judenthum und gegen Alles was mit ihm zusammenhing. Sie sah es als ein Unglück an, eine Jüdin zu sein. Bei meinem Vater, dessen starkem Verstande die Unvernunft der damaligen preußischen Gesetzgebung für die Juden ohnehin klar genug eingeleuchtet haben mußte, verstärkten die Hindernisse, unter denen er persönlich zu leiden hatte, nur seinen Widerwillen gegen alle Unvernunft und Tyrannei.
Die Gewährung einer Niederlassungserlaubniß für einen Juden hing zu jener Zeit im Königreich Preußen von dem Kanzler von Schrötter ab. Er war sehr geachtet in der Provinz; seine Frau, eine geborene Gräfin Dohna, galt für eine ausgezeichnet edle Frau, und ein Sohn oder ein jüngerer Bruder des Kanzlers war ein Jugend- und Universitätsfreund von dem jüngsten Bruder meiner Mutter, von David Assing gewesen. Auf den Rath dieses Letzteren gestützt, entschloß sich endlich meine Mutter, der bei ihrer Schüchternheit und Jugend solch ein Schritt sehr schwer geworden sein muß, sich bei der Gemahlin des Kanzlers persönlich eine Audienz zu erbitten und sie um ihre Verwendung zu Gunsten einer Niederlassung anzugehen.
Das entschied die Sache, und nach einer langen Liebeszeit wurden meine Eltern endlich zu einer Ehe verbunden, welche während der dreißig Jahre ihres Bestehens uns Allen ein Vorbild und überhaupt ein Muster häuslicher Eintracht gewesen ist.
Zweites Kapitel
Meines Vaters Vermögenslage war günstig als er sich verheirathete. Er und sein Bruder betrieben ansehnliche Bankier- und Speditionsgeschäfte, und das Kapital, welches meine Mutter ihm zubrachte, eröffnete ihm in jener Zeit, in welcher das Geld fast noch einen doppelten Werth hatte, die Aussicht, seine Geschäfte in der ersprießlichsten Weise ausdehnen zu können.
Beer Markus und die Schwestern nahmen eine besondere Wohnung, meine Eltern bezogen ein Haus in der Vorstadt, das zur Freude meiner Mutter hinter dem großen Hofe, auf welchem sich die Waarenremisen befanden, einen kleinen Garten hatte. Sie richteten sich ansehnlich und behaglich ein, und in diesem Hause in der Vorstadt bin ich an einem Sonntag Morgen geboren worden.
Mein Vater stand in seinem vierundzwanzigsten Jahre, meine Mutter im einundzwanzigsten, als ich auf die Welt kam, und ich habe es immer als einen Vorzug betrachtet, ihr ältestes Kind gewesen zu sein, denn die Erstgeburt ist ohne alle Frage ein Glück für Denjenigen, welchem sie zu Theil wird. Ein eben solches Glück aber war für uns Geschwister alle die frühe Heirath unserer Eltern. Denn wie mich immer der Gedanke gefreut hat, daß ich es war, durch welche die Eltern zuerst die Wonne der Elternliebe kennen lernten, daß ich sie zuerst Vater und Mutter genannt habe, so kam uns Allen, je mehr wir heranwuchsen, die Jugendlichkeit unserer Eltern überall zu statten. Sie empfanden die Mühe und Störniß welche wir ihnen verursachten minder schwer, als Personen vorgerückten Alters; sie hatten ein Verständniß für unsere Wünsche und Fehler, weil ihnen selbst die Erinnerung an die eigene Jugend noch so nahe lag. Und die Hauptsache war: wir selber fühlten uns ihnen, als wir herangereift waren, näher verwandt, als es bei bejahrten Eltern vielleicht der Fall gewesen wäre. Junge Eltern zu haben, ist für Kinder ein ganz unschätzbarer Gewinn.
Ich soll sehr klein gewesen sein, dafür aber den ganzen Kopf voll krauser schwarzer Locken gehabt haben, als man mich meinem Vater brachte. »Ich habe mich sehr mit Dir gefreut!« sagte er mir einmal, als ich ein junges Mädchen war und in meiner Gegenwart die Rede auf meine Geburt kam; und noch in viel spätern Jahren pflegte er wohl gelegentlich meinen Kopf in seine Hände zu nehmen, und wenn er mich küßte, dazu sehr zärtlich: »mein ältestes Kind!« zu sagen. Wir haben einander sehr geliebt.
Meine Mutter konnte mich nicht selbst nähren. Man nahm daher eine Amme in das Haus, eine schöne, blonde und sehr fröhliche Person, die mehrere Jahre bei uns blieb, und die heute noch gesund und rüstig in meiner Heimath lebt. Meine Eltern waren in den ersten Monaten nach meiner Geburt so glücklich, als ein schönes, junges, sorgenfreies Menschenpaar, das sich zärtlich liebt, es mit seinem ersten Kinde nur sein kann. Indeß schon in der Mitte des Sommers von achtzehnhundert eilf veränderte sich das plötzlich.
Mein Vater ging am Mittage, wie gewöhnlich, nach der Börse, meine Mutter hatte mich auf dem Arme und begleitete ihn bis zur Hausthüre, von wo aus sie ihm grüßend nachsah, so weit sie konnte. Dann ging sie in das Haus zurück, legte mich zu Bett und saß ruhig an meiner Wiege, als etwa eine halbe Stunde nachdem er sich entfernt hatte ein Feuerlärm von der Straße gehört wurde, und gleich darauf mein Vater bleich und mit dem Ausruf: die Speicher brennen! in das Zimmer meiner Mutter trat.
Wer Königsberg kennt, weiß, was dieser Ausruf zu bedeuten hat. Für Denjenigen, der es nicht kennt, bedarf es aber einer Erklärung, den Schrecken zu rechtfertigen, welchen eine solche Nachricht in meiner Vaterstadt erzeugt. Königsberg ist nämlich eine alte und aus drei besonderen Ortschaften zusammengewachsene Stadt. Sie besteht aus der Insel Kneiphof, aus der Altstadt und aus dem Löbenicht, welche einst besondere Stadtgerechtsame hatten und von deren Sonderwesen noch jetzt die drei Rathhäuser, die drei Junkergarten und ein Paar der übrig gebliebenen Thore und Thürme Zeugniß geben, mit welchen die Städte einst gegen einander abgesperrt gewesen sind. Der Pregel, welcher den ganz auf Pfählen erbauten Kneiphof umfließt, zieht sich in zwei Armen auch durch die andern Stadttheile hin, und ist mit sieben Brücken überbaut, welche jetzt die Verbindung in und zwischen den verschiedenen Stadttheilen unterhalten. Vor alten Zeiten hatte jede der drei Städte ihre Scheunen und Speicher besonders, und jede auf einem besonderen Flecke, massenhaft zusammengebaut. Indeß als die Städte vereinigt worden waren, hatte der Handel sich ganz und gar nach dem Kneiphof gezogen, der als Insel den leichtesten Wasserverkehr zuließ, dessen Wasserumgebung die tiefste war, und der, wenn auch noch eine Meile davon entfernt, so doch in grader Linie vor dem Ausfluß des Pregels in das frische Haff gelegen war, wodurch er den Schiffen, weil sie keine Brücke zu passiren hatten, das leichteste Einlaufen an seine Kai's gewährte. Mit der Zeit hatte sich also auch der bei weitem größte Theil der Kaufmannschaft in dem Kneiphof und in seinen beiden Vorstädten angesiedelt, welche nur durch die sogenannte grüne Brücke von ihm getrennt, und die vordere und die hintere Vorstadt geheißen wurden. Hart an dieser grünen Brücke lag und liegt, wie der ganze Kneiphof auf Pfählen erbaut, die unschöne, und wie ich glaube nur aus Fachwerk errichtete Börse, und vor der Börse stehend hat man zu seiner Rechten das grüne Thor mit seinem hohen Thurme, den Eingang in den Kneiphof, zu seiner Linken die grüne Brücke und die Vorstädte, und vor sich gen Süden den Ausfluß des Pregels, dessen beide Ufer weit hinaus mit ganzen Stadtvierteln von Speichern besetzt sind. Das rechte Pregelufer heißt die Lastadie. Eine Fähre führt, der Zeitersparniß wegen, vom Kneiphof dicht hinter der Königlichen Bank zur Lastadie hinüber, auf der sich die größte Anzahl der Speicher befindet. Auf dem linken Pregelufer liegt die Vorstadt, und dort reichten und reichen die Speicher bis dicht an die Hintergebäude der Wohnhäuser hinan.
Nun war Königsberg damals noch weit mehr als jetzt die Vermittlerin des Handels zwischen Polen und Rußland mit Deutschland und dem übrigen Norden von Europa, und es lagerten also in seinen Speichern, namentlich während der Schifffahrtszeit, große Massen von Getreide, Hanf, Flachs, Holz, Rinde, Matten, Oel, also lauter Gegenstände, welche eben so leicht Feuer fingen, als sie gemacht waren, es schnell durch die Reihen der Speicher fortzupflanzen, die obenein zum großen Theile nur Fachwerkbauten waren.
An dem gedachten Tage also, – es war am hohen Mittag des vierzehnten Juni und die Jahreszeit schon lange heiß und trocken, – befand sich die Kaufmannschaft eben an der Börse, als sich die Nachricht verbreitete, es sei nahe bei der Hanfwaage, auf der Vorstadtseite, im Heeringshofe ein Feuer ausgebrochen. Da nun während der Kontinentalsperre der Heeringshandel danieder lag, war der Heeringshof als Ablagerungsplatz für große Vorräthe von Oel, Talg, Theer und Pech eingeräumt worden, und kaum war die Kunde von dem Feuer nach der Börse gelangt, so schossen auch schon die hellen Flammen in die Höhe, flogen bereits aus der benachbarten Hanfwaage die brennenden Hanfbündel durch die Luft, zündend und Feuer erzeugend, wohin sie fielen. In Zeit von einer halben Stunde brannte es an mehreren Stellen. Dazu lag der Pregel dicht voll von Schiffen und von jenen flachen, russischen und polnischen, floßartigen Fahrzeugen, Wittinnen genannt, die alle ebenfalls mit brennbaren Waaren schwer beladen waren, und die, weil sie sich bestrebten, aus dem Hafen fort, und hinaus in das Freie zu kommen, so in einander geriethen, daß jedes Entrinnen für sie unmöglich wurde. Schiffe und Wittinnen zu erleichtern, warf man einen Theil ihrer Ladung in das Wasser, auch aus den Speichern rollte man Oel- und Spiritusfässer in den Pregel, und bald standen nicht nur die beiden Seiten des Flusses, sondern der Fluß selbst in hellen Flammen. Die Schiffe und Kähne brannten, der ganze Pregel brannte, das aus den Fässern ausgeflossene Oel brannte zusammen mit den Hanfladungen der Wittinnen auf dem Wasser.
Die ganze Lastadie, die sämmtlichen Speicher auf der Vorstadtseite, die ganze, dem Kneiphof zunächst gelegene, vordere Vorstadt, und alle mit ihr zusammenhängenden Straßen bis in die hintere Vorstadt hinaus, die grüne Brücke und die Börse, wurden ein Raub der Flammen, und noch Monate nachher bezeichneten Rauchwolken die Stellen, an denen man hie und da unter den Trümmern Nachgrabungen zu unternehmen versuchte.
Mein Vater hatte gleich beim Ausbruche des Feuers meine Mutter mit mir und meiner Amme durch unsern treuen Hausknecht, – man nannte in Königsberg einen solchen einen Faktor, – auf einem weiten Umwege zu einer befreundeten Familie in den Kneiphof geschickt, welche in der Brodbänkenstraße unweit vom Domplatz wohnte. Der Faktor, er hieß Hermann Kirschnik und war in meiner und meiner Geschwister Kindheit unser großer Freund, trug in einem Bündel meine Betten. Meine Mutter und meine Amme hatten Wäsche für mich zusammengepackt, und als nach dem Verlauf von mehr als vierundzwanzig Stunden mein armer Vater zum ersten Male wieder zu seiner jungen Frau kam – seine Kleider zerfetzt, seine Schuhe zerrissen und verbrannt, er selbst von Staub, Schweiß und Asche bedeckt, von Hunger und Anstrengungen erschöpft und bleich, – da waren seine Frau, sein Kind und die Betten und Wäsche seines Kindes das Einzige, was er aus seinem Hause hatte erretten können, das Einzige, was er aus demselben noch besaß. Der Brand – er wird in Königsberg der Vorstädtische Brand genannt – hatte ihn so gut wie ruinirt, denn ein unglücklicher Zufall hatte denselben für ihn noch besonders verderblich gemacht.
Die Feuerversicherung für den größten Theil der Waarenbestände des Hauses und für meines Vaters Mobiliar war nämlich grade an dem Tage fällig geworden. Weil mein Vater und sein Bruder aber einige Veränderungen darin zu machen gewünscht hatten, lag die ablaufende Police an jenem Morgen noch auf seinem Pulte im Comptoir, und er hatte die Absicht gehabt, diese Angelegenheit, sobald er von der Börse käme, in Ordnung zu bringen, d. h. die etwas umgeänderte Police prolongiren zu lassen. In diesem entscheidenden Augenblicke aber war das Feuer ausgebrochen, und aus ihrem hübschen Hause, aus sorgenfreien Umständen, sahen meine Eltern sich plötzlich in eine sehr schlimme und sehr schwere Lage versetzt.
An eine neue hübsche Wohnung wie die bisherige war für meine Eltern, in ihren veränderten Verhältnissen und bei den um das dreifache gesteigerten Wohnungspreisen, nicht zu denken. Sie mußten froh sein als sie am obern Ende der Brodbänkenstraße ein Paar Zimmer zur Miethe fanden. Die Verwandten meiner Mutter, welche in dem Kneiphof wohnten und also von dem Brandunglück verschont geblieben waren, halfen für den Augenblick mit Wäsche, Hausrath und Möbeln aus, bis das Nöthige wieder herbeigeschafft werden konnte, und es bedurfte von Seiten meines Vaters und seines Bruders der größten Anstrengungen, um ihr Geschäft aufrecht zu erhalten und die gehabten schweren Verluste nur einigermaßen auszugleichen. Meiner Mutter Vermögen wurde dabei zum Opfer gebracht, und unsere Familie war mit ihrer Existenz von da ab allein auf meines Vaters Thätigkeit gewiesen, welche glücklicher Weise in den Ereignissen der nächsten Jahre ein reiches Feld fand, sich mit Nutzen geltend zu machen.
Königsberg hatte nämlich kaum Zeit gehabt, sich von seinem Brandunglücke zu erholen, als mit den beginnenden Durchmärschen der französischen Truppen, welche nach Rußland zogen, eine für den Kaufmannsstand Preußens sehr bedeutende Epoche eintrat. Vom Frühling des Jahres achtzehnhundert und zwölf ab glich die ganze Provinz Ostpreußen einem großen Heerlager, und es gab einen Zeitpunkt, in welchem dort durch mehrere Wochen dreimalhunderttausend Mann Fußvolk und über vierzigtausend Mann Reiter versammelt waren. Das Land wurde von dieser Last völlig ausgesogen und erdrückt, die Noth, die Plagen und die Theuerung in den Städten waren ungemein groß; aber wer irgend welche Waare zu verkaufen hatte, konnte die höchsten Preise dafür erhalten, und bei dem ungeheuren Menschen- und Geld-Verkehr, bei den großen Unternehmungen welche für die Verpflegung dieser Heeresmassen nöthig waren, gehörte das Geld selbst zu einem der wichtigsten Handelsgegenstände, so daß die Banquiers und Geldwechsler bedeutende Geschäfte machten, und großen Gewinn davon hatten.
Mein Vater hatte, sobald es möglich gewesen war, die enge Wohnung, welche die Eltern nach dem Brande inne gehabt, wieder verlassen, und ein dreistöckiges, zwei Fenster breites, auch in der Brodbänkengasse gelegenes Haus bezogen, welche Brodbänkengasse die Hauptstraße des Kneiphofs, die Langgasse, mit dem Rathhausplatze verbindet. Sein Geschäft war wieder aufgeblüht, und neben dem frühern Speditionshandel hatten die Brüder angefangen ein bedeutendes Geldgeschäft zu betreiben. Meines Vaters älterer Bruder Beer, sein jüngster Bruder Friedrich Jakob, der achtzehnhundert acht und fünfzig in Breslau als Direktor der Oberschlesischen Eisenbahn in Breslau gestorben ist, sein Vetter der noch in Stuttgart lebende bekannte Schriftsteller August Lewald, und einige Handlungsgehilfen waren in dem Hause thätig, und da der älteste Onkel wenig über dreißig Jahre, mein Vater fünfundzwanzig, sein jüngster Bruder achtzehn und August Lewald zwanzig Jahre alt war, so bildeten sie bei aller auf ihnen lastenden Arbeit, und mitten in den Drangsalen der Kriegszeit, von denen kein Haus verschont blieb, doch eine sehr fröhliche Gesellschaft, die keine Gelegenheit von sich wies, sich und Andern Lebensgenuß zu bereiten. Mein Onkel Friedrich Jakob und unser Vetter August Lewald wohnten im Hause meines Vaters. Sie waren sehr hübsche junge Männer; die Schwestern meines Vaters, von denen Johanna eine blendende Schönheit war, als welche ich selbst sie noch in ihren spätern Jahren gekannt habe, waren vielfach anwesend, und obschon man sich durch die zahlreiche Einquartierung in seinen Wohnungen über alle Gebühr beschränkt fand, so waren doch unter diesen unwillkommenen Gästen auch viele sehr gebildete und rücksichtsvolle Männer, mit welchen es sich gut verkehren ließ, und die bemüht waren, die Unbequemlichkeiten und Mühen, welche sie verursachten, durch Zuvorkommenheit und Liebenswürdigkeit vergessen zu machen. Mancher Franzose, der mit schwerem Herzen Weib und Kinder in der Heimath zurückgelassen, war obenein sehr glücklich, ein Paar Tage in einer fremden Familie sich der Seinen zu erinnern. Es bildete sich also fast überall, auch in dem Hause meiner Eltern, eine Geselligkeit zwischen den Wirthen und der Einquartierung aus, und wenn die letztere, wie es hie und da der Fall war, längere Zeit an dem Orte verweilte, schied man bisweilen von den feindlichen Soldaten, wie diese sich von ihren Wirthen trennten, mit dem Bedauern, im Grunde doch Feinde zu sein.
Die eigentliche Königsberger Lebensweise, bei der man um sieben oder acht Uhr ein erstes, um eilf Uhr ein zweites Frühstück, um ein Uhr das Mittagsbrod einnahm, und dann noch mit Kaffee, Imbiß und Abendbrod zwei drei Mahlzeiten zu machen hatte, mußte in vielen Familien nach dem Wunsche der Einquartierung geändert werden. In den Kaufmannshäusern wich sie dem großen Arbeitsandrange als Nothwendigkeit. Man richtete sich auf ein gehöriges Gabelfrühstück und auf ein Abendbrod ein, das dann reichlicher als das sonst gewohnte ausfiel, oder man aß gar erst nach dem Theater die Hauptmahlzeit, wobei dann oft bis tief in die Nacht hinein gewacht wurde. Diese veränderte Lebensart, diese schnell hinfluthende Existenz, in die sich das Militär mit seinem auf den Augenblick angewiesenen Dasein hineinmischte, in der gereifte Krieger von ihren abenteuerlichen Feldzügen durch ganz Europa, von ihren Siegen an den Pyramiden, von dem Glanze des Pariser Lebens und von den Wunderthaten ihres Kaisers erzählten, in der junge Soldaten von Ehren, Ruhm und Auszeichnungen sprachen, mit der sichersten Gewißheit sie zu erreichen, hatte etwas Berauschendes, Etwas, was die Phantasie anregte, und auch mittelmäßige und gleichmüthige Menschen über sich selbst hinauszutragen geeignet war. Man hatte den Sohn eines Pastetenbäckers König von Neapel werden und den Sohn eines Advokaten zum Beherrscher der Welt emporwachsen sehen. Junge, aus den untern Volksschichten hervorgegangene Männer durchzogen als Generale und Marschälle die Welt, welcher ihr Herr seine Gesetze vorschrieb; und wenn ich in spätern Jahren in Preußen in den Familien, von den Franzosen und von den Kriegsjahren erzählen hörte, geschah es immer mit einer Erregung, welche nicht allein von dem Zorne gegen die Feinde des Vaterlandes herrührte. Es schien mir vielmehr, als drücke sich in solchen Mittheilungen eine ungewöhnlich lebhafte Erinnerung aus, als hätten die Menschen ein Bewußtsein oder doch mindestens eine Empfindung davon, daß sie in jener Zeit, welche recht eigentlich eine Zeit für die Jugend gewesen sein muß, weil überall die Jugend herrschte, ein volleres, ein frischeres Leben geführt hätten, als es ihnen sonst in der Ruhe der entlegenen Provinz jemals zu Theil geworden war. Selbst wo man sich über die Franzosen zu beschweren, wo man ihren Anmaßungen entschiedenen Widerstand entgegenzusetzen gehabt hatte, war man sich eben dadurch seiner Persönlichkeit und seiner Kraft bewußt geworden; und so hart die Kriegsjahre auf dem Lande gelastet hatten, boten sie doch in der Erinnerung fast Jedem auf die eine oder die andere Weise etwas dar, das ihn innerlich erwärmte und erhob, wenn er es mit der stumpfen Ruhe verglich, welche die darauf folgende Epoche kennzeichnete.
In den jüdischen Familien befand man sich obenein gegenüber der französischen Invasion in einem sehr erklärlichen Zwiespalt. Die französische Revolution hatte die staatliche Gleichberechtigung der verschiedenen Kulte in Frankreich festgestellt, und wenn Napoleon auch seinen Frieden mit der katholischen Kirche gemacht hatte, so hatte er es doch nicht gewagt, die Glaubensfreiheit und die staatliche Gleichberechtigung der verschiedenen Religionsbekenntnisse anzutasten. In Frankreich, und wohin die französische Herrschaft sich ausbreitete, waren die Juden emancipirt; in Preußen lasteten Unfreiheit und Verspottung auf ihnen. Es ist also natürlich, daß in jener Zeit sich in vielen Juden die Frage regte: ob Freiheit unter einem fremden Herrscher nicht der Knechtschaft unter einem heimischen Fürstenstamme vorzuziehen sei? Und es ist nach meiner Meinung nie genug gewürdigt worden, wie groß die Selbstverläugnung und die Vaterlandsliebe der Juden gewesen sind, welche sich im Jahre 1813 als Freiwillige den Kämpfern gegen Frankreich angeschlossen haben, um einem Lande seine Freiheit wieder erobern zu helfen, welches ihnen selbst keine Freiheit, wohl aber Kränkungen und Beschränkungen aller Art dafür zum Lohne bot. Das Verhalten der modernen Staaten, das Verhalten unseres Jahrhunderts gegen die Juden, mag man diese als abweichende Religionspartei oder als eine fremde Nation betrachten, wird einmal ein besonderes Kapitel in der Kulturgeschichte einnehmen: ein Kapitel, welches merkwürdig sein wird durch die begangenen Ungerechtigkeiten und durch den Mangel an Logik in den Thatsachen von denen es handelt. Daß die Bekenner des einen Kultus die Bekenner des andern Kultus verdammen, daß eine Race eine Abneigung gegen die andere empfindet, das ist zwar sehr unvernünftig, aber nicht auffallend, und die Urgeschichte der Juden selbst liefert dafür das Beispiel. Sie hätten kaum Etwas dagegen sagen dürfen, wenn die Germanische Race z. B. es fest ausgesprochen und durch ihre Fürsten hätte ausführen lassen, daß sie die Juden verabscheue und keine Juden wolle neben sich wohnen lassen – vorausgesetzt, die Germanische Race hätte dies wie die Juden vor zweitausend Jahren oder doch mindestens in den vorchristlichen Zeiten sagen können und gesagt. Daß man die Juden aber in den christlichen Staaten zuließ, daß man sie die Staatslasten mit tragen ließ, daß man ihnen die Bürgerpflichten auferlegte, sie allmälig für alle Leistungen emancipirte und sie dennoch von dem Genuß der vollen Rechte eines Staatsangehörigen und Bürgers ausschloß, das ist jenes Verhalten, welches die Kulturgeschichte einst mit allen seinen ernsten und lächerlichen Einzelheiten in ihren Büchern zu verzeichnen haben wird.
Mein Vater wußte die französischen Institutionen, so weit sie den Juden zu Statten kamen, sehr wohl zu würdigen. Die Lebhaftigkeit der Franzosen sagte ihm daneben zu, ihre Sprache war ihm geläufig und er hegte für Napoleon, dem er beiläufig überraschend ähnlich sah, eine Sympathie, welche sich ganz auf den Kaiser als Person bezog. Das Beharrliche, das Selbstgewisse, das in sich Abgeschlossene und auch das Gewaltthätige im Charakter des Kaisers fanden in der Natur meines Vaters ein verwandtes Element, und der wunderbare Lebensweg, welchen jener Mann gegangen war, hatte für meinen Vater den Reiz, den ein außerordentliches Wollen und Können, und die Gewahrung eines ebenso außerordentlichen Gelingens für jeden kräftigen Charakter haben müssen. Ein blinder Verehrer des Kaisers war er nicht, aber ich kann es mir nicht denken, daß er in jener Zeit ein leidenschaftlicher preußischer Patriot gewesen sein sollte. Vorliebe für ein Land zu empfinden, nur weil er zufällig in demselben geboren, oder ein Herrscherhaus besonders zu lieben, blos weil es das Land besaß, in welchem er geboren worden war, das lag nicht in seiner Art. Er verehrte Friedrich den Großen, wie er Napoleon verehrte, als bedeutende Menschen, indeß die preußischen Zustände waren von dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelm's des Zweiten bis zu dem Beginn der Freiheitskriege nicht dazu angethan, irgend einen Enthusiasmus zu erregen, am wenigsten in der Seele eines Mannes, dessen Vater durch die Willkür der Regierung in das Gefängniß geworfen worden war, und der selbst von den engherzigen Gesetzen des Landes zu leiden gehabt hatte.
Aber es war ein anderes Element, welches ihm den Gedanken an eine dauernde Fremdherrschaft unannehmbar machen mußte: mein Vater wurzelte mit seiner ganzen Bildung in Deutschland. Er liebte den deutschen Geist, er liebte und bewunderte die deutsche Literatur und ihre Klassiker mit tiefem Verständniß, und da jeder Mensch das Produkt seiner Zeit und ihres Geistes ist, so hatte ein Zug der damaligen Romantik höchst eigenartig neben dem scharfen Verstande meines Vaters Platz gefunden, der an sich allein hingereicht haben würde, ihm die Fremdherrschaft im Lande verhaßt zu machen, wenn dem selbstherrlichen jungen Manne nicht ohnehin die Willkür des Eroberungszuges im Allgemeinen, und die Willkür und Anmaßung der einzelnen Franzosen in seinem Hause unerträglich gewesen wären. Meine Mutter und meines Vaters jüngste Schwester, welche während jener Zeit ganz bei meinen Eltern lebte, um meiner Mutter mit ihrer Kenntniß der französischen Sprache auszuhelfen, erzählten mir später oftmals, welche Angst der Vater ihnen verursacht, wenn er jeder unbilligen Forderung der Einquartierung das Genügen verweigert habe, jeder ihrer Anmaßungen entschieden entgegengetreten sei, und wo er nicht selbst sein Recht wahren konnte, augenblicklich die Abhülfe und Genugthuung von den französischen Behörden verlangt habe, obschon man preußischer Seits auf das Dringendste vor einem feindlichen Auftreten gegen die Franzosen gewarnt und selbst die Magistrate in besondern Erlassen die Bürger zu geduldigem Ertragen aller Unbill ermahnt hatten.
Einmal, als auch ein älterer französischer Offizier ich weiß nicht welche übertriebene Forderung stellte, hatte mein Vater dies angezeigt und seine Entfernung aus dem Hause begehrt, ohne sie erlangen zu können. Der Offizier hatte einen Verweis erhalten, war aber im Hause geblieben, und hatte, obschon er sich von da ab in seinen Grenzen hielt, gedroht, er werde sich an meinem Vater rächen. Dieser hatte davon gar keine Notiz genommen, man hatte dem Offizier sein Essen, das er sonst am Familientische erhalten, seit dem Zerwürfniß auf sein Zimmer geschickt, und meine arme Mutter, welche keine Sylbe französisch verstand, hatte dadurch dreifach unter der Sorge gelitten, was der Offizier dem Vater anthun und was er mit ihm beginnen werde. Es ließ ihr nicht Tag nicht Nacht Ruhe, sie glaubte, man verberge ihr was der Offizier gesprochen, und als das Corps, zu dem er gehörte, Marschordre bekam, zählte sie die Stunden bis zum Aufbruche desselben. Die Tage vergingen jedoch ganz ruhig, der Abend vor dem Aufbruch kam heran, und es war nichts geschehen. Da sitzt meine Mutter, nachdem es dunkel geworden, in der Kinderstube, in der man mich zu Bette brachte, als sie plötzlich ein furchtbares Schreien, ein Poltern, Schimpfen und einen Fall auf der Treppe hört. Sie stürzt hinaus und sieht bei der schwachen Beleuchtung der Flurlampe den Franzosen mit einer Hetzpeitsche in der Hand, der drohend gegen die untere Etage gewendet da steht und wüthend gegen Jemand hinunterspricht, welchem unten bereits die Hausgenossen zu Hülfe eilen. Ueberzeugt, daß es mein Vater sei, der von dem Franzosen gemißhandelt worden, fliegt sie nach der Treppe, aber der Offizier hatte das Opfer seiner feigen Rache verfehlt, und einer von den Handlungsgehülfen hatte die Peitschenhiebe empfangen, welche Jener meinem Vater zugedacht. Der Offizier hatte es sich nämlich gemerkt, daß mein Vater um die Dämmerungszeit gewöhnlich nach der Kinderstube ging, um mich vor Nacht noch zu sehen, und darauf fußend, hatte er sich in einer Ecke des Flures verborgen, von der aus er seinen Anfall unternehmen konnte. Indeß mein Vater war diesmal länger im Comptoir festgehalten worden, ein Commis hatte für ihn gelitten, und da der Erstere also heil und unversehrt war, erlangte er noch an dem Abende die Arretirung des Offiziers. – Im Ganzen aber waren die Klagen über die Rohheit mancher deutschen Truppen, namentlich der Hessen, Baiern und Würtemberger, in Preußen viel größer, als die Beschwerden über die Franzosen, und man rühmte diesen Letzteren im Allgemeinen große Rücksicht für Kranke und große Freundlichkeit für Kinder nach.
Durch zwei und ein Viertel Jahre blieb ich das einzige Kind meiner Eltern. Meine Mutter hatte also Zeit sich viel mit mir zu beschäftigen. Sie war ungemein freundlich und lieblich, meine Amme war jung, froh und sehr redselig, und es war also kein Wunder, daß ich früh und gleich sehr deutlich sprechen lernte. Sie sagten mir, ich hätte von jeher ein starkes Gedächtniß gehabt, und noch vor dem Ende meines zweiten Jahres Verse vor mich hin gesprochen, die ich irgendwie aufgeschnappt hatte, und die ich doch bis zu einem bestimmten Grade auch verstehen mußte, weil ich sie hie und da richtig anzubringen wußte. Ein solcher Fall, der mir meine frühe Klugheit beweisen sollte, war nach der französischen Retirade aus Rußland, im Anfang des Jahres Dreizehn, nicht lange vor meinem zweiten Geburtstage vorgekommen.
Es waren damals eine Menge französischer Lieder im Schwange, und wieder andere, die irgend welche damals interessirende Zustände in gebrochenem Deutsch behandelten. Meine Mutter hatte eine liebliche Stimme, und muß wohl das Liedchen von »Jean Grillon«, das in aller Leute Munde war, vielfach gesungen haben, denn ich hatte es theilweise behalten und weiß es noch auswendig, da die Mutter es auch in späteren Jahren noch manchmal für uns sang. Es lautete:
Ich bin ein Franzose, mes dames,
Comme çamit die hölzerne Bein,
Jean Grillon ist mein Name,
Mein Stolz ist die hölzerne Bein.
Ich scherze, ich küsse, ich kose,
Comme çamit die hölzerne Bein,
Im Herzen, da bleib ich Franzose,
Und wär' ich auch außen von Stein.
Nun fügte es sich eines Tages, daß wieder einmal ein Trupp retirirender Franzosen ankam, von denen Einer, dem das Bein in Rußland erfroren und abgenommen worden war, ein Quartierbillet auf unser Haus erhielt. Als man den Schwerleidenden vom Wagen gehoben und in das Zimmer gebracht hatte, befand ich mich in demselben. Ich sah den Offizier verwundert an, denn er hatte einen Stelzfuß, lief dann auf ihn zu und rief freundlich: »Comme ça mit die hölzerne Bein!« – Da stürzten dem noch jungen Manne die Thränen aus den Augen. »Ich habe auch solch ein Kind, solch ein Mädchen zu Hause«, sagte er zu meinem Vater, und diesem die Hand reichend, fügte er hinzu: »um dieses Kindes willen, haben Sie Mitleid mit mir, ich leide fürchterlich!« – Das war ein Anruf, der nicht unbeachtet geblieben wäre, hätte das Elend des jungen Franzosen nicht ohnehin alle Theilnahme für sich in Anspruch genommen. Er blieb also lange in unserem Hause, wurde sorglich gepflegt, und verließ Königsberg erst kurz vor dem Ausbruch des Kampfes im Frühjahr Achtzehnhundertdreizehn. Mir hatte er eine Schnur Perlen von Malachit zum Andenken geschenkt, die ich bei einem Kinderfeste verloren habe, als ich sieben, acht Jahre alt war. Sie waren sehr wahrscheinlich in Rußland erbeutet, d. h. gestohlen worden, ich beweinte aber seiner Zeit deshalb ihren Verlust nicht weniger.