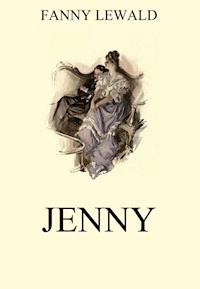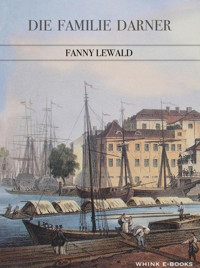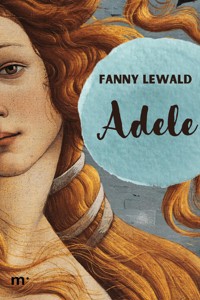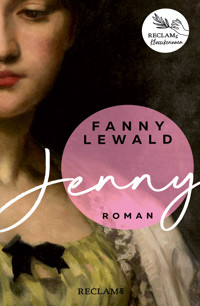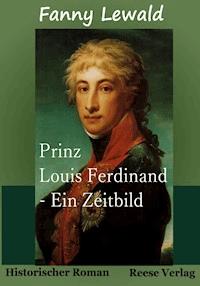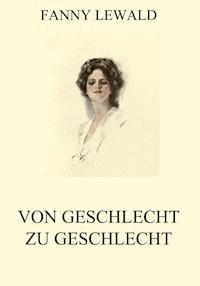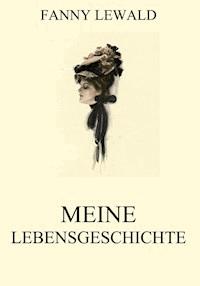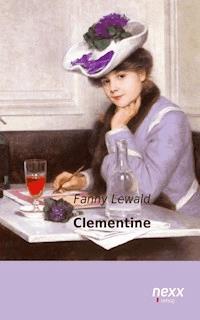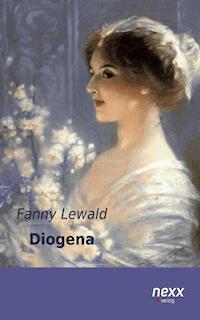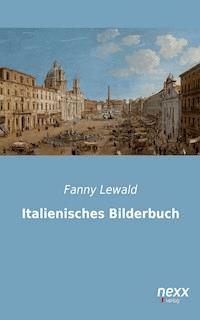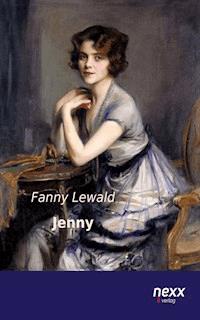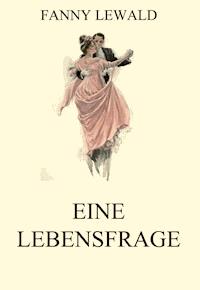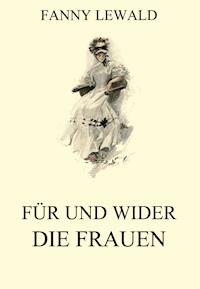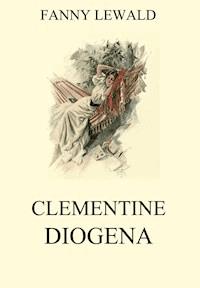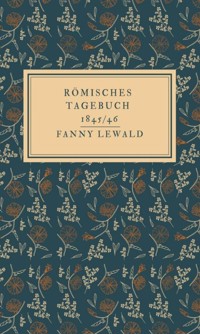
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Herbst des Jahres 1845 war außerordentlich schön und warm, und ich genoss ihn in dem fremden Lande, in der mir neuen südlichen Natur mit täglich neuer Freude. Noch heute, nachdem volle zwanzig Jahre seit jenem meinem ersten Eintritt in Italien hingegangen sind, kann ich mir die Eindrücke, welche ich damals empfangen habe, mit einer solchen Deutlichkeit in das Gedächtnis zurückrufen, dass ich all die Lust und Wonne in der Tat noch einmal zu erleben meine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fanny Lewald
Römisches Tagebuch1845/46
Einleitung
Das Schicksal, dessen Knüpfung auf diesen Blättern dargestellt ist, hat einst weit über den Kreis derer, die es leben mussten, hinaus in Deutschland Anteil erweckt. Durch viele Denkwürdigkeiten des neunzehnten Jahrhunderts und durch Briefe der Zeitgenossen schreiten Fanny Lewald und Adolf Stahr vereint hindurch, bewundert und gescholten, verstanden und missverstanden. Den letzten Ursprung und die tiefe Gründung ihrer späteren, Leben und Tod überdauernden Einheit bekennen erst diese, so lange nach beider Tode in den Druck gelangenden Aufzeichnungen.
Es ist keine indiskrete Hand, die das lange Bewahrte — im Einverständnis mit den Familien Lewald und Stahr — ans Licht zieht. Vielmehr hat Fanny selbst dieses Buch zur Veröffentlichung bestimmt, und ihr Gatte hat sie in dieser Absicht bestärkt. Wohl sind es tagebuchmäßige Aufzeichnungen aus jenen italienischen Monaten — aber erst zwanzig Jahre später verwob sie Fanny Lewald zu schlüssiger Darstellung und legte die Erinnerungen «dem Manne, der sie mit mir in schmerzvollem Glück durchlitten, als ein Zeichen unserer geliebtesten Erinnerung» auf den Weihnachtstisch. Damals waren Adolf und Fanny bereits zehn Jahre lang in einer Ehe verbunden, deren tiefes Glück nicht zuletzt die noch heute lebenden Enkel aus Stahrs erster Ehe in warmer Erinnerung tragen. Und auf die von der Frau heimlich verfasste Arbeit setzte der Mann, als er sie tiefbewegt durchgelesen hatte, die Verse:
Unseren Frühling hast du, Geliebteste, heut mir erneuert, herrlich mit Blüten geschmückt unserer Liebe Gedicht. Unser seliges Leid, von dir geschildert, erblüht mir heut in flammender Pracht neu in der Seele empor.
Und er, Stahr, wünschte die Veröffentlichung, erbat sie noch wenige Tage vor seinem Tode. Fanny aber hat in ihren dreizehn überschatteten Witwenjahren die Handschrift wohl druckfertig gemacht und sie dennoch erst den Nachlebenden zur Veröffentlichung überlassen. So tritt sie heute, achtzig Jahre nach den in ihr dargestellten Erlebnissen, hervor und gewährt den vollen Blick auf ein ungewöhnliches, von ungewöhnlichen Menschen mit namenlosem Glück und namenlosem Schmerz, in allen Tiefen erfahrenes Schicksal. Der Bericht über diese Tage aber ergreift um so tiefer, da sich den Liebenden an ihrem Ende nicht der schmalste Ausblick in eine glücklich lösende Zukunft eröffnet. Zwei Naturen, nach Anlage und Überzeugung gewöhnt, sich immer ins Rechte zu denken, geraten in einen tiefen Zwiespalt aller gewohnten Empfindung und müssen doch den Urgrund dieses Zwiespalts, je dunkler die Zukunft zu werden scheint, um so mehr, als das täglich sicherer gewusste, höchste Glück ihres Lebens preisen. Was ein späterer Dichter aus verwandtem Schicksal zu unvergesslichem Vers formte, klingt wie ein immer stärker, schließlich unüberhörbar werdendes melodisches Motiv durch die Geschichte von Fanny Lewald und Adolf Stahr:
Alles Leid ist Einsamkeit, alles Glück Gemeinsamkeit.
Diesem mit reinem Willen und erschütternder, seelischer Energie erlebten Finden aber gibt der Ort, wo es geschah, für den späten Leser ebenso den besonderen Reiz, wie er dem Paare selbst alles überhöhte und vertiefte. Denn es war Rom, wo sie sich fanden.
Aus der Alltagsbilder irrem Wanken plötzlich still verklärt Gestalt sich los, Größe, die nicht Wandel kennt, noch Schranken, ruht in ihrer Züge tiefem Schoß. Welcher Laut hat menschlich je geschallet, den die Vorzeit hier nicht widerhallet?
So hat einer der größten Deutschrömer, Wilhelm von Humboldt, die ewige Stadt gefühlt und gegrüßt, so offenbart sie sich heute noch, jede Erwartung und Ahnung mit überbietend, dem deutschen Kömmling. Und um wie viel mehr dem von 1845, der noch wie auf Goethes und Winckelmanns unmittelbarer Spur über Ponte Molle durch Porta del Popolo einfuhr. Fanny Lewald erging es, wie, genau zehn Jahre später, Herman Grimm. «Ich selbst habe noch einen allerletzten Schimmer der Abendröte erleben zu dürfen geglaubt, in welcher Goethe Rom erblickte. Ich bin vor zwanzig Jahren noch eingefahren durch die Porta del Popolo, nachdem ich in langer Fahrt Rom näher und näher gekommen war, und habe die letzten Priester und Mönche noch in voller Berechtigung leben und weben sehen, die heute wie arme abgedankte Statisten eines abgebrannten Theaters in den alten Kostümen herumgehen. Heute dringt man, wie durch eine Bresche, durch einen Mauerdurchbruch an ganz anderer Stelle ein und findet sich am Bahnhofe in einem neuen Quartiere mit glatt aufgeschossenen, eleganten Häusern, die ebenso gut Berlin, Wien oder einer andern modernen Stadt gehören könnten. Von da aus sucht man dann das alte Rom erst auf wie eine abseits liegende Merkwürdigkeit. Früher wurde man gleich ins Herz der alten Stadt geführt und sah sich von ihr umgeben und eingeschlossen.»
Damals, in fast eisenbahnlosen Tagen, mochte man sich in Rom aller gewohnten Welt in unabsehbare Ferne entrückt scheinen. Dass vor den Fenstern der Freundin der unablässige Fall der Fontana Trevi in diese jähe Lebensfügung hineinrauscht, gibt ihr eine unvergessliche Kadenz.
Und auch das verstärkte für Fanny Lewald und verstärkt für uns Farbigkeit und Fülle dieser Begebnisse, dass ihnen im römischen Rahmen die römische Gesellschaft jener gesegneten Jahre mit allem Takt und aller Teilnahme innerster Vornehmheit beiwohnt, dass Fanny Lewald hier zum ersten Mal mit der Erfüllung eines Herzenserlebnisses die ganze Fülle geistig strömender, ihr frei zugetanener Freundschaft bedeutender Menschen zuteil wird.
Sie war vierunddreißig Jahre alt geworden. Zweimal hatte sie schwerlastende Herzenserfahrungen machen müssen. Der junge Pfarramtskandidat Leopold Bock, dem sie sich ohne ausdrückliche Aussprache angelobt, hatte sich, wohl unter dem Einflusse ihres Vaters, von ihr zurückgezogen und war im Begriff einer zweiten Annäherung jung gestorben. Ihr Vetter Heinrich Simon aber, damals im jugendlichen Aufstieg zu glänzender politischer Laufbahn, hatte ihre heiße Neigung nur mit einer treuen, männlichen, bis an seinen Tod dauernden Freundschaft zu erwidern vermocht.
Das alles hatte sie in den engen häuslichen und heimatlichen Verhältnissen durchgemacht. In dem Augenblick ihres unbewussten Eintritts auf die Schwelle der Lebenserfüllung beschritt Fanny zugleich, zum ersten Male ganz auf sich selbst gestellt, die Stufen zu einer neuen Welt.
Sie war Königsbergerin, eine Tochter der Stadt, die als der Ausgangspunkt Gottscheds, Hamanns, Herders, Hippels, vor allem Kants, einer der geistigen Vororte des achtzehnten Jahrhunderts gewesen war. Wohl war ihr mit Immanuel Kants Tode die Krone vom Haupte gefallen, aber schon hatte sie sich mit der romantischen Dichtung Hoffmanns, Werners, Schenkendorfs ein neues Diadem geschmiedet, und eben jetzt rüstete sich, noch unter den Augen Heinrich Theodor von Schöns und Eduard von Flottwells, ein ganzes, hochbegabtes Geschlecht junger Politiker zum Aufbruch: die Brüder Gaucken und Auerswald, Eduard Simson, Graf Fritz Eulenburg, Johann Jacoby, Wilhelm Jordan, Friedrich Albert Dulk. Zugleich trat die Albertus-Universität in eine Zeit neuer Hochblüte.
Von alledem hatte Fanny Lewald ihr bescheiden Teil empfangen. Der einzige in Königsberg verbliebene romantische Dichter, Raphael Bock, der letzte Domherr von Oliva, war ihres Vaters Jugendfreund, dem Theologen Ludwig August Kähler, einem von Goethe geschätzten Dichter, hatte sie nahetreten dürfen, Eduard Simson, dessen Eltern die ihren verschwiegert waren, war ihr Schulkamerad gewesen, Jacoby war der Arzt des Hauses. Der verheißungsvolle Julian Schmidt gehörte zu den Kommilitonen ihrer Brüder. Karl von Holtei und Auguste Crelinger waren bei Königsberger Besuchen im Lewaldschen Hause in der Kneiphöfischen Langgasse eingekehrt. Dem Minister Schön hatte sie im Jahre 1843 eine Lebensskizze gewidmet. Auf Reisen mit ihrem Vater und bei ihrem Breslauer Oheim Friedrich Lewald hatte sie Hoffmann von Fallersleben, Meyerbeer, Börne, Spindler, Herwegh, Dingelstedt kennengelernt und in dem letzten Berliner Jahr, zum erstenmal in eigener Häuslichkeit, mit Therese von Bacheracht, Gutzkows Freundin, Freundschaft geschlossen, mit Theodor Mundt, Henriette Herz, Varnhagen von Ense, Theodor Mügge verkehrt.
Hier in Rom aber war alles anders. Selbst in Berlin war sie, bei einer Verwandten eingemietet, mit ihrem ältesten Bruder verbunden gewesen, und wenn sie bei Henriette Solmar dem Geheimrat Varnhagen vorgestellt ward, so sah er in ihr vielleicht weniger die Schriftstellerin als die entfernte Verwandte. Jetzt aber musste sie ganz auf sich selbst stehen. Ihre einzige Beglaubigung waren ihre drei Romane: «Clementine», «Jenny» (beide noch namenlos erschienen) und «Eine Lebensfrage»; selbst die Hilfestellung ihres Vetters August Lewald, der einst in seiner «Europa» ihre ersten Arbeiten hinausgeleitet hatte, fiel hier fort.
In einer Gesellschaft, an deren Spitze Ottilie Goethe und Sibylle Mertens standen, galten nur geistiger Rang und geistige Teilnahme, und jeden Weg in das nun zu erschließende römische Wunderland musste die eigene Persönlichkeit eröffnen. So erleben wir den überwältigenden Hinsturz des Neuen, Großen, jedes Vorgefühl hinter sich Lassenden, erleben zugleich das Glück, sich von den in Rom vereinten Menschen dieses geistigen Ranges mit Wohlwollen, heiterem Sinn und jener unbequemem Zudrängen, wie herrschsüchtiger Überlegenheit gleich fernen Freiheit empfangen zu sehen. Und wir erleben mit Fanny Lewald die langsame Einordnung verwirrender Eindrücke unter der absichtslos lehrenden und führenden, kundigen Hand Adolf Stahrs; Rom ist nicht nur der Ort, es wird in einem großen Sinne auch der Anlass ihrer Lebensbindung.
Denn wohl war Adolf Stahrs, des einst Gefeierten und heute allzu sehr Unterschätzten, Dasein ganz anders verlaufen als das der Freundin. Aber der uckermärkische Pfarrerssohn hatte sich von früh an, seit dem ersten studentischen Semester, unabhängig in geistigem Erwerb und geistigen Kämpfen bewegen können, mit Männern wie Ruge und Echtermeyer die literarischen Kämpfe von Jung-Halle durchgefochten, mit Julius Mosen gegenseitig fördernde Lebensgemeinschaft geschlossen, um dann freilich die Enge Oldenburgs drückend zu empfinden.
Beide kamen aus gebundenen Verhältnissen in eine von der Sehnsucht der Jahrhunderte umwobene Stätte, von der in einem höchsten Sinne das alte, deutsche Rechtswort galt und gilt: Stadtluft macht frei. Die Stadt, die urbs orbis, sollte auch sie freimachen und legte ihnen doch ein Band auf, das kein Tag wieder gelöst hat. Wie sie diese römische Freiheit als charakterstarke Menschen werteten, trugen und schließlich meinten, entsagen zu müssen, klingt herzanfassend aus diesen Blättern, darauf die Sonne der Campagna scheint und darüber die Wipfel des borghesischen Gartens im milden italienischen Lenzwind schwanken.
Für Fanny Lewald gewann nun freilich die große Erfahrung von Rom noch eine besonders merkwürdige Folie. In ihrem ersten Roman, der 1843 erschienenen «Clementine», hatte sie eine Vernunftehe geschildert. Die Frau dieses Werkes schloss die Heirat mit einem nicht geliebten, viel älteren Manne. In diese Ehe trat ein einst leidenschaftlich geliebter Jugendfreund, schwerer Konflikt brach auf und endete mit der Entsagung der Frau. Ihr dritter, kurz vor der Südreise geschaffener Roman «Eine Lebensfrage» behandelte die unter Umständen sittliche Notwendigkeit der Trennung einer Ehe. Beide Probleme hatte die Schriftstellerin nicht aus eigenem Erlebnis schöpfen und durcharbeiten können. Bei der «Clementine» mochte ihr, wenn wir ihrer Selbstbiographie folgen, wenigstens für die Atmosphäre einer solchen Vernunftehe das unglückliche Geschick einer zur Versorgung verheirateten Tante vorgeschwebt haben, und etwas kam aus Eigenem dazu: Gerade im Hinblick auf diese Ehe hatte Fanny die dringende Bewerbung eines ostpreußischen Landrats, trotz wärmster Zusprache ihres geliebten Vaters, ausgeschlagen, nicht weil ihr der zugedachte Gatte zuwider war, sondern weil sie ihn nicht liebte und eben keine Versorgungsheirat schließen wollte. Noch viel ferner war ihren eigenen Erfahrungen der Grundstoff der «Lebensfrage» gewesen; aber merkwürdig genug, die Anregung zu diesem Werk war aus einem Ausspruch jener Halleschen Jahrbücher geflossen, unter deren Hauptmitarbeitern Adolf Stahr stand. Jetzt galt es in innerster Aufwühlung zu eigener schriftstellerischer Beglückung und Befriedigung Ersonnenes im eigenen Daseinskreis zu erleben.
Indem Fanny Lewald und Adolf Stahr in Rom den großen Umschwung ihres Lebens erfuhren — oft mit dem Gefühl von Wanderern auf hohem Grat neben tiefem Absturz — machte dies schicksalsvolle Zusammentreffen und Zueinanderleben auch in ihrem literarischen Wirken Epoche. Wohl besaß die Schriftstellerin ein ungewöhnliches, von dem feinen Redakteururteil des Vetters August aus ihren unbefangenen Briefen über den Königsberger Muckerprozess sicher herausgespürtes Talent. Gewiss hatte es von mancher Seite Anerkennung und Aufmunterung, nie aber so rücksichts los liebevolle, eindringliche, fördernde Kritik gefunden, wie nun von dem Freunde. Immer hatte Fanny Lewald klar und mit eingrenzender Deutlichkeit zu schreiben gesucht; jetzt erst ward sie sich unausweichlicher stilistischer Anforderungen bewusst, von hier an erst schreibt sich ihr auf die Kunstform gerichtetes Studium Goethes her, erst durch Stahr gewann sie ein Verhältnis zur Ästhetik des Romans und der künstlerischen Prosa, wie sich ihr an seiner Hand, aus seinem Munde der Gehalt der antiken Kunst erschloss. Wohl schrieb Gutzkows fast auf den Tag gleich geborene Altersgenossin auch fürderhin breit, bändereich, erläuternder Betrachtung zugeneigt. Aber sie fand doch auch den knappen satirischen Ton ihrer «Diogena», sie erwies gleich im «Italienischen Bilderbuch» ihr geschärftes und zugleich vertieftes Naturgefühl, die neu eroberte Anschauung großer Kunstwerke, fremder Landschaft, anderer Volkheit [sic!]. In dem ungefügen Roman «Von Geschlecht zu Geschlecht» spürt man eine an den «Wahlverwandtschaften» gefeilte, stilsicher meißelnde Plastik bei der Herausarbeitung einzelner Gestalten und Örtlichkeiten. Ein so gegenständlich klar umrissenes Bild, wie das der Johanna Kinkel aus dem Jahre 1858, wie das aus den Erinnerungen dieser Zeit geschöpfte Porträt von Caroline Ungher-Sabatier, wie später das Franz Liszts, erweisen ebenso den in Rom und im geistigen Austausch mit Stahr erklommenen Aufstieg, wie zuletzt Fanny Lewalds Meisterwerk, die «Familie Darner». Gewiss, fast alles von Fanny Lewald Geschaffene hat nur Zeitbedeutung behalten; aber ihr gilt sicherlich das Wort: «Wer der Zeit dient, der dient redlich.» Selbst der ihr nicht geneigte Treitschke rühmt ihre Befähigung zur Kritik und zum sicheren Beobachten — beides hat sie in Rom und durch Stahr üben und vervollkommnen gelernt.
Für Adolf Stahr bedeuten italienische Reise und Lebensumschwung nicht weniger. Erst in Rom ward aus dem Aristotelesforscher und Jahrbuch-Kritiker der Schriftsteller. Die eine Frucht dieser zwölf Monate, das «Jahr in Italien» zeigt bei manchmal scharfer politisch-kritischer Einstellung auf seinen liebenswürdigsten Blättern doch den süßen Sommerhauch des wie mit neuen Sinnen Erlebten; das Buch bezeugt eine Dehnung des Blickfeldes und des Weltbildes. Auch Adolf Stahr, dessen eigene Dichtungen durchschlagender Kraft entbehren, diente der Zeit, und wenn er, wie ich sagte, heute durchaus unterschätzt wird, so beruht das auf fehlerhafter geschichtlicher Einstellung. Ein Buch wie das seine über die Apenninen-Halbinsel hatte damals nicht Dutzende von Vorgängern und eröffnete dem gebildeten Publikum der Zeit wirklich neue Ausblicke. Stahrs zweite Schöpfung aus italischen Tagen und römischem Studium, das Werk «Torso. Kunst, Künstler und Kunstwerke der Alten» bedeutete für eine an fasslichen archäologischen Darstellungen und photographischen Hilfsmitteln arme Zeit außerordentlich viel. Mag Christian Daniel Rauchs rühmendes Urteil, da es zu Stahr selbst gesprochen wurde, in diesem Falle nicht für voll genommen werden — es ist schon, trotz Wilhelm Lübkes scharfem Tadel, etwas, wenn Varnhagen an Karl Rosenkranz schreibt: «Ich halte das Buch in hohem Wert und danke ihm viele gute Stunden; es ist mit Kenntnis und Begeisterung abgefasst und bringt die ganze Kunstwelt der Alten zur erfreuenden Anschauung. Über einzelne Ansichten und Urteile mag man streiten, wie das von jeher geschieht, in diesem Fach von den Zunftgenossen bis zur trockensten Langeweile. Aber das Ganze ist ein erfreuliches Buch, ein Buch, wie wir noch keines haben, und Frankreich und England auch nicht.» Und noch elf Jahre nach Stahrs Tode bestätigte Varnhagens Großneffe, der feine Kenner Walter Robert-Tornow, Stahrs Lessing-Biographie die lebendige Fortwirkung über ein Vierteljahrhundert hinaus, während Friedrich Theodor Vischer trotz unumwundenen kritischen Einwendungen die «wohlbedachte Ansammlung, Schwellung, Steigerung» des vollendeten Bildes, die wachsende Vertiefung rückhaltlos zu rühmen wusste.
Als Adolf Stahr dieses sein Lieblingsbuch schuf und erscheinen ließ, waren Fanny und er seit Jahren endlich zu dauernder Lebensgemeinschaft verbunden. Nach langen, zermürbenden Kämpfen war unter freundschaftlich förderndem Beistand des Großherzogs Carl Alexander von Sachsen nach der Trennung von Stahrs erster Ehe im Jahre 1855 zu Berlin die Verbindung des Fünfzigjährigen mit der Vierundvierzigjährigen vollzogen worden. Nichts ehrt dieses nach innerm Sturm und äußerm Streite fest in sich gefügte Eheglück mehr als der Brief, darin Marie Stahr, Adolfs erste Gattin, der zweiten dafür dankt, was diese zu des ältesten Sohnes Alwin Erziehung und Bildung beitrage.
Einundzwanzig gemeinsame Jahre waren Adolf und Fanny Stahr vergönnt. Auf dieses Höhenweges Mitten rundeten sich Aufzeichnungen und Erinnerungen jener Tage am Tiber zu diesem Buche. Am dritten Oktober 1876 war Adolf Stahr in Wiesbaden gestorben; am zweiundzwanzigsten, seinem Geburtstage, schrieb die Witwe eine letzte Zeile und den Namen Fanny Lewald-Stahr unter diese Blätter.
Alles geben die Götter, die unendlichen, ihren Lieblingen ganz: Alle Freuden, die unendlichen, alle Schmerzen, die unendlichen, ganz.
Aber auf dass nicht dem Leide das letzte Wort bliebe, setzte Fanny Lewald-Stahr noch einmal dazu:
Alles geben die Götter ihren Lieblingen ganz!
Dass diese Tagebücher erst nach dem siegreichen Abschluss langer, Wunden schlagender Kämpfe zusammengefügt wurden, dass die alternde Hand der Schreiberin unter die wahrheitsgetreue Darstellung der Vergangenheit die Rune spät und reich erfüllten, dankbar getragenen Glückes zeichnen durfte, gibt diesen Blättern einer Geschichte gewordenen Leidenschaft den letzten Reiz.
Heinrich Spiero
1
Der Herbst des Jahres 1845 war außerordentlich schön und warm, und ich genoss ihn in dem fremden Lande, in der mir neuen südlichen Natur mit täglich neuer Freude. Noch heute, nachdem volle zwanzig Jahre seit jenem meinem ersten Eintritt in Italien hingegangen sind, kann ich mir die Eindrücke, welche ich damals empfangen habe, mit einer solchen Deutlichkeit in das Gedächtnis zurückrufen, dass ich all die Lust und Wonne in der Tat noch einmal zu erleben meine.
Jeder Morgen brachte mir neue Freude, an jedem Abend legte ich mich mit dem Gefühl zur Ruhe, dass ich glücklich sei. Wenn dann auch dazwischen immer wieder Stunden kamen, in denen die Erinnerung, wie ich doch mit aller meiner Liebe keine Gegenliebe gefunden hätte und wie ich verschmäht worden sei, mich traurig machen wollte, so scheuchte das strahlende Sonnenlicht, das mich umfunkelte, die trüben Schatten bald wieder von meiner Seele fort, und die reiche und frohe Lebensfülle, die mich in dieser üppigen Natur umgab, gewann schnell wieder ihre Herrschaft über mich.
Es war mir, als wären mir Flügel gewachsen; und so unglaublich kam es mir oft vor, dass ich, meiner Eltern Kind, dass ich die Kaufmannstochter aus der Kneiphöfischen Langgasse in Königsberg in Preußen, jetzt aus eigener Machtvollkommenheit so weit, so weit von der Heimat, am Lago maggiore umherging, dass mir im Grunde nun gar nichts mehr wunderbar erschienen sein würde, was mir jetzt noch hätte begegnen können. Ohne dass ich es mir eben aussprach, belebte mich der Gedanke: Wenn das geschehen konnte, kann ja auch noch viel mehr geschehen, und ich hatte das ganze Herz voll Hoffnung, ohne dass ich imstande gewesen wäre, es anzugeben, worauf ich denn so freudig hoffte.
Ich betraf mich zuweilen darauf, dass ich still für mich lachte, wenn mir unsere Königsberger Nachbarschaft, meine Bekannten in der Heimat und meine Jugendgenossen und Schulfreundinnen einfielen, von denen manche mir einst sehr beneidenswert erschienen waren. Nun saßen die alle zu Hause in ihren Stuben an den Fenstern und sahen, wie um elf Uhr die Soldaten zur Wachparade zogen, wie die Studenten durch die Straßen schlenderten und die Kaufleute zur Börse wanderten. Und sie betrachteten einander von einem Hause zu dem andern hinüber und beurteilten einander und kümmerten sich umeinander, wie sie sich einst um mich gekümmert hatten; aber das alles, alles ging mich nun auf der Welt nichts mehr an, und ich konnte tun und machen, was ich wollte, und sie tun und reden lassen, was sie wollten. Denn ich war frei! Ich war in Italien, hatte nach niemand zu fragen, als nach meinem Vater, der mir mein Glück und meine Freude von ganzem Herzen gönnte.
Es war geradezu ein Gefühl von übermütiger Lebenslust. Hätte ich damals meinen Goethe schon so gut im Kopfe gehabt wie jetzt, ich würde meine Empfindung und meine Stimmung am besten in die Worte eingekleidet haben: «Schon bin ich heraus, ich mache mir nichts draus! Ade!» —
Auch fügte sich alles für mich auf das beste, auf das freundlichste. Wir fanden überall angenehme Reisegesellschaft, und es mochten wohl die Heiterkeit und das Glücksgefühl sein, die man mir von dem Gesichte ablesen konnte, welche mir die Neigung der Menschen gewannen, mit denen wir in Berührung kamen.
Goethe lässt im Epilog zum Essex die Königin Elisabeth die Worte sprechen:
Der Mensch erlebt, er sei auch, wer er mag, ein letztes Glück und einen letzten Tag!
Und ganz mit demselben Rechte kann man sagen, dass ein jeder in den verschiedenen Bereichen der Erkenntnis und der Empfindung ein erstes und unvergessliches Glück erlebt. Für mich war, nach einer bestimmten Richtung hin, dieser Eintritt in Italien ein solches erstes, nie zu vergessendes Glück.
Wenn ich zurückdenke an den Morgen, an welchem ich von Baveno aus in kleinem, überschattetem Boote nach der Isola bella hinüberfuhr, kommt es noch heute mit solcher Glücksfülle der Erinnerung über mich, dass es mir die Tränen in die Augen treibt.
Mir war ganz feierlich zumute, als wir, aus dem Kahne aussteigend, uns von einer mir fremden Pflanzenwelt umgeben fanden. Die dunkelgrünen, architektonischen Zypressen, der glänzende, fest emporsteigende Lorbeer, die Oleanderbüsche, deren weidenartige Zweige sich mit ihren roten Blumenbündeln tief herniederneigten und ihren süßen Duft mit dem der blühenden Zitronen und Orangenbäume mischten, die üppigen Gräser und Kräuter und Moose, welche überall den Stein bedeckten, hatten etwas Märchenhaftes für mich; und als wir dann aus dem blendenden Tageslichte in das Schloss geführt wurden, als die weiten, kühlen Säle mit ihren Mosaikfußböden, mit den hochgewölbten Decken sich vor mir auftaten, als ich die Ölgemälde und die Statuen erblickte, mit denen die Borromäer ihren Palast ausgeschmückt haben, da erst verstand ich Goethes sehnsuchtsvolle Frage: Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn? — Da erst erfasste ich sie vollkommen, die Worte: «Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht»; und es ergriffen mich wahrhaft heilige Schauer, als ich es mir in Italien sagen durfte: «und Marmorbilder stehn und sehn mich an!» Es war mir wieder einmal eine Offenbarung zuteil, eine langgehegte Sehnsucht befriedigt worden, und diese Befriedigung erneuerte und steigerte sich mit jedem Tage.
Es ist hier nicht der Ort, eine Reisebeschreibung durch Italien zu geben, oder jene Schilderungen der schönen Halbinsel und ihrer Bewohner zu wiederholen, die ich nach meiner Heimkehr in dem skizzenhaften «Italienischen Bilderbuche» zu geben versuchte. Es kommt in diesen Blättern mir nur darauf an, den Einfluss darzutun, welchen das damals Erlebte auf mein Schicksal und auf meine Entwicklung gehabt hat, und es genügt also, nur in großen Umrissen anzudeuten, auf welchen Wegen ich gegangen, was mir auf denselben fördernd oder hindernd entgegengetreten ist, bis all mein Erleben sich gleichsam in einem Brennpunkte zusammenfasste und abschloss. Nur hie und da, wo ich den Ausdruck in meiner Erinnerung nicht besser zu finden weiß, als ich ihn damals gegeben, werde ich zu jenen meinen Schilderungen zurückgreifen müssen.
Wir hatten schon von der Schweiz aus zwei Dänen, einen jungen, achtzehnjährigen Edelmann und seinen Mentor, welche dieselbe Straße mit uns zogen, in den Posten usw. zu beständigen Reisegefährten gehabt. In Mailand, als ich, meine Begleiterin erwartend, in der Tür von Reichmanns Hotel stand, hörte ich plötzlich deutsche Worte mit dem mir sehr vertrauten Dialekte der russischen Ostseeprovinzen an mein Ohr schlagen, und selbst die Stimme schien mir bekannt zu sein. Ich wendete mich um, und der Staatsrat Ernst von Baer, der berühmte Petersburger Zoologe, stand neben mir. Unsere Überraschung war gegenseitig und angenehm.
Ich hatte Herrn von Baer kennengelernt, als er Professor an der Universität in meiner Vaterstadt gewesen war. Wir hatten uns in jener Zeit an dritten Orten öfters in Gesellschaften gesehen, er war der Lehrer meines jüngeren Bruders gewesen, und die Entfernung, in welcher jeder von uns sich von der Heimat und von seiner Familie befand, machte, dass wir einander wie alte Freunde erschienen.
Herr von Baer, der inzwischen Mitglied der Petersburger Akademie geworden war, hatte eine wissenschaftliche Reise vor, die ihn zunächst nach Genua führte, da er am Mittelländischen Meere Untersuchungen über irgendwelche Seegeschöpfe anzustellen beabsichtigte, und schon am ersten Tage unseres Beisammenseins kamen wir überein, dass wir, solange unsere Straße dieselbe bliebe, auch zusammenzubleiben trachten wollten.
Das war eine gar angenehme Aussicht für mich. Denn wenn ich auch sehr weit davon entfernt war, die Gelehrsamkeit eines Mannes wie Herr von Baer auch nur annähernd ermessen zu können, so war ich doch sehr wohl imstande, seinen liebenswürdigen Charakter und seinen feinen Geist zu würdigen und es dankbar zu genießen, wie bereit er in jedem Augenblicke war, mir aus der Fülle seines Wissens mit höchster Anspruchslosigkeit darzubieten, was ich nur irgend begehren konnte und aufzunehmen fähig schien. Dazu hatte sein schlichtes Wesen oft einen wahrhaft kindlichen Anstrich. Wenn man im Verkehr mit ihm eben noch erstaunt gewesen war über das Große, das er dachte und in sich bewegte, denn Herr von Baer ist kein auf sein Fach sich beschränkender Gelehrter, sondern einer jener Geister, die sich an die Erforschung der höchsten und letzten Fragen des Menschen wagen, so erschien die Harmlosigkeit, mit welcher er sich den Eindrücken des Augenblickes hinzugeben vermochte, doppelt liebenswürdig. Alles unterhielt ihn, alles reizte seine Wissbegier, und da er des Italienischen nur wenig mächtig war, beschäftigten ihn die Anschläge an den Häusern und Straßenecken immer auf das lebhafteste, besonders diejenigen, welche sich oftmals wiederholten. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er eines Mittags nach Hause kommend, sich darüber beklagte, dass es doch in einem fremden Lande ohne die rechte Kenntnis der Sprache sehr unbehaglich sei. «Ich habe mir heute mitten im Gehen auf der Straße ein Diktionär kaufen wollen,» sagte er, «bloß um es herauszubringen, was das verwünschte: da affitarsi bedeutet, das ich an allen Ecken und Enden angeschlagen finde. Wissen Sie denn, was das heißt? — Es hieß einfach: zu vermieten!
Unsere dänischen Reisegefährten trennten sich von uns, als wir Mailand verließen. Sie wollten ihre Straße nach Florenz östlich nehmen, wir beabsichtigten über Genua zu gehen, und es wurde ein Wiedersehen mit ihnen in Florenz verabredet. Wir aber, Herr von Baer und ich mit meiner Begleiterin, setzten, mit einem Vetturin fahrend, über die Certosa, über Pavia, Voghera und Novi in kleinen Tagestouren unsere Reise bis Genua fort, und es war ein wundervoller Anblick, als wir gegen den Abend des dritten Tages, von der Höhe der Seealpen herniederfahrend, plötzlich die funkelnde Bläue des Mittelmeeres, weit leuchtend, gleichsam in üppiger Lebenslust aufatmend, sich vor unserm entzückten und doch geblendeten Auge ausbreiten sahen.
«Und darüber hinzuschweben gleich dem königlichen Tag!» rief es in mir mit den Worten Fiescos; und wieder einmal, wie bei dem ersten Besuche der Isola bella, wurde es mir deutlich, welch einen Besitz unsere Dichter und Denker uns mit dem von ihnen geschaffenen fertigen Ausdruck für die Gegenstände, welche stark auf unsere Empfindung wirken, und für diese Empfindung selbst, erschaffen haben. Wie viel Hunderttausende von Deutschen auch nach den Tagen Schillers und nach dem ersten Erscheinen seines Fiesco, von den Höhen, welche Genua beherrschen, zu der Stadt und zu dem Meere herniedergeschaut haben mögen, sie werden, sofern sie überhaupt das Werk des Dichters kannten, das stolze Genua in dem Lichte gesehen und es mit den Worten des Dichters begrüßt haben, dessen leibliches Auge diese Herrlichkeit nie geschaut hat, und der sie doch mit der erratenden Kraft des Genius so unvergleichlich zutreffend geschildert.
Der Palast Doria, der Palast der Fieschi, die Dorsena, das Thomastor, das alles war mir nur eine Versinnlichung dessen, was seit meiner frühen Kindheit in mir lebendig geworden war, und wenn die Menge des Neuen und Ungeahnten mich bisweilen fast zu überwältigen drohte, so brauchte ich mich mit meinen Gedanken nur in die Dichtung Schillers zu vertiefen, um mich in der mir fremden Welt und Natur und dem fremden Volke wie in einer altvertrauten Heimat schnell wieder zu sammeln und zurechtzufinden.
Wir hatten unsere Wohnung in dem auf das Meer hinaussehenden Gasthof zu den vier Nationen genommen. Als wir am ersten Mittage nach unserer Ankunft zu der allgemeinen Speisetafel kamen, hatte sich die Gesellschaft schon zum Essen versammelt, denn wir waren, der Wege in der Stadt noch unkundig, etwas später, als wir beabsichtigt, in den Gasthof zurückgekehrt. Während meine Begleiterin und ich, nun unschlüssig um uns schauend, am Eingange des großen Zimmers stehenblieben, bemerkte ich, dass am oberen Ende des Tisches ein paar Männer, zwischen denen eine Dame saß, auf uns aufmerksam geworden waren und einer von ihnen sich erhob, um mir anzudeuten, dass neben ihm noch zwei Plätze offen wären. Der Oberkellner, der uns inzwischen auch gewahr geworden war, erklärte, dass dies eben unsere Plätze sein sollten, und dass er sie eigens für uns ausgewählt habe, weil der eine der beiden Herren und die Dame ebenfalls Deutsche wären. Sie sprachen mich denn auch beide freundlich an, und da meine Reisebegleiterin mich im Laufe der Unterhaltung mit meinem Familiennamen nannte, sah ich mit Vergnügen, dass ich unsern neuen Tischnachbarn als Schriftstellerin nicht fremd war. Indes, die Genugtuung, welche sie an den Tag legten, als sie meinen Namen erfuhren, musste offenbar eine andere Ursache haben, als die bloße Begegnung mit einem Mädchen, das ein paar Romane geschrieben hatte, sie in ihnen hervorrufen konnte, und der ältere der beiden Männer ließ mich darüber auch nicht lange im Ungewissen.
«Sie haben unserm Freunde,» sagte er, indem er auf seinen Gefährten, einen Franzosen zeigte, «eben einen großen Triumph bereitet. Unser Freund ist nicht nur ein Kunstkenner und Kunstforscher, er ist auch Phrenologe; als er Sie in das Zimmer treten sah und Sie einen Augenblick betrachtet hatte, äußerte er: C'est une femme, qui compose! Je ne sais pas quoi, mais elle est compositeur.»
Ich sah mich denn nun von den Fremden nicht nur gekannt, sondern auch freundlich aufgenommen, und als ich, von dem Rechte der Gegenseitigkeit Gebrauch machend, sie um ihren Namen fragte, erfuhr ich, dass ich den in unserer Kunstliteratur berühmten Geheimrat Karl Schnaase aus Düsseldorf vor mir hatte, der mit seiner Frau und einem Freunde, wie wir, einen Aufenthalt in Genua zu machen und sich dann gleichfalls nach Florenz zu begeben gedachte. Noch an demselben Mittage ward die Bekanntschaft zwischen diesen Personen und dem Staatsrat von Baer vermittelt, und schon am nächsten Tage kamen wir zu einer Einrichtung, welche uns in dem Gasthof der fremden italienischen Stadt zu einer Art von gemeinsamer Häuslichkeit verhalf. Wir entschlossen uns, um miteinander zu sein, samt und sonders eine Treppe höher hinaufzuziehen, wo wir natürlich an frischer Luft und an Weite des Blickes gewannen. Ein großer Saal ward uns als gemeinsames Zimmer überwiesen, und vier Seitenzimmer dienten den verschiedenen Partien zu Schlafstuben. Man frühstückte getrennt, aber wir speisten zusammen und früher, als es in dem Gasthof üblich war, um bei den kürzer werdenden Tagen nicht unnötig lange an der Wirtstafel zu verweilen, und ich wüsste kaum irgendeine Zeit, welche mir auf Reisen heiterer und förderlicher als eben diese geworden wäre.
Morgens in aller Frühe schlenderte ich mit Herrn von Baer auf dem Fischmarkt herum. Er hatte, da die Genuesischen Fischer es gewohnt sind, Naturforscher aller Nationen zu bedienen, schon eine Menge von Bekanntschaften unter ihnen gemacht und hatte seine Freude an ihrem Verständnis und ihrer Anstelligkeit. Dann holten wir die übrige Gesellschaft aus dem Gasthofe ab und fuhren zum Seebad hinaus; und wenn die Septembersonne heiß herniederschien, wanderten wir unter des kunstgelehrten Landsmannes freundlicher Führung durch die kühlen Marmorsäle des Palasts Doria, des königlichen Schlosses, des Palazzo Rosso, oder wir saßen unter den hochgespannten Bogen und Wölbungen der Kirchen, hier wie dort die Meisterwerke der Kunst betrachtend, deren Schönheit der Geheimrat Schnaase uns durch sein Verständnis und seine Erklärungen noch deutlicher fühlbar machte.
Ich verstand damals noch recht wenig von der Kunst. Ich wusste kaum, wie man in Ölfarben malt. Ich kannte freilich die verschiedenen Malerschulen in jenen großen, weiten, unbestimmten Umrissen, mit deren Namen der Laie blindlings um sich wirft, wenn er in Bausch und Bogen von der deutschen, von der niederländischen und von der italienischen Schule spricht. Ich kannte auch die Namen der hervorragendsten Meister und hatte deren Werke in mehr oder weniger guten Stichen frühzeitig gesehen. Wenn ich in Berlin verweilte, war ich öfter ins Museum gegangen, hatte zerstreuten Sinnes und anderweit beschäftigten Herzens die Bilder angeguckt, so dass ich wohl wusste, was auf der Leinwand zu sehen war; auch hatte ich mir gelegentlich von den Malern in der Gesellschaft verschiedene technische Ausdrücke angeeignet, deren ich mich vorkommenden Falles in Rede und Schrift mit jener bedenklichen Selbstgefälligkeit bediente, mit welcher der Ungebildete die Worte einer ihm fremden Sprache zu benutzen liebt. Indes war ich weit davon entfernt, es zu begreifen, welch eine Befriedigung in dem Studium der Kunstgeschichte liegen, welch ein Genuss uns die eingehende und Verständnis erzeugende Betrachtung eines Kunstwerkes gewähren könne.
Jetzt, da nichts mich drückte, da meine Seele frei war, kam es mir, wenn ich so vor den Bildern dasaß, oftmals vor, als hätte ich überhaupt noch gar kein Bild gesehen; als erführe ich es unter dem Lichte dieses Himmels, was Formen und was Farben seien und welche Fülle des Gedankens, der Liebe und der Schönheit uns von einer Leinwand entgegentreten könne. Glück und Freude lassen gute Naturen immer liebenswürdig erscheinen, und ich meine, es muss die Freude gewesen sein, welche ich im Anschauen der Kunstwerke empfand, welche den trefflichen Schnaase so geneigt machte, sich mit mir eingehend zu beschäftigen, während ich ihm doch nichts entgegenbrachte, als ein gutes Auge, einen offenen Sinn und eine mit jedem schwachen Strahle neu gewonnenen Verständnisses wachsende Begeisterung für das Schöne und für die Kunst.
Die Tage in Genua gingen bald vorüber und unsere Gesellschaft musste sich, sehr gegen ihre Wünsche, trennen. Geheimrat Schnaase mit seinen Gefährten wollte sich nach Siena begeben, Herr von Baer die russische Großfürstin Helene erwarten, deren Geistes- und Herzensvorzüge er höchlich rühmte und die ihm ihre bevorstehende Ankunft verkündet hatte. Wir aber wollten die Riviera di Levante kennenlernen und die Steinbrüche von Carrara sehen, und nachdem wir verabredet hatten, mit Schnaase in Florenz wieder zusammenzutreffen, trennten wir uns mit Bedauern von Herrn von Baer und zogen mit der sardinischen Kurierpost unsere Straße weiter.
2
In Florenz trafen wir denn mit unseren Genossen aus Genua abermals zusammen, auch die beiden Dänen, welche an den Seen und in Mailand viel mit uns gewesen waren, gesellten sich aufs Neue zu uns, und der Jüngere von ihnen schloss sich mit einer Wärme an mich an, die mir seit der ersten Stunde unseres Begegnens auffallend gewesen war.
Er war ein hoch aufgeschossener, etwa achtzehnjähriger Jüngling, blond, blauäugig, fast immer träumerisch zerstreut, ohne irgendeine Teilnahme für irgend etwas, ohne irgendwelche gründliche Kenntnisse, ja weit weniger unterrichtet, als junge Männer seines Alters und Standes — er gehörte einer alten Adelsfamilie an und war, da seine Eltern nicht mehr lebten, Besitzer eines reichen Majorates — es sonst zu sein pflegen. Niemand konnte daher schlechter für die großen Reisen vorbereitet sein, die man ihn unter dem Schutze eines älteren Kavaliers machen ließ, und niemand konnte weniger wirkliche Befriedigung oder wirklichen Genuss davon haben als eben er. Er wusste oft gar nicht, was er eigentlich sah. Ihm fehlte oft jeder Zusammenhang mit den historischen Monumenten und mit den Kunstwerken, an denen man ihn vorüberführte; und dabei hatte er doch Verstand genug, es zu empfinden, dass er nicht an seinem Platze sei, dass ihm etwas fehle, und Empfindung genug, sich darüber unglücklich zu fühlen. Weil er entschieden stolz und nicht ohne Eitelkeit war, merkte er es sofort, wenn seine Unbildung die andern lächeln oder erstaunen machte und zog sich dann so scheu und finster in sich selbst zurück, dass er Mitleid erregen musste. Dabei hatte er, soweit seine Einsicht reichte, die unbeirrte Gradheit und Einfachheit der Kinder, und mit dem Instinkt eines Kindes hatte er sich von Anfang an mir zugewendet, weil er merkte, dass ich ihn nicht belächelte, sondern dass er mich dauerte, und dass ich ihn nahm und gelten ließ, so wie er eben war.
Dies ganz instinktive Vertrauen, das er in mich setzte, rührte mich, abgesehen davon, dass die Erscheinung dieses Jünglinges mir ein anziehendes Seelenrätsel war und dass es mich freute, jemand neben mir zu haben, dem ich fortwährend helfen konnte, ohne dass ich Mühe davon hatte. Da ich sechzehn Jahre älter war als er, kam ich ihm ganz alt vor, und ich hatte es sehr bald zu bemerken, wie er völlig ohne Zutrauen zu seinem Mentor herging und wie man diesem an sich ausgezeichneten Manne mit der Führung eines so knabenhaften Zöglings eine Aufgabe gestellt hatte, die ihm unglaublich wenig zupassend sein musste, denn der junge Baron war für die leitende Hand eines feinen, an sich und seine Interessen denkenden Weltmannes noch in keiner Weise reif. Der Kammerherr wäre der Mann gewesen, einem gut gebildeten und erzogenen jungen Menschen die letzte Politur und den Schliff für die Welt zu geben; aber er war völlig ungeeignet, in dem ihm anvertrauten Jünglinge sozusagen die ersten Begriffe von dem Leben unter den Menschen und in der Welt hervorzurufen und zu entwickeln.
Julian bedurfte damals noch, wie ein Kind, ganz entschieden der nachgiebig eingehenden Geduld einer Frau, die in jedem Augenblick zu erraten versteht, was in der Seele eines solchen werdenden Menschen vorgeht, und die erfinderisch genug ist, ihm die Dinge und Gegenstände so zurechtzulegen, wie sie dieselben von ihm aufgefasst und ergriffen zu sehen wünscht. Wo der Mentor Julians nur ein verächtliches Achselzucken für ihn hatte, konnte ich in der Regel dem Gedankengange nachkommen, auf welchem der Jüngling zu der Äußerung gelangt war, deren Absonderlichkeit, wenn man sie aus dem Zusammenhange herausnahm oder sie mit den üblichen Ansichten und Aussprüchen verglich, wirklich oft geradezu unbegreiflich erscheinen mussten, während ich doch zu bemerken glaubte, dass gerade solchen Äußerungen bei ihm oft etwas ganz richtig Gefühltes zugrunde lag. Ich hatte eben von meiner frühen Jugend an mit Kindern, mit Werdenden verkehrt, und obschon mir, wie ich es seinerzeit meinen Geschwistern gegenüber mit Bedauern wahrgenommen, die Gabe, in bestimmten Gegenständen zusammenhängend zu unterrichten, durchaus fehlte, besaß ich dagegen ebenso viel Neigung als Geschick, entwickelnd und erziehend auf Kinder und auf jüngere Personen einzuwirken. Im ersten Falle machte meine eigene schnelle Fassungsgabe mich leicht ungerecht gegen diejenigen, die nicht , wie ich es wünschte, dem Unterrichte folgen konnten; in dem letzten Falle aber war meine Geduld nicht zu ermüden, was dann später, als mir die Erziehung meiner Stiefkinder zur Pflicht ward, mir und ihnen gelegentlich wohl zustatten gekommen ist.
Ich hatte also wirklich eine Freude, als es an einem der ersten Morgen, die wir in Florenz, nachdem wir den Gasthof verlassen hatten, in unserer Wohnung zubrachten, an meine Tür klopfte und Julian hereintrat.
«Ich habe alle Tage im Fremdenanzeiger nachgesehen, meine liebe Lewald (so nannte er mich wunderlich genug von Anfang an), ob Sie noch nicht angekommen wären!» sagte er, und es verstand sich für ihn nun ganz von selbst, dass er, da ich nun angekommen war, mir wie mein Schatten folgte, wenn ich ihn nicht eben fortgehen hieß. Manchmal, wenn er mich in den Galerien mit seinen kindischen Fragen störte, musste ich über mich selber lachen, denn ich kam mir dann bisweilen wie die Prinzessin in Immermanns reizendem Märchen, im Tulifäntchen, vor, die den jungen Riesen zu bilden unternimmt, ohne damit sonderliche Ehre einzulegen; und die sich täglich wiederholende Bemerkung meiner Begleiterin, dass der junge Fremde doch gar zu einfältig sei, war auch nicht sehr ermutigend. Ich brauchte dann aber auch nur zu sehen, mit welcher Zuversicht er sich an mich wendete, wie zufrieden er war, wenn er mir in einer Stunde des Ausruhens von seiner Heimat, von seinen Gütern, von seinen Vettern erzählen durfte, die er nicht liebte, und von seiner Kusine Stina, die er sehr liebte und zu heiraten dachte, wenn er majorenn sein würde und sie ihn haben wollte, um ihm auf seine allabendliche Frage, ob er morgen wiederkommen dürfe, so lange bejahend zu antworten, bis sein Wiederkommen sich ganz von selbst verstand und bis es mir gleichfalls fast zur Gewohnheit geworden war, ihn, wie ein Kind, immer neben mir zu sehen und zu haben.
Ich hatte dabei gar kein Verdienst, sondern vielmehr eine Art von unverdienter Genugtuung. Wie heiter ich gerade damals auch war, blutete doch die alte Wunde in meinem Herzen noch fort, und mit allen den Erfolgen, die ich seitdem errungen hatte, bei all dem herzlichen Wohlwollen, welches mir eben jetzt von all unsern Reisebekannten entgegengebracht worden war, wurde ich doch das Gefühl nicht los, dass ich eigentlich zu keines Menschen Glück unentbehrlich sei, und mich verlangte nach dieser Unentbehrlichkeit.
Manchmal nannte ich dies eine Torheit, aber ich konnte mich mit einer solchen Beschwichtigung nicht über ein ganz berechtigtes Empfinden fortheben. Es liegt in der Frauennatur, die auf Hingebung angelegt ist, das unabweisliche Verlangen nach dem Besitze eines Menschen, dem man ein Höchstes ist, dem man alles gewähren kann, was er bedarf, und der dabei doch unser eigen ist; und ich habe nie ein Mädchen gekannt, das nicht, wenn es der Hoffnung auf Liebesglück und Ehe, wie ich in jenen Tagen, zu entsagen begonnen hat, einen oft unbewussten Trost und einen, wenn auch nur vorübergehenden Anhalt in der Zuneigung jüngerer Personen, einer Schwestertochter, eines Neffen, oder auch eines ihr zufällig in den Weg gekommenen jungen Menschen zu finden getrachtet hätte.
Wie aber Bildung immer duldsam macht, so hatte niemand mehr Geduld und Freundlichkeit für den armen jungen Dänen, als Geheimrat Schnaase. Weil er selbst eine dichterisch angelegte Natur und viel mit schöpferischen Geistern, namentlich im engsten Verkehr mit Immermann gelebt hatte, begriff er auch vollkommen, welch eine Anziehungskraft eine Gestalt wie Julian für einen jeden haben musste, der in einem Menschen mehr als nur seine äußere Erscheinung zu sehen vermochte, und Julian würde es denn auch nicht müde, zu versichern, dass er die Deutschen liebe und dass er gern in Deutschland leben möchte, wenn alle Deutschen so gut wären wie der Geheimrat und ich.
Florenz brachte im ersten Augenblick einen sehr ernsten, fast finsteren Eindruck auf mich hervor. Der stolze Palazzo vecchio, dem sein kühn emporstrebender Turm so verwegen zu Gesicht steht, wie einem vierschrötigen Kämpen der mächtige Helmbusch an seinem Hute, hatte in seiner Gewaltigkeit etwas Überwältigendes für mich. Der Palazzo Strozzi, der sich finster drohend mitten in den Straßen der Stadt wie eine Burg auftürmt, erschreckte mich. Or San Michele, mit seiner geheimnisvollen Fassade, das Barghello — das war alles so befremdend; und wenn durch die enge Straße, in welcher das Geburtshaus des unsterblichen Dichters, des Dante Alighieri gelegen ist, zufällig einmal verhüllten Angesichts und in ihre Kapuzenmäntel gehüllt eine jener Brüderschaften vorüberzog, die, während der Kämpfe der Welfen und Waiblinger gestiftet, heute noch bestehen und heute noch das gleiche Werk barmherziger, parteiloser Bruderliebe üben, zu welchem sie sich dazumal verbunden, so fragte ich mich anfangs immer mit Erstaunen: Wie kommst du denn hierher?
Das Mittelalter in seiner gewalttätigen Größe war mir nie zuvor so lebendig geworden als hier, wo die alten Paläste einander noch bis auf diese Stunde wie Festungen inmitten des Stadtbezirkes zu trotzen schienen. Aber je öfter ich an ihnen vorübergegangen war, um so häufiger hatte ich mein Auge von ihnen ab- und zu dem fröhlichen Leben hinübergewendet, das sich in dem Corso degli Adhimari, das sich auf der Piazza Granducale, auf der Brücke der Goldschmiede, am Dome und an den Ufern des Arno überall bewegte, bis das ganze Florenz mit seinen mittelalterlichen Bauten, mit seinem erhabenen Dome und dem schönen schlanken Campanile, mit seinen Blumenverkäuferinnen und seinen unzähligen Sträußen von blühenden Blumen mir nur noch wie ein einziges mittelalterliches Bauwerk erschien, um dessen wohlerhaltene Mauern frisches Gras seine belebenden und verschönernden Kränze windet.
Die Stunden gingen mir wie im Fluge hin. Ich hatte die Freude gehabt, in Florenz einen Bekannten wiederzufinden, den als Schriftsteller bekannten Doktor Tomaso Gar, mit dem ich ein paar Jahre vorher, als er einen Aufenthalt in Berlin gemacht, häufig in Gesellschaft zusammen gewesen war; und Empfehlungen meiner Berliner Freunde Ehlert hatten mich in den gastlichen Kreis der Familie Sabatier eingeführt.
Franz Sabatier, ein im südlichen Frankreich heimischer und dort reich begüterter Franzose, hatte sich früh mit deutscher Literatur und Musik beschäftigt, war viel in Deutschland umhergereist und hatte auf einer dieser Reisen die damals in voller Blüte ihrer Kraft stehende Sängerin Caroline Ungher gesehen, gehört und nach längerer Werbung geheiratet; denn da Caroline bedeutend älter als der junge Franzose war, hatte sie ein immerhin gerechtes Bedenken getragen, seinen Wünschen und ihrer Neigung nachzugeben.
Als ich Sabatier und Caroline kennenlernte, hatte ihre Ehe schon mehrere Jahre bestanden. Caroline mochte vierzig Jahre alt sein, sah aber jünger aus, und die Altersverschiedenheit der Gatten fiel nicht störend auf, da die große Lebhaftigkeit, mit welcher beide an allem Geistigen teilnahmen, zu einem ausgleichenden Elemente zwischen ihnen wurde.
Ich fand sie nicht in der Stadt, sondern in einer Carolinen gehörenden Villa, die, wenn ich mich recht entsinne, auf der Straße nach Fiesole gelegen war. Man kam mir freundlich und wie einer alten Bekannten entgegen.
«Das ist ein gar Schönes an der Kunst,» sagte Caroline, «dass sie zu einer Art Freimaurerei zwischen denen führt, die sie üben und lieben. Man hat, wenn man einen Künstler kennenlernt, gar nicht nötig, nach dem Woher und Wohin zu fragen, mit dem man sich in dem Leben andrer Leute erst zurechtfinden muss, um zu wissen, was man an ihnen etwa besitzen wird, und wir wissen doch wenigstens ungefähr, was jeder im wesentlichen will; da kann man gleich miteinander ruhig darauflos verkehren und das Gelegentliche der Enthüllung dem Zufall überlassen.»
Ich musste von unseren zahlreichen gemeinsamen Bekannten in Berlin erzählen, sie sprach von einer großen Reise nach Griechenland und dem Orient, die sie in Begleitung ihres Mannes und eines ihm befreundeten Malers unternommen hatte, sprach mit Vorliebe von ihrer früheren ruhm- und erfolgreichen Künstlerlaufbahn und mit noch weit mehr Liebe von ihrem Gatten; und wie sie denn immer seines Lobes voll war, sagte sie einmal zu mir: Seine große Natur und seine Bedeutung waren es auch, die mich endlich zu der Ehe mit ihm bestimmten und diese den Jahren nach so ungleiche Verbindung erklärlich machen oder entschuldigen — wie man es nehmen will! —
Es lag ein fester, selbstgewisser Freimut in ihrem ganzen Behaben, und doch war alles, was sie tat und sprach und wie sie es tat und sprach, durchaus formvoll und weiblich. Unwillkürlich musste ich an die Schröder-Devrient denken, obgleich Caroline mit der Devrient nicht zu vergleichen war; aber sie hatte wie diese einen großen Stil in der Haltung und im Ausdruck und eine herzgewinnende einfache Güte. Ich möchte nicht sagen: Sie musste gefallen, sondern sie war gefällig, d.h. für alle diejenigen zum Gefallen geschaffen, welche für diese in sich selbst bestimmte Weise des Verständnisses nicht entbehrten.
Mir, die ich nun schon seit Wochen und Wochen wie in einem Feenreiche ein fremdes und erhöhtes Dasein lebte, waren auch diese Besuche in Villa Concepcione, denn ich kehrte noch ein paarmal dahin zurück, nachdem ich einmal dort gewesen war, wie neue Blicke in die lang geahnte und ersehnte Welt. Das schöne Haus mit seinen weiten kühlen, durch Vorhänge beschatteten Gemächern, aus denen man auf die breiten Terrassen des blumenreichen, in Wohlgeruch schwimmenden Gartens hinaustrat; die Aussicht , die man von dieser milden Höhe auf das schöne Tal genoss, erschienen mir des Nachts noch in meinen heiteren Träumen. Ich wurde nicht müde, mir die inhaltsreichen Gespräche zu durchdenken, die Franz Sabatier, dessen Sinn beständig auf Großes und Bedeutendes gerichtet war, eben dadurch unwillkürlich anregte. Von den Theorien Fouriers war viel die Rede, die damals Sabatiers große Teilnahme erregten; viel wurde auch von Malerei und Skulptur in ihrer Anwendung bei der Architektur gesprochen, denn meine neuen Bekannten ließen eben in jener Zeit ein palastartiges Haus in Florenz erbauen, in dessen einem Saale Szenen aus den klassischen deutschen Dramen und Opern gemalt und an dessen Marmorkaminen in den Kindergestalten, welche die Brüstungen stützten, Fouriers Gedanken über die Geschlechter ausgedrückt werden sollten. Dazwischen hatte man Musik gemacht; Frau Caroline hatte selbstkomponierte Lieder gesungen, und das alles war vorgegangen in einem Lichte und in einer Luft und unter einem Himmel, dessen sanfte Herrlichkeit für mich noch immer etwas Berauschendes hatte.
Wenn ein junger Baum Bewusstsein hätte, der lange in einem dürftigen, ihn zurückhaltenden Erdreich gestanden und urplötzlich in den ihm zusagenden Boden verpflanzt wurde, so müsste ihm so zumute sein, wie mir in jenen Tagen. Ich fühlte mich förmlich wachsen. Ich empfand es, wie ich in jeder Stunde Neues, Schönes in mich aufnahm, wie es mir zu eigen ward, wie meine Seele sich aufschloss, sich erweiterte und befreite.
Ich stand vor der Madonna della Sedia, vor den Tizianschen Venusgestalten; ich sah den Sichelschleifer, die Niobiden, ich ging in der Loggia dei Lanzi umher; die schattigen Gänge des Giardino Boboli, die breiten Wege der Cascinen eröffneten sich mir. Ich hielt die lieblichen Sträuße von weißen Tuberosen, in deren Mitte die feuerroten Nelken brannten und die rings von den feinen Zweigen der Zitronenmelisse umgeben waren, alltäglich in meinen Händen, und ich genoss das alles in Gesellschaft von Menschen, deren feiner Sinn mich belehrte, und die mich liebgewonnen hatten, um meiner selbst willen. Ich war sehr glücklich.
Manchmal, wenn ich noch im Dämmerlichte durch die Straßen ging, kam mir all diese Wirklichkeit ganz plötzlich wie ein Traum vor; und von dem geheimnisvollen Zauber des abendlichen Glockengeläutes umfangen, pflegte ich dann, den Gläubigen folgend, bisweilen in die Hallen der Kirchen einzutreten.
Die Stille, der Duft des Weihrauchs, das Dunkel selbst taten mir wohl und hatten für meine große Aufregung etwas Beschwichtigendes. Halbestundenlang konnte ich dort sitzen ohne einen bestimmten Gedanken, in einem Hinträumen, wie ich es nie zuvor gekannt hatte; aber neben der Ruhe, welche ich dort fand, lernte ich es auch erkennen, was die alltäglich geöffnete Kirche, was ein paar Minuten Einsamkeit dem Menschen unter gegebenen Verhältnissen zu sein vermögen, und ich beklagte dann von Herzen, dass in unserm protestantischen Norden dem Gläubigen diese Möglichkeit der Sammlung, diese unmittelbare Befriedigung eines religiösen Gemütsbedürfnisses nicht gewährt werden. Kaum ein solcher Abend verging mir in den Kirchen, ohne dass ich Frauen und Männer einsam eintreten, vor einem der entlegenen Altäre niederknien und kaum erkenntlich bei dem matten Scheine der silbernen Lampe in stillem Beten ihre Tränen weinen und trocknen sah. Ich wurde jedesmal davon ergriffen und erschüttert, und nicht mich allein rührte dieses stille Beten.
Eines Abends kamen wir in größerer Gesellschaft von der Höhe zurück, auf welcher die schöne Kirche von San Miniato steht, und da die Sonne schon zeitiger sank, denn wir waren bereits über die Tag- und Nachtgleiche hinaus, hatte der Abend uns überrascht, und wir hatten uns in der Straße getrennt, um noch einmal in unsere verschiedenen Wohnungen zurückzukehren und dann im teatro Cocomero wieder zusammenzutreffen. Ich hatte, um nicht in den Dämmerlichte allein zu gehen, Julian bei mir behalten und teils aus Neigung, teils weil ich ihm sein blindes und eben deshalb fanatisches Vorurteil gegen den Katholizismus abgewöhnen wollte, das er, ohne ein Bewusstsein davon zu haben, zeitig eingesogen, trat ich in eine der Kirchen ein. Er folgte mir offenbar mit Widerstreben, ja, er sagte endlich, er finde es heidnisch und abscheulich, im Finstern zu beten und sich bei Nachtzeit, wie ein Dieb, in eine Kirche einzuschleichen.
Das waren Aussprüche, wie ich sie von ihm gewohnt war. Ich achtete aber nicht darauf, sondern ging in die Kirche hinein, es ihm überlassend, ob er mir folgen wolle oder nicht. Weil ich nicht lange verweilen konnte, blieb ich, an einem der Beichtstühle gelehnt, nicht allzufern vom Eingang stehen. Julian stand neben mir. Fernab brannte die ewige Lampe am Altare, langsam ging ein Geistlicher an uns vorüber, es war ganz still in der Kirche, die starken Ledervorhänge vor den Türen hielten den Lärm des Straßengewühles und des alltäglichen Lebens von diesem, der Sammlung geweihten, geheiligten Raume fern. Hie und da lag ein Betender vor einem der Altäre oder kniete, in sich und sein persönliches Leid versunken, auf nichts sonst achtend, mitten in dem Schiff der Kirche. Mit einem Male schlug Julian die Hände vor sein Gesicht und ging hinaus. Ich sah, dass er weinte. Als ich dann nach einer Weile ebenfalls die Kirche verließ und wir uns schon wieder auf der Straße befanden, sagte er plötzlich gepresst und hastig: Ich konnte nicht bleiben! Es kam über mich, ich weiß nicht wie! Ich hätte mich auf die Knie geworfen, wenn ich geblieben wäre!
An diesen Abend und an dieses Erlebnis habe ich sehr oft zurückgedacht, wenn ich später in der Heimat an unseren verschlossenen protestantischen Kirchen vorübergegangen bin, die sich nur an Sonntagen mit einer gewissen kalten Feierlichkeit, die sich nur bei jenen Ereignissen des Lebens für den Menschen öffnen, auf welche der Staat und die protestantische Kirche ihr Siegel gedrückt haben. Freilich steht geschrieben: «Wenn du beten willst, so gehe in dein Kämmerlein!» Aber es ist ein eigen Ding um das Kämmerlein des Armen, des Notleidenden, in dem kein stiller Winkel für ihn frei ist, in dem ihn aus jeder Ecke das Elend anstiert, aus dem er Rettung ersehnt. Und selbst aus dem Hause des Reichen und aus dem säulengetragenen Palast kann man sich hinaussehnen in eine feierliche Stille, um ungesehn und ungestört die Tränen eines schwer beladenen Herzens auszuweinen.
In seiner Herzensangst zu jeder Stunde vor dem Altar Gottes, dem man Allmacht und die höchste Vaterliebe zutraut, niederknien und zu ihm in verschwiegener Einsamkeit um Hilfe flehen zu können; von dem Sterbebette eines Geliebtesten hinzufliehen in das Gotteshaus und im Aufschrei der Herzzerrissenheit sich zu den Füßen eines Alliebenden hinzuwerfen, das muss für gewisse Naturen eine unsagbare Erquickung sein. Mit seinen Leiden, mit seiner Verzweiflung vom Sonntag bis zum nächsten Sonntag ganz allein zu sein, sich dann feierlich zu kleiden und in der Gemeinschaft mit einigen Hunderten anderen gleichgültigen Menschen eine oft nüchterne Predigt anzuhören, während man in sich zerschlagen und der Erhebung bedürftig am Boden liegt, darin kann unter solchen Verhältnissen kein Mensch eine Befriedigung finden. Der sonntägliche protestantische Gottesdienst ist eine Art von Staatsaktion, und die während der ganzen Woche verschlossene, kahle und schmucklose protestantische Kirche ist nicht der Zufluchtsort, dessen der Mensch benötigt ist, der sich mühselig und beladen fühlt.
Ich weiß sehr wohl, welche Entstellungen die katholische Hierarchie in das Christentum hineingebracht hat, das ursprünglich wirklich eine Erlösung der Menschheit durch die Liebe war, und ich weiß auch, dass jene Hierarchie vor keinem Mittel zurückschreckt, um ihre bewundernswert organisierte Herrschaft durch die Jahrhunderte aufrechtzuerhalten; aber ebenso wenig kann ich mich der Überzeugung verschließen, dass in dem katholischen Kultus auch heute noch erhabene Elemente vorhanden sind, welche dem Bedürfnis der Leidenden und der Gedrückten weit entsprechender entgegenkommen, als — nach meiner Erfahrung — der Protestantismus es zu tun vermag. Dass er dem Gemüte, dass er den Sinnen etwas zu bieten hat, das ist schon ein Vorzug; und auch in der Weise, in welcher er dies tut, beweist er mehr Geschick als der Protestantismus. Es ist, wie mich dünkt, nicht viel damit getan, wenn man sich zu überreden trachtet, dass die Wissenschaft die Religion verdränge, das Wissen allmählich den Glauben unmöglich und somit durch Erkenntnis die Menschen in sich ruhig, zueinander liebevoll, die Welt sozusagen zu einer Art von Paradies und ihre Bewohner — um den alten Ausdruck zu gebrauchen – selig machen werde. Man muss den Menschen als Einzelwesen und das Leben in seiner Gesamtheit wenig kennen, um sich in solchen Hoffnungen zu ergehen.
Es wird unter den Menschen immer Organisationen geben, deren Vorstellungskraft für das Erfassen von abstrakten Gedanken nicht ausreichend ist, sondern die es nötig haben, sich die Gedanken zu verkörpern, damit sie ihnen erfassbar werden, und diese Art von Menschen wird immer einer positiven Religion, immer bestimmter Kultusformen bedürfen, unter welchen diejenigen den Vorzug verdienen werden, welche dem Herzensbedürfnis, dem Gemütsleben und den sinnlichen Anschauungen jener Naturen entgegenkommen, welche sich Trost und Anhalt innerhalb einer solchen Religion und Religionsgemeinschaft zu suchen nötig finden.
Ich für mein Teil bekenne, dass ich dieses Bedürfnis nicht fühle. Ich habe mich frühzeitig dahin beschieden, nichts zu sein als ein verschwindendes Atom in dem rätselvollen All, das wir die Welt nennen, und mit der uns möglichen bedingten Freiheit, innerhalb ihrer geheimnisvollen und undurchbrechbaren Gesetze, unter ihren folgerechten Notwendigkeiten mit zu schaffen, mit zu wirken, mit zu leiden. Aber ich finde, dass man dazu einer großen Resignation bedarf, und ich vermag es vollständig nachzufühlen, dass diese Resignation nicht jedes Menschen Sache ist, dass es Menschen gibt, welche den Gedanken an eine so entgottete Welt nicht zu ertragen vermögen.
Ich habe hochentwickelte Gemütsmenschen gekannt und verehrt, welche sich weder der Entsagung noch der Verantwortlichkeit fähig fühlten, die uns auferlegt werden, wenn wir nicht mehr an eine göttliche Vorsehung glauben; und ich bin im Gegensatze dazu Personen von sehr hervorragender Kraft begegnet, deren Phantasie es nicht genügte, nur ein wieder verschwindender, unendlich kleiner Bruchteil in dem ewigen Ganzen zu sein, sondern die über ihr Erdendasein hinaus noch fortzubestehen und eine selbstständige Dauer zu bewahren verlangen. Jene Schwachen und jene in ihrem Kraftgefühl und ihrer Stärke doch ungenügsamen Geister würden sich bald eine neue positive Religion erschaffen müssen, welche ihren Anforderungen entspräche, ihnen ihre Verlangnisse gewährleistete, wenn irgendwelche Ereignisse die Kenntnis von den vorhandenen positiven Religionen in der Welt zerstörten.
Wer aber einmal eine solche Ansicht von der Notwendigkeit positiver Religionen gewonnen hat, wird es, wie ich glaube, schwer in Abrede stellen können, dass der Katholizismus, der in seinen Kultus so viel von den verschiedenen Kulturen aufgenommen hat, die vor ihm bestanden und vor ihm sich wirksam erwiesen haben, dem menschlichen Bedürfnis nach einem sichtbaren Anhalt während des Erdenlebens freundlicher zu Hilfe kommt, als der Protestantismus es tun kann.