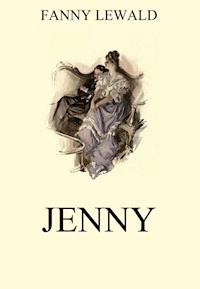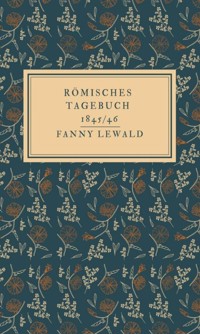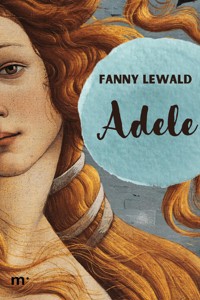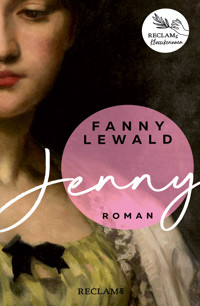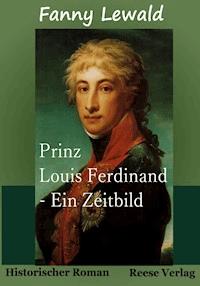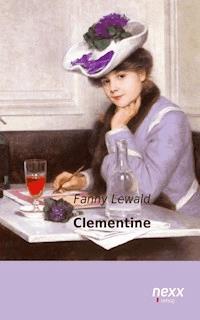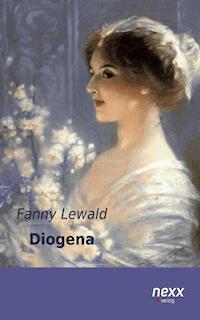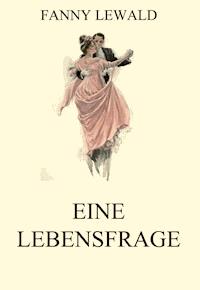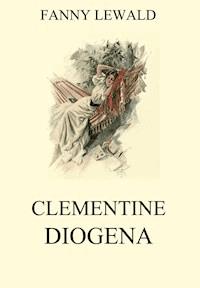0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NEXX
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Jenny" gilt als einer der bedeutendsten „Frauenromane“ des 19. Jahrhunderts in deutscher Sprache. Das Werk ist sowohl für die Frauen- als auch die Juden-Emanzipation in Europa bedeutend gewesen, da hier zum ersten Mal eine Frau offen soziale und politische Umwälzungen forderte. Zu Anfang des Romans, liebt Jenny Reinhardt, einen Theologen, der extrem orthodoxe Ansichten vertritt. Die Beziehung scheitert an Jennys eigenen religiösen Überzeugungen. Doch dann trifft sie den verständnisvollen und liberalen Grafen Walter ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Fanny Lewald
Jenny
Impressum
Cover: Gemälde "Porträt einer Dame" von Philip Alexius de Laszlo
Covergestaltung: nexx verlag gmbh, 2015
ISBN/EAN: 9783958705609
Rechtschreibung und Schreibweise des Originaltextes wurden behutsam angepasst.
www.nexx-verlag.de
1.
Bei Gerhard, dem ersten Restaurant einer großen deutschen Handelsstadt, hatte sich im Spätherbst des Jahres 1832 nach dem Theater eine Gesellschaft von jungen Leuten in einem besonderen Zimmer zusammengefunden, die anfänglich während des Abendessens heiter die Begebenheiten des Tages besprach, allmählich zu dem Theater und den Schauspielern zurückkehrte und nun in schäumendem Champagner auf das Wohl einer gefeierten Künstlerin, der Giovanolla, trank, welche an jenem Abende die Bühne betreten hatte.
»Sie soll leben und blühen in ewiger Schönheit!« sagte entzückt der Maler Erlau, »und möge es mir vergönnt sein, die Feueraugen und den Götternacken dieses Mädchens immer vor meinen Augen zu haben, wie sie sich mir bei der gestrigen Sitzung zeigten. Ihr seht sie alle in der falschen, täuschenden Beleuchtung der Bühne und könnt nicht ahnen, wie schön ihre Farben, wie regelmäßig und vollendet ihre Züge und wie üppig ihre Formen sind. Ich sage euch, sie ist der Typus einer italienischen Schönheit.«
»Wenn sie nur nicht so verdammt jüdisch aussähe«, sagte wegwerfend der junge Horn, der Sohn und Erbe eines reichen Kaufmanns. »Ich sagte es gleich zu meinem Vetter Hughes, den ich Ihnen, lieber Erlau, als einen Mitenthusiasten empfehlen kann und der für nichts Augen hatte als für diese Person, die mir wirklich mit all ihrer gepriesenen italienischen – oder sagten Sie orientalischen? – Schönheit im höchsten Grade missfallen hat. Wir lieben in unserer Familie diese Art von Schönheit nicht, es ist eine uns angeborene Antipathie, und mir wurde erst wieder in England bei den schlanken, blonden Insulanerinnen recht wohl, nachdem ich mich in Havre ein Jahr lang unter jenen kleinen, brünetten Französinnen in der Frankfurter Judengasse geglaubt hatte.«
»Apropos Judengasse, lieber Ferdinand!« fiel der Vetter, ein geborener Engländer und erst seit wenig Tagen in dieser Stadt, dem Sprechenden ins Wort, »wer war wohl das ganz junge Mädchen in der zweiten Loge rechts von der Bühne? Sie ist offenbar eine Jüdin, aber es ist ein sehr interessantes Gesicht.«
»Ich kenne die Leute nicht«, antwortete der Gefragte.
»Schämen Sie sich«, rief im komischen Zorn der Maler, »und verleugnen Sie nicht, wie unser heiliger Apostel Petrus seligen Angedenkens, Ihren Meister und Herrn. Sie sollten den reichen Bankier Meier nicht kennen, bei dessen Vater Ihr Herr Vater die Handlung erlernte und von dem er die Mittel zu seinem Etablissement erhielt, als er sich in Ihre Mutter verliebte? Freilich kam Ihr Herr Papa durch diese Heirat in die schönste Mitte der Kaufmannsaristokratie und mag in der Gesellschaft wohl seine alttestamentarischen Verbindungen vergessen haben.«
Horn war halb beleidigt, halb verlegen. »Ach so!« sagte er, »die Meiers hatten die Loge? Es waren die Meiers? Die Tochter soll ein hübsches Mädchen werden, eine sehr reiche Erbin, sie steht noch zu Diensten, lieber Vetter! – Das ist aber auch alles, was ich von ihnen weiß.«
»So erlauben Sie mir«, nahm der Kandidat Reinhard, ein schöner junger Mann, der bis dahin schweigend der Unterhaltung zugehört hatte, die ihm nicht zu gefallen schien, das Wort, »so erlauben Sie mir, Ihnen, falls es Sie interessiert, nähere Auskunft über die Familie zu geben. Das Meiersche Haus ist eines der gastlichsten in unserer Stadt, die Mutter eine freundliche, wohlwollende Frau, der Vater ein sehr gescheiter und braver Mann, der ein offenes Herz für die Menschen und die Menschheit hat und sich lebhaft für alles interessiert, was es Großes und Schönes gibt. Die Leute haben nur zwei Kinder: einen Sohn, der mein genauer Freund ist, den Doktor Meier, und eben diese Tochter, Jenny Meier, die ich bis vor kurzem unterrichtet habe.«
»Und ist niemand da, der die Handlung fortsetzt, wenn der alte Meier, dessen Firma ja sehr bekannt ist, einmal stirbt?« fragte der Vetter.
»Jawohl, ein Neffe, seines Bruders Sohn, der auch Meier heißt und schon lange in der Handlung ist. Man sagt, er werde die Tochter heiraten und das Geschäft einst übernehmen«, antwortete Reinhard zögernd.
»Der Glückliche, ich könnte ihn beneiden, denn das Mädchen ist wahrhaft reizend«, rief der Engländer aus.
»Das denkt Freund Reinhard auch«, lachte Erlau, »und gewisse Leute wollen behaupten, dass er die junge Dame, nachdem er ihre geistige Ausbildung meisterhaft geleitet, jetzt praktisch in der Konjugation mancher Zeitwörter unterrichte, als da ist: ich liebe, du liebst, usw. usw. Werde nicht rot, lieber Reinhard, es ist eine Bemerkung wie jede andere, und ich teile deine Neigung und Anhänglichkeit für das ganze Meiersche Haus. Es sind gute und gebildete Leute, und wenn auch die sogenannte Elite der Gesellschaft dort im Hause nicht zu sehen ist, so findet man den größten Teil unserer Gelehrten und Künstler, eine Menge von Fremden und vortreffliche Unterhaltung bei Meiers. Ich wüsste kein Haus, das ich lieber besuchte als das ihre.«
»Sie schildern die Familie so anziehend, dass Sie mir fast den Wunsch einflößen, mich in dem Hause einführen zu lassen«, sagte Hughes.
»Nicht doch, William!« fiel Horn ein, »meine Mutter würde das sehr ungern sehen, wie kommst du nur darauf? Ich bitte dich, diese Juden hängen wie die Kletten zusammen, und bist du erst in einem ihrer Zirkel, so steckst du auch gleich so fest in der ganzen Clique, dass man sich scheuen muss, mit dir an öffentlichen Orten zu erscheinen, aus Furcht, von deiner mosaischen Bekanntschaft überfallen zu werden. Die Visite bei Meiers...«
»Würde Ihnen beweisen, dass Ihr Herr Vetter mit seinen Gesinnungen in mancher Beziehung noch tief im Mittelalter steckt«, unterbrach Reinhard die Rede, »und ich bekenne Ihnen, Herr Horn, dass mir Ihre Äußerungen nicht nur in unserer Zeit höchst befremdlich erscheinen, sondern dass ich sie geradezu für unschicklich halte, nachdem ich Ihnen gesagt habe, dass ich der Familie befreundet bin und sie hochachte.«
»Entschuldigen Sie, ich vergaß, dass Sie Lehrer in dem Hause sind und die Sache also anders ansehen müssen. Ich aber, der ich unabhängig bin, gestehe Ihnen...«
»Gestehen Sie nichts mehr, Sie haben ja schon so vieles heute gestanden«, rief Erlau dazwischen, »was Sie lieber hätten verschweigen sollen. Sie sind ein reicher, junger Kaufmann, sehr elegant, sehr fashionable, was kümmern Sie Geständnisse und Juden? Mein Gott! Sie haben nun einmal die Antipathie, und Sie brauchen ja auch nicht zu Meiers zu gehen, es hat Sie niemand gebeten – selbst nicht«, so fügte er halblaut, gegen Reinhard gewendet, hinzu, »als vor drei Jahren die Sontag dort war und der junge Herr alle Segel aufsetzte, um eingeladen zu werden. Ich bitte dich, Reinhard, ärgere dich über den Laffen nicht und lass' ihn laufen.«
Die Unterhaltung war zu einem Punkte gekommen, auf dem sie leicht eine verdrießliche Wendung nehmen konnte, da öffnete sich plötzlich die Türe und ein junger, hübscher Mann, kaum dreißig Jahre alt, trat in das Zimmer. Er war nur mittlerer Größe, aber kräftig und wohlgebaut, hatte krauses, schwarzes Haar, eine gebogene Nase, ein paar durchdringend kluge, schwarze Augen und vor allem eine hohe, gewölbte Stirn, die beim ersten Anblick den Mann von Geist und Charakter verriet. Seine Bewegungen waren rasch wie sein Blick. Er hatte eine gelbliche, aber gesunde Farbe und war modern, doch ganz einfach gekleidet. Kaum war er in das Zimmer getreten, als Erlau und Reinhard ihm mit dem Ausruf. »Guten Abend, Meier, gut, dass du kommst!« entgegengingen. Er wandte sich aber, die Begrüßung nur flüchtig erwidernd, an Horn und sagte: »Ich komme eben aus dem Hause Ihrer Eltern. Ihr Fräulein Schwester hat sich den Fuß beschädigt, als sie nach der Rückkehr aus dem Theater aus dem Wagen stieg. Man hat mich holen lassen, es ist jetzt alles in Ordnung, durchaus nichts zu befürchten, und ich freue mich, dass ich Sie hier treffe, denn ich glaube, man erwartet Sie zu Hause. – Guten Abend, und schön, dass ich euch noch finde«, fuhr er, gegen die Freunde gewendet, fort und setzte sich zu ihnen nieder.
Horn machte ein paar besorgte Fragen, die von Doktor Meier beruhigend beantwortet wurden, dann brach jener auf, und William wollte ihn begleiten. Erlau indessen, der niemals genug Leute beisammen haben konnte und dem der Engländer gefiel, redete ihm zu, bei ihnen zu bleiben, um noch ein paar Stunden zu plaudern. »Im Hause Ihres Onkels können Sie nichts nützen und hier«, sagte er, »haben wir Gelegenheit, Sie unserm Freunde, dem Doktor Meier, von dem wir vorhin sprachen, vorzustellen, also bleiben Sie immer hier.«
William war das zufrieden, und Horn empfahl sich dem kleinen Kreise, indem er William versicherte, er beneide ihn um den Genuss, in so vortrefflicher Gesellschaft noch länger zu bleiben, dabei warf er einen spöttischen Blick auf Meier, den dieser nicht sah, da er Horn den Rücken zugewendet hatte, und den Reinhard mit verächtlichem Achselzucken erwiderte.
Ein Kellner räumte die leeren Bouteillen, die gebrauchten Gläser fort und setzte eine volle Flasche vor die Zurückgebliebenen hin.
Erlau, Reinhard und William, die schon seit einer Stunde beim Weine saßen, gerieten allmählich in eine immer munterere Laune, gegen welche Meiers Ruhe eigentümlich abstach. Vor allem konnte Erlaus ausgelassene Fröhlichkeit sich nicht genug tun; ein Witz folgte dem andern, ein Toast dem andern. »Alt-England soll leben!« rief er aus, »mit seinen freien Institutionen, seinem edlen Lord auf dem Wollsack, seiner Magna Charta und seinen Constables und Beefsteaks, und Sie sollen leben und leben immer mit uns, wie heute, Mr. Hughes.«
Der Toast wurde erwidert. Hughes trank auf die Einheit Deutschlands; Reinhard ließ die deutschen Frauen leben, Erlau vor allem die Schauspielerin, von der schon früher die Rede gewesen war, und Meier gab sich dem Treiben hin wie ein Erwachsener, der mit Kindern spielt. Er nahm äußerlich teil daran, während ihn im Innern offenbar ein anderer Gegenstand beschäftigte und er in ein Hineinträumen versank, aus dem Erlaus Ruf: »Meier, die Deinen sollen leben!« ihn aufstörte. Schweigend und nur mit dem Kopfe nickend dankte dieser und trank sein Glas aus. Damit war aber Erlau noch nicht zufrieden.
»Mein Gott! Du unerträglich ernsthafter Doktor und Misanthrop, gibt es denn nichts mehr auf der Welt, was dich aus deiner philosophischen Philisterlaune herausreißen kann? – Ich erschöpfe mich in hinreißender Geistreichheit, ich verschwende die beste Laune, den allerbesten Wein an dir, und du nimmst meine Liebenswürdigkeit, die doch heute ganz außerordentlich ist, hin wie ein Bettler das tägliche Brot, ohne Freude und Genuss, und gießt den edlen Wein hinunter, gedankenlos, als gälte es, das harte tägliche Brot mit langweiligem Wasser hinab zu spülen. Ich werde irre an dir, Doktor! Was fehlt dir, was denkst du, was meinst du? Soll ein Gott vom Himmel steigen, um dir zu beweisen, dass die Welt die beste ist, in der auf ödem Kalkfelsen dieser Göttertrank zu wachsen vermag? In der auf allen Wegen die schönsten Blumen erblühen und in manchen alten Häusern die hellsten Mädchenaugen blitzen? Sünder, gehe in dich und tue Buße und rufe mit mir: Die Weiber sollen leben! – Und – ha! Nun hab' ich's, was ihn wecken wird; steht auf, ihr Weisen, und trinket mit mir! Meier, deine Schwester soll leben! –«
Reinhard und Hughes standen auf, und der letztere rief lebhaft: »Ja! Das schöne Mädchen mit dem dunkeln Flammenblick soll leben und immer leben! –«
Auch Reinhard, in dem noch mancher Widerhall seiner Studentenjahre nachtönte, erhob sein Glas und bereitete sich, es gegen die andern Gläser klingen zu lassen, nur Meier blieb ruhig sitzen und sagte: »Seit wann ist es Sitte, dass man bei Zechgelagen auf das Wohl unbescholtener Mädchen trinkt? Ich werde es wenigstens nicht leiden, dass der Name meiner Schwester in meiner Gegenwart im Weinhause entweiht werde. Setzen Sie sich, meine Herren! Den Toast nehme ich nicht an. –«
Dieser ruhige, ernste Ton schien Erlau plötzlich abzukühlen, während er den Engländer in lebhafte Bewegung versetzte. Er ging rasch auf Meier zu und rief "Verzeihen Sie mir, mein Herr! Aber Sie müssen mein Freund werden! Wir Engländer haben sonst nicht das Herz auf der Zunge – aber ihr Deutschen seid unsere Stammverwandten. Ihr wisst es, was sweet home und a blushing maid dem Herzen sein können – Sie wissen es vor vielen gut, darum schlagen Sie ein, Doktor! Ich bin dessen nicht unwert!«
Meier tat, wie jener es verlangte, und tat es gern, denn es lag so viel Ehrenhaftes in dem Gesicht des Fremden, dass es augenblicklich für ihn einnahm. Auch Reinhard schüttelte ihm die Hand, und man trank auf die Dauer und das Gedeihen des neuen Bundes. Dadurch blieb Erlau allein stehen; er goss zwei Gläser voll, nahm in jede Hand eins derselben und sprach in affektierter Traurigkeit: »Auf das U folgt gleich das Weh, das ist die Ordnung im ABC – auf jeden Augenblick voll Wonne eine Ewigkeit von langer Weile, denn ich schwöre euch, die rechte, wahrhafte Ewigkeit wird erst recht langweilig sein! Auf jede liebenswürdige Sünde folgt bei euch eine unausstehliche Bußfertigkeit. Anathema über das ausgeartete Geschlecht, das nicht begreift, wie man sündigt aus süßer, inniger Überzeugung, dem nur en passant ein kleines, borniertes Sündchen in den Weg kommt und das nie jenes großartige Gebet des edlen Russen begriff und gläubig zu beten vermochte: ›Herr! Führe mich in Versuchung, damit ich unterliege!‹ – Hier stehe ich allein, ich fühle es, in einer verderbten Zeit, in der mich niemand versteht, und so muss ich für mich allein den Toast ausbringen: Gott erhalte mich in meiner geliebten Sündhaftigkeit, worauf ich dies Glas ausleere – und hole der Teufel eure verdammte Tugend, bei der man nicht an ein hübsches Mädchen denken und ihm Glück wünschen darf, ohne eine Ladung Moral und ein Fuder Gefühl in den Kauf zu bekommen.« – Dabei leerte er das zweite Glas und sagte verdrießlich, während die andern herzlich lachten: »Und nun könnt ihr alle ruhig nach Hause gehen, nachdem ihr mich mit eurer abgeschmackten Sentimentalität um meine beste Laune gebracht habt. Geht nach Hause und schlaft wie die Ratten und träumt tugendhaft – ich werde noch nach dem Fenster der göttlichen Giovanolla wandeln und sehen, ob dieser süße Strahl der Liebe, der Gott sei Dank keine Heilige ist, noch über der Erde leuchtet oder ob er sich schon hinter den Wolken des Schlummers verborgen hat und mir erst morgen wieder als Stern und Sonne aufgehen will. – Beiläufig könnte ich dann diesen unsern Insulaner in das Haus seines Onkels geleiten, in sein sweet home, damit er uns nicht auf den Querstraßen des Lebens verloren gehe und seine warme Seele nicht erstarre in kalter Winternacht. – Gute Nacht, liebe Söhne! Gute Nacht, Meier – kommen Sie, Herr Hughes!« – Mit diesen Worten brach er auf, und die Gesellschaft ging auseinander.
2.
»Wo warst du gestern, Eduard?« fragte Jenny Meier am nächsten Morgen ihren Bruder, als dieser in das Wohnzimmer seiner Eltern trat, in welchem die Familie frühstückend beisammen saß. »Wir hatten dich zum Tee erwartet, und du kamst nicht! Auch im Theater bist du nicht gewesen!«
»Steinheim war bei mir und unser Joseph, und wir plauderten eine Weile; dann wollte ich mit ihnen hinaufkommen und eure Rückkehr aus dem Theater erwarten, wurde aber plötzlich in das Haus des Kommerzienrates Horn gerufen, wo sich die Tochter den Fuß gebrochen hatte, als sie aus dem Theater kam. So gingen meine Gäste fort, und ich sprach nachher, als ich den Verband angelegt hatte und nach Hause gehen wollte, bei Gerhard ein, fand dort Bekannte und blieb noch eine Stunde sitzen!«
»Mein Gott!« rief die Mutter, »hat sich das schöne Mädchen schwer beschädigt?«
»Du hörst es ja«, antwortete der Vater, »sie hat den Fuß gebrochen, und ein schwerer Fall, ein ganz verzweifelter muss es wohl sein, wenn der alte Horn sich entschloss, gerade Eduard rufen zu lassen.«
»Das kannst du nicht behaupten, lieber Mann! Eduard ist doch, obgleich einer der jüngeren Mediziner, in den ersten Häusern der Stadt Hausarzt, sowohl bei Christen als bei Juden; und du weißt selbst, wie ungemein zuvorkommend ihm überall begegnet wird und wie sehr man für ihn eingenommen ist!«
»Ich weiß es wohl, und es freut mich, dass er sich diese Stellung errungen hat, aber eben sowohl weiß ich, dass es jener ganzen Clique gewiss die höchste Überwindung gekostet hat, den jüdischen Arzt in ihre engeren Kreise zu ziehen. Sie entschuldigen sich vor sich selbst mit dem Nutzen, den er ihnen gewährt, und doch: Wer weiß, ob Eduard überall den gleichen Empfang fände, wenn er sich mit einer Jüdin verheiratete und für seine Frau dieselben Rücksichten verlangte als für sich? Den einzelnen jungen Mann nehmen sie allenfalls gern auf. Eine Familie? Da würden sie vielleicht Bedenken haben.«
»Das glaube ich nicht«, sagte die Mutter, »im Gegenteil, ich bin überzeugt, dass Eduard nur zu werben braucht, um eine Frau aus welchem christlichen Hause er wollte zu bekommen, und ich kann es nicht leugnen, dass ich nichts sehnlicher wünsche als ihn recht bald eine solche Verbindung schließen zu sehen!«
Der Vater lächelte, und Eduard antwortete: »Eine Verbindung der Art, liebe Mutter, werde ich nie eingehen, das weißt du wohl. Ich werde mich niemals taufen lassen, und deine ehrgeizigen Hoffnungen für mich, mit denen du in der Zukunft eine große Laufbahn voller Ehrenstellen, Orden und Würden für mich erblickst, werden sich schwerlich jemals verwirklichen. Es sei denn, dass eine neue Zeit für uns heraufkäme.«
»Die zu schaffen du dich berufen fühlst, mit Steinheim, Joseph und andern«, fiel Jenny ein. »Ich bitte dich, Eduard, nur beim Frühstück verschone mich mit Politik, nur die eine Tasse Kaffee lasse mich ohne politische Zutaten genießen. Vater! Verbiete ihm überhaupt, schon beim Frühstück vernünftig zu sein. Er hat ja dazu seine große Praxis und den ganzen, langen Tag, der Morgen muss für uns sein.«
Der Vater gab scherzend den gewünschten Befehl und fragte, ob Eduard nicht wisse, wie man bei Horns darauf gekommen sei, gerade ihn rufen zu lassen.
»Ihr Hausarzt, der alte Geheimrat, fand den Fall sehr bedenklich«, berichtete der Sohn, »tat sehr ängstlich, und daher bestand das Fräulein selbst darauf, sich von ihm nicht den Verband anlegen zu lassen, und verlangte, man solle nach mir schicken. Wenigstens erzählte mir der Kommerzienrat es so, ich weiß nicht, ob um mir begreiflich zu machen, dass er selbst es nicht getan hätte, oder um mir mitzuteilen, welch schmeichelhaftes Vertrauen die Tochter in mich setze.«
»Ist sie so schön, als sie zu werden versprach? Ich habe sie in der Schule gekannt«, sagte Jenny; »aber spiele nicht den kalten, gefühllosen Arzt, der nichts sieht als die Krankheit«, fügte sie hinzu.
»Sie ist so schön, dass selbst der Kälteste sich an ihrem Anblick erfreuen muss«, antwortete er; »dabei war sie so geduldig bei dem großen Schmerz, so liebenswürdig gegen die Umgebung, so dankbar gegen mich, dass ich ganz für sie eingenommen bin. Ich würde es sehr bedauern, wenn sie nicht völlig herzustellen wäre.«
Jenny war ganz glücklich, den Bruder so erwärmt zu sehen, und meinte, die Kranke könne sich glücklich schätzen, die werde gewiss sorgsamer und besser als manche Königin behandelt werden, aber Eduard möge sich bei der Kur nicht zu sehr anstrengen, damit er sich nicht etwa selbst eine Herzkrankheit zuziehe, die leicht unheilbar sein könnte.
Nun kam auch Joseph Meier, der Neffe, welcher ebenfalls im Hause wohnte, dazu. Er war fast im gleichen Alter mit Eduard, doch ließ sein düsteres Wesen ihn älter erscheinen als er war. Er hatte ein kluges Äußeres, ohne hübsch zu sein, weil er sehr unregelmäßige Züge hatte und gewöhnlich etwas mürrisch aussah. Nur selten flog ein Lächeln über das markierte Gesicht und verbreitete ein mildes Licht über die Augen, die eigentlich höchst gutmütig waren, aber fast immer brütend zur Erde blickten. Joseph und Eduard waren von Kindheit an die besten Freunde gewesen und hatten, einander gegenseitig ergänzend, sich zu dem gebildet, was sie geworden waren, zu tüchtigen Menschen, jeder in seiner Art. Nur fehlte Joseph das liebenswürdige Wesen, der schöne ungezwungene Anstand, die Eduards Erscheinung so angenehm machten; und vor allem hatte dieser eine angeborene Beredsamkeit, während Joseph in den meisten Fällen nur kurz und abgebrochen sprach.
Natürlich wurde bei Josephs Ankunft das eben Mitgeteilte wiederholt und nochmals besprochen. Er ließ sich das Ganze ruhig erzählen und sagte dann mit seinem gewöhnlichen sonderbaren Lächeln: »O ja, so sind sie, wenn sie dich brauchen, können sie recht liebenswürdig sein. – Aber höre doch einmal, wie sie von dir reden, wenn sie unter sich sind. – Frage einmal, ob sie dich für ebenbürtig halten.«
Diese Äußerung, eben jetzt ausgesprochen, wo man in so guter Laune war, verstimmte die übrigen sichtlich. Jenny, die das düstere Wesen des Vetters nicht liebte, war die erste, die ihren Verdruss äußerte, indem sie ihm den Kaffee mit den Worten reichte: »Da, du Störenfried! Trinke nur, damit du nicht brummen kannst.« – Auch Madame Meier schien unzufrieden. Der Vater fing an, die Zeitungen zu lesen, die Joseph mitgebracht hatte, und nur der Doktor plauderte noch eine Weile mit ihm fort; dann entfernten sich die drei Männer, um an ihre Geschäfte zu gehen, und nur Mutter und Tochter blieben zurück.
»Joseph wird doch von Tag zu Tag unerträglicher«, sagte die letztere, »er wird immer finsterer, immer abstoßender, und ich freue mich auf kein Fest, auf nichts mehr, sobald er dabei ist, weil ich weiß, dass er mir jede Freude stört.«
»Und doch glaube ich«, wandte die Mutter ein, »dass es kaum ein reicheres, edleres Herz gibt als das seine. Ich wüsste niemand, der so freudig alles für seine Geliebten zu opfern bereit wäre, niemand, der es mit mehr Anspruchslosigkeit täte als er. Auch achten wir alle ihn von Herzen, haben ihn sehr lieb, und es tut mir leid, dass du dich nicht in seine Eigenheiten schicken kannst.«
»Können? Mein Gott, können würde ich es schon, aber ich will es gar nicht!«
»Das ist es eben, was mich betrübt, mein Kind! – Dies ewige ›Ich will‹ und ›Ich will nicht‹, dies Unfügsame in deinem Wesen, das ist es, was mich über dich besorgt macht. Als du geboren wurdest und ich dich auf meinem Schoße heranwachsen sah, habe ich oft zu Gott gebetet, er möge alles Unheil von dir abwenden. Bisher ist mein Gebet auf fast wunderbare Weise erhört worden, und doch sehe ich es mit Schmerz, dass wir Menschen Gott eigentlich um nichts bitten dürfen, weil wir nicht wissen, was uns frommt.«
»So hättest du mir also lieber Unglück wünschen sollen?« fragte die Tochter lächelnd.
»Zu deinem wahren Heile wäre es vielleicht besser gewesen. Ich schloss von meinem Herzen auf das deine, und darin irrte ich. In dir ist der Charakter deines Vaters, der feste, starke Sinn, und Eduards Einfluss hat diese Charakterrichtung in dir noch mehr ausgebildet. Vom Glück verzogen, von uns allen mit der nachgiebigsten Liebe behandelt, hast du es nie gelernt, dich in den Willen eines andern zu fügen; was man an dir als Eigensinn hätte tadeln sollen, das haben Vater und Bruder als Charakterfestigkeit gelobt, und ich begreife, dass dir Joseph zuwider ist, weil er allein dir entschieden und mit Nachdruck entgegentritt. Trotzdem weiß ich, dass er dich mehr liebt als viele, die dir schmeicheln.« Bei den Worten reichte die milde Frau der Tochter die Hand. Diese nahm sie, drückte einen Kuss darauf und saß eine Weile schweigend bei ihrer Arbeit.
Man sah es ihrem lieblichen Gesichte an, dass irgendein Entschluss, ein Gedanke sie beschäftigte; auch legte sie plötzlich die Arbeit beiseite, sah ganz ruhig die Mutter an und sagte mit einer Stimme, der man nicht das Geringste von der Bewegung anmerkte, die ihre Züge verrieten: »Mutter! Den Joseph heirate ich niemals. Niemals, Mutter! – Sage ihm das, und auch dem Vater. Ich weiß, dass ihr es wünschet, dass Joseph es erwartet und mich nur erzieht, um eine gute Frau an mir zu haben; die Mühe aber kann er sparen. Sieh«, fuhr sie fort, und ihre Fassung verlor sich mehr und mehr, so dass sie zuletzt bitterlich weinte, »sieh, gute Mutter! Was dein Beispiel, deine Geduld, und Vater und Eduard, die ich so lieb habe, nicht über mich vermochten, das kann Joseph, den ich gar nicht liebe, gewiss nicht von mir erlangen. Ihr sagt oft, ich sei noch ein Kind, ich werde erst in einigen Wochen siebzehn Jahre, aber solch ein Kind bin ich nicht mehr, dass des Cousins raue, befehlende Art mich nicht verletzte. Andere haben mich auch getadelt, aber sie verlangen nicht das Unmögliche von mir. Dort die große, hohe Pappel im Garten biegt der Wind hin und her, und meinen kleinen, stacheligen Kaktus hat er gestern mitten durchgebrochen, weil er sich nicht beugen konnte. So ist mein Herz! Es mag euch starr, rau und hässlich erscheinen, aber es kann, so hoffe ich, Blüten tragen, die euch freuen. Man kann mein Herz brechen, aber es niemals zu schmählichem Nachgeben, zu schwankender Gesinnung überreden – und das schwöre ich dir, lieber will ich sterben, als Josephs Frau werden.«
Laut schluchzend warf sie sich vor die Mutter nieder und barg das Gesicht in ihren Schoß. Erschreckt über so viel unerwartete Leidenschaftlichkeit schlang die besorgte Mutter die Arme um das geliebte Kind und versuchte auf alle Weise es zu beruhigen. Sie versicherte Jenny, dass sie allerdings glaube, der Vater würde ihre Verbindung mit Joseph gern sehen, doch sei es ihm nie in den Sinn gekommen, jemals ihrer Neigung Zwang anzutun. Sie solle selbst über ihre Zukunft entscheiden; sie wisse ja, dass die Eltern keinen andern Wunsch hätten als das Glück ihrer Kinder – aber alles war vergeblich. Jenny konnte nicht zur Ruhe kommen, und die Mutter sah an der Leidenschaftlichkeit, die so plötzlich, so anscheinend grundlos hervorgebrochen war, dass wohl schon lange ein andres stilles Feuer in Jennys Seele geglüht haben mochte. Wer dieses Feuer aber angefacht, das wusste sie nicht zu erraten. Sie konnte sich nicht erinnern, dass irgendeiner der jungen Männer, die in ihr Haus eingeführt waren und Jenny auf jede Weise huldigten, einen besonderen Eindruck auf diese gemacht hätte. Sie sann und sann, während die Tochter noch ganz erhitzt und aufgeregt wieder an den Nähtisch zurückgekehrt war und sich emsiger als sonst mit einer Arbeit beschäftigte, die gar nicht so großer Eile bedurfte. Sie wurde aber allmählich ruhiger dadurch und hatte sich äußerlich bereits gesammelt, als man den Doktor Steinheim meldete.
Einen Augenblick schwankte die Mutter, der in dieser Stimmung jeder Besuch unwillkommen war, ob sie ihn annehmen solle oder nicht, dann entschied sie sich dafür, weil sie hoffte, Steinheims Lebhaftigkeit werde Jenny auf angenehme Weise zerstreuen. Als er darauf nach wenig Minuten in das Zimmer trat, wurde er von beiden Damen wie ein alter Bekannter behandelt. Er mochte siebenundzwanzig bis achtundzwanzig Jahre alt sein, hatte eine große, kräftige Figur und einen vollblütigen, rotbraunen Teint. Sein krauses schwarzes Haar, die dunklen Augen und der starke bläuliche Bart konnten ebenso gut dem Südländer als dem Juden gehören und machten, dass er von vielen Leuten für einen schönen Mann gehalten wurde, während andere die kohlschwarzen Augen starr und unheimlich, die Schultern hoch, den starken Hals zu kurz und Hände und Füße so groß fanden, dass dies alles ihm jeden Anspruch auf wirkliche Schönheit unmöglich mache. Er selbst schien indessen gar nicht dieser Meinung zu sein, das bewies die sehr studierte Toilette, die aber trotz ihrer gesuchten Eleganz des Geschmacks ermangelte. Er trug an jenem Morgen einen kurzen dunkelgrünen Überrock, zu dem eine ebenfalls grüne Atlasweste und mehr noch ein dunkelroter türkischer Shawl sonderbar abstachen, den er unter der Weste kreuzweise über die Brust gelegt und mit einer großen Brillantnadel zusammengesteckt hatte. Handschuhe, Stiefel und Frisur waren nach der modernsten Weise gewählt, aber all das stand ihm, als ob er es eben wie eine Verkleidung angelegt hätte. Es war für den feinen Beobachter etwas Unharmonisches in der ganzen Erscheinung, das störend auffiel.
»Ich bitte tausendmal um Vergebung«, sagte er, »dass ich in diesem Morgenanzug vor Ihnen erscheine, aber ich bin so durchweg erkältet, meine Nerven sind so abgespannt, mein Wunsch, Sie zu sehen, war so groß, dass ich dachte, die Damen entschuldigen dich wohl. Es ist allerdings eine Verwegenheit – aber: ›Ich kann nicht lange prüfen oder wählen, bedürft Ihr meiner zu bestimmter Tat, dann ruft den Tell! Es soll an mir nicht fehlen.‹«
»Mein Gott! Herr Doktor! Geht es so bergab mit Ihnen, dass Sie von dem göttlichen Shakespeare, dem erhabenen Calderon und dem heiligen Schmerzenssohne unserer Zeit, dem unvergleichlichen Byron, schon zu unserm armen Schiller zurückkehren müssen? Sie haben also in den letzten Tagen wohl gar zu viele Zitate verbraucht?« fragte Jenny spottend, und –
»Jenny!« rief die Mutter mit missbilligendem Tone. – Aber Steinheim ließ sich nicht stören, er ging zu Jenny und sprach: »›Mit Ihnen, Herzogin, hab' ich des Streits auf immer mich begeben‹, und Sie werden auch nicht mehr streiten wollen, meine schöne kleine Feindin, wenn ich Ihnen sage, dass ich als der Verkünder sehr interessanter Nachrichten komme. Erstens ist Erlau entzückt über den Vorschlag Ihrer Frau Mutter, hier am Silvesterabend Tableaux darzustellen, zweitens – nun raten Sie – hat man heute Herrn Salomon, einen jüdischen Kaufmann, zu einem städtischen Amte erwählt.«
»Das letztere ist mir ungemein gleichgültig«, rief Jenny, »aber für die erste Nachricht bin ich Ihnen sehr dankbar, und sie macht mir großes Vergnügen. Weiß es Eduard schon?«
»Was denn?«
»Dass der Kaufmann Salomon gewählt ist?« fragte Jenny.
»Also sehen Sie, sehen Sie, es ist Ihnen doch nicht so gleichgültig als Sie behaupten, und wie könnte es auch. Wen sollte es nicht freuen, wenn alte, barbarische Vorurteile allmählich vor der gesunden Vernunft und der Gerechtigkeit weichen müssen; wenn ein Volk, das Jahrhunderte hindurch mit Füßen getreten wurde, endlich allmählich die Rechte erlangt, an die es dieselben Ansprüche hat als die andern Bürger des Staates, wenn... apropos! Was ist gestern Abend bei Horns vorgefallen, man ließ ja Eduard noch so spät holen?« sagte Steinheim, der oft von dem Hundertsten, wie man sagt, auf das Tausendste kam. – »Ich höre, die Clara Horn hat den Fuß gebrochen; Erlau sagte es mir, der mich, das fällt mir eben ein, bei der Giovanolla erwartet! Wie hat sie Ihnen gestern gefallen, die Giovanolla? Sie gehen doch morgen wieder hin?« – Das alles fragte er so durcheinander, dass es nicht möglich war, irgendeine der Fragen zu beantworten; dann wandte er sich Abschied nehmend an Madame Meier, riet Jenny nochmals, das Theater nicht zu versäumen, und empfahl sich mit den Worten: »›So süß ist Trennungswehe, ich sagte wohl Adieu, bis ich den Morgen sähe.‹«
Mutter und Tochter sahen ihm lächelnd nach.
Ehe wir in der Erzählung fortfahren, müssen wir aber einen Rückblick auf den Lebensweg der Personen werfen, von denen diese Blätter handeln sollen.
3.
Die Familie Meier galt bei allen, die sie kannten, für eine der glücklichsten. Der Vater hatte ein hübsches Vermögen, das er von seinen Eltern ererbt, durch Tätigkeit und kluge Berechnung in einen großen Reichtum verwandelt, dessen er bei seiner Bildung auf würdige Weise zu genießen wusste und von dem er dem Dürftigen gern und reichlich mitteilte. Aus Neigung hatte er sich früh mit seiner Frau, einem schönen und guten Mädchen, verheiratet, die ihm mit immer gleicher Liebe zur Seite gestanden und ihm zwei Kinder, Eduard und Jenny, geboren hatte. In seiner Frau, und mit ihr in diesen beiden Kindern, hatte Meier Trost und Ersatz gefunden, wenn Welt und Menschen ihren Hass und ihre Unduldsamkeit gegen den Juden bewiesen, wenn man ihn ausgeschlossen hatte von Gemeinschaften, ihm Rechte verweigert, deren Gewährung jeder Mann von Ehre zu fordern hat. Die Tätigkeit, Wirksamkeit und Liebe, denen einer großen Gesamtheit zu nutzen nicht vergönnt war, waren lange Zeit hindurch Eduards alleiniger Segen geworden, da er mehr als zehn Jahre älter war als seine Schwester.
Man wundert sich oft, dass die Juden noch immer die Geburt eines Messias erwarten und die göttliche Sendung Jesu weder anerkennen noch begreifen. Aber von ihrem Standpunkte aus muss das ganz natürlich erscheinen. Wie sollten sie an eine Lehre glauben, deren missverstandene Grundsätze ihnen bis auf den heutigen Tag die blutigsten, widersinnigsten Verfolgungen zugezogen haben? Wie an einen Erlöser, der sie bis jetzt nicht von Schmach und Unterdrückung erlöset hat? Von der Liebe, die Jesus der Menschheit gepredigt, haben die Juden bei den Christen seit jener Zeit wenig zu bemerken Gelegenheit gehabt. Sie haben in der Tat noch keinen Messias gefunden. Welch ein Wunder also, wenn sie ihn umso sehnlicher erwarten, je mehr sie der Befreiung und Erlösung sich wert fühlen; wenn jeder Vater bei der Geburt eines Sohnes freudig hofft, dies könne der Erlöser seines Volkes werden, und wenn er den Knaben so erziehen möchte, dass der Mann reif werde für den großen Zweck.
So war auch Eduards Erziehung in jeder Beziehung sorgfältig geleitet worden. Sie sollte ihn zu einem Menschen heranbilden, der in sich Ersatz für die Entbehrungen finden könnte, welche das Leben ihm auferlegen würde, und sollte ihn andererseits fähig machen, die Verhältnisse zu besiegen und sich womöglich eine Stellung zu verschaffen, die ihn der Entbehrungen überheben und alle Vorurteile besiegen könne. Glücklicherweise kamen Eduards Fähigkeiten dem Wunsche seiner Eltern entgegen. Eine starke Fassungsgabe und eine große Regsamkeit des Geistes machten, dass er die meisten seiner Mitschüler überflügelte, und erwarben ihm ebenso sehr die Gunst der Lehrer als eine gewisse Herrschaft über seine Gefährten. Von Liebe und Wohlwollen überall umgeben, schien sein Charakter eine große Offenheit zu gewinnen, und er galt für einen fröhlichen, sorglosen Knaben, bis einst in der Schule der Sohn einer gräflichen Familie, mit dem er sich knabenhaft in Riesenplänen für die Zukunft verlor, bedauernd gegen ihn äußerte: »Armer Meier, dir hilft ja all dein Lernen nichts, du kannst ja doch nichts werden, weil du nur ein Jude bist.«
Von dieser Stunde ab war der Knabe wie verwandelt. Er erkundigte sich eifrig nach den Verhältnissen der Juden, er fühlte sich gedrückt und gekränkt durch sie, und nur sein angeborener Stolz verhinderte ihn, sich gedemütigt zu fühlen, doch entwickelte sich durch das Nachdenken über diesen Gegenstand bei ihm sehr früh der Begriff von jenen Rechten des Menschen, die alle in gleichem Grade geltend zu machen vermögen, das Bewusstsein inneren Wertes und ein Zorn gegen jede Art von Unterdrückung. Je älter er wurde und je mehr er erkennen lernte, welche Vorzüge ihm schon bei seiner Geburt durch die Aussicht auf eine glänzende Unabhängigkeit zuteil geworden waren, je bestimmter er einsah, zu welchen Ansprüchen ihn seine Fähigkeiten einst berechtigen dürften, umso mehr empörte sich sein Herz gegen ein Vorurteil, das alle seine Hoffnungen unerbittlich vernichtete.
Grade in der Zeit von Eduards Kindheit war wieder eine neue Judenverfolgung durch ganz Deutschland gegangen, und die allgemeine Stimmung hatte sich natürlich auch in der Schule sichtbar gemacht, die Eduard besuchte. Spott und Kränkungen mancher Art waren nicht ausgeblieben; man hatte wohl gehofft, der feige Judenjunge werde alles ruhig dulden. Darin hatte man sich aber geirrt. Eduards Charakter war furchtlos, und er erlangte durch Übung bald eine Gewandtheit und Entschlossenheit, die jeder sich anzueignen vermag. Er lernte fechten, reiten, schwimmen, und nachdem er sich ein paarmal mit starker Hand selbst sein Recht verschafft hatte, fand er Ruhe und endlich auch wieder seine frühere überlegene Stellung zu seinen Gefährten wieder. Hatte der Jüngling früher in einzelnen Momenten dem Gedanken Raum gegeben, sich von dem Judentum loszusagen und Christ zu werden, so verschwand der Plan plötzlich bei dem Anblick der Rohheiten, die er als Knabe hatte selbst von sogenannten gebildeten Christen gegen seine Glaubensgenossen ausüben sehen. Er konnte sich nicht denken, dass das Recht und die Wahrheit sich auf einer Seite befänden, die so zu handeln imstande war, und Verfolgung machte auch ihn, wie tausend andere zu allen Zeiten, nur fester seinem Volke angehörig.
Er hatte sich aber in jener Zeit gewöhnt, sich in der Opposition zu empfinden, und das Gefühl verließ ihn nie wieder, weil er beständig in Verhältnissen lebte, die dazu gemacht waren, seine Opposition hervorzurufen.
Da Eduard keine Neigung für den Kaufmannsstand hegte, beschlossen seine Eltern, ihn studieren zu lassen, wobei ihm freilich nur die Wahl blieb, Mediziner zu werden oder nach beendigten Studien in irgendeinem andern Fache als Privatgelehrter zu arbeiten, da ihm der Eintritt in eine Staatsstelle ebenso wie die Erlangung eines Lehrstuhles als Jude unmöglich waren. Er entschied sich für das erstere und verließ das Vaterhaus, um die Universität zu beziehen.
Glücklicherweise herrschte damals an den Hochschulen ein freier akademischer Geist, und die neuen Verhältnisse übten auf Eduard einen guten Einfluss aus. Hier galt er selbst, sein eigenstes Wesen, ohne dass ihn jemand fragte, wer bist du und was glaubst du? Sein Geist, seine körperliche Gewandtheit erwarben ihm die Achtung seiner Genossen, sein Fleiß das Wohlwollen der Lehrer, und die Bereitwilligkeit, mit der sein reichlich gefüllter Beutel allen offenstand, die Sorglosigkeit und Genussfähigkeit, die er zu jedem Feste brachte, machten ihn bald zum Lieblinge der ganzen Burschenschaft, der er sich mit jugendlicher Begeisterung angeschlossen hatte. Die Idee der Freiheit und Sittlichkeit, die jenem Bunde ursprünglich zum Grunde lag, berührte die zartesten Seiten seiner Seele und kam seiner ganzen Richtung entgegen. Er fühlte sich gehoben als Glied eines schönen Ganzen, das harmonisch aus den verschiedensten Elementen zusammengesetzt war, frei in einem Verband, in dem alle gleiche Rechte genossen.
Unter den Jünglingen, die sich an ihn angeschlossen hatten und deren Freundschaft ihn beglückte, war Reinhard ihm der liebste geworden. Er war der Sohn einer armen Predigerwitwe, die einer reichen Familie angehörte. Von seinen Verwandten unterstützt, hatte er die Schule besucht und kaum die Universität bezogen, als er erklärte, nun weiter keines Beistandes zu bedürfen, da er in sich die Kraft fühle, für seine Existenz selbst zu sorgen und hoffentlich auch seine Mutter ernähren zu können. Es hatte ihn seit Jahren schmerzlich gedrückt, von andern abhängig zu sein, es hatte ihn gedemütigt, seine Mutter von den Wohltaten einer hochmütigen Familie leben zu sehen, welche ihr niemals die Heirat mit einem armen bürgerlichen Kandidaten hatte vergeben wollen. Abhängigkeit irgendeiner Art schien ihm die größte Schmach, weil sie ihm Kränkungen zugezogen, die er nie vergessen konnte, und nur zu leicht mussten er und Eduard sich verständigen, da beide, wenn auch aus ganz verschiedenen Gründen, sich in ihrem Ehrgefühle verletzt, in mancher Rücksicht von der Allgemeinheit ausgeschlossen empfunden hatten.
Wenn Reinhard den halben Tag mit mühevollem Unterrichten zugebracht hatte und mit unerschütterlichem Eifer seinen theologischen Studien nachgekommen war, erquickte ihn abends der Frohsinn, der Geist und der Reichtum an Hoffnungen, mit denen Meier in die Zukunft sah. Im Anfang ihrer Bekanntschaft waren ihre religiösen Überzeugungen freilich oftmals zwischen ihnen zur Sprache gekommen und ein Gegenstand lebhafter Erörterungen geworden. Meier konnte es nicht begreifen, wie man an einen Sohn Gottes, an seine Menschwerdung, an die Dreieinigkeit, an die wirkliche Anwesenheit Christi im Abendmahl zu glauben vermöge – ein Glaube, den Reinhard mit tiefer Überzeugung heilig hielt und den zu lehren und zu predigen sein sehnlicher Wunsch war; denn er gehörte zu jenen poetischen Naturen, die sich alles, was sie ergreifen, zu einer Religion gestalten und bei denen der Glaube an die Wunder ein wahrhaftes Bedürfnis ist. Später aber war davon niemals mehr die Rede zwischen ihnen gewesen, weil sie fühlten, dass der verschiedene Glaube sie beide doch zu demselben Ziele leite, und ein äußeres Ereignis war dazugekommen, sie noch fester zu verbinden.
Es war gegen die Zeit ihres Abgangs von der Universität gewesen, als die Regierung es für nötig befunden hatte, eine Untersuchung gegen die Burschenschaft einzuleiten. Meier und Reinhard waren nebst vielen andern verhaftet, längere Zeit mit Verhören und Untersuchungen geplagt und erst nach einem halben Jahre freigesprochen worden. Meier hatte diese Zeit gezwungener Zurückgezogenheit benutzt, sich für sein Doktorexamen vorzubereiten, das er in den ersten Tagen der wiedererlangten Freiheit gemacht, und war dann in seine Vaterstadt zurückgekehrt, um dort seine Karriere zu beginnen. Zwar war er, wie es zu geschehen pflegte, noch eine geraume Zeit unter der sorgsamen Aufsicht der höheren Polizei geblieben, aber das hatte ihn in der Ausübung seiner medizinischen Praxis nicht gehindert, die er gleich mit dem glücklichsten Erfolge begann. Anfänglich waren es, wie gewöhnlich, nur die Armen gewesen, die seiner Hilfe begehrt und sie bei ihm gefunden hatten, doch das Gerücht von einigen glücklichen Kuren, von seiner Uneigennützigkeit und Menschenliebe hatte sich schnell verbreitet, seine Praxis hatte angefangen, sich auch in den höheren Ständen auszudehnen, und sein Los würde ein beneidenswertes gewesen sein, wenn nicht aufs neue die alten Vorurteile gegen ihn geltend gemacht worden wären.
Meiers sehnlichster Wunsch war nämlich dahin gegangen, Vorsteher irgendeiner bedeutenden klinischen Anstalt zu werden, um lehrend zu lernen und zu nützen. Auf eine solche Stelle an irgendeiner Universität Deutschlands hatte er aber nicht rechnen können, und es war ihm also wünschenswert geworden, wenigstens die Leitung einer Krankenanstalt zu erhalten. Als dann durch den Tod eines alten Arztes die Direktorstelle eines Stadtlazaretts freigeworden, hatte er nicht gezögert, sich darum zu bewerben, besonders da er einer günstigen Meinung im Publikum gewiss gewesen war. Die Vorstellungen der Armenvorsteher und mancher andern Leute hatten die betreffende Behörde auch wirklich dazu vermocht, den jungen geachteten Arzt, dessen Kenntnisse ihn ebenso sehr zu dieser Stelle empfahlen als seine strenge Redlichkeit und seine reinen Sitten, zum Direktor zu wählen und bei der Regierung um seine Bestätigung einzukommen. Meier war auf dem Gipfel des Glücks gewesen, und in der Freude seines Herzens hatte er sich, nachdem er gewählt worden war, anheischig gemacht, auf das immerhin bedeutende Gehalt zugunsten der Lazarettkasse zu verzichten. Einige Wochen waren in frohen Erwartungen hingeschwunden, er hatte die Glückwünsche seiner Freunde empfangen und bereits daran gedacht, seine Wohnung im elterlichen Hause mit der neuen Amtswohnung zu vertauschen, als der Bescheid der Regierung angelangt war, welcher statt der erwarteten Bestätigung die Aufforderung enthalten, Meier möge zum Christentum übertreten, da es ganz gegen die Ansichten der Regierung sei, einem Juden irgendeine Stelle anzuvertrauen. Vergebens waren seine Vorstellungen, wie der Glaube bei einer solchen Anstellung gar kein Hindernis sein könne, wie diese Zurückweisung in den Gesetzen des Staates nirgends begründet sei – die Regierung war bei ihrem Entschlusse geblieben. Man hatte Meier einen unruhigen Kopf genannt; seine Neider, an denen es dem Talentvollen, Glücklichen nie fehlt, hatten über die jüdische Anmaßung gelacht, die sich zu Würden dränge, für die sie nicht berufen sei, und dabei vergessen, dass die Behörden selbst den verspotteten Gegner durch ihre Wahl für den Würdigsten erklärt hatten.
Auf das Empfindlichste gekränkt, hatte Meier schon damals sein Vaterland verlassen wollen; doch die angeborene Liebe zu demselben und der Gedanke an seine Eltern hatten ihn davon zurückgehalten. Er war in der Heimat geblieben, und obgleich er das Unrecht, das ihm geschehen, niemals vergessen oder es verschmerzen konnte, das schöne Feld für seine Tätigkeit verloren zu haben, hatten ihn die Anerkennung, die er fand, der ausgezeichnete Ruf, den er erwarb, endlich schadlos gehalten für die erfahrene Zurücksetzung.
Bei seiner Rückkehr von der Universität hatte er Jenny als ein liebliches Kind von elf Jahren wiedergefunden, das sich mit leidenschaftlicher Innigkeit an ihn hing und für das er eine Zärtlichkeit fühlte, die ebenso viel von der Liebe eines Vaters als eines Bruders besaß. Die Eltern hatten die Kleine niemals aus den Augen verloren und jeden Wunsch des nachgeborenen Lieblings mit zärtlicher Zuvorkommenheit erfüllt. Eduard war überrascht durch den Verstand und den schlagenden Witz des Kindes, er sah, dass ein lebhaftes, leidenschaftliches Mädchen aus demselben werden müsse, konnte sich es aber nicht verbergen, dass die übergroße Liebe seiner Eltern in Jenny eine Herrschsucht, einen Eigensinn entstehen gemacht hatten, dem bis jetzt nur durch seinen Vetter Joseph eine Schranke gesetzt worden war, der, im Meierschen Hause lebend, die Kleine mit seiner ernsten, rauen Art tadelte und zurechtwies. Dafür hatte Jenny den Cousin schon damals nicht leiden mögen und es dem Bruder unter vielen Tränen geklagt, wie garstig der Joseph sei, wie er ihr alles zum Trotze täte und wie sie hoffe, in Eduard einen Beschützer gegen den unliebenswürdigen Cousin zu finden.
Der junge Mann begriff schnell, dass bei Jenny mit Strenge nichts auszurichten sei, und machte sich in der ersten Zeit seiner Anwesenheit selbst zu ihrem Lehrer und Erzieher. Sie lernte fast spielend, ja es schien oft, als läge das Verständnis aller Dinge in ihr, und man dürfe sie nur daran erinnern, um klar und deutlich in ihr Kenntnisse hervorzurufen, die man ihr erst mitzuteilen wünschte. Ebenso wahr und offen als Eduard, wuchs sie diesem von Tag zu Tag mehr ans Herz, und obgleich er gegen die Eltern oft beklagte, dass sich in Jenny zu viel Selbstgefühl und eine fast unweibliche Energie zeigten, obgleich er es Joseph zugestehen musste, dass sich bei ihr die Eigenschaften des Geistes nur zu früh, die des Herzens aber scheinbar gar nicht entwickelten, so fiel es ihm doch schwer, als er nach zwei Jahren den Unterricht derselben aufgeben musste, weil seine zunehmende Praxis ihm keine Zeit mehr dazu übrig ließ.
Eduard drang deshalb darauf, man möge seine Schwester einer Privatschule anvertrauen, die von den Töchtern der angesehensten Familien besucht wurde. Er hoffte, der Umgang und das Zusammenleben mit Mädchen ihres Alters werde bei Jenny die Härten und Ecken, die ihr Charakter zu bekommen schien, am leichtesten vertilgen. Die Eltern folgten seinem Rate, und die neuen Verhältnisse machten in vielen Beziehungen einen günstigen Eindruck auf Jenny. Sie gewöhnte sich, ihrem Witze nicht so zügellos den Lauf zu lassen wie in dem elterlichen Hause, wo man ihre beißenden Einfälle nur lachend getadelt hatte; sie lernte es, sich in den Willen ihrer Mitschülerinnen zu fügen, dem Lehrer zu gehorchen, aber sie fing auch an, sich ihrer Fähigkeiten bewusst zu werden, welche sie in eine Klasse gebracht, in der alle Mädchen ihr im Alter um mehrere Jahre voraus waren. Von einem Umgange, wie Eduard ihn für sie gehofft hatte, war indessen nicht die Rede. Die halberwachsenen Mädchen dieser ersten Klasse mochten sich größtenteils mit dem bedeutend jüngeren Kinde weder unterhalten noch befreunden, das ihnen obendrein von den Lehrern mitunter vorgezogen wurde. Andere, denen Jennys lebhaftes, freimütiges Wesen behagte und die gern mit ihr zusammen waren, konnten von ihren Eltern nicht die Erlaubnis erhalten, die Tochter einer jüdischen Familie einzuladen oder zu besuchen, und zu diesen letzteren gehörte auch Clara Horn. Zwei Jahre älter als Jenny, hatte sie dieselbe unter ihre Vormundschaft genommen, ihr geraten und geholfen, wenn das verzogene Mädchen sich in den strengen Schulzwang nicht zu finden gewusst, und dadurch ihr volles Vertrauen erworben. Ihr hatte Jenny in den Zwischenstunden von ihren Eltern, von ihrem Bruder, von allen ihren Freunden erzählt und damit ihrer Beschützerin eine Vorliebe für die ganze Meiersche Familie eingeflößt. Wenn nun Clara nach solcher Mitteilung ihre kleine Freundin glücklich pries und sie um die Eintracht ihrer Eltern und die Liebe ihres Bruders beneidete, da sie beides entbehrte, wenn Jenny sie dringend bat, zu ihr zu kommen und das alles mit ihr zu genießen, hatte Clara immer verlegen geantwortet, sie dürfe das nicht. Endlich hatte Jenny sie einmal beschworen, ihr den Grund zu sagen, warum sie nicht zu ihr kommen könne. Da hatte Clara ihr mit Tränen erklärt, sie dürfe nicht, weil Jennys Eltern Juden wären und ihre Eltern diesen Umgang niemals gestatten würden. Jenny wurde glühend rot, sprach aber kein Wort und gab nur schweigend der weinenden Clara die Hand. Die nächsten Stunden saß sie so zerstreut da, dass weder Lehrer noch Mitschüler sie erkannten. Sie dachte über Claras Worte nach, und es wurde ihr klar, wie sie allein und einsam in der Schule sei, wie keines von den ihr befreundeten Mädchen sie besuche oder ihre Einladungen annähme, außer bei solchen Gelegenheiten, wo man die ganze Klasse einlud und sie, ohne es zu auffallend zu machen, nicht zurücklassen konnte. Sie erinnerte sich der ewigen Frage, bei wem sie eingesegnet werden würde, und des Lächelns, wenn sie den Namen des jüdischen Predigers nannte. Es schien ihr unerträglich, künftig in diesem Kreise zu leben, und als sie nach Hause kam, warf sie sich weinend den Eltern in die Arme, flehentlich bittend, man möge sie aus der Schule fortnehmen. Alle Tränen, die sie in der Schule standhaft unterdrückt hatte, brachen nun gewaltsam hervor. Eduard kam dazu, und bei der Schilderung, die sie von ihrer Zurücksetzung und Ausgeschlossenheit machte, deren sie sich jetzt plötzlich bewusst geworden war, fühlten ihre Eltern und ihr Bruder nur zu lebhaft, dass sie auch dies geliebte Kind nicht gegen die Vorurteile der Welt zu schützen, ihm nicht die Leiden zu ersparen vermochten, die sie selbst empfunden hatten und nun wieder mit ihm erdulden mussten.
Jenny länger in der Anstalt zu lassen fiel niemand ein, weil man das bei ihrem Charakter fast für untunlich hielt und mit Recht befürchtete, dass ihre Fehler, die man zu bekämpfen wünschte, dort unter diesen Verhältnissen nur wachsen könnten. Man gab also den Besuch der Schule wieder auf, und Jenny sollte wieder zu Hause unterrichtet werden, wobei man aber die Änderung machte, dass man ihr Therese Walter, die Tochter einer armen Beamtenwitwe, zur Gefährtin gab, die in der Nachbarschaft wohnte und mit der sie von früh auf bekannt gewesen war.
Jenny hatte bis dahin für Therese keine besondere Zuneigung gefühlt. Jetzt, getrennt von der Schule, in welcher ihr der Umgang mit Mädchen zum Bedürfnis geworden war, wurde Therese ihr Ersatz für diese Entbehrungen, ja ihr einziger Trost. Es bildete sich dadurch allmählich eine Freundschaft zwischen den beiden Mädchen, die sich sonst wohl niemals besonders nahe getreten wären, da Theresens mittelmäßige Anlagen, ihr ruhiges und stilles Wesen zu Jennys Art und Weise nicht recht passten und sie derselben unterordneten, was aber freilich dazu beitrug, das Verhältnis zu befestigen.
Als es nun nötig wurde, einen Lehrer für die beiden jetzt fast fünfzehnjährigen Mädchen zu wählen, schlug Eduard seinen Freund Reinhard dazu vor, der in sehr beschränkten Verhältnissen noch immer in der Universitätsstadt lebte, in welcher die Freunde einander begegnet waren. Reinhards Bemühungen, nach gemachtem Examen eine Pfarre zu bekommen, waren an dem Einwande gescheitert, den man gegen ihn wegen seiner burschenschaftlichen Verbindungen machte. Ein paar Jahre war er Hauslehrer gewesen, hatte die Stelle aber aufgegeben, weil sein Gehalt zwar für seine Verhältnisse hinreichte, jedoch nicht groß genug war, seiner Mutter die Unterstützung zu gewähren, deren sie bedurfte. Seitdem hatte er durch Unterrichten und durch literarische Tätigkeit für sich und seine Mutter zu sorgen gesucht. Von Eduard Beistand anzunehmen hatte er verweigert, und nur mit Vorsicht konnte derselbe ihm den Vorschlag machen, nach dessen Vaterstadt zu kommen, um den Unterricht der beiden Mädchen unter den vorteilhaften Bedingungen, die man ihm stellte, zu übernehmen.
Eduards Plan gelang. Er sah seinen Freund nach mehrjähriger Abwesenheit wieder und fand in ihm mit großer Freude den alten treuen Gefährten, den er verlassen hatte; doch war er im Denken und Fühlen mannigfach verändert. Ein düsterer Ernst hatte sich seiner bemächtigt. Die Armut hatte ihn stolz, misstrauisch und reizbar gemacht und dadurch die Schönheit seines Charakters beeinträchtigt. Im höchsten Grade streng gegen sich selbst, wahr gegen seine Freunde, glühte er für Recht und Freiheit, hing er mit dem alten schwärmerischen Glauben dem Christentum an, das ihm der Urquell der Wahrheit und der Liebe war. Der günstige Erfolg, den sein Unterricht im Meierschen Hause hatte, verschaffte ihm bald so viele Schüler, dass er den Anforderungen, die in dieser Beziehung an ihn gemacht wurden, kaum genügen konnte, während sie ihm eine sorgenfreie Existenz bereiteten, da der Unterricht in der reichen Handelsstadt ganz anders als in dem kleinen Universitätsstädtchen bezahlt wurde. Er konnte seine Mutter zu sich nehmen, mit der er seine kleine freundliche Wohnung teilte, und die treffliche Frau wurde bald in vielen Familien, besonders aber im Meierschen Hause ebenso geachtet und geliebt als Reinhard selbst. –
Auf Jenny hatte der neue Lehrer einen eigentümlichen Eindruck gemacht. Weil Eduard ihn so hoch hielt, hatte sie im Voraus die günstigste Meinung für ihn gehegt, und als nun Reinhard in ihrem elterlichen Hause vorgestellt worden, hatte ihr sein Äußeres und sein ganzes Wesen auf ungewohnte Weise Beachtung geboten. Weit über die gewöhnliche Größe, schlank und doch sehr kräftig gebaut, hatte er eine jener Gestalten, unter denen man sich die Ritter der deutschen Vorzeit zu denken pflegte. Hellbraunes, weiches Haar und große blaue Augen bei graden regelmäßigen Zügen machten das Bild des Deutschen vollkommen, und ein Ausdruck von melancholischem Nachdenken gab ihm in Jennys Augen noch höhere Schönheit. Er bewegte sich ungezwungen, sprach mit einer ruhigen Würde, für die er fast zu jung schien, doch ließen sich seine große Abgeschlossenheit, seine sichtbare Zurückhaltung nicht verkennen, die er selbst der Freundlichkeit entgegensetzte, mit der man ihn im Meierschen Hause empfing. Therese und Jenny, welche man ihm als seine künftigen Schülerinnen vorstellte, behandelte er mit einer Art Herablassung, die Therese nicht bemerkte, von der aber Jenny, durch die Huldigungen Steinheims und Erlaus bereits verwöhnt, sich so betroffen fühlte, dass sie ganz gegen ihre sonstige Weise sich scheu zurückzog und weder durch Reinhards Fragen noch durch Eduards und der Eltern Zureden in das Gespräch und aus ihrer Befangenheit gebracht werden konnte.
Nach einigen Tagen hatte der Unterricht begonnen, und beide Teile waren sehr miteinander zufrieden gewesen. Reinhard fühlte sich durch die ursprüngliche Frische in Jennys Geist angenehm überrascht, und die ruhige, stille Aufmerksamkeit Theresens machte ihm Freude. Was jene plötzlich und schnell erfasste, musste diese sich erst sorgsam zurechtlegen und klarmachen, dann aber blieb es ihr ein liebes, mühsam erworbenes Gut, dessen sie sich innig freute, während Jenny des neuen Besitzes nicht mehr achtete, wenn er ihr Eigentum geworden war, und immer eifriger nach neuen Kenntnissen strebte. Diese unruhige Eile machte, dass sie sich ihres geistigen Reichtums kaum bewusst ward und sich und andere damit in Verwunderung setzte, wenn sie gelegentlich veranlasst wurde, ihn geltend zu machen.
Für Reinhard war der Unterricht doppelt anziehend. Er hatte wenig Gesellschaften erlebt, wenig mit Frauen verkehrt, und ihr eigentümliches Gemütsleben, die ganze innere Welt desselben, war ihm fremd. Mit erhöhter Begeisterung las er die deutschen Klassiker mit den Mädchen, wenn er Jenny, hingerissen durch die Schönheit der Dichtung, rot werden und ihr Auge in Tränen schwimmen sah. So hatte er ihnen einst das erhabene Gespräch zwischen Faust und Gretchen vorgetragen, das mit den Worten beginnt: ›Versprich mir, Heinrich!‹ und das schönste Glaubensbekenntnis eines hohen Geistes enthält. Reinhard selbst fühlte sich wie immer lebhaft davon ergriffen, und als Jenny bei den Versen: ›Ich habe keinen Namen dafür! Gefühl ist alles. Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsgut!‹ weinend vor Wonne dem Lehrer beide Hände reichte, ihm zu danken, hatte er dieselben schnell und warm in die seinen geschlossen, obgleich er es einen Augenblick später schon bereute.
Infolge dieser Stunde und eines dadurch entsprungenen Gesprächs war Reinhard zu der Erkenntnis gekommen, dass Jenny, obgleich tief durchdrungen von dem Gefühl für Schönheit und Recht und von dem zartesten Gewissen, dennoch in seinem Sinne aller religiösen Begriffe entbehrte. Ihre Familie hatte sich von den jüdischen Ritualgesetzen losgesagt; Jenny hatte daher von frühester Kindheit an sich gewöhnt, ebenso die Dogmen des Judentums als die des Christentums bezweifeln und verwerfen zu hören, und es war ihr nie eingefallen, dass es Naturen geben könne, denen der Glaube an eine positive geoffenbarte Religion Stütze und Bedürfnis sei. Ja, sie hatte ihn, wo ihr derselbe erschienen war, mitleidig wie eine geistige Schwäche betrachtet. Umso mehr musste sie es befremden, dass Reinhard, vor dessen Geist und Charakter ihr Bruder so viel Verehrung hatte, dass ihr Lehrer, der ihr so wert geworden war, einen Glauben für den Mittelpunkt der Bildung hielt, den sie wie ein leeres Märchen, wie eine den wahren Kern verhüllende Allegorie zu betrachten gelernt hatte. Reinhard behauptete geradezu, dass ein weibliches Gemüt ohne festes Halten an Religion weder glücklich zu sein noch glücklich zu machen vermöge. Absichtlich führte er deshalb die Unterhaltung mit seinen Schülerinnen häufig auf christlich-religiöse Gegenstände, so dass in seinem Unterricht Religion und Poesie Hand in Hand gingen, wodurch den Lehren des Christentums ein leichter und gewinnender Einzug in Jennys Seele bereitet wurde.
Ihr und Reinhard unbewusst, war aber mit dem neuen Glauben nur zu bald eine leidenschaftliche Liebe für den Lehrer desselben in des Mädchens Herzen entstanden, für den begeisterten jungen Mann, der ihr wie ein Apostel des Wahren und des Schönen gegenüberstand. Aus Liebe zu ihm zwang sie sich, die Zweifel zu unterdrücken, die immer wieder in ihrem Geiste gegen positive Religionen aufstiegen, und sich nur an die Morallehren zu halten, die dem Gläubigen in dem Christentum geboten werden. Reinhard seinerseits hatte nicht eigentlich daran gedacht, seinem Glauben eine Proselytin zu gewinnen, diese Schwäche lag ihm fern, denn er ließ jeden Glauben gelten, weil er Geltung für den seinen forderte; nur einem dringenden Mangel in dem Herzen seiner Schülerin hatte er abhelfen wollen. Er war überzeugt, dass der Glaube in Jenny den geistigen Hochmut zerstören, ihr Wesen milder machen müsse, und war sehr erfreut, wirklich diese Resultate zu erblicken, ohne zu ahnen, dass ihre weichere Stimmung, die er für das Werk der Religion gehalten, nur eine Folge ihrer Liebe zu ihm war. Jenny fühlte das Bedürfnis, an einen Gott zu glauben, der das Gute jenseits lohne, weil ihr kein Erdenglück für Reinhard ausreichend schien; sie wurde demütiger, aber nicht im Hinblick auf Gott, sondern vor dem Geliebten; und der Gedanke, ihre Liebe könne jemals ein Ende finden oder durch den Tod aufhören, machte sie so unglücklich, dass ihr die Hoffnung auf Unsterblichkeit und ein ewiges Leben wie der einzige Trost dagegen erscheinen musste.
Den Eltern und Eduard blieb die vorteilhafte Veränderung in Jennys Wesen nicht verborgen, und wenn Eduard, was häufig geschah, mit Reinhard über die Schwester sprach, so verfehlte er nicht, es dankend anzuerkennen, wie wohltuend des Freundes Unterricht auf Jenny wirke. Nur Joseph schien die Meinung nicht zu teilen.