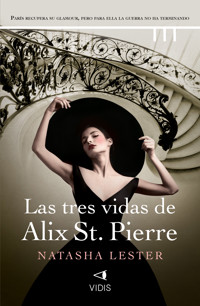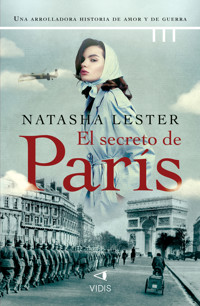9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit die Frauen Farbe tragen.
England, 1918: Obwohl das Tragen roten Lippenstifts noch als skandalös gilt, stellt die junge Leonora in der Apotheke ihres Vaters heimlich Kosmetika her. Als ihr Vater an der Spanischen Grippe stirbt, sucht sie ihr Glück in Amerika und lernt den charmanten Everett kennen – und lieben. Doch um diese Liebe muss sie ebenso kämpfen wie um ihren Traum von einer Kosmetikfirma, denn auch in Manhattan gibt es Widerstand gegen den Wunsch der Frauen, selbst über ihr Aussehen zu entscheiden ...
New York, 1939: Alice, eine aufstrebende junge Ballerina, erhält das Angebot, das Gesicht einer Kosmetikkampagne zu werden – aber warum wollen ihre Eltern ihr das um jeden Preis verbieten?
“Natasha Lester erzählt von Frauen, die den Lauf der Welt verändern.“ Ulrike Renk.
„Eine Liebesgeschichte, die Sie bezaubern wird.“ Woman's Day.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Seit die Frauen Farbe tragen.
England, 1918: Obwohl das Tragen roten Lippenstifts noch als skandalös gilt, stellt die junge Leonora in der Apotheke ihres Vaters heimlich Kosmetika her. Als ihr Vater an der Spanischen Grippe stirbt, sucht sie ihr Glück in Amerika und lernt den charmanten Everett kennen – und lieben. Doch um diese Liebe muss sie ebenso kämpfen wie um ihren Traum von einer Kosmetikfirma, denn auch in Manhattan gibt es Widerstand gegen den Wunsch der Frauen, selbst über ihr Aussehen zu entscheiden.
New York, 1939: Alice, eine aufstrebende junge Ballerina, erhält das Angebot, das Gesicht einer Kosmetikkampagne zu werden – aber warum wollen ihre Eltern ihr das um jeden Preis verbieten?
»Natasha Lester erzählt von Frauen, die den Lauf der Welt verändern.« Ulrike Renk
»Eine Liebesgeschichte, die Sie bezaubern wird.« Woman’s Day
Über Natasha Lester
Natasha Lester war Marketingleiterin bei L’Oréal und verantwortlich für die Marke Maybelline, bevor sie sich entschloss, an die Uni zurückzukehren und Creative Writing zu studieren. Heute lebt sie als Autorin und Dozentin in Perth, Australien, und ist Mutter dreier Kinder. Ihre Romane, in denen es stets um spezifisch weibliche Aspekte der Geschichte geht, sind internationale Bestseller.
Mehr zur Autorin unter www.natashalester.com.au
Christine Strüh übertrug u.a. Kristin Hannah, Gillian Flynn und Cecelia Ahern ins Deutsche. Sie lebt in Berlin.
Anna Julia Strüh übersetzte ihr erstes Buch mit fünfzehn, lebt heute in Leipzig und überträgt auch Lyrik.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Natasha Lester
Die Farben der Frauen
Roman
Aus dem Englischen von Christine Strüh und Anna Julia Strüh
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Teil 2
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Teil 3
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Teil 4
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Nachwort der Autorin
Dank
Impressum
Was würde man nicht darum geben,
zum Anfang zurückkehren zu können,
wieder so zu sein wie damals,
als die Zukunft so frisch und hoffnungsvoll war,
dass es unmöglich erschien,
irgendetwas falsch zu machen?
Therese Anne Fowler, Z – A Novel of Zelda Fitzgerald
Teil 1
Kapitel 1
Sutton Veny, England, November 1918 | Der Behälter in Leonoras Hand enthielt eine Substanz so schwarz wie der Himmel in einer Neumondnacht. Unter den gespannten Blicken ihrer Freundin Joan schraubte sie den Deckel ab.
»Es hat funktioniert!«, rief Leonora aus.
»Probier es aus!«, verlangte Joan.
Leonora befeuchtete einen Finger, rieb ihn über die dunkle Masse, bis eine nasse, schwarze Schicht davon kleben blieb, und trug sie vom Wimpernansatz her zuerst vorsichtig auf. Dann tauchte sie den Finger ein zweites Mal in das Gläschen und verteilte noch etwas mehr von der tags zuvor selbst gemachten Mascara. »Wie sieht es aus?«
»Warte.« Joan nahm den Handspiegel und das Exemplar von Pictures and the Picturegoer, der Zeitschrift, die aufgeschlagen vor ihnen auf dem Arbeitstisch lag, und hielt Leo den Spiegel sowie daneben das Bild von Theda Bara als Kleopatra vors Gesicht.
Lächelnd betrachtete Leo sich – tatsächlich wirkten ihre grünen Augen durch die Tusche größer und strahlender. »Es ist sogar noch besser, als ich es mir erhofft habe. Hier.«
Sie reichte das Gläschen an Joan weiter, die ihre Wimpern auf die gleiche Weise schwärzte.
»Ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich noch ein bisschen Öl dazu, für mehr Glanz«, meinte Leo. »Kleopatras Wimpern blitzen ja richtig.«
»Dafür, dass es die einzige Wimperntusche im Umkreis von mehreren Hundert Meilen ist, finde ich das Zeug aber sehr gut.«
»Jedenfalls würde man nicht auf die Idee kommen, dass es sich einfach nur um eine Kombination aus Seifenflocken und Lampenruß handelt, oder? Ich hab es auch mit Vaseline probiert, aber das ist zu zäh geworden. Die Mixtur hier ist leichter aufzutragen, aber ich glaube, ich kriege es noch besser hin.« Mit einem tiefen Seufzer sah Leo sich in der chaotischen Kammer um und ließ den Blick nachdenklich über den mit allen möglichen Salben, Tinkturen und kosmetischen Experimenten überhäuften Werktisch schweifen. »Vorausgesetzt, ich finde Zeit dafür und kann mich mal um etwas anderes kümmern als um die ganzen Präparate gegen Wundinfektionen …«
Sie seufzte. »Denkst du, wir sind ganz grässliche Menschen? Ich meine, weil wir so oft über Kinofilme und Mascara reden, während …«
»Natürlich nicht!«, unterbrach Joan sie mit Nachdruck, und wie immer, wenn sie sich ereiferte, hörte man ihren australischen Akzent besonders deutlich. »Ich habe zwölf Stunden am Tag versucht, die Männer im Armeelazarett am Leben zu halten, und du hast genau das Gleiche mit deinen Medikamenten gemacht. Ganz zu schweigen davon, dass wir die Moral aufrechterhalten haben – um den Botengang zur Apotheke haben sich die Männer im Lager immer buchstäblich gerissen.«
Leo wurde rot und lenkte schnell ab: »Gehen wir nun ins Kino oder nicht?«
»Ich brauche bloß noch ein bisschen Lippenstift.«
Leo reichte ihr einen Tiegel mit einer glänzenden, roten Creme.
»Du bist ein Schatz. Bestimmt sind die Schwestern hier besser versorgt als die Ladys in London.« Joan tupfte sich Farbe auf den Mund, strich sich die braunen Haare glatt, setzte sich einen dunkelblauen Glockenhut auf den Kopf und nickte zufrieden.
»Was, wenn Mrs Hodgkins uns so sieht?«
»Und wenn schon?«, erwiderte Joan achselzuckend. »Wimperntusche ist nicht verboten.«
»Noch nicht. Aber wahrscheinlich nur, weil niemand versteht, wie dringend wir alle sie benutzen wollen.« Leo deutete auf die Zeitschrift. »Meinst du, ›Theda Bara hat mich dazu gezwungen‹ wäre eine gute Entschuldigung?«
Joan schüttelte lachend den Kopf. »Lass uns gehen. Dann kann ich dir auch meine Neuigkeiten erzählen.«
»Ich schau noch kurz nach Daddy.« Mit einer geübten Handbewegung drehte Leo das Schild mit der Aufschrift Harold East, Dispensing Chemist and Apothecary an der Ladentür um und rannte die Stufen zu der Wohnung hinauf, wo sie mit ihrem Vater lebte.
Harold East saß am Tisch, vor sich die Zeitung, aber er hatte die Brille abgenommen, und seine Augen waren geschlossen. Er wirkte sehr dünn und noch blasser als sonst. Zum tausendsten Mal wünschte Leo sich, sie könnte ihm genügend zu essen besorgen. Für junge Menschen wie sie selbst waren die Rationierungen kein großes Problem, doch ihr Vater war nicht so robust. Der Kummer über den Tod seiner Frau, die im Kindbett gestorben war, setzte ihm schon seit Jahren zu, nun hatten Stress und Entbehrung das Ihre beigetragen und ihn noch schneller altern lassen.
»Daddy«, flüsterte Leo und legte ihm behutsam die Hand auf den Arm.
Ihr Vater zuckte zusammen und riss die Augen auf. »Was ist los?«, fragte er und begann, hektisch nach seiner Brille zu suchen.
Leonora fand sie unter der Zeitung und gab sie ihm, aber er behielt sie in der Hand und blickte seine Tochter an. »Entschuldige, dass ich dich erschreckt habe«, sagte sie sanft. »Es ist nichts passiert, ich bin nur hochgekommen, um mich zu verabschieden. Ich wollte mit Joan einen Film anschauen gehen, erinnerst du dich?«
»Ach, natürlich.« Er strahlte und breitete die Arme aus.
Leo küsste ihn auf den Kopf. »Hast du ein bisschen Brot gegessen?«
»Ich habe sogar den Teller abgeleckt, um auch noch die letzten Krümel zu kriegen«, antwortete er. »Geh nur und amüsier dich. Du verbringst sowieso zu viel Zeit hier mit mir.«
»Wie war es heute Vormittag im Laden?«
»Gut. Ein paar Soldaten sind gekommen und waren sehr enttäuscht, als ich ihnen gesagt habe, du seist leider nicht da. Und du wirst noch mehr von deiner Cold Cream machen müssen, die ist nämlich schon wieder ausverkauft. Mrs Kidd hat mir gesagt, deine Creme sei besser als die von Pond’s.«
»Ich wusste doch, dass sie gut ankommen würde. Vielleicht lässt du mich jetzt ja auch Lippenschminke verkaufen?«
Zwar schüttelte ihr Vater den Kopf, aber er lächelte dabei noch immer. »Stell dir doch mal vor, was Mrs Hodgkins dazu sagen würde!«
Natürlich wusste Leo das nur zu gut – Mrs Hodgkins hatte es sich zur Aufgabe gemacht, für Leos Moralerziehung zu sorgen. Zum Glück hatte ihr Vater die Brille nicht aufgesetzt und konnte ihre geschwärzten Wimpern nicht sehen. »Ich brauche außer dir wirklich niemanden, der mich bemuttert.«
Ihrem Vater traten die Tränen in die Augen, und Leonora wusste, dass er an ihre Mutter dachte, die nicht einmal mehr Gelegenheit gehabt hatte, ihre Tochter im Arm zu halten. »Nun ja«, sagte er, und seine Stimme zitterte ein bisschen, »eigentlich ist es sowieso dein Laden, ich bin ja kaum mehr da, und du solltest einfach verkaufen, was du möchtest. Und jetzt gehe ich ins Bett, Liebes. Ich bin fix und fertig.«
Leo sah ihm nach, wie er davonschlurfte und sich dabei ein paarmal an der Wand abstützte. Dann rannte sie die Treppe wieder hinunter.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte Joan.
Leo schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht recht – mir kommt es vor, als raube der Krieg ihm allmählich alle Kraft. Er macht einen noch zerbrechlicheren Eindruck als sonst.«
»Kann ich irgendwie helfen?« Joan drückte ihre Hand.
»Nein«, antwortete Leo fest und wischte sich die Tränen aus den Augenwinkeln. »Gehen wir.«
So machten sie sich auf den Weg die High Street hinunter, wo Leo Mr Banks zuwinkte, der zweimal hinschauen musste, den Gruß dann aber fröhlich erwiderte. Leos Schultern entspannten sich etwas. Es war schön, auszugehen und eine kurze Zeit zu vergessen, was aus der Welt geworden war. Es fühlte sich gut an, ihrem Gesicht ein bisschen Farbe zu geben und damit ein Gegengewicht zu ihrem Kleid zu setzen, das schon vier Jahre alt, zu einem schmutzigen Grau verblasst und so oft geflickt worden war, dass es sich fast anfühlte, als bestünde es mehr aus Stopfgarn denn aus Stoff. Und es war schön, mit Joan zu lachen, statt ständig nervös auf die neueste Nachricht zu warten, wer von den Männern aus dem Dorf noch gestorben war.
Ihre Schritte raschelten in den Ulmenblättern, die in diesem Herbst ebenso schnell auf die Straße fielen, wie neue Grabsteine auf dem Friedhof auftauchten, und als Leo gerade den Mund aufmachte, um Joan nach ihren Neuigkeiten zu fragen, kam eine Gruppe von Soldaten auf sie zu. Soldaten gehörten ebenso wie die australischen Krankenschwestern und das Armeelager mit seinen langen Reihen identischer Hütten und dem Lazarett, in dem Joan arbeitete, für Leo inzwischen so sehr zum Alltag, dass sie sich kaum noch daran erinnern konnte, wie das Dorf vorher ausgesehen hatte. Wie zum Trocknen ausgebreitete Stofftaschentücher waren in der Ferne die weißen Zielscheiben der Schießanlage auszumachen, und ein Doppeldeckerflugzeug machte sich bereit, auf der Wiese neben dem Lager zu landen. Unwillkürlich zog Leo den Kopf ein – Dingen, die vom Himmel fielen, traute sie lieber noch nicht.
Joan packte ihre Hand. »Schnell«, zischte sie. »Da drüben ist Mrs Hodgkins, und wenn wir nicht ganz schnell verschwinden, wird sie dich entdecken.«
Da die ihnen entgegenkommende Soldatengruppe so groß war, dass viele Dorfbewohner, die in die entgegengesetzte Richtung unterwegs waren, stehen bleiben mussten, bot sie Joan und Leo eine gute Möglichkeit, unerwünschten Blicken zu entgehen.
»Leonora!«
Als sie ihren Namen hörte und den Kopf hob, blickte Leo in das vertraute Gesicht eines jungen Mannes in Uniform, den sie schon ihr ganzes Leben als »Albert von Gray’s Farm« kannte. Bei seinem letzten Fronturlaub hatte er sie zu einem Spaziergang und ins Kino eingeladen, und als er zum Abschied ihre Hand küsste, hatte Leonora den Atem angehalten und auf den Blitzschlag gewartet, der Verliebte in Büchern immer traf, wenn sie einander berührten. Aber sie hatte nichts empfunden – außer dem Wunsch, anderswo zu sein. Wieder in London vielleicht, wo sie vor dem Krieg drei Jahre studiert und bei ihrer Rückkehr eine Sehnsucht mitgebracht hatte, die sich nicht ansatzweise dadurch zufriedenstellen ließ, dass sie von der Apotheke einen kleinen Schwarzhandel mit Lippenstift für die Schwestern im Lazarett betrieb.
Diesmal griff Albert nicht nach ihrer Hand. »Was hast du denn mit deinem Gesicht gemacht?«, fragte er entsetzt, als er ihre schwarz getuschten Wimpern sah.
Im Nu verpuffte die Freude, die Leo bis gerade eben empfunden hatte.
Ja, was hatte sie denn gemacht? Während Männer in den Kampf zogen, um ihr Vaterland zu retten, hatte sie Wimperntusche hergestellt. Plötzlich war es ihr unendlich peinlich, dass sie sich derart frivol benahm.
»Du siehst aus wie eine …« Gerade rechtzeitig brach er ab. »Du machst dich lächerlich, Leonora. Was wird dein Vater dazu sagen?«
Das war die schlimmste aller Fragen, die Albert hätte stellen können. Ihre eigene Scham konnte Leo ertragen, aber nicht die ihres Vaters.
»Entschuldige uns«, mischte Joan sich knapp, aber energisch ein, nahm Leos Arm und zog sie mit sich ins Palace Cinema. Dort suchte sie zwei Plätze ganz vorn, in sicherem Abstand von den Soldaten, die sich meist lieber in die hinteren Reihen verkrümelten.
Als Leo sich gesetzt hatte, kehrte auch ihr Mut zurück. »Also ehrlich, warum muss man denn wegen ein bisschen Schminke so ein Theater machen?«, fragte sie, verärgert, dass Alberts Bemerkung sie so getroffen hatte. »Für einen Mann ist es in Ordnung, wenn er sich … zum Beispiel bei einer französischen Prostituierten – die, nebenbei bemerkt, wahrscheinlich jede Menge Lippenstift trägt – wer weiß wie viele Krankheiten holt, aber eine Frau darf sich nicht ganz harmlos die Wimpern dunkel färben?«
»Beachte ihn einfach nicht.« Joan zündete sich eine Zigarette an und hielt ihrer Freundin das Päckchen hin, aber Leo schüttelte den Kopf. »Du siehst einfach so hübsch aus, dass er Angst gekriegt hat.«
»Glaubst du, die Leute werden eines Tages aufhören, sich vor so etwas zu fürchten?«, überlegte Leo. »Glaubst du, Mrs Hodgkins wird irgendwann nicht mehr darüber jammern, dass die Schwesternuniformen nicht ordentlich über die Knöchel reichen? Und Mr Ellis wird mich nicht mehr ermahnen, doch bitte den Lärm abzustellen, wenn er in die Apotheke kommt und ich statt ›Oh! It’s a Lovely War‹ einen Bluessong von Marion Harris auf der Victrola höre?«
»Wahrscheinlich wird das noch eine Weile dauern«, räumte Joan ein.
Auf der Leinwand begann die Wochenschau, das Licht im Saal wurde schummrig. Leo hatte es sich gerade auf ihrem Platz bequem gemacht, als ihr plötzlich ein Gedanke kam. »Warum ist Albert wieder da?«, flüsterte sie. »Und so viele andere Soldaten auch?«
»Die haben heute Morgen ein ganzes Regiment zurückgeschickt«, antwortete Joan, ohne auf die tadelnden Blicke der Umsitzenden zu achten. »Genau das wollte ich dir erzählen. Pete hat geschrieben, er würde in ein paar Tagen hier sein.«
»Ach, wirklich?«
Leos Bemerkung wurde mit einem lauten »Psssst« quittiert.
»Vielleicht ist der Krieg bald vorbei«, fügte sie flüsternd hinzu.
»Ja, vielleicht.«
Leo grinste. »Wenn es so wäre, würde ich mitten im Kino anfangen zu tanzen.«
»Pete möchte mit mir nach New York ziehen, wenn er entlassen ist. Stell dir nur vor!«
»New York! Aber was ist mit Sydney?«
»Pssssst!« Inzwischen beschwerten sich immer mehr Zuschauer.
»Ich erzähl dir alles nach dem Film«, flüsterte Joan.
So wandten sie sich wieder der Leinwand zu, aber Leo konnte sich nicht richtig konzentrieren. Vor ihrem inneren Auge sah sie New York, die legendäre Stadt, diesen Ort voller Liebe und Hoffnung. Und voller Wolkenkratzer, die – tief im Boden fundiert, jedoch weit in den Himmel emporgereckt – wie Sinnbilder dafür waren, dass hier auch hochfliegende Träume Wirklichkeit werden konnten, wenn sie nur über eine feste Grundlage verfügten. Falls der Krieg wirklich fast überstanden war, würde vielleicht doch die Zukunft kommen, und das Leben könnte wieder beginnen, nachdem es so lange ins Stocken geraten war. Was würde sie dann wohl machen?
Während der kurzen Vorfilme, des Hauptfilms und auch, als sie wieder draußen auf der Straße waren, blieb das Lächeln auf Leos Gesicht. Es verschwand nicht einmal, als ein Soldat ihr nachpfiff. War es nicht wundervoll, dass sie hier war, dass der Soldat noch lebte und dass sie flirten konnten?
»Hast du Ja gesagt?«, fragte Leo, als sie losmarschierten, und hakte sich bei Joan unter. Gegen den Novemberwind, der ihnen trotz Mantel und Handschuhen gnadenlos zusetzte, schlugen sie einen forschen Schritt an. »Zu New York?«
»Aber klar hab ich Ja gesagt. Und du solltest mitkommen.«
»Das geht nicht«, erwiderte Leo. »Daddy würde die Reise wahrscheinlich nicht überleben, und von mir im Stich gelassen zu werden, noch viel weniger.«
»Joan!«, rief eine Stimme hinter ihnen. Die beiden jungen Frauen wirbelten herum, direkt in den Wind, der mächtig aufgefrischt hatte und richtig wehtat im Gesicht.
Eine von Joans Kolleginnen holte sie ein. »Du musst sofort zurückkommen, Joan«, keuchte sie.
»Was ist denn los?«, fragte Joan.
»Die Spanische Grippe«, stieß die Schwester finster hervor.
Die unheilvollen Worte hallten durch die Nacht. Joan verschwand in der Dunkelheit, und Leo stand allein und frierend im eisigen Wind.
Influenza. Nicht schon wieder! Nicht ausgerechnet jetzt, da die Soldaten zurückkamen und der Krieg fast vorbei war. Im Frühling hatten sie die Seuche schon einmal durchgemacht, sowohl Leo als auch Joan hatten volle zwei Wochen im Bett gelegen. Aber aus den Städten und Dörfern, in denen die Grippe bereits zugeschlagen hatte, waren ihr Gerüchte zu Ohren gekommen, dass die jetzige womöglich noch schlimmer war.
Unfähig, die Sorge zu verdrängen, die sich in ihrem Inneren breitmachte, eilte sie im Sturmschritt nach Hause. Noch bevor sie Mantel, Mütze und Handschuhe ablegte, schlich sie den Korridor entlang zum Zimmer ihres Vaters und öffnete seine Tür einen Spaltbreit. Als sie ihn im Bett liegen sah und laut schnarchen hörte, konnte sie lächelnd mit ihrem Mantel auch ihre Angst abstreifen.
***
Am nächsten Morgen wachte sie früh auf und ging nach unten in die Kammer hinter dem Laden. Wenn die Influenza im Armeelager angekommen war, stand ihr ein arbeitsreicher Tag bevor, also vergewisserte sie sich, dass genügend Salbe zum Einreiben der Brust und reichlich Hustensaft vorhanden waren. Erst dann nutzte sie die stille Zeit am frühen Morgen dafür, die Trittleiter herauszuholen, um ans oberste Regalbrett zu gelangen, wo die Bücher ihres Vaters standen. Chemie- und Biologielehrbücher – dicke Wälzer mit langen, unbekannten Wörtern, aber Leo hatte entdeckt, dass sie, wenn man sich ein bisschen Zeit nahm, um sie kennenzulernen, zu den bezauberndsten Wörtern der englischen Sprache gehörten. So war beispielsweise »Petrolatum« eine geschmeidige und wasserabstoßende Mixtur aus Kohlenwasserstoffen – auch bekannt als »Vaseline« –, aber wenn man Lampenruß hinzufügte, bekam man Wimperntusche. Behutsam strich Leo mit dem Zeigefinger über die Buchrücken und hielt inne, als sie zu ihren Schätzen kam: eine emaillierte Puderdose von Fabergé, in der sich eine Puderquaste aus Schwanendaunen befand, und ein Lalique-Fläschchen in Form einer Libelle, das Coty-Parfüm enthielt. Das waren Leos wertvollste Besitztümer, denn die Sachen hatten ihrer Mutter gehört, und Leo wünschte sich sehr, ihre Kosmetika in etwas ähnlich Hübsches abfüllen und in einem Laden reihenweise in die Regale packen zu können. Entschlossen stieg sie die Leiter wieder hinunter. Vorausgesetzt, die Influenza würde doch nicht so schlimm werden – und in diesem Augenblick, im blassgoldenen Licht eines Herbstmorgens, konnte sie sich nichts wirklich Schlimmes vorstellen –, würde sie ihre Lippenschminke im Laden anbieten, statt immer nur mit ihrem Vater Scherze darüber zu machen. Wen kümmerte es denn, was Mrs Hodgkins dazu sagen würde!
Sie nahm einen Topf und einen Holzlöffel – ihre Version eines Mischkessels –, erhitzte Bienenwachs, Karmin, Mandelöl, Rote-Bete-Saft und Rosenöl, rührte alles um, bis es die richtige Rotschattierung besaß, und goss die Mischung zum Festwerden in kleine Gläschen – ein Hauch von Schönheit mitten in dem Grauen, in dem sie lebten.
Dann ging sie wieder nach oben. »Daddy?«, rief sie.
»Ich hab heute ein bisschen länger geschlafen, Liebes«, ertönte seine Stimme aus seinem Zimmer. »Bin gleich da.«
Leo kochte zwei Eier, schnitt zwei Scheiben Brot ab und goss kochendes Wasser auf jeweils einen halben Löffel Teeblätter. Zwar mochte ihr Vater seinen Tee lieber mit drei ganzen Löffeln, aber Tee war in den letzten Tagen ebenso Mangelware geworden wie gute Neuigkeiten.
Als ihr Vater endlich erschien, ließ er sich schwer auf seinen Stuhl sinken. Er zitterte am ganzen Leib.
»Dir ist kalt!«, rief Leo. »Warte, ich hol dir schnell eine Wolldecke.«
»Ach, das ist doch nicht nötig. Wenn ich meinen Tee getrunken habe, ist alles wieder gut.«
Leo reichte ihm seine Tasse. »Dann trink«, sagte sie gespielt streng. »Und ich mach dir gleich noch einen.«
»Du bist ein gutes Mädchen, Leo. Wie war denn dein Abend gestern?«
»Ich bin Albert begegnet. Sein Regiment ist zurück.«
»Vermutlich hat er sich gefreut, dich zu sehen«, meinte ihr Vater in einem Ton, den Leo nicht deuten konnte.
»Ich weiß nicht. Ich hatte mir die Wimpern getuscht, und er war ein bisschen schockiert.«
»Pffft!«, spottete ihr Vater. »Er war im Schützengraben und ist schockiert von ein bisschen schwarzem Zeug auf deinen Wimpern? Dann ist er nicht der Richtige für dich. Keiner von diesen Jungs ist der Richtige!«
»Du bist eben mein Vater und willst mich beschützen«, neckte sie ihn.
»Aber nein«, widersprach er entschlossen. »Er wird dir einen Heiratsantrag machen, warte nur. Aber du musst ablehnen, du willst doch nicht hier hängen bleiben. Sobald der Krieg vorbei ist, werde ich eine Möglichkeit finden, wie du zurück nach London kannst, du wirst schon sehen.«
»Ich gehe aber nicht weg von dir, da kannst du sagen, was du willst.«
Das Läuten der Kirchenglocken unterbrach sie. »Es ist doch nicht Sonntag!«, rief Leo verwundert.
Sie rannte zum Fenster und riss es trotz der kalten Luft, die hereinströmte, weit auf.
Die Glocken bimmelten unermüdlich weiter, die Menschen strömten aus ihren Häusern. Zuerst erkannte Leo das Geräusch gar nicht, das sie hervorbrachten, so fremd war es ihr geworden. Aber dann merkte sie, dass die Menschen lachten.
»Was ist los?«, rief sie zu Mr Banks hinunter, der vor seiner Anwaltskanzlei nebenan stand und strahlte.
»Der Krieg ist vorbei!«, antwortete er.
Leo sauste zu ihrem Vater und umarmte ihn so fest, dass er zu husten begann. »Es ist vorbei!«, rief sie.
Auch er lachte und klatschte in die Hände. »Na los, Leo, steh hier nicht rum, raus mit dir!«
Sie wischte ihm die Freudentränen mit ihrem Taschentuch vom Gesicht, dann rannte sie die Treppe hinunter und nach draußen, in der Hoffnung, Joan zu sehen und mit ihr auf der Straße tanzen zu können. Doch es war nahezu unmöglich, sich vorwärtszubewegen, denn bei jedem Schritt wollte ein anderer Soldat ein paar Schritte mit ihr tanzen. Einer versuchte sogar, sie zu küssen, und sie ließ es zu, denn es war ein Tag, an dem Anstandsregeln unwichtig geworden waren.
»Danke«, rief er und grinste sie an, bevor er weiterlief.
An diesem Morgen spielte der ganze Ort verrückt, die Kirche war voller Menschen, die Gott dankten, der Besitzer des Woolpack Hotel überreichte jedem, der vorbeikam, einen Krug Bier, die Polizisten ignorierten solche offenkundigen Regelverstöße – sogar die Bäume schienen mitzufeiern und ließen Blätter auf Leos rotgoldene Haare herabschweben, wie um sie und auch all die anderen Dorfbewohner zu segnen, die sich zu der spontanen Feier auf der High Street zusammengefunden hatten.
Leo trank ihr Bier und wollte sich gerade in einen improvisierten Kreistanz einreihen, als jemand sie auf die Schulter tippte. »Miss, meine Mum braucht was für ihren Husten.«
Die Worte waren wie ein Schlag ins Gesicht, und Leo wurde plötzlich klar, dass sie Joan nicht gesehen hatte und dass sich überhaupt nur sehr wenige Krankenschwestern in der Menge befanden. Aber so viele Soldaten waren gekommen – es konnte also nicht zu ernst sein mit der Influenza. Trotzdem hatte sie ein unbehagliches Gefühl. »Ich komme«, versprach sie dem Jungen, der vor ihr stand.
Als sie sich auf den Rückweg machte, begann es zu regnen. Im Nu war ihr Rock schlammbespritzt und schwer von Schmutz und Feuchtigkeit. Zurück im Laden, gab sie dem Jungen die Medizin für seine Mutter, fragte nach den Symptomen und runzelte die Stirn, weil er von Fieber, Husten und Kopfschmerzen berichtete. Nachdem er weg war, rannte Leo wieder nach oben zu ihrem Vater, der noch immer so am Tisch saß, wie sie ihn verlassen hatte.
»Die Influenza ist wieder ausgebrochen«, erklärte sie ihm ohne lange Vorrede. »Ich würde es nicht ertragen, wenn du dich angesteckt hättest.«
»Ach, jetzt mach dir mal keine Sorgen«, entgegnete ihr Vater. »Ich bin bald wieder auf dem Damm. Aber ich lege mich vielleicht ein bisschen hin, bis der Tee meine Gelenke wieder in Schwung gebracht hat.«
Nachdem sie ihren Vater wohlbehalten in sein Zimmer gebracht hatte, kehrte Leo in die Apotheke zurück. Der Kundenstrom riss nicht ab, aber es wurde nie hektisch. Ein paarmal Husten und Fieber, aber schließlich war es ja Herbst. Um sechs schloss sie den Laden, machte wieder Eier und Toast für ihren Vater und ging zu Bett. Doch schon um fünf Uhr erwachte sie von einem lauten Klopfen an der Ladentür. Sie erschrak und zog sich hastig an, denn sie wusste, wenn jemand so früh kam, suchte er Hilfe für einen Schwerkranken.
»Was ist los?«, fragte ihr Vater aus seinem Zimmer.
»Nur ein Kunde, dessen Uhr falsch geht.« Sie gab sich alle Mühe, unbesorgt zu klingen, als wäre es nur ein bisschen lästig, in der Morgendämmerung aufstehen zu müssen.
Aber vor der Tür stand nicht nur ein Kunde, sondern eine ganze Schlange wartete dort bereits. Die Gesichter wirkten seltsam benommen und verwirrt – als fragten sie sich, wie es sein konnte, dass sie den gnadenlosen Krieg besiegt hatten und sich nun plötzlich ein anderer, der womöglich ebenso brutal war, auf ihrer Schwelle eingefunden hatte. Und alle wollten genau das, was Leo nicht hatte: ein Heilmittel. Ein Wunder. Einen Ausweg aus der Hölle, in die diese Welt sich verwandelt hatte.
In der Zeit zwischen gestern und heute hatte die Influenza die Hand ausgestreckt und alle Menschen, die sich in ihrer Reichweite befanden, an der Gurgel gepackt. Und sie war nicht bereit, loszulassen.
Den ganzen langen Tag tat Leo ihr Bestes, mischte Hustensalbe und verteilte sämtliche Stoffmasken, die sie noch hatte, ohne einen Pfennig dafür zu verlangen. Der schlimmste Moment war der, als die Frau des Bäckers mit wilden Augen hereinrannte und rief, ihr Mann sei blau angelaufen. Leo wusste, dass in einem solchen Fall das Ende bevorstand, denn die blaue Haut war ein unverwechselbares Zeichen dieser Grippe. Leo konnte nichts für ihn tun.
»Bleiben Sie bei ihm«, flüsterte Leo und nahm die Frau einen Moment in den Arm.
Doch dann kam die Nachricht, dass Albert – Albert, der nie etwas Unrechtes getan hatte – ebenfalls der Krankheit erlegen war.
Danach bemühte sich Leo, ihre Gedanken zu unterdrücken, und konzentrierte sich nur noch darauf, den Menschen zu helfen, denen sie helfen konnte. Sie riet allen, sich häufig die Hände zu waschen, Bettzeug und Taschentücher ordentlich zu reinigen und im Haus zu bleiben. Bis zum Nachmittag gab es sowieso keinen Grund mehr, nach draußen zu gehen. Die meisten Läden, die Kirche, das Palace Cinema, das Woolpack Hotel – alles war geschlossen. Der Waffenstillstand würde nicht mehr gefeiert werden. Stattdessen würde ihr vom Krieg bereits dezimiertes Fünfhundertseelendorf weitere Tote begraben.
Als die Nacht hereinbrach, eilte Leo nach oben zu ihrem Vater. Eigentlich erwartete sie, ihn in Gesellschaft einer Kanne Tee am Tisch vorzufinden, aber die Wohnung war dunkel. Er war doch nicht etwa schon schlafen gegangen?
Dann hörte sie ein Geräusch. Ein bellendes Husten. Leo riss die Tür zu seinem Zimmer auf. »Geht es dir gut? Ich dachte, ich höre …« Sie brachte den Rest nicht über die Lippen.
»Ich habe Fieber«, krächzte ihr Vater.
Schwarze Angst ergriff Leonoras Herz. »Alles wird gut«, sagte sie und wollte aufmunternd klingen, verfehlte ihr Ziel aber bei Weitem. »Ich mache dir eine Brühe.«
»Nein, ich schlafe mich erst mal aus.« Seine Augen schlossen sich, aber statt friedlich einzuschlafen, rasselten seine Lungen bei jedem mühsamen Atemzug.
Leo holte einen Lappen und eine Schüssel mit Wasser, setzte sich ans Bett ihres Vaters und kühlte seine Stirn. Sie rieb ihm den Rücken, als ihn ein Hustenanfall schüttelte, hielt ihm die Schüssel zum Ausspucken hin, wusch sie aus, und kam gerade rechtzeitig für den nächsten Krampf zurück. Weil er nassgeschwitzt war, wechselte sie seine Bettwäsche. Zwischendurch wurde er immer wieder ruhiger, während sie auf der Stuhlkante kauerte und vor Anspannung an ihrem Rock herumzerrte. Dann überfiel ihn erneut der Husten – lange, schrecklich lange, es fühlte sich an, als daure der Anfall Stunden. Leos Vater klammerte sich an sie, als wäre er ihr Kind, sie hielt seine Hand und versuchte, ihn in den Schlaf zu singen, wie es eine Mutter getan hätte.
***
Der Morgen dämmerte schon, als sie registrierte, dass sie nur noch das Krähen der Hähne und das Klappern der Milchwagen hörte. Die Erleichterung darüber, dass ihr Vater tatsächlich aufgehört hatte zu husten, machte sie benommen, das Zimmer drehte sich vor ihren Augen. Doch sie atmete tief und langsam, bis es allmählich wieder zum Stillstand kam. Im ersten Morgenlicht, das unter den Vorhängen hervorkroch, konnte sie nur die Umrisse ihres Vaters erkennen, der allem Anschein nach friedlich und entspannt auf der Seite lag.
Auf Zehenspitzen verließ Leo das Zimmer. Sie würde ihm Porridge kochen, solange er noch schlief, der Haferbrei würde ihn wärmen und ihm neue Kraft geben. Sogar etwas von ihrem kostbaren Zucker streute sie hinein. Als der Brei dampfte, trug sie ihn den Korridor hinunter, ganz sicher, dass ihr Vater ihn bereits gerochen hatte und hungrig auf dieses unerwartete Festmahl wartete.
Aber er hatte sich nicht gerührt.
»Daddy? Ich hab Porridge für dich gemacht.«
Keine Reaktion.
»Daddy!«
Bestimmt könnte sie an sein Bett gehen, seine Schulter berühren und zusehen, wie er aufwachte und nach seiner Brille tastete. Oder sie könnte bleiben, wo sie war, in einem Raum außerhalb der Zeit. Sie konnte verhindern, dass die Zukunft kam, sie brauchte nur lange genug zu warten. Eine Träne fiel in den Porridge. Und noch eine.
Sie schüttelte den Kopf und konnte es nicht glauben. Entschlossen marschierte sie die Treppe hinunter, zur Haustür hinaus und klopfte bei Mr Banks.
Als der Anwalt öffnete, war von dem ganzen Mut, den Leo zusammengenommen hatte, nichts mehr übrig. Stumm, mit tränennassen Augen und geballten Fäusten stand sie da.
»Was ist los?«, fragte Mr Banks.
»Mein Vater«, stammelte sie. »Influenza.«
»Oh, Leo.« Mr Banks nahm sie in den Arm, und sie ließ es starr mit sich geschehen, obwohl sie eigentlich am liebsten zusammengebrochen wäre. Aber das hätte alles nur real werden lassen.
»Ich schaue nach ihm«, bot Mr Banks ihr an.
Leo nickte, folgte ihm zurück in die Wohnung und wartete in der Küche, während er ins Zimmer ihres Vaters ging. Auf einmal merkte sie, dass sie den Herd angelassen hatte und der Wasserkessel pfiff. Und dass ihr Vater nicht gekommen war, um ihn abzustellen. Zäh schlurften die Minuten voran.
Dann kam Mr Banks zurück. Stumm schüttelte er den Kopf.
Leo fühlte sich, als hätte ihr jemand ein Messer in den Bauch gestoßen.
Sie rannte ins Schlafzimmer und zog das Laken weg, mit dem Mr Banks das Gesicht ihres Vaters bedeckt hatte. Dieses kostbare Gesicht, das ihr vertrauter war als ihr eigenes, war über Nacht verschwunden, war kalt und fahl geworden. Und sein Mund – er war weit aufgerissen, als habe er im Moment seines Todes nach ihr gerufen. Doch sie hatte ihn nicht gehört, und nun würde sie nie erfahren, was er hatte sagen wollen.
Den ganzen Tag saß sie neben ihrem Vater, wortlos, tränenlos, und hielt seine kalte Hand. Überall aus dem Dorf glaubte sie das Husten zu hören, das auch ihren Vater getötet hatte. Sie schob die Bibel weg, die jemand ihr in die Hand drücken wollte. Sie war nur wütend. Wer brauchte diesen nutzlosen Gott, der ihr, ihrem Vater und all den anderen Menschen so etwas antat? Sie beschimpfte ihn mit allem, was ihr in den Sinn kam, schlimme Worte, die sie zum Teil noch nie benutzt hatte.
Dann kamen sie, um die Leiche ihres Vaters wegzubringen. »Nein!«, kreischte sie und sprang auf. »Ihr könnt ihn mir doch nicht einfach wegnehmen!«
»Du musst ihn gehen lassen«, versuchte Mr Banks sie zu beschwichtigen und nahm sie wieder fest in den Arm, damit sie die Männer, die ihren Vater aus dem Bett hoben, nicht daran hindern konnte.
»Wie denn?«, flüsterte Leo. »Wie kann ich ihn jemals gehen lassen?«
Erst als ihr Vater nicht mehr da war, begannen ihre Tränen zu fließen – sie fielen auf das nun für immer leere Bett.
Kapitel 2
Tod und Stille. Später erinnerte sich Leo an nichts anderes von den nächsten drei Monaten. Tote Blätter, die nicht von der Straße geräumt wurden und einfach verrotteten. Schweigsame Kunden mit starrem Blick, zu erschöpft, um Konversation zu machen. Der braune Schneematsch, der die Welt aller Farbe beraubte. Und ein Lied, das Einzige, das Leo hörte:
I had a little bird
Its name was Enza
I opened the window
And in flu enza
Dieses Lied, zu dem die Kinder gerne seilhüpften, hallte durch die Straßen, und Leo ging die Melodie nicht mehr aus dem Kopf. Sie hatte keine Gelegenheit gehabt, in Ruhe zu trauern, denn die Menschen brauchten die Apotheke. So verteilte sie von November bis Januar Masken und Salben und ließ ihre Nachbarn an ihrer Schulter weinen, wenn wieder ein Freund oder Angehöriger dem grässlichen blauen Tod zum Opfer gefallen war. Unterdessen wartete ihre eigene Trauer geduldig irgendwo in ihrer Magengrube.
Bis die Grippe irgendwann tatsächlich nachgab. Bis der Kundenstrom dünner wurde und Leo lange, schreckliche Momente des Nichtstuns aushalten musste, in denen ihr in der Umgebung plötzlich noch mehr Zeichen der Resignation auffielen: zum Beispiel die dicke Staubschicht auf den Regalen, die ihr Vater selbst gebaut und jeden Tag abgestaubt hatte. Man braucht keine Tearooms oder Leihbibliotheken wie bei Boots, wenn man selbst saubere Regale hat. Leo hörte die Stimme ihres Vaters so klar und deutlich, als stünde er vor ihr, doch wenn sie sich umsah, erinnerte sie sich plötzlich wieder daran, dass er tot war und die Zeit sich gnadenlos vor ihr erstreckte, leer, ohne ihn.
Eines Tages im Februar fanden Mr Banks und Joan, die fast jeden Tag vorbeikam, um nach Leo zu sehen, sie weinend auf dem Boden sitzend vor. Sie hatte einen Kistenstapel umgestoßen, Glasbehälter waren auf dem Boden zu Bruch gegangen und hatten ihren Inhalt in die Gegend gespritzt, rot wie frisches Blut.
»Bist du verletzt?«, fragte Joan, als sie die rote Pfütze sah.
»Es ist bloß Lippenfarbe«, sagte Leo.
»Gott sei Dank.« Mr Banks streckte ihr die Hand entgegen, um ihr beim Aufstehen zu helfen.
»Ich hab sie an dem Morgen damals im November gemacht«, erklärte Leo stockend. »Als ich noch dachte, die Grippe würde nicht so schlimm werden. Ich wollte die Gläschen ins Fenster stellen und zum Verkauf anbieten. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich an so was gedacht habe, wo ich doch besser …«
Joan nahm sie in den Arm. »Du konntest es nicht wissen«, sagte sie eindringlich. »Und es ist nicht deine Schuld.«
»Aber ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich noch lebe, wo so viele andere tot sind. Du etwa nicht?«
»Dein Vater wäre sehr froh, dass du noch hier bist, Leo«, sagte Mr Banks. »Wofür hätte er denn sonst gelebt?«
»Ich weiß es nicht«, flüsterte Leo und ließ den Blick ratlos über das Chaos schweifen, das sie angerichtet hatte: über den Staub, die überall herumstehenden Kisten, das nicht aufgerollte Verbandsmaterial, den schmutzigen Herd, die unverschlossenen Flaschen. Nichts war mehr wie früher. Nichts. »Ich muss aufräumen«, stieß sie dann abrupt hervor. »Ich brauche Staubtücher, Besen, Wischmopp, Eimer.«
»Jetzt sofort?«, fragte Mr Banks zweifelnd.
»Wir helfen dir«, meinte Joan.
Nicht einmal fünfzehn Minuten später waren sie schon am Schuften. Nachdem Leo die Regale ausgewischt hatte, packte sie die Kisten aus, Mr Banks stellte alles ordentlich in Reihen hinein, und Joan schrubbte den Herd. Als Letztes kam der Boden an die Reihe – Mr Banks fegte, Leo und Joan wienerten ihn mit Bürsten.
Als Leo dabei war, das letzte bisschen Lippenfarbe aufzuwischen, meinte sie nachdenklich: »Stellt euch doch mal vor, was Mrs Hodgkins sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir mit unseren lockeren Sitten sogar den Boden mit Lippenstift bearbeiten.«
Joan sah zu ihr hinüber und grinste, und Leo erwiderte ihr Lächeln, doch dann prustete sie plötzlich los, krümmte sich vor Lachen, hielt sich die Seiten und bekam kaum noch Luft. Joan stimmte ein, bis Mr Banks den Kopf aus dem Hinterzimmer hereinstreckte und rief: »Ich hab anscheinend einen guten Witz verpasst«, woraufhin Leo nur noch mehr lachen musste.
Schließlich wischte sie sich die Augen trocken und setzte sich auf den nun sauberen Fußboden. »Das hab ich gebraucht«, sagte sie.
»Allerdings«, pflichtete Mr Banks bei. »Ich mach uns einen Tee.«
Fünf Minuten später kam er zurück, ein Tablett mit Tee, Brot und Marmelade in den Händen. Behutsam ließ er sich neben Leo nieder und verteilte Tassen und Untertassen.
Leo schlürfte ihren Tee und schloss kurz die Augen, als seine Wärme sich in ihr ausbreitete.
»Ich hab ihn so gemacht, wie dein Vater ihn am liebsten mochte«, sagte Mr Banks. »Extra stark. Jetzt nimm dir aber auch ein bisschen Brot. Du bist viel zu dünn geworden.«
Leo bediente sich und sagte: »Wisst ihr, dass ihr die einzigen Menschen seid, die mit mir über ihn sprechen? Alle anderen glucken nur vorsichtig um mich herum oder vermeiden es ganz, über ihn zu reden – was viel schlimmer ist, denn wie können sie so tun, als hätte er nie existiert?« Sie legte den Kopf in den Nacken und blickte zu den ordentlichen Regalen empor, alles genau so, wie es ihrem Vater gefallen hätte. Die Feststellung machte sie zwar traurig, aber nur ein bisschen, denn die Freude, über ihn zu sprechen, sich an ihn zu erinnern, ihn nicht nur als Gespenst zu betrachten, glättete die Sorgenfalten auf ihrer Stirn und erleichterte ihr Herz.
Auf einmal kamen die Worte wie ein Wasserfall. »Anscheinend denken die Leute hier im Dorf, ich verwandle mich in Miss Leonora East, die exzentrische unverheiratete Apothekerin. Wenn sie reinkommen, tätscheln sie mir die Hand und sagen: Ach, es ist ein Jammer – als wäre mein Leben jetzt auch zu Ende.«
»Das würde dein Vater niemals wollen – er hat immer unmissverständlich klargemacht, was er sich für dich wünscht«, rief Mr Banks ihr in Erinnerung.
Als Anwalt ihres Vaters hatte Mr Banks ihr bei der Testamentseröffnung einen Brief überreicht, in dem ihr Vater sie ermahnte: Verkauf alles. Nimm das Geld und tu etwas damit, so, wie ich es mir immer gewünscht habe und wie Du selbst es immerwolltest. Verschenke Dein Leben nicht an Sutton Veny. Du bist zu Größerem bestimmt.
»Im Mai gehe ich weg von hier«, sagte Joan. »Pete wird schon früher aufbrechen, aber ich hab ihm gesagt, dass ich bleibe, bis das Lager vollständig demobilisiert ist. Du solltest wirklich mit nach New York kommen, es ist einfach die perfekte Stadt für uns beide, so voller Chancen. Es gibt Arbeit dort, und ich wette, die Leute sind viel aufgeschlossener als hier.«
»Aber es ist so weit weg«, erwiderte Leo traurig, brach jedoch ab und wiederholte nachdenklich: »Es ist so weit weg … Womöglich ist es schön, weit weg zu gehen.«
»Könnte gut sein«, stimmte Mr Banks zu.
New York … Ob sie es schaffen würde? In Sutton Veny hielt sie nichts, genau genommen nicht einmal in England.
»Ich verspreche, darüber nachzudenken«, sagte sie.
Mr Banks ergriff ihre Hand, Joan nahm die andere und drückte sie. Und hier auf dem Fußboden des Geschäfts ihres Vaters fühlte Leo sich wie ein Kind, das seine ersten Schritte macht, weg von der Vergangenheit, weg von der überwältigenden Trauer. Bei dem Gedanken, sich ins Unbekannte aufzumachen, schauderte sie mit einer Mischung aus Angst und Vorfreude.
***
Zwei Wochen später arrangierte Leo eine Pyramide aus kleinen Tiegeln im Ladenfenster. Davor stellte sie ein Schild mit der Aufschrift: Lippenschminke und Wimperntusche für schöne Frauen. Diese Töpfchen herzustellen war so viel befriedigender, als Pulver für zahnende Babys zu mischen. So etwas wollte sie auch in Zukunft machen – die einzige Frage war: wo?
Ihre Kosmetikprodukte stießen auf eisernes Schweigen. In den nächsten drei Tagen überquerte kaum jemand die Ladenschwelle, lediglich in dringenden Fällen. Abgesehen von den wenigen Krankenschwestern, die noch im Armeelager arbeiteten, fasste niemand die Töpfchen an, die Dorfbewohner eilten mit misstrauischen Seitenblicken ins Schaufenster vorüber, flüsterten und schüttelten vielsagend die Köpfe. Obwohl Leo nichts anderes erwartet hatte, schmerzte es sie mehr, als sie zugeben mochte. Die ganze Arbeit, die ganze Liebe, die sie in jedes Gläschen gesteckt hatte, all die Schönheit wurde gemieden. Schlimmer noch: verachtet.
»Wenn dein Vater sehen könnte, was du hier treibst …« Plötzlich stand Mrs Hodgkins in der Tür, und ihre Blicke schweiften geringschätzig über die Schaufensterauslage.
Leo betrachtete ihren säuerlichen Gesichtsausdruck und wusste, dass sie niemals so werden wollte wie sie. Nie wollte sie in einer von den starren Regeln der Vergangenheit vorgeschriebenen Zukunft leben.
»Du solltest morgen zur Messe erscheinen«, fuhr Mrs Hodgkins fort. »Und mit Father Lawrence sprechen.«
Leo lächelte, nicht zum Dank, sondern weil Mrs Hodgkins ihr die Entscheidung leichter gemacht hatte. »Nein, danke. Ich glaube, mein Vater wäre stolz auf mich.« Damit komplimentierte sie Mrs Hodgkins aus der Tür, schloss den Laden ab und ging hoch erhobenen Hauptes davon. Nach ein paar Schritten fing sie an zu laufen, rannte durchs ganze Dorf, vorbei an den Hütten des Armeelagers, die aussahen, als wären sie notdürftig aus Kinderbaukästen zusammengesetzt, bis zum Ende der Hospital Lane.
»Ich komme mit!«, rief sie, als sie Joan entdeckte. »Ich komme mit dir nach New York.«
»Oh, Leo.« Joan stützte die Ellbogen auf die Rezeption an der Schwesternstation und verbarg ihr Gesicht hinter ihren Händen. »Wie sich herausgestellt hat, ist Pete ein Schwindler. Er nimmt irgendein anderes Mädchen mit nach New York, und wenn ich hier fertig bin, gehe ich wahrscheinlich einfach wieder zurück nach Sydney.«
Leo umarmte ihre Freundin, und Joan seufzte. »Ich glaube, nicht nach New York zu gehen, ist eigentlich eine größere Enttäuschung für mich, als dass Pete mich sitzen lässt. Vor allem, wenn du es jetzt ausprobieren willst. Tust du es auch allein?«
Leo zögerte. Würde sie es schaffen, ohne Joan? »Ich möchte schon.«
***
Auf dem Nachhauseweg setzte die Schwermut der Abenddämmerung Leos Enthusiasmus einen kleinen Dämpfer auf. Mit Joan in New York zu sein wäre so viel schöner, aber vermutlich würde sie auch allein zurechtkommen. Jedenfalls konnte sie nicht in diesem Dorf bleiben, ihre Welt zusammenschrumpfen lassen und so engstirnig werden, dass alles Neue eine Bedrohung darstellte. Denn dann hätte sie auch sterben können, genau wie so viele andere.
Jetzt rannte sie nicht mehr, aber das Gedankenkarussell in ihrem Kopf drehte sich mit großer Geschwindigkeit. Als sie die High Street erreichte, ging sie direkt zu Mr Banks’ Haustür. Vielleicht konnte er ihr helfen.
Als er öffnete, platzte sie ohne Vorrede mit ihrem Anliegen heraus. »Joan geht doch nicht nach New York – obwohl ich mich doch gerade entschieden hatte! Ich möchte Kosmetika herstellen und in New York einen Laden aufmachen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich hinkomme.«
»Das klingt wie eine gute Idee«, sagte Mr Banks. »Komm erst mal rein, möglicherweise habe ich eine Lösung für dich.«
In der Küche wartete er nicht einmal, bis das Wasser im Kessel kochte, sondern begann sofort zu sprechen: »Erinnerst du dich an meine Nichte Mattie?«
Leo überlegte. Lady Mattie, ja, natürlich – Mr Banks hatte eine aristokratische Nichte. Als Leo ungefähr fünf oder sechs gewesen war, hatte Mattie ihren Onkel besucht. Sie hatten ein paarmal miteinander gespielt, und Leo hatte ihr die Stelle auf dem Hügel hinter Mr Banks’ Haus gezeigt, von der aus man im Schlamm bis ganz nach unten rutschen konnte. Leider war Mattie von solchen Eskapaden nicht begeistert gewesen, weil ihre hübschen Kleider schmutzig wurden und ihre Ringellocken in Unordnung gerieten.
»Also«, begann Mr Banks. »Mattie und ihre Eltern wollen demnächst nach New York übersiedeln. Sie haben finanzielle Probleme und irgendwo gehört, dass verarmte englische Adlige drüben besser behandelt würden als hier. Ich schreibe gleich meiner Schwester – bestimmt wärst du für Mattie die ideale Reisebegleiterin.«
»Das wäre ja wunderbar«, rief Leo. »Aber ob sie mich wirklich dabeihaben wollen? Mattie ist eine Lady, und ich bin bloß ein Bauernmädchen.«
»Meine Liebe, du warst noch nie ›bloß ein Bauernmädchen‹. Ich schreibe noch heute Abend.«
»Ich gehe nach New York!«, rief Leo aus.
»Auf dein Wohl«, sagte Mr Banks und hob seine Tasse. »Ich wünsche dir viele Abenteuer!«
Abenteuer! Leo grinste. Wie sich die Dinge innerhalb von wenigen Monaten ändern konnten. Statt sich wegen Krieg und Tod Sorgen zu machen, freute sie sich jetzt auf ein neues Leben an einem ganz neuen Ort – an dem sie vielleicht ihren eigenen Laden eröffnen würde. Einem Ort, an dem es sicher leichter war als hier, den Menschen zu zeigen, dass es keine Sünde und kein Verbrechen war, wenn eine Frau sich schminkte, und dass es sie auch nicht als Prostituierte abstempelte. Denn wenn genug Frauen Schminke kaufen und ausprobieren konnten, mussten Tradition und Konvention sich zwangsweise irgendwann verändern. New York war eine Stadt, in der sie herausfinden konnte, wer Leo East wirklich war. Und wer Leo East sein konnte.
Kapitel 3
An einem Nachmittag Ende Mai, an dem es für die Jahreszeit ungewöhnlich kalt und dunkel war und Sturmwolken über den Himmel rasten, machte Leo über Southampton den ersten Schritt in Richtung New York. Seit ihrem Gespräch mit Mr Banks waren zwei Monate vergangen, in denen er mit etwas Mühe einen Käufer für das Geschäft und die Wohnung gefunden hatte – nicht sehr viele Leute hatten Interesse an einer Apotheke mitten in einem halb ausgestorbenen Dorf. Zwar hatte Leo nun ein bisschen Geld, doch es war weniger als erhofft.
Während draußen das Wylye Valley vorüberzog – erst Warminster, dann Heytesbury, Codford und Wylye –, schienen die ratternden Räder des Zugs zu singen: endlich-weg, endlich-weg, endlich-weg. Leo übernachtete in Salisbury, wo der Regen seine Wut am Dach des Gasthauses ausließ und der Wind gegen die Fenster peitschte. Auch der nächste Tag hatte noch gar nicht richtig begonnen, als die Sonne schon wieder von einer tiefdunklen Wolke verschlungen wurde. Im Zug nickte Leo bald ein, weil sie in der vorangegangenen Nacht kaum Schlaf gefunden hatte, und wurde unsanft geweckt, als der Zug plötzlich scharf bremste und sie vom Sitz rutschte.
Der Schaffner brachte die Neuigkeiten. »Der Sturm hat die Hälfte der Bäume in ganz Hampshire entwurzelt, die Gleise sind blockiert und frühestens morgen Nachmittag wieder frei. Wir müssen nach Dunbridge laufen und dort unterkommen. Lassen Sie Ihr Gepäck im Zug.«
Widerwillig stieg Leo aus und versuchte, ihre Ungeduld wegen der Verzögerung herunterzuschlucken. Innerhalb weniger Sekunden hatte der Regen sie durchnässt, doch sie folgte der langen Schlange von Passagieren, die, umgeben von zuckenden Blitzen, schicksalsergeben durch knöcheltiefes Wasser trotteten. Erst knapp zwei Stunden später waren sie endlich in Dunbridge, wo es nur ein einziges Gasthaus gab, und so drängte sich eine große Menschenmenge in den winzigen Empfangsraum. Leo war froh, endlich ins Trockene zu gelangen, stand allerdings so weit vom Empfangspult entfernt, dass sie die Anweisungen der Wirtin nicht hören konnte. Nach ihr kam nur noch ein dunkelhaariger junger Mann an die Tür des Gasthauses, und sie beobachtete amüsiert, wie er einen wahren Sturzbach von seinem Hut auf den Rasen draußen abschüttelte, was sehr höflich war, aber letztlich keine Rolle spielte, da er selbst von oben bis unten tropfnass war. »Verfluchtes Wetter«, sagte er im Hereinkommen.
»Das kann man wohl sagen«, bestätigte Leo von ganzem Herzen. »Ich wäre viel lieber auf einem Schiff nach New York, als hier festzusitzen.«
Der Fremde lächelte. »Obwohl man bei dem Wetter auch leicht seekrank werden könnte.«
»Da haben Sie vermutlich recht«, meinte Leo und erwiderte sein Lächeln.
Als sie endlich an die Reihe kam, war es still geworden an der Rezeption, die meisten Leute hatten sich bereits in ihre Zimmer zurückgezogen. Ein paar Gäste gingen gerade die Treppe hinauf, nur noch Leo und der freundliche junge Mann mussten untergebracht werden.
»Ach du liebe Zeit, warum haben Sie denn nicht Bescheid gesagt, als ich gefragt habe, ob Frauen hier sind?«, fragte die Wirtin, als sie Leo sah.
»Von dort hinten konnte ich Sie leider nicht verstehen«, erklärte Leo.
»Aber jetzt gibt es kein Zimmer mehr für Sie!«, entgegnete die Wirtin ungehalten, als sei das Leos Schuld. »Und ich kann Sie auch nicht bitten, sich mit jemandem das Zimmer zu teilen – Sie sind die einzige Frau! Da muss ich wohl nach oben gehen und ein paar Männer auffordern umzuziehen. Obwohl ich eigentlich schon so viele in die Zimmer gequetscht habe, dass ich gar nicht weiß, wie ich es anstellen soll.«
»Dann warte ich eben im Aufenthaltsraum«, bot Leo an. »Wir werden ja sicher nicht allzu lange hier sein.«
»Sie sind ganz schön optimistisch«, meinte der junge Mann mit einem Blick aus dem Fenster und auf die Wassermassen, die immer noch vom Himmel stürzten.
Die Wirtin seufzte. »Na ja, im Aufenthaltsraum haben Sie wenigstens ein schönes Feuer, an dem Sie Ihre Klamotten trocknen können. Und auch ein Sofa, das Sie gern benutzen können, Miss. Und bei Ihnen …«, wandte sie sich an den Mann, beäugte seinen Mantel aus feinem Kaschmir, der ihn als wohlhabend auswies. »… bei Ihnen bin ich sicher, dass jemand seinen Platz für Sie frei macht.«
»Das ist nicht nötig«, antwortete er. »Ich kann auch im Aufenthaltsraum warten.«
»Ich weiß nicht, ob das angemessen wäre«, meinte die Wirtin unsicher.
»Es ist ein öffentlich zugänglicher Raum«, sagte Leo. »Das ist in Ordnung.«
»Vermutlich müssen wir es so machen«, räumte die Frau schließlich ein, denn auch ihr war natürlich daran gelegen, das Problem aus der Welt zu schaffen. Sie nahm Leo mit sich in einen anderen Raum, um etwas Trockenes zum Anziehen für sie zu suchen.
Als sie in den Aufenthaltsraum zurückkamen, wartete der junge Mann mit gelockerter Krawatte und aufgerollten Hemdsärmeln bereits an der Tür.
»Everett Forsyth«, stellte er sich vor und streckte Leo die Hand entgegen.
Die Wirtin schnappte nach Luft. »Von den Londoner Forsyths?«
»Richtig.«
Leo erinnerte sich vage an ein nobles Londoner Kaufhaus namens Forsyths – sie hatte nie genug Geld gehabt, um dort einzukaufen. »Leonora East.«
»Sehr erfreut«, sagte der Mann.
Nachdem die Wirtin sie noch einmal ermahnt hatte, die Tür unbedingt offen zu lassen, verschwand sie.
»Also ehrlich – was glaubt sie denn, was zwei nasse und müde Reisende in einem öffentlich zugänglichen Raum eines Gasthauses anstellen könnten?«, fragte Leo, eher sich selbst als ihren Mitreisenden.
»Offensichtlich hat sie mehr Phantasie als wir beide«, meinte Everett Forsyth. »Aber ich wollte damit nicht andeuten …«, fügte er hastig hinzu.
Leo lachte. »Ich verstehe schon, was Sie gemeint haben.« Dann ging sie hinüber zum Feuer.
Mr Forsyth blieb an der Tür. Sie schwiegen beide, was etwas unangenehm war, dann jedoch ging Forsyth zum Büfet und holte das Kartenspiel, das darauf lag. »Spielen Sie Bridge?«, fragte er. »Obwohl wir dafür eigentlich mehr als zwei Leute brauchen …«
»Wir können ja Double-Dummy Bridge spielen«, schlug sie vor. »Mein … mein Vater hat mir das beigebracht.« So etwas zu sagen tat immer noch weh, denn sofort fiel ihr ein, dass sie nie wieder mit ihrem Vater Karten spielen würde. Müde ließ sie sich auf einen Sessel sinken.
»Wir müssen nicht unbedingt spielen«, sagte Forsyth. »Ich dachte nur, dann vergeht die Zeit schneller, und Zeit haben wir hier ja im Überfluss.«
»Doch, spielen wir«, sagte Leo entschieden. »Ich zeige Ihnen Double-Dummy.«
Sie streckte die Hand nach den Karten aus, und als sie die Bridge-Variante für zwei Personen erklärt hatte, spielten sie schweigend eine Runde. Abgesehen vom regelmäßigen Geräusch der auf den Tisch fallenden Karten war es ganz still, und Leo beobachtete den jungen Mann verstohlen. Er war groß – größer als Leo, was nicht viele Männer von sich behaupten konnten –, mit dunklen Haaren und Augen so blau wie ein sonniger Sommerhimmel. Wie Leo ihn darum beneidete, dass seine Augen keine Geschichte vom Tod erzählten!
Aber sie schob den Gedanken beiseite. »Sie spielen sehr gut, Mr Forsyth«, sagte sie, als er sie in der zweiten Runde besiegte.
»Nennen Sie mich doch Everett. Außer den Dienstboten sagt niemand Mr Forsyth zu mir.«
»Damit kenne ich mich nicht aus«, erwiderte sie etwas schnippisch. »Dienstboten hatte ich noch nie.«
Er musterte sie einen Moment sehr aufmerksam, und Leo konzentrierte sich lieber wieder aufs Austeilen der Karten. Sein eindringlicher Blick machte sie verlegen.
»Warum sehen Sie so traurig aus?«, fragte er plötzlich sanft.
Ihr blieb fast die Luft weg, denn in seiner Stimme schwang so viel ehrliche Behutsamkeit mit, dass sie glaubte, es interessiere ihn wirklich. Deshalb erzählte sie ihm, was passiert war. Ihre Stimme zitterte, obwohl sie sich bemühte, ruhig zu bleiben.
Als sie fertig war, griff Everett in einer spontanen Geste des Mitgefühls nach ihrer Hand. »Das tut mir sehr leid«, sagte er leise.
Leo zuckte heftig zusammen. Plötzlich und unerwartet hatte der Blitz sie getroffen, auf den sie bei Alberts Berührung gewartet hatte.
***
Der Regen prasselte die ganze Nacht hernieder, Donnergrollen war zu hören. Gerade noch saß Leo auf ihrem Sessel und hörte Everett zu, der ihr erklärte, warum er unterwegs war, und im nächsten Moment erwachte sie auf der Couch, unter einer Decke, den Kopf gemütlich auf einem Kissen. Sie stützte sich auf die Ellbogen und sah einen Mann in einem Sessel am Feuer sitzen.
»Was ist passiert?«, murmelte sie.
»Sie sind eingeschlafen, mitten in meiner Erzählung, was nur bedeuten kann, dass ich ein entsetzlicher Langweiler bin. Und ich dachte, auf dem Sofa wäre es bequemer für Sie. Die Wirtin, Mrs Chesterton, hat uns eine Decke und ein Kissen zur Verfügung gestellt.«
Leo wurde rot. »Sie waren überhaupt nicht langweilig, ich war nur schrecklich müde. Ich schlafe nicht so viel, seit …«
»Seit Kriegsende.«
»Ja.«
»Ich habe Ihnen Tee und Toast aus dem Speisesaal mitgebracht.« Everett deutete auf ein Tablett, das auf dem Tisch stand.
»Danke.« Leo stand auf und streckte sich. Dabei erhaschte sie in dem Spiegel über dem Kamin einen Blick auf sich selbst, die feuerrote, zerzauste Mähne, das bleiche Gesicht – und Everetts Spiegelbild, das sie beobachtete.
Auf einmal war es im Zimmer viel zu warm.
»Wahrscheinlich steht das Wasser inzwischen knietief«, meinte Everett.
Leo blickte aus dem Fenster. Der Sturm hatte nicht nachgelassen.
»Allem Anschein nach kommen wir frühestens morgen hier wieder weg«, fuhr Everett fort. »Mein Auto steckt immer noch fest, und Ihr Zug kommt auch nicht von der Stelle. Da können Sie genauso gut etwas essen.«
»Sie sind wirklich nett zu mir – bringen mir Frühstück, schleppen mich zum Sofa, wenn ich unhöflicherweise einschlafe …«
»Ich wollte Ihnen beweisen, dass ich nicht für jede Kleinigkeit auf Dienstboten angewiesen bin, falls sich das gestern Abend so angehört hat.«
Leo erinnerte sich an ihre schnippische Bemerkung. »Dann schließen wir doch Frieden!«, sagte sie und hob die Hände. »Ich schlafe nicht ein, wenn Sie mir etwas erzählen, und stichle auch nicht wegen Ihrer Dienstboten, und Sie erinnern mich nicht mehr daran, dass ich so was getan habe, ja?«
Er lachte. »Gut, abgemacht.«
Leo setzte sich auf, schlürfte ihren Tee und konnte sich die Frage nicht verkneifen: »Waren Sie im Krieg an der Front oder …?«
»… oder habe ich in einem gemütlichen Büro in Whitehall die Füße auf den Schreibtisch gelegt?«, vollendete er ihren Satz mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Ich dachte, wir haben Frieden geschlossen!«, sagte Leo.
Er grinste, und ihr wurde klar, dass er es nicht ernst gemeint hatte.
»Es ist nur … Es sind Ihre Augen.« Als sie es aussprach, fühlte Leo, wie die Stimmung im Raum genauso trübe wurde wie der Tag draußen. »Sie sehen glücklich aus, als hätten Sie nichts erlebt, das Sie verletzt hat.« Kaum waren die Worte aus ihrem Mund, wusste sie, wie albern sie klangen. »Tut mir leid«, fügte sie hastig hinzu. »Ich weiß nicht, was ich sage. Vielleicht sollte ich lieber raus an die frische Luft gehen.«
Aber als sie aufstehen wollte, berührte Everett ihre Hand.
»Bitte bleiben Sie, Leonora«, sagte er.
Leo stockte der Atem, und sie wünschte sich, dieser Moment würde ewig dauern. Everetts Hand streifte die ihre, und ein Teil ihrer selbst, den sie bisher nicht gekannt hatte, entfaltete sich. »Niemand nennt mich Leonora«, sagte sie und sank wieder auf ihren Sessel. »In Wirklichkeit bin ich Leo.«
»Passt gut zu Ihnen«, sagte Everett leise. Dann räusperte er sich. »Aber um Ihre Frage zu beantworten: Ja, ich war an der Front. In Frankreich. Ich habe an der Somme gekämpft. Und in Ypres.«
»Sind Sie jemals verwundet worden?«
»Durch die Schulter geschossen. Ich hab deswegen noch Narben auf der Brust und dem Rücken.« Seine Stimme klang nüchtern, aber Leo wusste, dass eine Schusswunde keine Kleinigkeit war.
»Jetzt sind Sie beide wach, stimmt’s?« Mrs Chesterton erschien an der Tür mit einem Tablett und zwei dampfenden Teetassen. »Ich bringe noch einen Tee, damit Sie warm bleiben. Trinken Sie, junge Frau, Sie sind ja fast nur Haut und Knochen.«
Betroffen fuhr Leos Hand zu den hervorstechenden Spitzen ihrer Schlüsselbeine, und Everett verfolgte die Bewegung mit den Augen.
»Jetzt, wo wir wissen, dass alle noch eine Nacht hierbleiben müssen, werde ich mein Möglichstes tun, ein Zimmer für Sie zu organisieren, Miss«, fuhr Mrs Chesterton fort. »Das gehört sich einfach.« Dabei blickte sie zu Everett, der seinerseits in seinen Teebecher starrte.
Es gehört sich. Leo schüttelte den Kopf. Wen kümmerte so etwas denn heutzutage noch?
»Mrs Chesterton hat ganz recht«, sagte Everett scharf, und Leo merkte plötzlich, wie absurd ihre Gedanken waren. Die verstohlenen Blicke, die sie immer wieder zu bemerken glaubte, waren pure Einbildung. Wahrscheinlich rissen sich die Frauen um Everett Forsyth, den reichen Geschäftsmann. Was kümmerte ihn Leo East?
»Ich komme wieder, wenn ich alles arrangiert habe.« Damit verschwand Mrs Chesterton, und Leo nahm geistesabwesend das Kartenspiel in die Hand und mischte.
»Wollen Sie noch einmal spielen?«, fragte Everett. »Wenn es Ihnen lieber wäre, kann ich Sie auch einfach in Ruhe lassen«, fügte er förmlich hinzu.
»Nein, spielen wir«, sagte Leo und teilte die Karten aus. Als sie fertig war, fragte sie: »Wie haben Sie das Forsyths-Kaufhaus im Krieg geleitet?«
»Das war kein Problem, denn zu meinem Glück habe ich einen sehr guten Manager«, antwortete Everett. »Ich habe meinen gesamten Heimaturlaub im Büro verbracht, und wenn ich an der Front war und alle anderen Briefe an ihren Schatz geschickt haben, habe ich an meinen Manager geschrieben.«
Ohne es zu merken, legte Leo die Karten wieder auf den Tisch. »Dann sind Sie jetzt bestimmt froh, wieder verfügbar zu sein und alles persönlich erledigen zu können.«
Everett lehnte sich im Sessel zurück. »Genau genommen habe ich meinem Manager komplett die Zügel überlassen. Ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann, und dadurch kann ich es mir erlauben … meinen Träumen nachzujagen, die mir in den Sinn gekommen sind, während ich um mich herum die Granaten durch die Luft pfeifen hörte.«
»Wie kann man denn in so einer Situation überhaupt träumen?«
»Es ist das Einzige, was einen am Leben erhält.«
Vielleicht hatte er recht – der Traum von New York hatte schließlich auch ihr wieder Zuversicht geschenkt. »Welche Träume haben Sie denn?«
»Ein Forsyths-Geschäft in New York zu eröffnen. Dorthin werden sich im nächsten Jahrzehnt die Blicke der Welt richten, da bin ich sicher. Es gibt keine Rationierungen, und im Gegensatz zu unserer muss sich die amerikanische Wirtschaft nicht von einem Krieg erholen. In ein paar Monaten will ich nach New York umziehen, ich habe schon einen Laden gekauft, der Bankrott gemacht hat, und will ihn in etwas richtig Schönes und Besonderes verwandeln. In einen Ort, den die Menschen nur wegen seiner überwältigenden Pracht besuchen werden – einen Ort für Frauen, die auch nach dem Krieg ihre Arbeitsstellen nicht aufgeben wollen, einen Ort, an dem sie Mode aus Paris, Seidenstrümpfe, vielleicht sogar Kosmetik kaufen können.«
»Ich habe mir die Nächte in der Apotheke meines Vaters um die Ohren geschlagen, indem ich für die Krankenschwestern im Armeelager Schminksachen zusammengemischt habe.«
»Wer hätte gedacht, dass sich hinter Ihrer dezenten Erscheinung eine Frau versteckt, die andere Frauen in England mit derart skandalösen Dingen versorgt hat?«, neckte er sie.