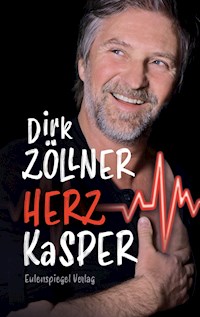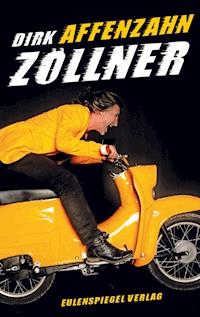Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neues Leben
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Am Anfang standen The Sweet. Die machten Musik, die ankam. Wichtiger aber, es war die Musik, die der Klassenschönsten gefiel. Und Vater Zöllner - die Kindheit findet schließlich in der DDR statt - "besorgte" eine LP, Opa stiftete die erste Gitarre, Marke Eigenbau. Dirk Zöllner erzählt von schöner, wilder und doch behüteter Kindheit. Und irgendwann stand fest: "Ich war infiziert vom Virus des Rock n Roll." Wie es weiterging - wild und schön - mit Songs und Bands und mit den Mädchen, mit Shows und Aftershow-Parties, mit dem ganzen bunten Rockerleben, mit dem gefundenen und wieder verlorenen Glück, mit neuen Anläufen und Mut und Wut und Trauer und Spaß, das ist eine Geschichte, die unter die Haut geht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
ISBN eBook 978-3-355-50000-5
ISBN Print 978-3-355-01794-7
© 2012 Verlag Neues Leben, Berlin
Umschlaggestaltung: Buchgut unter Verwendung
eines Fotos von Holger Jarosch
Neues Leben Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Neue Grünstr. 18, 10179 Berlin
Die Bücher des Verlags Neues Leben
erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.eulenspiegel-verlagsgruppe.de
Prolog
Die Zeit, die alte Sau! Von Jahr zu Jahr rinnt sie mir schneller durch die Finger. Doch nun bin ich aus dem Hamsterrad gefallen, denn ein Freund ist mir gestorben.
Kurz vor seiner zweiten Rückenmarktransplantation besuche ich Thomas Maser noch mal im Krankenhaus, fliege dann aber gleich in den Urlaub nach La Palma. Wieder in Berlin, traue ich mich nicht, den Operierten direkt zu kontaktieren. Habe elenden Schiss vor einer schlechten Nachricht und rufe deshalb erst mal meinen Kollegen Dirk Michaelis an. Thommy ist der Gitarrist meines Sängerkollegen, und ich will erfahren, ob die Transplantation erfolgreich war. Dirk ist leider unerreichbar. Vier Tage lang versuche ich es.
Ich bin mit meiner kleinen Mimi-Tochter auf dem Boxhagener Platz, jage sie gerade durch den Sandkasten, als das Handy klingelt. Thomas ruft seinen feigen Freund selbst an. Er klingt müde. Ich plappere drauflos, Angst und Scham überspielend: »Was geht ab? ... La Palma ... mit Mimi ... Wollte dich auch grade anrufen!«
»Es hat nicht funktioniert.«
Mir wird schwarz vor Augen, aber ich plappere weiter: »Wie? Was? Wo steckst du? Wann kann ich dich besuchen? Thommy, du kriegst das gebacken! Zieh durch … auf zu neuen Ufern ... blabla ... Thomas Maser 2.0!«
»Ich möchte morgen sterben.«
Das Herz schlägt mir bis zum Hals, ich muss mich hinlegen: » .«
Mimi krabbelt mir über den Bauch, Dutzende Kinder toben um mich herum über den Spielplatz, und ich kann Thomas kaum verstehen. Ich will ihn nicht verstehen. Er spricht leise, aber bestimmt: »Alles gut. Keine Chemos mehr. Keine Bluttransfusionen. Ich bin durch.«
Ich kann mein Schluchzen nicht mehr unterdrücken. Der Kerl besitzt die unglaubliche Kraft, mich zu trösten. Er sagt, dass er dankbar wäre für unsere Freundschaft und mit seinem Leben im Reinen. Er könne das Wichtige vom Unwichtigen trennen – das hätte er jetzt gelernt, in den anderthalb Jahren seiner beschissenen Krankheit.
Verdammt! Thommy, mein geliebter Freund! Das konntest du doch schon immer! Jedenfalls viel besser als die meisten!
Ich darf noch mal kommen. Er würde gern einem kleinen Freundeskreis zum Abschied die Hand reichen. Ich bekomme einen Termin. Morgen. Dienstag. 12. April 2011. 12 Uhr mittags. Es bleiben noch 24 Stunden.
Es ist dunkel. Tiefschwarze Nacht. Unerträgliche 24 Stunden lang befinde ich mich in einem üblen Traum. Habe ich diesen Anruf von Thomas wirklich erhalten? Im Protokoll meines Handys kann ich es sehen, aber ich muss mich immer wieder davon überzeugen.
Ich rufe Uge an. Und Gensi und Matze und Sascha. Und Dirk Michaelis spreche ich auf den Anrufbeantworter. Der ruft endlich zurück, und ich erfahre, dass er schon ein paar Tage involviert ist, ansonsten heulen wir uns nur an. Ich treffe mich mit Marco, der ebenfalls diesen Anruf erhielt. Wühle mich durch Umzugskartons voller Fotos, suche alles, was ich von Thomas finden kann. Abends treffe ich mich mit Robert Gläser, der viel mit dem virtuosen Gitarristen zusammengearbeitet hat. Auch Robert macht sich Vorwürfe, weil er Thomas nur ein Mal besucht hat und genau wie ich die direkten Anrufe fürchtete. Jetzt bringt er den Mut auf, eine SMS an den sterbenden Kollegen zu schreiben. Wir sind fassungslos, müssen uns betäuben. Anders würde wohl keiner in den Schlaf finden.
Über Nacht schlägt das Wetter um, es hat sich der Gefühlslage angepasst. Halb zwölf holt mich Dirk Michaelis ab, wir gehen den schweren Gang gemeinsam. Ich erfahre von ihm, dass die Verweigerung von Bluttransfusionen und die gleichzeitige Erhöhung der Morphiumdosis ein sanftes Entschlafen unseres Freundes zur Folge haben werden. Vermutlich gegen Abend. Wie ferngesteuert gelangen wir an sein Bett, nur die Eltern sind da. Thomas ist nicht mehr ansprechbar. Sein armer, hilfloser Vater versucht immer wieder, einen Kontakt herzustellen. »Thomas, Thomas, der Scholle ist da! Scholle, sprich ruhig mit ihm, er versteht dich!« Mechanisch grüße ich meinen schon schlafenden Freund von Uge, Matze, Robi. »Und von Gensi soll ich dir über die Haare streichen!« Die unzähligen Chemotherapien haben meinen Freund längst all seiner Haare beraubt. Ich heule. Ein Pfleger kommt ins Zimmer, wir erfahren, dass Thomas noch am Vorabend dem Personal seine Lieblingslieder auf der Gitarre vorspielte. Alles heult durcheinander. Der nächste Termin rückt an, ein weiterer Thomasfreund. Dirk organisiert so etwas wie eine Sitzordnung am Bett. Schon wird die Atmung immer flacher. Wir alle halten unseren Thomas fest und merken doch, dass wir ihn gleich loslassen müssen. Fünf Minuten nachdem wir das Zimmer gemeinsam verlassen haben, stirbt er mit 41 Jahren in den Armen seiner Eltern. Vio, seine Lebensgefährtin, kommt zwei Minuten zu spät.
Thomas, du hast mir gezeigt, dass zumindest der eigene Tod zu bewältigen ist! Du bist nachhaltig. Dass du jetzt nur noch in meinen Gedanken weiterleben sollst, ist schwer zu verkraften! Ich muss dir doch noch so viel sagen. Noch was loswerden. Ich will mit dir reden und dir noch viel besser zuhören. In einem nächsten gemeinsamen echten Leben. Verdammte Scheiße – mir fehlt der Glaube! Ich sehe die Details, aber ich erkenne nichts. Ich bin erstarrt und ich starre. In die Frühlingsblüten, in die Sonne, in den Regen, in den Wind, in den Nachthimmel. Welcher von den Sternen hinterm Mond bist du?
Zu selten habe ich Thomas während seines anderthalbjährigen Martyriums angerufen und noch seltener im gruseligen Benjamin-Franklin-Krankenhaus besucht. Ich habe die Möglichkeit einer Niederlage nicht wirklich in mein Denken einbezogen. So, wie ich auch die eigene Sterblichkeit anzweifle. Die Endlichkeit des eigenen privaten Universums ist mir unbegreiflich. So unbegreiflich wie die Unendlichkeit des großen Universums.
Als Kind habe ich oft darüber nachgegrübelt und fiel manchmal in eine Art albtraumhaftes Wachkoma, sah lauter bunte Zahlen, in allen Schreibweisen und Größen, in denen ich mich hoffnungslos verhedderte. Da konnte nur meine Mutter helfen, die sofort spürte, wenn irgendetwas nicht stimmte mit mir.
Von diesem tiefen unergründlichen Schmerz werde ich mein Leben lang gelegentlich heimgesucht. Gerate aber im Gegenzug auch immer wieder in manische Verzückung. Mir fehlt das Maß. Der religiöse Lehnstuhl, der mich nach dem Gebet in den friedlichen Schlaf schaukelt. Das Morphium des Herrn, welches mich die apokalyptischen Momente stoisch ertragen lässt.
Zur Beerdigung an einem herrlich sonnigen Frühlingstag im Mai 2011 kommen über 200 Angehörige, Freunde, Kollegen und Fans. Trotz der vielen Menschen herrscht eine angenehme, intime Atmosphäre. Ich weine die Tränen der letzten zehn Jahre. Gefrorene Tränen. Mein Leben verliert die Konturen, die selbstauferlegten Gedankenzwänge schmelzen dahin. Ich bin klein. Flankiert von Uge, der Mutter meines fünfjährigen Sohnes Egon, und meiner Freundin Denise, der Mutter meiner kleinen Mimi, sehe ich Gott. Schmerzlich. Schön. So soll es bleiben!
Alle lieben Mirko
Die Religion meines Vaters ist ein kunterbunter Mix aus Rudimenten. Bisschen Marx und bisschen Lenin, ein wenig Jesus und paar andere Volksweisheiten. Gern zitiert er Limericks und Liedtexte. Alles im Dienste seines eigenen Herzens, das die Größe eines ausgewachsenen Schnitzels hat. Er ist ein ausgesprochen liebesfähiger Mensch. Mein Vater liebt auf fast schmerzvolle Weise den Spreewald, seine Heimat. Seine Mutter, seine Schwester, seine Brüder. Er liebt seine Arbeit, seine Kollegen, seine Freunde. Die Natur. Meinen Bruder, mich. Die Frauen. Am allermeisten seine.
Meine Mutter befasst sich dagegen ausschließlich mit ihren eigenen unendlichen Gedankenwegen. Uniformität und Gleichschritt sind ihr ein Graus. Ihr fehlt das Talent zum Mitmachen. Ein Leben lang rebelliert sie gegen jede Form der Unterwerfung. Innerhalb der Familie tritt sie engagiert als Frauenrechtlerin auf, und es ist ihr gelungen, zumindest meinen Vater von ihrer Wahrheit zu überzeugen. Meine Mutter lebt das große Universum auf kleinstem, selbstbestimmtem Terrain. Nur vorübergehend gründet sie pseudoreligiöse Geheimbünde.
Meine Eltern wurden als Anneliese Berndt und Hans Erwin Zöllner 1941, mitten im 2. Weltkrieg geboren. Beide sind erst 20 Jahre alt, als ich selbst am 13. Juni 1962 das Licht der kleinen Welt von Ostberlin erblicke. Kurz vor meiner Geburt heiraten sie und sind jetzt, mit Beginn dieser Rückblicke, fast 50 Jahre zusammen.
Den Kreis, den meine Eltern als Paar bilden, empfinde ich in Kinderjahren mitunter als zu groß. Freiheit will gelernt sein! Aber so kann ich im Kleinen frühzeitig üben, was mir im Großen ja noch bevorstehen soll. Erwachsen kommen mir die beiden unterschiedlichen Traumtänzer jedenfalls nicht vor. Erwachsen im Sinne von eingerichtet. Jetzt bin ich sehr stolz auf meine jung gebliebenen Eltern, aber als angehender Teenager empfinde ich sie manchmal als peinlich. Wenn meine Mutter sich bei bestimmter Musik seltsam ekstatisch verrenkt oder bei Elternversammlungen mit Plateauschuhen und wehenden Tüchern erscheint. Der Wellensittich unter den Spatzen. Ich wünsche mir ein unauffälliges Muttertier, ordentlich eingereiht in die Herde der anderen Muttertiere.
Auch der Geist meiner Mutter ist farbenfroh, mehr als ihr zarter Körper vertragen kann. Sie braucht Platz für sich selbst, den die Neubauwohnung in Berlin-Karlshorst leider gar nicht bietet. Um so weniger, da mein Vater die vielleicht 60 Quadratmeter gern mit Familie, Freunden und Kollegen vollstopft und lebensfrohe Gelage feiert. Über allem thronen dann souverän sein wieherndes Lachen und die von Euphorie gedopte Sprechstimme. Mir gefällt das, aber die Nachbarn reagieren gereizt und meine Mutter mit tagelangen Mi-gränen. Die Ruhe vor dem nächsten Sturm, die Schonzeit für die Nachbarn. Neben meinem emotionalen, sehr kindlichen Vater kommen mir die meisten anderen Männer wie Trauergestalten vor. Er ist unbesiegbar. Auf einer Ebene mit Tarzan, Jesus und Gojko Miti´c. Er nimmt sich viel Zeit, um diesen Mythos für seine Kinder aufrechtzuerhalten. Wir machen Rad-, Wander- und Bootstouren, kämpfen, toben, spielen. Er erzählt schauerliche Geschichten aus seiner Kinderzeit im Spreewald, und manchmal spielt er auf seiner Ziehharmonika Heimatlieder vor. Er ist ein zärtlicher Vater, doch wenn es um die Verteidigung seiner Familie oder seiner Ideale geht, kann er zum bösen Tier werden. Nur ein Beispiel: Wir fahren mit unserem kleinen Saporosch die Karl-Marx-Allee entlang, vor uns eine Limousine mit rotem CD-Kennzeichen, also Botschafter oder Politiker in ausländischen Diensten. Sie genießen Immunität und werden von Verkehrsprüfungen weitestgehend oder sogar ganz verschont. Der Fahrer der Limousine ist augenscheinlich besoffen, schlingert gefährlich gegen den Gehsteig, fährt ohne abzubremsen über einen Zebrastreifen, so dass ein paar Menschen zurückspringen müssen. An einer Kreuzung bremst er so unvermittelt, dass wir fast auffahren. Mein Vater springt aus dem Auto, reißt die Fahrertür der Limousine auf, zerrt den Kerl raus und gibt ihm voll eins auf die Zwölf. Mein Bruder und ich sind begeistert! Doch während wir unserem väterlichen Helden zujubeln, erleidet die Mutter einen Nervenzusammenbruch. Mit irrem Blick kehrt der Rächer aller Witwen und Waisen ans Steuer zurück und lässt die so gegensätzlichen Gefühlsbekundungen seiner Familie wortlos über sich ergehen. Als wir vorüberfahren, rappelt sich der in meinen Augen zu Recht Bestrafte gerade wieder auf und sieht uns erschrocken nach.
Durch diese und eine weitere Reihe solcher Begebenheiten gibt es immer wieder Spannungen zwischen den so unterschiedlichen Eltern, und ich werde als Kind oft von der Angst vor einer Trennung geplagt. Dann müsste ich zu meiner Großmutter ziehen. Eine Entscheidung für ein Elternteil käme für mich nicht infrage. Bevor ich aber schon vorsorglich meinen Koffer packe, gehe ich erst mal eine Etage tiefer zur Lebensberatung. Da wohnt Big Helga, ebenfalls in nicht ganz konventionellen Familienverhältnissen. Sie hat einen um viele Jahre jüngeren Lover, der ihr und leider auch dem Alkohol verfallen ist. Helga hat Asthma, aber sie raucht wie ein Schlot. Wenn sie von ihrem Kellnerjob aus der Kneipe zurückkehrt, hört man es im ganzen Hause husten und ächzen. Sie ist auch nicht so gut zu Fuße, fährt immer mit dem Taxi. In liebevollster Art und Weise kümmert sie sich um ihren Enkel Marco. Den bekam ihre Tochter noch minderjährig, aber an ihrer Stelle zieht nun Helga die Mutterschaft komplett durch. Auch eine tätowierte tschechische Schwester ist gelegentlich vor Ort. Big Helga ist im Haus die einzig Verbündete in Sachen Zöllnerfamilie. Ein Berliner Original, etwa 40 Jahre älter als ich, aber eine echte Freundin, ein Schutz für Kinder vor der gruseligen Welt der Gebügelten. Die erwachsenen Spießer haben nichts zu lachen, wenn sie sich – breitbeinig und die Hände in die vollen Hüften gestemmt – vor uns stellt. Sie ist die Patin der Roßmäßlerstraße. Vom Fensterbrett aus verschafft sie sich den Überblick und regiert mit lautem, aber gerechtem Wort.
Im Gegensatz zum späteren Chaos verbringe ich die ersten beiden Jahre meines Lebens im geordneten Haushalt meiner Großmutter Marianne Berndt. Da riecht es immer nach Essen und so einer Zaubersalbe gegen Erkältungen. Pulmotin. Sie entspricht meinem Bild von einem Muttertier. Eingerichtet. Erwachsen. Mit Schürze und wohlleibig. Die Großmutter wird von mir Mimi genannt. Mimi dient einem Herrn, und das ist mein Großvater. Und einem Kind – das bin ich! Der Großvater Johannes Berndt arbeitet als technischer Direktor an der Berliner Staatsoper und ist selten zu Hause. Meine Eltern haben viel mit sich zu tun, mit der Beendigung ihres Studiums und dem Einstieg ins Berufsleben. So komme ich in den Genuss der ungeteilten Aufmerksamkeit meiner Mimi. Ich bin genau zur Stelle, als ihr jüngster Sohn das Haus in Köpenick verlässt. Platz für das Nesthäkchen und Mimis Liebling.
Es soll so bleiben. Die überaus enge Bindung zur Großmutter lässt nie nach. Die Wochenenden und Ferien verbringe ich meist auf dem Grundstück in Berlin-Karolinenhof. Mein Großvater reagiert gelegentlich eifersüchtig auf unsere enge Beziehung. Einmal spritzt er mich völlig unerwartet und hämisch grinsend mit dem Gartenschlauch ab, kaum dass Mimi außer Sichtweite ist. Auch versucht er, ihren unglaublich ausgeprägten Gerechtigkeitssinn zu untergraben, indem er mich für jede Zeugnisnote mit dem entsprechenden Geldwert entlohnt. Eine Mark für eine Eins – fünf Mark für eine Fünf. Lange Zeit hat der Großvater unter Bertolt Brecht und Helene Weigel am Berliner Ensemble gearbeitet und raucht, wie Brecht, dicke stinkende Zigarren. Allen Familienangehörigen verleiht er charakterbedingte Zweitnamen, die durchweg Theaterstücken und Opern entliehen sind. Wenn Fisch auf den Tisch kommt, droht er jedes Mal, bühnenreif an einer Gräte zu ersticken. Bei Kirschkuchen an einem vergessenen Stein. Später verstehe ich, dass er meine Großmutter damit bestrafen will. Er kämpft gegen seine Vernachlässigung.
Von Mimi werde ich in die Künste des Pilzesammelns, Beerenpflückens, Entenfütterns und Kuchenteigessens eingeweiht, reife zum Hauptgegner beim Romméspiel. Von jeglicher Hausarbeit bin ich freigestellt. Mimi bevorzugt mich unverhohlen gegenüber ihren anderen Enkelkindern, und ich fühle gelegentlich den Missmut meiner Onkel und Tanten. Es werden viele Familienfeste bei den Großeltern abgehalten. Ich freue mich immer auf meine Cousins. Zuerst interessiert mich der ältere Uwe. Später sein Bruder, der verrückte Polli. Er legt gerne Brände bei Experimenten mit dem großelterlichen Gasherd, erschießt Singvögel mit dem Luftgewehr vor den Augen meiner entsetzten Großmutter. Alles aus Versehen! Jedenfalls brennt immer die Luft, wenn Polli auftaucht.
Das Viertel in Berlin-Karlshorst, in das die Eltern 1964 ziehen, besteht aus etwa 20 dreigeschossigen Neubaublöcken. Q3A-Bauserie, typisch für die 60er Jahre. Im Osten steht davon in jedem Kaff mindestens ein Exemplar. Unser Kiez liegt eingekeilt zwischen einem riesigen Panzerregiment der Roten Armee, dem Tierpark Berlin und einem großen Friedhof. Es gibt hier viele junge brütende Paare, daher mangelt es mir nicht an gleichaltrigen Spielgefährten. 1967 wird mein Bruder Reyk geboren. Ich bin noch zu jung, um mich für ein Baby zu interessieren.
Meinem Vater, der bisher als Bauleiter beim Tiefbau Berlin gearbeitet hat, wird die Leitung eines Asphaltwerkes übertragen. Er ist Feuer und Flamme, tritt in die SED ein. Er will mit befreundeten Kollegen eine Asphaltverlegemaschine erfinden, meine Mutter arbeitet ihnen als Zeichnerin zu. Sie arbeitet zu Hause, überall in der engen Wohnung liegen Baupläne herum. Es ist chaotisch. Ich bin eigentlich nur draußen. Mit dem Kindergarten tue ich mich sehr schwer. Es funktioniert nicht, ich wehre mich mit Händen und Füßen, kann mich dieser Strenge nicht unterordnen. Mimi muss wieder einspringen, ich bin sehr oft bei ihr. Mit meiner Einschulung wird es leichter, ich gehe ganz gern zur Schule. Freue mich über die Lesefibel: »Mimi am Zaun«! Unweit der Schule ist ein Kindergarten, und da steht Reyki am Zaun, besser gesagt: hinter dem Zaun, und guckt mich mit großen, traurigen Augen an. Ich ziehe ihn einfach rüber und nehme ihn mit nach Hause. Die Aktion zieht einigen Stress nach sich. Mein Bruder klebt seit diesem Vorfall jedenfalls an mir dran, und so soll es lange bleiben.
Mein erster wichtiger Freund heißt Karsten. Seine Eltern rufen ihn Miggi. Sie meinen wohl Mickey, kommen aber ursprünglich aus sächsischen Gefilden. Wir übernehmen diesen Spitznamen einfach dem Klang nach. Miggi ist eine wilde Type, ich kann mich mit ihm streiten, prügeln und wunderbar wieder vertragen. Wenn er sich im Streite von mir abwendet und irgendeinen anderen zum besten Freund erhebt, empfinde ich Eifersucht. Miggi ist meine erste Liebe. Zusammen sind wir unantastbar. Selbst ältere Jungen vermeiden es, uns zu provozieren. Wir sind der zweiköpfige Albtraum unserer Feinde. Die Kinder des eigenen Blocks stehen unter unserem besonderen Schutz. Big Helga thront natürlich über allem und gibt gelegentlich Anweisungen. Ungerechtigkeiten können wir uns nur außerhalb ihres Blickfeldes erlauben.
Noch in Sichtweite, hinter unserem Block, befindet sich ein Bahngleis. Hier verkehren Dampflokomotiven Richtung Ostsee und verursachen immer wieder sensationelle Brände. Dahinter liegt das Gelände des Tierparks, unseres Reiches Filetstück! Der Zugverkehr, das Brüllen der Löwen und Affen, das Heulen der Wölfe und Trompeten der Elefanten sind der Soundtrack meiner Kindheit. Natürlich ist der Zutritt verboten, aber wir können der Verlockung zu keinem Zeitpunkt widerstehen. Wo doch die Pfauen regelrecht nach mir rufen: »Diiiaaaak! Diiiaaaak!«, so dringt es Tag und Nacht an mein Ohr. Das hintere Tierparkgelände muss vor dem Krieg eine Kleingartenanlage gewesen sein. Versteckt zwischen Fliederhecken und Obstbäumen gibt es noch ein paar verlassene kleine Häuschen, und überall entdecken wir intakte Kellerräume. Auf der ständigen Flucht vor dem Tierparkpersonal geben uns diese »Bunker« sichere Deckung. In diesem Partisanenkrieg beläuft sich die Chance auf einen Sieg der Erwachsenen gegen Null. Wenn doch mal einer von uns in die Hände der Häscher fällt, müssen die Eltern antanzen. Partisan Miggi bekommt in diesem Ausnahmefall dann leider Stubenarrest.
Größere Probleme bereiten uns dagegen die Angriffe der »Russenbanden«. Die Offiziere der Roten Armee wohnen mit ihren Familien in mehr oder weniger kasernierten Wohngegenden, und somit hält sich auch zwangsläufig die vielbeschworene Deutsch-sowjetische Freundschaft in Grenzen. Mitunter kommt es trotzdem zu wahrhaftigen Freundschaften unter den Kindern, aber bei den Eltern sitzt der Albtraum des Krieges wohl noch tief. Aus dem Munde eines deutlich älteren Deutschen klingt das Wort Russe oft wie eine Schmähung, und den Schlusspunkt jedweder Auseinandersetzung mit den so Bezeichneten bildet häufig ein nicht weniger hingerotztes: »Faschist!«
Manchmal dringt eine Bande sowjetischer Offizierssöhnchen in unser Revier ein und wiederholt die Große Schlacht um Berlin auf unserem kleinen Rodelberg hinter dem Haus. Miggi, die anderen Freunde, ich und sogar der kleine Reyki sind Faschisten. Ganz und gar gegen das eigene Herz. Es geht brutal zu, blutige Verletzungen sind nicht selten, und mein bester Freund rettet mir mehr als einmal den Arsch. Er ist ein guter Kämpfer, hat schon als Kind eine athletische Figur. Ich sehe dagegen aus wie ein Hänfling, bin aber nicht weniger Kamikaze. Die Sorge um meinen kleinen Bruder verleiht mir Bärenkräfte. Bei den Gegnern gelte ich sogar als Anführer. Das ist wohl meiner relativ großen Klappe zuzuschreiben. Die Eltern und Big Helga ahnen nichts davon. Und bei Mimi und in der Schule bin ich sowieso noch der ganz brave Junge.
Oft fahren wir zu den Eltern meines Vaters in den Spreewald. Sie wohnen in Burg, dem flächenmäßig größten Dorf Deutschlands. Oma Marie entstammt dem slawischen Volk der Wenden, sie ist sehr einfach und sehr lieb. Sie war auch schon bei uns in Berlin, aber weiter ist sie nie gekommen. Wir sind kaum zur Tür rein, da sitzen wir auch schon vor üppig beladenen Tellern. Meistens gibt es Kaninchen, was mir nicht recht schmecken will, weil ich das Tier ja noch vom letzten Besuch namentlich kenne. Aber es gibt auch Spreewälder Gurkensalat mit saurer Sahne und Leinöl. Und Kartoffeln. Mein Vater kann Berge davon in sich hineinschaufeln, ich beobachte es immer wieder mit Faszination. Ich liebe den Spreewald und meine Essenoma, aber ich fürchte mich ein wenig vor dem Plumpsklo und vor Opa Erwin. Dieser liegt meistens in einem kleinen dunklen Raum und starrt in den Fernseher. Wenn wir ihn dort begrüßen, reagiert er nur mit kurzen mürrischen Geräuschen. Er war als Soldat in Russland, geriet in Gefangenschaft und kehrte erst weit nach Kriegsende zurück. Erst später bekomme ich eine Ahnung, was er durchgemacht hat und dass seiner abweisenden Art eine schwere psychische Störung zugrunde liegt. Eigentlich gelingt es ihm nur unter Alkohol, halbwegs am Leben teilzunehmen. Hin und wieder geht er angeln und Pilze sammeln. Am Sonnabend zu den Fußballspielen der SG Burg. Fußballspieler haben es etwas leichter bei ihm, mein Cousin Hardy ist so einer. Mein Cousin Michael und ich leider nicht.
Es ist ein sonniger Oktobertag im Jahre 1971, meine Oma hat Geburtstag. Ich gehe mit Hardy und Michael Kastanien sammeln, die meisten hängen aber noch am Baum. Meine älteren Cousins heben mich auf ihre Schultern, und ich schüttele an den so erreichbaren Ästen, den Blick begehrlich auf die Früchte geheftet. Sie prasseln auch reichlich hernieder, doch eine bleibt samt ihrer stacheligen Schale genau in meinem linken Auge stecken. Ich habe Schmerzen und kann nur noch verschwommen sehen. Als es sich nicht bessert, fährt mich mein Vater ins Cottbuser Krankenhaus. Ich bekomme eine Überweisung in die Berliner Charité, wo mir schließlich die beschädigte Linse operativ entfernt wird. Anfänglich habe ich ein paar Probleme mit der Räumlichkeit, gieße mir die Milch neben das Glas oder fege alles Mögliche vom Tisch. Aber das Gehirn stellt sich allmählich um, und ich gewöhne mich an die kleine Behinderung.
Miggi ist ein Freak. Alles interessiert ihn, und ich folge ihm mit Spannung. Wenn wir eine tote Ratte oder eine tote Katze finden, dann seziert er sie mit leicht sadistischer Lust vor meinen Augen. Oder muss ich jetzt sagen: Vor meinem Auge? Sein Vater ist jedenfalls im Besitz des dazu nötigen Bestecks und als Wissenschaftler günstigerweise selten zu Hause. So bekomme ich von Miggi alle inneren Organe der toten Tiere säuberlich auf dem elterlichen Wohnzimmertisch präsentiert. Manchmal werden sie auch nur gebraten oder noch einmal vom Ostseezug überrollt. Hin und wieder fürchte ich mich ein wenig vor diesem seltsamen Freund. Hinter meinem Rücken wagt er es einmal sogar, meinen kleinen Bruder zu malträtieren. Er kann stundenlang schweigen und beobachten. Ich folge dann seinem Blick und entdecke darüber seltene Vögel, lustige Kleintiere, Regenbögen und Windspiele.
Angenehm an der Nähe der sowjetischen Streitkräfte sind das von ihnen verwaltete Kapitulationsmuseum und die vielen »Russenmagazine«. Hier bekommen wir zuerst das berühmte russische Konfekt, mit frühester Pubertät dann auch Zigaretten und Wodka Lunikov. Die Mädchen beginnen uns zu irritieren, und wir brauchen das Zeug zur Unterstreichung unserer unglaublichen Coolness. Auch in der Schule werde ich cool und somit zum Ärgernis der Lehrer. Tadel und schlechte Noten halte ich den Mädchen gegenüber für kernig. Bei der Antierziehungsmethode meines verrückten Großvaters wird somit auch noch das dringend benötigte Taschengeld aufgebessert.
In unserer Klasse sind Miggi, Udo und ich das Trio Infernale. Udo heißt eigentlich Olaf, aber er beherrscht alle Lindenbergtexte in original Nuschelslang. Wir haben lange speckige Haare und stinken nach Nikotin. Unsere Vorbilder sind Udos große Brüder, durch die wir auch an alle Lindenbergsongs rankommen. Überhaupt die großen Kerle aus der 10. Klasse, also die mit langen Haaren, Schellparka, ausgewaschenen Jeans und Römerlatschen. Einer davon, er heißt Scholle, gefällt mir ganz besonders, und ich kann ihn perfekt imitieren. Seitdem werde auch ich von all meinen Freunden und sogar von meinem Vater Scholle genannt. Der Hauptgrund unseres Gehabes ist aber eindeutig Britta. Sie ist die Klassenschönste, überdurchschnittlich weit entwickelt und hört so abgefahrenes Zeug wie Suzi Quatro, Gary Glitter und THESWEET. Ich hänge sofort an der Nadel und nächtelang am Radiorecorder meines Vaters. Eine Sweet-Karaokeband wird gegründet, ich bin Andy Scott, der Gitarrist. Gitarren sind das Männlichkeitssymbol schlechthin. Miggi ist der Bassgitarrist Steve Priest. Udo will eigentlich lieber das Panik-Karaokeorchester aufmachen, aber muss nun Mick Tucker mimen. Der Drummer von THESWEET wird immerhin von unser aller Britta favorisiert! Sänger Brian Connolly wird vom ebenfalls blonden Jens dargestellt. Mein Vater besorgt mir über irgendwelche Umwege ein Live-Doppelalbum meiner Lieblingsband, und der Großvater baut mir die darauf abgebildete Gitarre in der Sperrholzvariante nach. Meiner Karriere steht also nichts mehr im Wege.
Der erste Gig findet im Wohnzimmer von Miggis Eltern statt. Die sind natürlich nicht vor Ort, dafür aber die gesamte Mädchenschar unserer Klasse. Wir sind höllisch aufgeregt und testen deshalb den von Miggis Vater persönlich angesetzten Hagebuttenwein. Reyki macht die Technik, bedient also den Plattenspieler und Kassettenrecorder parallel. Volumenregler auf Anschlag – volles Brett! In Sweet-typischer Kriegsbemalung entern wir das Sofa. Die dummen Hühner kichern. Doch dann geht es ab! Udo malträtiert zum Schlagzeugintro von Ballroom Blitz die armen Sofakissen. Jens, der sein kleines schwarzes Plastik-Mikrofon auf einen Besenstil geschraubt hat, shoutet los:
»Are you ready, Steve?« – »Aha!«
»Andy?« – »Yeah!«
»Mick?« – »Okay!«
»Alright now – then let’s start!!!«
Bass und Gitarre steigen gleichzeitig ein – also Miggi und ich! Vom Hagebuttenwein enthemmt, toben wir headbangend durch das Wohnzimmermobiliar. Das Gekicher verstummt, die Mädchen werden blass. Es dröhnt und scheppert, doch im fade out des Titels hören wir es an der Wohnungstür schellen. Sturm! Das werden irgendwelche Nachbarn sein, am Ende gar die gefürchtete Frau Pudwill. Nun werden auch die Rockstars blass. Glücklicherweise wohnt Miggis Familie Parterre, so können die Musiker und das gesamte Publikum die Wohnung unbemerkt durchs Fenster verlassen. Während es ununterbrochen weiter an der Tür klingelt. Wir verschanzen uns in unserem Lieblingsbunker auf dem Tierparkgelände, Miggi hat noch was von Papas gutem Wein dabei. Noch authentischer als unser erster Auftritt wird die erste Aftershowparty. Die Mädchen wollen ein bisschen knutschen, wir schweben vor Stolz in anderen Sphären, lassen uns feiern, lachen, trinken. Und kotzen! Was das Zeug hält. Es wird schon fast dunkel, und der Alkoholpegel sinkt allmählich. Parallel dazu die Laune meines besten Freundes. Er ahnt wohl, was ihm blüht – sein Vater ist nicht zimperlich!
Ich bin infiziert vom Virus des Rock’n’Roll. Und von Britta. Natürlich im Doppelpack mit Miggi. Allein würde es keiner von uns wagen, sie anzusprechen! Im Unterricht belästigen wir die Angebetete mit pubertären Sprüchen. Eines Tages klingeln wir aber verschämt an Brittas Wohnungstür, sie wohnt im selben Aufgang wie Miggi. Freundlich lässt sie uns rein, und wir bestaunen ihre Zeichnungen. Meistens abgemalte Portraits von Mick Tucker.
Bravoposter stehen hoch im Kurs, nur wenige sind im Umlauf. Ein kleines kostet 20 Ostmark, ein großes Poster sogar 50. Hohen Wert besitzen auch die Fußballbilder aus der Sprengelschokolade. Dagegen bin ich allerdings immun, Fußball interessiert mich nicht. Vielleicht, weil mir das Geschick für diese Sportart fehlt. Ich kann zwar wie ein Irrer losrennen, aber ein Talent für Technik ist mir nicht gegeben. Die Comics von Hannes Hegen, mit den Digedags und Ritter Runkel, sind ebenfalls eine krisenfeste Währung. Sie bringen 5 Ostmark das Heft, ältere sogar noch mehr. Einige musste ich schon einbüßen, um an ein begehrtes Poster von THESWEET zu gelangen. Das alles geht mir durch den Kopf, doch dann greife ich plötzlich nach Brittas Hand. So war es ausgemacht. Miggi krallt sich todesmutig die andere. Mit unseren freien Händen grabschen wir unisono nach Brittas knospender Brust und stürzen Sekunden später aus der Wohnung. Bei den Tischtennisplatten werten wir unser Erlebnis mit glühenden Gesichtern aus. Wir sind fix und fertig. So etwas Schönes haben wir beide noch niemals berührt! Wir sind glücklich, doch schämen uns auch ein wenig. Vielleicht erzählt sie es ihrer Mutter! Wir klingeln also noch mal an Brittas Tür und entschuldigen uns. Auch sie sieht ein wenig verstört aus, verspricht aber, nichts weiterzusagen. Als wir ihr fortan gemeinsame Liebesbriefe schreiben, entscheidet sie sich schließlich: Sie will mit mir gehen! Meine erste Freundin! Ich bin sehr befangen, so ohne Miggi, und bekomme bei gemeinsamen Spaziergängen nicht viel über die Lippen. Eigentlich reden wir nur über Musik, und zum Abschied gibt es einen züchtigen Kuss. Nach ein paar Wochen küsst sie sich mit dem zwei Jahre älteren Coco auf andere Art. Vor meinen Augen, an den Tischtennisplatten. Coco hat eine entfernte Ähnlichkeit mit Mick Tucker.
Mein erster Liebeskummer lässt mich nicht schlafen, ich heule in die Kissen und brauche Trost von meiner Mutter. Der arme Reyki, mit dem ich mir ein Zimmer teile, ist beunruhigt. Er kann meine Aufregung nicht nachvollziehen. Doch meine Liebe schlägt schnell in Hass um. Die arme Britta hat es nicht leicht. Miggi, Udo und ich sind die Chefs in der Klasse, sie kriegt also die geballte Ladung. Brittas Martyrium hält allerdings nicht lange an, denn bald darauf verlieben wir uns in Conny.
Sie ist ein Jahr älter, und ich schreibe die Liebesbriefe diesmal gemeinsam mit Jens. Der Frontmann unserer Sweet-Karaokeband ging in Connys Klasse, bevor er sitzenblieb. Wieder habe ich das Glück, erhört zu werden, aber Conny stellt Bedingungen. Jens muss dafür mit ihrer Freundin Heike gehen. Ich muss dem geschäftstüchtigen Freund mehrere seltene Mosaikhefte überlassen, bevor er auf den eigentlichen Deal eingeht.
Als ich mit Conny ins Kino gehen möchte, ergibt sich das erste Problem wegen unseres Altersunterschiedes. Der Film ist ab 14. Ich werde nicht reingelassen, und sie ist sauer auf mich. Bei nächster Gelegenheit bemängelt sie meine Zurückhaltung, wünscht sich Zärtlichkeit. Küssen und so weiter. Ich gebe also meinem inneren Drängen nach und erkunde fortan bei jeder sich bietenden Gelegenheit die weibliche Anatomie. Unter einer Decke, direkt am Badesee des Pionierparks Wuhlheide, erleide ich meinen ersten Samenerguss. Es ist mir peinlich, dass ich meine Freundin so albern bekleckere, und sie ist auch nicht gerade erfreut. Aber in meinem Kopf erscheinen mir wundersame Farben, und als sich die erste Aufregung legt, werde ich von einem angenehm bittersüßen Gefühl erfasst. Letztendlich lachen wir über das seltsame Erlebnis, und Conny erklärt mir zärtlich ihre Liebe und dass auch Mädchen dieses Kopfkino erleben können. Sie hat Ahnung, und ich werde eingeweiht. Jeder kann es für sich machen, und wir machen es nun so oft es geht miteinander. Noch nicht so ganz wie Mann und Frau, aber auf unsere eigene befriedigende Art.
Miggi will alles ganz genau wissen, und ich erzähle ihm, was ich weiß. Ich habe nun nicht mehr so viel Zeit für meinen Busenfreund, und er neigt sich in seiner Eifersucht demonstrativ in Richtung Udo. Ich nehme es gelassen. Viel mehr Sorgen macht mir mein Bruder Reyk, weil ihm meine Gang ohne mich nicht zur Verfügung steht. Ich habe nur noch Augen für die Eine und schlendere mit ihr Hand in Hand über den Schulhof. Die Kerle ihrer Klasse machen sich lustig darüber, dass ich jünger bin, und drehen mit Nuckeln behangen ihre Runden um uns. Am schlimmsten treibt es Schingming, ein berüchtigter langer und sehniger Typ. Er hängt mir regelrecht am Arsch. Ich dreh mich um und schubse ihn weg, sofort sind wir von einer schaulustigen Meute umringt. Schingming drückt mir eine Faust aufs Auge. Nun gehe ich auf Nahdistanz, bekomme ihn in den Schwitzkasten, und da muss er bleiben. Mir schwillt derweil das Auge zu. Macht nichts, es ist das linke, auf dem ich sowieso nichts sehe. Miggi greift nicht ein. Egal, ich hab die Sache auch selbst im Griff! Am kommenden Tag begegne ich Schingming im Treppenhaus und mustere ihn düster mit dem heilgebliebenen Auge, er dagegen grinst mich fröhlich an und präsentiert eine verbundene Hand. Wir werden Freunde.
Connys Vater ist ein älterer, geheimnisvoller Mann. Ich nenne ihn das Phantom. Er hat einen Agentenroman geschrieben, der auch verfilmt wurde: Das unsichtbare Visier, mit Armin Mueller-Stahl in der Hauptrolle. Er scheint selbst dieser Agent gewesen zu sein, denn er schreibt unter einem Decknamen. Die Familie des Phantoms lebt in einem mir bisher nicht begegneten Luxus. An Wochenenden und während der Schulferien bewohnt Conny mit ihren Eltern eine riesige Villa in Wendenschloss an der Dahme, ansonsten ein üppiges Haus in Karlshorst. Es ist vollgestopft mit Büchern, Bildern und Antiquitäten. Conny besitzt eine Plattensammlung, dass mir die Augen feucht werden. DEEPPURPLE, LEDZEPPELIN, ROLLINGSTONES – alles, was das Herz begehrt. Natürlich auch THESWEET. Das ist eine komplett andere Welt, ich sehe keine volkseigene Ware. Das Phantom hingegen macht einen auf Kommunismus. Nicht so romantisch wie mein Vater, sondern eher so wie die Pappfiguren aus der »Aktuellen Kamera«. Die läuft hier natürlich jeden Tag, aber in Farbe – ich werde im wahrsten Sinne aus schwarzweißen Träumen gerissen! Das ist ein besserer Intershop, und es riecht auch so wie in den Läden, wo man nur für D-Mark einkaufen kann. Ich weiß gar nicht, ob dieser privilegierte Mensch überhaupt einen Schimmer davon hat, wie die Wirklichkeit aussieht. In seiner Rhetorik erinnert er mich an Karl-Eduard von Schnitzler, der in seiner Sendung »Der schwarze Kanal« so eifrig als Frontkämpfer des Kalten Krieges auftritt. Das hat einen leichten Touch von Comedy.
Meine Klassenlehrerin Frau Schröder ist auch so eine seltsame Marionette. Wir schreiben einen Aufsatz über Hobbys, ich erwähne meine Leidenschaft für die Digedaghefte mit Ritter Runkel und wähle als Überschrift: Jedem das Seine. Meine Arbeit wird nicht benotet, dafür hält Frau Schröder vor der ganzen Klasse mit eiskalter Miene Gericht über mich. Diese meine Überschrift hätten bereits die Nazis verwendet, um alle kommunistischen Widerstandskämpfer zu verhöhnen. Sie prangte über dem Eingangstor des Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar. Ich hatte natürlich keine Ahnung, bin total erschrocken und nun schon wieder ganz unfreiwillig zum Faschisten geworden. Mein Vater tickt aus, als ich ihm die Story erzähle. Rennt in die Schule und macht die Dame zur Schnecke. Ich kann ihn nicht aufhalten! Er meint, dass Frau Schröder so extrem links wäre, dass sie schon wieder rechts aufschlägt. Mein Vater muss es wissen, denn er ist für mich der wahre Kommunist.
Ich komme mit Miggi überein, dass es sich bei dem Phantom um ein ganz hohes Tier von der Stasi handeln muss. Wir wollen auch für DM intershoppen und besuchen deshalb, wie immer hintenrum, den Tierpark Berlin – bewaffnet mit Küchensieben und Schnüren, an denen wir große Magneten befestigen. Wenn wir die durch die Brunnen ziehen, bleiben Westpfennige daran kleben. Überall wo Wasser ist, schmeißen die Touristen ihr Geld rein. Miggi steigt sogar in die künstlichen Teiche der Tropenhalle, während ich Wache schiebe. Wie ein Goldsucher durchsiebt er den Schlamm. In den flachen Goldfischpools des Raubtierhauses angeln wir per Hand sogar größere Münzen raus. Unsere Beute beträgt am Ende fast 10 Deutsche Mark. Wir knallen den Riesenhaufen Kleingeld in einer Plastiktüte auf den Tresen des Intershops vom Hotel Stadt Berlin am Alexan-derplatz und bekommen dafür drei Schachteln Dumont und zwei Büchsen Cola. Die gute Coke wird sofort weggezischt, die eleganten Westzigaretten wollen wir uns dann zur Jugendweihe gönnen.
Miggi und ich kaufen uns genau die gleichen Anzüge, die gleichen Schuhe, Hemden, Schlipse. Wir sind wieder das Dreamteam! Alle sollen an unserem großen Tag sehen, dass wir zusammengehören. Im Kino International nehmen wir mit stolzgeschwellter Brust den Ritterschlag entgegen. Wir fühlen uns schon längst nicht mehr wie Kinder, aber endlich ist es offiziell. Zur Feier im Alextreff rückt meine gesamte Spreewälder Verwandtschaft samt Lieblingscousin Hardy an. Polli, mein Berliner Lieblingscousin, teilt sich mit Hardy und mir eine Flasche süßen Rotkäppchensekt und muss bereits nach einer halben Stunde entsorgt werden. Bei jedem Familientreffen sind die beiden meine Hauptkumpane.
1976 fahre ich ein letztes Mal gemeinsam mit meinen Eltern und meinem Bruder in einen längeren Urlaub. Nach Boltenhagen, an die Ostsee. Zwei endlose Wochen bleibt meine Freundin Conny allein in Berlin zurück. Ich bin pappesatt und mache keinen Hehl aus meinem Frust über die Zwangstrennung. Meine armen Eltern sind einfach nur ratlos angesichts ihres pubertierenden Sohnes. Umso besser läuft es mit Reyk. Extremverbrüderung, wir sind wie Latsch und Bommel. Für unsere Vorhaben reicht das elterliche Taschengeld bei weitem nicht aus. Hinter einem Kiosk klaue ich kistenweise leere Pfandflaschen, die ich Reyki über den Zaun reiche, damit er sie vorn wieder abgeben kann. Wir brauchen Eis. Nicht irgendein Eis. DAS Eis, die Mutter aller Eise – aus einer Softeismaschine! Ich träume noch heute davon. Außer DEM Eis sind wir auch noch einem Spielautomaten verfallen. Es kommen alle DEFA-Indianerfilme im Kino, jeden Tag ein anderer. Gojko Miti´c ist einfach ein besserer Mensch, genauso wie die Digedags und unser Vater. Kommunisten eben! Und abends kommen gemäßigte Rockbands auf die Freilichtbühne am Fußgängerboulevard, alle spielen sie die internationalen Dauerbrenner nach. Das geht gut ab. 60 Prozent der öffentlich aufgeführten Musik muss aber aus eigenem Anbau stammen, und so wird als Alibi hin und wieder eine zusammengeklaute »Eigenkomposition« eingestreut. Bei den Boltenhagener Rocknächten hält sich eigentlich nur Wolfgang Ziegler mit seiner Gruppe WIR an die Quotenvorgabe. WIR übererfüllen den Plan sogar und bringen nur eigene Nummern auf die Bühne. Kein richtiger Rock’n’Roll, aber auch kein dummer Schlager. Ganz flott, würde meine Großmutter Mimi wohl sagen. Am Ende ist der Familienurlaub doch nicht so übel.
Ich habe jetzt zwei Langspielplatten von den PUHDYS, die gefallen mir ganz gut, aber die beste Ostband ist ganz eindeutig die KLAUSRENFTCOMBO! Eigentlich kenne ich nur drei Titel der Band, sie befinden sich auf dem Amiga-Sampler Hallo Nr. 4. Der Renftsound wühlt auf, ebenso die Texte. Sie richten sich immer gegen Engstirnigkeit. Zwischen Liebe und Zorn, Cäsars Blues und Baggerführer Willi. Mein Vater singt lachend mit.
One, two, three – wer behauptet da, der Willi sei in unserm Sinne nicht ganz einwandfrei? One, two, three sagt der Baggerführer Willi, doch morgen sagt er ganz bestimmt schon eins, zwei, drei!
Ich kriege gute Laune, obwohl ich nicht so richtig verstehe, worum es hier eigentlich geht. Die Gartenzwergkommunisten finden das jedenfalls gar nicht lustig und sind von den kleinen kabarettistischen Spitzen derart aufgewühlt, dass sie der RENFTCOMBO bald darauf die Spielerlaubnis entziehen. Durch meinen Vater interessiere ich mich immer mehr für deutschsprachige Musik. Reinhard Lakomy finde ich gut, ebenfalls die abgedrehte Schlagersängerin Nina Hagen. Aber die Wortgebirge der meisten Ostbands sind ganz seltsame Kopfgeburten. Kein deutschsprachiger Musikathlet kommt auch nur im Entferntesten an Udo Lindenberg ran. Der Panikrocker verdrängt sogar meine alten Glamrockidole.
Immer mehr verstehe ich auch den Musikgeschmack meiner Mutter und vermute, dass ihre ekstatischen Verrenkungen zu den Klängen des Soul irgendetwas mit Sex zu tun haben könnten.
Otis Redding, Ike & Tina Turner, THETEMPTATIONS und dieser herrlich bellende James Brown! Diese Art von Musik hört man nun auch in den Hitparaden, allerdings in schaumgebremster Form. Das Zwitterding nennt sich DISCO und wird ausschließlich von dunkelhäutigen Menschen performt. Sie stöhnen und tanzen in hautengen Glitzergewändern: George McCrae mit Rock your baby, KC & THESUNSHINEBAND mit That’s the way und natürlich HOTCHOCO-LATE mit You sexy Thing. Die erste Zeile des Liedes wird immer lauthals mitgesungen: Alle lieben Mirko ... Es handelt sich aber um einen kollektiven Verhörer, heute weiß ich, dass es eigentlich I believe in miracles hätte heißen müssen.
Ein weiterer Discohit ist Daddy Cool von BONEY M. – die Sensation dieser Band ist ein Tänzer. Miggi imitiert dessen Tanzstil absolut perfekt und ist damit der Chef aller Tanzflächen, die wir gerade erobern. Freitags immer die des Kreiskulturhauses Lichtenberg. Wir glühen mit einer Flasche billigsten Rotweins vor und können unsere Tanzkünste ungehemmt der staunenden Damenwelt vorführen. Um 22 Uhr geht das Neonlicht an, und alle unter 16 werden aussortiert. Coitus interruptus! Wir verstecken uns noch unter dem Tisch von Udos älteren Brüdern, doch es gelingt nicht, die peinliche Selektion zu umgehen. Wir sind jetzt eine größere Clique, ein paar langhaarige coole Typen sind dazugestoßen, darunter mein ehemaliger Rivale Schingming. Er wohnt mit seiner Mutter in einer Kleingartenkolonie, dort befindet sich auch die Beerenlaube. In dieser Kneipe sind alle Gesetze aufgehoben, da fragt kein Mensch nach einem Ausweis. Die Karawane zieht also dorthin. Nach dem dritten Bier bin ich völlig hinüber, aber die Coolness steht gerade meilenweit über der Vernunft. Ich quäle mir noch mal die doppelte Menge rein und markiere ausgiebig den relativ weiten Nachhauseweg. Es will nicht aufhören. Völlig erschöpft schlafe ich irgendwann neben der heimischen Kloschüssel ein. Mein Vater findet mich weit nach Mitternacht und trägt mich sanft in mein Bett. Ich stelle mir vor, was mein Freund Miggi jetzt auszustehen hätte. Ich liebe meine Eltern. Jetzt kann ich die Freiheit genießen, die mich als Kind mitunter ängstigte. Ich hatte mich nur nach einer überschaubaren Welt gesehnt.
Ich merke allerdings immer öfter, dass mein geliebtes Land sehr überschaubar ist, und das will mir als nun heranwachsendem Menschen gar nicht gefallen. Ich bin vom Marionettentheater der ostdeutschen Medien irritiert und von der Engstirnigkeit der pseudokommunistischen Hofschranzen regelrecht provoziert. Diese speichelleckenden Kleinbürger erhoffen sich eine Karriere und sind die Schmeißfliegen des Alltags. Ihr vorauseilender Gehorsam ist nur lächerlich. Mein Vater kämpft mit der Fliegenklatsche bewaffnet für den wahren Kommunismus und wird auf den Versammlungen seiner Partei dafür gerügt. Die SED ist längst von den Feinden des linken Ideals unterwandert.
Das Politbüro, also die großen Gralshüter, sind alt und debil. Durch ihre Verfolgung während des Faschismus meinen sie, das Recht auf ewige Führung beanspruchen zu können. Die jüngeren Hardliner sind privilegierte Eremiten, die in ihrer Sonderwelt den Blick auf das eigentliche Leben verloren haben. Wie Connys Vater, das Phantom. Wahrscheinlich wollen die auch alle gar nichts mehr sehen und sind einfach nur eitel, erregt von ihrer Macht.
Unsere Klasse tritt geschlossen der Freien Deutschen Jugend bei. Ähnlich wie die Jugendweihe wird dieser Festakt als ein weiterer Schritt zum Erwachsensein empfunden. Als dann aber der kollektive Beitritt zur Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft ansteht, weigern sich Miggi, Udo und ich. Obwohl wir in unmittelbarer Nachbarschaft zu sowjetischen Offiziersfamilien leben, hat sich bisher leider keine Freundschaft ergeben. Ja, dankbar sind wir natürlich. Für die Befreiung vom Hitlerfaschismus und für die Russenmagazine, von denen wir so unbürokratisch mit Zigaretten versorgt werden. Aber ist das schon Freundschaft?
Vielleicht ist diese Verweigerung auch nur eine Klatsche gegen Frau Schröder, das Phantom & Co. Ich fühle mich provoziert und provoziere zurück, gehe zur Christenlehre, trage in der Schule ein großes Kreuz mit gusseisernem Jesus und einen Schellparka mit Amiflagge. Das findet nun auch mein Vater albern, und er rennt diesmal nicht Sturm, als ich eine Vorladung beim Direktor erhalte. Der Direktor macht keinen großen Aufstand, aber ich glaube, er hat Angst vor Frau Schröder.
Die Atmosphäre in der 15. Oberschule »Valentina Tereschkowa« in Berlin-Karlshorst ist aber vergleichsweise sehr gemäßigt, was wohl unserem liberalen Direktor zu verdanken ist. Aus dem erweiterten Freundeskreis erfahren wir Geschichten, die uns erschauern lassen. Später merke ich immer wieder, dass die sozialistische Erziehung sehr individuell ausgelegt wird. Eine Führungsfigur hat in der DDR Bewegungsfreiheit, die freilich selten mutig genug an die Grenzen geht. Auch mein Vater leitet einen kleinen Betrieb, und ich lerne noch viele freie und offenherzige Menschen kennen, die mich an eine Zukunft meines Landes glauben lassen.
In der 8. Klasse übernimmt die warmherzige Frau Hannemann unsere Führung. Und es gibt Herrn Böhme und Herrn König und vor allem Frau Kühn, unsere Deutschlehrerin. Ich liebe ihre Leidenschaft für klassische Gedichte. Und er warrrf ihr den Handschuh ins Gesicht – den Dank, Dame, begeeehrrr ich nicht! Und ich bin wieder dabei und der brave Dirki. In Chemie, Physik, Mathematik und Russisch habe ich dagegen komplett den Anschluss verpasst. Alles, was ich über die Naturwissenschaften weiß, verdanke ich Hannes Hegen und seinen Digedagheften. Der Erfinder der populären Comics heißt eigentlich Johannes Hegenbarth und wohnt ebenfalls in Karlshorst. Ich erfahre es durch Zufall, denn der Vater meines Freundes Jens hat ein Eisenwarengeschäft in Schöneweide, wo Herr Hegenbarth eine gute Bohrmaschine im Tausch gegen ganz seltene Mosaikhefte ersteht. Bückware gegen Bückware sozusagen. Jens bekommt außerdem eine Führung durch die Comic-Manufaktur, und ich hänge mich hinten ran. Wir sehen Entwürfe von Figuren und Landschaften, Rohzeichnungen des Meisters, wie diese dann mit der Hand ausgemalt und im nächsten Arbeitsschritt ordentlich umrandet werden. Wir bekommen Vorabdrucke der nächsten beiden Hefte und erfahren geschockt, dass es fast die letzten sein werden. Auch Hannes Hegen hat Probleme mit der Kleinkariertheit, er fühlt sich in seiner künstlerischen Freiheit eingeschränkt.
Ich empfinde die Jugendzeit in der Karlshorster Enklave als hell und habe sie als einen nie enden wollenden Sommer in Erinnerung. Unsere Partyzentrale ist das Haus der Familie Hoelzke. Christians Mutter ist eine bekannte Schauspielerin und der Vater ein erfolgreicher Regisseur. Wir sind auch willkommen, wenn die mal zu Hause sind.
Ich bin mit Miggi, Udo, Schingming, Jens und einigen anderen langhaarigen Kunden immer auf der Jagd nach guten Partys. Wir fahren zu Livekonzerten nach Friedrichshagen, nach Woltersdorf und in den Plänterwald, hängen im neu erbauten Palast der Republik ab oder einfach nur am nahe gelegenen Biesdorfer See. In den Sommerferien laufen wir durch den Spreewald, ich kenne alle Geheimwege von meinem Vater. Sogar Brittas älterer Lover Coco schließt sich den Wanderern an. Als ich mir an einem Zeitungskiosk die FRÖSI kaufe, rastet er allerdings aus. Es ist eine Zeitung für Junge Pioniere.
Bei einer Klassenfahrt verliebe ich mich in Michaela, mit der mein Busenfreund leider auch schon geliebäugelt hatte. Ich habe es nicht ernst genommen, und Miggi ist zerknirscht, als sich das hübsche scheue Mädchen schließlich mir zuwendet. Michaela ist die Klassenbeste, eigentlich will keiner von uns so richtig zu ihr passen, denn wir gehören zu den Problemschülern. Jedenfalls hole ich Michaela fortan von verschiedenen Kursen ab und begleite sie bis zur Haustür. Im Gegensatz zu Conny reicht ihr anscheinend diese Art von Geselligkeit. Ich bin längst nicht mehr so verklemmt wie bei Britta – aber all meine Bemühungen werden lediglich mit kleinen züchtigen Küsschen belohnt. Als ich nach etwa einem Monat im Kino ihre Brüste berühren möchte, wehrt sie mich empört ab. Nach einem weiteren Monat ziehe ich mich allmählich zurück, und entgegen jeglicher Erwartung sehe ich Tränen in Michaelas Augen, als ich mich nach weiteren Wochen geschlagen gebe. Mit dem 9. Schuljahr verlässt das intelligente Mädchen unsere Klasse für ein Abitur auf einer Erweiterten Oberschule. Eine Brieffreundschaft hätte mir nun wahrlich nicht genügt!
Leider werde ich auch von Miggi verlassen, er zieht mit seinen Eltern an den Rand von Berlin. Wir besuchen uns, so oft es geht. Die Herbstferien verbringe ich bei ihm in Eichwalde. Die SEXPISTOLS rollen gerade die Musikszene auf, wir stechen uns alle möglichen Sicherheitsnadeln durch die Ohrläppchen. Aber es bleibt bei den vordergründigen Accessoires, im Herzen lieben wir Melodien und raffinierte Grooves. Neil Young ist eine weitere gemeinsame Entdeckung. Wir haben den gleichen Blick, die gleichen Gefühle. In diesen Tagen verlieben wir uns schließlich gemeinsam in Kirstin. Schwer. Sie ist eine echte Blondine mit herrlichen blauen Augen. Diesmal leide ich. Miggi hat keine Zeit mehr für mich, Kirstin ist seine erste große Liebe.