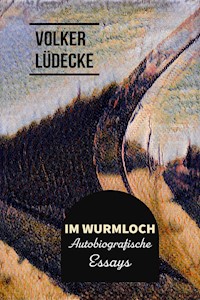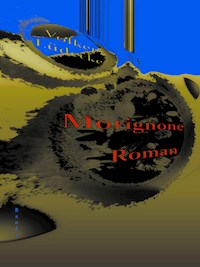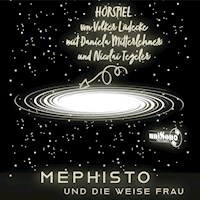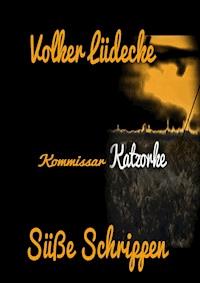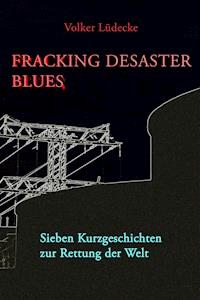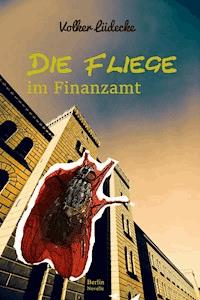
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Konstantin hat Pech, seine Steuererklärung wird von einer schlecht gelaunten Finanzbeamtin in Berlin Kreuzberg bearbeitet, was zur Folge hat, dass er einen Bescheid bekommt, der den beruflich Selbständigen komplett aus der Spur bringt. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich seinen Fotoapparat zu schnappen und auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof als Paparazzi Jagd auf Prominente zu machen, die dort ihre verstorbenen Angehörigen besuchen. Als er sich sicher ist, die Tochter solch einer höheren Persönlichkeit abgelichtet zu haben, wird er durch sie immer tiefer in Probleme verwickelt, während die Finanzbeamtin Helga Durm, die ihm das eingebrockt hat, heimlich an Lyrikwettbewerben teilnimmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Lüdecke
Die Fliege im Finanzamt
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Impressum neobooks
1.
Volker Lüdecke
Die Fliege im Finanzamt
Alle Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder ähnlichen Handlungen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Berlin gilt als die Stadt des Nachtlebens, der nicht müde werdenden Partyszene und der bunten Künstler und Lebenskünstler.
Ein attraktives Reiseziel für junge Touristen aus der ganzen Welt, die ihre Dollars, British Pound, Dänische Kronen oder was es sonst noch an Währungen gibt, über ihre Ausgaben in Bars und Hotels indirekt in die Schatulle dieser notorisch klammen Stadt fließen lassen.
Für diesen Dienst an den Finanzen der Stadt belohnt Berlin seine Künstler durch jährliche Ausschreibungen von Stipendien und Projektförderungen, für deren Erreichen sich meistens hunderte Kulturschaffende gleichzeitig bewerben, so als werfe ein Geflügelfarmer eine Handvoll Weizenkörner in den Hühnerstall seiner Legebatterie und sämtliches Federvieh stürze im selben Moment laut gackernd darauf zu.
„Wenn ein Autor mit seiner Arbeit zu geringe Einkünfte erzielt, ist seine Schriftstellerei keine Arbeit, sondern Liebhaberei.“
Ratsch, sauste der Stempel auf die Akte mit den eingereichten Unterlagen zur Gewinnprognose des armen Literaten, die der optimistische Schreiberling nach Aufforderung durch das Finanzamt dorthin gesandt hatte. Danach folgte das übliche Kürzel als Unterschrift, und die seine Akte bearbeitende Finanzbeamtin, eine gewisse Helga Durm, die solch hoffnungslose Fälle beinahe täglich bearbeitete, schloss das Deckblatt der Akte.
„Fantasieprodukte!“
Grauenhafte Verzerrungen der Wirklichkeit, was ihr an Unterlagen zur zukünftigen Gewinnerzielung mal wieder eingereicht wurde!
„Eine Unverschämtheit, was diese Künstler sich anmaßen, und unerträglich, wie die Papiere riechen!“
Sie strich sich eine blonde Strähne aus ihrem noch jungen Gesicht und schnäuzte sich in ein Taschentuch.
Zigarettenqualm und andere Odeurs haftete an vielen dieser eingereichten Beweismittel künstlerischer Selbstbetrachtung und eingebildeter Relevanz, so dass ihr manchmal übel davon wurde.
Augenblicklich sehnte sie sich nach ihrem Pferd, das auf einer Weide weit draußen am östlichen Stadtrand der Metropole graste. Die frische Luft dort konnte sie nur am Wochenende genießen, denn nach Dienstschluss im Finanzamt Friedrichshain Kreuzberg lohnte sich ein Ausflug unter der Woche nicht.
Soeben brachte ihr der Laufbursche der Poststelle des Finanzamts einen Stapel neue Kuverts, an deren krakeliger Adressaufschrift sie gleich erkennen konnte, wie es um die Absender bestellt war.
Keine moderne EDV, mit Hilfe derer die Kuverts gleich mit Adresszeile bedruckt waren, erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass wieder eine dieser armseligen, selbständigen Künstlerexistenzen hoffte, mit einer Verlustabrechnung seiner beruflichen Existenz ihre Gnade zu erwirken.
„Das Finanzamt ist nicht das Sozialamt!“
Die unerfüllbaren Kreativträume dieser Sonderlinge und verpeilten Existenzen zu refinanzieren würde das Land Berlin in den Ruin treiben, war die feste Überzeugung der Mittdreißigerin Helga Durm. Wer keinen finanziellen Gewinn erzielte, dem mangelte es doch höchstwahrscheinlich an künstlerischer Klasse, so dass er auch sicher in Zukunft keinen Gewinn erzielen würde.
„Können diese Selbstverwirklicher sich sparen, ihre losen Blätter mit Kaffee- und Rotweinflecken drauf.“
Der Kollege Möllner durchquerte das Vier-Mitarbeiter-Büro und kam verständnisvoll grinsend auf sie zu.
„Wieder Muffpost erhalten?“
„Kann ich den Gang bis zur Kantine mit pflastern.“
Sie deutete auf ein fleckiges Blatt Papier, was zuvor wohl auf einem Küchentisch neben der Butter gelegen hatte.
„Unleserlich. Muss ich entsorgen!“
„Hier, schau dir mal den hier an. Prominenter Schreiberling. Viel Vergnügen!“
Möllner legte ihr einen Aktenordner vor und kurvte zurück an seinen Schreibtisch.
„Erstmal muss ich mir jetzt die Hände waschen. Mahlzeit!“
Mit spitzen Fingern ließ sie das Butterpapier in den Abfall segeln und ging hinaus.
Vor jedem Gang zum Mittagessen in die Kantine reinigte sie sich gewissenhaft von den Bazillen und Viren der siechenden Berliner Künstlerriege. „Proleten“ wollte sie nicht sagen, denn sie hatte ihre Wurzeln im Osten der Stadt, wo das Proletariat einst hohes Ansehen genossen hatte. Und den Begriff „Subproleten“ fand sie unaussprechlich.
Ja, sie achtete auf Wörter, denn neben ihrem Pferd war das Reimen von Gedichten ihre Leidenschaft. Beides half dem Gemüt über den tristen Alltag im Finanzamt, der auch durch das sichere Gehalt am Monatsende nicht vollkommen kompensiert werden konnte.
Dermaßen sinnierend bediente sie mehrfach den Seifenspender in der Damentoilette, bevor sie sich vor den Fahrstuhl zur Kantine in die Schlange der dort wartenden Kollegen einreihte.
Von den grauen Flurwänden hallte vielstimmig und monoton der ewige mittägliche Behördengruß: „Mahlzeit!“
2.
Auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin liegt die kulturelle High Society der vergangenen Jahrhunderte unter der Erde begraben. Ein Ort zur Inspiration, dachte sich Konstantin Reuter, prominenter Krimiautor aus Detmold, seit dreizehn Jahren wohnhaft in Berlin.
Die Toten sind Geschichte und erzählen Geschichten aus Perspektiven, wie sie die Lebenden niemals einnehmen könnten.
Zwischen den Gräberzeilen spazierend kam er an der Grabstelle eines prominenten Denkers vorbei, Johann Gottlieb Fichte, 19. Mai 1762 – 29. Januar 1814.
Reuter kramte im Gedächtnisbestand seiner Allgemeinbildung, schemenhaft liftete sich die Philosophie des Deutschen Idealismus aus dieser Grube. Kant, Hegel, dessen Schreibstil er während seines Studiums gehasst hatte.
Er blickte vom Grabstein hinauf in die Höhe des Geästs eines Baumes und sah in dessen Schema gleich die vielfältige Verästelung der Einflüsse der deutschen Philosophie des Idealismus auf die Literatur der deutschen Klassik und Romantik bis heute.
Goethe, Schiller und Herder wirkten mit ihren Werken, diesen alten, halbblinden Spiegeln aus längst vergangenen Tagen, bis hinüber in unsere Gegenwart.
Selbst wenn die Schüler in den Schulklassen des Deutschunterrichts sich an ihnen langweilten und manche Bevölkerung ihre Schriftsteller zu Lebzeiten demütigte und hasste, nach deren Ableben verbreiten sie eifrig ihre Schriften und setzen Heerscharen von Studenten auf jeden Notizzettel an, der im Papierkorb eines verblichenen Dichters und Denkers vor dem ewigen Schredder gerettet werden konnte.
Konstantin Reuters zuletzt veröffentlichter Band, „Das Blut unter den Dielen von Neukölln“, passte schon vom Titel her nicht in den illustren Kreis jener Geistesgrößen im Dichterolymp dieser Ruhestätte.
Sein Taschenbuch verkaufte sich immerhin erstaunlich gut, vor allem nach der Rezension im „Tagesspiegel“, eine jener Berliner Tageszeitungen, die seit der Wiedervereinigung vergeblich um internationales Ansehen als Hauptstadtblatt rangen.
Jahrelang hatte er mit mäßigem Erfolg versucht, sich in der Berliner Literaturszene Gehör zu verschaffen, und dann unverhofft dieser plötzliche, nahezu unerklärliche Aufschwung.
Reuter schreibt seine durch die Straßen mäandernden Figuren wie eine Liebeserklärung an einen Vergessenen, dessen aufgeschriebene Sätze in keine Zeit passen.
So stand es im Tagesspiegel.
„Meine Sätze passen in keine Zeit?“
Was wollte das meinen, „Liebeserklärung an einen Vergessenen“?
Meinte die Rezensentin mit dieser Sinnschleife etwa, dass er ein zeitloser Autor war?
Oder wollte sie versteckte Kritik anbringen, dass sein Kriminalroman „Das Blut unter den Dielen von Neukölln“ keinen substantiellen Bezug zur Wirklichkeit habe?
Er grübelte, auf das mit Efeu bewachsene Grab von Ernst Litfaß schauend, hin und her, kam aber bald zu dem Schluss, dass es letzten Endes gleichgültig war, was diese Tagesspiegel Rezensentin gemeint haben wollte, denn das Blatt war ja auch nichts anderes als eine Litfaßsäule.
Einige Berliner, die noch Zeitung lasen, hatten sich seit seiner kleinen Erwähnung dort für Konstantin Reuters Kriminalromane interessiert, und zwar besonders für seinen zuletzt publizierten Band „Das Blut unter den Dielen von Neukölln“.
Auf seinem Sterbebett würde er vielleicht eines Tages seufzen, mein größter Erfolg war „Das Blut unter den Dielen von Neukölln“.
Sein Verlag, der ihn zwischenzeitlich als Karteileiche geführt hatte, drängte seitdem auf einen Folgeband, aber Reuter wollte seine Leser jetzt erst recht durch literarische Qualität überzeugen.
„Meine Leser zu begeistern, das kostet eben Zeit.“
Seinem neuen Manuskript fehlte noch der besondere Kick, die für den Leser unvorhersehbare, überraschende Wendung.
Vor ein paar Tagen, im Café M, wo er gelegentlich schreibend vor seinem Laptop saß, hatte er sich durch einige Gäste gestört gefühlt, die ihn offenbar mit einer Figur aus seinem Buch identifizierten.
„Was soll man solchen Idioten sagen? Nein, ich habe niemanden erschlagen? Ich bin nicht der Mörder aus meinem Buch?“
Die Schattenseiten der Bekanntheit ließen sich aber noch ganz gut ertragen. Reuter ging es seit einem halben Jahr richtig gut. Nur fiel es ihm nicht mehr ganz so leicht, sich auf seine Schreibarbeit zu konzentrieren, weshalb er immer öfter den Dorotheenstädtischen Friedhof aufsuchte.
Auch im Frühsommer ein morbider Ort, an dem es Reuter wie nirgendwo sonst gelingen sollte, seine fast perfekten Morde zu planen.
3.
Helga Durm hatte ihr Mittagessen in der Kantine des Finanzamts eiliger als gewöhnlich verspeist und eilte nun aus dem Speisesaal zum Eingang des Fahrstuhls, denn sie wollte einige Minuten vor den Kollegen zurück im Büro ihrer Abteilung sein.
Eines Tages würde sie entweder eine berühmte Lyrikerin sein, mit einem eigenen Haus jenseits des Speckgürtels der Stadt mit seinen uniformen Neubausiedlungen, oder zumindest in einem eigenen Büro allein ohne Kollegen den Status in der Direktion des Finanzamtes genießen. Mit Mitte dreißig war es noch lange nicht zu spät und auch nicht zu früh für solche Karrierepläne.
Am heutigen Tag hatte sie die Mittagspause mit besonderer Spannung erwartet, denn nach ihrer Teilnahme an einem Lyrikwettbewerb lag seit dem Morgen ein ungeöffnetes Schreiben des Literaturbüros Brandenburg auf ihrem Schreibtisch.
Sie hatte das Kuvert immer wieder angefasst und in der Hand gewogen, aber mit der in ihr immer weiter anwachsenden Spannung dennoch ungeöffnet gelassen.
Sie dachte an ihre gelungenen Verse, die sie zum Literaturwettbewerb eingesendet hatte. I
In den ersten Frühlingstagen, nach einem langen und tristen Berliner Winter, waren ihr die Zeilen wie kleine Eingebungen in den Sinn gekommen.
Wo der Wind die fauligen Blätter des vergangenen Herbstes zu modernden Häufchen angesammelt hatte, an den Pfählen des Weidezauns ihres Pferdes mit dem Namen „Hübchen“, waren ihr die Zeilen ihres Gedichts sozusagen in den Sinn geweht.
„Einsame Distel.
Wehrhaft stehst Du am Wegesrand,
Kein Wanderer hat dich je gebrochen
Du drohtest allen mit blutender Hand
Denn Dornen sind deine Waffen.“
Inbrünstig murmelte sie die erste Strophe ihres Gedichts halblaut vor sich hin, während sie das Kuvert öffnete.
Heraus fiel das Blatt, auf dem sie auf liniertem Papier in Schönschrift ihre Zeilen eingesandt hatte, mehr nicht.
Kein Kommentar, kein Gruß, keine Erläuterungen der Juroren zu ihrer Teilnahme. Nicht einmal Kritik. Einfach nichts.
Die getrocknete Tinte ihrer Handschrift verschwamm zu einer unleserlichen Kladde, als sich ihre mit Tränen füllenden Augen überliefen.
Weniger war nicht nötig, um sie zu verletzen, als dieses EDV automatisch adressbeschriftete Kuvert ohne Briefmarke. Eine durch die Frankiermaschine gejagte Verspottung ihres lyrischen Empfindens und Schaffens!
Kurze Zeit zuvor war sie sogar versucht gewesen, das Kuvert im Beisein ihrer Kollegen zu öffnen. So sehr hatte sie in Gedanken an ihre Dichtkunst gehofft und schon innerlich triumphiert. War sich sicher gewesen, bald als neue literarische Entdeckung zu gelten.
Als sich die Tür zum Büro öffnete und Kollege Möllners Sonnenbank gebräuntes Gesicht im Rahmen seiner schwarz gefärbten Haare in der Tür auftauchte, täuschte sie einen Schnupfen vor und schnäuzte vernehmlich laut in ein Taschentuch, dass sie sich im letzten Moment vor der Entdeckung ihrer Tränen vor Nase und Augen gehalten hatte.
„Stauballergie?“
Sie deutete auf den Umschlag mit dem Absender Konstantin Reuter und nickte mit geschwollenen Augen.
„Die kratzen sich am Sack, waschen sich nach dem WC nicht die Hände, kiffen und huren ihr Leben lang herum, aber wir müssen ihre Syphilis Umschläge trotzdem öffnen. Weißt Du, was der geschrieben hat? „Das Blut unter den Dielen von Neukölln“! Da kannst Du dir besser gleich Gummihandschuhe anziehen.“
Möllner entrüstete sich wohlwollend stellvertretend für seine Kollegin, während Durm bloß zustimmend nickte und sich sodann, wie etwas suchend, in einer Schublade ihres Schreibtisches verkroch. Doch plötzlich fuhr sie wieder daraus hervor und schleuderte einen Aktenbeschwerer gegen die Wand.
„Zum Kotzen!“
Es blieb ein sichtbarer Abdruck an der Wand.
4.
Um die Mittagszeit strömten viele in Berlin-Mitte tätige Büroangestellte in die kleinen Schnellrestaurants und Imbissstuben der Torstraße, wo auf den Gehsteigen aufgestellte Tische und Stühle ein sonniges Plätzchen zum Essen und Plaudern anboten.
Nur wenige suchten sich für ihre Mahlzeit einen ruhigen Ort, um auf einer Parkbank ihre morgens mitgebrachten, belegten Brote zu verspeisen.
Reuter verachtete diese Leute, die sich nicht entblödeten, einen Friedhof aufzusuchen, um dort auf einer Parkbank vor den Grabsteinen Wurst- und Käsestullen zu verdrücken.
Den vielen Spatzen und Tauben gefielen die Krümelmonster, wie Reuter sie scherzhaft getauft hatte, dagegen sehr. Sie scharrten sich um die wenigen Friedhofsbänke und stritten laut zwitschernd um die herabfallenden Krümel.
Reuter ahnte nicht, dass etwa zur gleichen Zeit im Finanzamt Friedrichshain Kreuzberg seine Steuerakte von einer angehenden Lyrikerin bearbeitet wurde, deren Gemütszustand sich gefährlich im roten Bereich befand.
Er hatte den ganzen Morgen über nachdenklich an seinem neuen Fall gearbeitet, also am Folgeband, und die überraschende Wendung, die seinen Kommissar und mit ihm seine Leserschaft in großes Erstaunen versetzen sollte, meinte er nun gefunden zu haben.
Mit Eigenlob sparte Reuter nicht, ein genialer Einfall für einen Kriminalroman, so seine Überzeugung.
In einem Neuköllner Hinterhof schreit nachts eine Frau um Hilfe und ihr Nachbar aus dem dritten Stock, der ihren Vergewaltiger mit einem gezielten Blumentopfwurf niederstreckt, muss anschließend vor dem tobenden Mob des Familienclans des Getroffenen flüchten. Am nächsten Morgen entdeckt er sein Foto in der Bildzeitung, mit der Überschrift: wegen Mordes gesucht.
Reuter überlegte logischerweise, ob sich eine Lovestory zwischen dem Blumentopfwerfer und der geretteten Nachbarin anböte? Der Nachbar war wahrscheinlich schon lange scharf auf sie, wodurch seine Rettungstat in neuem Licht erschiene: mehr als Eifersuchtsdrama. Denn vielleicht waren die Hilferufe der Frau ja nur Teil ihres sonderbaren Liebesspiels?
Reuter schwankte innerlich hin und her, ob er seinen Lesern die Trivialität dieser Verkettung von Zufällen zumuten wollte, oder ob er lieber mit einer erneuten Wendung des Falls die gängigen, vor Spannung ächzenden Segel der Crimestory verlassen wollte, um von einer Metaperspektive aus das Genre insgesamt zu ironisieren?
Seine langen Beine ragten wie eine Stolperfalle von der Friedhofsbank auf den Gehweg, als sich ein Mann in Arbeitskleidung, ähnlich wie Straßenarbeiter sie tragen, neben ihm Platz nahm. Er entnahm einer Plastikbox eine mit Wurst und Käse belegte Stulle und begann ungeniert hungrig, daran abzubeißen.
Die Hand des Mannes, die Reuter aus den Augenwinkeln beobachtete, wie sie in kurzen Abständen seinem Mund das Brot zuführte, hatte verkrustete schwarze Ränder, Hornhaut und Schorf, und unter den Fingernägeln klebte schwarzer Dreck.
„Ganz in der Nähe, in der Humboldt Uni, gibt es eine öffentliche Kantine.“
Der Mann im Arbeitsdress nickte.
„Weeß ick.“
Dann kaute er, Salamischeiben schlingend, weiter.
„Wenn die Toten Appetit kriegen, möchte ich hier nicht anwesend sein.“
„Die nehmen, was sie kriegen können. Würmer, und was sonst noch unter der Erde haust.“
Reuter gefiel das Gespräch, denn sein Banknachbar war sicher keiner der gut gekleideten Versicherungs- oder Immobilienmakler, die sich gelegentlich aus einem der nahen Büros hinter die Friedhofsmauern verirrten. Die wären bestimmt, außer über ihre Prämien und Gewinnmargen zu reden, für keinen außergewöhnlichen Gesprächstoff zu gebrauchen gewesen.
„Hab gerade einen Schädel ausgebaggert.“
Das Schmatzen neben Reuter blieb einen Moment lang unterbrochen, nur das laute Gezeter der Spatzen war noch zu hören.
„Ich hab Sie hier schon öfter gesehen. Angehöriger?“
„Nein, ich genieße die Ungestörtheit an diesem Ort. Hilft mir beim Nachdenken. Und Sie sind also der städtische Totengräber?“
Der Mann nickte fast unmerklich und seine Kaugeräusche waren wieder zu hören. Welch ein ausgefallener Beruf, dachte Reuter, während er sich dessen Anker mit Herz Tattoo auf dem Unterarm näher betrachtete. Er mutmaßte, dass es von einem Zellengenossen gestochen wurde, so wenig kunstvoll, wie es aussah.
„Ein Beruf mit Zukunft. Und Sie?“
„Krimiautor.“
Der Totengräber lachte.
„Kann man davon leben?“
„Mal so, mal nicht. Aber im Moment läuft es gut. „Das Blut unter den Dielen von Neukölln“ geht wie geschnitten Brot.
Der Totengräber grinste.
„Die Kollegen auf den beiden Neuköllner St. Thomas Kirchhöfen haben immer Konjunktur. Die beneiden mich um meinen ruhigen Job hier in Mitte.“
„Prominente leben länger?“
„Für gewöhnlich.“
Der Totengräber stopfte das Brotpapier in die leere Plastikbox und stand auf.
„Dann noch frohes Schaffen, Herr Kriminalromanautor!“
„Sie mich auch, Herr Totengräber!“
Sie gaben sich beinahe freundschaftlich die Hand und der Totengräber schlenderte gemächlich den geraden Weg entlang, bis er links abbog und zwischen Büschen und Bäumen aus dem Blickfeld Reuters verschwand.
Später beobachtete Reuter seinen neuen Bekannten aus der Ferne, wie der zentimetergenau mit einem kleinen Schaufelbagger eine neue Grabstätte inmitten der Hauptstadt aus dem Berliner Urstromtal aushob.
„Liegt wohl mal wieder ein Prominenter im Sterben.“
Inspiriert von seinen Eindrücken machte sich Reuter auf den Weg zur Arbeit.
5.
Die Arbeitsstunden der Finanzamtsbeamtin Durm dehnten sich an diesem Nachmittag angesichts ihres emotionalen Ausnahmezustands zu ganzen Epochen unerträglichen Daseins.
Alle dreißig Sekunden schaute sie auf ihre goldene Armbanduhr. Doch die hatte keine Sekundenanzeige, sondern überließ diese allzu vergängliche Zeitbetrachtung lieber der Vorstellungskraft ihrer Besitzerin.
Durm wünschte sich nichts sehnlicher, als dass Kollege Möllner, der als einziger ihrer drei Kollegen im gemeinsamen Büro mit den vier Schreibtischen noch anwesend war, sich endlich mit seinem gewöhnlich monotonen „Schönen Feierabend“ aus dem Arbeitsraum in die Freiheit verabschiedete. Doch Möllner wälzte Akte um Akte, offenbar wollte er einen neuen, internen Tagesrekord für die Abteilung aufstellen.
„Bei Hübchen alles im Stall?“
Sie nickte ihm mit gesenktem Blick zu und signalisierte ihrem Kollegen mit stumm sich bewegenden Lippen, dass sie gerade eine Addition von Zahlen im Kopf durchführte. Sie glaubte an die heilsame Wirkung des Gehirntrainings, weshalb sie für kleine Summen nicht den bereitstehenden Tischtaschenrechner, sondern ihr Gehirn nutzte. Verständlicherweise war sie in solchen Momenten intensivster Konzentration nicht ansprechbar.
Nach einer Weile notierte sie eine Zahl.
„Hübchen geht´s gut. Steht ja im Wuhletal auf einer saftigen Weide.“
Möllner, in West Berlin aufgewachsen, diagnostizierte mit scharfem analytischen Blick die innere Verfassung seiner Kollegin: total frustriert!
Er wunderte sich etwas, denn vor der Mittagspause schien sie noch bester Laune. „Ich hatte heute das Kartoffelgratin. Grauenhaft!“
„Spaghetti mit Tomatensauce. Schmeckte wie Wasser.“
Das am meisten diskutierte Gesprächsthema im Finanzamt brachte nichts Neues. Eigentlich ist Frau Durm mit ihren langen blonden Haaren und dem ovalen Gesicht doch eine attraktive Frau, dachte Möllner. Nur leider vollkommen ohne Kommunikationspotential und soziale Kompetenz. Da kann es dann halt emotional nur mit dem Gaul harmonieren.
„Immer noch die Akte von diesem Konstantin Reuter?“
Möllner hatte noch nie große Lust verspürt, sich mit den Quittungen und Honorarverträgen von Künstlern zu befassen. Sobald welche bei ihm landeten, leitete er deren Akten gleich an Kollegin Durm weiter. Sie pflanzte ihm dafür im Gegenzug die arbeitenden Rentner und selbstständigen Gemüsehändler auf den Schreibtisch, denn schließlich musste jeder Mitarbeiter im Amt seinen Anteil an den schweren Fällen erledigen.
Das Geschäftsleben von Schriftstellern, Filmemachern, Regisseuren und Schauspielern schien Durm aus irgendeinem Grund zu interessieren.
„Jahrelang hat der Reuter nur Verluste geschrieben.“
Sie schaute Möllner mit einer unbegreiflichen Wut im Gesicht an.
„Jahr für Jahr hat der steuerlich abgesetzt. Und wir haben immer schön brav erstattet.“
Möllners Mundwinkel zuckten zwar, als wollte er etwas entgegnen. Doch bei ihrem wutverzerrten Gesicht schien es nicht ratsam, Partei für diesen Konstantin Reuter zu ergreifen. Obwohl er Möllners Meinung nach ein gutes Beispiel für eine gelungene Selbstständigkeit war. Im Grunde genommen sogar vorbildlich für alle Steuerpflichtigen, für die berufliche Eigeninitiative ein Fremdwort war.
Nach Möllners Auffassung schuf ein erfolgreicher Autor, ähnlich wie ein Bäcker sein Backwerk aus Wasser, Salz und Mehl knetete, allein aus seiner immateriellen Fantasie und seiner Recherche einen Wert, mit dem er neben seiner eigenen Existenz auch noch die Arbeitsplätze von Buchhändlern, Druckereiarbeitern und Onlineverkäufern sicherte.
„Immerhin ein erfolgreicher Autor.“
„Da erkenne ich keine Nachhaltigkeit.“
Sie schloss den Aktendeckel über den eingereichten Papieren und gab den Bescheid in die EDV Anlage ein.
Reuter würde somit in den nächsten Tagen per Post seinen Bescheid vom Finanzamt erhalten, dass er sämtliche steuerlichen Abschreibungen der vergangenen drei Jahre, jede Briefmarke, jeden Stift und die Miete für sein Arbeitszimmer, innerhalb von vier Wochen ans Finanzamt Friedrichshain Kreuzberg zurück zu erstatten hatte. Eine erkleckliche Rechnung kam auf den Schreiberling zu.
„Schönen Feierabend!“
„Schönen Feierabend!“
Als Möllner endlich draußen war, öffnete Helga Durm das Fenster. Weil der Verkehrslärm vom Mehringdamm, einer vielbefahrenen Straße vor dem Gebäude des Finanzamts, nun ohrenbetäubend herein drang, konnte sie sich nun ein kurzes, aber heftiges Schluchzen gestatten.
„Soll er sich um einen regelmäßigen Broterwerb kümmern, dieser blöde Reuter! Damit er mal sieht, wie schwierig es ist, neben täglich acht Stunden Arbeit einen Bestseller zu schreiben. Schluss mit seinem Ausruhen auf Kosten der Allgemeinheit!“
Kaum stand das Fenster ein paar Sekunden lang offen, flog mit hörbarem Brummen eine dicke Fliege herein. Sie landete zuerst auf Möllners Schreibtisch, was Helga Durm nicht wunderte. Doch dann hob sie von dort wieder ab und steuerte ihre Flugbahn direkt auf die Lyrikerin zu.
Sie musste sogar mit dem Gesicht ausweichen, so selbstgefällig lenkte das dreiste Insekt seine Flugbahn.
Durm stand auf und wedelte mit den Armen, um das störende Biest wieder durch das Bürofenster ins Freie zu scheuchen, aber das minderbemittelte Viech verpasste den Ausgang. Kreiste wie betrunken torkelnd, sich keiner Gefahr bewusst, inmitten ihres Büros.
Sie griff sich die Akte Reuter noch einmal vom Stapel und schlug damit nach dem dicken Brummer, aber als sich einzelne Blätter aus dem Blattsammler lösten und auf den Fußboden segelten, räumte sie stattdessen lieber die gebrauchten Kaffeetassen vom Tablett und nutzte die braune Plastikunterlage als gewaltige Klatsche gegen den aufdringlichen Flieger.
Ihr emotionaler Zustand löste sich bald vollkommen in einer fanatischen Hetzjagd auf. Ihre ganze Wut auf die Jury des Lyrikwettbewerbs fokussierte die Finanzbeamtin Helga Durm auf diesen hässlichen Flieger.
„Du wirst vernichtet, Du Einwohner eines stinkenden Misthaufens!“
Sie würde diesen wahrscheinlich männlichen Brummer erlegen, und eines Tages würde sie auch über die Jury triumphieren! Das war sonnenklar, dieser Kampf wollte ausgefochten werden, und zwar sofort!
Beim Verfolgen des Fluginsekts spürte sie ihre Überlegenheit. Ein Kampf um Leben und Tod für das grünlich schimmernde Tier, das die überlegene Intelligenz der Beamtin mit allerlei überraschenden Flugbahnen narrte.
Durms vollschlanke, auf fünfundsechzig Zentimeter und einen Meter verteilte Körpermasse bildete das Katapult, mit dessen Hilfe sie weit ausholend Schlag auf Schlag gegen die deplatzierte Existenz ihres Gegners ausführte.
„Ein eingetragener Verein, diese Literaturgesellschaft. Da darf sich bestimmt jeder mal eben aus dem Lamäng heraus als Lyrikexperte aufspielen.“
Das Tablett traf rückwärtig beim Schwung holen für den beabsichtigten Schlag krachend gegen eine Schreibtischlampe, wobei das Leuchtmittel im Lampenschirm paffend implodierte. Hammerwerfen war im Schulsport Durms Lieblingsdisziplin in der Leichtathletik gewesen.
„Lyrikexperten! Dass ich nicht lache! Die sind nicht ansatzweise legitimiert. Solch eine entscheidende Instanz müsste staatlich geregelt werden.“
Der folgende Schlag mit dem Tablett fegte Möllners Satz farbige Kugelschreiber vom Desktop, doch die fluchtbereite Fliege parierte die sportliche Herausforderung mit sensationellen Reflexen.
„So, jetzt lernst du deutsche Gründlichkeit kennen, du Schmeißmonster!“
Sie schloss das Fenster zum Mehringdamm.
„Dein Zuhause auf dem Scheißhaufen wirst du nie wiedersehen!“
Wie zum Hohn landete der Brummer auf der Fensterscheibe, so als ahnte er mit seinem winzigen Gehirn, dass ein Schlag mit dem Tablett dort nicht in Frage kam.
„Wollen wir mal schauen, was unsere Bildenden Künstler zu bieten haben?“ Manche an der Finanzbehörde verzweifelnden Maler und Grafiker hatten zur Dokumentation ihrer kreativen Arbeiten Pappröhren mit Plakaten eingesandt, die seitdem in einem Spalt zwischen zwei hohen Aktenschränken einstaubten. Was ging es das Finanzamt an, ob die ihre Ateliermieten zahlen konnten?
Durm griff sich solch eine Röhre und zog sie mehrmals wie im Schwertkampf durch die Luft. Dann schlich sie sich mit Schritten wie in Zeitlupe an die Fliege heran.
Die Aussicht über Häuser und Kirchtürme im Fensterrahmen verschwamm, nur den grünlich schimmernden Punkt inmitten ihres Jagdreviers nahm sie in Betracht.
Dann spannte sie Muskeln in ihrem Körper an, von denen sie zuvor nicht einmal geahnt hatte, dass sie überhaupt existierten.
Der Schlag auf die Fliege, die noch kurz abhob, folgte mit ungeheurer Wucht und verletzte beim Streifen einen der Flügel. Sie stürzte zappelnd auf die Fensterbank, wo sie in Schräglage vergeblich wieder zu starten versuchte.
Die Beamtin der Finanzbehörde beobachtete diese verzweifelten Versuche des Insekts, sich doch noch zu retten, mit lyrischer Kontemplation. War dieser Todeskampf nicht Stoff für ein Poem? Was hätte Gottfried Benn an ihrer Stelle getan?
Auf dem Fußboden verstreut entdeckte sie Möllners farbige Softstifte. Das war wie ein Zeichen, dass sie es nicht verschieben sollte, nicht abwarten durfte, bis die Inspiration womöglich erloschen war.
„Die Fliege“.
Die Überschrift war schon mal geschafft. Das war ein Einstieg in den kreativen Prozess, wie sie ihn in den beiden Volkshochschulkursen „Kreatives Schreiben“ im vergangenen Jahr gelernt hatte.