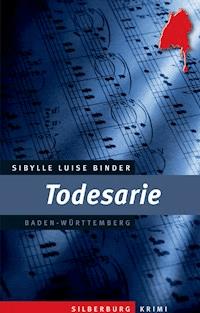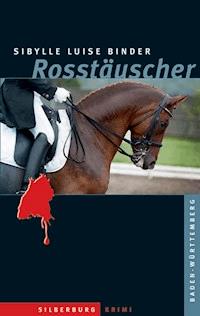14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Trakehnen im Sommer 1943. Auf dem berühmten Gestüt trifft man Vorbereitungen für die Flucht. Jesco von Esten, gerade schwer verletzt aus dem Krieg zurückgekehrt, soll eine 50-köpfige Trakehner Stutenherde nach Westen bringen. Auf dem Rücken seines Hengstes Preußenlied führt er seinen Treck bei eisiger Kälte über das gefrorene Frische Haff… Hochspannend und gespickt mit historischen Fakten schildert Sibylle Luise Binder die legendäre Flucht der Trakehner, auf der Pferde und Menschen sich gegenseitig das Leben retteten und zu einer Einheit wurden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Stattdessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
KAPITEL 1
ABSCHIED UND WILLKOMMEN
Ostpreußenim September 1943
Sophie-Charlotte von Esten-Lohmoor leistete sich ein kleines Seufzen, steckte ihr Taschentuch ein und drehte sich um. Sie ging über die alte Kastanienallee in Jesensee, an deren oberem Ende das Gutshaus mit allen seinen Nebengebäuden – Ställe, Leutehäuser, Remisen – stand. Sie kannte hier jeden Stein, jeden Baum, jeden Busch. Dort drüben, die alte Eiche, an der Mauer – dort hatte Jesco sie zum ersten Mal geküsst. Es war Sommer gewesen, Jesco war aus dem Internat für die Ferien nach Hause gekommen – und da war’s passiert. Sein Vater hatte ihn vom Bahnhof abgeholt und als er zuhause vor der kleinen Freitreppe ausgestiegen war, war es für Sophie gewesen, als wenn sie einen Schlag in den Magen bekommen hätte.
Abgereist war er als 16-jähriger, pickeliger Junge, nur ein Strich in der Landschaft. Zurück kam er als Mann – breitschultrig, mit einem dicken Schopf dunkelblonder Haare und einem energischen Kinn. Sie hatte ihn angestarrt, als wenn er ein Fremder wäre, und doch, in seinen Augen hatte sie ihren Jesco, den Freund ihrer Kindheit, wiedererkannt. Sie waren immer noch braun mit Goldfünkchen um die Iris und sie schauten immer noch ein wenig schüchtern, trotz der schnittigen Uniform der Kadettenanstalt.
Sie war 17, ein paar Tage vor Jesco zur Welt gekommen, doch im Gegensatz zu ihm, dem Freiherrn von Esten-Lohmoor, dessen Geburt mit „Der Erbe ist da!“ bejubelt worden war, war sie die Tochter des Verwalters, auf die niemand sonderlich achtete. Sicher, ihr Vater liebte sie, aber er hatte eine Menge zu tun und war froh gewesen, als die Herrin des Gutes, Jescos Mutter Christine von Esten, ihm nach dem Krebstod seiner Frau die damals 2-jährige Sophie abgenommen hatte. So war sie tagsüber im Gutshaus gewesen und nur abends zum Schlafen die lange Allee hinuntergerannt, um bei ihrem Vater im Torhaus zu schlafen.
Trotz der fehlenden Mutter war sie ein fröhliches Kind gewesen. Sie hatte Jesco gehabt, mit dem sie durch Haus und Park tobte. Als die beiden älter wurden, hatten sie ihren Kreis erweitert – sie waren im zum Gut gehörenden, großen Persingsee1 geschwommen, hatten gefischt, im Herbst im Wald Eicheln, Bucheckern und Pilze gesucht und sie an einem offenen Feuer gebraten.
Jescos Vater Gottfried von Esten war Kavallerieoffizier gewesen, wurde darum auch „der Herr Major“ genannt, liebte Pferde und züchtete mit ein paar Stuten. So war’s gekommen, dass Jesco und Sophie schon sehr früh Kontakt zu Pferden gehabt hatten und dass sie reiten gelernt hatten.
Aber dann hatte Jesco in die Kadettenanstalt nahe Berlin gemusst und Sophie in die Höhere Töchterschule in Hohenstein2. Im Sommer bedeutete das, dass sie rund 18 Kilometer mit dem Fahrrad durch dichten Wald fuhr. Im Winter fuhr sie mit dem kleinen Schlitten und einer alten Stute, die dann den Tag über im Stall eines Bauern am Ortseingang von Hohenstein stand und auf sie wartete.
Sophie hatte schon sehr früh gewusst, was sie werden wollte: Landwirtin. Natürlich lachten sie ihr Vater und der Gutsherr erst aus. „Ein Mädchen als Landwirt? Was für eine komische Idee! Du kannst doch einfach einen Landwirt heiraten, wenn du in dem Bereich tätig werden willst!“, hatte ihr Vater gesagt. Aber auf Jesensee wurde niemand davon abgehalten, mitzuarbeiten, und sowohl der Major als auch Sophies Vater hatten geduldig ihre Fragen beantwortet. Den beiden Männern hatte die eifrige Schülerin Freude bereitet und so war sie in alles einbezogen worden, was Gut Jesensee betraf.
Sophie hatte dabei geholfen, die Pläne für die Drainage einiger neuer Wiesen zu machen; sie hatte Pferde vor dem Pflug geführt; gelernt, wie man wo Dampfmaschinen einsetzen konnte, und in der Buchhaltung geholfen.
Bei Jesco wurde die Berufswahl nie diskutiert. Er war der Erbe und es war klar, dass er einst auf Jesensee leben und arbeiten würde. Bis dahin würde er, wie alle seine Vorfahren, als Offizier in der Armee dienen – möglichst bei der Kavallerie, denn er liebte Pferde und war ein guter Reiter.
So sah die Planung aus, als er in jenem Sommer 1926 für die Sommerferien nach Jesensee kam. Sophie war bei den Pferden, als er ankam, doch bevor er ins Haus ging, kam er in den Stall, um nach seinen Lieblingen zu schauen. Und dann standen sie voreinander und entdeckten einander neu: Sophie sah zum ersten Mal den Mann in dem Jungen, mit dem sie aufgewachsen war, und Jesco begriff, dass seine kleine Kameradin langsam zur Frau wurde.
Drei Tage schlichen sie umeinander herum, befangen und überwältigt von den neuen Gefühlen. Und dann wurden die Kirschen auf dem alten Baum im Park reif, und Sophie hielt sich natürlich nicht an die Leiter, sondern kletterte auf einen Ast hinaus. Das alte Holz gab unter ihrem Gewicht nach, der Ast knackte und brach ab. Doch Jesco stand darunter und fing Sophie auf. Dabei lachten sie einander an, ihre Augen trafen sich, und anstatt sie auf ihre Füße zu stellen, hielt er sie fest.
Sie behauptete später, er habe sie geküsst. Er wiederum bestand darauf, sie habe sich ihm zugeneigt. Es wäre „unhöflich“ gewesen, sie dann nicht zu küssen – und Jesco war Kavalier.
Von da an waren sie ein Paar gewesen und es war ihnen wie eine Selbstverständlichkeit erschienen. Sie gehörten zusammen, sie verstanden sich ohne Worte. Ihre Umgebung gewöhnte sich daran, dass man selten einen ohne den anderen sah, wobei Jescos Mutter allerdings nicht beglückt war. Sie hatte die Tochter ihrer besten Freundin als standesgemäße Braut für den Sohn vorgesehen, und davon war sie auch nicht abzubringen, als Jesco schon 12-jährig eine ausgesprochene Abneigung gegen die zwei Jahre ältere, walkürenhafte Freya entwickelt hatte.
Die beiden Väter dagegen, die über ihre Stellung als Gutsbesitzer und Gutsverwalter hinaus Freunde geworden waren, nickten zufrieden, wenn sie Jesco und Sophie zusammen sahen, und fanden, dass diese Verbindung zu erwarten gewesen sei. Gottfried von Esten erklärte jedenfalls seiner Frau: „Was hätte er denn mit dieser Gans aus der Stadt gesollt? Der wäre hier langweilig geworden. Sophie passt.“
Nach dem ersten Sommer, als Jesco wieder abgereist war, hatte seine Mutter sich noch mit dem Gedanken getröstet, dass diese Jugendliebe die Trennung wohl nicht überstehen würde. Und zu Weihnachten hatte sie Freundin Anna samt Tochter Freya eingeladen. Freya, so fand Christine von Esten, war doch hübscher als Sophie, deren Figur immer noch knabenhaft war und die sich noch nie für Mode interessiert hatte. Auf dem Gut sah man sie immer nur in Reithosen, Stiefeln und einfachen Blüschen, dazu trug sie ihre dunkelbraunen Haare in einem praktischen Kurzhaarschnitt. Dass sich gerade daraus ein reizvoller Kontrast zu ihrem zarten Gesicht mit den großen, tiefblauen Augen ergab, fiel Christine von Esten nicht auf.
Aber Jesco sah es und ihn faszinierte es immer wieder. Freya hatte er zur Begrüßung mit einer knappen Verbeugung und einem gebrummten Gruß bedacht, danach hatte er sie kaum noch angeschaut – wann denn auch, wo er die ganze Zeit damit beschäftigt war, Sophie zu beobachten?
Als seine Mutter ihn schließlich auf seine „Gastgeberpflichten“ gegenüber Freya von Bertram angesprochen hatte, war er deutlich geworden. „Gewöhne dich daran, Mama: Ich gehöre zu Sophie.“
Im Sommer 1928 hatten Sophie und er dann über ihre gemeinsame Zukunft gesprochen. Heiraten, Kinder – mindestens zwei, fand Jesco, der das Dasein als Einzelkind nur bedingt gemocht hatte –, das Gut gemeinsam bewirtschaften und Trakehner züchten. Und so weit gediehen, erklärte Jesco dann seinem Vater, dass er in einer Offizierslaufbahn keine Zukunft sehe. Er wolle das Abitur machen und Landwirtschaft studieren.
Gottfried von Esten stimmte zu. Obwohl er auf Jesensee so abgelegen lebte, hielt er zwei Zeitungen und hörte Radio. Er war informiert und er sah die Zeichen am Horizont. Als gläubiger Protestant gefiel ihm überhaupt nicht, was sich da abzeichnete, und er war froh, dass sein Sohn als werdender Landwirt wohl nicht in Politik verwickelt werden würde.
Jesco hatte die Schule gewechselt, ein Jahr lang gebüffelt und es tatsächlich geschafft, gleichzeitig mit Sophie 1929 das Abitur abzulegen. Und zu der Zeit hatte Sophie schon durchgesetzt, dass auch sie in Berlin an der Landwirtschaftlichen Hochschule studieren durfte. Den Sommer 1929 verbrachten Jesco und sie noch mal am See, im Herbst fuhren sie mit ihren Vätern nach Hohenstein und stiegen in den Zug nach Berlin. Dort wohnten sie dann sogar Tür an Tür: Jesco bei einem ehemaligen Regimentskameraden seines Vaters und dessen ebenso sparsamer wie moralischer Frau; Sophie gegenüber bei einer Witwe, deren Sohn im ersten Weltkrieg gefallen war.
Dummerweise schienen sich beide Vermieter vorgenommen zu haben, über die Tugend und Moral des jungen Paares zu wachen. Gemeinsam lernen durften sie nur unter Aufsicht bei offener Türe, und spätestens um neun Uhr abends hatten sie sich – aber bitte sittsam ohne Küsse und Umarmungen! – voneinander zu verabschieden und jeder in das eigene, keusche Bett zu gehen.
Im Sommer 1930 löste dann Jesco einen nicht kleinen Ehekrach bei seinen Eltern aus. Er verkündete, dass er fest entschlossen sei, Sophie an seinem 21. Geburtstag am 11. November 1931 zu heiraten. Seine Mutter drohte darauf, ihn zu „enterben und zu verstoßen“, sein Vater nannte das „albernen Unsinn“ und fand schließlich ganz pragmatisch, es komme ja billiger, wenn Sophie und Jesco heirateten und sich in Berlin eine kleine Wohnung teilten. Und so weit gediehen, meinte er dann: „Eigentlich müsst ihr gar nicht warten, bis ihr 21 seid – wenn eure Väter zustimmen, ist es doch kein Problem, dass ihr diesen Sommer schon heiratet.“
Eine große Hochzeit hatten die beiden sowieso nie gewollt, also wurde die Feier zu ihrer Verehelichung kurzerhand mit dem alljährlichen Jagdball Ende September zusammengelegt. Ein paar Freunde und die Nachbarn wurden eingeladen, Jescos Mutter fand sich mit den bevorstehenden Ereignissen ab und lieh Sophie sogar ihren Brautschleier und die Tiara der Freifrauen von Esten-Lohmoor. Und so gab es die Feier im Saal des Gutshauses, danach traten die Frischvermählten zur Hochzeitsreise an – eine Woche an der Küste. Und dass es da fast durchgehend regnete, bekamen die beiden kaum mit.
Danach bezogen sie in Berlin eine kleine Dachstockwohnung und studierten zusammen, dementsprechend an der Hochschule „die Unzertrennlichen“ genannt. Gemeinsam hatten sie das Diplom absolviert, dann aber gingen sie getrennte Wege: Jesco war an das Institut für Tierzucht gegangen, Sophie hatte sich mit dem Anbau von Saatgetreide beschäftigt. Eigentlich hatten sie im gleichen Jahr promovieren wollen, aber 1939 kam der Krieg – und Jesco meldete sich freiwillig, wobei dahinter weder Patriotismus noch Kriegsbegeisterung steckte, sondern Pragmatismus: Er wollte zur Kavallerie und wusste, dass seine besten Chancen in einer frühen, freiwilligen Meldung bestand.
Tatsächlich sollte Jesco dann Anfang 1940 in die Kavallerieschule Hannover einziehen. Davor hatte er in Windeseile noch seine Dissertation beendet. Sophie unterdessen hängte noch ein Jahr daran – und war sehr froh darum, weil Jesco schon nach einem Vierteljahr in Hannover zur 1. Kavallerie-Division abkommandiert wurde, die in Frankreich an der Front stand. Von dort aus ging es dann über Danzig in den Osten.
Sophie flüchtete sich in Arbeit – und konnte doch nicht verhindern, immer wieder an Jesco zu denken. Zuhause hatte sie jedes Mal, wenn es an der Tür klingelte, Angst, dass es ein Telegramm oder Brief sein könnte, der ihr mitteilte, dass sie Witwe war.
Und dann, im Oktober 1941, bekam Jesco Urlaub. Sophie reiste nach Jesensee, selig im Gedanken, dass er nun wenigstens für zehn Tage in Sicherheit und bei ihr sein würde. Sie war weit davon entfernt, eine „tapfere Soldatenfrau“ zu sein. Sie war nicht stolz auf den schmucken Offizier an ihrer Seite – ihr gefiel er in seiner alten, hirschledernen Reithose zuhause in Jesensee besser.
Der Oktober in Jesensee wurde Sophie durch die neuesten Nachrichten von Jescos Regiment verdorben: Die Kavallerie-Division sattelte ab und stieg auf Panzer um – und Jesco sagte: „Ich bin froh. Nicht, dass ich gerne Panzer fahre. Aber ich bin froh, dass wir die Pferde raushalten. Die haben nichts mit unserem Krieg zu tun.“
Sophie war in diesen Tagen wütend. Sie sah, wie Jesco sich verändert hatte, wie er von einem fröhlichen, manchmal übermütigen Jungen zu einem ernsten und oft sogar bitteren Mann geworden war. Und sie, die nie Sympathien für die Nazis gehabt hatte – Gleichschritt und Parolen waren nicht ihre Sache –, begann, sie zu hassen. Sie waren schuld, dass Jesco in den Krieg gemusst hatte, sie waren schuld, dass die Welt so freudlos geworden war und Angst die Menschen beherrschte. „Sie stehlen uns unsere Jugend – und was bekommen wir dafür?“, hatte sie Jesco gefragt. „Wenn wir siegen, werden sie triumphieren und wir werden in einem Land der Großmannsucht, der Aufmärsche und Parolen leben.“
Und er hatte tief durchgeatmet und erwidert: „Keine Angst – sie werden nicht siegen. An Russland ist schon Napoleon gescheitert – und der war sicher ein begabterer Feldherr als der ehemalige Gefreite A.H.“
Damals hatten sie gehofft, der Krieg wäre bald zu Ende. Doch er zog sich – und je länger er sich zog, desto mehr schlechte Nachrichten kamen auf Jesensee an. Sophie war schon zweimal ins Dorf gegangen, um Beileidswünsche zu überbringen, und sie wollte schon nicht mehr zählen, wie viele „Wir trauern mit euch“-Briefe sie geschrieben hatte. Schulkameraden, Kommilitonen, ein Verehrer aus der Tanzstunde – und jedes Mal, wenn wieder ein schwarz umrandeter Brief kam und sie die Worte „für Führer, Volk und Vaterland“ und „in stolzer Trauer“ las, stellte sie sich vor, dass dazwischen „Jesco Leander Freiherr von Esten-Lohmoor“ stehen würde.
Seine Briefe halfen ihr nicht viel. Er schrieb regelmäßig, aber die Feldpost brauchte meist zwei Wochen, bis sie auf Jesensee ankam, und so war sich Sophie immer bewusst: Während sie seine Worte las, konnte er schon tot sein. Alpträume weckten sie nachts – ein brennender Panzer, Jescos Schreie; Jesco mit einem Loch in der Stirn, von einem Scharfschützen erschossen. Immer wieder wachte sie weinend auf und war am nächsten Tag wie zerschlagen. Dabei hatte sie eine Menge zu tun. Der Stallmeister war inzwischen auch eingezogen worden, also hatte Sophie seine Arbeit übernommen, vom morgendlichen Füttern und Misten über das Reiten und Fahren – ein Teil der schweren Pferde war für den Dienst bei der Artillerie eingezogen, also musste sie die jungen Pferde einfahren – bis hin zur letzten nächtlichen Runde Heu gegen zehn Uhr.
Und dann stand sie oft auf dem Hof, schaute in den Sternenhimmel, suchte den Nordstern und fühlte sich für einen kleinen Moment Jesco nahe – weil sie wusste, dass er abends auch nach dem Nordstern schaute.
Sommer 1943 – ein einsamer Sommer, denn Jesco war jetzt tief in Russland und hatte keinen Urlaub bekommen. Sophie war auf die Felder hinausgeritten, um nach den Kartoffeln zu schauen. Als sie danach aufs Gut zuritt, wunderte sie sich. Ihre Uhr – Hochzeitsgeschenk von Jesco und eigentlich sehr zuverlässig – zeigte 12 und sie erwartete eigentlich, die Mittagsglocke läuten zu hören. Doch auf Jesensee herrschte bedrückende Stille. Niemand war im Stall, die beiden dafür zuständigen Jungen waren wohl zum Essen ins Gutshaus gegangen, wo neben der großen Küche eine Halle mit langen Bänken und Tischen fürs Gesinde bereitstand.
Doch auch im Haus war kein Ton zu hören! Sophie stand in der Vorhalle, schlüpfte in die Filzpatschen, die sie immer über die Stiefel zog, um den Dreck nicht ins Haus zu schleppen, und lauschte auf die Treppe, die hinunter in den Essraum der Gutsarbeiter führte. Normalerweise hörte man Gelächter und das Klappern von Geschirr. Doch an diesem Tag nichts – die Leute schienen zu schweigen.
Ihr Magen verkrampfte sich und sie eilte durch die Halle ins Esszimmer. Der Tisch war gedeckt, aber keiner war da und auch nebenan der Salon war leer. Dafür drang leises Weinen aus dem letzten Raum in der Zimmerflucht. Sie eilte durch die Bibliothek und ins Arbeitszimmer ihres Schwiegervaters.
Er saß auf der Armlehne des alten Ledersofas und hatte den Arm um die Schulter seiner weinenden Frau gelegt. Als er Sophie sah, stand er auf und kam ihr entgegen: „Schwiegertochter …“
„Was ist geschehen?“ Ihre Stimme zitterte.
„Er wird vermisst“, antwortete Gottfried von Esten. „Kurz nachdem du losgeritten bist, kam das Telegramm seines Kommandeurs.“
Sophie fühlte, wie ihr schwindelig wurde. Sie musste sich am Türpfosten festhalten und erst einmal tief durchatmen. Ihr Schwiegervater fasste nach ihrem Arm und führte sie zum Sofa, wo die Schwiegermutter ihre Hand nahm. „Wie ist dir, Kind?“
Sophie senkte den Kopf. Sie wollte nicht weinen. Es hieß doch, er sei vermisst – nur vermisst, nicht gefallen. Sie sah ihn, wie er durch einen Birkenwald stolperte, die Uniform zerrissen, an einem Arm einen durchgebluteten Notverband. Aber er lebte! Sie war ganz sicher. Er lebte und er würde es schaffen. Wo immer er war, was immer er tun musste – er würde durchkommen.
Sie drückte die Hand ihrer Schwiegermutter. „Mutter, bitte – er ist nur vermisst. Ich weiß, dass er lebt und dass er zu uns zurückkommen wird.“ Sie wollte nicht um ihn trauern. Es wäre ihr wie Verrat erschienen, als ob sie ihn aufgegeben hätte.
Drei Tage später, als sie gerade aus dem Haus trat, kam ihr auf der Allee ein Postbote auf dem Fahrrad entgegen. „Ein Telegramm, Baronin!“ Er schaute neugierig zu, als sie mit zitternden Händen den Umschlag aufriss und das Formular auffaltete. Tatsächlich, es kam von seinem Regiment und sagte: „Oberleutnant v. Esten verletzt aufgefunden. Ins Lazarett überstellt.“
Nicht mehr – aber dennoch genug, dass Sophie ins Haus eilte, wo ihre Schwiegereltern beim Frühstück saßen: „Er lebt! Er ist verletzt, aber er lebt. Und jetzt ist er im Lazarett! Ob sie ihn dann wohl heimschicken?“
Fünf Tage ohne jede Nachricht. Sophie erinnerte sich, einmal in einem Buch gelesen zu haben, wie die Frau eines verletzten Offiziers nach Osten fuhr, um ihren Mann zu holen. Aber das war im vorigen Krieg gewesen. Trotzdem fuhr sie nach Neidenburg3, wo ein Teil des Regimentes lag. Sie traf einen Oberst, der auf Krücken mit einem Holzbein unterwegs war und der ihr klar sagte, dass es für sie „unter keinen Umständen“ möglich sei, zu Jesco ins Lazarett zu fahren. Aber: „Sie schicken alles, was transportfähig ist, so schnell wie möglich zurück ins Reich“, hatte er als Trost anzubieten. Und dass er sich melde, wenn er was über Jesco erfahre.
Tatsächlich rief er ein paar Tage später an: Jesco sei in einem Zug mit Verletzten unterwegs nach Königsberg. „Er soll morgen oder übermorgen dort eintreffen und wird dort in ein Lazarett gebracht.“
Für Sophie gab es kein Halten. Sie wäre mit dem Fahrrad nach Königsberg gefahren, aber zum Glück war das nicht nötig. Das Wetter war zwar schlecht und die Wege versanken fast im Matsch, aber sie hatte Creve Cœur und die braune Elfenhalle vor die Victoria-Kutsche gespannt und die beiden kämpften sich wacker durch Pfützen und Schlamm nach Königsberg.
Ihr Schwiegervater hatte ihr dort eine Adresse gegeben – ein alter Freund, ehemaliger Regimentskamerad, der etwas außerhalb ein Gut betrieb. Bei ihm fanden die Stuten Box und Futter, während Sophie zum Bahnhof eilte und sich erkundigte. An diesem Tag war noch kein Lazarettzug angekommen, aber man erwarte einen am späten Nachmittag.
So wartete sie auf einer Bank vor dem Bahnhofsgebäude, mehr als einmal von einem jungen Offizier angesprochen. Und endlich kam der Zug, doch mit ihm eine Enttäuschung: Sie eilte an ihm entlang, als die Verletzten fürs Königsberger Lazarett ausgeladen wurden, fragte – und erfuhr, dass der Zug aus einer anderen Gegend in Russland kam als der, in der Jesco verwundert worden war.
Am Abend fuhr Sophie auf dem klapprigen Fahrrad der Gutsbesitzerstochter zurück, schlief in einem Gästebett und machte sich am nächsten Morgen in aller Frühe wieder auf. Und dieses Mal war das Glück ihr hold: Kurz nach 11 Uhr traf wieder ein Lazarettzug ein. Wieder eilte sie über den Bahnsteig, von Trage zu Trage, jedes Mal mit einem bangen Blick in ein bleiches, eingefallenes Gesicht. Ein Mann war da, der so verbunden war, dass man nichts von ihm erkennen konnte, doch ein Blick auf die Hand, die auf seiner Brust lag, versicherte Sophie, dass sich unter all dem Mull nicht ihr Jesco befand. Und dann war da plötzlich eine vertraute Stimme: „Soph! Sophie, hier bin ich!“
Er stand neben dem Waggon, sehr mager geworden, die Uniform schlackerte an ihm, sein Gesicht sah grau aus, doch auf den ersten Blick schien ihm nichts zu fehlen. Sophie rannte auf ihn zu, wollte sich in seine Arme werfen – und dann stockte sie. Es fehlte doch etwas: Der linke Ärmel seiner Uniformjacke war hochgeschlagen und festgesteckt.
„Dein Arm …“ Sie schluckte und konnte nicht weiterreden.
„Den habe ich in Russland gelassen“, versuchte er einen müden Witz. „Wenigstens war es der linke.“ Mit der rechten Hand zog er sie an sich und küsste sie. „Es ist so gut, dich zu sehen.“
Er war ins Lazarett eingewiesen worden, doch als Sophie drei Stunden später mit der Kutsche vorfuhr, hatte er den Arzt überredet, ihn nach Hause zu entlassen.
Die ersten Tage wunderte sich Sophie, wie gefasst er mit seiner Verletzung und der Amputation umging. Was sie anging, so bedauerte sie natürlich, dass er seinen Arm verloren hatte. Aber gleichzeitig war da auch Erleichterung: Einarmig würde man ihn nicht nach Russland zurückschicken. Der aktive Dienst in der Armee war für ihn zu Ende.
Allerdings ließ seine Entlassung auf sich warten – und nach ein paar Wochen fuhr sein Vater nach Königsberg, um sich danach zu erkundigen. Er kam nach zwei Tagen zurück und verkündete: „Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht.“ Und dann fing er mit der schlechten an: Jesco würde nicht entlassen werden. Man überlegte, ob man ihn im Stab oder in der Verwaltung in Königsberg einsetzen solle.
Jesco biss sich auf die Unterlippe, als er das hörte. Nach einem Seufzen sagte er: „Das hätte ich mir denken können. Solange Krieg ist, lassen die keinen aus den Krallen. Da müsste man schon den Kopf unter dem verbliebenen Arm haben.“
„Du hast meine gute Nachricht noch nicht gehört“, lächelte sein Vater. „Ich habe von Königsberg aus einen Besuch in Trakehnen gemacht. Ihr wisst doch: Dr. Ernst Ehlert – der Landstallmeister4 – ist ein alter Freund von mir. Und er hat sich nach dir erkundigt, Jesco! Du hast ihm imponiert, damals, als du auf der Körung mit ihm über die Dark Ronald-Linie gesprochen hast.“
„Da war ich 17“, erinnerte sich Jesco.
„Und hattest schon einige Ahnung von Pferdezucht, fand Dr. Ehlert“, nahm Gottlieb von Esten den Faden wieder auf. „Er klagt, dass er wegen des Krieges ziemlich allein in Trakehnen ist. Er bräuchte dringend einen Landwirt mit Pferde-Erfahrung, der das Vorwerk Bajohrgallen leiten kann.“
„Bajohrgallen?“ Sophie schluckte. „Das sind die gemischten, leichten Warmblutstuten – so ziemlich das Edelste, was Trakehnen hat.“ Sie streichelte Jesco, der neben ihr saß, über den gesunden Arm. „Soviel ich weiß, stehen in der Herde sogar drei Nachkommen von deinem heißgeliebten Dark Ronald.“
„Nun“, sagte Gottlieb von Esten, „dein Einverständnis voraussetzend, hat Dr. Ehlert einen Antrag gestellt, dass man dich für diese Aufgabe in Trakehnen vom Militärdienst freistellt. Und seine Chancen, das durchzubringen, sind ziemlich gut. Er meint, die Verwaltung in Berlin schuldet ihm einen Gefallen.“ Er schaute seinen Sohn erwartungsvoll an. „Wie findest du das, Jesco? Ich hätte dich natürlich lieber hier, aber ich sehe ein, dass das Gestüt dich mehr braucht als unser Gut – und das läuft dir ja nicht weg. Noch sind ich und der treue Kuklas im Einsatz.“
Schon drei Tage später bekam Jesco seinen Einsatzbefehl: Vorübergehend für den Dienst im Haupt- und Landgestüt Trakehnen freigestellt. Ankunft dort in zwei Wochen – die letzten 14 Tage galten noch als Rekonvaleszenz.
Es war ein Freitagmorgen, an dem der Brief kam. An dem fand sich dann auch Wochenend-Besuch ein: Friedrich Wilhelm Graf von Tranckow und seine Frau Luise. Tranckow war Gottlieb von Estens ältester Freund. Die beiden hatten sich dereinst einen Hauslehrer geteilt, waren dann zusammen in die Kadettenanstalt gegangen und hatten schließlich sogar beim gleichen Regiment gedient. Sie waren auch so etwas wie „Nachbarn“ – nach ostpreußischen Verhältnissen zählten die rund 40 Kilometer zwischen dem großen Persing-See und dem in der Nähe von Allenstein5 gelegenen Gut Tranckow als „Nachbarschaft“. Und da passte es auch, dass der Graf Tranckow Taufpate von Jesco war.
Doch sein Besuch an diesem Samstag war nicht nur durch Freundschaft motiviert. Tranckow wollte etwas von den Estens und als man nach dem Essen um den Kamin herumsaß, rückte er damit heraus: „Ich habe ein Problem, zu dessen Lösung ich euch brauche. Ihr wisst, dass mein Verwalter sich schon vor drei Jahren freiwillig gemeldet hat. Ich habe mein Gut selbst geführt, aber in den letzten Monaten bin ich damit mehr und mehr in Schwierigkeiten geraten. Mein Rheuma …“ Er trank einen Schluck von dem Roten, den Gottlieb von Esten ihm eingeschenkt hatte, worauf seine Frau übernahm.
„Fritz’ Rheuma ist inzwischen wirklich schlimm geworden. Er kann oft tagelang nicht reiten, und mit der Kutsche rauszufahren, ist dann auch eine Qual für ihn. Außerdem verschlimmert es seine Schmerzen …“
„Ach, komm, Luischen!“ Ihr Ehemann tätschelte ihre Hand. „So schlimm ist es auch wieder nicht. Aber es ist schlimm genug, dass ich einen Verwalter brauche.“
„Hmm …“, Gottlieb von Esten gönnte sich selbst einen Schluck Wein. „Ich könnte Kuklas bitten, dass er nach den Feldern von dir schaut, die an unsere grenzen …“
„Das ist freundlich von dir, aber es reicht nicht“, erwiderte der Graf. „Aber …“, er wandte den Kopf und schaute Sophie an, „… ich habe an deine Schwiegertochter gedacht. Sophie, du hast doch dein Studium abgeschlossen?“
„Mit Promotion!“, vermeldete Jesco stolz und griff nach Sophies Hand. „Sie hat sogar ein ‚summa cum laude‘ bekommen. Ich hab’s nur zu einem ‚cum laude‘ gebracht.“
Friedrich-Wilhelm von Tranckow schaute Sophie sehr ernst an. „Frau Doktor, ich brauche Ihre Hilfe. Würden Sie nach Tranckow kommen und mein Gut verwalten? Wenigstens bis Kriegsende?“
Sophie schaute ihn an, dann Jesco, dann schüttelte sie den Kopf. „Das ist schwierig. Ich kann doch Jesco nicht alleine lassen! Er braucht doch Hilfe!“ Erst vor zwei Stunden, als sie sich zum Essen umgekleidet hatten, war er vor ihr gestanden und hatte sich anziehen lassen wie ein Kind: Knöpfe schließen, den Manschetten- und Kragenknopf einfädeln, die Schleife binden. Beim Essen schnitt sie ihm das Fleisch, schenkte Getränke nach; im Stall putzte sie ihm das Pferd …
Obwohl: Als er vor ein paar Tagen das erste Mal wieder aufs Pferd gestiegen war – ihre Creve Coeur hatte dafür herhalten müssen –, war Sophie erstaunt gewesen, wie gut es ging. Ja, natürlich hatte er beim Aufsteigen erst einmal Hilfe gebraucht und in der ersten Viertelstunde hatte sie ein bisschen Sorge um seine Balance gehabt. Vor allem, als Creve Coeur mit großem Tritt im Trab losmarschiert war, hatte Jesco kurz kämpfen müssen, um ins Gleichgewicht zu finden. Doch dann ging es von Sekunde zu Sekunde besser, und als er die Stute schließlich angaloppierte, sah es aus wie in alten Zeiten. Er saß mit der Lockerheit, die den geborenen und geübten Reiter auszeichnet, mit dieser Mischung von steter Aufmerksamkeit und Ausrichtung auf das Pferd und gleichzeitig Ruhe, die dem Pferd Gelassenheit vermittelt. Das hatte ihn immer ausgezeichnet und daran hatte anscheinend auch der Verlust des Armes nichts geändert.
Als er danach mit Sophie ins Haus zurückgegangen war, hatte sie gefragt. „Hast du damit gerechnet, dass du so gut klarkommst?“
„Ja.“ Eine ganz klare Antwort. „Schau, ich hab’ das doch gelernt.“
„Wie? Bist du nach der Verletzung schon geritten?“, hatte Sophie sich gewundert.
„Nein, nein, natürlich nicht.“ Ein Schatten war über sein Gesicht geglitten. „Die haben mich aufgelesen, auf einen Lastwagen verfrachtet und ins Lazarett gekarrt. Danach habe ich natürlich kein Pferd mehr gesehen. Aber einhändig reiten ist für einen Kavallerie-Offizier doch kein Problem! Was denkst du, was du im Feld bei einer Attacke machst? Kannst ja nicht auf einen zustürmen und sagen, ‚Entschuldige, lieber Gegner, kannst du mal warten, bis ich die Zügel in einer Hand geordnet und meinen Degen aus der Scheide gezogen habe?‘ …“
Er hatte bei der Vorstellung gelacht, aber Sophie hatte schaudernd die Schultern hochgezogen und nach seiner Hand gefasst. Er war hier. Er hatte es hinter sich. Man würde ihn nicht aufs Schlachtfeld zurückrufen. Das musste reichen – und nein, sie würde dabei nicht darüber nachdenken, wie privilegiert sie anderen Frauen gegenüber war.
Doch nun war da Graf Tranckow und schaute sie erwartungsvoll an. Und Jesco – und einen Augenblick empfand Sophie es wie einen Verrat – sagte: „Naja, ich kann dich eh nicht nach Bajohrgallen mitnehmen. Ehefrauen sind da meines Wissens nicht vorgesehen, jedenfalls noch nicht auf dem Posten.“
„Aber …“, fing Sophie an, verstummte dann aber sofort wieder. Was hatte sie sagen wollen? Dass man für Jesco mit seiner Verletzung doch eine Ausnahme machen müsse? Sie studierte sein Profil im Schatten der Stehlampe, angefangen von der hohen Stirn, der Falkennase und dem energischen Kinn. Nein, Jesco war nicht der Mann, sich durch einen verlorenen Arm aufhalten zu lassen. Auch wenn er sich in diesen Tagen von ihr hatte helfen lassen – sein Bemühen, möglichst viel alleine zu können, war eindeutig.
„Was pflanzt ihr eigentlich gerade auf Hohentranckow an?“, fragte der Alte von Esten.
„Dasselbe wie du: Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln – und natürlich Gerste und, so weit es geht, Rüben“, antwortete Graf von Tranckow. „Wir müssen die Volksernährung sicherstellen.“
„Ja ja“, stöhnte Gottfried von Esten. „Die Herrschaften an ihren Schreibtischen wissen ja auf den Gütern, die unsere Familien seit Generationen bewirtschaften, so viel besser Bescheid als wir.“ Er goss seinem alten Freund etwas Cognac ins Glas und lehnte sich mit dem seinen zurück, wobei er Sophie ansah. „Sag mal, du hast mir doch die Tage was über diese Dünger-Experimente in Weihenstephan erzählt? Wäre das nichts für Tranckow?“
Graf von Tranckow trank einen Schluck und hob abwehrend die Hände. „Bloß keine Experimente!“, rief er. „Nicht, solange uns die Kreisleitung so im Nacken sitzt!“ Er schaute Sophie an. „Ich weiß, ihr neuen Besen würdet gerne den alten Kram auskehren, aber im Moment …“
Sophie schaute zu Jesco hinüber, der milde lächelte. „Keine Angst, Onkel FiWi – Sophie ist viel zu bodenständig, um Tranckow total auf den Kopf zu stellen. Aber es würde natürlich nichts bringen, wenn du sie engagierst und dann nicht machen lässt! Wir haben nicht zum Spaß studiert und auch in der Landwirtschaft bewegt sich einiges.“ Er griff nach der Flasche mit Portwein, die auf dem Tisch stand, schenkte Sophie und sich nach und sprach weiter. „Es ist übrigens kein Zufall, dass Sophie sich auf Ackerbau und ich mich auf Tierzucht spezialisiert habe. Unsere Zukunftsvision bezieht sich natürlich auf Jesensee und darauf, dass wir da einst ziemlich autark wirtschaften wollen.“
„Ich denke, Ihr wollt Pferde züchten!“ Graf von Tranckow schaute seinen Patensohn fast irritiert an.
Jesco lachte. „Onkel FiWi, wir wissen beide, dass das nur bedingt eine Zukunft hat.“ Er schaute Sophie auffordernd an.
„Ich denke, die Industrialisierung wird weiter voranschreiten. Das Pferd …“, mit einem kleinen Schulterzucken und Seufzen sagte sie: „Nach dem Krieg werden Pferde wahrscheinlich der Luxus sein, den man sich auf den großen Gütern nebenbei leistet. Das Geld werden wir mit Ackerbau und Viehzucht verdienen – und auf Jesensee wird das vor allem Fleischproduktion bedeuten. Wir werden Rinder züchten …“
Graf Tranckow schaute zu Freiherr von Esten hinüber. „Deine Kinder werden dein Gut umbauen, hmm?“
„Ja, so gehört das doch, nicht? Als ich Jesensee übernommen habe, haben wir vorwiegend vom Forst gelebt“, erzählte Gottfried von Esten. „Aber mir war damals schon klar, dass das auf Dauer nicht funktioniert und ich mir was einfallen lassen muss …“
„Wobei bei Sophie und mir die Waldwirtschaft wieder ein Thema sein wird“, sagte Jesco.
Einen Moment schwieg die Runde, dann sagte Graf Tranckow: „Wisst ihr, als mir Sophie eingefallen ist, habe ich auch an etwas anderes als nur die nächsten Monate gedacht. Aus unserem Joachim wird in diesem Leben kein Landwirt mehr. Den interessiert das nicht. Wenn er Hohentranckow mal übernehmen muss, sucht er sich einen Verwalter …“
„Joachim ist ganz Offizier – und er hat eine große Karriere von sich“, sagte Jesco. „Er gilt als echtes Talent für einen Stabsoffizier …“
„Ja – und dann wäre es gut, wenn Tranckow in guten Händen wäre! Und was spräche denn dagegen, dass man es gemeinsam mit Jesensee bewirtschaftet?“, schlug Graf Tranckow vor.
Jesco und Sophie schauten aneinander an, dann nickte Jesco. „Wäre eine Überlegung wert …“
„Langfristig!“, bremste Sophie. „Sehr langfristig.“
„Aber es wäre bestimmt kein Schaden, wenn du dich jetzt schon mal auf Tranckow engagieren würdest.“ Friedrich-Wilhelm von Tranckow beugte sich nach vorne und fasste nach Sophies Hand. „Du würdest mir sehr damit helfen!“
Sophie schaute Jesco an, der lächelte, worauf sie sagte: „Darf ich das eine Nacht überschlafen?“
„Selbstverständlich. Wir sind bis morgen zum Frühstück hier.“
Sophie hatte nicht wirklich nachdenken müssen. Auf Jesensee waren ihr Schwiegervater und ihr Vater, die sie – bei aller Zuneigung – als Landwirtin nie ganz ernst nahmen. Wenn sie bei ihnen etwas Neues einführen wollte, bekam sie im besten Fall ein Feld – und dann behandelten die Herren ihr „Experiment“ wie das Spiel eines kleines Mädchens. Auf Tranckow dagegen – nun gut, der alte Graf würde ihr sicher reinreden, aber dennoch würde sie mehr Bewegungsfreiheit haben. Außerdem sagte Jesco: „Er ist wirklich ein alter Freund. Wenn ich nicht schon nach Trakehnen vergeben wäre, würde ich aushelfen, aber so …“
„Liebster, du bist auf Tierzucht spezialisiert und damit in Trakehnen bestimmt besser untergebracht als auf einem Gut, das vorwiegend Ackerbau betreibt. Das ist dafür mein Gebiet …“, erinnerte ihn Sophie.
„Natürlich – und darum geh’ ich nach Trakehnen und du nach Tranckow“, Jesco beugte sich zu ihr hinüber und küsste sie.
Sophie lächelte: „Tranckow hat übrigens einen Vorteil gegenüber Jesensee – es ist näher an Trakehnen. Aus Jesensee brauchst du mit der Kutsche oder zu Pferd vier, fünf Stunden. Aus Tranckow sollte man es in zweieinhalb schaffen, also kann ich dich vielleicht an den Wochenende besuchen? Oder andersrum?“
„Wie wäre es mit abwechselnd?“, schlug Jesco vor. „Ein Wochenende kommst du nach Bajohrgallen, am nächsten reite ich nach Tranckow.“
Die Abmachung stand – und nun war Jesco nach Trakehnen unterwegs und Sophie stand auf der Allee und schaute der Kutsche nach, die immer kleiner wurde. Natürlich sorgte sie sich um ihren Mann. Wie würde er in Bajohrgallen klarkommen? Er hatte in den letzten Monaten gelernt, sich mit einer Hand anzuziehen, mit Hilfe eines Spezialbesteckes zu essen, aber wie würde er zu Essen kommen? Er machte sich da keine Sorgen. „Auf Bajohrgallen findet sich bestimmt eine Frau, die kocht und bei der ich mitessen kann. Und wenn nicht, reite ich eben nach Trakehnen hinüber – da gibt es eine Kantine.“
Aber das war ja nicht alles! Putzen, aufräumen, das Bett beziehen – er hatte ja keine Ahnung von Haushalt. Aber auch da hatte er gesagt: „Da wird sich jemand finden. Ich bin ja bereit, dafür zu bezahlen.“
Nun war die Kutsche in der langen Allee kaum mehr zu sehen – und bald würde sie um die Kurve herum vollends verschwunden sein. Sophie schlang die Arme um sich. Der Morgen war kühl und sie fröstelte, als sie langsam Richtung Haus ging. Ihre Koffer standen gepackt in der Halle, obenauf lagen zwei Satteltaschen, denn sie würde sich jetzt umziehen – um Jesco zu verabschieden, hatte sie das blaue Kleid mit dem weiten Rock angezogen, das er so gerne mochte. Doch nun waren wieder Jodhpurhose, knöchelhohe Stiefel, eine karierte Bluse und ein Wollpullover angesagt. Sie würde mit Creve Cœur nach Tranckow reiten, ihr großes Gepäck würde der kleine Klaus, der nun gerade Jesco nach Trakehnen fuhr, später nach Tranckow bringen.
Der Ritt in den Morgen hinein war wunderschön. Die hellbraune Creve Cœur hatte beim Antraben um den See herum ein wenig gebuckelt – wie immer, wenn sie einen Tag nur auf der Koppel gewesen war. Sophie hatte über die Eskapaden der Stute gelacht. Creve Cœur war Jescos Hochzeitsgeschenk gewesen – eine Originaltrakehnerin mit hervorragendem Stammbaum, in dem natürlich auch Dark Ronald eine Rolle spielte, damals drei Jahre alt. Als sie die schöne, hochbeinig-elegante Braune damals das erste Mal bewundert hatte, war Jesco hinter ihr gestanden, hatte die Arme um sie gelegt und ihr ins Ohr geflüstert: „Nicht nur dein neues Reitpferd, sondern auch die Stammstute unserer Zucht.“
Sophie hatte sie eingeritten, was gar nicht so einfach gewesen war. Die Trakehnerin hatte zwar alles, was ein gutes Reitpferd brauchte – gute, fördernde Gänge, Geschmeidigkeit, Intelligenz und Leistungsbereitschaft –, aber dem entgegen standen ihre Sensibilität und ihr Temperament. Sie ließ sich leicht ablenken und sie wehrte sich nachdrücklich, wenn ihr etwas nicht gefiel. In den ersten Wochen verzweifelte Sophie manchmal fast an ihr und war nahe daran, sie auf die Koppel zu stellen und zu warten, bis Jesco wieder zuhause war, um sie auszubilden.
Aber dann war da doch ihr Stolz. Er ließ sie sogar in den Stall stolpern, als sie sehr erkältet war. „Ein Ausritt an der frischen Luft wird mir guttun“, hatte sie vorher ihrem besorgten Vater erklärt. Doch die Prognose, dass ihr im Sattel wohler werden würde, traf nicht zu. Ganz im Gegenteil. Sie musste ihren Galopp auf dem Seeweg abbrechen, weil ihr dabei die Luft ausgegangen war. Danach hing sie wie ein nasser Sack im Sattel, den Zügel nur noch locker in der Hand. Creve Cœur ging im zügigen Schritt Richtung Heimatstall. Und erst, als sie dort angekommen war und der kleine Klaus Sophie aus dem Sattel half, fiel ihr etwas auf: Creve Cœur, die Schwierige, hatte auf dem Heimweg kein einziges Mal auch nur einen Tritt, geschweige denn einen Sprung zur Seite gemacht. Sie war sogar an der Ziegenweide – normalerweise immer ein Grund für sie, nervös zu werden und loszutoben – vorbeimarschiert.
An dem Tag begriff Sophie etwas über ihre Stute: Creve Cœur wollte Vertrauen – und das bekam sie von da an. Sophie hatte gelernt, dass sie sich im Notfall auf die Braune verlassen konnte, und danach probierte sie es im „Normalfall“ – und plötzlich ging es und sie kamen sich mit jedem Tag näher.
Als Sophie um den See herumritt, wehte ein leichter Wind, gerade genug, um das Wasser zu kräuseln. Sophie schaute zu der kleinen Insel hinüber und erinnerte sich, wie Jesco gelernt hatte, mit einer Hand zu schwimmen und wie sie vor ein paar Wochen wieder mit ihm auf die Insel geschwommen war. Dort hatten sie sich unter der alten Hängeweide, deren Blätterdach sie vor neugierigen Blicken beschützte, geliebt. Nun würde es wohl eine Weile dauern, bis sie dazu wieder Gelegenheit haben würden. Aber wenigstens war Jesco nicht mehr in Gefahr und das war das Wichtigste. Er würde zurückkommen nach Jesensee, wenn dieser grausige Krieg vorbei war. Und dort würden sie dann Kinder haben und ein Gestüt aufbauen.
KAPITEL 2
DER NEUE AUF BAJOHRGALLEN
Haupt- und Landgestüt Trakehnen,Vorwerk Bajohrgallen, Ostpreußenim September 1943
Jesco hatte das Gefühl, gerade erst eingeschlafen zu sein, als der Wecker klingelte. Mit geschlossenen Augen holte er aus und schlug mit der flachen Hand auf den Störenfried, der darauf verstummte. Jesco grunzte zufrieden und drehte sich zur anderen Seite. In den letzte Monaten hatte er seinen Wecker immer ein Viertelstündchen früher gestellt, als er aufstehen musste, denn so blieb ihm Zeit, Sophie zärtlich zu wecken und vor der Arbeit noch ein bisschen mit ihr zu schmusen.
Doch nun landete er mit seiner Drehung an der Wand – und langsam sickerte es in sein noch verschlafenes Hirn: Er war nicht mehr auf Jesensee, sondern im etwas abseits stehenden Verwaltungsgebäude auf dem Trakehner-Vorwerk Bajohrgallen. Dementsprechend war die Geräuschkulisse. In Jesensee war das Gutshaus im Mittelpunkt, links und rechts von seinen Wirtschaftsgebäuden umgeben. Da hörte man morgens die Kühe, die muhend ihr Bedürfnis, gemolken zu werden, anmeldeten, außerdem schnatterten Gänse und die Schafe, die hinauswollten, meckerten. Dazwischen hörte man die Stimmen der Melker und Hütejungen, die Haferquetsche im Pferdestall lief rumpelnd an.
Das zweistöckige Backstein-Haus, von dem aus Bajohrgallen verwaltet wurde, stand etwas abseits von den Ställen an einer Kastanienallee. Links und rechts schlossen sich große Koppeln an, wobei Jesco vor allem die vorderen mochte, die von Heckenrosen gesäumt waren.
Zur Linken von der Verwaltung aus lag der große Reitplatz, daneben ein Boxenstall für ungefähr ein Dutzend Reitpferde. Auf der rechten Seite war der große Laufstall der Stuten mit einem hohen Dachaufbau, in dem Stroh und Heu gelagert wurden.
Dann gab es noch einen kleinen Anbau an den Laufstall – die Deckbox.
Jesco wohnte im ersten Stock der Verwaltung. Nun wälzte er sich aus dem Bett und rieb sich das rechte Auge. Im Schlafanzug tapperte er ins kleine Badezimmer, schaute in den Spiegel und seufzte. Zuhause in Jesensee hatte er verkündet, dass er natürlich mit allem klarkomme, hier aber gestand er sich ein, dass das einhändige Rasieren immer noch eine reichlich schwierige Übung war. Er musste erst jemanden bitten, seinen Riemen zum Abziehen der Klinge mit einem zweiten Nagel zu befestigen. Aber das hatte Zeit – gestern Morgen hatte ihn sein Vater rasiert und der hatte vorher das Rasiermesser superscharf geschliffen. Es würde noch einmal gehen und so befeuchtete er sein Gesicht, schlug etwas Schaum im dafür bereitstehenden Becher, seifte sich ein und fing mit der linken Seite an – der schwierigeren, weil er dazu ja um sein Gesicht herumgreifen musste.
Eine Viertelstunde später stand er – mit einem Pflaster am linken Kiefer, denn da hatte er sich prompt geschnitten – in der Küche, füllte eine Kanne mit Wasser und hängte den Tauchsieder hinein, den Sophie ihm besorgt hatte. Im Eisschrank fand er eine Wurst, ein Stück Käse und Butter, im Brotkasten war ein Laib Brot und auf dem kleinen Regal über dem Herd stand ein Gläschen, auf dem in einer kritzeligen Handschrift „Brombeeren, Sommer ’43“ stand.
Er stellte sich einen Teller und eine Tasse auf den Tisch, holte Besteck dazu und betrachtete den Brotlaib. Tja – wie sollte er von dem nun eine Scheibe abschneiden? Er überlegte einen Moment, dann nahm er sich ein großes Messer, schnappte sich den Laib und setzte sich auf die Holzbank unter dem Fenster. Er wickelte ein sauberes Handtuch um die Hälfte des Brots und klemmte es sich unter den Oberschenkel. So – nun war es fest und er konnte etwas davon abschneiden. Die Scheibe fiel zwar ziemlich dick aus, aber er war dennoch zufrieden. Er freute sich an allem, was er neu lernte und dann ohne Hilfe machen konnte.
So, das Wasser kochte. Er löffelte Kaffeemehl in die Kanne und rührte um. Nun musste er nur noch einen Moment warten, bis das Kaffeemehl nach unten gesunken war. Bis dahin aber hatte er immerhin schon mal den herrlichen Duft nach frischem Kaffee und der machte Appetit. Brot buttern – das hatte er schon zuhause geübt. Die Wurst rollte beim Aufschneiden zweimal weg, beim dritten Versuch legte er seinen Teller auf das hintere Teil. Nun ging es. Er säbelte drei kräftige Scheiben ab, biss in eine, schob ein Stück gebuttertes Brot hinterher – na, also, ging doch! Und jetzt noch der Kaffee, den er wie immer schwarz trank.
Beim Essen und Trinken dachte er darüber nach, wie er sich gestern von Jesensee verabschiedet hatte. Sophie war sehr tapfer gewesen – aber das war sie eigentlich immer und es gehörte zu den Eigenschaften, die er an ihr schätzte. Als er dereinst 15-jährig von der Kadettenanstalt aus zur Tanzstunde geschickt worden war, hatte man ihn mit einer durchaus hübschen Blondine zusammengespannt. Der hatte er anscheinend sehr gefallen und – ja, sie war sehr hübsch mit ihrem hüftlangen Haar, den sanften, braunen Augen und dem süßen Kirschmund. Und sie war immer sehr nett gekleidet und die meisten Jungs in der Tanzstunde hatten ihn beneidet, vor allem, nachdem er den Ausgang am Samstag dafür genutzt hatte, sie ins Café einzuladen und man ihn dort mit ihr gesehen hatte.
Doch dieser Besuch im Café war’s gewesen, der seine Begeisterung für Blondchen im Keim erstickt hatte. Bei Kaffee und Streuselkuchen war es nämlich gewesen, als wenn sie sich geschworen hätte, den ganzen Nachmittag hindurch kein vernünftiges Wort zu reden. Stattdessen erzählte sie ihm ausführlich von dem neuen Kleid, das sie zur nächsten Tanzstunde tragen würde und den „zuckersüßen Lackschühchen“, die sie gesehen hatte und dazu kaufen wollte. Und als er sie dann endlich dazu gebracht hatte, das Thema zu wechseln, landete sie nach einem kurzen Schwenk bei einem Filmschauspieler, für den sie schwärmte und von dem sie sich bei einer Premiere ein Autogramm geholt hatte. „Vier Stunden bin ich dafür angestanden, in strömendem Regen. Aber das war mir egal, weil ich ihn so toll finde!“
Jesco, ganz Kavalier, hatte sie schließlich an ihrer Haustür abgesetzt – und war so schnell abgehauen, dass es einer Flucht geglichen hatte. In der Kaserne hat er dann einen Kameraden ermutigt, sie in der nächsten Tanzstunde abzuklatschen, und hatte dafür das schüchterne Mauerblümchen zum Walzer aufgefordert. Sie hatte kaum ein Wort gesprochen, aber das war ihm deutlich lieber als die Blondine mit ihrem sinnlosen Redeschwall.
Gedacht hatte er da aber an Sophie – mit der er stundenlang reden und lachen konnte, die immer etwas Interessantes zu erzählen hatte und die er sogar hübscher fand als Blondchen. Allerdings machte Sophie viel weniger aus sich. Ihre dunkelbraunen Haare hatte sie zu einem pflegeleichten Pagenkopf schneiden lassen, der ihr sehr gut stand. Jesco jedenfalls mochte ihn – vor allem, wenn die Sonne darauf fiel und ihre Haare glänzten wie Seide. Er fand auch, dass sie einen spannenden Kontrast zu ihren blau-grünen Augen bildeten und obwohl Sophies Mund nicht so voll war wie der des blonden Berliner Mädchens – er war feiner gezeichnet, mit einer hübsch geschwungenen Oberlippe mit ausgeprägtem Amorbogen und einer weichen Unterlippe. Darunter kam noch ein durchaus energisches Kinn mit einem kleinen Grübchen, das sie von ihrem Vater geerbt hatte. Überhaupt: Jesco liebte ihre Grübchen – nicht nur das am Kinn, sondern auch die beiden, die sich in ihrem Mundwinkel bildeten, wenn sie lachte.
Sie war inzwischen wohl in Tranckow angekommen und er hoffte, dass sie dort so freundlich empfangen worden war wie er in Trakehnen. Sein junger Kutscher und er waren durch die Allee auf das Verwaltungsgebäude – daran zu erkennen, dass davor eine lebensgroße Bronze des Gründerhengstes Tempelhüter stand – zugefahren. Als der Kutscher noch an der Bremse gekurbelt hatte, war die Tür aufgegangen und Dr. Ernst Ehlert, der Trakehner Landstallmeister, war seinem neuen Mitarbeiter entgegengekommen. „Herr Doktor von Esten – wie schön, dass Sie da sind und uns verstärken! Wir können vor lauter Arbeit kaum mehr über die Schreibtische schauen!“
Dr. Ehlert hatte Jesco in sein Büro gebeten, bei Kaffee und Streuselkuchen hatten sie über das Gestüt im Allgemeinen und Besonderen gesprochen, wobei Jesco sich sehr wohl darüber bewusst gewesen war, dass Ehlert sein Wissen über Trakehnen abklopfte. Doch da musste Jesco sich keine Sorgen machen. Er hatte schon als Junge alles gelesen, was er über Pferde und natürlich speziell Trakehner in die Finger bekommen konnte.
Ehlert unterdessen hatte auch noch eine grundsätzliche Frage gehabt: „Muss ich Ihnen erklären, was ein Haupt- und Landgestüt ist?“
Jesco hatte gelacht. „Nein, nicht nötig – ich habe es erst gestern meiner Frau auseinandergesetzt.“
„Was haben Sie ihr gesagt?“
„Die Kurzversion: Das Hauptgestüt dient der Zucht von Pferden. Darum gibt es dort Stuten, die von den zum Hauptgestüt gehörenden Hengsten belegt werden. Aus den Stuten fallen Fohlen, die aufgezogen und in ihrem vierten Lebensjahr angeritten und verkauft werden – so es keine Stuten von hoher Qualität sind. Die werden dann nämlich wieder in die Stutenherde des Hauptgestüts eingestellt.“ Jesco hatte Ehlert wohlwollendes Lächeln gesehen und weitergesprochen: „Das Landgestüt dient der Verbesserung der ländlichen Pferdezucht in der Region. Dafür offeriert es den Stutenhaltern ausgesuchte Hengste, die ‚Landbeschäler‘ genannt werden. Die stehen im Frühjahr, also während der Decksaison, auf überall im Land verstreuten Deckstationen, sodass keiner von den Stutenhaltern es zu weit zu einem dieser Hengste hat.“
„Sehr gut!“, lobte der Landoberstallmeister. „Haben Sie Ihrer Frau auch erklärt, warum auf den meisten Deckstationen drei Hengste stehen?“
„Aber sicher“, lachte Jesco. „Meine Frau hat ihre Promotion als Agrarwirtin über Saatgetreide geschrieben, folglich hat sie wenig von Pferdezucht mitbekommen. Ergo habe ich ihr schon vor einiger Zeit mal erklärt, dass auf eine gute Deckstation drei Hengste gehören: Ein Erhalter – der deckt die Stuten, die in Größe und Rahmen schon dem Zuchtziel entsprechen; ein Veredler, der bei etwas zu groß geratenen, groben Stuten die Trakehner Eleganz und den Adel vererbt, und schließlich einen Verstärker, der mit etwas zu klein geratenen Stuten normal große Fohlen machen soll.“
„Ich sehe, Sie kennen sich wirklich aus“, sagte Ehlert. „Wie ist es mit Praxis? Reiten, Fahren, Pferde beurteilen?“
„Ich war bei der Kavallerie und nicht der schlechteste Reiter im Regiment. Fahren …“, Jesco wiegte den Kopf hin und her. „Ich habe es natürlich gelernt – und mein Vater hat immer Wert darauf gelegt, dass auf Jesensee gut gefahren wird, also wurde auch ich nach Achenbach6 ausgebildet. Aber jetzt ist es mit Fahren schwierig.“ Er schluckte und setzte neu an. „Pferdebeurteilung – ja, ich denke, ganz schlecht bin ich da nicht.“
„Dann gehen wir doch mal in den Stall zu den Landbeschälern“, schlug Ehlert vor und setzte mit einem verschmitzten Lächeln dazu: „Sie können Ihre Fähigkeiten in Sachen Pferdebeurteilung dort gleich unter Beweis stellen, in dem Sie sich Ihr Reitpferd aussuchen. Wir haben ein paar Landbeschäler, denen es ganz guttun würde, wenn sie mal eine Weile aus dem Zuchtbetrieb genommen und dafür reiterlich gefördert würden.“ Er stand auf, ging zur Tür und lud Jesco mit einer Handbewegung ein, ihn zu begleiten.
Eine Stunde später schwirrte Jesco der Kopf. Sie hatten vorne im langen Landbeschäler-Stall Ehlerts Stellvertreter Haio Lehnert getroffen. Ehlert hatte sie einander vorgestellt und sich dann verabschiedet. „Ich habe noch allerlei zu tun, aber ich denke, die Herren kommen auch ohne mich klar. Sie erzählen mir nachher, welchen Hengst Sie ausgesucht haben, Baron? Ich bin wirklich gespannt.“
Haio Lehnert hatte Jesco durch den großen Hengststall geführt, in dem an die 60 Landbeschäler ihre Boxen hatten. Zu den meisten hatte er etwas zu sagen gehabt und ein paar Mal war auch gekommen: „Das wäre übrigens einer zum Reiten – interessiert?“
„Das sage ich erst, wenn ich alle gesehen habe.“
Lehnert hatte gegrinst. „Sie sind ein kluger Mann, Herr Doktor von Esten.“
Nun waren sie am Ende des Stallgangs angekommen und Jesco überlegte. Er hatte jetzt sechs Hengste gesehen, unter denen er auswählen konnte. Zwei davon hatten ihn sehr beeindruckt. Der eine war ein hocheleganter Schwarzer mit einem Keilstern. Jesco hatte gar nicht aufs Boxenschild schauen müssen, um festzustellen, dass der Rappe eine Menge Vollblut mitbekommen hatte. Und tatsächlich: Auf dem Boxenschild tauchte das xx als Kennzeichen des englischen Vollblüters gleich zweimal hinter einem Namen auf. Der Vater des Rappen war auf der Rennbahn gelaufen und ebenso sein Muttervater. Dieser Abstammung hatte der Fünfjährige wohl auch sein Temperament zu verdanken, das er mit Wiehern und einem dröhnenden Tritt gegen die vordere Boxenwand ausdrückte. Jesco aber ließ sich davon nicht beirren. Als Lehnert die Boxentür aufmachte, streckte er dem Schwarzen die Hand hin – und siehe, er schnupperte interessiert daran, hob dann den schönen Kopf und blies Jesco seinen warmen, haferduftenden Atem ins Gesicht. Jesco pustete zurück und sprach ihn mit tiefer, ruhiger Stimme an: „Na, du? Kannst du so schnell laufen wie du aussiehst?“