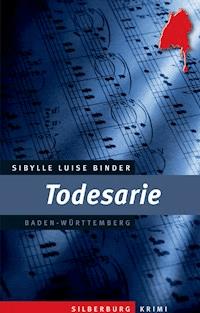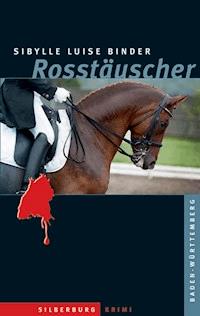14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Dr. Maximiliane Kersten, Tierärztin und passionierte Reiterin, kommt durch Zufall einem gefährlichen Betrüger auf die Spur, der mit dem Handel von Sportpferden großes Geld verdient. Dann geschieht ein Mord und Maxi muss sich entscheiden, ob sie ihrem Herzen oder ihrer kriminalistischen Leidenschaft folgen soll. Am Ende steht beides auf dem Spiel: ihre große Liebe und Maxis Leben ... Ein spannender Krimi mit viel Pferdekompetenz von Erfolgsautorin Sibylle Luise Binder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Stattdessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
PROLOG
Ich bin sauer. Mein Allegro ist stocklahm und wenn er Pech hat, wird er nie wieder klar gehen. Und er hat Schmerzen. Ich taste sein geschwollenes Bein ab, er zuckt zusammen. Brav, wie er ist, zieht er es trotzdem nicht weg, aber er zittert.
Ich würde ihn ja gerne in Ruhe lassen, aber ich muss erst eine Salbe auf die Wunde schmieren, die der verflixte Draht hinterlassen hat. Wenn ich an den denke – Allegro hat noch Glück gehabt, dass er sich »nur« das Bein angeschlagen hat. Er hätte sich bei dem Sturz über den Trakehnergraben auch den Hals brechen können – und ich gleich mit.
Das war wohl der Zweck der Übung. Die Herrschaften wollten mich ausbremsen. Sie wollten mich kaltstellen, damit ich aufhöre, herumzuschnüffeln und Fragen zu stellen.
Dass diese Aktion mich das Leben hätte kosten können, nahmen sie in Kauf. Auf ein Menschenleben kommt es ihnen nicht an, wie sie schon bei Carina Müllerschön bewiesen haben. Aber dass sie dabei auch ein Pferd über den Jordan schicken würden – das kann ich nicht fassen.
Es macht mich wütend. Dass Allegro auf drei Beinen im Stall steht – ich könnte platzen vor Zorn! Ich möchte etwas unternehmen, ich möchte mit den Fäusten gegen die Wand schlagen, ich möchte diese Kerle in die Finger bekommen und ihnen die Stiefelspitze dahin stellen, wo’s einem Mann wirklich weh tut. Und eines weiß ich ganz sicher: Wenn die glauben, dass sie mich durch einen Sturz über ein Hindernis ausschalten können, dass ich mich danach zitternd vor Angst hinter die dicken Mauern von Burg Waldeck verziehe und Titus bitte, die Zugbrücke hochzuziehen – die wir übrigens auf Waldeck gar nicht mehr haben! –, liegen sie falsch. Jetzt erst recht – jetzt folge ich dem Spruch meines Großvaters, der über einen besonders widerlichen Menschen urschwäbisch sagte: »Bei dem isch he net g’nug! Da muss no a Fuß raus!1
Mein Kopf dröhnt, wenn ich mich vorwärts beuge wie jetzt über Allegros Bein. Außerdem muss ich ein Auge zukneifen, um nicht doppelt zu sehen. Ich bin froh, dass Allegro jetzt versorgt ist und ich mich aufrichten kann. Tut allerdings auch weh – mein Brustkorb schillert links in allen Regenbogenfarben und ich habe den alten Professor Möbius im Ohr, der damals predigte: »Nehmt Prellungen nicht zu leicht. Sicher, sie hinterlassen keine Schäden, wenn sie Zeit zum Abheilen bekommen. Aber sie schmerzen ganz fies.«
Stimmt. Die Prellung tut weh und wenn ich ehrlich sein soll: Mir geht’s mieser als ich gegenüber meinen Lieben zugeben will. Mich so matschig zu fühlen und so sehr das Bedürfnis nach »in die Ecke legen, zusammenrollen und ein bisschen heulen« zu haben, passt nicht zu meinem immer eifrig gepflegten Image als »Super-Max«.
Es hilft aber nichts. Die nächsten Tage muss ich Ruhe geben und mich schonen. Ich habe zwar in Tiermedizin promoviert, aber es hat sich sogar schon zu mir herumgesprochen, dass man eine Gehirnerschütterung beim Menschen am besten durch Ruhe kuriert. Ansonsten muss der Patient mit Spätfolgen wie zum Beispiel migräneartigen Kopfschmerzen rechnen – und das brauche ich nicht.
Also werde ich Allegros weitere Versorgung Paula überlassen. Sie ist als künftige Pferdewirtin Zucht-und-Haltung-Azubiene auf Gestüt Waldeck. Sie hat gemistet und gestreut, nun fegt sie den Stallgang. Ich streichle Allegro über den Hals und schaue aus der Box nach draußen. »Paula, haben Sie einen Moment für mich, wenn Sie fertig sind?«
»Bin schon fast so weit!« Paula schiebt eine Schaufel unter den Staub-Strohberg, den sie zusammengekehrt hat, lädt ihn auf und kippt ihn in die Schubkarre am Eingang. Dann hängt sie Schaufel und Besen im Stalleingang hinter die Tür und kommt auf ihren langen Beinen – sie hat etwas von einem Fohlen in ihrer grazilen Schlaksigkeit – zu mir. »So, Frau Doktor – was kann ich für Sie tun?« Sie streckt den Arm und streichelt Allegro, der ihr neugierig die Nase entgegenstreckt. »Wie geht’s ihm?«
»Nicht so sehr gut«, seufze ich. »Er ist beim Sturz offenkundig mit der Hufspitze von einem Hinterbein ins rechte Vorderbein getreten – und da war die Gamasche irgendwie verrutscht. Jedenfalls ist die Sehne angeschlagen.«
»Wie schlimm?«, fragt Paula.
Ich zucke mit den Schultern – besser gesagt: Mit der rechten Schulter. Die linke tut nämlich auch noch weh. »Kann man so nicht einschätzen. Dazu muss er in die Klinik – ich brauche eine Szintigrafie von seinem Bein. Aber ich fürchte, da ist einiges ab.«
»Aber er wird wieder?«
»Tja …« Ich lehne mich an die Boxenwand. »Ich wäre froh, wenn ich das schon sagen könnte. Aber das ist vom Zustand der Sehne abhängig. Wenn sie durch ist, dann war es das – dann wird er Beistellpferd und muss nie wieder was tun.«
»Oh je!« Paula schluckt. »Aber er rennt doch so gerne.«
Ich nicke. »Darum hoffen wir gemeinsam, dass die Sehne eben nicht ganz gerissen ist. Dann kann sie heilen – es wird allerdings einige Monate dauern.« Ich ringe mir ein Lächeln ab. »Ich rufe nachher wegen eines Termins für die Szintigrafie in der Klinik an. Bis dahin kühlen wir sein Bein und füttern ihm Buta«.2
»… auf der Dopingliste«, vollende ich ihren Satz. »Macht aber nichts – selbst im besten Fall wird Allegro die nächsten 12 Monate keinen Turnierplatz sehen. Aber das Buta wird ihm helfen. Am besten ist es, wenn Sie ihm ein Süppchen3 kochen und dann bei mir ein paar Beutelchen Buta holen. Zweimal täglich ein Beutel in Mash – das müsste dafür sorgen, dass ihm das Bein nicht zu sehr wehtut.«
»Fein – koche ich gleich. Er mag ja zum Glück Mash sehr. Und soll ich ihm auch gleich die Kühlbandage aufs Bein machen?«
»Ich liebe Mitarbeiter, die mitdenken!«, grinse ich sie an – etwas mühsam, denn langsam schwirrt mir wirklich der Kopf und ich bin müde.
»Na, dann …«, Paula zupft an Allegros Ohr. »Kühles Bein, warmes Süppchen und Buta – Pferd, dir geht’s gut!« Sie hält mir die Boxentür auf, lässt sie hinter mir ordentlich einschnappen und flitzt in Richtung Futterküche.
Ich bin nicht ganz so schnell beim Verlassen des Stalls und bleibe draußen erst einmal stehen und schaue mich um. Der Hauptstall des Gestüts Waldeck liegt am Rand eines Anstiegs im Osten der Schwäbischen Alb – und ich bin davon überzeugt, dass es keinen Ort auf der Welt gibt, der so schön ist wie der Höhenzug, auf dem vorne die Burg Waldeck steht und der sich dann nach Westen über die Hochfläche des Rauen Feldes.4 zieht.
Ich kenne jeden Baum und Busch hier – und dennoch genieße ich den Ausblick immer wieder. Hinter dem Stall nach Westen ist nicht viel Platz. Da passt eine Reihe von kleinen Paddocks, dahinter noch ein Weg und dann kommt schon die Mauer aus alten, sorgfältig behauenen Buckelquadern, einstmals Teil des mittleren Befestigungsringes der Burganlage. Sie steht auf der Kante, danach geht es steil nach unten ins Tal.
Folgt man der Straße, die über das Gestüt führt, nach Norden, hat man rechts den Stall und links den großen Reitplatz mit der Halle dahinter. Hinter dem Reitplatz kommen der Laufstall der Stuten, das Wohngebäude, in dem die Bereiter und Lehrlinge untergebracht sind, und die kleinen Einzelkoppeln. Hinter ihnen dann die beiden Außenlager, in denen wir Stroh, Heu und Hafer aufbewahren. Über die weiten Wege zwischen Stall und Futterlager beschweren sich vor allem die Azubis, aber diese dienen dem Brandschutz. Und dahinter führt die Straße dann in Serpentinen abwärts, zwischen den großen Wiesen hindurch, auf denen die jungen Pferde des Gestüts heranwachsen.
Im Osten dann hinter der Reithalle beginnt ein kleiner Anstieg, der zur Hochfläche, dem Rauen Feld, hinaufführt. Er wird durch einen Wald begrenzt – die Bäume an seinem Rand geben unseren Stuten, die darunter ihre Koppel haben, im Sommer Schatten und im Winter, wenn kalte Winde über die Hochebene pfeifen, Schutz. Die Stuten sind der Schatz des Gestüts – 12 edle Trakehnerinnen und zwei Vollblüterinnen. Eine davon kommt tatsächlich von der Rennbahn und ist da recht erfolgreich gelaufen; die andere ist eine Original-Araber-Stute aus Marbach.5 Die beiden und außerdem drei Trakehner-Mädchen hat Titus zur Blutauffrischung eingekauft. Alle anderen Stuten wurden auf Waldeck geboren und stammen größtenteils von den beiden Stuten ab, mit denen Titus’ Großmutter dereinst aus Ostpreußen übers vereiste Haff nach Westen6 geflohen ist.
Im Wald hinter der Koppel ist unsere Trainingsstrecke mit einer ganzen Reihe von festen Hindernissen. An einem davon sind Allegro und ich gestern gestürzt.
Hinter dem Wald beginnt die Hochfläche, die sich ungefähr fünf Kilometer weit bis zum Ort Waldeckhausen zieht – und mittendrin, eine halbe Stunde Fußmarsch vom Ort und vom Gestüt entfernt, steht unsere »Möchtegern-Basilika« – die Pfarrkirche St. Georg auf dem Rauen Feld.
Ihren Spitznamen hat St. Georg ihrer edlen, weißen Renaissance-Kuppel zu verdanken, die tatsächlich an Bauten wie die Basilika in St. Blasien erinnert. Und dass sie so frei auf der Hochebene inmitten von Feldern steht, geht darauf zurück, dass Graf Georg von Waldeck, Herr über Burg, Güter und Dörfer im 17. Jahrhundert, ebenso stur wie eigenwillig und äußerst sparsam war.
Der Gute fand es auf seiner alten Burg – die wurde nämlich schon um 1130 herum erbaut – wahrscheinlich ausgesprochen ungemütlich. Da wehte der Wind durch die Ritzen, da fiel das Stroh vom Dach und die Mauern bröckelten. Dazu war vom Vermögen, das die Waldecks auf den Kreuzzügen zusammengeklaut hatten, im Laufe der Zeit nicht mehr viel übrig, um »standesgemäß« leben zu können.
Graf Georg aber, so sagt die Legende, habe ausgesprochen gut ausgesehen und er war clever. So polierte er eines Tages den verrosteten Harnisch, ließ sich ein paar neue Federn auf den Helm stecken und ritt ins Tal hinunter nach Schwäbisch Gmünd. Da war nämlich Geld zuhause: Gmünd war eine reichsunmittelbare Stadt, hatte Markt- und Münzrecht und lag an einer Handelsstraße, die aus dem Norden Richtung Italien führte. Entsprechend hatten sich dort viele Kaufleute niedergelassen, die mit Salz, Gold und Silber handelten und damit richtig reich geworden waren.
Einer der reichsten hatte dazu noch ein nettes und hübsches Töchterlein. Dem wiederum gefiel der flotte Graf, was auf Gegenseitigkeit beruhte. Und weil dem Handelsherrn die Idee, seine Tochter als Gräfin von Waldeck zu sehen, sehr gefiel, ließ er sich den Spaß etwas kosten – so viel, dass Georg von Waldeck seine Burgruine abreißen lassen und ein neues, »modernes« Schloss mit allem Schnick und Schnack – Treppengiebel, Aussichtsturm, prachtvolle Wappenfelder über der repräsentativen Eingangstür, holzgetäfelte Innenräume mit Kachelöfen – errichten lassen konnte.
Dem Abbruch der alten Burg war aber auch die Kapelle zum Opfer gefallen – und zur gleichen Zeit wurde klar, dass der unter Graf Georg gewachsene Ort Waldeckhausen eine Kirche brauchte. Blaublüten schlug zwei Fliegen mit einer Klappe: Er stiftete St. Georg inklusive Kuppel und Gruft, in der künftig die von Waldecks ruhen konnten – und er bestand darauf, dass »seine« Kirche eben nicht mitten im Ort, sondern auf dem Rauen Feld gebaut wurde, sodass sein Personal am Sonntag nicht den ganzen Morgen wegen Kirchgangs abwesend war.
Georg von Waldeck war nicht der einzige aus der Familie, der – wenn die Braut genügend Mitgift hatte – keine Berührungsängste gegenüber bürgerlichen Damen kannte. Ungefähr alle zwei, drei Generationen heiratete ein von Waldeck gewinnbringend, und so ist die Familie im 19. Jahrhundert zu einigen Industriebeteiligungen gekommen, die heute noch nette Sümmchen in die Kasse spülen und es dem jetzigen Familienchef leichter machen, Schloss, Gut, Gestüt und Wald in Schwung zu halten.
Der heutige Familienchef – das ist Dr. agr. Titus Martin Philippus Bernhard Carl Eugen Graf von Waldeck und Lauterstadt, 38 Jahre alt, geschieden, Vater einer 16-jährigen Tochter und mein bester Freund.
Ich – und mein Name ist übrigens Maximiliane Kersten, geborene Raither – bin vier Jahre jünger als Titus und in Stuttgart geboren. Daran kann ich mich allerdings kaum mehr erinnern – als ich vier war, zogen meine Eltern nach Donzdorf auf die Ostalb um. Meine Mutter wurde Rektorin in der dortigen Staufer-Schule, mein Vater, der für die Landessparkasse arbeitete, übernahm dort die Filiale seiner Bank.
Als ich 10 war, hatte ich dann so lange erfolgreich gequengelt, dass ich beim Donzdorfer Reitverein reiten lernen durfte – und dabei lernte ich Titus kennen, der zweimal in der Woche von Waldeck zur Dressurstunde herüberkam. Wir freundeten uns an, und als er dann 17-jährig zur Abi-Vorbereitung in ein Internat am Bodensee verfrachtet wurde, ritt ich seine Pferde, wofür ich im Gegenzug versprochen hatte, ihm mindestens einmal in der Woche einen ausführlichen Bericht von zuhause zu schicken.
Dabei blieb es dann auch, als Titus nach dem Abitur nach Wien ging, um Landwirtschaft zu studieren und bei einem Bereiter der Spanischen Hofreitschule seine Dressurkenntnisse zu vervollkommnen. Dabei traf er auf unseren »Wikinger« – Atreju Ødegård, der aus Norwegen nach Wien gekommen war, um am Konservatorium zum Cellisten ausgebildet zu werden.
Atreju war zwar als Sohn eines Geigers in Oslo geboren worden, sein Großvater züchtet aber Pferde. Atreju wuchs beim Großvater auf – seine Eltern hatten sich schon sehr früh getrennt und seine Mutter, einzige Tochter und studierte Agrarwirtin, war auf das seit 12 Generationen im Familienbesitz befindliche Gut auf der Insel Uløybukta zurückgekehrt.
Von Uløybukta hatte Atrejus Weg über ein Internat nahe Oslo an die Musikhochschule nach Wien geführt, wo er sich mit Titus ein kleines, gemietetes Haus teilte. Darin gab es dann auch ein Kämmerchen für mich, als ich nach meinem Abi zum Studium der Veterinärmedizin nach Wien kam.
Die nächsten vier Jahre war ich nur in den Ferien in Waldeck, wobei ich Titus öfter nicht antraf. Der schrieb nämlich in Bolivien seine Doktorarbeit über die Zucht von Saatgetreide für karge Böden; danach war er ein Jahr auf der Krim und wäre vermutlich noch eine ganze Weile durch die Weltgeschichte gegeistert, wenn er sich nicht in die französische Ballerina Josephine verliebt hätte. Die beiden heirateten und Titus zog zu ihr nach Paris. Dort blieb er aber nur zwei Monate. Sein Vater kränkelte nämlich und starb acht Wochen nach der Hochzeit. Titus musste nach Hause, Josephine kam mit und so wurde die kleine Tochter schon auf Waldeck geboren.
Nun wurde ich zwar Patentante der kleinen Arabella von Waldeck, aber ich gestehe, dass ich nicht so oft in Waldeck war, wie ich eigentlich gesollt hätte. Ich war nämlich auch verliebt und bildete mir tatsächlich ein, dass ich an der Seite eines smarten Wirtschaftsanwalts glücklich sein könnte. Wie ich je auf die Idee gekommen bin, kann ich mir nur mit »hormonell bedingtem Wahnsinn« erklären. Ich habe nicht einmal mehr auf die Stimmen in meinem eigenen Hinterkopf gehört, als ich meinen Abschluss gemacht und nach Stuttgart gezogen bin, woselbst Matthias – mein nunmehriger Ehemann – in eine renommierte Kanzlei eingetreten war, die ihm neben einem schicken Appartement in Halbhöhenlage mit Aussicht über Stuttgart auch noch einen Porsche vors Haus gestellt hatte.
Immerhin ritt Matthias auch – er hat mir mal erklärt, dass Reiten ja doch noch immer etwas »exklusiver« und nicht so langweilig wie Golf sei, daher amüsierte er sich dreimal in der Woche beim vornehmen Stuttgarter Reitverein St. Georg und becircte da – er sah im Sattel durchaus nach etwas aus, und ich ritt ihm seine Pferde so hin, dass er darauf bella figura machen konnte – die Damen.
Ich unterdessen – ja, irgendwann fiel bei mir der Groschen und ich merkte, dass ich den Spreizschritt zwischen meinen beiden Welten nicht schaffte. Auf der einen Seite waren da meine Ehe und das damit verbundene »gesellschaftliche Leben« mit Parties und Opernbesuchen und Urlauben an angesagten Orten. Auf der anderen Seite fand ich mich dann in Gummistiefeln, verkrustetem Overall und mit dem Arm bis zur Schulter im Hintern diverser Stuten, denn ich bastelte gleichzeitig als Assistentin in einer Stuttgarter Pferdeklinik an meinem Facharzt für Pferde.
Ungefähr ein halbes Jahr vor dem Facharzt-Abschluss stellte ich dann fest, dass ich den Teil im Stall und OP sehr viel lieber mochte – und das war genau zu der Zeit, zu der Matthias entdeckte, dass Segeln auf dem Bodensee noch schicker ist als Reiten und dass er in der sehr blonden, sehr langbeinigen Tochter eines Stuttgarter Topmanagers eine ideale Lehrerin gefunden hatte.
Ich überließ es der jungen Dame, ihm vielleicht auch noch mal etwas über »Loyalität« und Treue beizubringen, reichte die Scheidung ein und zog nach Waldeck.
Titus und ich hatten schon früher davon gesprochen, wie das in Zukunft sein würde: Er würde Waldeck übernehmen, und obwohl da heute viel Platz ist – im Gegensatz zu seinen Vorfahren, bei denen teilweise 30 Bedienstete im Haus herumrannten und noch viel mehr auf den Feldern – kommt er mit einer Haushälterin und einem Hauswirtschaftslehrling klar. Auch im Stall ist es deutlich übersichtlicher geworden, und so hat Titus, als er Waldeck übernommen hat, gleich entsprechend umbauen lassen.
Als ich dann mein Ehegespons verließ, stand auf Waldeck alles für mich bereit – und ich kam insofern richtig, da Josephines Begeisterung für die ländliche Idylle auf dem Familiensitz mittlerweile sehr nachgelassen hatte. Sie fand, dass der Tochter in Waldeck die »intellektuelle Anregung« fehle und sie in Paris zur Schule gehen solle – und eines schönen Tages, ich war kaum drei Monate da, warf sie Tochter und Klamotten ins Auto und verschwand.
Es folgte eine äußerst unerfreuliche Scheidungsschlacht, die Titus seine Tochter kostete und eine gewisse Melancholie hinterließ, die ihn seitdem immer wieder überkommt.
Ablenkung widerfuhr ihm dann zwei Jahre später. Da fuhren wir nach Wien und fühlten uns sehr fremd, als wir in eine »Society- Hochzeit« mit jeder Menge Bling-Bling, bekannten Gesichtern und ratternden Kameraverschlüssen gerieten. Atreju heiratete – und was das anging, war er leider nicht gescheiter als Titus und ich. Nachdem er jahrelang Society-Hyänen, Klassik-Groupies und Models mit kulturellem Anspruch entflohen war, hatte es ihn am Ende doch noch erwischt. Die Dame seines Herzens war die russische Star Sopranistin Ewelina Jefimnova Kusznov – glamourös, wunderschön, hochbegabt und laut Titus »a Zicke em King Size Format«.
Ich vermute, sie hätte uns erst gar nicht eingeladen – sie empfand uns als zu ignorierendes Überbleibsel aus Atrejus Vergangenheit.
Auf der Rückfahrt von Wien nach Waldeck – wir fuhren in einem Rutsch durch, weil wir beide das Gefühl hatten, nicht schnell genug heimkommen zu können – lästerten wir. Dabei – ja, unter uns kann ich es zugeben – war ich traurig und enttäuscht. Ich hatte eine Schwäche für Atreju und ich hatte mir gerne eingebildet, dass zwischen uns eine Verbindung war, die ausbaufähig sein könnte; dass wir uns über Sympathie und gemeinsame Interessen hinaus etwas zu geben gehabt hätten.
Die Eheschließung ließ mich daran zweifeln. Ich konnte mir nicht vorstellen, was der eigentlich doch eher bodenständige, nachdenkliche Atreju mit dieser überdrehten Schreckschraube anfing!
Als wir dann ins Waldecker Tal fuhren, ging hinter der Burg gerade die Sonne unter. Titus blinzelte hinauf und sagte: »Ich glaub’, ich lass’ jetzt die alte Remise umbauen.«
»Warum das denn? Die brauchst du doch nicht. Wir haben doch riesig Platz«, widersprach ich.
Titus atmete tief durch. »Atreju schwärmt immer davon, was es für eine geniale Akustik geben wird, wenn man oben den Dachstock als einen großen Raum ausbaut. Ein Lichtgaden unter den First, vorne oben die Front aufmachen und verglasen – das könnte sehr schön werden.«
Es wurde sehr schön – und gerade rechtzeitig fertig. Am Donnerstag hatte der letzte Elektriker die letzten Schalter gesetzt und seinen Klimbim auf den Wagen geschmissen, am Freitagabend kam ich – total verfroren, denn es war November und der Wind fegte über die Hochfläche – in meine vier Wände, zog die Stiefel aus, schaltete die Glotze an und stellte mich in Hühnchenstellung – den Rücken und einen Fuß im dicken Wollsocken an den Kachelofen gedrückt – zum Aufwärmen in meinen großen Wohn-Ess-Raum, als Bilder von einem zerschmetterten Flugzeug an einem Berg über den Monitor flimmerten.
Ich bin auch so abgehärtet, dass ich da nicht mehr immer genau hinschaue, aber dann drang die Stimme des Sprechers zu mir durch: »… unter den Toten sind mehrere Deutsche und die russische Star-Sopranistin Ewelina Jefimnova Kusznov, ihr zweijähriger Sohn und ihr Partner, der Bariton …«
Mehr bekam ich nicht mehr mit. Ich war schon losgerannt, unten in die Schlappen gehüpft, über den Hof gewetzt, bei Titus die Treppe hinauf: »Titus, Titus, schalt den Fernseher ein! Atrejus Bub und seine Frau …«
Atreju war in der Nähe von Bayern und nahm Kammermusik auf. Ich fuhr Titus hin, eine Umarmung für den völlig geschockten Atreju, dann beförderte ich die beiden nach München zum Flughafen. Ein Privatflugzeug brachte sie nach Spanien, wo das Unglück geschehen war.
Titus erzählte mir später, dass Atreju – völlig versteinert – seine Frau habe identifizieren müssen. Und dann sei er vor dem kleinen Sarg mit den Überresten seines Jungen gestanden. Man hatte ihm gesagt, dass der den Absturz wohl überstanden habe, dann aber seinen inneren Verletzungen erlegen sei – und ich möchte nicht wissen, wie oft das seinem Vater in Alpträumen nachgeht, und ich werde wohl nie Atrejus wachsweißes Gesicht vergessen.
Eine Woche später wurden der kleine Jonte und Ewelina in Wien beerdigt. Und ich weiß noch von der Beerdigung, dass ich wie auf Kohlen stand – ich hatte nämlich Angst, dass mein Auto geklaut werden würde! Titus hatte zuhause kurzerhand entschieden, dass wir mit meinem Geländewagen fahren, weil Atreju zugestimmt hatte, sofort nach der Beerdigung mit uns nach Waldeck zu kommen. Das bedeutete aber, dass wir sein Gepäck und vor allem seine beiden Violoncelli – ein Guarneri del Gesu von 1738 und die »Lady Stainer« von 1670 schon eingeladen hatten. Die standen unbewacht auf dem Parkplatz vor dem Wiener Zentralfriedhof und ich hatte die hirnrissige Vision von irgendwelchen Bösewichtern, die da mit einem Lieferwagen vorfuhren, meinen alten Koreaner knackten und die beiden Instrumente klauten.
Zum Glück blieben die beiden Celli aber in meinem Kofferraum und fanden sicher nach Waldeck, wo dann zwei Wochen später auch der Dagi – Atrejus neunjähriger Lipizzaner-Hengst Favory Dagmar – eintraf.
Seitdem sind wir eine »Dreier-WG mit viel Platz und Zoo«, leben sehr friedlich miteinander – und denken nicht darüber nach, was aus uns werden würde, wenn sich einer von uns wieder verpartnerte. Atreju würde dazu sagen: »Probleme lösen wir, wenn wir sie haben.«
KAPITEL 1
Atreju war gerade erst von einer langen Asien-Tour zurückgekommen, wir wollten an diesem Abend eine Opern DVD anschauen, darum hing er in seinen Gammelchinos und einem Hoody auf meinem Sofa, als Doktor Ulrich Merländer anrief. Er ist mein Verleger – klingt gut, gell? Tatsächlich habe ich inzwischen drei Bücher geschrieben und veröffentlicht.
Selbiger hatte eine Bitte: Seine Tochter hatte Abitur gemacht und sollte dazu ein Pferd bekommen. Nun habe sie das Pferd ihrer Träume gefunden: Eine 6-jährige braune Stute, die ein Verkaufsstall in der Nähe von Stuttgart anbot. An der Stelle lachte Ulrich Merländer: »Und soll keiner sagen, ich würde die Bücher, die mein Haus macht, nicht lesen – wir haben da eines von einer gewissen Maximiliane Kersten, das sich über Pferdekauf auslässt und empfiehlt, dass man dafür einen neutralen Pferdemenschen mitnimmt, der das Pferd ausprobiert. Außerdem sollte man das Tier zwecks einer tierärztlichen Ankaufsuntersuchung vorstellen – und so weit gediehen, dachte ich an Sie, da Sie die Tierärztin unseres Vertrauens sind und Sie gut reiten.«
Für mich war das kein ungewöhnlicher Auftrag – ich werde öfter nach Ankaufsuntersuchungen gefragt und weder Titus noch ich würden ein Pferd kaufen, ohne den jeweils anderen probereiten zu lassen.
Also machte ich mit dem Verleger aus, dass wir uns zwei Tage später am Nachmittag – ich hab’ ganz gerne Tageslicht, um ein Pferd anzuschauen – im Stall des Pferdehändlers treffen würden. Ich würde das liebe Tier anschauen, ausprobieren, röntgen und untersuchen.
Atreju, der das Gespräch mitbekommen hatte, fragte: »Nimmst du mich mit?« Er ging immer gerne Pferde gucken und mochte solche Ausflüge: Gemütlich von der Alb ins Unterland bummeln, Pferdchen gucken und »Sag mal, ist das nicht in der Nähe dieser Weingarten am Neckar? Da waren wir doch mal in der Kellerei – und der Wein war echt gut!«
Ja, der Pferdehändler – ein gewisser Andreas Haller – war in der Nähe von Besigheim und da sind die Felsengärten, in denen großartiger Wein wächst. Und zum steten Amüsement von Titus ist unser Norweger Atreju ein Fan württembergischer Weine.
Also Mittagessen in der Besigheimer Altstadt im Sonnenschein, Einkauf bei den Weingärtnern, danach weitergefahren zum Pferdehändler Andreas Haller. Bei dem erwartete uns ein gepflegter Hof mit hübschen Fensterboxen, aus denen eine ganze Reihe von Pferden interessiert herausschauten. Am Reitplatz stand ein Bänkchen und auf dem ließ sich Atreju mit einem zufriedenen Seufzer nieder. »Frau Doktor, walte deines Amtes – ich verdau’ jetzt erst mal gemütlich!«
Andreas Haller sah ich nur kurz – einen durchaus sympathischen Herrn Mitte 50, der sich aber entschuldigte. Er müsse weg, aber »die Marit« – eine sommersprossige, knochige Bereiterin, deren Reitstiefel sich bestimmt über etwas Lederfett gefreut hätten – kümmere sich.
Leonie Merländer war zappelig. Sie war vor drei Tagen schon mit ihrer Mutter bei Haller gewesen, hatte Dorita – die Stute, um die es ging – angeschaut und ausprobiert. Nun schwärmte sie in den hellsten Tönen. So hübsch, so süß und sei ihr gleich entgegengekommen und sie fühle, dass Dorita ihr Pferd sei, und hoffentlich sei mit ihr alles in Ordnung! Dabei schaute sie mich an, als ob es an mir liege, ob ich der Kleinen ein akzeptables Gesundheitszeugnis ausstellen könnte!
Immerhin: Der erste Eindruck war gut. »Die Marit« meinte zwar, wir sollten vor dem Stall in der Sonne warten, bis sie die Stute hole, aber ich schaue mir doch ganz gerne an, wie sich so ein Vierbeiner im Stall benimmt, also dackelten wir hinterher.
Die hellbraune Stute hatte einen Langstern auf dem hübschen Köpfchen, sie schaute uns aus großen Augen interessiert an, die Ohren freundlich nach vorne gerichtet und offenkundig zum Schmusen aufgelegt. Leonie stürzte sich auf sie. Mir war’s recht, gab es mir doch Gelegenheit, zu beobachten, wie die beiden Mädchen miteinander agierten.
Die Bereiterin zog der Stute ein Halfter an und führte sie nach draußen auf die Putzplatte. Dabei sah ich, dass mein Verleger sich zu Atreju gesetzt hatte. Die beiden unterhielten sich angeregt, was mir ganz lieb war – dann waren sie beschäftigt und ich hatte nicht das Gefühl, mich beeilen zu müssen. Ergo bremste ich »die Marit« aus, als sie mit Putzzeug und Sattel kam.
»Entschuldigung, ich möchte die Stute erst noch mal abtasten.« Ich krabbelte mit den Händen über ihre Wirbelsäule. Muskeln hatte sie nicht eben viele, offenkundig hatte sie noch nicht gearbeitet. Das kann bei einer Sechsjährigen positiv sein. Mir ist es auf jeden Fall lieber, als wenn sie in dem Alter schon wer-weiß-was hinter sich haben. Der Rücken war in Ordnung, Puls, Atmung und Temperatur auch, keine Lungengeräusche, das Herz klopfte regelmäßig. Also ging ich an die Beine – die Vorderbeine gab sie problemlos, hinten links zog sie weg, was mir aber eher schlecht erzogen schien als ein Zeichen für Schmerz. Als ich energisch wurde und mich gegen ihre Schulter lehnte, überließ sie mir das Bein.
Die Männer sprangen auf und boten Hilfe an, als ich das tragbare Röntgengerät anschleppte, aber ich bin’s gewöhnt, das zu tragen. Und Dorita ließ sich von Leonie Karotten füttern und stellte ihre Beine auf die Platten wie ein Profi – Nerven hatte sie also gute.
Röntgenbilder … hmm … ja, was soll ich sagen? Ganz 150 %ig waren beide Vorderbeine nicht, aber auch nicht so, dass ich wirklich Bedenken hätte anmelden müssen. Die Bereiterin beobachtete mich scharf, als ich mich schließlich aufrichtete und sagte: »Ich würde sie nicht unbedingt als Kandidat für eine olympische Vielseitigkeit sehen, aber als Damenpferd für hin und wieder Turniereinsatz passt es.«
Leonie atmete durch und lehnte die Stirn an den Hals der Stute, Doktor Merländer lächelte. »Naja, ich glaub’ nicht, dass Leonie olympische Vielseitigkeitsambitionen entwickelt, oder?«
Seine Tochter schüttelte den Kopf. »Ganz bestimmt nicht. Ich will ins Gelände, vielleicht alle Vierteljahre zum Spaß eine kleine Dressur reiten, aber ich muss noch viel lernen.« Und an mich gewandt: »Reiten Sie Dorita jetzt?«
»Wenn Sie das möchten.«
»Gerne. Ich hab’s ausprobiert und ich fühle mich auf ihr wohl, aber ich bin eben noch Anfänger.«
»Gut. Dann probiere ich aus, was sie kann …« Ich schaute die Bereiterin an. »Und ich würde gerne ein wenig mit ihr ins Gelände gehen – so einmal um den Hof und ein kleiner Galopp draußen. Geht das?«
»Ja, klar – nur muss ich mitkommen. Sie kennt sich hier auch nicht aus und ohne Führpferd …«, antwortete die Bereiterin.
Ja und so weit waren wir jetzt gediehen. Ich hatte Dorita auf dem Platz ausprobiert und war nicht unzufrieden. Viel konnte sie nicht, aber was sie konnte, war einigermaßen solide, und dass sie wohl nicht immer mit sensibler Hand geritten worden war – diesbezüglich bin ich meine Illusionen schon vor Jahren losgeworden.
Also ab ins Gelände – und auch da: ein kleiner Hüpfer, als ein Mäuschen im Gras raschelte. Das muss man einer Sechsjährigen verzeihen und wer das nicht sitzen kann, sollte sich kein junges Pferd kaufen. Dass sie vor einer Schranke zögerte und erst darum herum ging, als Marit auf dem Führpferd vor ihr zeigte, wie’s geht – mir sind im Zweifelsfall vorsichtige, zurückhaltende Pferde lieber als die, die in alles hineintrotteln.
Wir trabten durch ein kleines Wäldchen, Marit immer schön vor mir – Dorita ließ sich gut halten und war entspannt. Marit hob den Arm. »Schritt …« Wir parierten durch, sie ließ mich neben sich aufkommen und deutete mit dem Kinn auf eine Kreuzung vor uns. »Da geht’s links ab und etwas aufwärts. Wenn`s Ihnen recht ist, können wir da galoppieren.«
War mir recht – und so bogen wir um die Ecke, Dorita sah den Kollegen losstürmen, legte sich für einen Augenblick schwer aufs Gebiss, knirschte ein wenig, weil ich sie nicht los ließ, galoppierte dann links an, obwohl ich rechts die Hilfe gab. Also noch mal zum Trab durchparieren, rechts bitte – lief.
Dennoch – mein Hintern meldete schon nach ein paar Galoppsprüngen Unbehagen.
Ich konnte nur nicht fassen, was mich eigentlich störte. Es war nicht so, dass irgendetwas an ihren Bewegungen nicht richtig gewesen wäre. Sie ging in allen drei Grundgangarten taktrein und klar, ihr Schritt war recht gut, der Trab ein wenig kurz – aber wenn es eine Gangart gibt, bei der man durch Training wirklich etwas verbessern kann, ist es ja der Trab – und ihr Galopp sogar ausgesprochen gut. Es machte Spaß, sie laufen zu lassen, und obwohl sie dabei Ehrgeiz zeigte und richtig vorwärtsging, war sie gut zu regeln.
Aber dennoch war da an ihrem Galopp etwas – und jetzt endete der schmale Waldweg und bog in einen breiteren ein, der aber eben war. Marit hatte ihren Fuchs durchpariert, ich hatte Dorita auslaufen lassen, nun sah ich mich um. Niemand in der Nähe – wer geht auch um halb drei herum in so einem Wald spazieren?
»Können wir noch mal?«, fragte ich.
»Ja, schon – bis da vorne zur Schonung. Da müssen wir dann aber Schritt gehen, da ist der Weg befestigt«, antwortete die Bereiterin – und galoppierte wieder an.
Dorita pullte wieder ein wenig – und dieses Mal ließ ich sie zumindest links galoppieren. Ihr Linksgalopp war sogar noch besser als der Rechtsgalopp, aber das Unbehagen ließ mich nicht los. Nur fand ich es ein wenig paranoid. Dass Dorita nach vorne am Fuchs der Bereiterin vorbei wollte – verständlich. Da meldeten sich die Blüter in ihr. Immerhin hat man die über Jahrhunderte schon darauf gezüchtet, dass es vorne Geld gibt, weswegen die Guten unter ihnen ungern hinter einem anderen Pferd herlaufen. Ich dachte an ihren Stammbaum. Dorita war eine Tochter vom Trakehner Mozart, der wiederum vom englischen Vollblüter7 Prince of Hearts xx und der Trakehnerstute Morgenlicht abstammte. Und diese Morgenlicht hatte auch einen Blütervater gehabt. Außerdem hatte Dorita ja auch noch eine Mutter – die Dolores von Südflug aus einer Stute von Merry Jump xx.
Die Familie von Doritas Mutter kannte ich gut. Auf meinem Heimatgestüt stand nämlich eine Dreiviertelschwester von ihr. Dieser Do Good blitzte der Blüter aus allen Knopflöchern – ebenso wie den beiden Dolores-Söhnen, die ich eingeritten habe, und zwei anderen Kindern von ihrem Vater Südflug, die mir im Lauf der Jahre begegnet waren. Einer von den Südflugs hatte sogar zwei Jahre lang in meinem Stall gestanden, ich war mit ihm durch drei, vier Vielseitigkeiten geritten, kannte ihn also wirklich gut.
Und nun ging Dorita in einem lang gestreckten, flüssigen Galopp den Hang hinauf – und mir wurde klar, was mich rückwärtig so irritierte. Doritas Galopp war das, was Richter in Materialprüfungen als »Bergauf-Galopp« beschreiben und hoch bewerten. Es fühlte sich an wie eine perfekte Kurve: Aufwärts im Absprung, ein Strecken auf dem Höhepunkt der Kurve, dann abwärts und der nächste Sprung. Für den Reiter war es zu sitzen wie eine Welle, die ihn mitnahm.
Und das war’s, was mich – nein, natürlich nicht störte. Wer stört sich denn an einem so guten Galopp? Ich fand es aber seltsam insofern, dass alle Südflug-Nachkommen, die ich geritten hatte, einen ganz anderen Galopp hatten. Sie waren alle fünf sehr schnell gewesen, aber bei ihnen war das Tempo nicht unbedingt aus einem ganz großen Aufwärts-Galopp entsprungen, sondern eher aus ihrer »Wuseligkeit«. Dorita bewegte sich ruhig, fließend. Ihre Verwandtschaft aber – bei denen war es gewesen, als ob die Galoppkurve vorne abbrechen würde. Die fünf hätten dennoch bei Dorita mithalten können, aber sie hätten deutlich mehr Galoppsprünge gebraucht.
War Doritas im Vergleich zu den anderen Südflug-Nachkommen verbesserter Galopp ein Zuchterfolg? Ein Produkt der väterlichen Gene? Eigentlich wählt man einen Hengst ja im Bestreben, dass er die Schwächen einer Stute ausgleicht. War das im Fall von Dolores passiert? Hatte Mozart der Tochter Dorita diesen Galopp vererbt?
Ich hatte Mozart einmal bei einer Hengstvorstellung gesehen. Titus hatte überlegt, eine seiner Stuten von ihm decken zu lassen. Und ja, Mozarts Bewegungen hatten uns gefallen. Er konnte marschieren, er hatte einen ausdrucksstarken, guten Trab und auch der Galopp sah gut aus. Allerdings – so spektakulär, dass er mir als erster Kandidat zum Ausgleich eines eher schwachen Galopps bei einer Stute eingefallen wäre, war er aber nicht. Und Titus hatte sich schließlich auch gegen ihn entschieden, weil Mozart ihm zu »puppig« im Gesamteindruck war. Ich hatte deswegen nicht geweint. Mir erschien er nämlich ein wenig übersensibel bis kurz vor dem Hysterischen.
Wir waren an der Schonung angekommen, hatten durchpariert und waren nun im Schritt unterwegs. Marit hatte versucht, ein Gespräch mit mir anzufangen und mir zu entlocken, ob ich ihren Kunden zum Kauf raten würde. Ich hatte aber nur einsilbig geantwortet – ich war nämlich nachdenklich.
Die Sache mit dem Galopp – ich glaube, wenn das alles gewesen wäre, hätte ich es unter »Chromosomenlotto« gebucht. Zucht ist nicht berechenbar und selbst wenn man Stute und Hengst in x Generationen rückwärts kennt, kann man Überraschungen erleben. Aber in diesem Fall war da noch etwas, was ich mir nicht erklären konnte.
Also, die meisten europäischen Sportpferde haben so etwas wie ein »Markenzeichen« – das Brandzeichen des Zuchtverbandes, bei dem sie eingetragen wurden. Dahinter steckt eine strenge Qualitätskontrolle, auf die Züchter und Verbände sehr stolz sind und die von den Reitern insofern anerkannt wird, dass sie sich die entsprechenden Brände etwas kosten lassen.
Dabei hat sich eine gewisse »Hierarchie« der Brandzeichen entwickelt. Sie ist durch Tradition geprägt insofern, dass in den Anfangszeiten der deutschen Sportpferdezucht die norddeutschen Verbände die Nase vorne hatten. Wer etwas auf sich hielt, kaufte einen Hannoveraner für Dressur und einen Holsteiner zum Springen. Erst in den 70ern und 80ern des vorigen Jahrhunderts haben die Süddeutschen aufgeholt, allerdings sind Reiter und Pferdezüchter konservativ, und auch wenn sie sich gegenseitig immer erzählen, dass es heute keine Unterschiede mehr gäbe – in der Praxis schlagen sie sich immer noch auf den Preis nieder.
Eine Ausnahme von der Regel sind die Trakehner, der einzige Sportpferdeverband, der in der Bundesrepublik regional übergreifend züchtet. Daraus hat sich ergeben, dass man Trakehner liebt oder hasst. Die, die sie lieben, lassen sich das was kosten – und die, denen Trakehner zu »spinnert« und nervös sind, kaufen sowieso keinen.
Auf Waldeck werden Trakehner gezüchtet und damit war ich aufgewachsen. Und jetzt saß ich auf einem. Dorita blitzte der Traki aus allen Knopflöchern. Aber auf ihrer linken Hinterbacke prangte das Wappenschild mit den Buchstaben »WBZ« – das Brandzeichen des Deutschen Warmblut-Zuchtverbandes.
So. Kenner kratzen sich an der Stelle am Kopf und sagen: »Wie kommt’s?« Der WBZ ist nämlich der jüngste der deutschen Zuchtverbände, aus einer Abspaltung von Rebellen gegen die Süddeutschen Verbände entstanden. Seitdem ist der Verband gut gediehen und es ist sicher kein Schaden, dass es ihn und damit eine Alternative zu den Regionalverbänden gibt. Allerdings ist es immer noch so, dass der Brand des WBZ nicht so viel »wert« ist wie die Brände der alten Verbände.
Deshalb wunderte ich mich, warum jemand, der mit einem Pferd Anspruch auf die beiden Trakehner Elchschaufeln erheben könnte, beim WBZ eintragen lässt – aber wer weiß, welchen Zoff der Züchter mit dem Trakehnerverband gehabt hatte? Auf jeden Fall war es kein Grund, Ulrich Merländer vom Kauf der Stute abzuraten.
*****
Die nächsten 14 Tage hatte ich eine ganze Menge zu tun. September – das ist die Zeit, in der auf den Gestüten die Fohlen abgesetzt8 werden. Und wenn man schon dabei ist, werden sie auch gleich geimpft und entwurmt. Auf Gestüt Staufenblick – das ist mein alter Freund Arthur Callert, den ich sehr schätze – hatte ich außerdem Sorgenkinder: Zwei Hengstchen hatten sich am Tag, nachdem sie von ihren Müttern getrennt worden waren, im Laufstall geprügelt.
Keine 750 Meter vom Staufenblick entfernt sind meine Freunde von der Zottelfraktion: das Isländergestüt Hagnar, das recht erfolgreich Fünfgänger9 züchtet. Dort war im Frühjahr ein hübsches Scheckstütchen geboren worden, das allerdings einen Bockhuf mitgebracht hatte. Bei jungen Pferden mit ihren noch biegsamen Knochen und Gelenken kann man da etwas machen. Man schneidet den Huf über eine längere Zeit in Form, indem man immer wieder kleine Stücke abnimmt. Dann sorgt man dafür, dass es auf diesem Stand bleibt und das Baby hineinwächst.
Schließlich und endlich hatte ich noch das unvermeidliche »Einzelkind«. Das kommt fast jedes Jahr mindestens einmal vor: Irgendein Pferdebesitzer hat festgestellt, dass seine meist schon etwas angealterte Stute nicht mehr klar geht, worauf er beschließt, aus ihr ein Fohlen zu ziehen. Wenn ich da eingeschaltet werde, rate ich meist ab. Dass eine Stute lieb und hübsch ist, macht sie nämlich noch lange nicht zur idealen Zuchtstute, und wenn sie mit 16 oder 17 noch nie ein Fohlen gehabt hat, ist es oft gar nicht so einfach, sie in Zuchtkondition und gesund durch die 11-monatige Trächtigkeit zu bringen.
Besonders »lustig« wird’s dann beim Absetzen, wenn so ein Einzelkind bis dahin von den Menschen immer nur verwöhnt wurde und alles durfte, weil es ja »so niedlich« ist. Ich bin schon von halbjährigen Hengstchen »angestiegen« worden – und ich kann versichern, dass es keine Freude ist, wenn einem kleine, aber sehr scharfe und harte Vorderhufe um die Ohren strampeln. Ich kann auch gut darauf verzichten, dass sich so ein Winzling um meine Schultern hängt – die wiegen da nämlich schon 350 kg.
Dieses Jahr hatten wir eine junge Dame, die in Arthurs Absetzerherde landete. Ich sah zu, als sie auf Staufenblick ankam. Sie hatte da schon fast zwei Stunden Verspätung, weil sie beim Einladen eine Riesenshow veranstaltet hatte. Beim Aussteigen zog sie vier ausgewachsene Männer über den Hof, wobei sich Arthurs Jüngster den Knöchel verletzte. Das Ende vom Lied war, dass ich ihr mit dem Blasrohr ein Beruhigungsmittel verpasste und dabei alle Stutenbesitzer verfluchte, die ungezogene Fohlen beim Aufzüchter abliefern.
Gleichzeitig war auf Waldeck Titus’ Tante Adele zu Besuch – und die fand es sehr ungehörig, dass ihr Neffe da mit einer geschiedenen Bürgerlichen »zusammenlebte«! Und dass die dann morgens ständig mit irgendwelchen sehr fröhlichen, sehr aufgedrehten und voll »deckbereiten« Hengsten am Strick über den Hof turnte, gefiel Tantchen gar nicht. Sie hielt mir gerade einen Vortrag darüber, was sich für eine Dame geziemt, als Leonie Merländer anrief. Sie hatte Probleme mit Dorita. Die Stute sei immer noch »süß und lieb«, aber sie habe Muskeln abgebaut und Leonie schaffe es nicht, sie anzugaloppieren. In der Halle und auf dem Platz sei es unter dem Sattel weder links noch rechts möglich, an der Longe brauche es immer Peitschenknallen und mehrere Ansagen. Im Gelände gehe es – allerdings nur im Linksgalopp.
Darüber, dass die Kleine Gewicht und Muskeln verloren hatte, wunderte ich mich nicht. Besitzer- und Stallwechsel sind Stress für Pferde – und die sind diesbezüglich sehr empfindlich. Dazu eine Futterumstellung und Dorita war sowieso ein zierliches Mädchen, also hätte es mich eher gewundert, wenn sie das ohne irgendwelche Auswirkungen weggesteckt hätte.
Ich hatte sowieso einiges in Stuttgart zu erledigen, also fuhr ich schon am nächsten Tag zu Leonie und Dorita – und war nicht eben erfreut, denn die beiden hatten sich richtig festgefahren. Leonie war verkrampft, Dorita spürte das natürlich und widersetzte sich. Dazu erzählte mir Leonie, dass Dorita im Stall merkwürdige Gewohnheiten habe. Sie habe in der zweiten Nacht eine Überschwemmung veranstaltet, indem sie irgendwie die Zunge ihrer Selbsttränke festgeklemmt habe. Überhaupt spiele sie ständig mit dem Wasser. »Wenn ich mit ihr draußen war und sie kommt zurück, rennt sie zuerst ans Becken und trinkt«, erzählte Leonie. »Überhaupt trinkt sie sehr viel. Kann es sein, dass die Zucker hat? Gibt’s das beim Pferd?«
Ich nickte. »Ja, gibt es – wobei es bei Pferden üblicherweise Insulinresistenz genannt wird und eine Folge langzeitiger Überfütterung ist. Dorita ist nicht der Typ dafür, aber ich nehme trotzdem Blut und untersuche es.«
Ansonsten schaute ich mir die zwei miteinander an und stellte fest, dass ich Leonie unterschätzt hatte. Als sie mir erzählt hatte, dass sie Schwierigkeiten beim Angaloppieren habe, hatte ich gedacht: »Wahrscheinlich auch eine, die nach vorne fällt.« Das ist ein Fehler vieler Reitanfänger. Das war’s aber nicht. Leonie saß ordentlich, ihre Galopphilfen hätten präziser sein können, aber sie waren nicht so daneben, dass sie Doritas Verweigerung erklärten.
Um ehrlich zu sein: Ich konnte sie mir noch nicht mal erklären, als ich selbst drauf saß. Bei mir galoppierte Dorita an, aber es kostete Mühe und es gefiel ihr nicht. Sie war generell verspannt und löste sich nur schwer. Gleichzeitig hatte sie weder körperlich noch mental Kondition – nach 20 Minuten war sie groggy und konnte sich nicht mehr konzentrieren. Also ließ ich sie ein wenig am langen Zügel bummeln und überlegte, wie es mit den beiden Mädchen weitergehen sollte.
Mein Vorschlag an Leonie war dann, Urlaub auf der Schwäbischen Alb zu machen. Konkret: Dorita kam erst einmal nach Waldeck. Leonie würde sie zwei-, dreimal in der Woche dort besuchen und unter Anleitung reiten. Wir würden gemeinsam ihre Kondition aufbauen und dafür sorgen, dass die Mädchen zueinander fanden. Gleichzeitig hatte ich allerdings vor, Leonie auf Favory Dagmar zu schulen. Der ist jetzt 16, hat Nerven wie breite Nudeln, beherrscht alle großen Dressurlektionen und ist ein vierbeiniger Professor. Einer seiner großen Vorzüge ist nämlich, dass er ganz korrektes Reiten verlangt. Er kann alles, er macht es auch, aber er verlangt von seinem Reiter saubere Hilfen im richtigen Moment.
*****
Mittwoch, gegen halb zwölf: Ich war schon in aller Frühe zu einem Notfall gefahren – Kolik bei einem Pony, vom Besitzer bei der Morgenfütterung entdeckt. Pony ging es inzwischen wieder gut, danach hatte ich ein paar Routinebesuche erledigt und nun knurrte mir der Magen, denn ich hatte das Frühstück ausfallen lassen.
Als ich am Stall vorbeifuhr, stieg mir der scharfe Geruch nach verbranntem Horn in die Nase. Der Schmied war da. Sein Kastenwagen stand seitlich neben der alten Schmiede, von innen hörte ich ein Pferd schrill wiehern, dann Ferencs Stimme: »Jo, Putzigam, is’ gut. Musst du dich nicht aufregen – hooooh!«
Ich lächelte in mich hinein. Király Ferenc – bei den Ungarn kommt der Familienname üblicherweise vor dem Vornamen und Ferenc ist so ungarisch wie Pörkölt10 und Gänsebraten11 – gehört zu Waldeck wie der dicke Turm. Keiner von uns kann sich Waldeck ohne Ferenc Bacsi – das heißt »Onkel Ferenc«12 und so nennen wir ihn alle, obwohl er nur Titus’ Onkel ist – vorstellen.
Titus war drei, als seine Großmutter – eine durchaus extravagante Dame – eine kleine Erbschaft machte und beschloss, die zur Anschaffung einer Vollblutstute einsetzen. Deswegen fuhr sie nach England. Danach hörte man drei Wochen nichts von ihr. Dann kam ein Telegramm: Man möge sie mit Pferdetransporter am nächsten Abend in Süßen auf dem Bahnhof abholen.
Mit ihr kam eine Fuchsstute, die auf den ersten Blick ein wenig »langweilig« wirkte. Aber auf den zweiten zeigten sich Klasse, Eleganz, Adel und Härte. Wondergirl – so hieß die Kleine – kam aber nicht alleine. Als sie aus dem Hänger stieg, hatte sie die Nase auf der Schulter eines hochgewachsenen, etwas mageren Mannes mit dunklen Haaren und preußisch-blauen Augen. Die weiblichen Angestellten auf Waldeck seufzten und fanden ihn umwerfend – und als Gräfin Arabella ihn dann noch als ihren verschollenen Halbbruder Ferenc vorstellte, waren sie vollends hin und weg.
Welch ein Mann und was für eine Geschichte! 30 Jahre jünger als Gräfin Arabella, entstammte er einer Affäre ihres flotten Vaters, die der sich bei einem Besuch in Ungarn geleistet hatte. Das Produkt daraus – eben Ferenc – wuchs bei einem Cousin des Erzeugers, einem Grafen Batthyany auf, der ihm so viel über Pferde beibrachte, dass er als Kavallerieoffizier schnell Karriere machte. Dann aber kam der Krieg, Ferenc wurde bei einem Patrouillenritt in Russland gefangen genommen und saß drei Jahre in einem Gefangenenlager. Dann gelang ihm zusammen mit einem Freund die Flucht. Auf abendteuerliche Weise schlugen die beiden sich in die Mongolei durch, wo der Freund dann in eine nomadisierende Pferdezüchter-Familie einheiratete. Ferenc blieb drei Jahre lang dort, dann zog es ihn nach Ungarn, wo Graf Batthyany inzwischen enteignet und verstorben war. Ferenc wollte nach Ostpreußen zu seinem Vater gehen, hörte aber, dass der sich erschossen hatte, als die Russen kamen. Und Schwester Arabella sei irgendwie verschwunden.
Ferenc landete in Newmarket bei den Rennpferden. Für einen Jockey im Renneinsatz war er zu groß, aber als Reiter fürs Training und als Trainer-Assistent konnte er seine Brötchen verdienen – bis Gräfin Arabella kam, die Stute und ihn entdeckte und ihn mit nach Waldeck brachte.
Ferenc Bacsi ist Pferdemann durch und durch. Auf Waldeck arbeitete er sich zum unentbehrlichen Stall- und Futtermeister hoch, dazu betreute er die Reitausbildung. Aus seinem Können heraus wunderte es mich nicht, dass er nach einigen Tagen mit Dorita kam und sagte: »Du, die hat nicht nur ein Problem mit dem Wasser. Die muss am Koppeltor mal in ein Gemenge gekommen sein und hat dabei offenkundig Prügel bezogen. Hast du den weißen Fleck innen am linken Knie gesehen?«
Ja, der war mir auch aufgefallen, obwohl er recht klein war. Ich hatte ihn als Zeichen für ein eventuell vorhandenes Scheckgen gewertet.
»Wenn du die Stelle vorsichtig abtastet, spürst du, dass da eine Verletzung war«, sagte Ferenc. »Und jetzt pass auf: Sie hat sich ganz gut mit den drei kleinen Stuten angefreundet, die ich hinten stehen habe. Darum wollte ich die gestern zusammen auf die Koppel schicken. Also: Die drei Mädels raus, ich hole Dorita – und in dem Moment, in dem ich mit ihr durchs Tor der Koppel gehe, kommen die drei Stuten. Sie wollten ihr nichts Böses, aber Dorita hat völlig durchgedreht. Sie warf mich fast um, raste los, zitternd vor Angst, wie eine Irre um die Koppel, über den Zaun …«
»Ach, du Schande!« Ich mochte mir das gar nicht vorstellen. »Ihr habt sie wieder gekriegt? Ist sie verletzt?«
»Das linke Vorderbein ist ein bisschen dick – das hat sie sich beim Sprung angeschlagen. Ich hab’s gekühlt, vielleicht guckst du noch mal drauf«, antwortete Ferenc. »Aber sonst ist zum Glück nichts passiert.«
»Dann lass’ uns doch gleich mal gucken!«, schlug ich vor.
Wir gingen in den Stall, wo die Kleine mit hängendem Kopf in ihrer Box stand, das linke Vorderbein im Angussverband zum Kühlen. Ich wickelte die Bandage ab, tastete das Bein ab, wobei ich mir dabei fast ein wenig dumm vorkam. Ferencs Fingerspitzen sind besser als ein Röntgengerät. Er scheint Strukturen unter dem Fell damit erahnen zu können, und nach meiner Erfahrung stimmen seine Diagnosen immer.
Auch in dem Fall hatte er es wieder einmal richtig eingeschätzt, und was nun die Behandlung anging – ich wusste auch nichts Besseres als kühlen. Natürlich hätte man auch etwas spritzen können, aber wann immer es möglich ist, setze ich auf Zeit und die natürliche Heilung.
Ferenc hatte mir schweigend zugesehen, als ich Doritas Bein untersucht hatte, nun lächelte er etwas schräg. »Du, Frau Doktor, ich glaube, das Putzikam …«, er streichelte der Stute über die Samtnase, »… ist mal in einem Pulk untergepflügt worden. So panisch wie die reagiert, als die drei anderen auf sie zukamen – da ist was dahinter …«
Ferenc behauptet immer, Pferde würden einem früher oder später erzählen, was sie erlebt haben – man müsste nur gut zuhören, die Pferde beobachten und ihre Sprache verstehen. Er tut es – und ich stand nun da, beobachtete, wie die Kleine von sich aus näher kam und ihm ihren warmen, haferduftenden Atem ins Gesicht blies. Im Moment schien es kaum vorstellbar, dass dieses Pferd, das so voll Vertrauen Ferencs Zärtlichkeit suchte, in Panik flüchten konnte. Was hatte es erlebt, das eine solche Reaktion bei ihm auslöste?
»Ich rufe mal den Händler an, ob der was über das Vorleben der Stute weiß«, kündigte ich an.
»Das ist eine gute Idee!« lobte Ferenc.
*****
Bei Pferdehändler Andreas Haller hatte ich Pech – was mich nicht überraschte. Die Stute war nur drei Wochen bei ihm gewesen, und in Handelsställen ist es nicht üblich, dass Pferde gemeinschaftlich auf eine Koppel gehen. Dadurch, dass die Besetzung im Stall sich ständig ändert, können sich keine Herdenstrukturen bilden, ergo würden die Pferde auf der Weide erst einmal versuchen, ihre Rangordnung auszutragen. Das kann zu Verletzungen führen, und der Gefahr setzt kein Pferdehändler seine »Ware« aus.
Immerhin aber hatte Haller eine Telefonnummer für mich: Er verwies mich an Carina Müllerschön – das war die Dame, die in Doritas Papieren als Vorbesitzerin eingetragen war und von der Haller die Stute in Kommission genommen hatte. Laut Eintrag im Pferdepass hatte Carina Müllerschön Dorita als Absetzer gekauft, also musste sie doch wissen, wo die Kleine gewesen war und was sie erlebt hatte.
Doch die Telefonnummer brachte mich nicht weiter. »Die von Ihnen gewählte Telefonnummer ist nicht vergeben« verkündete eine Computerstimme. Hartnäckig, wie ich bin, rief ich Haller noch einmal an und glich die Nummern ab. Ich hatte sie richtig aufgeschrieben und gewählt – und Haller versicherte, dass er drei Tage nach Doritas Verkauf zuletzt unter der Nummer mit dieser Frau Müllerschön telefoniert habe.
Weiter konnte er mir aber auch nicht helfen. Also probierte ich es mit Google – und stellte fest, dass diese Carina Müllerschön offenkundig nichts mit »social media« am Hut hatte. Kein Facebook-Eintrag, auf Instagram zumindest nicht unter ihrem Namen gelistet. Es war noch nicht mal ein Telefonbucheintrag gelistet – entweder hatte sie keine Festnetznummer oder sie war eben nicht eingetragen.
Immerhin aber hatte ich eine Adresse: Gundelsheimer Str. 38 in Stuttgart-Rot. Ein Blick auf Google Maps verriet mir, dass ich in der Gegend sogar schon mal gewesen war. Unweit von der Gundelsheimer Straße hat nämlich eine Kollegin, mit der ich in Stuttgart in der Tierklinik zusammengearbeitet bin, eine Kleintierpraxis übernommen. Ich hatte sie einmal dort besucht – und war erleichtert wieder weggefahren. Die Gegend war nämlich so gar nicht meins gewesen und Natalies Arbeit hätte ich auch nicht gerne gemacht.
Stuttgart-Rot ist ein jüngerer Stuttgarter Stadtteil. Der größte Teil davon wurde nach dem zweiten Weltkrieg aus dem Boden gestampft und diente Flüchtlingen aus dem Osten als neue Heimat. Dementsprechend standen dort größtenteils anonyme Wohnblocks, dazwischen ein paar kleine Geschäfte, eine reichlich scheußliche Kirche aus den 50ern des vorigen Jahrhunderts.
Ich wunderte mich ein wenig über diese Umgebung bei Doritas Ex-Besitzerin. Die Gundelsheimer Straße ist eher kleinbürgerlich, die Wohnblocks dort bieten preiswerte Wohnungen – und wie passte das zu Dorita, die ja kein durchschnittliches Freizeitpferdchen war? Wieso wohnte jemand, der sich ein Pferd wie sie leistete, so einfach? Dazu meinte ich, Hallers Aussagen entnehmen zu können, dass er mit Dorita nicht das erste Pferd von Carina Müllerschön gekauft hatte.
Merkwürdig. Ich war sehr neugierig – und am Samstag musste ich nach Stuttgart. Ich hatte allerlei kleine Erledigungen und am Ende stand ein Besuch bei einer kranken Tante im Robert-Bosch-Krankenhaus. Das ist im Stuttgarter Norden – gar nicht weit von Stuttgart-Rot und damit der Gundelsheimer Straße entfernt. Und als ich da aus dem Parkhaus herausfuhr, konnte ich einfach nicht widerstehen – ich fuhr in die Gundelsheimer Straße. Vielleicht hatte ich ja Glück und Carina Müllerschön war zuhause?
Die Straße ist schmal und zugeparkt. Das Haus Nummer 38 war das zweite in einem Viererblock, ich musste aber noch ein Stückchen fahren, bevor ich meine koreanische Reisschüssel in eine Parklücke stopfen konnte. Als ich ausstieg, verkündete der Kirchturm gerade mit zwei Schlägen, dass es Zeit war, den geschäftigen Teil des Samstags auslaufen zu lassen, um zum Wochenende überzugehen. Bei Schwaben bedeutet das: Kehrwoche.
Und tatsächlich: Als ich vor Haus Nummer 38 ankam, öffnete sich die Tür, eine rundliche, ältere Frau mit rotgefärbtem Haar, einer Leggings im Leomuster und einer blau-grauen Kittelschürze trat mit Besen, Eimer und Mülltüte auf die Straße. Sie beförderte den Abfall in die große Tonne, die seitlich hinter einer Abschrankung stand, dann lehnte sie den Besen an die Tür und begann, Klingelschilder, Briefkästen und Glastür mit einem Lappen zu reinigen.
»Ähm … ’tschuldigung …« Ich musste ans Klingelschild – je drei Schilder in fünf Reihen. Ich streifte von oben nach unten, fand im zweiten Stock ein freies Schild, aber nirgends eines mit dem Namen »Mülllerschön«.
Die Putzfee im Leolook hatte mich neugierig betrachtet, nun fragte sie in breitem Schwäbisch: »Suchet Sie ebber?«13
»Ja.« Ich lächelte sie an – es kann ja nie schaden, ein paar Sympathiepunkte einzuheimsen, und sie sah wie jemand aus, der gut über die Nachbarschaft informiert war. »Ich will zu Frau Müllerschön.«
»Oh!« Die Rothaarige schluckte, beugte sich über ihren Eimer, wrang sorgfältig den Lappen aus, hängte ihn über den Rand und stützte sich dann auf ihren Besen. »Da hen Sie Pech g’hett«, antwortete sie schließlich.
»Ist sie nicht zuhause?«, erkundigte ich mich.
»So könnt’ man sagen«, antwortete sie kryptisch, und weil sie sich wohl nicht unterstellen lassen wollte, einfach herumzustehen und zu tratschen, bewegte sie zweimal ihren Besen hin und her. »Sie isch tot«, sagte sie dann.
»Oh.« Ich schluckte. »War sie schon älter gewesen?«
»Noi«, gab die Nachbarin Auskunft. »Im Gegenteil – die war höchstens 26 oder 27 – viel z’ jung zum Sterben!« Und nun waren die Schleusen ihrer Beredsamkeit geöffnet und auf ihren Besen gestützt, erzählte sie mir, sie sei geschockt gewesen, als sie davon gehört habe. Sie wohne nun schon an die 25 Jahre im zweiten Stock der Gundelsheimer Straße 38 und habe allerlei Leute durchmarschieren sehen. Vor zwei Jahren sei ihr gegenüber in die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung Carina Müllerschön eingezogen. Kosmetikerin sei sie gewesen, aber sie habe als Verkäuferin in der Kosmetik-Abteilung eines großen Kaufhauses in der Innenstadt gearbeitet – zuerst jedenfalls. »Wobei ich mich damals ja schon etwas gewundert habe. Sie war immer mordsmäßig hergerichtet und ist jedes Wochenende am Freitag und am Samstag ausgegangen und immer mit den neuesten Klamotten und Täschle und Schuh’. Auch wenn sie in ihrem Laden Rabatt gekriegt hat, muss das doch richtig Geld gekostet haben!«
Und dann, so nach ungefähr einem halben Jahr im Haus, habe sie aufgehört zu arbeiten. An Geld habe es ihr aber nicht gefehlt, wofür offenkundig ein Mann verantwortlich gewesen wäre. »Ich denk’, der ist verheiratet und hat sie ausgehalten. Jedenfalls kam er manchmal tagsüber, aber meist eher spät abends, ist aber nie über Nacht geblieben. ›Jimmy‹ hat sie ihn g’rufen, das habe ich ein paar Mal gehört.« Und er habe einen Porsche gefahren – passend zu seinem sonstigen Auftreten mit Designer-Sonnenbrille und »teure Anzügle, so italienische«. Aber ein komisches Kennzeichen habe er gehabt – nix aus der Gegend, sondern mit einem A vorne.
»Ein-, zwei- oder dreistellig danach?«, erkundigte ich mich.
»Häh?«
»Naja – A wie zum Beispiel Augsburg? Oder eher AB wie Aschaffenburg oder AA wie Aalen? Oder gar …« Ich musste kurz nachdenken, bis mir ein dreistelliges A-Kennzeichen fiel. »ABI – das ist Anhalt-Bitterfeld.«
»Wo isch au des? Des hab ich ja noch nie g’hört!«
»In den fünf neuen Bundesländern«, gab ich Auskunft.
Sie überlegte und antwortete nach einer Weile: »’s könnt’ scho’ AA g’wesen sein.« Aber so genau habe sie doch nicht darauf geachtet. Sie sei ja nicht neugierig. Aber ihre Freundin habe vermutet, dass »Jimmy« das Geld für seinen Porsche vielleicht »mit Pferdle« verdient hat.
An der Stelle spitzte ich natürlich die Ohren und fragte: »Meinen Sie, er hat auf der Rennbahn gewettet oder sowas?«
»Noi, net solche Pferdle!«, lachte sie. »Solche in der Altstadt, hat meine Freundin gemeint – mit zwei Füße und ohne Hufe, dafür mächtig Schminke druf!« Sie beugte sich nieder und schaute meine Hündin, die wunderschöne Prinzessin W. an – wobei das »W« dafür steht, dass sie ein Whippet ist –, die mit interessiertem Blick neben mir stand. »Des ist aber a hübscher Hund! Bloß so dünn – isch der krank?«
Irgendwann werde ich mir ein T-Shirt machen lassen, auf dem steht: »1. Mein Hund ist ein Mädchen. 2. Sie ist nicht krank, sondern ein Windhund und muss daher so dünn sein. 3. Nein, sie friert nicht. Wenn sie zittert, ist es Aufregung und Jagdtrieb. 4. Sie trägt den Schwanz nicht zwischen den Beinen, weil sie vor etwas Angst hat, sondern weil ihr Becken schräg steht. Das muss bei ihrer Rasse so sein.«
Ich gab also wieder einmal die diesbezügliche Erklärung ab, die Hoheit wurde gestreichelt und dankte, in dem sie mit dem Hintern wedelte. Dabei hatte ich über der Nachbarin Schulter hinweg das Klingelschild studiert. Neben dem leeren war eines mit einem griechischen Namen und auf dem dritten stand »Weckerle, Brigitte«. Ich spekulierte einfach mal: »Sie sind die Frau Weckerle, nicht?«
»Ja, woher wisset Sie?«
»Ich habe aufs Klingelschild geschaut und nachdem wir uns so nett unterhalten …« Ich streckte ihr die Hand hin. »Mein Name ist Kersten – Doktor Maximiliane Kersten.« Normalerweise benutze ich meinen Doktortitel nicht, um mich vorzustellen, aber in dem Fall wollte ich ein wenig Eindruck schinden und die Unterhaltung verlängern. »Ich bin Tierärztin und …«
Weiter kam ich nicht. Frau Weckerle unterbrach mich begeistert: »Tierärztin? Verstehet Sie au ebbes von Vögele?«
»Nicht schrecklich viel. Ich bin auf Pferde spezialisiert.«
»Des ist aber schade!«, fand mein Gegenüber. »Ich habe nämlich zwei Wellensittiche, aber glauben Sie, die kommen miteinander aus? Alle Leute haben mir immer gesagt, es ist Tierquälerei, so ein Vögele alleine zu halten, also habe ich die zwei gekauft, aber die prügeln sich nur! Jetzt habe ich zwei Käfige, denn sobald sie zusammen sind, rupfen sie sich gegenseitig die Federn aus. Es ist ganz schlimm!«
»Oh, das tut mir leid«, bedauerte ich sie.
»Wisset Sie was?« Sie schnappte energisch ihren Eimer, schüttete den Inhalt schwungvoll auf den eh schon sehr kränklich aussehenden, handtuchgroßen Rasen des Pseudo-Gartens, schnappte dann ihren Besen und schloss die Haustür auf. »Kommen Sie mit mir nauf, Frau Doktor und gucket Sie sich meine Vögele an!« Sie streichelte der Prinzessin über den Kopf. »Du bisch bestimmt au in der Wohnung manierlich, gell? Und haaren tust du net.«
»Nein, sie verliert höchstens im Fellwechsel ein paar Haare, aber im Moment behält sie alle!«, versicherte ich und stapfte hinter Brigitte Weckerle die Treppe hoch, um mich von ihr in eine reichlich vollgestopfte Wohnung – im Flur jede Menge Salzteighäuschen an den Wänden, inklusive Wohnzimmer mit großer Anbauwand in Gelsenkirchener Barock, grün-braun gemusterten Polstermöbeln und dem guten, alten Kachelcouchtisch – einladen zu lassen. Immerhin reichte mir ein Blick auf die beiden Piepmätze, um ihr erklären zu können, warum die Zwei nicht miteinander turtelten: Sowohl das türkisblaue wie auch das knallgrüne Exemplar waren nämlich Mädchen – eindeutig daran zu erkennen, dass ihre Nasen hellbraun eingefärbt waren. Bei Männchen wäre die Haut blau gewesen.
»Ja, so ebbes!«, schimpfte Frau Weckerle. »Beim Tiergeschäft haben sie mir die beiden als Paar verkauft! Ha, denen erzähl’ ich am Montag was!« Sprach’s – und ging Kaffee kochen, was mir nicht unrecht war. Unten auf der Straße war es nämlich doch recht kühl gewesen und ich hatte in meinem Krankenhaus-Besuch-Stadtlook gefroren.
Eine Stunde und drei Tassen dünnen Kaffees später half mir die Hoheit, der gesprächigen Brigitte Weckerle wieder zu entkommen. Sie hatte sich neben mich gelegt, doch nun meinte sie, es reiche, stand auf, lief zur Wohnungstür und fiepte leise. Ich sprang natürlich sofort auf. »Oh, Frau Weckerle – ich muss gehen! Die Kleine möchte in den Park.«
»Da müsset Sie natürlich gehen! Und ich muss ja au no mei Kehrwoch’ fertigmache! Kommet Sie, mir gehen nunter!«