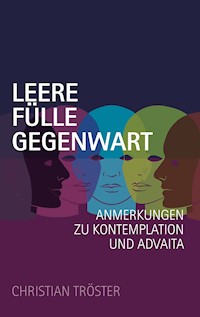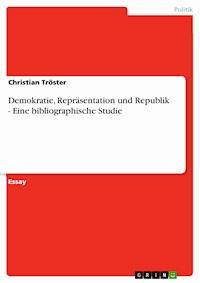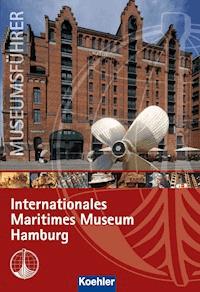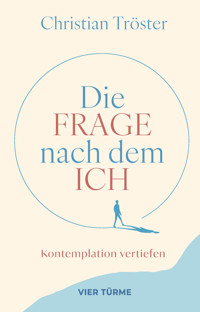
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vier-Türme-Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Christian Tröster praktiziert seit vielen Jahren Kontemplative Exerzitien, eine christliche Schule der Meditation, die unter anderen von Franz Jalics SJ entwickelt wurde. Irgendwann bemerkte er, dass auf diesem Weg bei ihm Stillstand eingetreten war. Und stellte fest, dass er diese Erfahrung mit vielen teilte, die ebenfalls schon länger diesen oder einen ähnlichen Weg praktizierten. Er machte sich daher auf, andere spirituelle Praktiken zu erkunden, was sich als sehr hilfreich herausstellte. Denn am Ende geht es in allen Traditionen und Übungen um grundlegende Fragen nach Sehnsucht, Erreichen-Wollen und danach, wie man mit diesem scheinbar ewigen Thema umgehen kann. Allerdings liegt es auch in der Natur der Sache, dass Sprechen über Kontemplation, über Stille, Bewusstsein und das Selbst etwas Unabgeschlossenes hat. Es gibt keine letzten theologischen Antworten. Immer wieder ist daher auch vom "unbegreiflichen Geheimnis Gottes" die Rede. Das Geheimnis, das wir Gott nennen, ist jedoch nicht "irgendwo da draußen" zu finden, sondern wohnt auf dem Grund unserer Seele und strahlt von dort aus. Dieses Geheimnis in meditativem Erforschen zu entdecken, ist das wesentliche Anliegen dieses Buches.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie. Detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Printausgabe
© Vier-Türme GmbH, Verlag, Münsterschwarzach 2025
ISBN 978-3-7365-0649-7
E-Book-Ausgabe
© Vier-Türme GmbH, Verlag, Münsterschwarzach 2025
ISBN 978-3-7365-0670-1
Alle Rechte vorbehalten
E-Book-Erstellung: Sarah Östreicher
Lektorat: Marlene Fritsch
Covergestaltung: Finken und Bumiller, Stuttgart
Covermotiv: © Jozef Micic / Shutterstock
www.vier-tuerme-verlag.de
Christian Tröster
Die Frage nach dem Ich
Kontemplation vertiefen
Vier-Türme-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Die Kontemplation und Ich
Über das Verhältnis von Spiritualität und Psychologie
Die Hinwendung zum Bewusstsein
Die kontemplative Praxis
Am Ende anfangen oder: Wer bin ich?
Selbsterkundung – Den Seinsgrund entdecken
Gibt es Erfahrungen außerhalb von Bewusstsein?
Der Körper oder: Wo ist Innen?
Den Allgrund erfahren
Das Relative und das Absolute oder: Mensch und Gott
Einssein
Ein Ausflug in die Theologie
Die Kontemplation und das übrige Leben
Das Ich-Gefühl
Zusammenfassung
Nicht-Praxis
Literatur
Anmerkungen
Guide
Cover
Impressum
Buchtitel
Einführung
»Wenn du es verstanden hast, ist es nicht Gott.«
Augustinus
Lange habe ich überlegt, wie wohl der Titel dieses Buches lauten sollte. »Kontemplation vertiefen«, so hieß der Arbeitstitel. Damit wäre zunächst gesagt, dass das, was ich vermitteln möchte, nicht als »Einführung in die Meditation« gedacht ist, stattdessen richtet es sich an Menschen, die schon über langjährige Erfahrungen mit dem kontemplativen Gebet oder anderen Meditationspraktiken verfügen. Dass am Ende »Die Frage nach dem Ich« vorne steht, soll auf die Zielrichtung meines Unterfangens hinweisen: die Selbsterkenntnis als Gotteserkenntnis – ein in unserer Kultur fremd und irritierend wirkender Ansatz. Ich hoffe, diese Fremdheit in diesem Buch so weit wie möglich aufzulösen und möchte, sozusagen als Appetithappen, nur ein Zitat von Meister Eckhart voranstellen: »Wer Gott recht in Wahrheit hat, der hat ihn an allen Stätten und auf der Straße ... ein solcher Mensch trägt Gott in allen seinen Werken und an allen Stätten und alle Werke dieses Menschen wirkt allein Gott.« Das Geheimnis, das wir Gott nennen, ist demnach nicht »irgendwo da draußen«, sondern wohnt auf dem Grund unserer Seele und strahlt von dort aus. Dieses Geheimnis in meditativem Erforschen zu entdecken, ist das wesentliche Anliegen dieses Buches.
Die Idee dazu, vielleicht auch die Notwendigkeit, meine Gedanken schriftlich zu formulieren, ergab sich aus meinen eigenen Erfahrungen in Kontemplativen Exerzitien – einer christlichen Schule der Meditation – und der Feststellung, dass ein gewisser, aber anhaltender Stillstand eingetreten war. Dies führte mich zur Erkundung anderer spiritueller Praktiken, die sich für mich – einige Sackgassen eingeschlossen – als überaus hilfreich herausstellten.
Einige Retreats, die ich später selbst mit dem Titel »Kontemplation vertiefen« veranstaltet habe, zeigten mir, dass ich mit dem Gespür für diese Möglichkeiten nicht allein bin. Vielfach bin ich dem Wunsch begegnet, für die Kontemplation andere Aspekte zu beleuchten, als es die Exerzitien tun – und sie dabei doch als Bezugspunkt und gemeinsamen Grund zu würdigen. Möglicherweise sprechen meine Hinweise zudem Menschen an, die sich nicht im christlichen Rahmen bewegen. Auch Meditationsansätze von Vipassana über Zen bis zum Tibetischen Buddhismus können Fragen nach Stillstand und Entwicklung aufwerfen. Es sind am Ende grundlegende Fragen nach Sehnsucht und Erreichen-Wollen und danach, wie man mit diesem scheinbar ewigen Thema umgehen kann.
Was genau ist eigentlich mit dem Weg nach Innen gemeint, habe ich mich selbst irgendwann gefragt, und was mit reinem Gewahrsein? Ist es wirklich mit dem Lauschen auf den Atem getan? Und was hat es mit jener geheimnisvollen Formulierung aus der Wolke des Nichtwissens auf sich, die mich faszinierte und verwirrte: Man solle, so heißt es da, nicht begreifen, wie und was man sei, sondern allein begreifen, dass man sei. Warum zog mich diese Aussage so an und warum ließ sie mich trotz ihrer Einfachheit ratlos zurück? Was sollte das sein? Ist es gefährlich, sich damit zu beschäftigen – die eigene Existenz ohne Berücksichtigung ihrer Eigenschaften zu meditieren? Oder wäre es einfach nur trivial? Was könnte simpler sein als festzustellen, dass ich bin?
Ausgangspunkt meiner Überlegungen sind die Kontemplativen Exerzitien, wie sie von Franz Jalics SJ entwickelt wurden, und das Gebet der Sammlung, das Thomas Keating und seine Weggefährten formuliert haben. Was ich im Anschluss versuche, ist eine Ergänzung und Präzisierung kontemplativer Gebetspraxis durch Mittel, die uns die Tradition des Advaita Vedanta zur Verfügung gestellt hat. Es waren diese, die mir an vielen Stellen die Augen geöffnet haben. Dabei hat die Lehre der Non-Dualität, die auf die Upanishaden und den indischen Gelehrten Shankara (788–820 n. Chr.) zurückgeht, mit meditativen Übungswegen zunächst wenig zu tun. Ich werde darauf später eingehen. Hier sei nur vorausgeschickt, dass die Hinweise des Advaita, des Direkten Wegs oder der Non-Dualität (die Bezeichnungen werden gern wechselnd und unscharf verwendet) für die Kontemplation neue Horizonte oder neue Tiefen eröffnen können – es ist ein Anliegen dieses Buches, diesen Schatz einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, insbesondere jenen, die dem kontemplativen Gebet verbunden sind.
Auch möchte ich auf die Erfahrung der Einheit zu sprechen kommen – schließlich bedeutet der Begriff A-dvaita »nicht zwei«. Allerdings, das scheint mir sicher, hat dieses Thema ebenso viele Facetten wie Möglichkeiten des Missverstehens. Dass es im Zusammenhang mit der Kontemplation überaus diskret behandelt wird, ist offensichtlich und im Kontext von überkommenen Theologien auch verständlich. Allein die Berufung zur Kontemplation, geschweige denn die Erfahrung von Einheit galt jahrhundertelang als so außergewöhnlich und unwahrscheinlich, dass sie theologisch an den Rand gedrängt und praktisch nicht weiter beachtet wurde. Wer sich in der christlich dominierten Welt dennoch auf den Weg machte, wurde gewarnt, wenn nicht sanktioniert.
Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung mag sein, dass der Einheitserfahrung noch eine weitere Bedeutung zugeschrieben wurde. Im Zuge von New Age und östlich inspirierten Bewegungen im Westen erfuhr sie eine utopisch-romantische Überhöhung. Begriffe wie »Erleuchtung«, »Erwachen« und »Selbstverwirklichung« werden in einer esoterischen Alternativkultur mit der Fantasie verbunden, sein Leben von diesem Punkt an in höheren Sphären zu verbringen – losgelöst vom Alltag, vom Ego und von allen Problemen. Dass dem nicht so ist, wurde in jeder spirituellen Kultur zwar auch schon ausgedrückt – von Jack Kornfields »Nach der Erleuchtung Wäsche waschen« bis zu dem Zen-Spruch »Nach der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen«. Durchgedrungen scheinen diese Aussagen aber kaum. Die Einheitserfahrung jedoch vor lauter Respekt oder um Missverständnisse zu vermeiden nicht anzusprechen, halte ich für ein Versäumnis, gilt sie doch allen spirituellen Kulturen, auch dem Christentum, als grundlegend.
Unabweisbar erscheint mir, dass moderne Non-Dualität, wenngleich aus einem anderen Kulturraum stammend, in einen christlichen Deutungshorizont hineingenommen werden kann. Dazu eine Metapher, die mir in diesem Zusammenhang hilfreich erscheint: Die Religionen sind wie die Speichen eines Rades zur Mitte, zu Gott hin angeordnet – je weiter sie von diesem Zentrum entfernt sind, desto größer werden die Distanzen zwischen ihnen.
Dieses Bild kann ohne Umstände auf spirituelle Praktiken übertragen werden. Damit ist gesagt, dass man sie nicht gegeneinander ausspielen sollte, vielmehr gilt, voneinander zu lernen. Sicher sind Eigenheiten, Unterschiede und Schwerpunkte benennbar. Gemeinsam aber, und das erscheint mir im Zusammenhang dieses Buches als wesentlich, ist der christlichen Kontemplation und Advaita, dass sie die Unmittelbarkeit Gottes betonen. Während die Kontemplativen Exerzitien eine Phase der einübenden Sammlung zu immer weniger Tun vorsehen, setzt Advaita von Anfang an auf Gewahrsein. Beides läuft auf etwas hinaus, das man die »Einheit allen Seins«, das »universelle Selbst« oder die »Christuswirklichkeit« nennen kann. Dieses »etwas« (das kein etwas ist) gilt in beiden Denkrichtungen als vorausgesetzt. Es kann folgerichtig nicht erreicht, sondern nur entdeckt werden. Hierauf verweist im christlichen Zusammenhang das Wort »Offenbarung«: Es kommt nichts hinzu, sondern es wird sichtbar (offenbar).
Demgegenüber legen buddhistische und davon abgeleitete Praktiken großen Wert auf stufenweises Vorangehen mithilfe mentaler Techniken. Dieses Vorgehen wird beispielhaft vom amerikanischen buddhistischen Lehrer B. Alan Wallace beschrieben: Auf die »nach innen gerichtete Aufmerksamkeit« folgten demnach die »stetig gerichtete Aufmerksamkeit«, »die wieder zurück gerichtete Aufmerksamkeit«, »die zunehmend gerichtete Aufmerksamkeit« usw., bis schließlich die neunte oder zehnte Stufe erklommen ist: ein Zustand namens Shamatha, in dem der begrifflich denkende Geist still und unbewegt ruhe »wie der Berg Meru, der König der Berge«1.
Hier steht offensichtlich das Üben im Vordergrund, bis hin zu einem geistigen Hochseilakt: »Sie können nun mühelos mindestens vier Stunden lang den kontinuierlich makellosen Samadhi aufrechterhalten«, so Wallace, aber »um an diesen Punkt zu gelangen, muss man fast mit Sicherheit viele Monate oder auch einige Jahre vollzeitlich (!) praktizieren«2. So weit zum Thema Arbeitsethos. Doch Wallace thematisiert auch, dass im Buddhismus das Verständnis des »uranfänglichen Bewusstseins« oder des »klaren Lichts ursprünglichen Gewahrseins« einen »Bereich anhaltender Debatten« bilde. Die unterschiedlichen Positionen fragen, »ob man das erleuchtete Bewusstsein als etwas ansieht, das man kultivieren, also entwickeln, entfalten und pflegen muss, oder ob es etwas ist, dass es bloß zu entdecken gilt«3.
Advaita steht in dieser Frage klar aufseiten des Bewusstwerdens, des Wissens. Ebenso die christliche Kontemplation, die nach einer Phase einübender Sammlung auf Hingabe setzt und Nicht-Erreichen-Sollen. »Techniken«, sagt deshalb der Kontemplationslehrer Martin Laird OSA, »suggerieren eine gewisse Kontrolle, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Sie haben zweifellos ihre Berechtigung. Kontemplative Praxis aber ist etwas anderes.«4
Eine schöne Synthese zwischen Übungsweg und Erkenntnis hat Thomas Keating formuliert. Er weist darauf hin, dass das Wort »Kontemplation« seinem Ursprung nach ein »Erfahrungswissen« meint, »das sich durch Liebe mitteilt«5. Diese Aussage möchte ich mit drei Ausrufezeichen versehen. Das hier gemeinte Wissen ist vorbegrifflich und als Verb zu verstehen, nicht als angehäufte Kenntnis. Nur: Ab dem Moment, in dem man versucht, dieses »wissen« zu kommunizieren, mithin zu versprachlichen, erscheint es als enorm kompliziert.
Damit bin ich bei den Reaktionen, die ich zu einer früheren Version meines Buches6 erhalten habe. Meine Ausführungen darin haben teils Unverständnis hervorgerufen. »Worüber man sich so Gedanken machen kann ...«, war noch eine der freundlicheren Bemerkungen dazu. Der Inhalt erschien nicht nur einzelnen Personen sehr abstrakt. Die Frage »Wie macht man das?« war mir da schon angenehmer. Dass ich sie im ersten Buch nicht ausreichend beantwortet habe, lag auch daran, dass ich mich gegen einen »How-to«-Ansatz entschieden hatte. Abgesehen davon, dass es in der Kontemplation ohnehin nicht um Machen geht, mag ich Bücher, deren Titel mit »Wie man ...« beginnt, grundsätzlich nicht, jedenfalls, wenn es um spirituelle Themen geht. Deshalb hatte ich mich zunächst gegen begleitende, didaktische Vorschläge im Buch entschieden. Heute, drei Jahre später, hoffe ich, einen Weg aus diesem Dilemma heraus gefunden zu haben. Ich ergänze den Text um Mitschriften aus Zoom-Seminaren, die ich zwischenzeitlich gegeben habe. Die dialogische Form soll eine bessere Klärung mancher Aspekte ermöglichen. Ich verstehe mittlerweile immer mehr, warum einige spirituelle Lehrer überhaupt nur Dialoge oder Mitschriften von Seminaren und Vorträgen veröffentlichen. Auch Franz Jalics hat dem in seinem Exerzitienbuch breiten Raum gegeben. Das gesprochene Wort, im und aus dem Moment entstanden, hat eine größere Offenheit als das am Computer geschriebene. Die Kombination von beiden erfüllt in diesem Buch hoffentlich ihren Zweck. Die Dialoge sind hier im Buch jeweils eingeschoben und mit dem Symbole gekennzeichnet.
Allerdings liegt es auch in der Natur der Sache, dass Sprechen über Kontemplation, über Stille, Bewusstsein und das Selbst etwas Unabgeschlossenes hat. Es gibt keine letzten theologischen Antworten, die wir mit einem »Jetzt ist die Sache klar« quittieren dürften – so eine Formulierung von Karl Rahner7. Immer wieder hat er deshalb vom »unbegreiflichen Geheimnis Gottes« gesprochen. Auch in der Kontemplation beziehen wir uns darauf. Und doch müssen wir darüber sprechen. »Die Worte sind lediglich ein Katalysator der wahren Formulierung, die im Leser stattfindet«, las ich einmal zum Werk des von mir verehrten spirituellen Lehrers Jean Klein.8 Das Thema könnte in immer weiteren Facetten beleuchtet werden, und doch würde immer ein Rest an Unbegreiflichem bleiben. Seit Jahrhunderten und in vielen Kulturen haben sich schon klügere Menschen dem angenähert9, besser als ich es je könnte.
Die Kontemplation und Ich
Über meine Motivation, dieses Buch überhaupt zu verfassen, möchte ich ein paar Worte verlieren. Das kontemplative Gebet hat in den letzten zwanzig Jahren in der westlichen Welt viel Interesse erfahren. Im deutschsprachigen Raum ist dies mit den Kontemplativen Exerzitien und mit dem Namen Franz Jalics SJ verbunden. Man findet mittlerweile zahlreiche Kurse, die den Titel »Kontemplative Exerzitien« tragen. Seine Anweisungen führen die Meditierenden in genau definierten Schritten zu immer tieferer Sammlung. Im Einzelnen sind dies: Die Wahrnehmung der Natur, die Wahrnehmung des Atems und der Handinnenflächen. Es folgen Gebetsworte wie »Ja« und »Maria«, die innerlich gesprochen werden. Am Ende wird der Name »Jesus Christus« mit dem Aus- und Einatmen nach Art eines Mantras ununterbrochen innerlich wiederholt – das sogenannte Jesusgebet, das eine lange Tradition in der christlich-orthodoxen Mystik hat.
In ihrer Didaktik liegt das Verdienst der Kontemplativen Exerzitien. Sie haben in der Hinführung zur Sammlung strukturelle Ähnlichkeiten mit der sogenannten Achtsamkeits- oder Vipassana-Meditation aus dem buddhistischen Bereich. Die Exerzitien wirken in der seelischen Tiefe. Sie sind ein Segen für die Teilnehmer, vielleicht aber auch für die christlichen Kirchen. Im deutschsprachigen Raum haben sich mittlerweile über hundert Kontemplationsgruppen etabliert – allein auf Initiative Einzelner. Franz Jalics’ Buch »Kontemplative Exerzitien« gilt seit Jahrzehnten als Standardwerk und ist in viele Sprachen übersetzt. Parallel zur Verbreitung des Kontemplativen Gebets in Europa haben in den USA Lehrer wie Thomas Keating OCSO und Cynthia Bourgeault, dazu auch der Franziskanerpater Richard Rohr wertvolle Arbeit geleistet. Ihre Schriften haben ein spürbares Gegengewicht zu überkommenen Formen christlicher Verkündigung sowie zur Selbstbeschäftigung kirchlicher Institutionen geschaffen. Ganz sicher hat das Kontemplative Gebet auch tiefere Sehnsüchte vieler Menschen angesprochen, die über die Aktivitäten gemeindlichen Christentums hinausgehen und authentisches Suchen sind nach dem Geheimnis, das wir Gott nennen. Tatsächlich machen die Teilnehmer kontemplativer Retreats immer wieder tiefe spirituelle und heilsame Erfahrungen, die zu Wandlung, zu Versöhnung, mehr Liebe und innerem Frieden führen.
Nach meiner Beobachtung bleiben die Kontemplativen Exerzitien jedoch, wenn sie nicht von sehr erfahrenen Lehrern angeleitet werden, oft unter den Möglichkeiten, die in ihnen angelegt sind. Gemeint ist eine Art Verschulung, ein System der Vermittlung, das leicht zu reproduzieren ist, das zugleich aber auf einem gewissen Niveau stehen bleibt. Was in den Exerzitien-Ansprachen beim ersten, zweiten oder dritten Kurs bewegend und berührend ist, erschöpft sich bei weiterer Wiederholung. Selbstverständlich haben die Zeiten der Stille ihre eigene Kraft. Doch auch, wer zum siebten oder zehnten Mal an den Exerzitien teilnimmt – und das sind nicht wenige Teilnehmer –, durchläuft heute nach dem Grieser Exerzitienprogramm immer wieder die gleichen Schritte wie jene, die zum ersten Mal dabei sind. Das wäre wichtig und zwingend, hört man da, leider ohne weitere Begründung. Das Gute an dieser Vorgehensweise ist, dass sie gewiss nicht schadet. Doch führt sie nicht notwendigerweise in die Tiefe, die von ihrem Begründer noch vermittelt werden konnte. Die nüchterne Wahrheit ist: Auch Exerzitien können zur Routine werden. Es werden Impulse zu den immer gleichen Themen angeboten. Hinzu kommen verpflichtende Begleitgespräche, die freundlich und positiv sind, aber oft keine weitere Wegweisung enthalten, sobald die schwereren psychologischen Themen abgearbeitet sind. Die Themen ab den sechsten Exerzitien, ich spitze bewusst zu, heißen »zu viele Gedanken während der Meditationszeit« und »allgemeine Unruhe« – same procedure as every year. Und nun?
An dieser Stelle öffnet sich eine Falltür, die der Kontemplation selbst inhärent ist, nämlich das Diktum: »Du sollst nichts erreichen!«. Franz Jalics hat diesen Punkt immer wieder betont. Doch verlieren sich die Hilfestellungen vieler seiner Nachfolger im Ungefähren, mit Hinweisen auf Gnade, die schon alles richten werde – oder auch nicht. Die schlichte Anweisung dazu heißt: Mach einfach immer weiter. Gewiss, die ausgedehnten Zeiten der Stille tun das Ihre, um die Zeit auch der zwanzigsten Exerzitien zu einer positiven und immer wieder gesuchten Erfahrung zu machen. Gewiss, Geduld und die Fähigkeit zum Ausharren sind unabdingbar für die Kontemplation, und Vertrauen auf die Gnade kann auch nicht schaden. Doch die vage Didaktik des »wir wiederholen immer das Gleiche« ist nach meiner Auffassung keine ausreichende Antwort auf das Dilemma des Nicht-Erreichen-Sollens. Erschwerend kommt hinzu, dass sie, wie so vieles im Leben, weder ganz falsch noch ganz richtig ist. Was ist Erreichen-Wollen an dem Wunsch, überhaupt Exerzitien zu besuchen, und was davon ist echte Sehnsucht und genuines Gespür dafür, dass da irgendein »Mehr« hinter der psychologischen Ebene liegt?