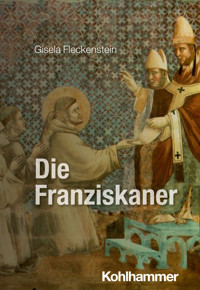
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Franziskaner sind eine der bekanntesten und einflussreichsten Ordensgemeinschaften innerhalb der katholischen Kirche. Die im 13. Jahrhundert von Franziskus von Assisi (1181/82-1226) initiierte Gründung blickt auf eine über 800 Jahre lange bewegte Geschichte voller spiritueller Höhen, aber auch ordensinterner Auseinandersetzungen zurück. Ausgehend von der evangelischen Lebensweise des Ordensgründers stellt Gisela Fleckenstein die historische Entwicklung der drei franziskanischen Ordenszweige vor: Franziskaner, Kapuziner und Minoriten (Erste Orden), Klarissen (Zweiter Orden) und den vorwiegend aus Laien bestehenden Dritten Orden. Von den Beiträgen der Franziskaner zur Missions-, Wissenschafts- und Kulturgeschichte schlägt sie den Bogen in die Gegenwart zum spirituellen Erbe der franziskanischen Bewegung und ihrem besonderen Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
00_Vorbemerkung (KeinKT)
Einleitung
1 Franziskus von Assisi und die neue evangelische Lebensweise
Das evangelische Ideal der radikalen Armut
Begegnung mit der Schöpfung
Franziskus, ein anderer Christus
Regel und Aufbau des Ordens
Eintritt in den Orden
Leben und Ämter im Orden
2 Evangelische Armut – eine trennende Frage
Die Bewegung der Spiritualen
Der theoretische Armutsstreit
Observanten und Konventualen
Weitere Richtungen im Orden
Die Kapuziner
3 Reformation und katholische Reform
4 Vom Dreißigjährigen Krieg bis zur Französischen Revolution
Abhängigkeiten von Bischöfen und Landesherren
Öffentliches Schulwesen
Ökonomische Voraussetzungen
5 Das lange 19. Jahrhundert
Säkularisation und Neubeginn
Volksmissionen
Kulturkampf
Die Fusion der Orden in der Unio Leonina
6 Kriege, Diktatur, Demokratie und kirchliche Reformen im 20. Jahrhundert
Kriegseinsatz und Kriegserfahrungen im 1. Weltkrieg
Zwischenkriegszeit
Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg
Assisi im Zweiten Weltkrieg
Das Zweite Vatikanische Konzil
7 Geschichtsschreibung – die »Franziskanische Frage«
8 Franziskanische Quellenschriften
9 Klara von Assisi und das franziskanische Lebensideal – der Zweite Orden
Orden von San Damiano
Klarissen, ihre Reformen und Verbreitung
Klarianische Föderationen und Alltagsleben
10 Franziskanisches Leben in der Welt – der Dritte Orden
11 Die Regulierten Dritten Orden
12 Mission und die Ausbreitung des Ordens
13 Theologie in Ausbildung und Wirkung
Bedeutende Theologen an den Universitäten
Ordensinterne Ausbildung
Theologie im provinzeigenen Studium
Ablasswesen und Portiunkula-Ablass
Theologie der Befreiung
14 Liturgie und Frömmigkeit
15 Franziskanisches in Kunst und Wissenschaft
Architektur
Die religiöse Gestaltung der Landschaft und die Veranschaulichung von Glaubensinhalten
Malerei
Poetische Literatur
Franziskanische Studien
Singspiel, Oratorium und Oper
Archive
Bibliotheken
16 Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
Franciscans International
Friedensgebete von Assisi
17 Interfranziskanische Bewegungen und allgemeine Erneuerung
Interfranziskanische Zusammenarbeit
Nachkonziliare Experimente
Franziskanische Zukunft
Schlussbemerkung
Abkürzungsverzeichnis
Gedruckte Quellen und Literatur
Personenregister
Urban: Die Geschichte der Christlichen Orden
Herausgegeben von Klaus Unterburger, Christoph Dartmann und Franz Xaver Bischof.Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/christliche-orden
Die Autorin
Gisela Fleckenstein (geb. 1962) ist Historikerin und Archivarin. Seit 2022 ist sie Leiterin des Landesarchivs Speyer. Sie promovierte 1991 an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit einer Arbeit über die Franziskaner im Rheinland 1875 – 1918. Nach ihrer Ausbildung zur Archivarin war sie von 1995 bis 2009 in Nordrhein-Westfalen im Staatsarchiv Detmold und im Personenstandsarchiv Rheinland in Brühl tätig. Von 2009 bis 2018 arbeitete sie am Historischen Archiv der Stadt Köln und wechselte 2019 als stellvertretende Leiterin an das Landesarchiv Speyer. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Kirchen- und Ordensgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Seit 2000 ist sie in der Leitung des Arbeitskreises Ordensgeschichte 19./20. Jahrhundert engagiert und seit 2004 Mitglied der Kommission für kirchliche Zeitgeschichte im Erzbistum Paderborn.
Gisela Fleckenstein
Die Franziskaner
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.Umschlagabbildung: Anerkennung der Ordensregel des Franziskus durch Papst Innozenz III. Fresko von Giotto di Bondone (1266 – 1337?), um 1295/1300 in der Oberkirche der Basilika San Francesco in Assisi, gemeinfrei.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-026321-5
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-026322-2epub:ISBN 978-3-17-026323-9
Hinweis zu den Franziskus- und Klara-Quellen
Die deutschen Franziskaner Kajetan Eßer, Lothar Hardick, Sophronius Clasen und Engelbert Grau waren weltweit die Ersten, welche die zahlreichen Quellen zum Leben des Franziskus wissenschaftlich und systematisch umfassend aufgearbeitet und in den Franziskanischen Quellenschriften einem breiten Publikum zugänglich gemacht hatten.
Auf der Grundlage dieser Forschungen baut die deutsche Übersetzung der 2009 erschienenen »Franziskus-Quellen. Die Schriften des heiligen Franziskus, Lebensbeschreibungen, Chroniken und Zeugnisse über ihn und seinen Orden« auf, herausgegeben von Dieter Berg und Leonhard Lehmann, 2., verb. Aufl., Kevelaer 2014.
Für den deutschen Sprachraum folgte ein Band »Klara-Quellen. Die Schriften der heiligen Klara, Zeugnisse zu ihrem Leben und ihrer Wirkungsgeschichte«, herausgegeben von Johannes Schneider und Paul Zahner, Kevelaer 2013.
Die Quellenangaben im vorliegenden Buch verweisen auf diese beiden Werke. Für die einzelnen Quellen werden Abkürzungen verwendet. Sie sind im Abkürzungsverzeichnis im hinteren Teil des Buches zu finden. Die Franziskus- und Klara-Quellen sind grundlegend für dieses Buch, weil das Handeln und Wirken der Franziskaner immer wieder an diesen Quellen ausgerichtet ist.
Einleitung
Franziskus von Assisi (1181/82–1226) entschied sich für ein Leben nach dem Evangelium in freiwilliger Armut. Damit gehörte er zunächst zu einer für seine Zeit typischen Büßerbewegung. Doch seine Bewegung hatte Erfolg und hat die Welt bis heute geprägt. Franziskus ist eine »spirituelle Leit- und Identifikationsfigur über seinen Tod hinaus«.1 Nicht nur die umbrische Stadt Assisi erinnert an den Heiligen, sondern auch die durch spanische Franziskanermissionare im 18. Jahrhundert gegründeten heutigen US-amerikanischen Metropolen San Francisco und Los Angeles (Maria von den Engeln).
Die Franziskaner bilden einen neuen Ordenstyp. Im Gegensatz zu der bis dahin üblichen benediktinischen Bindung an eine klösterliche Gemeinschaft auf Lebenszeit (stabilitas locis bzw. der stabilitas in congregatione) gibt es bei den Bettelorden nur die lebenslange Bindung an die Ordensgemeinschaft (stabilitas in ordine). Das zeigt eine gewisse Heimatlosigkeit der Franziskaner an, deren Kloster die ganze Welt ist (SC 30, 24–25).2 Die Franziskaner versuchten nach dem Ideal des heiligen Franziskus zu leben. Für sie galt ein Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam und eine Arbeit mitten unter den Menschen. Franziskaner haben bis heute ihre Niederlassungen in Städten bzw. dort, wo sie Menschen begegnen und das Wort Gottes verkünden können. Ebenso wollten sie ein Pilgerdasein führen. Geld durfte nur für die Versorgung von Armen angenommen werden. Damit unterschieden sich die Franziskaner ganz bewusst von alten, auf die Kontemplation ausgerichteten Orden. Hinzu kam der Verzicht auf ein autarkes Wirtschaften; den Lebensunterhalt bestritt man durch Betteln. Das franziskanische Ordensleben erfuhr im Laufe der Geschichte viele Anpassungen an die Realität. Dies fand seinen Niederschlag in päpstlichen Regelerklärungen sowie in den General- und Provinzstatuten. Die gravierendsten Änderungen ergaben sich immer hinsichtlich des Besitzes. Provinzen gründeten feste Niederlassungen, erwarben dafür Grundstücke und übernahmen auch feste Seelsorgestellen. Auch Geld wurde über die Geistlichen Väter nicht nur für Arme, sondern auch für die alltäglichen Bedürfnisse der Klöster angenommen.3
Es ist eine zentrale franziskanische Frage, welcher Umgang mit Besitz für einen Franziskaner angemessen ist. Die Frage nach der Armut ist von Beginn an ein Konfliktpotential, aber auch Antrieb für vielfältige Reformen innerhalb der franziskanischen Orden. Der Rückgriff auf die Ideen und die Ideale des Gründers und das Bestreben, diese wieder in der jeweiligen Gegenwart zu leben, macht bis heute die Lebendigkeit der franziskanischen Bewegung aus. Die franziskanischen Orden bestehen aus drei Zweigen. Franziskus selbst gehörte zum Ersten Orden (Männerorden). Dieser teilte sich aufgrund unterschiedlicher Armutsauffassungen im Laufe der Jahrhunderte in drei Untergliederungen: Franziskaner (OFM), Minoriten (OFMConv) und Kapuziner (OFMCap). Der Zweite Orden wurde mit Unterstützung des Franziskus von Klara von Assisi gegründet und lebt in strenger Armut und Kontemplation. Nach der Gründerin wird der Zweite Orden auch Klarissenorden (OSC) genannt. Der Dritte Orden entstand auch im 13. Jahrhundert. Hier fanden sich Männer und Frauen zusammen, die sich an den Idealen des heiligen Franziskus orientierten, aber nicht gemeinschaftlich in einem Kloster lebten. Der Dritte Orden entwickelte sich in zwei Richtungen weiter. Zum einen in den Dritten Orden franziskanischer Weltleute (OFS), dem Frauen und Männer angehören, verheiratet oder ehelos, darunter auch Priester, die außerhalb eines Klosters franziskanisch leben wollen. Zum anderen in den Zweig der Regulierten Dritten Orden (TOR), zu dem Männer- und Frauengemeinschaften gehören. Die Mehrzahl bilden die im 19. Jahrhundert gegründeten Franziskanischen Frauenkongregationen (OSF) mit meist karitativen Aufgaben.
Die Ersten, Zweiten und Dritten Orden sind rechtlich autonom, aber alle sind durch die Berufung auf die Ordensgründer Franziskus und Klara von Assisi und durch ihre Spiritualität eng miteinander verbunden. Deshalb kann man eine Geschichte der Franziskaner nie isoliert betrachten. Alle drei Zweige des Franziskanerordens sind erdumspannend verbreitet.
Das 1909 erschienene »Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens«4 des bayerischen Franziskaners Heribert Holzapfel (1868–1936) ist immer noch die umfassendste Geschichte in deutscher Sprache. Mit dem Franziskanertum als religiöser Bewegung und dem Weiterleben des franziskanischen Ideals hat sich Helmut Feld (1936–2020) in seinem erstmals 1994 erschienen Werk »Franziskus von Assisi und seine Bewegung«5 auseinandergesetzt. Helmut Feld, Kirchenhistoriker und Theologe, legte unter dem Titel »Die Franziskaner« 2008 eine kompakte und überzeugende Kurzfassung ihrer Geschichte vor. Das vorliegende Buch möchte, ausgehend von der evangelischen Lebensweise des Ordensgründers, die historische Entwicklung der drei franziskanischen Ordenszweige vorstellen. Der Schwerpunkt liegt auf der deutschen Ordensgeschichte, die in Bezug zur Gesamtordensgeschichte gesetzt wird. Zunächst werden die Franziskaner chronologisch mit den für die Epoche charakteristischen Themen dargestellt. Der Zweite und Dritte Orden erhält um der Übersichtlichkeit willen jeweils eigene abgeschlossene Kapitel. Im Anschluss an die Mission und die Verbreitung des Franziskanerordens wird von der Liturgie- über die Kunst- und Kulturgeschichte ein Bogen in die Gegenwart zum spirituellen Erbe der franziskanischen Bewegung und ihrem besonderen Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung geschlagen.
2026 jährt sich zum 800. Mal der Todestag des Franziskus von Assisi. Das Buch will auf der Folie der franziskanischen Geschichte, aufgrund des beschränkten Umfangs mit Mut zur Lücke, zeigen, wie lebendig seine Ideen bis heute sind und wie die Person des Franziskus von Assisi unabhängig vom Franziskanerorden auch die Kulturgeschichte beeinflusst hat.
Seit 2013 kann man von Franziskus von Assisi kaum mehr sprechen, ohne an Papst Franziskus zu denken. Am 13. März 2013 trat der argentinische Kardinal Jorge Mario Bergoglio auf die Loggia des Petersdomes in Rom. Dieser Papst nannte sich als erster in der Reihe der Päpste Franziskus. Der Name wurde sofort zum Programm. Papst Franziskus begann mit dem Bruch von Traditionen. Er bezog nicht die Papstwohnung im Apostolischen Palast, sondern blieb in einer Wohnung des Gästehauses Santa Marta. Er verzichtete auf große Autos, rote Schuhe und eine tradierte barocke Ausstattung. Er trägt die schlichte weiße Soutane und ein Blechkreuz. In seinem ersten apostolischen Schreiben Evangelii gaudium (2013) betonte er, dass es nicht das Ziel der Kirche sein dürfe, schön und unversehrt zu sein. Sie müsse sich auf den Weg zu den Menschen machen und sich verbeulen lassen. Er setzte sich ein für die Umwelt, für Migranten und andere an den Rand gedrängte Gruppen. Er ist der oberste Hirte und gibt sich pastoral. Er überraschte mit seinem bescheidenen Auftreten. Er ging auf Obdachlose, Arme und Flüchtlinge aktiv zu, suchte interreligiöse Bündnisse und verstand es, bemerkenswerte Zeichen zu setzen. Seine zweite Enzyklika Laudato si' (2015) bezog sich schon mit ihrem Titel direkt auf den Sonnengesang des Franziskus von Assisi. Zeichen setzte er auch in Assisi, der Stadt des Franziskus, die er wiederholt besuchte. Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf schrieb im Oktober 2013 in seinem Vorwort zur 3. Auflage von Helmut Felds Buch:6
Mit Papst Franziskus ist die mittelalterliche Armutsbewegung, die sich gegen die Machtentfaltung und den Prunk der Römischen Kurie im Speziellen und der Institution Kirche insgesamt richtete, in Rom selbst, auf dem Stuhl des Apostelfürsten angekommen.
Endnoten
1Breitenstein, Mirko: Das Noviziat im hohen Mittelalter. Zur Organisation des Eintrittes bei den Cluniazensern, Cisterziensern und Franziskanern, Berlin 2008 (Vita regularis. Abhandlungen, Bd. 38), S. 419.
2Hilsebein, Angelica/Fleckenstein, Gisela/Schmies, Bernd (Hgg.): Unser Kloster ist die Welt. Franziskanisches Wirken vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Begleitband zur Ausstellung im Franziskanerkloster Paderborn vom 9. Dezember 2011 bis zum 6. Mai 2012, Norderstedt 2012, S. 9.
3Plath, Christian: Zwischen Gegenreformation und Barockfrömmigkeit: Die Franziskanerprovinz Thuringia von der Wiederbegründung 1633 bis zur Säkularisation, Mainz 2010 (Quellen und Abhandlungen zur Mittelrheinischen Kirchengeschichte, Bd. 128), S. 315.
4Holzapfel, Heribert: Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens, Freiburg im Breisgau 1909.
5Feld, Helmut: Franziskus von Assisi und seine Bewegung, 2., überarbeite Aufl., Darmstadt 2007.
6Feld, Helmut: Franziskus von Assisi. Der Namenspatron des Papstes. Mit einem Vorwort von Hubert Wolf, 3., erweiterte u. bibliographisch akt. Aufl., Darmstadt 2013, S. XV. Bis auf das Vorwort von Hubert Wolf ist die Ausgabe 2013 trotz Änderung des Untertitels mit der von 2007 identisch.
1 Franziskus von Assisi und die neue evangelische Lebensweise
Im Frühjahr 1209 – irgendwann zwischen Ostern und Pfingsten – ging Franziskus Bernardone zusammen mit elf Begleitern von Assisi nach Rom. Die Gruppe wollte eine päpstliche Bestätigung ihrer Lebensweise nach dem Evangelium erhalten. Die Brüder machten sich auf den Weg zum Lateranpalast, dem Sitz des Papstes. Dort traf der »Visionär von Assisi«7, dem im Traum eine schöne arme Frau in der Wüste begegnet war, auf Papst Innozenz III. (1198–1226), dem im Traum ein Ordensmann erschienen war, der die einstürzende Lateran-Basilika mit seiner Schulter stützte (Gef 51; 2 C 16–17). Eine Begegnung, die die Kirche nachhaltig veränderte. Franziskus und seine Begleiter strebten nicht an, nach den Regeln der alten Mönchsorden zu leben. Sie wollten etwas Neues: ein Leben nach dem Evangelium in vollkommener Armut. Keine der bisherigen Ordensregeln hatte Eigentum oder gemeinsamen Besitz verboten.8 Franziskus wollte ein Leben in evangelischer Vollkommenheit. Damit waren Konflikte innerhalb des Ordens und mit der kirchlichen Hierarchie unvermeidlich. Mit dem Gang nach Rom machte die junge religiöse Bewegung aber deutlich, dass sie bereit war, sich innerhalb der kirchlichen Strukturen zu arrangieren.
Franziskus von Assisi war Sohn des vermögenden umbrischen Tuchhändlers Pietro di Bernardone und seiner Frau Pica, die wahrscheinlich aus Südfrankreich stammte. Während der Vater bei der Geburt des Kindes auf Geschäftsreise in Frankreich war, ließ die Mutter den Knaben auf den Namen Johannes (Giovanni Baptista) taufen. Diese Entscheidung wurde durch den Vater nach seiner Rückkehr revidiert und er nannte seinen ersten Sohn Francesco (»Franzose«). Franziskus konnte, wie sein leiblicher Bruder Angelo, auch Französisch. In der Kirche San Giorgio – heute steht dort in Assisi die Basilika Santa Chiara – erlernte er anhand des Psalters Lesen und Schreiben und auch die lateinische Sprache, in der er sich – wenn auch nicht fehlerfrei – ausdrücken konnte. Franziskus sollte als Kaufmann das väterliche Geschäft übernehmen. Einen großen Teil seiner Jugend verbrachte er mit Altersgenossen mit Fress- und Saufgelagen in Assisi, wobei Geld keine Rolle spielte. Das lockere Leben wurde durch einen Kriegseinsatz im Städtekrieg gegen Perugia unterbrochen. 1202 geriet Franziskus nach der Teilnahme an der Schlacht von Collestrada über ein Jahr in Gefangenschaft und kehrte danach krank nach Hause zurück. Sein ursprüngliches Projekt, Ritter zu werden, gab er auf. Assisi gehörte seit 1205 zum Gebiet des Kirchenstaates und unterstand damit der Herrschaft des Papstes. Die Selbstständigkeit der Stadt blieb allerdings durch einen eigenen Podestà (Bürgermeister) gewahrt. Innerhalb Assisis kam es zu weiteren Konflikten zwischen der teils adeligen Oberschicht, den Maiores, und dem Bürgertum, den Minores. Vom Aufschwung des Handels und des Gewerbes profitierte vor allem das Bürgertum, zu dem auch die Familie Bernardone gehörte, die einen regen Tuchhandel vor allem mit Frankreich betrieb. Vor den Stadttoren, also unterhalb des am Hügel des Monte Subasios gelegenen Assisi, lag das Kirchlein San Damiano. Darin befand sich ein Kreuzbild in romanisch-byzantinischem Stil, durch das der gekreuzigte Christus gesprochen haben soll (2 C 10):
Franziskus, geh hin und stell mein Haus wieder her, das wie du siehst, ganz verfallen ist.
Es bleibt offen, ob die Stimme wirklich zu hören war oder ob Franziskus sie in seinem Innern erspürte. Der so Angesprochene nahm den Auftrag zunächst wörtlich und baute diese und zusammen mit weiteren Helfern zwei andere Kirchen wieder auf. Aber Franziskus hatte auch die gesamtkirchliche Dimension des Auftrages verstanden. Es ging um die Rettung der Kirche, die vom geistigen Zerfall bedroht war. Das Kruzifix von San Damiano, dass sich heute in einer Seitenkapelle der Kirche Santa Chiara in Assisi befindet, wurde zur Basis für die besondere Verbindung des Franziskus zum leidenden und gekreuzigten Christus. In diesem Kreuzbild kommt die Idee der Welterlösung durch Christus zum Ausdruck. In der »Dreigefährtenlegende« (Gef) wird erwähnt, dass Franziskus die Wundmale Jesu (Stigmata) immer in seinem Herzen getragen hat (Gef 69). 1224, nach der Vision eines Seraphs auf dem Berg La Verna, zeigten sich die Stigmata auch äußerlich.9
Das Verlassen der Welt und die Unterstellung unter den Gehorsam der Römischen Kirche mit ihren Amtsträgern demonstrierte Franziskus auf dem Platz vor der Kathedrale San Rufino in Assisi. Wegen des Geldes, das Franziskus seinem Vater aus einem Warenverkauf unterschlagen hatte – es diente wohl für Baumaßnahmen in San Damiano – kam es zu einer Gerichtsverhandlung vor Bischof Guido von Assisi († 1228). Franziskus entkleidete sich vor der versammelten Menschenmenge und warf seinem Vater die Kleider hin. Danach erklärte Franziskus (2 C 12):
Von nun an will ich frei sagen: Vater unser, der du bist im Himmel, nicht mehr: Vater Pietro di Bernardone, dem ich nicht nur – schaut her! sein Geld zurückerstatte, sondern auch alle meine Kleider. So werde ich nackt dem Herrn entgegen gehen!
Der Bischof umarmte den nackten Franziskus, der nur ein Büßerhemd trug, und bedeckte seine Blöße mit einem Teil des bischöflichen Gewandes (Gef 20). Franziskus demonstrierte: Nackt, dem nackten Christus folgen, wie vor ihm Asketen und die Wandermönche des 12. Jahrhunderts. Es war ein weiteres Eingehen auf die Passion Christi und auf die Identifikation mit dem gekreuzigten Christus.10 Der nackte Christus am Kreuz galt als Sinnbild der Armut schlechthin und ihm so nachzueifern war Zeichen seiner besonderen Christusnachfolge.11
Nach der Trennung vom irdischen Vater gab es in Assisi für Franziskus Ablehnung und Bewunderung zugleich. Eine seiner ersten Unterstützerinnen war die vierzehn Jahre alte Klara (Chiara), eine Tochter des Adeligen Favarone di Offreduccio und seiner Frau Hortulana. Klara ließ Franziskus und seinen am Aufbau eines weiteren Kirchleins (Portiunkula-Kapelle) beteiligten Mitarbeitern einen Geldbetrag – sie kannte die Einstellung des Franziskus dazu noch nicht gut genug – überbringen, damit sie sich Fleisch kaufen konnten (ProKl 17, 7). In dem Portiunkula-Kirchlein Santa Maria degli Angeli (Maria von den Engeln) vor Assisi hörte Franziskus, vermutlich zwischen dem 9. und 14. April 1208, in der Messe das zehnte Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium von der Aussendung der Jünger. Nach einer Auslegung durch einen Priester war für Franziskus klar, was die Jünger Jesu nicht besitzen durften. Dazu gehörten Geld, Gold, Silber, Geldbörse, Reisebeutel, Brot, Wanderstab, Schuhe und mehr als ein Leibrock. Die Jünger sollten den Menschen die Botschaft vom Reich Gottes bringen und Umkehr und Buße predigen. Franziskus erklärte den Anspruch an die Jünger Jesu zu seiner eigenen Lebensregel. Eine religiös begründete Armut zu leben war sein vorrangiges Ziel. Er wurde zum Bußprediger. Zu seiner Predigt gehörte immer auch ein Friedenswunsch, wie er in seinem eigenen Testament steht (Test 23):
Als Gruß, so hat mir der Herr offenbart, sollen wir sagen: Der Herr gebe dir Frieden!
Der neuen Lebensweise des Franziskus schlossen sich rasch zwei angesehene Bürger Assisis an: Bernhard von Quintavalle († zwischen 1241/46) und Petrus Catanii († 1221), wahrscheinlich waren beide Juristen. Als dritter kam am Fest des hl. Georg am 23. April 1208 der Bauer Ägidius von Assisi († 1262) zu der kleinen Gruppe bei der Portiunkula-Kirche (Äg 1–9). Die Brüder brachen zu einer ersten Verkündigung des Evangeliums durch Mittelitalien auf. Sie wurden, wohl auch ob ihres armseligen Aussehens, von den Menschen abgelehnt und als Narren und Scharlatane beschimpft. Selbst Bischof Guido von Assisi riet ihnen, auf die absolute Besitzlosigkeit zu verzichten, doch darauf entgegnete ihm Franziskus (Gef 35):
Herr, wenn wir irgendwelche Besitztümer hätten, bräuchten wir Waffen zu unserem Schutz. Daraus entstehen Rechtsfragen und Streitereien, und in der Folge wird die Gottes- und Nächstenliebe gewöhnlich vielfach verhindert. Deshalb wollen wir in dieser Welt nichts besitzen.
Die Brüder sagten, dass sie »Männer der Buße waren, gebürtig aus der Stadt Assisi« (Gef 37). Bei der nächsten Reise brach die inzwischen gewachsene Gemeinschaft in vier Zweiergruppen zur Predigt auf. Die Dreigefährtenlegende (Gef) berichtet an gleicher Stelle über ein Gebet, welches die Brüder immer sprachen, wenn sie unterwegs eine Kirche oder ein Kreuz sahen. Franziskus schrieb das Gebet, das in der franziskanischen Ordensfamilie bis heute einen festen Platz hat, in seinem Testament auf (Test 4):
Und der Herr gab mir in den Kirchen einen solchen Glauben, dass ich in Einfalt so betete und sprach: »Wir beten dich an, Herr Jesus Christus [hier] und in allen deinen Kirchen auf der ganzen Welt, und wir preisen dich, weil du durch dein heiliges Kreuz die Welt erlöst hast.
Kirchen sind heilige Orte, die über die ganze Welt verstreut sind; sie bezeugen die Universalität der Erlösung und stehen damit mit der Friedensbotschaft für die »spirituelle Leitidee« des Franziskus. Kirchen sind greifbare Denkmäler der »in der Welt-Schöpfung sich vollziehenden Erlösung«,12 so der Franziskusforscher Helmut Feld.
Mit seinen jetzt elf Gefährten ging Franziskus 1209 zu Papst Innozenz III., um sich seine Regel mit dem radikalen Armutsgebot vorläufig bestätigen zu lassen. Die kleine Gruppe, die fast nur aus Laien bestand, erhielt die Erlaubnis zur Bußpredigt und zum Leben in radikaler Armut nach dem Evangelium. Wie Franziskus in seinem Testament schreibt, bestand die Lebensregel aus einigen dem Evangelium entnommenen Zitaten, die er hatte aufschreiben und dem Papst vorlegen lassen (Test 15). Das Franziskus im Mai 1209 nur mündlich bestätigte Propositum vitae ist nicht überliefert, aber das Jahr 1209 – gefeiert wird der 16. April (AP 3,1–2) – wird inzwischen von allen heute bestehenden Zweigen des Franziskanerordens als das Jahr der Gründungsidee der franziskanischen Lebensweise anerkannt.13 Bis 1221 erfuhr diese erste Regel Konkretisierungen und Erweiterungen, die der ständig wachsenden Gemeinschaft angepasst wurden. Franziskus nannte die Bruderschaft darin Fratres Minores (mindere/geringe Brüder) (NbR 6,3). Die Regel von 1221 wird als Regula non bullata (Nichtbullierte Regel, NbR) bezeichnet. Bis heute gilt für den Franziskanerorden die 1223 von Papst Honorius III. (1216–1227) mit der Bulle Solet annuere bestätigte Regula bullata (Bullierte Regel, BR). Diese Regel unterscheidet sich nicht nur durch ihren kürzeren Umfang von der ersten Regel, sondern auch in ihren Formulierungen. Beratend zur Seite stand der kanonisch gebildete Kardinalbischof Hugolino von Ostia, der spätere Papst Gregor IX. (1227–1241), dem, so Helmut Feld, der »subversive Charakter der franziskanischen Armut«14 für die Kirche kaum entgangen sein dürfte. Werner Maleczek schreibt:15
Bis zur Fixierung der Regula non bullata und Regula bullata des Franziskus gibt es keinen vergleichbaren Text, der die Armut als spirituelle Richtschnur und als handlungsleitende Norm in so ausgeprägtem Maße betont.
Das evangelische Ideal der radikalen Armut
Franziskus hatte seine Berufung vor dem Kreuz in dem zerfallenden Kirchlein von San Damiano erfahren. Für ihn wurde San Damiano zu einem Abbild des desolaten inneren Zustandes der Kirche seiner Zeit überhaupt, die er im Rückgriff auf das Evangelium, also auf die Kirche der Apostel, reformieren wollte. Im dritten Band seiner Lebensbeschreibung über die Wunder des heiligen Franziskus schreibt sein erster Biograph Thomas von Celano (3 C 1):
Ans Licht kam bald wieder die einst begrabene Vollkommenheit der Urkirche, von deren Großtaten die Welt las, deren Beispiele sie aber vermisste.
Franziskus war kein aggressiver Reformer, sondern er wollte mit seinem Lebensbeispiel im Gehorsam gegenüber der kirchlichen Obrigkeit überzeugen. Durch seine absolute Unterstellung unter alle Amtsträger der Römischen Kirche – vom Papst über Kardinäle und Prälaten bis zum Pfarrer – wollte er zeigen, dass er kein Häretiker war. Durch die Verkündigung des Evangeliums durch Leben und Predigt wollte er die bestehende christliche Kirche erneuern. Sein Weg, die Bekehrung der Kirche auch über die Bekehrung der hohen Kirchenfürsten erreichen zu wollen, blieb hingegen eine Illusion.16 Es sollte bis ins 21. Jahrhundert dauern, bis der Jesuit Jorge Mario Bergoglio als Papst seinen Namen wählte und franziskanische Ideen aufgriff.
Franziskus selbst und seine Bruderschaft wählten ein Leben in radikaler Armut. Spezifisch an dieser Lebensweise war, dass sich nicht nur das einzelne Mitglied der Gemeinschaft zur Besitzlosigkeit verpflichtete, sondern die ganze Bruderschaft. Dies war eine Innovation gegenüber bereits bestehenden monastischen Ordensgemeinschaften. Eine Steigerung erfuhr das radikal arme Leben noch durch ein absolutes Geldverbot. Es war den Brüdern verboten, Geld auch nur zu berühren. An dieser individuellen und kollektiven Besitzlosigkeit, die sich auf das Evangelium stützte, wollte Franziskus festhalten, denn jede, auch kirchenamtliche Interpretation, konnte nur auf eine Abschwächung des Ideals hinauslaufen. Daher untersagte Franziskus in seinem Testament jegliche Kommentierung der Lebensregel (Test 38–39):
Und allen meinen Brüdern, Klerikern und Laien, befehle ich streng im Gehorsam, dass sie keine Erklärungen zur Regel und auch nicht zu diesen Worten hinzufügen, indem sie sagen: So wollen sie verstanden werden. Sondern wie mir der Herr gegeben hat, einfältig und lauter die Regel und diese Worte zu sagen und zu schreiben, so einfältig und ohne Erklärung sollt ihr sie verstehen und mit heiligem Wirken bis ans Ende beobachten.
Das von den Minderbrüdern gewählte arme Leben stand im Widerspruch zu dem der Vertreter der Amtskirche und im Grunde zum Leben der ganzen Römischen Kirche, die auf Besitz, Macht und Gewaltanwendung verzichten sollte.17 Das Geldverbot war in einer zunehmenden Geldwirtschaft nicht aufrecht zu erhalten. Um das Geldverbot zu beachten, mussten die Brüder, falls ihnen für ihre Handarbeit nicht das Nötige gegeben wurde, betteln gehen. Je mehr der Orden sesshaft wurde und Studienhäuser und Klöster in der Stadt unterhielt, umso mehr bildete sich eine Rollenverteilung unter den Brüdern heraus. Die Gruppe der Kleriker, zu denen die Studenten und die in der Seelsorge tätigen Priester gehörten und die Laienbrüder, die die anfallenden Hausarbeiten verrichteten und im Umland betteln gingen.18 Franziskus hielt daran fest, dass ihm dieses Leben in radikaler Armut vom Herrn selbst geoffenbart worden sei (Test 14):19
Und nachdem mir der Herr Brüder gegeben hatte, zeigte mir niemand, was ich tun sollte, sondern der Höchste selbst hat mir offenbart, dass ich nach der Form des heiligen Evangeliums leben sollte.
Der schon zitierte Väterspruch »Nudus nudum Christum sequi« (Nackt dem nackten Christus folgen) begegnet schon in Briefen des Kirchenvaters Hieronymus (347–420). Er wird im 11. und 12. Jahrhundert zum Ausdruck des Lebensideals von Mönchen und Wanderpredigern. Die Zisterzienser unter Bernhard von Clairvaux (um 1090–1153) und die Chorherren der Prämonstratenser unter Norbert von Xanten (um 1080/85–1134) orientierten sich ebenfalls an diesem Ideal des armen Christus, bevorzugten aber ein Leben in Abgeschiedenheit und interpretierten die Armut als Armut des Einzelnen und nicht als die der Gemeinschaft.20 Neben anderen Bewegungen gelang es vor allem den Waldensern, Menschen für die evangelische Armut und die Wanderpredigt zu begeistern. Sie nannten sich nach ihrem Gründer, dem Kaufmann (Petrus) Waldes († vor 1218) aus Lyon. Es kam zu Konflikten über die Predigterlaubnis, was einen Teil der Waldenser zu Ketzern werden ließ; ein anderer Teil konnte 1208 wieder in Einklang mit der katholischen Kirche gebracht werden und erhielt den Namen Pauperes catholici.21 Die Franziskaner waren auf dem Weg der Christusnachfolge in Armut nicht allein, doch sie wählten den besonderen Weg über die römische Kurie. Neu war auch, dass Franziskus bereit war, jeden, der nach der »Form des heiligen Evangeliums« zu leben und »Gehorsam anzunehmen« (NbR 2,9) versprach, ganz unabhängig von Herkunft, Stand und Bildung in die Gemeinschaft aufzunehmen. Doch schon zu seinen Lebzeiten setzte eine Klerikalisierung des Ordens ein. Diese war zum Teil von Franziskus selbst verursacht, der den Priestern aufgrund ihrer Weihe und ihrer Vollmacht, Leib und Blut Christi zu vergegenwärtigen, höchste Achtung entgegenbrachte. Zum anderen drängte auch die Kirche zur Predigt- und Lehrtätigkeit der Brüder, weil diese in der Seelsorge benötigt wurden. Mit der Klerikalisierung der Bruderschaft ging ein Rückgang der Laienpredigt einher, die 1209 von Papst Innozenz III. noch allen Brüdern erlaubt worden war. Die Feld- und Handarbeit wurde immer weniger, weil sich die Brüder hauptsächlich in den Städten ansiedelten und das Almosensammeln quasi als Entgelt für die geistlichen Dienste der Priester gesehen wurde.22
Begegnung mit der Schöpfung
Für Franziskus war die gesamte Schöpfung erfüllt vom göttlichen Leben. Er glaubte an einen gütigen Schöpfer und Erhalter aller Dinge und erkannte eine Schönheit in der Schöpfung. Darin unterschied sich Franziskus von religiösen Bewegungen seiner Zeit, wie beispielsweise von den Katharern, die in Italien, Frankreich und Deutschland zu Einfluss gelangt waren. Das Weltbild der Katharer war von einem Dualismus zwischen Gut und Böse bestimmt. Franziskus sah die ganze Schöpfung vom göttlichen Leben erfüllt, wie es beispielsweise seine Predigt zu den Vögeln (1 C 58) und sein Loblied auf die Schöpfung im »Sonnengesang« (Sonn) zeigen.23 Die Schöpfung ist für Franziskus, genauso wie der Mensch, erlösungsbedürftig. Tiere, Pflanzen und die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Wind sind für ihn empfindende und beseelte Kreaturen und sind deshalb offen für das Wort der Predigt. Das franziskanische Verständnis von ›Bekehrung‹ und ›Erlösung‹ ist universal, d. h. es umfasst die ganze bestehende Welt. Franziskus' Auffassung von der Schöpfung hat nichts mit einem romantischen oder modernen Naturverständnis zu tun. Sein Reden zu den Tieren erkennt diese als Mitgeschöpfe an.24 Das Verhältnis des Franziskus zur Kreatur war bestimmt von mitleidsvoller Zuneigung und religiöser Ehrfurcht (pietas) und dem Mit-leiden (compassio), wie es aus der »Legende von Perugia« (Per) hervorgeht. Er sah in allen Kreaturen beseelte und intelligente Wesen, die er auch zum Lob Gottes aufrufen konnte. Sein erster Biograph Thomas von Celano deutete dies, in Anlehnung an das 8. Kapitel des Römerbriefes, theologisch (1 C 81):25
Schließlich nannte er alle Geschöpfe Bruder und Schwester und erfasste in einer einzigartigen und für andere ungewohnten Weise mit einem scharfen Blick seines Herzens die Geheimnisse der Geschöpfe; war er doch schon zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes gelangt.
Ebenso fühlte sich Franziskus in der freien Natur oft an Christus erinnert. Naturerscheinungen erinnerten ihn an Stellen aus der Bibel. Auch Steinen des Weges begegnete er mit Ehrfurcht mit Blick auf Christus, der im Korintherbrief »Felsen« (1 Kor 10,4) genannt wird. Ehrfurcht (reverentia) ist die Grundhaltung des Franziskus, die sein Verhältnis zu allen belebten und unbelebten Dingen erfüllt. Aus der Ehrfurcht gegenüber allen Kreaturen erfolgte sein Eintreten für die Erhaltung und Schonung der Natur. Daraus resultierte im 20. Jahrhundert das Interesse neuerer ökologischer Bewegungen für Franziskus von Assisi. Franziskus ging es aber nicht um die Sorge um den Planeten Erde, sondern darum, dass das Leben aller Kreaturen im Leben Gottes seinen Ursprung und seinen Bestand hat, also unmittelbar mit dem Ewigen zu tun hat. Dieses Verständnis und Verhältnis zur Natur war in der mittelalterlichen Kirche »so außerordentlich und singulär, daß es kaum Nachahmer fand«, so Helmut Feld. Da sich der Orden immer mehr auf die Städte konzentrierte, geriet dieser Aspekt franziskanischen Lebens für lange Zeit außer Betracht.26 Franziskus war der Heilige, der barfuß ging. Die Minderbrüder wurden daher oft auch »Barfüßer« genannt. Franziskus zog seine Schuhe deshalb aus, weil er wie Mose vor allem was ihm heilig war – und hier insbesondere vor der Natur und der Schöpfung – barfuß ging. Als Mose die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters weidete und zum Gottesberg Horeb kam, erschien ihm ein Engel des Herrn in einer Feuerflamme im Dornbusch. Gott rief ihm mitten aus dem Dornbusch zu: »Mose, Mose!« Er antwortete: »Hier bin ich!« Er sagte: »Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst ist heiliger Boden!« (Ex 3, 1–4). Ohne Schuhwerk ist kein großer Auftritt möglich, aber eine Begegnung mit Gott, eine Begegnung mit der Schöpfung.27
Das »Lied von Bruder Sonne« (Canticum fratris Solis oder Cantico di frate sole) entstand im Winter 1224/25 in altitalienischer Sprache. Das unter dem Namen »Sonnengesang« (Sonn) bekannte mehrstrophige Lied des Franziskus gehört zu den ältesten volkssprachlichen Dichtungen Italiens. Das Gedicht ist grundlegend für das Naturverständnis des Heiligen. Es ist Lob Gottes für die Geschöpfe und zugleich Lob Gottes durch die Geschöpfe. Franziskus nennt die Erscheinungen der Natur Bruder und Schwester (z. B. Bruder Sonne, Bruder Wind, Schwester Wasser, Schwester oder Mutter Erde, Schwester Tod).28 Franziskus entdeckte ein neues Verhältnis der Religion zur Natur. Er sah in der verachteten und misshandelten Natur eine Vermittlerin zwischen Gott und Mensch. Die franziskanische Welt geht von einem einzigen guten Schöpfer aus und alle Geschöpfe, die belebten und scheinbar unbelebten Dinge sind – wie die guten und noch bösen Menschen – zur Rückführung in den Frieden mit Gott bestimmt. Franziskus konnte die göttliche Schönheit der Natur empfinden. Dies zeigen auch heute noch erhaltene franziskanische Orte, wie etwa abgelegene Einsiedeleien – so die Carceri bei Assisi – an die er sich immer wieder zurückzog, um gegen den Dämon, den Teufel, zu kämpfen und Orte wie der Berg La Verna, wo Franziskus die Stigmata empfing. Bis heute sind dies heilige Orte.29
Franziskus, ein anderer Christus
Im Spätsommer 1224 zog sich Franziskus auf den Berg La Verna (1.283 m) nördlich der umbrischen Stadt Arezzo zurück, um dort zu beten und zu meditieren. Ihm erschien, wie die beiden ältesten Lebensbeschreibungen (1 C 94–95; Gef 69) berichten, am 14. September, dem Fest Kreuzerhöhung, ein gekreuzigter Seraph, »dessen Schönheit unbeschreiblich war«, also eine überirdische gekreuzigte Engelsgestalt mit sechs Flügeln. Nicht der leidende Christus, sondern eine Engelsgestalt wies auf die Erlösung der Welt von Sünde und Schuld hin (vgl. Jes 6,2). Nach diesem Ereignis trug Franziskus die fünf Wundmale des gekreuzigten Christus auf seinem Körper. Der älteste Bericht darüber stammt von Bruder Leo, dem Beichtvater, Sekretär und Begleiter des Franziskus. Ihm hatte Franziskus nach dieser Heilszusage eigenhändig ein Schriftstück auf Pergament angefertigt. Es zeigt eine Zeichnung eines unter einem Erdhügel begrabenen bärtigen Schädels mit Kapuze, der symbolisch für Franziskus auf Golgotha steht.30 Andere Autoren deuten ihn als den Kopf Adams in einem Grab, über dem das Kreuz von Golgotha aufgerichtet wurde, oder als den Kopf des Bruders Leo31. Aus dem Mund des Kopfes wächst als Buchstabe ein Tau heraus, welches durch den Text des alttestamentlichen Priestersegens (Num 6,24–26) geht, den Franziskus für Bruder Leo aufgeschrieben hat (SegLeo):
Der Herr segne dich und behüte dich. Er zeige dir sein Angesicht und erbarme sich deiner. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir Frieden. Der Herr segne, Bruder Leo, dich.
Von der Öffentlichkeit wahrgenommen und im Rahmen des Heiligsprechungsprozesses auch kirchlich anerkannt wurden die Stigmata erst mit dem Tod des Franziskus, als diese an seinem Leichnam entdeckt wurden.32Das Tau ist das Zeichen der Auserwählten, die Gott in der Endzeitkatastrophe vor dem Untergang retten will (vgl. Ez 9,4–6; Offb 7,2–8, 23,4). Franziskus hat mit diesem Zeichen Briefe signiert und es an Wände der von ihm bewohnten Klosterzellen gemalt, so auch in der Einsiedelei Fonte Colombo, wo es heute noch, in hellroter Farbe auf den Verputz gezeichnet, erhalten ist. Durch die Vision auf dem Berg La Verna und durch die Stigmatisierung war Franziskus zu einem ›zweiten‹ Christus geworden. Helmut Feld schreibt:33
Die Identifizierung des Franziskus mit dem Erlöser ist keine spätere Erfindung häretischer Kreise des Franziskanerordens, sondern sie geht auf den Heiligen selbst zurück.
Die Bezeichnung des Franziskus als »alter Christus« kommt erstmals in den »Actus Beati Francisci« in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts vor. Er sei – ein ungeheurer Anspruch – ein zweiter Christus gewesen, der der Welt gegeben wurde und den Gott Vater seinem Sohn gleichförmig gemacht habe.34 Franziskus wird auf dem Berg Alverna, wie Helmut Feld mit Blick auf das katharische Weltbild überzeugend darlegen kann, nicht zu einem zweiten, sondern zu einem »anderen Christus«.35 Infolge der Geschehnisse auf dem Berg La Verna erhielt Franziskus den Beinamen »Seraphicus« und die in ihrer Entstehung auf ihn zurückgehenden Gemeinschaften werden daher auch »seraphische Orden« genannt.
Die Stigmata hatte sich Franziskus – wie viele seiner Nachahmer und Nachahmerinnen – wohl im Rahmen eines liturgischen Spiels selbst beigebracht oder von seinen Mitbrüdern beibringen lassen. »Er inszenierte ein Passionsspiel und er benutze seinen Körper als ›Passionsdrama‹«; Selbstverletzungen in der Nachfolge des leidenden Christus waren im Zeitalter der Kreuzzüge nicht ungewöhnlich, so Christoph Daxelmüller.36 Der Forscher Paul Bösch sieht die Stigmatisierung als eine historisch nicht haltbare Legende in den Diensten der Apotheose des Franziskus.37 Die Erlebnisse auf dem Berg Alverna werfen schwierige Fragen auf, doch »der Heiligkeit des Franziskus geschieht damit kein Abbruch«.38 Der Franziskusforscher Leonhard Lehmann schreibt:39
Die historisch unleugbare Nachbildung der Wunden Jesu an seinem Leib beweist, Franziskus war bis ins Tiefste von der Liebe [zu Christus, die Verf.] verwundet, selbst zur Wunde geworden.
In der bildenden Kunst haben sich nicht die von den Zeitzeugen beschriebenen, in den Wundmalen steckenden Nägel durchgesetzt, sondern die Hand mit dem Wundenstigma. Diese wurde zum Zeichen des Franziskanerordens.40 Das franziskanische Wappen zeigt den nackten Arm Christi, der mit dem bekleideten Arm des heiligen Franziskus gekreuzt ist. Beide Hände tragen die Wundmale der Nägel vor dem Hintergrund des Kreuzes. Bei anderen Darstellungen umschließen zusätzlich Wolken die beiden Arme. Dem Wappen liegt ein Gedanke aus dem Galaterbrief (Gal 2,19) zugrunde: »Christo confixus sum cruci« (Ich bin mit Christus gekreuzigt). Die ältesten Darstellungen des franziskanischen Wappens reichen bis ins 14. Jahrhundert zurück.41
Regel und Aufbau des Ordens
Sicher wollte Franziskus ursprünglich keinen Orden stiften, doch nachdem sich seiner Lebensweise als Büßer weitere Personen angeschlossen hatten, war es unabdingbar, der Gruppe eine Struktur zu geben, die dann über mehrere Schritte zu einer kirchlich normierten Lebensform fand. Die erste Lebensform, das Propositum vitae des Franziskanerordens von 1209, ist textlich nicht überliefert, doch es fand Eingang in die Regula non bullata (NbR) des Ordens von 1221. Diese Regel hatte sich aus dem praktischen Leben, Beschlüssen der verschiedenen Ordenskapitel sowie den Ermahnungen des heiligen Franziskus entwickelt. Die Endfassung zählte 24 Abschnitte und diese bestehen aus mannigfaltigen Zitaten der heiligen Schrift, Aufrufen und hymnischen Texten. Der Text dieser geistlichen Regel war lang und wenig griffig, weder für die Brüder noch für die päpstliche Kurie. Franziskus zog sich deshalb mit Bruder Leo in die Einsiedelei Fonte Colombo ins Rietital zurück, um eine kürzere Regel zu schreiben. Ratschläge von rechtskundigen Brüdern und von Kardinal Hugolino selbst wurden darin aufgenommen. Diese Regel wurde am 29. November 1223 von Papst Honorius III. in Form einer päpstlichen Urkunde mit Bulle bestätigt und heißt deswegen Regula bullata (BR).42 Diese Urkunde wird, einer Reliquie gleich, bis heute im Sacro Convento in Assisi aufbewahrt. Eine Abschrift befindet sich im entsprechenden Registerband des Vatikanischen Apostolischen Archivs. Sie umfasst nur noch 12 Kapitel, enthält kaum Schriftzitate und ist juridischer formuliert. Weiterhin spricht Franziskus an mehreren Stellen in der Ich-Form und in der Textmitte ist ein Lied, welches an zentraler Stelle die Armut preist und so beginnt (BR 6, vgl. Jak 2,5):43
Dies ist jene Erhabenheit der höchsten Armut, die euch, meine geliebtesten Brüder, zu Erben und Königen des Himmelreiches eingesetzt, an Dingen arm, aber an Tugenden reich gemacht hat. Diese soll euer Anteil sein, der hinführt ins Land der Lebenden [...]
In dieser endgültigen Regel wurde für alle Franziskus nachfolgenden Ordensbrüder das Programm bzw. die Lebensweise der Minderen Brüder festgelegt. Im ersten Kapitel steht (BR 1):
Regel und Leben der Minderen Brüder ist dieses, nämlich unseres Herrn Jesus Christus heiliges Evangelium zu beobachten durch ein Leben in Gehorsam, ohne Eigentum und in Keuschheit. Bruder Franziskus verspricht Gehorsam und Ehrerbietung dem Herrn Papst Honorius und seinen rechtmäßig gewählten Nachfolgern sowie der Römischen Kirche. Und die anderen Brüder sollen verpflichtet sein, dem Bruder Franziskus und dessen Nachfolgern zu gehorchen.
Besonders in den Kapiteln vier bis sechs wird das Eigentümliche des Mendikantenordens begründet. Franziskus von Assisi bestand auf einem strengen Geldverbot für seine Gemeinschaft (BR 4,1):
Ich gebiete allen Brüdern streng, auf keine Weise Münzen oder Geld anzunehmen, weder selbst noch durch eine Mittelsperson.
Ebenso durften sie als Lohn für die Handarbeit bei den Leuten kein Geld für den täglichen Lebensunterhalt annehmen (BR 5). Dies ist eine franziskanische Besonderheit.44 Weder der einzelne Bruder noch die Gemeinschaft sollte Eigentum erwerben (BR 6,1):
Die Brüder sollen sich nichts aneignen, weder Haus noch Ort noch irgendeine Sache.
Die Regula bullata ist bis zur Gegenwart Richtschnur für die franziskanischen Orden, mit Ausnahme der Klarissen, die der Regel der heiligen Klara (KLReg) folgen. Sie unterscheidet sich in vielen Punkten von der älteren Regula Benedicti (Benediktusregel). Sie lässt vieles offen, gibt keinen Tagesplan vor und auch keinen Klosterplan. Da die Regula bullata eine Regel ist, die vieles nicht regelt, waren schon bald Auslegungen notwendig, die in (General)Konstitutionen (Satzungen) festgehalten wurden, wie etwa die des Bonaventura von 1260. Alle Reformzweige des Franziskanerordens verfassten eigene Konstitutionen, die in ihren Ausprägungen jeweils erkennen lassen, in welche Richtung die Reform geht, ob hin zur oder weg von der Regel. Konstitutionen hatten unterschiedlich lange Bestand. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil waren alle Orden, nicht nur die franziskanischen, aufgefordert, ihre Konstitutionen zu überarbeiten und an die Zeit anzupassen.45
Heute muten die franziskanischen Ordensstrukturen demokratisch an, aber das waren sie in den Anfängen nicht. Die Regel machte auch keine klaren Aussagen bezüglich der Leitung der schon kurz nach dem Tode des Gründers weit über Italien hinaus verbreiteten Brüdergemeinschaft. Anfangs waren die Brüder dem »Minister und Diener der ganzen Bruderschaft« (BR 8,1) unterstellt, dessen Wahl jeweils auf dem Pfingstkapitel erfolgte und der den Gesamtverband leiten sollte. Die Leitungsstruktur innerhalb der Ordensprovinzen und der einzelnen Niederlassungen ließ die Regel offen. Hausobere (Guardiane) wurden nur im Testament des heiligen Franziskus erwähnt (Test 27,30). Die rechtlichen Bestimmungen über die Wahl und die Wahlberechtigten für die Ämter des Generalministers (Leiter der Gemeinschaft auf Weltebene), der Provinzialminister (Leiter der Gemeinschaft auf Provinzebene) und Guardiane variierten im Laufe der Jahrhunderte und innerhalb der einzelnen Richtungen des Ordens. Neben der Regel entstanden daher schon früh Generalkonstitutionen als Interpretation der Regel.46 Die ersten Generalkonstitutionen von 1239 sind in ihrem Wortlaut nicht mehr erhalten. Die Minister und Kustoden (Obere) der einzelnen Provinzen sollten den Generalminister, der auf Lebenszeit gewählt war, absetzen können, wenn sie ihn für nicht geeignet hielten. Allerdings war die Möglichkeit der Provinzialminister zu diesem Eingriff beschränkt, weil nur der Generalminister das Generalkapitel einberufen konnte. Doch die Erfahrungen mit dem Leitungsstil des Bruders Elias (um 1180–1253) ließen den Orden auf dem Kapitel in Rieti von 1239 diese absolutistische Richtung verlassen. Elias von Cortona, der von 1232–1239 das Amt des Generalministers innehatte, setzte sich in seiner Amtszeit, gegen jene Brüder, die eine strengere Lebensweise der Armut anstrebten, für einen mehr monastischen Lebensstil ein. Vor allem mit der Richtung der Spiritualen innerhalb der Brüdergemeinschaft kam es zu Auseinandersetzungen. Elias, der den Bau der prächtigen Grabesbasilika und des Sacro Convento in Assisi forcierte und vorantrieb, sorgte bei seinen Gegnern für Unmut, da sie nicht mit dem Armutsideal und Charisma des Ordensgründers in Übereinklang zu bringen waren. Auch seine zentralistische und absolutistische Leitungsform sowie seine Bemühungen, die Rechte der Provinziale zu beschneiden wurde nicht positiv gesehen, so dass er schließlich seines Amtes enthoben wurde.47 Die Vollmacht des Generalministers wurde durch das Generalkapitel und die Konstitutionen eingeschränkt. Er musste das Generalkapitel nach einer festgesetzten Frist einberufen und konnte die Provinzoberen nicht mehr eigenmächtig ein- und absetzen. Alle Provinzen mussten vom Generalminister oder einem Visitator regelmäßig besucht werden. 1506 wurde die Amtszeit durch ein päpstliches Breve auf drei Jahre mit einer möglichen Wiederwahl beschränkt und 1517 legte Papst Leo X. (1513–1521) eine sechsjährige Amtszeit mit einer Wiederwahl fest. Diese Bestimmung gilt bis zur Gegenwart.48 In der weiteren Entwicklung des Ordens traten Probleme mit dem Leben nach der Ordensregel hervor, die einer Lösung bedurften. Immer wieder waren Modifikationen – auch mit päpstlicher Dispens – notwendig, die dann in den jeweiligen Generalkonstitutionen ihren Ausdruck fanden. Von 1260 bis 1921 wurden im Franziskanerorden innerhalb der Observanz 35 Fassungen der Generalkonstitutionen approbiert und promulgiert.49 Infolge des Zweiten Vatikanischen Konzils und den (neuen) Bestimmungen des Kirchenrechts hat der Minderbrüderorden neben der Regula bullata zwei Rechtssammlungen: Die Generalkonstitutionen, approbiert 1986 in Kraft getreten 1987, und die Generalstatuten, zuletzt geändert 2009 und 2010 in Kraft getreten, die als Ergänzung der Generalkonstitutionen alle weiteren Normen erfassen. Der Aufbau beider Dokumente orientiert sich an der Regula bullata.50
Die aktuellen Generalkonstitutionen sind wie folgt aufgebaut: Im ersten Kapitel (Art. 1–18) werden die Grundlagen des Ordens, die Profess und die Gesetze des Ordens behandelt und im zweiten (Art. 19–37) das Leben des Gebetes und der Buße. Das dritte Kapitel (Art. 38–63) ordnet das brüderliche Leben in der Gemeinschaft und das Verhältnis zur gesamten franziskanischen Familie. Die rechtlichen Bestimmungen zu den Themen Armut, Demut, Ordenseigentum und Arbeit sind im vierten Kapitel (Art. 64–82) zusammengefasst. Der Auftrag zur Evangelisierung, wie auch die missionarische Evangelisierung und Bestimmungen für das Heilige Land stehen im fünften Kapitel (Art. 83–125). Im sechsten Kapitel (Art. 126–167) geht es um die Grundsätze der Ausbildung (Grundausbildung, wissenschaftliche, berufliche und technische Ausbildung und jene zu den kirchlichen Diensten), die ständige Fortbildung, auch der Ausbilder selbst, die der Berufungspastoral und die Förderung der Studien im Orden. Das siebte Kapitel (Art. 168–250) widmet sich der Leitung des Gesamtordens, der Provinzen und jener der einzelnen Häuser mit den entsprechenden Gremien, sowie der Verwaltung von Gütern. Das achte und letzte Kapitel (Art. 251–261) beschließt die Generalkonstitutionen u. a. mit den rechtlichen Bestimmungen bei einem Austritt und der Entlassung aus der Ordensgemeinschaft.51
Die Generalstatuten, die durch das Generalkapitel verabschiedet und approbiert werden, enthalten Konkretisierungen und Ergänzungen zu den Generalkonstitutionen und passen diese an die Zeitumstände an. Wie die Generalkonstitutionen sind die Generalstatuten mit insgesamt acht Kapiteln in Titel, Artikel und Paragrafen unterteilt. Die Anzahl der Artikel ist mit insgesamt 271 etwas höher als die in den Konstitutionen und der inhaltliche Aufbau gestaltet sich ein wenig anders. Auf die Zitation franziskanischer Quellen, wie z. B. Regel und Testament wird verzichtet. Das erste Kapitel (Art. 1–6) widmet sich sofort der Sorgepflicht der Minister und Guardiane und betont, dass sie dafür zu sorgen haben, »dass jeder Bruder neben den Generalkonstitutionen und Generalstatuten ein Exemplar der Regel und des Testamentes« hat. Grundsätzlich werden die Pflichten der (höheren) Oberen im gesamten Regelwerk stärker hervorgehoben. Das geistliche Leben der Brüder wird im zweiten Kapitel (Art. 7–19) thematisiert und im dritten (Art. 20–30) das Zusammenleben innerhalb der Provinz und Hausgemeinschaften sowie mit emeritierten Bischöfen, die in eine Provinz zurückkehren, außerdem die Beziehungen zum Dritten Orden (OFS) und der Franziskanischen Jugend (JUFRA). Die konkreten Arbeiten, Reisen, Aufgaben und Tätigkeiten des Generalamtes für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung werden im vierten Kapitel (Art. 31–41) normiert. Die darauffolgenden Kapitel sind wieder parallel zu den Generalkonstitutionen angelegt. So deckt das fünfte Kapitel (Art. 46–77) die Aspekte der Evangelisierung und die der Kustodie und Kommissariate des Heiligen Landes ab. Die Bestimmungen der Ausbildung der Ordensangehörigen sind im sechsten Kapitel (Art. 78–118) zusammengefasst. Die Ordensleitung, die Leitung der Provinzen und der einzelnen Häuser sowie die Güterverwaltung sind Regelungsgegenstände des sehr umfangreichen siebten Kapitels (Art. 119–255). Die rechtlichen Vorschriften zu Austritt und Entlassung aus dem Orden sind im letzten Kapitel (Art. 256–271) zu finden. Dabei wird im Gegensatz zu den Generalkonstitutionen auch der Übertritt in eine andere Ordensgemeinschaft eigens angesprochen.52 Konstitutionen und Statuten sind für alle Franziskaner verbindlich. Hinzu kommen noch die Partikularstatuten (Provinzstatuten) für die jeweiligen Ordensprovinzen, die eigene Rechte und Gewohnheiten regeln.
Die Generalminister aller drei Zweige des Ersten Ordens (Franziskaner, Konventualen/Minoriten, Kapuziner) haben den Sitz ihrer Ordensleitung, die sogenannte Generalkurie in Rom. Das Generalkapitel setzt sich zusammen aus allen Provinzialministern, die den Generalminister und seine Definitoren (Berater) wählen. Die Leitung einer jeden Provinz obliegt einem Provinzialminister, der auf dem Provinzkapitel von allen Brüdern der Provinz, oder wenn diese zu groß ist, von Delegierten, gewählt wird. Ihm steht ebenfalls ein Definitorium als Beratungs- und Entscheidungsgremium zur Seite. Seine Amtszeit beträgt drei Jahre, höchstens aber neun Jahre. Den einzelnen Häusern steht ein Guardian vor, der von der Provinzleitung ernannt wird. Seine Amtszeit ist ebenfalls auf drei bzw. höchstens neun Jahre beschränkt.53 Danach muss, wie bei allen franziskanischen Ämtern, vor einer erneuten Amtsübernahme mindestens eine Pause von drei Jahren erfolgen. Mit den drei Ebenen Konvent, Provinz und Welt hat der Franziskanerorden eine flache Hierarchie.
Die Provinz ist ein Territorium und ein Haus- und Personalverband. Das Provinzgebiet ist nicht an politische oder kirchliche Grenzen gebunden. Der Bruder tritt immer in eine Provinz ein und nicht, wie bei älteren Orden, in ein Kloster bzw. eine Abtei. Innerhalb der Provinz kann ein Bruder immer wieder, maximal im Drei-Jahres-Rhythmus, versetzt werden. Dies steht als Zeichen dafür, sich nichts anzueignen, auch nicht ein festes Haus, in das man immer wieder zurückkehren kann.54 Das Provinzialat kann seinen Sitz einfach verändern, es hat nicht den Charakter eines Mutterhauses. Auch der Ort des Noviziates kann wechseln. Diese Struktur trägt zur Mobilität und Dynamik des Ordens bei, doch kann man nicht verkennen, dass hier auch Kontinuität fehlt.
Jede Provinz hielt über ihre Provinzleitung den Kontakt zur Ordensleitung nach Rom. Ebenso hielt man Kontakt zu anderen Provinzen und Häusern, zu anderen Klöstern, zu den Landesherren (Bischöfen) und städtischen Obrigkeiten. Die Franziskaner führten, da sie kein Klausurorden waren, ein nach außen gerichtetes Leben. Alle sechs Jahre fanden Generalkapitel des Ordens statt. Daran nahmen in der Regel die Generalkommissare, die Provinziäle, Kustoden, Prokuratoren und Vertreter der Generalkurie teil. Auf dem Generalkapitel wurden die (bis zur Union von 1897 vorhandenen) Generalkommissare für die verschiedenen Ordensrichtungen gewählt. Die Generalkommissare richteten sich nach ihrem Amtsantritt immer mit Rundschreiben zu aktuellen Fragen an alle Konvente in ihrem Zuständigkeitsbereich. Die Einhaltung von Regel und Statuten wurde in den Provinzen durch die regelmäßigen Visitationen durch die nächst höhere Ebene überwacht. Wenn der Generalkommissar bzw. der Generalminister die Visitation nicht selbst durchführte, benannte er dafür einen Vertreter. Ebenso visitierte der Provinzialminister regelmäßig alle Häuser seiner Provinz. Weitere Kontakte zwischen den Brüdern ergaben sich auf den Kapiteln (Zwischen- und Provinzkapitel). Der Kontakt einer Provinz zur Gesamtordensleitung war immer dann intensiv, wenn Brüder aus den eigenen Reihen als Generalkommissar/Generalminister, Generaldefinitor eingesetzt oder mit einem anderen Kurienamt betraut waren. So gab es, immer zeitlich befristet, Möglichkeiten, eigene Interessen an der Generalkurie durchzusetzen. In der Regel hielten die Provinzialminister über die regelmäßigen Visitationen und durch Zirkularschreiben den Kontakt zu den einzelnen Konventen. Fast immer wurde in den Schreiben die Ordensdisziplin angemahnt. Auf den Zwischen- und Provinzkapiteln mussten die Guardiane über ihre Amtsführung Rechenschaft ablegen.55
Eintritt in den Orden
Schon früh machte man sich im Orden Gedanken über die Ausbildung des Ordensnachwuchses. Der Franziskaner Bernhard von Bessa († 1300/1304), Sekretär des Generalministers Bonaventura, verfasste mit dem »Speculum disciplinae ad Novitios« ein umfangreiches Werk für die Ausbildung der Ordensneulinge. Die Regeln für Novizen wurden mit Zitaten aus den Kirchenvätern und der Bibel erklärt. Bis in die Frühe Neuzeit wurde dieser »Zuchtspiegel« in vielfach aufgelegten lateinischen und deutschen Ausgaben benutzt. Seine praktischen Erfahrungen als Novizenmeister fasste Mitte des 13. Jahrhunderts der franziskanische Prediger, geistliche Begleiter und Schriftsteller David von Augsburg (um 1200/1210–1272) in verschiedenen Werken – darunter seinem Hauptwerk »De exterioris et interioris hominis compositione« (Über die Beschaffenheit des äußeren und inneren Menschen) – zusammen. Dabei orientierte sich David von Augsburg an der Regula bullata und an verschiedenen Kirchenvätern. Die Aufnahme und Ausbildung der Novizen wurde im Franziskanerorden durch die jeweiligen General- und Provinzstatuten geregelt. Die Generalstatuten bestimmten, dass das Provinzkapitel einen Ort für das Noviziat festlegte und einen Novizenmeister bestimmte, der für die ordensinterne Ausbildung verantwortlich war. Für die Aufnahme als Kleriker war unter anderem eine ausreichende Schulbildung für das spätere ordenseigene Studium Voraussetzung. Von den Laienbrüdern wurden für die Aufnahme in das Noviziat handwerkliche Kenntnisse gefordert, die möglichst in der Provinz verwendbar waren. Die Novizen wurden innerhalb eines Jahres in das Ordensleben eingeführt und erhielten meist Unterricht im Gebet bzw. in Spiritualität, in der Liturgie anhand des Zeremoniales, in der Ordensregel und in den päpstlichen Regelerklärungen. Zum Noviziat gehörten Zeiten der Stille und ein strenger Rhythmus zwischen Arbeit, Unterweisung, persönlichem Gebet und der Teilnahme am Chorgebet. Das Noviziat war getrennt vom Konvent untergebracht, doch bei den Gebetszeiten und bei den Mahlzeiten waren die Novizen mit dem Konvent zusammen.56 Zu Beginn des Noviziats erfolgte die Einkleidung, bei der dem Kandidaten der ordenseigene Habit überreicht wurde, den er von nun an zu tragen hatte. Zumeist wurde den Novizen ein Ordensname zugeteilt, der den Taufnamen ablöste. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist die Annahme eines Ordensnamens freigestellt. Während des Probejahres stand es dem Novizen jederzeit frei, den Ordensverbund zu verlassen. Das Noviziat wurde mit dem Ablegen der zeitlichen Profess (Gelübde der Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam) vor dem Ordensoberen abgeschlossen; mit dem Ablegen der ewigen Profess – frühestens nach drei Jahren – band sich ein Franziskaner lebenslang endgültig an den Orden und umgekehrt.57
In der Säkularisation zielten die staatlichen Behörden auf das Aussterben der Klöster. Die Aufnahme von Novizen wurde untersagt, da junge Männer Militärdienst leisten und später Familien gründen sollten. Oft wurde die Aufnahme von Novizen von einer Regierungsgenehmigung abhängig gemacht, die bestimmte, dass junge Männer nicht mehr militärpflichtig sein durften und beim Ablegen der Profess über 25 Jahre alt waren. Das Aufnahmeverbot wurde in einzelnen Ländern unterschiedlich gehandhabt. Erst nach der Aufhebung von Regierungsseite durften wieder Novizen aufgenommen werden.58
Ob vor der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für einen Ordenseintritt bei den Franziskanern das franziskanische Ideal ein Hauptmotiv war, lässt sich nicht ermitteln. Wahrscheinlich war eher das Ordensleben an sich das Hauptmotiv und dann die Eintrittsvoraussetzungen. Es kam auch immer darauf an, welche Ordensgemeinschaften in einem Gebiet überhaupt verbreitet waren. Im Noviziat wurden dann spezifisch franziskanisch-theologische Grundwerte systematisch vermittelt, wobei auch franziskanische Grundlagentexte – insbesondere die Schriften des Heiligen Franziskus – herangezogen wurden.59 Die Noviziatsausbildung hat immer wieder Reformen erfahren. Sinkenden Zahlen von Novizen und die Probleme geeignete Noviziatsleiter zu finden, führten ab Mitte der 1990er Jahre zum Start von interprovinziellen Noviziatsausbildungen im deutschen Sprachraum.60 Die deutsche Franziskanerprovinz hat sich seit 2019 mit Provinzen aus mehreren Ländern zusammengetan und schickt ihre Novizen in das internationale Noviziat nach Irland. Sie beruft sich darauf, dass diese Internationalität schon in der Gründungsphase des Ordens praktiziert wurde.61
Die Unterrichts- und Lebenssprache ist Englisch. Unterrichtsgegenstände sind unter anderem: biblische Themen, Eucharistie, franziskanische Quellen, Geschichte des Ordens, Generalkonstitutionen, Centering Prayer und Spiritualität der Wüstenväter nach Johannes Cassian.
Leben und Ämter im Orden
In vielen kirchlichen Institutionen entschied die soziale Herkunft über die Aufnahme und die Karriere. Viele Ämter, wie beispielsweise Domherrenpfründen, waren Adeligen vorbehalten. Dies galt auch für Ordensgemeinschaften, die nicht allen Kandidaten offenstanden. Hier war der Franziskanerorden voraussetzungslos und ein Ordenseinstritt bot auch weniger Begüterten die Möglichkeit für eine geistliche Karriere, wenn die Eltern ein Studium nicht finanzieren konnten. Gerade im ländlichen Raum blieb jungen Männern oft kaum eine andere Möglichkeit, als den elterlichen Hof zu übernehmen oder in einem Handwerksberuf Fuß zu fassen. Unabhängig von der sozialen Herkunft war es im Franziskanerorden möglich, im Rahmen von zeitlich befristeten Ämtern intellektuelle, organisatorische sowie auch handwerkliche Kenntnisse auszubilden und anzuwenden. Im Idealfall bot das Leben im Franziskanerorden eine große Bandbreite an persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten, die einem jungen Mann in einem weltlichen, weitgehend vorgezeichneten Leben nicht zur Verfügung gestanden hätten. Eine Laufbahnplanung im Orden – ähnlich einer weltlichen Karriereleiter – war allerdings nur schwer oder gar nicht möglich. Ein übertragenes Amt galt es in Demut anzunehmen und auszufüllen. Macht, Ansehen und Reichtum waren damit nicht verbunden. Alle Ordensämter wurden in der Regel durch Wahl für einen Zeitraum von drei Jahren vergeben. Der regelmäßige Wechsel sollte sicherstellen, dass sich Personen nicht zu fest an ein Amt banden und keinen dauerhaften Anspruch auf ein Amt erheben konnten. Mit dem Ämterwechsel war in der Regel eine räumliche Versetzung verbunden. Die regelmäßigen Versetzungen innerhalb einer Provinz sollten dem evangelisch-franziskanischen Ideal des Pilgerlebens entsprechen und einem Machtdenken vorbeugen, was jedoch Machtkonflikte im Orden nicht verhinderte. Der Franziskanerorden bot nicht den Weg eines klassischen Aufstiegs an, aber es war möglich, temporär in der Ordenshierarchie aufzusteigen. Um durch Wahl in höhere Ämter zu gelangen, war es nicht notwendig, Ämterstufen zu durchlaufen. Zur Führungsebene der Provinz zählten die Ämter Provinzialminister, Kustos, Definitor und Lektor. Diese Ämter waren zahlenmäßig beschränkt. Auf der mittleren Führungsebene rangierten Guardiane (Hausobere) und Lehrer. Hausobere waren, je nachdem wieviel Konvente vorhanden waren, notwendig und Lehrer wurden bis zur Säkularisation an den zahlreichen Schulen gebraucht. Indes trat die Mehrzahl der Brüder in einer Provinz nicht in Leitungsämtern in Erscheinung. Außerhalb der hierarchischen Ebenen im Orden gab es Patres mit besonderen Tätigkeiten, wie Beichtväter, Domprediger oder Militärseelsorger, die, meist gut dotiert, besetzt wurden, wenn sie dem Orden angetragen wurden. Wenn man in die Provinzleitung gewählt wurde, hatte man sich zuvor in anderen Ämtern meist entsprechend bewährt. Über die Provinzebene hinaus war es möglich, ein Amt auf Weltebene zu übernehmen, wenn man ins Generaldefinitorium gewählt wurde oder gar zum Generalminister des Ordens. Wenn ein Minderbruder auf einer Stelle sehr beliebt war, für andere Aufgaben nicht geeignet war oder als Beichtvater ausdrücklich gewünscht wurde, konnte die Provinzleitung in Ausnahmefällen von der turnusmäßigen Versetzung absehen. Im Orden gab es keine festgelegten Laufbahnen, doch bei Priestern und Brüdern lassen sich Verwendungsprofile feststellen, die verschiedenen Begabungen Rechnung trugen. Die Ordensideale Demut und Gehorsam sollten in einem Amt vorbildlich erfüllt werden. Die Generalstatuten, wie zum Beispiel die Statuta Generalia Barchinonensia (Cap. VII § 2) von 1633 sahen für die Übernahme eines Amtes ein vorbildliches Leben und ein Mindestalter von 30 Jahren vor.
Innerhalb des Ordens gibt es keine Altersgrenze bzw. kein Pensionsalter. Alle Brüder werden möglichst ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt. Durch das im Orden verfolgte Rotationsprinzip werden auch Pfarr- und Kaplanstellen immer nur temporär besetzt. Die Bevölkerung muss sich jeweils auf neue Seelsorger einstellen.62 Die Vielzahl von Ordens- und Provinzämtern lassen sich über die jeweiligen Personalschematismen der Ordensprovinzen (Catalogus domuum et fratrum) nachverfolgen. Über die Versetzungen und die neue Aufgabenverteilung gibt nach jedem Kapitel die sogenannte Kapitelstafel Auskunft.63
Durch die in der Ordensregel angelegte Diskontinuität von Ämtern und Führungspositionen büßte der Franziskanerorden einen Teil seiner Wirkungsmöglichkeiten ein. Der Orden konnte sich nicht – wie andere Ordensgemeinschaften – etwa im Bereich der gelehrten Predigt, der Wissenschaft oder der Liturgie wirklich über einen längeren Zeitraum qualifizieren. Für die Franziskaner bleibt nur der breite Begriff eines Seelsorgeordens übrig. Vielleicht trug diese Offenheit auch zur Beliebtheit des Franziskanerordens in der Bevölkerung bei.64
Endnoten
7Feld, Helmut: Die Franziskaner, Stuttgart 2008, S. 42.
8Ebd., S. 42 f.
9Ebd., S. 14.
10Ebd., S. 15 f.
11Maleczek, Werner: »Nackt dem nackten Christus folgen«. Die freiwillig Armen in der religiösen Bewegung der mittelalterlichen Gesellschaft, in: Heimann, Heinz-Dieter u. a. (Hgg.): Gelobte Armut. Armutskonzepte der franziskanischen Ordensfamilie vom Mittelalter bis in die Gegenwart, Paderborn [u. a.] 2012, S. 17–34, S. 18.
12Feld: Franziskaner, S. 17.
13Lehmann, Leonhard: Die Gründungsidee des Franziskanerordens, in: Schneider, Johannes (Hg.): Regel und Leben. Materialien zur Franziskus-Regel II, Norderstedt 2009 (Werkstatt Franziskanische Forschung, Bd. 3), S. 9–40, S. 9 f.
14Feld: Franziskaner, S. 20.
15





























