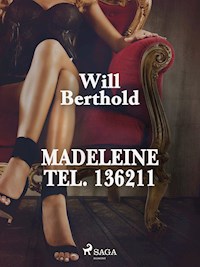Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es ist ein dramatischer Roman voll Spannung und überraschender Wendungen.Charly ist für viele Frauen ein aufregender Typ, ein Raubritter mit Herz. Kein Wunder, dass sich auf der ausgelassenen Party im Schwabing des Jahres 1948 einige Frauen von Rang eingefunden haben, die alle hinter Charly her sind. Groß ist daher die Bestürzung, als sie im Laufe der Party erfahren, dass ihr Gastgeber gar nicht mehr am Leben sein soll. Trotzdem sollen sie weiterfeiern. Das lässt die Hoffnung aufkeimen, dass sein Tod nur ein Gerücht ist und Charly einen letzten Coup landen möchte. So wie er sich auch schon in der Nachkriegszeit als charmanter Tausendsassa und Abenteurer hat durschlagen müssen. Holt ihn seine Vergangenheit gerade in diesem Moment ein?-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Die Frauen nannten ihn Charly
Roman
Originalausgabe
SAGA Egmont
Die Frauen nannten ihn Charly
Genehmigte eBook Ausgabe für Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
Copyright © 2017 by Will Berthold Nachlass,
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de).
Originally published 1986 by Goldman Verlag, Germany.
All rights reserved
ISBN: 9788711727102
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
I
Charly hatte an diesem naßkalten Dezembertag zu einer Party ohne Anlaß in die »Arche Noah« gebeten, und schon kurz vor 21 Uhr sah es aus, als würden die geladenen Gäste – wie schriftlich zugesagt – ausnahmslos erscheinen und dazu noch ein paar Ungebetene. Man gewährte ihnen Einlaß, schließlich war Charly für seine Großzügigkeit bekannt, die immer dann besonders verschwenderisch wurde, wenn ihm das Geld auszugehen drohte. Als man den Ankömmlingen »Veuve Cliquöt« in die Hand drückte und sich herumsprach, daß Champagner – so keine anderen Wünsche geäußert würden – das abendfüllende Getränk bleibe, schien es wieder einmal so weit zu sein. Die neue Mark war erst sechs Monate alt und hatte bereits im ersten Anlauf die Zigarettenwährung vernichtet – aber die Wohlstandsbrause war doch noch ein reichlich rares Getränk.
Der glatte, selbstsichere Dr. Werner Kündig, Charlys Vertrauter und offensichtlicher Stellvertreter, empfing die Ankömmlinge, entschuldigte sich für die Abwesenheit des Gastgebers und verschob weitere Erklärungen auf später. Der Vierzigjährige wandte sich sofort neuen Gästen zu, aber die kapriziöse Petra Meller ließ sich nicht so schnell abwimmeln. »Wo steckt denn Charly nun eigentlich?« bedrängte sie seinen Bevollmächtigten. Ihre rotblonden Haare fielen, unkonventionell geschnitten, tief in die Schultern. Ihr Gesicht war apart und wirkte ganz natürlich; wenn sie lächelte, hatte sie hübsche Grübchen.
»Geduld, Petra – Sie werden gleich erfahren, was mit Charly los ist«, erwiderte Dr. Kündig der gut figurierten und gut situierten Mittzwanzigerin, die vor kurzem, wie sie annahm, Charlys Einzige gewesen war. »Bitte suchen Sie sich den richtigen Platz. Wir haben bewußt keine Tischordnung aufgestellt, so finden Sie sicher einen passenden Gesellschafter. Es soll ganz zwanglos zugehen: Jeder neben jedem, und –«
»Oder jede gegen jede«, unterbrach ihn Petra lachend und entdeckte im Trubel Gesichter, mit denen sie nicht gerechnet hatte. Die geschlossene Gesellschaft war auch eine gemischte Gesellschaft: Neben Charlys Eintagsfliegen und Favoritinnen ein Staatssekretär, zwei Großindustrielle, der Inhaber eines expansiven Bankhauses, Staatsanwalt Nimm, ein Börsenjobber, ein Schwergewichtsprofi, der frühere US-Major Grady, der jetzt angeblich als Privatmann in Deutschland lebte, der Kripobeamte Gerber und der Präsident der Faschingsgesellschaft, die sich todernst nahm. Auch blaublütige Damen fehlten nicht; in ihrer unmittelbaren Nähe hielt sich Watschel-Paula auf, deren Standplatz sonst in der Sendlingerstraße lag, schräg gegenüber der Asamkirche. Zu ihr gesellte sich die polnische Maria, von der Kenner behaupteten, sie verfüge über einen Zementbusen, wiewohl sie sicher keinerlei Erfahrungen in der Handhabung von Zement hatte. Es ging wirklich quer durch den Gemüsegarten, und die buntschillernde Schar der Versammelten verhieß einen kunterbunten Abend.
Die betuchte Gräfin Grieben hatte einen Platz gewählt, von dem aus sie alles übersehen konnte, ohne in den Trubel einbezogen zu sein. Die wenigsten kannten die Dame mit dem kunstvoll geminderten Alter; die meisten nahmen ohne weiteres an, daß Charly auch in diesen Vollreifen Apfel, fruchtig und saftig, gebissen hatte. Vermutungen, Gerüchte, Anzüglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten – doch keiner der Anwesenden kannte die Rolle, die die Gräfin tatsächlich im Leben des Vielgeliebten spielte.
Genauer Bescheid wußte man schon über Julia Semper, die früher vor berühmten Domfassaden und auf alten Marktplätzen in Freilichtaufführungen »Jedermanns« Buhlin gespielt hatte. Heute war sie ein bekanntes und beliebtes Filmstarlet und gleich mit drei Begleitern erschienen. Petra verfolgte, wie die Filmfritzen eine Art Wurstschnappen um die Leinwandschöne veranstalteten. Keiner schien dabei so recht voranzukommen.
Das Terzett hätte bei Charly in die Schule gehen sollen. Er war eben ein Mann für jede und dadurch für keine. Petra konnte auf ihre Rivalinnen zurücksehen ohne Zorn. Seitdem der Vulkan erloschen war, verbanden sie mit Charly nur noch ziemlich problemlose Beziehungen. Das menschliche Erinnerungsvermögen ist bekanntlich so geschaffen, daß es die angenehmen Ereignisse behält und die unangenehmen verdrängt. Vielleicht waren deshalb so viele erloschene Flämmchen heute dem Ruf des Gastgebers gefolgt. Er hatte das Talent, abgekühlte Leidenschaft in bleibende Freundschaft auslaufen zu lassen. Die menschliche Qualität eines Mannes erkennt seine Partnerin nicht vorher und nicht auf dem Höhepunkt, sondern meistens erst danach. So betrachtet schnitt Charly gar nicht so schlecht ab.
Es war für Petra offensichtlich, daß viele weibliche Mitglieder aus Charlys Club und Clique nur aus alter Anhänglichkeit gekommen waren, sicher auch einige aus Neugier oder weil sie seine Großzügigkeit schätzten. Als sie jetzt sahen, daß ein großes kalt-warmes Büfett aufgebaut wurde, wußten sie, daß diese Rechnung aufgehen würde.
Auch die Neugierigen würden auf ihre Kosten kommen, denn der Gastgeber fehlte noch immer, genauso wie eine Erklärung seines Ausbleibens. Da die Versammelten ihn kannten, nahmen sie an, daß er an diesem Abend wieder einen besonderen Coup landen würde, und richteten sich auf die Überrumpelung ein. Jedenfalls mußte man bei Charly auf alles gefaßt sein; gelegentlich gefiel er sich auch als Exzentriker.
Sein Bevollmächtigter erblickte in der Tür Cynthia, die amerikanische Generalstochter, begleitet von einem französischen Journalisten. Er ging ihr entgegen. »I’m sure, you’re Miss Macomber«, begrüßte er die Amerikanerin. »Nice to meet you. My name is Kündig. I’m a friend of Charly’s and also his lawyer. I’m sorry, but Charly has been delayed.«
Sie schien enttäuscht, daß Charly aufgehalten worden war, aber von allen Seiten wurde versichert, daß er bald kommen würde. Cynthia stellte ihren Begleiter vor, und der schlanke Rechtsanwalt mit der randlosen Brille und den schütteren Haaren, die ihm eine hohe Stirne machten, geleitete als besondere Auszeichnung diese Gäste persönlich an einen reservierten Tisch, dicht an der Tanzfläche.
Hier tummelten sich bereits die ersten Paare. Die Combo war Charlys Lieblingsband; die drei Musiker beherrschten zusammen zwanzig Instrumente, und sie spielten die Gassenhauer der Saison: »Im Hafen von Adano«, »O mein Papa«, und »Sentimental Journey«; tatsächlich waren ja auch viele mit dem Frauengünstling auf die sentimentale Reise gegangen. Doch immer wieder setzte die Band zu seiner Erkennungsmelodie an: »Don’t fence me in.« Es war das Lieblingslied des abwesenden Gastgebers: »Sperr mich nicht ein.« Tatsächlich hatte der liebe Augustin der Nachkriegszeit schon ein paarmal im Knast gesessen, doch niemals lange. Niemand wußte so recht zu sagen, ob er ein Romantiker war oder ein Abenteurer, ein Michael Kohlhaas oder ein charmanter Freibeuter.
An die hundert Gäste, vorwiegend junge Frauen, begleitet von brandneuen Ehemännern, oder hübsche Mädchen mit ihren Freunden auf Zeit, hatten sich bereits eingefunden, Nachzügler drängten herein. Die »Arche Noah«, Schwabings berühmter Treffpunkt an der Leopoldstraße, würde überfüllt sein, aber das machte schließlich Stimmung. Nach der biblischen Überlieferung waren in Noahs Arche die Tiere, ein Paar jeder Gattung, über die große Sintflut gerettet worden – auch Charlys Gäste glichen Überlebenden einer Zeit, die endlich ihre schlimmsten Zeiten hinter sich gebracht hatte.
Von außen war die »Arche« eine schmucklose Holzbaracke, aber innen hatte sie Stil und Atmosphäre. Sie lag im Norden der Stadt, im Herzen des wieder erstehenden Schwabing, ziemlich genau in der Mitte der großen Durststrecke zwischen dem Siegestor und der Münchener Freiheit. Schwabylon war ein Programm, ein Zustand, mit großem Rummel und bescheidenen Preisen, ein permanentes Rendezvous von Tagedieben und Nachtschwärmern, von Schlaumeiern und Schlawinern, von Prominenten und Provinzlern, von Künstlern und Lebenskünstlern, die die Leinwand vorwiegend horizontal zu spannen pflegten.
Vis-à-vis, im Jazzkeller des »Studio 15«, war der Eintritt frei. In den Schwabinger Beizen, die so dicht beieinander lagen wie die Sommersprossen im Gesicht einer Rothaarigen, kostete einheitlich das Bier eine halbe, ein Schnaps eine ganze Mark, wobei er meistens den Nachnamen »Verschnitt« führte. Bei »Mutti Bräu« gab es für zwei Mark fünfzig zwei Schnitzel und im »Siegesgarten« zum gleichen Preis eine üppige Portion Langustensalat. Zigaretten wurden noch stückweise verkauft, und die Mädchen erhielt man, wenn man als Bewerber gefiel, gratis; andernfalls blieben sie unerreichbar. Sie waren – von Ausnahmen abgesehen – durchaus unkäuflich, sehr lustig, geschickt und mit wenig Aufwand hübsch zurechtgemacht, sie hatten noch keinen Pillenfrust im Gesicht, und sie trugen auch noch keine Strumpfhosen.
Die geschlossene Gesellschaft war jetzt fast vollzählig. Charlys Bevollmächtigter sah auf die Uhr. Sicherheitshalber wollte er doch noch Nachzügler abwarten.
Julia, das Filmsternchen, das dabei war, eine ernsthafte Schauspielerin zu werden, erblickte Petra, kam auf sie zu und umarmte sie. »Setz dich doch zu uns«, sagte sie. »Ich hab’ zwei Begleiter zu viel.«
»Zwei oder drei?« fragte Petra.
Sie lachten beide, sie verstanden sich immer; die rotblonde Attraktion folgte der Einladung. Es gab keine reservierten Tische mehr; Charlys Schönheitsgalerie mußte enger zusammenrükken. Es schien, als sollte an diesem Abend seine lebende Biographie, ein Querschnitt seiner wilden Jahre dargestellt werden.
Der Champagner erfüllte seine Pflicht, die Stimmung wuchs, wurde ausgelassen und versöhnlich. Die Rivalitäten versanken in perlenden Gläsern, ihr Inhalt wirkte wie Balsam auf offene Wunden, und die Witwe Cliquot machte Konkurrentinnen zu späten Schwestern, die einander verziehen und sich um die Wette erinnerten.
Fiorella, die rassige Italienerin, nannte den Abwesenden abwechselnd »Charly Pronto« oder »Charly Niente«, Suzanne, die Pariserin, »Charly oh là là«, die etwas plumpe Monika »Charly bum-bum«. Petra lobte ihn als »Schlawiner mit Herz«. Für Cynthia Macomber war er »Everybody’s Charly«. Die kühl-blonde Baronin Annette von Güßregen, die kaum ein Wort zu viel sagte, ging aus sich heraus und nannte Charly einen »krummen Hund, doch auch tollen Freund«.
»Sicher ist er ein schräger Vogel«, sagte die kesse Christa zu ihrem schmollenden Begleiter, »aber jedenfalls ein Filou mit Format.«
»Format hat eine Zigarette«, erwiderte der Ungehaltene grimmig.
Christa betrachtete ihn schweigend, verglich ihn wohl mit seinem Vorgänger; dabei schnitt der Amtierende offensichtlich schlecht ab.
Selbst ein abwesender Charly provozierte noch Eifersucht. Die scharfzüngige Annegret ging beim Anblick der vielen, die sie gekränkt hatten, beleidigt auf Dr. Kündig los. »Halten Sie diese Zusammenstellung für sehr geschmackvoll?« fuhr sie Charlys Stellvertreter an.
»Der Wunsch meines Mandanten«, erwiderte der Elegant. »Nicht ich habe eingeladen, sondern er.«
»Und die Wünsche Ihrer Mandanten erfüllen Sie, auch wenn sie undelikat und verletzend sind?« inszenierte Annegret den ersten Zwischenfall des Abends.
»Wenn ich Sie davon nicht abbringen kann«, ließ sie der Rechtsanwalt ablaufen.
»Sie alberner Winkeladvokat!« fuhr die Blondine den Erfolgsanwalt an und fummelte mit ihrer Handtasche vor seinem Gesicht herum, als wollte sie ihn damit schlagen. »Sie lächerlicher Paragraphenschuster! Ich – ich lasse mich nicht beleidigen, nicht von Ihnen und nicht von Ihrem Spießgesellen!«
Annegret rauschte hinaus. Als einzige verließ das hochgewachsene Mannequin die Veranstaltung vor dem großen Knall; sie war nur gekommen, um Charly die Meinung zu sagen.
»Gehört diese Dame auch zu den Blumen, die Charly gepflückt hat?« fragte Cynthia; sie hatte ein niedliches Deutsch erlernt. »Sie kann doch nicht seinem Geschmack entsprechen.«
»Er ist nun mal ein Vielfraß«, erwiderte Petra, »und ihr Blond ist so impertinent.«
»Meinen Sie, daß er mit all diesen Damen etwas gehabt hat?«
»Nicht mit allen«, sprang Julia ein, »aber mit den meisten.« Ihr Lächeln unterschlug nicht, daß sie nicht nur »Jedermanns« Buhlin gewesen war, sondern auch mit Charly liiert, soweit man es mit einem Mann wie ihm sein konnte. »Sind Sie denn so standhaft geblieben?« fragte die photogene Julia ein wenig spöttisch.
»Ich bin ein Mädchen aus dem Mittelwesten«, erwiderte die mittelgroße Amerikanerin mit den Türkisaugen und der Himmelschmeckernase. »Bei uns geht man zuerst in die Kirche und dann ins Bett.«
»Und wenn man weit vom Mittelwesten entfernt ist«, versetzte Petra, »und lange in Europa gelebt hat, kann man da nicht einmal die Reihenfolge durcheinanderbringen?«
»No comment«, entgegnete der frühere Leutnant der US Army. Cynthia eroberte mit ihrem Lachen die Tischrunde.
Der unsichtbare Gastgeber blieb der Hahn im Korb, selbst wenn er heute nicht krähte. Die Frauen nannten ihn Charly, und Julia hätte wetten können, daß die meisten nicht einmal seinen Nachnamen kannten, zumal er ihn ja auch – nicht ohne Grund – gelegentlich gewechselt hatte; doch nie seinen Vornamen. Vielleicht war der Frauenkenner auch ein Frauenopfer? Mochte er ein Herzensbrecher sein, so hatte er sich doch auch stets als ein herzensguter Herzensdieb erwiesen. Der Alkohol rückte seine guten Werke zunehmend ins Bild.
Als letzter Gast tauchte jetzt Jimmy auf, der, wenn man davon absah, daß er ein Ganove war, als ehrliche Haut galt. Natürlich war er als bayerischer Sepp zur Welt gekommen und hatte seinen Vornamen nur amerikanisiert. Sepp konnte jeder heißen; Jimmy hielt er für noch ziemlich einmalig.
Er hatte ein offenes Gesicht, glich einem Freistilringer, der gleich aus den Nähten platzen mußte. Bier wäre ihm lieber gewesen als Schampus, aber er wagte nicht, bei dem feinen Ober, der ihm das Glas in die Hand gedrückt hatte, den Wunsch nach Gerstensaft zu äußern; er hatte Charly in der Zelle kennengelernt.
Jimmy bemerkte den Kriminalbeamten Gerber und wollte vor ihm in Deckung gehen. Auf der Flucht erkannte er die Gräfin Grieben, sie saß noch immer allein in ihrer Ecke. Er näherte sich ihr unschlüssig, schlich um sie herum wie ein schwanzwedelnder Hund um den heißen Freßnapf.
Sie winkte Jimmy heran, forderte ihn mit einer Handbewegung auf, neben ihr Platz zu nehmen. »Sie müssen doch wissen, wo sich Charly zur Zeit aufhält?« fragte sie ihn.
»Leider nicht, Frau Gräfin«, erwiderte er. »Ich habe ihn schon seit sieben Monaten nicht mehr gesehen.«
»Warum das?«
Er zögerte. »Ich war in St. Adelheim«, erklärte er dann, leicht verlegen.
»Im Kurort – zur Erholung?« fragte sie belustigt.
»Im Untersuchungsgefängnis Stadelheim«, erläuterte Jimmy kleinlaut. »Natürlich unschuldig«, setzte er rasch hinzu.
»Wie damals, als Sie meinen Schmuck klauen wollten?« fragte die Dame mit der dreireihigen Perlenkette.
»Seien Sie doch nicht so nachtragend«, entgegnete Jimmy ziemlich beunruhigt, sich nach Gerber, dem Kripobeamten, umsehend; er stellte erleichtert fest, daß der Bulle außer Hörweite war.
Es war jetzt 21 Uhr 30, und noch immer beantwortete Rechtsanwalt Kündig Fragen nach Charlys Verbleib ausweichend und unverbindlich. Selbst die Arglosen nahmen jetzt an, daß der Veranstalter der Party etwas Besonderes im Schilde führte. Die Spannung wuchs; die Erwartung kletterte höher und höher, als wollte sie den in diesem Jahr von einem Düsenjet aufgestellten Höhenrekord von 19400 Metern brechen.
Begründungen wurden erfunden, Erklärungen herumgereicht. Am Tisch I kam das Gerücht auf, Charly habe ganz plötzlich geheiratet und nutze den Abend, seine vorläufige Endgültige zu präsentieren. Tisch II kolportierte, daß es sich um eine blutjunge rumänische Zigeunerprinzessin handle; bei Tisch III war sie zur amerikanischen Dollarmillionärin geworden, und zuletzt erfuhren Petra, Cynthia und Julia, Charly und seine Auserwählte seien sogar von einem echten Bischof getraut worden.
»Glaubst du das?« fragte Petra.
»Den Bischof würde ich ihm schon abnehmen«, erwiderte Julia. »Aber nicht die Ehe. Er hat immer einzelne Damen hintergangen, weil er allen treu sein wollte.«
Sie lachten; der Kummer von einst war zur Episode geworden, Charlys Unverfrorenheit zum Witz.
»Er sagt immer, er fürchte nur drei Dinge im Leben«, erklärte die reizvolle Julia, der die kurzgeschnittenen Haare ausgezeichnet standen. »Angeborene Verschwendungssucht –«
»– sture Gesetze«, ergänzte Petra.
»Und weibliche Eifersucht«, schloß die Amerikanerin.
Sie lachten alle drei – sie gefielen einander.
Der Stellvertreter des Gastgebers bat zum Büfett. Er hatte sich entschlossen, die Überraschung des Abends bis nach dem Dinner aufzuschieben, da sie sich den meisten auf den Magen schlagen mußte. Die Gäste standen Schlange; sie griffen beherzt zu. Der Kalorienterror war noch nicht in Mode, und die wenigsten brauchten nach den Hungerjahren um ihre Figur zu fürchten.
In vierzehn Tagen würde das ereignisreiche Jahr 1948 zu Ende gehen. In Bonn tagte der Parlamentarische Rat, um die Verfassung für die künftige Bundesrepublik auszuarbeiten. Die Währungsreform, an der sich die Sowjets – trotz Einladung ihrer früheren Verbündeten – nicht beteiligt hatten, beendete den Traum von der Einheit Deutschlands und füllte die leeren Regale in den Geschäften bis zum Bersten. Die Lebensmittelbewirtschaftung war nur noch ein Feigenblatt auf der Brieftasche.
Im Gegenzug strangulierten die Russen Berlin, schalteten der tapferen Stadt den Strom ab, blockierten den Güterverkehr. Die drei Westsektoren der früheren Reichshauptstadt mußten aus der Luft versorgt werden. Ununterbrochen starteten die »Rosinenbomber«; an einem Rekordtag schafften 896 Flugzeuge 7000 Tonnen Nahrungsmittel über die Luftbrücke nach Berlin. Trotzdem stellte sich die Bevölkerung die bange Frage, wie lange die Alliierten die Versorgung aus der Luft noch durchstehen würden.
Mehr als eineinhalb Millionen Kriegsgefangene befanden sich noch im Gewahrsam der Sieger. 750 deutsche Fabrikanlagen waren demontiert worden, aber auch anderswo hatte man Sorgen. Während die DM zum Siegeszug ansetzte, mußten der französische Franc und die italienische Lira abgewertet werden.
Der Marshallplan lief an. Für das erste Jahr waren 4875 Millionen Dollar für das amerikanische Hilfsprogramm vorgesehen. Die Zeit war hart, der Westen rückte zusammen. Mitunter wurden die Sorgen übermächtig, aber es gab auch Lichtblicke: Die Frauen waren eher feminin als feministisch, die rechtschaffenen Buchhalter wurden noch nicht durch seelenlose Computer ersetzt, es gab noch keine Gammler, Fixer, Rocker, keine Punks, Spontis und Chaoten, keine Massenarbeitslosigkeit und keine Geldwaschanlagen für nimmersatte Politiker. Die Roten waren eher rosarot, und Grün war eine Farbe und keine politische Richtung; saurer Regen, Flugzeugentführungen, radioaktive Verseuchung, Retorten-Babies, Herzverpflanzung und Gen-Manipulation gehörten noch in die Horrorkammer der Zukunft.
Am langen Büfett kam es zu kurzen Gesprächen.
»Wenn Charly eine Erbschaft gemacht hat, dann bringt er sie jedenfalls heute abend durch«, sagte Staatsanwalt Nimm zu dem Bankier. »Oder hat er einen Fischzug gelandet und ruiniert sich wieder einmal?«
»Er ist ein routinierter Selbstruinierer«, erwiderte der Mann von Geld. »Aber mir ist darüber nichts bekannt. Und ich führe ja schließlich seine Konten.«
»Alle?«
»Die überzogenen«, versetzte der Privatbankier lachend. »Aber ich will das Bankgeheimnis nicht verletzen.«
Der Andrang der Wartenden wurde noch größer, es gab einen Stau.
»Soll ich Ihnen etwas holen, Frau Gräfin?« fragte Jimmy höflich.
»Salat und etwas mageres Fleisch«, erwiderte sie. »Nicht viel und nichts anderes, bitte.«
Er erhob sich sofort. Erleichtert, weiterer Erörterung des seinerzeitigen Reinfalls zu entkommen, prallte er mit Gerber zusammen.
»Schon wieder raus?« fragte der Kripobeamte taktlos.
»Ja«, entgegnete Jimmy, »und zwar diesmal für immer und ewig.«
»Also mindestens für sieben Monate und drei Wochen – nutzen Sie die Ewigkeit«, spottete der Mann vom Dezernat zur Bekämpfung der Intelligenzdelikte. »Hat Ihr Freund Charly heute abend eigentlich etwas vor?« fragte er.
»Das weiß ich nicht«, versetzte Jimmy. »Und wenn ich’s wüßte, würde ich es Ihnen nicht auf die Nase binden.«
Der Bulle ging an das Büfett, häufte auf seinen Teller zielstrebig Delikatessen, die es in keinem Beamtenhaushalt gab, selbst an den höchsten Feiertagen nicht: Kaviar, Lachs, Salm, Hummer, getrüffelte Gänseleber, Bündnerfleisch, Carpaccio und vieles, was er nicht kannte, dazu raffinierte Saucen, delikate Marinaden, pikante Salate.
Die Kenner aus Finanz-, Regierungs- und industriekreisen erörterten, ob »Humpelmayer« das Büfett erstellt habe oder »Schwarzwälder«. Sie bedienten sich bescheiden: Einmal hatten sie es öfter, und dann achteten sie bereits auf ihre Gesundheit, gewillt, den Tag, an dem in schwarzumrandeter Anzeige versichert wurde, wie unvergeßlich der teure Verblichene bleiben werde, möglichst lange hinauszuschieben. Ausgerechnet die Einnehmer hoher Diäten hielten sich als erste an die Diät.
Um 22 Uhr 30 war es so weit: Dr. Kündig erhob sich und klopfte an sein Glas. Er hatte es schwer, sich gegen die ausgelassene Stimmung durchzusetzen. Die Gäste hatten dem Schampus so lebhaft zugesprochen, daß die Marke gewechselt werden mußte, nicht jedoch die Qualität. Endlich wurde es ruhiger. Selbst den Beschwipsten fiel jetzt die ernste Miene des Gastgeber-Stellvertreters auf – aber Juristen müssen ja immer ihr feierliches Brimborium abziehen.
»Verehrte Ehrengäste«, sagte der Rechtsanwalt mit einer knappen Verbeugung zum Tisch der Wirtschaftsgrößen, an dem auch der Staatsanwalt und der Kripobeamte Platz genommen hatten. »Liebe Freunde des Gastgebers«, ergänzte der Bevollmächtigte die Anrede. »Zunächst noch einmal meinen Dank für Ihr Kommen. Mein Mandant hat auf Ihr Erscheinen großen Wert gelegt und mich sogar gebeten, auf Ihrer Zusage mit Nachdruck zu bestehen, was glücklicherweise gar nicht nötig war.« Er wirkte sachlich. Nur sein linkes Auge zwinkerte nervös. »Sie alle stehen in einer freundschaftlichen, geschäftlichen oder amtlichen Beziehung zu dem Mann, der uns heute so verwöhnt. Er ist der Regisseur dieses Abends, und ich folge nur seinen Anweisungen, sowohl als sein Freund wie als sein Rechtsvertreter.«
Die Nebengeräusche verstummten allmählich. Die letzten Genießer legten das Eßbesteck beiseite, verschoben den Nachtisch auf später.
»Leider kann er nicht unter uns sein – und warum das der Fall ist, wird er Ihnen nun selbst erklären.« Dr. Kündig nickte den Musikern zu.
Sie zogen die Schutzhaube von einem unförmigen Gerät, verbanden es mit ein paar Handgriffen mit dem Verstärker, an den die Lautsprecher angeschlossen waren. Tonbandmaschinen waren im Nachkriegsdeutschland noch neu und mußten von den Amerikanern ausgeliehen werden.
»Okay, Herr Doktor«, rief der Schlagzeuger, und der Rechtsanwalt trat an das Gerät heran und ließ das Band von der Spule. Sie drehte sich; zuerst war nichts zu hören, dann kamen Geräusche und schließlich Charlys Stimme, klar, deutlich, ein wenig akzentuierter, als er sonst zu sprechen pflegte. Vermutlich hatte er für die Aufnahme lange geprobt.
»Also, ihr Lieben«, begann er. »Ich kann euch gar nicht schildern, wie gerne ich jetzt unter euch wäre – aber das ist leider unmöglich, und ihr werdet auch gleich erfahren, warum wir nie mehr beisammen sein werden.« Die Spule drehte sich ein paarmal tonlos, und bevor Charlys Stimme wieder da war, starrten alle seinen Sachwalter an. Er war der einzige, der den Inhalt des Tonbands kannte; er konnte Gelassenheit demonstrieren, aber der Wackelkontakt seines linken Auges war jetzt deutlicher zu sehen.
»Der guten Ordnung halber möchte ich euch sagen, daß heute der 7. März 1948 ist. Ich komme gerade vom Skilaufen. Ich bin von der Piste abgekommen und an einem Felsüberhang siebzig Meter tief abgestürzt. Ich bin in einer tiefen Schneemulde gelandet, bin nur leicht verletzt, also glimpflich davongekommen, doch der Schock ist noch da, und ich frage mich, was sein könnte, wäre ich nicht zufällig in einer Schneeverwehung aufgekommen. Das verschafft mir einen nachdenklichen Tag, und so bin ich entschlossen, Dinge zu ordnen, die man sonst vor sich herzuschieben pflegt.«
Einige von Charlys Freunden wußten von dem Skiunfall und hatten auch bemerkt, daß er noch eine Zeitlang an ihm laborierte, bis er ihn später wieder vergessen hatte – aber warum inszenierte er jetzt, ein dreiviertel Jahr danach, diese aufwendige Schau?
»Zunächst noch ein technischer Hinweis«, kam seine Stimme wieder vom Band. »Ich werde die Aufnahme meiner Worte, die ich jetzt in das Mikrophon spreche, bei Rechtsanwalt Dr. Kündig in einem versiegelten Umschlag deponieren, und ich hoffe, daß noch viel Zeit verstreichen wird, bevor er das Kuvert öffnen muß. Die Vorstellung, daß mir etwas zustoßen könnte, ohne daß ich mich von euch verabschiedet hätte, bedrängt mich seit einer Weile. Es ist nicht so, daß ich eine ausgesprochene Todesahnung hätte, aber ein Mensch, der denkt, muß damit rechnen und sorgt vor, auch wenn er noch verhältnismäßig jung ist. Bereits als Kinder erfassen wir ja, daß wir mit unserer Geburt eigentlich auch zum Tode verurteilt sind. Das ganze Leben ist nur mehr oder weniger der Versuch, die Vollstreckung möglichst lange hinauszuschieben –«
Der Staatsanwalt schüttelte den Kopf, der Kripomann Gerber zischte halblaut: »Das ist eine Blasphemie – ein Blödsinn –«
Die anderen Zuhörer wirkten verwirrt bis bestürzt; unbeeindruckt war keiner.
»Was danach kommt, wissen wir nicht – wir können allenfalls hoffen, daß es – wie auch immer – weitergeht. Entschuldigt, liebe Freunde, diesen melancholischen und philosophischen Ausrutscher, aber ich möchte euch heute einmal ernsthaft kommen. Unter anderem bin ich ja auch ein Rennfahrer, und ein solcher muß immer damit rechnen, einmal aus der Kurve geschleudert zu werden. Ich liebe das schnelle Leben, und wenn ich mich recht erinnere, haben einige von euch, vor allem du, liebe Petra, und auch du, verehrte Annette, schon ein paarmal behauptet, einer wie ich werde keinen natürlichen Tod erleiden.«
Die Stille wurde beklemmend. Einige schüttelten verständnislos den Kopf; aber die meisten erfaßten, daß es sich bei der Tonbandansprache um keinen albernen Coup handelte, sondern daß sich den lockeren Worten eine schlimme Eröffnung anschließen mußte. Das Erschrecken geisterte als unheimlicher Gast durch den Raum. Alle starrten Dr. Kündig an, als könnte er den Spuk vertreiben und das unbestimmte Entsetzen beenden.
»Aber was ein natürlicher Tod ist, darüber könnte man streiten. Wenn’s nach mir ginge, würde ich überhaupt nicht sterben. Wenn es aber schon sein muß, dann wenigstens nicht im Krankenhaus, Gefängnis oder Altersheim. Nicht daß ich erpicht darauf wäre oder daß ich etwa Selbstmordgedanken hätte. Ich liebe das Leben, wie ich an euch hänge, die Gefahr schätze und meine Freude daran habe, Geld zu verdienen und auszugeben. Es ist mir ein Bedürfnis, euch einzuladen, solange ich dazu in der Lage bin. Deshalb würde ich es hassen, einfach sang- und klanglos aus eurer Mitte zu verschwinden. Darum treffe ich nunmehr gewisse Vorbereitungen.
Ich werde bei meinem Freund und Anwalt auch einen ordentlichen Betrag hinterlegen – unter anderem zur Finanzierung dieses Abends. Ich möchte diese Runde nicht als Zechpreller verlassen.«
Flackerndes Kerzenlicht spiegelte sich auf den Gesichtern, zog Jahre ab, addierte welche hinzu, verschönerte oder vergröberte, wurde zum Zerrspiegel oder zur Schmeichelei, je nach Laune des Luftzugs. Keiner konnte sich mehr verstellen, seine wahren Empfindungen beherrschen, eine Stärke der Nerven vortäuschen, über die er nicht verfügte. Hände spielten nervös auf den Tischen, Angstschweiß wurde sichtbar.
»Wenn ich euch heute also zusammenrufe, habe ich – ohne das Datum dieses Tages zu kennen – den Löffel bereits abgegeben und bin, wie man so schön sagt, in einer anderen Welt.
Wann, warum und wie das geschehen ist, wird euch Dr. Werner Kündig erklären.
Er ist mein Testamentsvollstrecker und hat meinen ausdrücklichen Auftrag, euch über das erste Erschrecken hinwegzuhelfen, Ich bin kein Freund von Traurigkeit, und so will ich auch keine traurigen Gesichter hinterlassen. Wenn ihr vielleicht gelegentlich an mich denkt, was ich hoffe, sollt ihr die Erinnerung an einen lustigen Kerl behalten, der sich als Wellenreiter auf den Fluten unserer stürmischen Zeit versucht hat, ein paarmal abgeworfen wurde, aber immer wieder aufgestiegen ist …
So bitte ich euch jetzt, das Glas zur Hand zu nehmen und meinen albernen Trinkspruch zu verwirklichen: ›Wer trinkt, zerstört sein Leben, aber wer nicht trinkt, lebt nicht.‹
In diesem Sinne also: Servus, Petra, Annette, Christa, Annegret. Küss’ die Hand, Julia. Ciao, Fiorella. Adieu, Suzanne. Bye-Bye, Cynthia –«
Die Spule drehte leer.
Der selbstgehaltene Nekrolog war zu Ende.
Charlys Worte hatten die Anwesenden überrollt wie eine Dampfwalze, und wie nach einem Verkehrsunfall erfaßten viele nicht, was geschehen war, und wehrten sich andere gegen die Erkenntnis. Es war, wie wenn im Kino nach einem erschütternden Finale plötzlich wieder das Licht angeht und die Besucher einen Moment lang unfähig sind, zu sprechen oder sich zu erheben, weil sie erst noch ihre verstörten Gesichter ordnen müssen.
In diese Stille hinein sagte Dr. Kündig: »Ich erhebe das Glas auf Charly, der nicht mehr unter uns ist.« Die Anwesenden folgten ihm mechanisch. »Ex!« setzte der Anwalt hinzu.
Sie tranken aus.
Die Kellner füllten sofort nach.
Langsam, leise und getragen setzte die Melodie »Don’t fence me in« ein – als profanes Requiem für Charly.
»Ich muß jetzt amtlich werden«, stellte Rechtsanwalt Kündig fest und nahm ein Schriftstück zur Hand. »Ich habe hier eine Mitteilung der italienischen Polizei, daß Charly am 24. November in der Nähe von Palermo frontal gegen einen Baum gefahren und sein Wagen in Brand geraten ist. Er ist in den Flammen umgekommen.« Dr. Kündig hob die Hand. »Man nimmt an, daß er das Bewußtsein schon verloren hat, bevor er verbrannt ist. Die Polizei vermutet, daß bei forcierter Fahrt in einer Kurve der linke Vorderreifen geplatzt ist und der Wagen sich deshalb nicht mehr steuern ließ. Der Fall wurde amtlich abgeschlossen, der Totenschein bereits am 27. November ausgestellt. Ich habe hier eine beglaubigte Abschrift.« Er wies das Dokument vor. »Da sich in Charlys Gepäck im Hotel ein Hinweis auf mich befand, wurde ich von der italienischen Polizei benachrichtigt. Ich bin unverzüglich nach Sizilien geflogen und habe dort aus eigenem Augenschein festgestellt, daß sich die Dinge so ereignet haben, wie die Carabinieri behaupteten. Charly ist allein im Wagen gewesen, auf dem Weg zu einer Bekannten. Selbstmord ist nicht auszuschließen, aber äußerst unwahrscheinlich. Ich habe veranlaßt, daß die Urne mit Charlys Asche nach München überstellt und hier beigesetzt wird.« Er machte eine kurze Pause. »Ich sehe Ihre Betroffenheit und Ihre Trauer«, sagte er dann. »Und ich teile sie. Ich muß aber darauf hinweisen, daß Charly in seiner letzten Verfügung darauf bestanden hat, Ihnen die Hiobsnachricht zu vorgerückter Stunde bei vorgerückter Laune mitzuteilen. Das ist geschehen. Es bleibt mir nur noch zu sagen: Wir sind ärmer geworden. Trinken wir noch einmal auf Charly!«
Die Gäste erhoben sich zum zweiten Mal. Fiorella sagte nicht mehr: »Charly Niente.« Schluchzend wiederholte sie immer wieder: »Niente Charly – Niente Charly –«
»Charly, wie er lebt und stirbt«, stellte Petra fröstelnd fest.
»Kann man so etwas so schnell begreifen?« erwiderte Annette. »Ich hab’ ihn wirklich manchmal zum Teufel gewünscht, aber daß er jetzt, mit achtundzwanzig, so sinnlos und einsam stirbt –«
»Diese verdammte Schulweisheit, daß jung stirbt, wen die Götter lieben«, entgegnete Julia.
Sie redeten und tranken sich über den ersten Schmerz hinweg.
Aber nicht alle teilten ihn.
»Der Mann hätte zum Theater gehen müssen«, sagte Staatsanwalt Nimm. »Bei so einer Begabung für Bühneneffekte.«
»Mit einem solchen Einsatz hat jeder Erfolg«, versetzte Kripo-Gerber. Er wandte sich an Dr. Kündig: »Wenn ich Sie recht verstanden habe, liegt die Todesnachricht schon über vierzehn Tage zurück.«
»Fast drei Wochen«, erwiderte der Anwalt.
»Warum haben wir dann nichts davon erfahren?« fragte Gerber. »Auf dem Amtsweg.«
»Das wundert mich auch«, erwiderte der Testamentsvollstrecker. »Die deutsche Polizei wurde benachrichtigt«, sagte er. »Mit gleicher Post. Ich hab’ den Durchschlag des Schreibens in Palermo selbst gelesen.«
»Ich nicht«, konterte der Kriminalbeamte. »An wen war es gerichtet?«
»An das Unfallkommando der Münchener Polizei«, erwiderte der Anwalt. »In italienischer Sprache natürlich.«
»So ein Blödsinn«, schnaubte der Leiter des Betrugsdezernats. »Man hat das Schreiben nicht an mich weitergeleitet.«
»Warum denn auch?« fragte Dr. Kündig scheinheilig, als wüßte er es nicht. »Hätte es denn einen Grund gegeben?«
»Sie wissen doch ganz genau, daß wir schon lange gegen Ihren Mandanten gewisse Ermittlungen –«
»Lange und vergeblich«, entgegnete der Rechtsanwalt. »Die können Sie jetzt abschließen.« Er wollte es nicht ganz mit der Kriminalpolizei verderben, aber seine Genugtuung blieb offensichtlich.
»So geht’s im Leben«, sagte Staatsanwalt Nimm am Nebentisch zu dem Privatbankier Müncheberg. »So schnell verlieren wir einen Verdächtigen und Sie einen Kunden.« Der Angesprochene nickte zerstreut. »Kostet Sie diese Hiobsnachricht nun viel Geld?«
»Wer spricht denn schon in einer solchen Situation von Geld? Sie sind ganz schön herzlos, Herr Dr. Nimm.«
»Ich meine die überzogenen Konten.«
»Die sind abgesichert. Wir verlieren nichts. Keine Mark. Außerdem hab’ ich für Charly schon immer eine Schwäche gehabt. Ich habe den Mann nämlich gemocht.«
»Dann mein herzliches Beileid«, versetzte der Staatsanwalt pikiert. Von nun an aber hielt er sich zurück; er hatte erfaßt, daß Zynismus in dieser Runde nicht ankam. Na ja – de mortuis nil nisi bene. Jetzt würde wohl die verspätete Nikolausparty zum handelsüblichen Leichenschmaus ausarten.
Tatsächlich machten nun Charlys Eskapaden die Runde. Er wurde von Minute zu Minute interessanter, unwiderstehlicher, kühner, schlagfertiger und menschlicher. Die Gräfin Grieben gehörte zu den Gästen, die sich auch nicht vorübergehend mit Champagner über den Verlust hinwegtrösten konnten, und Jimmy, die ehrliche Haut, sagte mit trockener Kehle: »Es ist furchtbar, Frau Gräfin … Aber vielleicht hat sich Charly bloß wieder einen Schabernack ausgedacht«, setzte er tröstend hinzu.
Die Gräfin stauchte ihn zurecht: Jimmy konnte eben nur in seiner Ganovenmentalität denken. Sie griff nach ihrer Handtasche und verließ das Fest, ohne sich von irgendwem zu verabschieden.
»Von Ihnen habe ich nichts gewußt«, sagte Petra zu vorgerückter Stunde zu Cynthia. »Wo haben Sie eigentlich Charly kennengelernt?«
»Sie werden es nicht glauben«, erwiderte die Amerikanerin. »Charly war der erste Deutsche, den ich persönlich kennenlernte – der erste auch, dem es gelungen ist, mich zu verblüffen. Damals, etwa knapp zwei Monate nach Kriegsende, in der schlimmsten Zeit, als die Besiegten um die GIs herumstanden und warteten, bis sie ihre Kippen wegwarfen. Sie werden verstehen, daß wir Amerikaner damals noch nicht sehr gut – dafür gab’s einige Gründe – auf die Krauts zu sprechen waren. Ich hatte eine Autopanne – und da stand Charly auf einmal als Retter in der Not vor mir und bot mir eine Zigarette an.«
»Und?« fragte Petra.
»Ich hab’ sie genommen«, erwiderte die Amerikanerin lächelnd, »und hätte mich dafür hinterher ohrfeigen mögen. Es war eine seltsame Situation, Ende Juni 1945. Ich war wirklich in –«, sie fand das deutsche Wort nicht, »– in a terrible –«
»In der Klemme, Cynthia?«
»Und wie«, erklärte sie, und mit ihrer Schilderung beginnt Charlys Geschichte.
II
Sie steht am Gipfel eines ansteigenden Feldweges neben ihrem Jeep, der es nicht mehr tut, in einer herrlichen Landschaft, die sie entzückt hat und die ihr jetzt gestohlen bleiben kann. Seit über einer halben Stunde wartet sie vergeblich auf Hilfe, und es sieht nicht so aus, als könnte sich daran etwas ändern. Trotz aller Warnungen und auch entgegen dem Befehl war der weibliche Leutnant der US Army ohne Fahrer heute mittag losgerollt, aufs Blaue in diesen entlegenen Winkel des Werdenfelser Landes, der auch noch in einem überfüllten Germany menschenleer ist, und hatte dabei die Orientierung verloren. Während sie hin- und herrollte, mußte sie aus dem Kanister nachtanken, und auf einmal begann der Motor des Wagens zu spucken. Schließlich blieb er stehen wie ein störrisches Maultier, aber mit Peitschenhieben läßt sich ein Jeep nicht antreiben.
Die Sonne steht schon tief im Westen. Statt sich bei dem General in Garmisch-Partenkirchen zum Rapport zu melden, würde Leutnant Cynthia Macomber voraussichtlich im Jeep nächtigen müssen. Daß der Drei-Sterne-General ihr Vater ist, macht die Sache eher noch schlimmer. Auch in der Familie versteht er bei Befehlsverweigerung wenig Spaß.
Sie zündet sich die letzte Zigarette an, starrt um sich. Noch immer nichts zu hören, nichts zu sehen. Sie überlegt, ob sie den Jeep stehen lassen und sich zu Fuß weiter durchschlagen soll, aber vermutlich würde die Nacht früher kommen als die nächste Ortschaft, in der womöglich der Werwolf lauert. Cynthia fummelt an dem Motor herum, aber sie hat wenig Ahnung von Technik, und sie macht sich nur die Hände schmutzig. Die Zwanzigjährige in der schicken, olivgrünen Uniform wirft die Kippe mit der leeren »Camel«-Packung zornig auf den Boden. In den Staaten könnte sie das 100 Dollar Strafe kosten, aber in Deutschland ist für die Alliierten zu dieser Zeit nahezu alles erlaubt.
Ein Millionenheer überseeischer Soldaten hält die US-Zone in Germany besetzt, und erstaunt registriert dabei General Dwight D. Eisenhower, daß es sich um einen eigentlich überflüssigen Aufwand handelt. Die Angst vor einer ominösen Festung Alpenland, in der sich Hitlers letzte Fanatiker verschanzen würden, und vor Anschlägen des Werwolfs hatte den alliierten Oberbefehlshaber im letzten Stadium des Krieges zu der Fehlentscheidung verleitet, die deutsche Reichshauptstadt Berlin den Russen zu überlassen. Bei Kriegsende hatte sich die Gebirgsruine als schierer Bluff erwiesen, und wenn es irgendwo knallte, dann war allenfalls an einem amerikanischen Fahrzeug ein Reifen geplatzt. Jedenfalls spritzten die GIs nicht mehr auseinander, um sich in Deckung zu hauen. Die befürchteten Anschläge aus dem Hinterhalt fanden nicht statt, gehörten in die braune Märchensammlung, auf die der übervorsichtige Ike hereingefallen war. Die einzigen Partisanen, die olivgrüne Soldaten attackieren, sind die Spirochäten und Gonokokken der »Fräuleins« schlimmster Sorte, der »Amizonen«.
Cynthia Macomber aus Madison im US-Staat Wisconsin, vor kurzem noch Studentin, vor drei Wochen zum Lieutenant des »Women Auxiliary Corps« (WAC) befördert, fürchtet sich nicht gerade, aber mulmig ist ihr doch. Sie sieht nervös auf die Uhr, der Zeiger rückt weiter, stur auf die Dunkelheit zu.
Die Stille ist friedlich, doch bedrückend. Die mittelgroße Amerikanerin mit den kastanienbraunen Haaren und der niedlichen Stupsnase wird von Geräuschen genarrt, die sich als Halluzinationen erweisen. Als sie jetzt aus dem toten Blickwinkel ein leicht ansteigendes Brummen hört, fürchtet sie wieder eine Sinnestäuschung.
Cynthia sieht erst auf, als ein seltsames Gefährt mühselig die Anhöhe hochklettert.
Sie hebt die Hand, um auf sich aufmerksam zu machen – doch der Mann am Steuer des alten Vorkriegs-Opel P 4 ist nicht der Typ, der, wo und wann auch immer, ein hübsches Mädchen übersähe.
Cynthia wird bewußt, daß der Fahrer ein Deutscher sein muß; ihr ausgestreckter Arm sinkt klamm nach unten.
In ihrer Lage kann man sich den Helfer nicht erst aussuchen, aber jetzt fallen ihr die Werwolf-Räubergeschichten wieder ein, und tatsächlich haben ja – noch im Krieg – Unverbesserliche den in Aachen von den Amerikanern eingesetzten deutschen Bürgermeister ermordet.
Der Wagen hält; ein junger, hochgewachsener Mann steigt aus, betrachtet die Amerikanerin eher herausfordernd als devot, lächelt zufrieden und kennerisch. »Hello, Miss«, sagt er mit auffallend melodischer Stimme und deutet dann auf den Jeep mit der geöffneten Motorhaube: »You have trouble with the car?« Er kratzt sein bescheidenes Schulenglisch zusammen. »Is it the engine which doesn’t work?«
Die Amerikanerin nickt.
»Can I give you a hand?« fragt er.
»Maybe«, erwidert die Wartende.
Es soll abweisend klingen, doch es hört sich erleichtert an.
Der Unbekannte beugt sich über den Motor, dreht sich wieder zu der alliierten Augenweide um. »By the way – my name is Charly«, stellt er sich vor, seinen Namen wie ein Programm nennend. Aber nichts ist der Amerikanerin im Moment gleichgültiger als der Name des Pannenhelfers.
Er betrachtet die Innereien des Militärfahrzeugs mit dem weißen Stern, geht zu seinem alten Karren zurück, holt Werkzeug. Er untersucht die Zündspule, die elektrischen Zuleitungen, schraubt die Kerzen heraus, reinigt sie, setzt sie wieder ein, versucht den Jeep anzulassen. Der Starter funktioniert, der Motor nimmt einen schwächlichen Anlauf, spuckt und stirbt gleich wieder.
»Perhaps there is dirt in the carburettor«, stellt er fest.
Charly schraubt den Luftfilter ab, um ihn zu säubern. Er hantiert mit geschickten Händen. Cynthia stellt es fest und betrachtet dann von der Seite das Gesicht ihres Pannenhelfers. Daß der Mann ihr gefällt, mißfällt der Generalstochter. Er sieht wirklich prächtig aus, ist gut gewachsen, wirkt sportlich und adrett. Sichere Bewegungen, dunkle Haare mit einem blauschwarzen Metallschimmer, gewellt und vorteilhaft geschnitten, dazu unbekümmert leuchtende Augen in einem ganz bestimmten Blau.
Der Helfer schraubt den Vergaser wieder zusammen, fordert Cynthia mit einer Geste auf, sich ans Steuer zu setzen und den Anlasser zu betätigen. Er ist in Ordnung, aber der Wagen springt nicht an, und die ersten deutschen Worte, die die Zwanzigjährige aus dem Mittelwesten auffängt, sind ein paar handfeste Flüche.
Charly fummelt noch eine Weile am Motor herum und prüft die Benzinzufuhr; die Leitung ist nicht verstopft. »Did you get the gasoline from the US Army gas-station?«
Cynthia schüttelt den Kopf. »From the can«, antwortet sie und deutet auf den Kanister, aus dem sie nachgefüllt hatte. In einer Pantomime demonstriert der WAC-Leutnant, daß der Motor zuerst gespuckt und gestottert habe und dann ganz stehen geblieben sei.
»I’m sorry, Miss«, sagt Charly und zuckt bedauernd die Schultern. »But I’m sure, there is a lot of water in the tank.« Er sieht in das erschrockene Gesicht des Lieutenant Macomber. »Black market gasoline?« fragt er.
»Never«, versetzt Cynthia entrüstet. »Regular gas.«
Der Helfer lächelt mit wissender Überheblichkeit. Mit diesen Alltagsgeschäften kennt er sich aus. Eine dreckige Hand wäscht die andere, und so bleiben sie alle schmutzig. Deutsche Diebe hätten den Reservekanister wohl gleich ganz geklaut, um ihr Risiko zu amortisieren, Polen oder andere Hilfswillige der Amerikaner in den schwarzgefärbten Uniformen vielleicht nur die Hälfte des Inhalts und dann, um nicht aufzufallen, den Kanister wieder mit Wasser nachgefüllt. Aber auch die Militärpolizisten, die flinkhändige Hilfswillige zu bewachen haben, könnten ein Geschäft in die eigene Tasche gemacht haben: Schnaps ist selbst für alliierte Soldaten schwer zu bekommen, und mehr oder weniger schöne »Fräuleins« kosten Geld.
Charly betrachtet die Enttäuschte, fragt, wohin sie eigentlich will. Cynthia versteht ihn nicht gleich.
»How far is it to Garmisch-Partenkirchen?« fragt sie dann nach dem berühmten Wintersportort.
»About fifteen kilometers, but it’s a terrible road.«
»What shall I do?«
»There are two possibilities«, entgegnet der Mann mit den schräg geschnittenen Augen und dem energischen glatten Gesicht und deutet mit zwei Fingern an, daß es für sie zwei Möglichkeiten gebe, an das Ziel zu kommen. »I can give you a lift«, sagte er und bedeutet Cynthia, in seinen Opel einzusteigen. »I’m going to Garmisch also, you see we’ve the same way.«
»No, thanks«, lehnt sie ab. »What about the second chance?«
Ohne zu antworten durchsucht Charly den Jeep, schnappt sich ein Abschleppseil. Dann setzt er seinen P 4 vor Cynthias Gefährt, verbindet die beiden Wagen mit dem Seil, fordert sie mit einer Kopfbewegung auf, in den Jeep zu steigen. Er steuert seinen Wagen, würgt beim ersten Versuch den Motor ab, doch dann klappt es schlecht und recht.
Sie kommen voran, langsam, doch stetig. Ein Jeep ist viel zu schwer für einen kleinen Vorkriegs-Opel, aber auf ebener Strecke klappt es halbwegs, solange Charly im zweiten Gang fährt. Kritisch wird es erst, wenn die Straße ansteigt. Zweimal kommt er mit Vollgas im ersten Gang durch; beim dritten Versuch, kurz vor Garmisch, kocht das Kühlwasser, und Charly muß anhalten. »It’s terrible«, sagt er und deutet auf die Dampfwolke, die aus seinem Kühler zischt. »We must wait.« Tröstend setzt er hin zu: »Only a few minutes.«
»I’m really in a hurry«, entgegnet Cynthia.
In Eile ist Charly auch. Er hat sich den Wagen bei einem Bekannten der Münchener Stadtverwaltung ausgeliehen und die Fahrgenehmigung selbst ausgestellt. Im Kofferraum liegt ein schwarzgeschlachteter und bereits in Portionen zerlegter Hammel, den er für Zigaretten bei einem Bauern erworben hat. Mit dem Fleisch will er bei einem Schwarzbrenner Fusel eintauschen. Für den Schnaps wird er von einem US-Sanitätssergeanten Insulin erhalten. Dieses lebensnotwendige Medikament, in einem US-Hospital auf die Seite gebracht, benötigt er zu einem Teil für eine alte Tante, eine schwere Diabetikerin, seine einzige Verwandte, einen zweiten Teil wird er über den Bekannten, von dem der P 4 stammt, als Leihgebühr zur Weitergabe an ein Städtisches Krankenhaus abgeben und den Rest dann auf dem Schwarzmarkt verscheuern, um auf Selbstkosten nebst Gewinn zu kommen. Charly ist ein redlicher Amoralist – wenigstens hält er sich dafür.
»Patience«, bittet er. Er setzt sich an den Straßenrand und bedeutet der Amerikanerin, sich neben ihn niederzulassen. Nach kurzem Zögern folgt sie seinem Beispiel, wenn auch in einem Zwei-Meter-Abstand. Er bietet Cynthia eine zweite Zigarette an; sie weist sie zurück und ärgert sich im nächsten Moment genauso darüber wie über die Annahme der ersten. Als hätte es ihr Begleiter erfaßt, drängt er ihr den Glimmstengel auf, und diesmal greift die Amerikanerin zu – sie kann ihm ja bei Gelegenheit die Zigaretten wieder zurückgeben.
Charly betrachtet ungeniert ihre Beine; es gibt nichts daran auszusetzen, auch in der Uniform steckt eine ordentliche Portion Frau, genug jedenfalls, daß bei ihm der verdammte männliche Automatismus anspringt. Aber bei einem weiblichen Offizier der US Army trägt, acht Wochen nach der Kapitulation, selbst ein Mann wie Charly den Hintern zu tief unten. Unter anderem gehört es zu seinem Erfolgsrezept, sich nicht an Vertreterinnen des schönen Geschlechts heranzumachen, bei denen er nicht landen kann. Die erste Amerikanerin, der er seit dem Einmarsch der US-Truppen näher begegnet, ist auch die reizvollste; jung, appetitlich, unbekümmert, womöglich unberührt, Neuland, das ihm versagt bleibt. Zu seinem Bedauern muß Charly auf seine bewährte Annäherungstour verzichten, auf die er sich sonst so prächtig versteht. Er weiß, wie man ein Mädchen nimmt und eine Frau hält. Die Kunst des Werbens und Verführens beherrscht er aus dem Effeff, das einzige Fach, in dem er brilliert und keine Schwächen zeigt, Charme aus dem Handgelenk.
Sonst hat er in seinem fünfundzwanzigjährigen Leben, außer etwas Latein und Altgriechisch, nicht sehr viel gelernt. Auch sein Englisch besserte sich nicht, seit er mit noch nicht ganz siebzehn von der Penne flog, weil man ihm allzu vertrauten Umgang mit der Frau des Lehrers für moderne Sprachen vorwarf. So fein hatte die Erziehungsanstalt umschrieben, daß er sich von Frau Potiphar hatte verführen lassen und dabei kein keuscher Josef geblieben war.
Er kam aus der Schule des Büffelns in die Schule des Lebens, wurde als Rekrut auf Schießen und Töten gedrillt, auf Bettenbau und Staubverteilung, auf Organisieren und Überleben, in direkter oder auch unreiner Gangart.
Der P-4-Wassertank hat sich abgekühlt.
Charly bemerkt, daß kaum noch Dampfwölkchen aus dem Motorraum hervorquellen. »Just a moment more«, vertröstet er die selbstsichere Amerikanerin, die jetzt weniger reserviert wirkt und weder Angst noch Verachtung zeigt. Für einen Deutschen ist dieser Mann ein Ausnahmemensch, stellt Cynthia fest. Er hat kein schmutziges Hemd. Er trägt keine Wehrmachthose. Er zeigt keinen Hunger. Er jammert nicht über die erbärmlichen Verhältnisse, in denen er leben muß, und er beteuert nicht, daß er kein Nazi war, und deutet auch auf keinen anderen, der einer gewesen sein soll. Dieser Bursche gibt sich, als gehe ihn das alles nichts an, als sei er aus dem allgemeinen Schicksal ausgeschieden.
»What do you do? I mean what’s your profession?« fragt sie den Helfer.
»I’m a business-man«, behauptet Charly.
»What kind of business?« fragt sie.
»Allround«, entgegnet er. »Every kind of business –«
Die Amerikanerin erfaßt, daß es eine geschönte Umschreibung für Schwarzhandel sein muß.
Charly bleibt für weitere Erklärungen keine Zeit. In einer halben Stunde wird es dämmern. Der Sonnenuntergang wirft schon die ersten Schatten voraus. Bei Eintritt der Dunkelheit werden die Luftschutzsirenen heulen, dann dürfen Deutsche nicht mehr aus dem Haus: Curfew. Sperrstunde. Wen die MPs dann auf der Straße antreffen, sperren sie ein, nicht nur bis zum nächsten Morgen wie andere Deutsche, die in ihren Häusern kaserniert werden. Bei Verstößen gegen die Bestimmungen der Besatzungsmacht kann ein US-Schnellgericht ein paar Monate Haft verhängen. Gleich nach dem Krieg sind die Strafbestimmungen noch streng und werden schroff gehandhabt.
Für die GIs sind alle Privatgespräche mit den Besetzten verboten, auch mit deutschen Frauen, auch mit ihren Kindern. Ganz besonders aber mit den »Fräuleins«. »No fraternization!« lautet das Schlagwort, keine Verbrüderung. Soldaten, die sich nicht daran halten, sind mit 65 Dollar Strafe bedroht, für jeden Einzelfall. So betrachtet könnte die US Army seit dem Einmarsch täglich Millionen von Dollars von ihren Soldaten kassieren, aber auch beim amerikanischen Militär gilt die deutsche Landserweisheit, daß Befehle dazu da sind, um umgangen zu werden. Wenn schon die Vernunft keine menschlichen Brücken schlägt, dann wenigstens der Geschlechtstrieb animalische.
Eine Viertelstunde später erreicht der alte Opel mit dem Jeep im Schlepptau die Ortseinfahrt von Garmisch.
Charly hält vorsichtig an, springt aus dem Wagen. »Wohin?« fragt er die Amerikanerin. »Where do you want to go?«
»Hotel Alpenhof«, nennt Cynthia die von der Militärregierung beschlagnahmte Luxusresidenz. Es ist keine Reklame für die US Army, wenn sie mit dem Jeep, abgeschleppt von diesem lächerlichen deutschen Gefährt, dort ankommen wird. Aber wenn man ihr schon in einem Armeedepot verwässertes Benzin andreht und sie so in die Bredouille bringt, dann will sie den hohen Offizieren die Schweinereien ruhig einmal vorführen.
»Gentlemen«, poltert der Panzergeneral Brian M. Macomber im Konferenzraum des beschlagnahmten Ersten Hauses am Ort los, »können Sie mir vielleicht sagen, wozu wir diesen Krieg gewonnen haben? Wissen Sie, wofür wir unsere Soldaten ins Feuer gehetzt haben und wozu der US-Steuerzahler 240 Milliarden Dollar für den Sieg ausgegeben hat, wenn jetzt dieser Bastard Stalin die Raubpolitik der Nazis fortsetzt?«