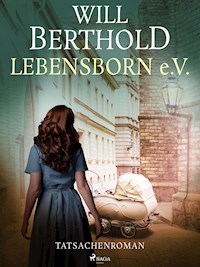Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Inferno
- Sprache: Deutsch
Im letzten Band der "Inferno"-Trilogie beschäftigt sich Will Berthold eingehend und ebenso anschaulich wie in den beiden ersten Teilen mit den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs: Die Geschehnisse zwischen 1942 und 1945 stehen hier im Mittelpunkt, genauer gesagt der Kampf um Stalingrad bis zur bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht im Mai 1945. Auf Grundlage von Fakten sind es neben den gut dokumentierten Stationen auch die Einzelschicksale, die den Schrecken des Krieges verdeutlichen.In seiner aus drei Bänden bestehenden "Inferno"-Serie beschreibt Will Berthold sehr eindringlich aus eigener Erfahrung als ehemaliger Soldat die Gräuel des Zweiten Weltkriegs. Er hatte sich bei Kriegsende geschworen, einen Beitrag zu leisten, dass solch ein Krieg nie wieder geschehen würde und entschied sich dabei für die Schriftstellerei, mit der er viele Menschen erreichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Inferno. Finale - Tatsachenroman
Saga
Inferno. Finale - TatsachenromanCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1984, 2020 Will Berthold und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726444674
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Die verratene Armee
Manche singen noch, den meisten ist es längst vergangen. Ihre Gesichter sind verbrannt, rotgerändert ihre Augen; sie haben sich Taschentücher um den Mund gebunden und schlucken doch pausenlos Staub. Das in ihren Feldflaschen schwappende Wasser ist eine widerwärtige und dennoch kostbare Brühe, denn die Russen haben auf dem Rückzug die wenigen Wasserstellen verseucht. Tag für Tag und Stunde um Stunde schleppen sich die Infanteristen über das verdorrte Gras, Richtung Osten, einem Horizont entgegen, der mit ihnen wandert, vorbei an frisch ausgehobenen Soldatengräbern und ausgebrannten Panzerwracks. Ihre Gedanken veröden in der weglosen Steppe, ihre Augen trocknen aus. Sie stolpern vorwärts wie einst Xenophons Griechen, und die Wolga ist ihr »Thalatta«.
Der lange Metschke, der Läusetöter, kratzt sich nicht mehr. Dem Gefreiten Staudigel, den sie Schweinigel nennen, gehen die Zoten aus. Der kleine Grigoleit kann sich nur noch gebückt anschieben. Der stille Lipsky schnauft wie eine Dampflokomotive, und Pranner, der bewährte Minnesänger, gibt nicht einmal mehr in den kurzen Marschpausen damit an, wie viele Tatjanas, Olgas, Katjas und Marussjas er in Stalingrad aufreißen wird, wo es Hunderte von Beizen und Nahkampfdielen geben soll.
Der sture Ondruschka, ein breitschultriger, breitbeiniger Breslauer, knallt mit dem Gesicht ungebremst in einen Haufen Pferdescheiße. Er rappelt sich wütend hoch, Gaulsmist und Fuhrmannsflüche spuckend. Keiner lacht mehr, jedem ist das schon passiert, und keiner kann sich mehr wundern, daß ihm in dieser alles verdunstenden Hitzehölle noch das Wasser im Arsch kocht, wie es die Kasernenhofschreier in der Heimat angedroht hatten.
Kein Lufthauch rührt sich. Seit Wochen hat es nicht mehr geregnet. Die vormals motorisierten Verbände der 6. Armee – sie hatten bei Dünkirchen die Briten ins Meer geworfen und später die Ukraine erobert – sind im Hochsommer 1942 auf rund 250 000 Hafermotoren angewiesen, auf belgische Kaltblüter und kleine russische Panjepferdchen, die mit ihren Äpfeln den Weg markieren. Von den Rotarmisten ist nichts zu sehen; sie weichen zurück, planmäßig und geordnet. Die Angreifer stoßen fast immer ins Leere, sie erbeuten Land, aber keine Ausrüstung, keine Panzer, keine Geschütze. Stalin hat für diesen Sommer eine elastische Kriegsführung propagiert und setzt die Weite und Tiefe des Raumes bewußt als Waffe ein. Die Front im Osten reicht nunmehr vom Eismeer bis zum Kaukasus, das entspricht annähernd der Entfernung von Frankfurt nach New York, doch die dezimierten deutschen Einheiten rücken weiter vor, abgekämpft, ausgelaugt, erschöpft. Tag für Tag und Schritt für Schritt ziehen Mensch und Kreatur durch die Kalmückensteppe in die längste und blutigste Schlacht der Militärgeschichte.
»Kurze Marschpause!« ruft Oberleutnant Pletzko; seine sonst so forsche Stimme klingt jetzt auch nur noch piano.
Einige seiner Leute lassen sich einfach umfallen; andere versuchen sich mit den Zeltplanen gegen die stechende Sonne abzuschirmen und greifen dann nach der Zigarette, die wie Stroh brennt.
»Pfui Teufel«, schimpft Pranner, »in diesem Scheißland verdunstet auch noch der Tabak.«
Er betrachtet Metschke, den Lulatsch, der wieder anfängt, sich mit beiden Händen zu kratzen. Fast jeder holt sich hier früher oder später Läuse, aber der geplagte Mecklenburger muß für das Ungeziefer eine wahre Delikatesse sein – sein Körper ist von oben bis unten rot von Läusebissen und Kratzwunden.
»Die Sache ist die«, doziert der kleine Grigoleit, im Zivilberuf Schulmeister, wieder einmal, »unser Kumpel hat auch noch Kopfläuse. Und fragt mich nicht, wie die sich vermehren: Ein Weibchen bringt in acht Wochen fünftausend Nachkömmlinge zur Welt, eine ganze Plantage, ein einziges Weibchen.«
»Halt’s Maul, Arschpauker!« schimpft der Lange.
»Und diese Biester sind unheimlich resistent«, fährt der kleine Grigoleit ungeniert fort. »Die wechseln die Farbe je nach Ernährer: Bei den Chinesen sind sie gelb, bei den Eskimos weiß und bei den Negern schwarz.«
»Und beim langen Metschke vollzählig«, albert Pranner. »Der hat noch mehr zu bieten als Kopf- und Kleiderläuse, ich glaub’, der hat sogar noch Sackratten.«
»Matrosen am Mast?« blödelt Staudigel interessiert.
»Hoffentlich hat er nicht das Cuprex ausgesoffen«, unkt Ondruschka.
Der Lulatsch verstärkt stumm seine Abwehrbewegungen. Er ist verseucht von oben bis unten, die Haut gerötet von winzigen Bißwunden. Trotzdem rücken die Kumpels nicht von ihm ab, seitdem sich das Gerücht verbreitet hat, sein Blut wirke so anziehend auf das Geschmeiß, daß die eigenen Untermieter auf ihn überspringen würden.
»Wie weit ist es denn noch bis Stalingrad, Herr Oberleutnant?« riskiert Lipsky eine Lippe.
»Ganz nah, Mann«, behauptet der Offiziert. »Ich riech’ schon die Wolga.«
»Ich riech’ bloß, daß die Kameraden stinken wie die Waldesel«, murmelt Pranner, der Minnesänger.
Was sich Bataillon nennt, ist höchstens noch eine Kompanie, verstärkt durch einige Gebirgsjäger, die auf dem Vormarsch zum Kuban-Knie ihren Haufen verloren haben und jetzt bei der 29. motorisierten Division mithumpeln. Die Kampfwagen, über die die eigentliche Eliteeinheit noch verfügt, sind vorne an der Spitze. In großem Abstand folgen die Fußlappengeschwader mit ihren Pferdewagen, beladen mit Munition, Proviant und maroden Infanteristen, die, Blasen an den Füßen, Wolf zwischen den Arschbacken, selbst angetrieben nicht mehr laufen können.
»Du hast’s gut«, giftet Staudigel den grinsenden Obergefreiten Schiller an, der zwischen Benzinkanistern und Tubenkäse gewissermaßen erster Klasse in den Angriff rollt; der Berliner hat die landesüblichen Leiden auf einmal und dazu noch eine fiebrige Sommergrippe.
»Ooch keen Vergnügen«, brummelt der Patient. »Hab’ ständig die ollen Blechdinger im Kreuz.«
»Die Prinzessin auf der Erbse«, albert Ondruschka.
Schiller sieht sich nach allen Seiten um. »Looft ja alles janz jut«, sagt er, »aber unsere Panzer sind viel zu weit vorne, was machen wa, wenn der Iwan aus der Flanke angreift?«
»Du betest, und wir schießen«, erwidert Pranner, der Minnesänger. »Mal sehen, wer’s weiterbringt.«
»Außerdem sichern an den Seitenflügeln rumänische und ungarische Einheiten«, schaltet sich Pletzko ein. »Ganze Divisionen.«
»Aber die Rumänen und Ungarn sind doch Erbfeinde, Herr Oberleutnant«, macht sich Grigoleit, der Arschpauker, wieder wichtig.
»Deshalb wurden ja Italiener zwischen die feindlichen Balkanbrüder als Friedensstifter geschoben«, erläutert der Offizier.
»Um Gottes willen«, entgegnet Staudigel. »Die Itaker haben doch mehr Gitarren dabei als Maschinengewehre.«
»Gitarren klingen auch besser«, stellt Lipsky fest, aber er kommt nicht weit mit seinen musikalischen Vergleichen.
»Ich halt’ das nicht mehr aus«, schimpft Metschke und wälzt sich im Gras, als könnte er das Ungeziefer mit seinem Körpergewicht zermalmen.
»Reißen Sie sich am Riemen, Mann!« tröstet Oberleutnant Pletzko. »In ein paar Tagen sind wir in Stalingrad, und da gibt es sicher ’ne prächtige Entlausungsstation.«
»In ein paar Wochen vielleicht«, brummelt Pranner. »Bis dahin haben die Biester den armen Hund aufgefressen.«
»Wenn wir am Ziel sind, lass’ ich Sie ins Lazarett schaffen«, verspricht der provisorische Bataillonskommandeur. »Sind wir mit den verdammten Iwans fertig geworden, werden wir schließlich ihre Ableger auch noch schaffen.«
Pletzko sieht mechanisch zum Horizont: Riesige Staubsäulen markieren den deutschen Vormarsch nach Stalingrad, aber was jetzt aus dem Süden auf sie zukommt, sieht beinahe wie ein Sandsturm aus.
»Achtung!« brüllt der Oberleutnant. »An die Spritzen, Männer!
Die meisten haben bereits ohne Kommando reagiert. Hier in diesem gottverlassenen Land muß man auf alles gefaßt sein. Die deutschen Panzerspitzen sind weit voraus, zwischen den seitlichen Sicherungen klaffen gewaltige Lücken. Die Fußlappengeschwader können nicht rasch genug aufrücken. Und überall lauern auch noch Partisanen.
»Erst schießen, wenn ich es befehle«, sagt der Kompaniechef und preßt das Glas an die Augen. »Laßt sie ruhig herankommen.«
Die Nachbareinheit feuert bereits, aber Oberleutnant Pletzko wartet, bis sich die Konturen der Angreifer aus den Staubwolken abzeichnen. Sie kommen aus der Sonne, sie kleben wie verwachsen auf den Pferderücken, ihre Säbel blitzen. Ein irrsinniges Bild: die Attacke einer Kosakenschwadron mitten in die Läufe deutscher MGs und Kanonenmündungen. Im ersten Moment fürchten die Infanteristen eine Ausgeburt der Hitze, eine Fata Morgana. Dann hören sie das Wiehern der Pferde, den gedämpften Rythmus der Hufe und nehmen die herangaloppierenden Selbstmörder ins Visier.
Ondruschka zieht den Schaft seines MGs tief in die Schulter. Lipsky, sein Schütze eins, versucht in die Erde zu schlüpfen wie ein Regenwurm.
»Die sind so wahnsinnig wie die Polacken anno neununddreißig«, ruft Pranner und nimmt Maß. »Feuer frei!« befiehlt Oberleutnant Pletzko.
Die ersten Garben fetzen in die vordere Reihe, mähen Reiter und Pferde nieder, aber die ihnen folgenden Kosaken stürmen stur weiter in den Tod, keine Schwadron mehr, eine ganze Brigade jetzt. Es ist, als würden sich die toten Reiter und die zerfetzten Pferde von der Walstatt erheben und erneut zum Sturm antreten, sie kommen immer näher heran, wie die Reiter des Dschingis-Khan, die mit ihren Krummsäbeln die modernen MG 42 vernichten wollen.
Die Artillerie, offensichtlich durch Sprechfunk alarmiert, greift ein. Bereits die ersten Salven liegen gut. Die nächsten krepieren mitten in den Reihen der Verwegenen. Pferde brüllen. Menschen schreien. 100 Meter vor dem dezimierten Bataillon bricht die erste Attacke zusammen, wälzen sich Menschen und Tiere im Knäuel auf der trockenen Erde, die das Blut sofort aufsaugt.
Die Verschnaufpause ist kurz und trügerisch. Neue Reiterverbände preschen heran, teilen sich. Während das Gros die Infanteristen frontal attackiert, versuchen die anderen Reiterscharen über die Flanken in den Rücken der Deutschen zu gelangen. Trotz furchtbarer Verluste kommen sie heran, bis auf 70, 80 Meter, aber das ist noch lange keine Säbeldistanz. Aus den Augenwinkeln beobachtet Metschke, wie sich sein Kumpel Schiller, das heulende Elend, hochrappeln will. »Bleib liegen, du Armleuchter!« ruft er ihm zu. »Das schaffen wir auch ohne dich.« Er nimmt einen Zielwechsel um 180 Grad vor, die Kosaken reiten jetzt gegen die Sonne, greifen die ungeschützte Stellung von hinten an.
Das MG fetzt die vorderen Angreifer vom Pferderücken. Die Tiere wiehern, galoppieren weiter, von Furien gejagt, mit verdrehten Augen. Einen Moment lang herrscht wildes Durcheinander, es kommt zu Nahkämpfen, dann bekommen Pletzkos Männer die Situation wieder in den Griff – aber ausgerechnet Schiller, der auf dem Fuhrwerk zu pomadig nach seinem Karabiner gegriffen hatte, ist durch einen Säbelhieb der Kopf gespalten worden.
»Los«, befiehlt der Oberleutnant. »Stilles Vaterunser. Eingraben. Mit Beeilung. Wir müssen weiter.«
Einer bricht die Erkennungsmarke des Berliners auseinander. Der Staubboden bietet keinen Widerstand. Auf das Birkenkreuz müssen sie verzichten. Sie markieren das Grab mit dem Stahlhelm des Gefallenen. Während das stille Vaterunser laut wird, weil einige noch oder wieder richtig beten können, überlagern dünne Pistolenschüsse das dumpfe Gemurmel: Ondruschka und Staudigel erschießen die verwundeten Pferde.
»Mensch«, sagt der sture Ostpreuße und zeigt auf eine nur leicht verwundete Stute. »Die hat nur einen Streifschuß.« Er hilft dem verstörten Tier auf die zitternden Beine. »Die nehm’ ich mit.« Er streichelt die struppige Mähne. »Wie heißt du denn?«
»Blödmann«, krakeelt Staudigel, »was soll denn der Quatsch?«
»Ich nenn’ dich einfach Paula«, fährt der sture Tierfreund fort. »Und wenn wir erst mal in diesem Scheiß-Stalingrad sind, kriegste Hafer und Würfelzucker, so viel du willst.«
»Fertigmachen zum Abmarsch!« befiehlt Oberleutnant Pletzko, und Ondruschka hängt das Kosakenpferd an das Heck des Panje-Fuhrwerks, das um die Last des gefallenen Obergefreiten Schiller leichter geworden ist.
Mit gesenkten Köpfen, gleichermaßen gequält von der Hitze, trotten Menschen und Tiere in Richtung Wolga, vorbei an Pferdekadavern, an toten und sterbenden Kosaken in verrenkten Stellungen. Myriaden von Fliegen, die den Abend nicht abwarten, lassen sich auf ihnen nieder.
»Los, Beeilung!« treibt Pletzko seine Leute an.
Ein brutheißer Sommer war im Osten einem katastrophalen Winter gefolgt. Seit dem 28. Mai 1942 hatten die deutschen Divisionen wieder angegriffen und waren bei Charkow mitten in einen sowjetischen Gegenangriff gestoßen. Die Blitzkriegtechnik hatte sich noch einmal durchsetzen können. Die Sowjets mußten gewaltige Verluste an Menschen und Material hinnehmen.
Ungeduldig wartete Hitler auf die Eroberung der Halbinsel Krim. Generalfeldmarschall von Manstein belagerte die Festung Sewastopol. Die Erbitterung und der Todesmut, mit dem die Russen Fort um Fort verteidigten, ließen darauf schließen, daß sie mit den Rotarmisten des Vorjahrs nicht mehr zu vergleichen waren. Sewastopol mußte förmlich in Stücke geschossen werden. Ende Juni meldete zum Beispiel das Artillerieregiment 22 den Abschuß der hunderttausendsten Granate.
Trotzdem kamen die Belagerer nur schrittweise voran. Deutsche Artillerie setzte 2 200 Kilo schwere Betongranaten ein, die aus dem Lauf eines 61,5-cm-Mörser-Monsters kamen. Das größte Kaliber hatte der »Schwere Gustav«, ein Ungeheuer, das auf 60 Eisenbahnwagen herantransportiert und zusammenmontiert worden war. Das Rekordgeschütz konnte aus einem 32,5 Meter langen Rohr 5-Tonnen-Granaten fast 50 Kilometer weit feuern, 3 Schuß pro Stunde. Über 4000 Artilleristen waren nötig, das auf zwei Doppelgleisen angefahrene Ungeheuer zu bedienen und zu warten. Mit einer Granate hatte der »Schwere Gustav«, offiziell »Dora« genannt, einen 30 Meter unter der Erde lagernden Munitionsbunker in die Luft gejagt.
Am 2. Juli fiel der sowjetische Brückenkopf Sewastopol und damit die stärkste Festung der Welt: 90 000 Rotarmisten gerieten in Gefangenschaft. Tausende von Gefallenen lagen auf der Walstatt. Die Eroberer erbeuteten 467 Geschütze, 758 Granatwerfer und 155 Paks. Die ganze Krim war nunmehr in deutscher Hand, womit die Südflanke zunächst als abgesichert galt. Nach der ersten Juliwoche hatten die Invasoren die Sowjets zwischen Don und Donez zurückgedrängt. Das Gros der deutschen Angriffsspitzen näherte sich Anfang August von Norden, Süden und Westen Kaiatsch, hinter dem die 100 Kilometer tiefe Kalmückensteppe liegt.
Ein ideales Gelände für Panzerverbände, für schnelle Vorstöße und Durchbrüche, für Zangenbewegungen großen Stils nach bewährtem Blitzkriegmuster. Aber Hitlers Weisung Nummer 45 vom 23. Juli 1942 hatte die durch Verluste längst halbierte Heeresgruppe Süd noch einmal geteilt und massive Panzerverbände für den Sturm auf die Ölfelder Transkaukasiens abgezweigt.
Die motorisierten Einheiten des Generalobersten Friedrich Paulus – dessen 6. Armee nunmehr das Gros der Heeresgruppe B stellte, während die abgezogene Heeresgruppe A über Rostow weiter nach Südosten vorstieß – mußten ihre Spritreserven für die abenteuerliche Operation abgeben und wurden auf den Nachschub vertröstet.
Aber selbst noch die nunmehr gevierteilte Heeresgruppe Süd mußte einen weiteren Aderlaß hinnehmen. Der Vorstoß zu den Ölfeldern setzte voraus, daß zuvor der Kaukasus erobert wurde. Mitten in der Schlacht zog Hitler 5 Divisionen und den Generalfeldmarschall Erich von Manstein zur Belagerung Leningrads ab. Als die Anglo-Kanadier einen verunglückten Vorstoß nach Dieppe wagten, verlegte der Führer und Oberste Feldherr, eine Invasion am Kanal befürchtend, zwei weitere Elitepanzerdivisionen nach Westen: die »Leibstandarte« und »Großdeutschland«.
Die überdehnte Front stellte die Versorgungseinheiten vor unlösbare Probleme. Die Schienenstränge waren hoffnungslos verstopft, durch einen 2000 Kilometer langen Stau, der bis nach Schlesien reichte; und hier, in Feindesland, waren Munition, Proviant und Post gestrandet und kamen verspätet oder überhaupt nicht in die täglich voraneilende Hauptkampflinie.
Die Partisanen waren jetzt weit mehr als eine Plage und ein Störfaktor; sie stellten eine ernsthafte Bedrohung dar. Ihre Anführer, trainiert und mit Haß munitioniert, wurden aus Sowjetflugzeugen abgesetzt und mit Vollmachten über Leben und Tod ausgestattet. Flugzeuge der plötzlich unglaublich erstarkten sowjetischen Luftflotte warfen laufend Waffen, Munition und Proviant ab.
Auf endlosen, nur notdürftig abzuschirmenden Gleisanlagen und auf abgelegenen Stützpunkten kam es nunmehr in jeder Woche zu etwa 200 Anschlägen, die mit furchtbarer Härte vergolten wurden: Für einen deutschen Soldaten hängte man zehn russische Partisanen – oder was die örtlichen Jagdkommandos für solche erklärten, Männer wie Frauen. Und für zehn hingerichtete Partisanen metzelten die plötzlich auftauchenden Untergrundgruppen wiederum eine Vielzahl deutscher Soldaten nieder.
Gefangene wurden nicht gemacht. Auf keiner Seite. Eine einfache Erschießung oder Erhängung war für die Todeskandidaten noch ein Glücksfall. Oft wurden Überfallene mit ausgestochenen Augen, abgeschnittenen Nasen und dem Geschlechtsteil im Mund aufgefunden. Ein schweinischer Krieg uferte in die letzte Gemeinheit aus, wobei keine Seite der anderen etwas schuldig blieb.
Selbst Zivilisten, die Stalin bisher feindlich gegenübergestanden hatten, schlossen sich jetzt den Untergrundverbänden an. In der Ukraine wiederum gab es bunt zusammengewürfelte Einheiten, die unter Anführung von Priestern gleichermaßen die feldgrauen Besatzer wie die kommunistischen Partisanen angriffen. Mord, Folter und Verstümmelung tobten sich über Tausende von Kilometern aus. Jagdverbände wie die Brigade Dirlewanger, ein Haufen Krimineller ohne Eid und ohne Sold, töteten, was ihnen vor die Gewehrläufe kam. Und die Partisanen schlugen genau so erbarmungslos zurück. Es schien, als wäre es Stalin und Hitler in gemeinsamer Anstrengung gelungen, Gott abzuschaffen.
Die bei Beginn der Sommeroffensive 800 Kilometer lange Südfront war dabei, eine Ausdehnung von mehr als 4000 Kilometern zu erreichen, weil Hitler die Ölgebiete um Baku und Tiflis und die Wolga-Metropole Stalingrad gleichzeitig erobern wollte. Dazu hätte er nach Meinung von Experten mindestens doppelt so viele Soldaten, dreimal so viele Panzer und viermal so viele Flugzeuge benötigt, und dazu noch den Treibstoff, der erst am Kaspischen Meer erobert werden sollte. Zwar hatten inzwischen die Angriffsspitzen im äußersten Süden die Ölfelder von Maikop genommen, aber sie waren zuvor von der Roten Armee unbrauchbar gemacht worden.
Der Vorstoß nach Asien – bei gleichzeitigem Angriff auf Stalingrad – war überstürzt und wahnwitzig: Zur Orientierung des Generalstabs über den Kaukasus diente zum Beispiel eine Straßenkarte aus dem Jahre 1926. Hitlers Generäle warnten; sie taten es verhalten, halbherzig. Wenn sie sich doch ermannten, wurden sie abgelöst, wie zum Beispiel der Generaloberst Franz Halder. Der Diktator tat Einwände mit der Behauptung ab, die Generalstäbe neigten grundsätzlich dazu, den Feind zu überschätzen.
Der Mann, der sich im Reichsrundfunk als den »Größten Feldherrn aller Zeiten« feiern ließ, – was ihm hinter seinem Rücken den Spottnamen »Gröfaz« einbrachte –, war, nach dem winterlichen Fiasko vor Moskau, berauscht von seinen Sommersiegen und bereit, alle Fehler des Vorjahres zu wiederholen; er hatte den Bezug zur Wirklichkeit verloren.
»Wer ihn dennoch auf sie hinzuweisen wagte«, stellt Raymond Cartier fest, »mußte dies teuer bezahlen. Anfang September war ein General seines Kommandos enthoben worden, weil er die Ansicht vertreten hatte, der Vormarsch dürfe nur noch in begrenztem Maße fortgesetzt werden. Ein zweiter General, der für den Entlassenen eingetreten war, fiel ebenfalls in Ungnade. Der erste General war Generalfeldmarschall List, der zweite Generaloberst Jodl. Nach seiner Rückkehr von einem Auftrag im Hauptquartier der Heeresgruppe A hatte Jodl die Kühnheit besessen, Hitler ins Gesicht zu sagen, daß die Fehler, die er List zuschreibe, in Wahrheit nur die Folge von Befehlen seien, die er, Hitler, selbst erteilt habe. Der Führer bebte vor Wut. Stundenlang lief er ziellos im Wald von Winniza umher. Fortan verzichtete er darauf, seine Mahlzeiten gemeinsam mit seinen Generälen einzunehmen.«
Ohne Vorstellung von den tatsächlichen Frontbedingungen bewegte er auf den Generalstabskarten Verbände hin und her, die fast nur noch nominell bestanden. Er hatte vorübergehend sein Hauptquartier von der Wolfsschanze in Ostpreußen nach Winniza in der Ukraine verlegt, weit abgelegen von den Kämpfen. Nicht ein einziges Mal wird er während des ganzen Ostfeldzuges seine Soldaten an der Front besuchen. Was dort geschieht, läßt er sich von den zur Verleihung hoher Auszeichnungen in das Führerhauptquartier befohlenen Offizieren und Soldaten berichten. Sie erscheinen entwanzt, entlaust, frisch gebadet, sie riechen nicht mehr übel und erscheinen mit frischgeschnittenen Haaren in sauberen Uniformen, um das Ritterkreuz in Empfang zu nehmen – und so stellt sich der Diktator seine Kämpfer in der vordersten Linie vor.
Er starrt fasziniert auf die Karte: Alles will er gleichzeitig, das Öl, die Wolga und ihre Metropole, die früher Zarizyn hieß und der nach Stalins siegreicher Schlacht gegen die Weiße Armee sein Name verliehen worden war.
Die Industrieanlagen im Norden der aufstrebenden Stadt zogen sich 50 Kilometer an der Wolga entlang. Aus dem Stahlwerk »Roter Oktober«, dem Geschützwerk »Barrikade«, der Traktorenfabrik »Dserschinskij« kamen jeder zweite T 34, jeder zweite Traktor, den die Sowjetunion produzierte, sowie Gewehre, Mörser, Granaten, Katjuschas, wie die Stalin-Orgeln offiziell hießen. Die Werktätigen in den Fabriken waren als Milizionäre an der Waffe ausgebildet und von Politkommissaren politisch ausgerichtet.
In der rauchigen, verdreckten Industriestadt lebten über eine halbe Million Menschen. Quartiere der Arbeiter lagen in über 300 Wohnblöcken – die höchstens sechs Stockwerke erreichten –, die Räume zwischen den Wohnmaschinen wurden durch Parkanlagen aufgelockert. Für russische Verhältnisse galt die Metropole an der Wolga als eine aufstrebende Stadt mit Kinos, Theater, Zirkus, Schulen und dem Warenhaus »Univermag«. Die riesigen, auf der Wolga angelandeten Getreidemengen wurden in mächtigen Zementsilos gehortet.
Die Altstadt lag im Süden, wo sich die Geschäfte befanden, der Bahnhof und die Clubtreffpunkte wie das »Haus des Eisenbahners« oder das »Haus der Spezialisten«. Das Gesicht Stalingrads blickte zur Wolga, der Rücken der Industriestadt war der Steppe zugewandt. Die Metropole erreichte nur eine Breite von 3 Kilometern. Es gab keine Brücken zum Ostufer der Wolga; Fähren besorgten über Inseln das Übersetzen. Den Stadtkern bildete der Rote Platz. Die Zariza, ein Flüßchen, hatte tiefe Schluchten und Senken in das Weichbild gegraben.
Rings um die Stadt waren von der Roten Armee und von dienstverpflichteten Zivilisten – unter ihnen viele Frauen – provisorische Befestigungen gebaut worden. Stalin, Hitlers Pendant, der die STAWKA genauso beherrschte wie der braune Diktator das OKW, hatte nunmehr die Parole ausgegeben, daß Stalingrad um jeden Preis verteidigt werden müsse. Die Parole lautete: »Halten oder sterben.« Die elastische sowjetische Kriegsführung des Sommers 1942 endete an der Wolga und im Kaukasus.
Während sich die 6. Armee an Stalingrad herankämpfte, hatten Geländeschwierigkeiten, hartnäckiger Widerstand und Versorgungsengpässe den deutschen Vormarsch 60 Kilometer vor Baku zum Stehen gebracht. Die Angreifer mußten zur Verteidigung übergehen.
An der Eroberung der Sowjetunion nahmen nunmehr 264 Divisionen teil, 196 deutsche und 68 rumänische, italienische, ungarische und slowakische Divisionen auf einer 4000 km langen Front, die niemals ganz geschlossen werden konnte. Abschnitte, zu deren Streckensicherung eine ganze Division notwendig gewesen wäre, waren oft nur von einer einzigen Kompanie besetzt. Riesige Gebiete konnten überhaupt nur durch Spähtrupps kontrolliert werden. Wenn Gefahr im Verzug war, zog man einfach anderswo Alarmeinheiten ab und warf sie in die Bresche. Trotz ihrer Millionenzahl verloren sich die ausgedünnten deutschen Truppen in Rußlands riesigen Weiten.
Die Angriffe lebten von der Improvisation, von der Hand in den Mund. Die Kampfkraft war wie ein Hemd, das an allen Ecken und Enden zu kurz war; zog man es an einer Stelle in die Länge, deckte es an anderer die Blöße auf. Es war zu erwarten, daß die Sowjets, sowie sie sich gefangen hatten, in die Weichteile vorstoßen würden. Inzwischen führten russische Militärs, die das Siegen gelernt hatten. Die alten Revolutionsgeneräle – unter dem Zarenregiment oft nur Wachtmeister oder Unteroffiziere – hatte Stalin in die Wüste geschickt. Jüngere Truppenführer waren nachgerückt, die die deutsche Blitzkriegtechnik sorgfältig analysiert hatten. Sie waren in der Lage, ihr wirksam zu begegnen, und bald auch imstande, sie selbst anzuwenden.
Während die Siegesmeldungen der extremen deutschen Kriegsführung in den Äther hinausgeschmettert wurden, hatte sich bereits die Wende angebahnt: Im Norden konnte Leningrad trotz aller Anstrengungen nicht genommen werden. Im Mittelabschnitt stand die Wehrmacht in schweren Abwehrkämpfen gegen die Sowjets, die nach Schätzung von »Fremde Heere Ost« – die man Hitler zunächst nicht vorzulegen wagte – auf 790 Divisionen angewachsen waren. Zu ihrer Kampfstärke trug auch entscheidend bei, daß sich jetzt die amerikanischen Hilfslieferungen an »Uncle Joe’s« Truppen auswirkten. Vom Oktober 1941 bis zum Juni 1942 hatten die USA den Russen 1 285 Flugzeuge, 2 249 Panzer, über 8 000 Maschinengewehre, fast 40 000 LKWs und 30 Millionen Kilo Sprengstoff übergeben. Es war nur eine Vorleistung; die tatsächlichen Hilfslieferungen würden bald ein Mehrfaches erreichen. Die Sowjets forderten, und die Amerikaner zahlten – um ihre problematischen Bundesgenossen vor dem Ruin zu bewahren, machten sie aus ihnen eine Weltmacht.
Der Bewegungskrieg großen Stils tobte nur noch an der zweigeteilten Südfront Rußlands. Am 27. Juli 1942 fiel Rostow, einen Tag später erreichte die 6. Armee den Don westlich Stalingrads. Am 9. August eroberte die Heeresgruppe A die unbrauchbaren Ölfelder von Maikop. Die 4. Panzerarmee erhielt von dem Hasardeur in Winniza den Befehl, nach Norden in Richtung Stalingrad abzudrehen. Vier Tage später eroberte sie Elista in der Kalmückensteppe.
Im Kaukasus kam Hitler der Vormarsch nach Baku zu langsam voran; er übernahm – anstelle des abgelösten Generalfeldmarschalls List – selbst den Oberbefehl über die Heeresgruppe A, aber die Panzer mit dem Balkenkreuz blieben, aufgehalten von hartnäckigem Widerstand, liegen. Geländeschwierigkeiten und Versorgungsengpässe ließen 60 Kilometer vor Baku am Kaspischen Meer den Angriff endgültig zusammenbrechen. Der Traum des Gefreiten aus dem Ersten Weltkrieg und des Obersten deutschen Befehlshabers im Zweiten, über den Iran in östlicher Richtung nach Indien und südwestlich in den Vorderen Orient, womöglich bis Kairo vorzustoßen, war endgültig ausgeträumt. Hitler vergaß auch seine Feststellung, daß er ohne das kaukasische Öl den Krieg nicht mehr gewinnen könne, und flog von Winniza in sein ostpreußisches Hauptquartier Wolfsschanze zurück.
Am 7. August hatte die 6. Armee bei Kalatsch einen Brükkenkopf am Don gebildet. Westlich der Stadt kam es zu einer vier Tage anhaltenden Schlacht. Die erschöpfte, abgekämpfte Truppe stand sie mit Bravour durch. Ihre soldatischen Tugenden waren exemplarisch, aber gerade diese beispiellose Leistungskraft, die die Welt entsetzte und die sie bewunderte, führte sie letztlich in die Katastrophe.
Am 19. August befahl Generaloberst Paulus seiner 6. Armee, Stalingrad konzentrisch anzugreifen. Die Wolgametropole, über die ihr Namensgeber sechs Tage später den Belagerungszustand verhängte, sollte in südlicher und nördlicher Umklammerung genommen werden.
Vermutlich hatte Generaloberst Paulus seine Bedenken, sein Ehrgeiz jedoch war größer und seine Ergebenheit dem Diktator gegenüber grenzenlos. Für den zweiundfünfzigjährigen, hochgewachsenen Generalstabsoffizier mit dem verschlossenen Gesicht war die 6. Armee das erste Truppenkommando. Der frühere Oberquartiermeister im OKH war ein Mann nach Hitlers Geschmack; als Sohn eines mittleren Beamten provozierte er nicht den Minderwertigkeitskomplex, den der Braunauer gegenüber den blaublütigen Trägern großer Namen hatte. Paulus sollte später den in Ungnade gefallenen Generalobersten Alfred Jodl als Chef des Wehrmachtsführungsstabes ablösen, aber zunächst einmal wurde er in Stalingrad benötigt.
Am 23. August erreichte gegen Mitternacht die 16. Panzerdivision die Umgebung von Stalingrad. Die 3. Infanteriedivision humpelte fast 20 Kilometer hinter der Panzerspitze her. Die 60. Infanteriedivision lag überhaupt fest, aber die Verbände, unter ihnen die 29. Division – wie zum Hohn eine motorisierte Infanteriedivision genannt –, versuchten aufzuschließen. Nach der Blitzkriegrezeptur würden die Marschierer ohnedies als letzte an den Feind geraten: Erst Kampfflugzeuge, dann Panzer und dann die Infanterie – so hatte es immer geklappt.
Der neu ernannte Chef der 62. Sowjetarmee, Wassilij Tschuikow, vor kurzem erst abgesetzt und aus Not jetzt wieder in Stalins Gnade, kannte die Kampfweise der Belagerer und schärfte seinen Soldaten von Anfang an ein, so nahe als möglich an den Feind heranzugehen, damit ihre Kampfflugzeuge keine Bomben werfen konnten, ohne die eigenen Leute zu gefährden.
Das hieß Nahkampf, Mann gegen Panzer, Mann gegen Mann, Straße um Straße, Ruine um Ruine, bei ständigem Besitzwechsel. Es ging nicht mehr um taktische Postitionen, der Kampf in und um Stalingrad erreichte schon bald eine irrationale Dimension.
Seit am Horizont einer weglosen Steppe die ersten zerschossenen Dörfer und verwüsteten Felder aufgetaucht sind, wissen die Männer der Kampfgruppe Pletzko, daß sie Stalingrads Peripherie erreicht haben. Ein Kradmelder schält sich aus einer Staubwolke. Er holt den Oberleutnant zu einer Einsatzbesprechung beim Regimentskommandeur ab. Pletzko schwingt sich auf den Soziussitz, und Pranner mault ihm schlapp, aber zufrieden nach: »Hoffentlich bleibt der Alte gleich bis Weihnachten.«
Jedenfalls können die Erschöpften eine Verschnaufpause einlegen, und die brauchen sie auch dringend. Ondruschka geht an den Karren und streichelt Paula, das Beutepferd, steckt ihm eine Sonderration zu. Der lange Metschke schlüpft aus seinem Hemd und zeigt den geröteten und entzündeten Kriegsschauplatz auf seiner Haut vor. Der schweigsame Lipsky mustert nur stumm seine Füße, die auf einmal zu signalisieren beginnen, daß sie doch nicht ganz gefühllos sind.
»Mensch«, sagt er dann, »ich glaub’, daß wir an die tausend Kilometer getippelt sind.«
»Nicht ganz«, verbessert ihn sofort der kleine Grigoleit. »Achthundert Kilometer ungefähr, vielleicht auch noch ein bißchen mehr.«
»Wir sind ja auch noch nicht ganz da« wirft Pranner ein. »Mensch, ich glaub’, ganz Großdeutschland bewundert uns.«
»Ganz Großdeutschland kann mich am Arsch lecken, wenn ich jetzt nicht bald einmal Urlaub bekomme«, ruft der sture Ondruschka vom Wagen herüber.
»Schaut euch das an«, sagt Lipsky und deutet wieder auf seine geschwollenen Füße mit den geplatzten Blasen. »Hoffentlich müssen wir die ganze Strecke nicht zu Fuß wieder zurücktippeln.«
»Auf dem Bauch würde ich kriechen«, wirft der lange Metschke ein. »Tausend Kilometer robben, wenn’s endlich nach Hause geht, das wär’ mir egal.«
»Weißt du eigentlich, was egal ist, Kumpel?« verfällt der Gefreite Staudigel erstmals seit langem wieder in seine Schweinigel-Tour. »Egal ist«, gibt er sich selbst die Anwort, »egal ist, ob er ihn drin hat oder sie.«
Metschke ringt sich ein müdes Lächeln ab, und Pranner brummt: »Auch schon bessere Witze gehört. Mußt mal ’ne neue Platte auflegen, Schweinigel.«
Motorengeräusche am Himmel beenden den aufkeimenden Streit. Eine Rotte Me 109 fegt über ihre Köpfe hinweg, gefolgt von Nahaufklärern.
»Jetzt, wo’s auf den Feierabend zugeht, sind die aufgewacht, diese Schlipssoldaten«, räsoniert Metschke.
»Feierabend ist gut«, erwidert Ondruschka. »Daß du dich bloß nicht brennst, Kumpel. Vielleicht fängt die Scheiße jetzt erst richtig an.«
»Ach was«, erwidert Grigoleit, der Arschpauker. »Der Iwan ist doch fix und fertig. Der läuft doch bloß noch davon.«
» Aber wenn’s so weitergeht, können wir ihm noch bis China hinterher latschen, mit und ohne Gelbsucht«, sagt Staudigel. »Da wird die Welt dann schlitzäugig. Und die Chinesinnen haben die Möse quer.«
»Ach nee«, entgegnet Pranner. »Interessant. Woher weißt du das?«
Die weitere Erörterung anatomischer Anomalien erstickt im Motorenlärm; eine Staffel Stukas fliegt in 2000 Meter Höhe träge zum Angriff auf Stalingrad heran. Dahinter und darüber zwei Formationen He III. Dann die nächste Stuka-Staffel, gefolgt von den ersten Ju-88-Pulks.
»Wie beim Reichsparteitag«, schreit der kleine Grigoleit begeistert.
Und dann rauschen die ersten Bomben ins Ziel. Dumpfe Detonationen lassen die Erde beben. Zwischen den Bombenteppichen hört man die Abschüsse der Flak. Die Pferde an den Gespannen werden unruhig, wiehern, schlagen mit den Flanken aus.
»Ruhig, Paula«, sagt Ondruschka und streichelt seinem Beutetier die Kruppe. »Gleich vorbei und ganz weit weg.«
Das Kosakenpferd betrachtet seinen neuen Herrn mit großen, verdrehten Augen. Die Stute ist schon so mit Ondruschka vertraut, daß seine Stimme auf sie tatsächlich beruhigend wirkt.
Weitere deutsche Kampfverbände fliegen Stalingrad an, begegnen den abdrehenden Formationen. Ein Schwärm Lagg-Jäger mit dem roten Stern versucht, sich auf die nicht mehr ganz so geordnet fliegende Ju-87-Staffel zu stürzen, aber sofort sind die Mes zur Stelle und pauken die lahmen Krähen heraus.
Das verheerende Bombardement tobt weiter. In Stalingrad muß die Hölle los sein. Die Holzhäuser brennen wie Stroh. Volltreffer im Wasserwerk. Die Feuerwehr kann nicht mehr löschen; sie muß zusehen, wie die Flammen auf unversehrte Häuserzeilen übergreifen. Brüllende Menschen wälzen sich mit lodernden Kleidern am Boden. Gebäude brennen bis zu den Fundamenten nieder. Bald ragen aus der Trümmerwüste nur noch die gemauerten Kamine wie Findlinge aus der Steinzeit.
Die verwinkelten Straßen der Altstadt werden zu Feuerfallen. Ruinen, in deren Kellern sich die Menschen zusammendrängen, stürzen ein. Noch mitten im Bombenhagel versuchen Bergungstrupps, sie freizuschaufeln. Frauen sammeln Verwundete ein und schleppen sie auf Handkarren in überfüllte Behelfslazarette. Vom asiatischen Ufer der Wolga aus gesehen, ist Stalingrad eine einzige Feuersbrunst.
Leichter Nieselregen kommt auf, der erste seit zwei Monaten; er verwandelt die Brandstellen in Qualmwolken. Die meisten Gebäude der Gogol- und Puschkin-Straße fallen zusammen wie Kartenhäuser. An der Nordseite des Roten Platzes krepieren die Redaktionsbüros der »Prawda«. Alle Häuser brennen in der Medewditskaja-Straße, und in der weiteren Umgebung sieht es kaum anders aus. Auf dem Abhang des 110 Meter hohen Mamajew-Hügels, von dem aus man einen Panoramablick über ganz Stalingrad hat, liegen Scharen von zerfetzten Spaziergängern und Ausflüglern, die das Bombardement schutzlos überrascht hat.
Im Hafengelände platzen die Tanks. Das brennende Öl bildet auf der Wolga einen Flammenteppich, der stromabwärts treibt, auf die Kaianlagen übergreift und die Flußkanäle erfaßt. Im rollenden Einsatz starten die Kampfverbände der 4. Luftflotte fünf-, sechsmal hintereinander aus frontnahen Flugplätzen und verwandeln die Stadt in ein einziges Flammenmeer. Als die Flugzeuge mit dem Balkenkreuz am Morgen des 24. August erneut angreifen, schwebt über den Ruinen der Pesthauch von Brand und Verwesung.
Tausende von Toten liegen auf den Straßen und Plätzen, als das Inferno von neuem losbricht, in dessen Schutz sich von drei Seiten die Panzerspitzen nähern.
»Also!« ruft Oberleutnant Pletzko seinen Männern zu. »Wir schließen zu den Sturmgeschützen auf und folgen ihnen ins Gefecht. Die schießen uns den Weg frei – und dann nichts wie los. Alles wie gehabt.« Er wirft sich die MP über die Schulter und nickt seinen Männern ermunternd zu: »Auf zum letzten Gefecht!«
Schon Stunden später begreifen die abgesessenen Infanteristen der 29. motorisierten Division – und der anderen Einheiten –, daß das letzte Gefecht nur das erste ist. Es gibt keine Verschnaufpause, kein Dach über dem Kopf, keine Gefechtsruhe, noch nicht einmal in der Nacht. Die Geschwader der Luftwaffe können den Bodentruppen nicht mehr helfen, denn Freund und Feind sind oft nur auf Armlänge ineinander verkeilt. Wenn die feldgrauen Angreifer die oberen Etagen erobern, sitzen die Rotarmisten oft noch im Keller. Die Stadt muß Meter für Meter erkämpft werden, aber was die Deutschen am Tag erobern, holen sich nicht selten die Rotarmisten in der Nacht zurück.
Als die Kampfgruppe Pletzko in die Altstadt eindringt, begreifen die Männer, daß die Nahkämpfe noch wochenlang weitertoben werden.
»Was ist denn bloß mit diesen verdammten Russen los?« stöhnt der Obergefreite Pranner. »Die kennt ja keine Sau wieder.«
Sein Kumpel Lipsky gibt keine Antwort mehr. Mitten im Gespräch hob er den Kopf unvorsichtig aus der Deckung und fiel um. Kopfschuß. Einzelfeuer. Ohne Vorwarnung. Einer der sowjetischen Scharfschützen, die den Angreifern zunächst mehr Verluste zufügten als das massierte Artilleriefeuer, hatte an Stalin telegraphiert: »Die Wolga hat für uns nur ein Ufer.«
Es liegt auf der westlichen Seite, ist langgestreckt, steil abfallend. Es liegt für die Soldaten der 6. Armee im Blickfeld und ist doch uneinnehmbar, denn jede Ruine wird zur Festung, jede Straße zur HKL.
Vierzehn Tage kämpften sie auf der Stelle, um einen Haufen Trümmer. Erbarmungslos wütet der Kampf Mann wider Mann: mit Granatwerfern, Maschinenpistolen, Handgranaten, mit dem Messer. Geschützrohre brüllen. Aus jedem Rattenloch spuckt der Verteidiger feurige Knöpfe. Wenn die Raketen der Stalin-Orgeln verrauschen, foltert das gräßliche »Urräh« die Nerven. Straßen und Plätze werden von beiden Seiten mit hundertfachem Tod bezahlt.
In mehreren Schichten liegen die Toten, Deutsche und Russen, übereinander. Jeder Korridor ist ein umkämpftes Niemandsland. Über Feuerleitern und ausgebrannte Dächer setzen sich die Nahkämpfe fort. Ständig explodieren Handgranaten, Granaten wenden die Trümmerberge, die Einschläge liegen dicht beieinander, ob sie nun aus deutschen oder russischen Rohren stammen.
Weiter wütet der Nahkampf im nächsten Haus.
Die Panzer bleiben im Geröll liegen. Die Flugblätter beider Seiten verbrennen, bevor sie auf die geschundene Erde kommen. Die deutschen Infanteristen nehmen die Altstadt, aber die Rotarmisten igeln sich in riesigen Getreidesilos zwischen dem Mamajew-Hügel und dem Roten Platz ein, verwandeln sie in Bunker. Die dumpfen Explosionen in den vollgefüllten Speichern lassen die Trommelfelle platzen. Die dicken Wände aus Eisenzement halten Bomben und Granaten stand.
»Es nützt alles nichts«, sagt Oberleutnant Pletzko, »wir können uns hier von dem Scheißding nicht aufhalten lassen bis zum Jüngsten Tag.«
Für ihn ist es der Jüngste Tag. Drei Minuten später. Nach ein paar Minuten Angriff liegen 29 Tote am Eingang zum Silo – und damit begann erst das Gemetzel.
Die Verteidiger sprengen die Zwischenwände. Tonnen von Weizenkörnern prasseln herab, verschütten, ersticken, begraben die Infanteristen. Verzweifelt versuchen sie, sich herauszuwühlen. Sowie eine Hand aus den Körnern nach oben greift, wird sie von Kolbenhieben zerschmettert, von Seitengewehren zerstochen.
Die Körner färben sich rot.
Die Angreifer haben sich unter furchtbaren Verlusten um eine Plattform höher gekämpft; mit Handgranaten und Flammenwerfern stürmen sie die Widerstandsnester.
Die Druckwellen, von den dicken Zementwänden gehalten, zerfetzen das Trommelfell. Der Obergefreite Pranner hält sicherheitshalber den Mund offen, schluckt und spuckt jede Menge Weizenkörner.
Wieder bricht eine Zwischenwand – eine ganze Lawine Weizenkörner überrollt ihn und seine Kumpels. Blind geht der Obergefreite zu Boden, versucht sich aufzurichten. Körner und Staub rollen ihm in den Kragen, nageln ihn an die Erde, legen sich auf seine Schultern, auf seine Brust, schnüren ihm die Luft ab.
Nur nicht ersticken, sagt sich Pranner, alles, bloß das nicht. Wie Dampfhämmer durchwühlen seine Hände die Getreideflut. Er stößt mit den Beinen nach. Er kommt mit dem Kopf hoch, langsam. Bevor er noch etwas sieht, pressen ihm Hände die Kehle zusammen.
Der Obergefreite schlägt wütend um sich.
Es wird schwarz vor seinen Augen.
Wohin seine Hände auch greifen, sie fassen Körner, nichts als Körner.
Und dann krallt er sich an einem Rumpf, an einem Körper fest.
Die Panik gibt ihm Kraft. Seine Hände greifen nach dem Hals, pressen ihn brutal zusammen. Mit verdämmernden Sinnen merkt Pranner, daß sich der Griff an seiner Kehle lockert.
Benommen rappelt er sich hoch. Seine Lungen stechen. Sein Hals schmerzt, aber er pumpt sich voll mit Luft, atmet schwer, sieht sich verworren um. Sein Gegner ist tot: ein schmächtiger junger Bursche mit einem Mädchengesicht.
»Schwein gehabt, Kumpel«, stellt der lange Metschke fest und beugt sich über den Toten: Kurze Blondlocken umrahmen ein verzerrtes Gesicht mit entsetzlich aufgerissenen Augen.
Der Läusetöter schreckt zurück. »Weißt du, wen du da umgelegt hast?« stöhnt er.
Der Obergefreite Pranner, der Minnesänger, sieht es selbst: keinen Soldaten, eine Frau, ein Mädchen noch.
»Jetzt kommen die auch noch mit Weibern«, flucht der kleine Grigoleit, »so eine Schweinerei! So eine grenzenlose Schweinerei!«
Pranner kann nicht antworten.
Er kniet und kotzt seinen leeren Magen in die blutigen Weizenkörner, aber nicht einmal das kann er in Ruhe tun; es fallen schon wieder Schüsse, und ein verzweifelter Stoßtrupp der Sowjets kommt bis auf einige Meter heran.
Einen Widerstand wie in Stalingrad hatte die deutsche Wehrmacht nicht einmal vor Moskau erlebt. Die 62. Sowjetarmee – unterstützt von anderen Einheiten –, unter Führung des Generals Tschuikow, war in verzweifelter Lage entschlossen, bis zum letzten Mann, zum letzten Arbeiter und zur letzten Frau zu kämpfen. Obwohl die Schanzarbeiten ein untrügliches Zeichen gewesen waren, daß die Deutschen heranrückten, war der größte Teil der Zivilbevölkerung von ihrem Ansturm überrumpelt worden. Erst drei Monate später würde die rote Propaganda erstmals zugeben, daß der Feind bereits an der Wolga stand.
Wen man bei der Verteidigung der Metropole nicht verwenden konnte – Mütter und Kleinkinder, Alte und Gebrechliche –, wurde aufgefordert, die Stadt zu verlassen, und dadurch einem ungewissen und unmenschlichen Schicksal ausgesetzt. Die Flüchtlinge irrten ziellos in der Steppe umher. Die meisten von ihnen kamen dabei um, Tausende verhungerten.
Seit dem 2. September, an dem sich die 6. Armee mit der aus Südwesten heranrollenden 4. Panzerarmee vereinigt hatte, kämpften die Sowjets praktisch ohne Chance. Ihre Landverbindungen waren ausnahmslos gekappt. Nachschub mußte über die Wolga herangeschafft werden; sie wurde wie ihre Anlegeplätze auf dem westlichen Ufer von den Belagerern eingesehen und lag unter zielgenauem Beschuß.
Im Industriegelände im Norden hatten sich die Verteidiger und Angreifer zwischen umgestürzten Maschinen und oft noch laufenden Förderbändern ineinander verkeilt. Wenn die Nahkämpfe vorübergehend abflauten, um sofort wieder mit verstärkter Heftigkeit auszubrechen, rechnete man nicht mehr nach Siegern und Besiegten, sondern nach Toten und Überlebenden.
General Tschuikow, im letzten Moment nach Stalingrad eingeschleust, mußte im Laufe der zweimonatigen Straßenschlacht seinen Befehlsstand fünfmal wechseln. Er hatte ihn zuerst auf dem Mamajew-Hügel etabliert, war dann in den Zariza-Bunker umgezogen. Als es Mitte November aussah, als würde die ganze Altstadt in deutsche Hände fallen, mußte der Chef der 62. Armee in das nördliche Industriegelände ausweichen. Dieser Umzug war umständlich und gefährlich; da er ihn auf dem Landweg nicht mehr vornehmen konnte, hatte Tschuikow zuerst unter deutschem Beschuß die Wolga zu überqueren, auf dem östlichen Ufer nach Norden zu fahren, um dann unter starkem Beschuß den Strom ein zweites Mal zu überqueren. Der General wurde noch einmal bis zur Traktorenfabrik zurückgedrängt und leitete zuletzt die Schlacht in einem unübersichtlichen System von Unterständen und Laufgräben zwischen der Wolga und dem Industriegelände, 11 Meter tief unter einem Felsen.
»Innerhalb der Roten Armee stellte General Tschuikow eine Seltenheit dar«, schreibt der britische Autor Arnold-Forster. »Er war ein Offizier, der nie zögerte, seinen Vorgesetzten zu widersprechen, wenn er glaubte, daß sie unrecht hätten. Am Anfang des Krieges war er zum stellvertretenden Kommandeur der 64. Armee degradiert worden. Als Stalingrad bedroht wurde, beförderte Chruschtschow, der für diesen Abschnitt verantwortliche politische Kommissar, ihn wieder und übertrug ihm das Kommando der belagerten 62. Armee. Das war eine der besten und wichtigsten Ernennungen des gesamten Krieges. Tschuikow liebte seine Männer, und sie liebten ihn. Er kämpfte mit ihnen in den Ruinen, aß mit ihnen, trank mit ihnen, lachte mit ihnen und ließ sie niemals im Stich. Tschuikow strahlte eine rauhe Heiterkeit aus, die seine 62. Armee antrieb.«
Arbeiterbrigaden und Frauenbataillone kämpften Schulter an Schulter nach der Parole: Hinter der Wolga gibt es kein Land. Jeder Schutthügel wurde zum Massengrab, jedes Loch zur Todesfalle. Es gab auf russischer Seite keine Unterschiede des Rangs mehr, nicht einmal des Geschlechts. Frauen stellten sich, kaum ausgebildet, an die Flakgeschütze. Sie halfen als Funkerinnen und bargen als Sanitäterinnen mit verzweifeltem Mut aus der vordersten Stellung die verwundeten Rotarmisten.
Über ihre Leistungen sagte der Verteidiger Stalingrads General Tschuikow: »In der 62. Armee gab es viele Heldinnen. Die Listen der Ausgezeichneten enthalten über tausend Namen von Frauen. Darunter sind die Namen von Maria Uljanowa – sie nahm bis zuletzt an den Verteidigungskämpfen im Haus des Sergeanten Pawlow teil –, Walja Pachomowa – sie trug über hundert Verwundete vom Gefechtsfeld –, Nadja Kolzowa – sie wurde zweimal mit dem Rotbannerorden ausgezeichnet – und viele andere Namen. Und kann Ljuba Nesterenko, die als Sanitäterin der von Oberleutnant Dragan geführten Besatzung des belagerten Hauses Ecke Krasnopiterskaja-Komsomolskaja-Straße den Gardisten die Wunden verband und in treuer Pflichterfüllung den Tod fand, vergessen werden? Ich gedenke auch der Ärztinnen in den Sanitätsabteilungen und am Verwundetensammelplatz bei der Übersetzstelle an der Wolga. Jede von ihnen verband und versorgte Nacht für Nacht hundert und mehr Verletzte. Es kam vor, daß Sanitätspersonal in einer Nacht 2 000 bis 3 000 Verwundete auf das linke Ufer brachte. Und das alles unter pausenlosem Beschuß aus allen Waffen und bei feindlichen Fliegerangriffen.«
Den Verteidigern erwuchsen unvorstellbare Kräfte. Es änderte nichts daran, daß ihre Stellungen schrittweise eingedrückt wurden. Ab Mitte Oktober begann die Lage kritisch zu werden. Fast zwei Drittel Stalingrads waren nunmehr in deutscher Hand; eine ausgebrannte Geisterstadt mit einer blutgetränkten Erde. Jeden Tag traten die Truppen des Generalobersten Paulus – wie sie meinten – zum letzten entscheidenden Stoß an.
Stalingrad, das hieß: äußerste Brutalität sich selbst wie dem Feind gegenüber. Um den Mamajew-Hügel führte die 234. Sowjetdivision einen permanenten Nahkampf. Mit ihrer Verpflegung erhielten die Rotarmisten eine Tagesration von 100 Gramm Wodka, der von den meisten gleich an Ort und Stelle ausgetrunken wurde. Sie hatten jeweils begierig darauf gewartet und überlegten, wie sie ihre Zuteilung verdoppeln könnten.
»Als besonders erfolgreich erwies sich dabei«, berichtet in seinem Buch »Die Schlacht um Stalingrad« US-Autor William E. Craig – er hat nach dem Zweiten Weltkrieg mit Hunderten von Überlebenden beider Seiten gesprochen –, »Oberleutnant Iwan Besditko, von seinen Leuten ›Iwan der Schreckliche‹ genannt. Er hatte nicht nur einen unheimlichen Wodkaverbrauch, sondern auch einen Weg gefunden, sich die nötigen Mengen zu verschaffen. Iwan führte die Gefallenen seines Werferbataillons einfach in der Ist-Stärke und kassierte deren tägliche Wodkaration selbst ein. In kurzer Zeit hatte er literweise Wodka gehortet und sorgfältig in seinem Unterstand verstaut.
In einem Lager an der Wolga stellte Major Malygin, ein Nachschuboffizier, bei der Durchsicht seiner Unterlagen fest, daß Besditkos Einheit sich trotz des wochenlangen Geschützhagels außerordentlich gut gehalten hatte. Mißtrauisch ging Malygin der Sache nach und fand heraus, daß die Werferabteilung in Wirklichkeit schwere Verluste erlitten hatte. Er rief Besditko an, sagte ihm, daß er ihm auf die Schliche gekommen sei und ihn dem Armeehauptquartier melden werde. Dann fügte er hinzu: ›Ihre Wodkaration wird gestrichen.‹
Das war zuviel für Besditko. Er schrie: ›Wenn ich die nicht kriege, werden Sie Ihr blaues Wunder erleben.‹
Malygin legte auf, erstattete dem Hauptquartier Bericht und sperrte Iwans Schnaps.
Wütend setzte Besditko sich mit der Feuerstellung seiner 12,2-cm-Batterien in Verbindung, machte eine genaue Lageangabe und gab Schießbefehl. Drei Lagen fielen mitten auf Malygins Depot am Flußufer. Hunderte von Wodkaflaschen gingen in Scherben, der Inhalt ergoß sich auf den Boden. Malygin stolperte zum nächsten Telefon und ließ sich mit dem Hauptquartier verbinden. Während er hinausbrüllte, was passiert sei, wurde er immer wütender. Er war sich absolut sicher, daß es stimmte: Iwan der Schreckliche hatte ihm gezeigt, was eine Harke ist.
Die Stimme am anderen Ende hörte zwar geduldig zu, sagte dann aber völlig unberührt: ›Geben Sie ihm das nächstemal besser seinen Wodka. Er ist gerade mit dem ›Roten Stern‹ ausgezeichnet worden, also geben Sie ihm welchen.‹
Fassungslos stürzte Malygin in sein Lager zurück und blieb hilflos zwischen den zerstörten Flaschenregalen stehen. Wenige Stunden später bekam Oberleutnant Besditko wieder seine Wodkaration, und Malygin ließ von nun an die Finger von den Machenschaften Iwans des Schrecklichen.«
Im Traktorenwerk hatten deutsche Infanteristen der 389. Division die russischen Stellungen durchbrochen; sie stürmten durch die Werkhallen vorwärts. Zu einem wilden Kampf kam es in der Kantine. Über Tische und Stühle hinweg gingen Angreifer und Verteidiger aufeinander los. Von 8 000 Mann der 37. russischen Gardeschützendivision, die den bedrängten Arbeitern zu Hilfe kamen, waren nach zwei Tagen 5 000 gefallen oder verwundet. Aber gleich nebenan liefen mitten in der Schlacht weiterhin T 34 von den Fließbändern direkt in das Gefecht.
Die russischen Nachrichtenverbindungen waren unterbrochen. Auf sich gestellte Einheiten schickten Melder zum Wolgaufer, um festzustellen, ob die 62. Armee überhaupt noch eine Kommandostelle hatte. General Tschuikow funkte Notsignale. Seine Befehle sagten immer das Gleiche: Durchhalten. Verteidigen. Halten um jeden Preis.
An einem Tag wechselte Stalingrads Hauptbahnhof viermal den Besitzer. Kurz vor Einbruch der Nacht war das erste Bataillon des sowjetischen 42. Regiments der Tagessieger, aber nicht einer der Kämpfer sollte jemals lebend aus dem zerstörten Gebäude herauskommen.
Unter großen Opfern eroberten die Rotarmisten eine Eisenbahnbrücke zurück. Bei dem erbarmungslosen Kampf setzte das 270. NKWD-Regiment 30 Hunde mit auf dem Rücken angeschnallten Explosivstoff ein; die Tiere waren abgerichtet, unter deutsche Panzer zu kriechen und sich mit ihnen hochzujagen.
Wilde Kämpfe tobten in der Nordwestecke der Geschützfabrik »Barrikade«. Tschuikow entsandte seine letzten Reserven. Sie robbten im Trommelfeuer am Wolgaufer entlang, unter furchtbaren Verlusten. Auf dem Ostufer der Wolga war General Andrej Iwanowitsch Jeremenko, der Chef der Stalingrad-Front – Front war die russische Bezeichnung für Heeresgruppe –, in großer Sorge, ob die Verteidiger den Kampf durchstehen könnten. Der General, ein energischer, äußerst fähiger Offizier, der wiederum dem Marschall Georgij Konstantinowitsch Schukow, dem Retter Moskaus, unterstand, entschloß sich, trotz der Gefahr über die Wolga zu setzen, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen.
Er kündigte seine Absicht per Funk an. Tschuikow riet ihm ab, aber er kam bei Jeremenko, einem notorischen Kriegshelden, an den Unrechten. Im Feuerhagel setzte der Chef der Stalingrad-Front mit seinem Gefolge über, kletterte über Verwundete und Schutthaufen, verfehlte aber an der Landestelle Tschuikow.
Erst Stunden später trafen die beiden Generäle zusammen. Sie brauchten die Lage nicht zu besprechen; die Lage war offensichtlich: Stalingrads Restverteidiger benötigten dringend Munition und frische Truppen. Jeremenko sicherte sie zu, wiewohl er nicht wußte, wie er sie vom anderen Ufer heranschaffen sollte. Der Besucher sprach dann mit anderen Offizieren. Der Kornmandant der 37. Gardeschützendivision schilderte ihm, wie er im Traktorenwerk 5 000 Soldaten verloren hatte; er brach dabei weinend zusammen.
Am 17. Oktober erreichte Jeremenko wieder seinen Gefechtsstand auf der anderen Seite. Er war sicher, daß Tschuikow durchhalten würde, obwohl er bis jetzt 13 000 Mann verloren hatte und auf dem Landeplatz der Wolga 3 500 Verwundete auf die rettenden Fährschiffe warteten, die oft mit gefallener Besatzung herrenlos im Strom vorbeitrieben.
General Paulus lieh sich beim gesamten Ostheer Sturmpioniere aus, um die letzten sowjetischen Widerstandsnester im Industriegebiet und im Uferstreifen hochzujagen. Außer diesen hielten die Rotarmisten Anfang November nur noch einen durchgehenden schmalen Streifen am Westufer und die Inseln der Wolga.
Die Luftwaffe flog fünf Pionierbataillone ein, die sofort in den Kampf eingriffen. Schon nach den ersten Versuchen war jeder dritte der Spezialisten gefallen. Die Temperatur sank rapide; die Wolga würde bald Treibeis führen und damit den Fährverkehr, über den der russische Nachschub wenigstens während der Nachtstunden, stets im Strahl der Scheinwerfer und im deutschen Artilleriefeuer, schlecht und recht herankam, so lange ganz unmöglich machen, bis der Strom zugefroren war und über eine tragende Eisdecke verfügte. Tschuikow befahl, die letzten Tage, an denen die Wolga noch schiffbar war, bis zum Äußersten zu nutzen. In einer Dringlichkeitsliste forderte er zuerst Soldaten und Munition, dann Verpflegung und erst an letzter Stelle Winterausrüstung an.
»Irgendwie gelang es Tschuikow jedoch nicht, dem Nachschubdienst klarzumachen«, schreibt in seinem Buch »Stalingrad« der US-Autor Geoffrey Jukes, »daß ein frierender, hungriger Soldat mit Munition besser war als ein warm gekleideter, gutgenährter Soldat ohne Munition. Der stellvertretende Nachschubführer der Roten Armee, General Winogradow, der die Versorgung vom Ostufer aus leitete, setzte eigene Prioritäten und überschwemmte die 62. Armee mit Wintermützen und Filzstiefeln, bis ihre Lager von Bekleidung überquollen. Tschuikow mußte sich schließlieh hilfesuchend an Chruschtschow wenden, damit Winogradow abgelöst wurde, und die 62. Armee machte sich daran, möglichst viel Munition zu erbetteln, zu entleihen oder zu stehlen. Ehemalige Seeleute und Fischer aus ihren Reihen bauten Boote und Flöße, mit denen die herkömmlichen Transportmittel ergänzt wurden, solange die Wolga schiffbar blieb. Auch Verpflegung wurde nach Stalingrad gebracht, und Tschuikow legte einen Notvorrat von zwölf Tonnen Schokolade an, von dem seine Armee notfalls ein bis zwei Wochen leben konnte.
Spähtrupps bestätigten, daß Paulus seine Verbände erneut umgruppierte, um Stalingrad mit einer letzten Kraftanstrengung doch noch zu nehmen. Dazu brachte er die letzte bisher noch nicht eingesetzte Division der 6. Armee – die 44. Infanteriedivision – in die Stadt. Die deutsche Offensive stand allem Anschein nach unmittelbar bevor, und Tschuikows Befürchtung, daß Paulus losschlagen würde, sobald die Schiffahrt auf der Wolga eingestellt werden mußte, erwies sich als völlig gerechtfertigt.«
Da die Verteidiger entschlossen waren, nicht aufzugeben, zählte ihre Lebenserwartung nur noch Tage, vielleicht nur noch Stunden. Zwar erschienen erstmals russische Flugzeuge über dem Schauplatz der Grausamkeit, aber man hielt es mehr für einen Zufall oder einen psychologischen Trick denn für das Anzeichen einer unmittelbar bevorstehenden Sowjetoffensive.
Neun Zehntel Stalingrads waren jetzt erobert. Der Eisgang der Wolga hatte, wie erwartet, jeglichen Fährverkehr unterbunden. Die 62. Armee mußte ans andere Ufer funken, daß ihr die Munition ausgehe und daß sie keine Möglichkeit mehr sehe, Verwundete zu versorgen.
Während Tschuikow das Ende hinausschob, hielt es Hitler bereits für eingetreten. Zwar hatte Generaloberst Kurt Zeitzler, Halders Nachfolger als Generalstabschef, in einer Lagebesprechung am 7. November, gestützt auf exakte Unterlagen der deutschen militärischen Abwehr, eine deutliche Warnung vor einem großangelegten russischen Gegenschlag vorgebracht, aber von Hitler, dem ewigen Gefangenen eigenen Wunschdenkens, waren die geschilderten Vorzeichen wieder einmal als Hirngespinste abgetan worden; er stützte sich auf die Feindlagebeurteilung aus dem September, derzufolge die Sowjets über keine nennenswerten operativen Reserven mehr verfügten. Viele Militärs seiner Umgebung – die sich nachträglich von dieser Auffassung distanzierten – teilten sie. Tatsächlich lebten 40 Prozent der russischen Bevölkerung unter deutscher Besatzung und erwiesen sich die Verluste der Roten Armee inzwischen höher, als ihre Kampfstärke bei Kriegsbeginn gewesen war. Deshalb hielt man im Führerhauptquartier die sowjetischen Brückenköpfe westlich des Don – ideale Sprungbretter bei einem Angriff – für ungefährlich, annehmend, der russischen Dampfwalze sei längst die Kraft ausgegangen.
Zudem war im OKW vorübergehend der Blick von Stalingrad abgelenkt. Am 4. November hatte das Afrikakorps den Rückzug nach Tripolis angetreten. Vier Tage später waren die Anglo-Amerikaner im Rahmen der »Operation Torch« in Nordafrika gelandet. Als Antwort darauf ließ Hitler seine Truppen auch in das bisher unbesetzte Frankreich einmarschieren, was wiederum Reserven band.
Das Kommando über die im Kaukasus operierende Heeresgruppe hatte der Diktator inzwischen an Generalfeldmarschall Maximilian von Weichs übertragen, der am 2. November mit der Eroberung von Ordschonikidse zwar die Hauptverkehrsader durch den Kaukasus abgeschnitten hatte, aber seitdem liegen geblieben war. Der Überfall auf die Sowjetunion hatte damit seine extremste Entfaltung erreicht. Von nun an konnte es – von örtlichen Erfolgen abgesehen – nur noch zurückgehen.
In dieser Situation erhoben die Diktatoren fast gleichzeitig ihre Stimme: Zum fünfundzwanzigsten Jahrestag der bolschewistischen Revolution stellte Stalin in einem Aufruf am 7. November an die russische Bevölkerung fest, daß »bald auch auf unserer Straße gefeiert werde«.
Hitler nutzte die Traditionsfeier zum 9. November – an dem 1923 sein Marsch auf die Feldherrnhalle gescheitert war – zu einer Rede an seine Alten Kämpfer (angeschlossen waren alle deutschen Reichssender): ». . . und sind bei diesem fortgesetzten Zurückschlagen jetzt langsam bis zum Kaukasus gekommen. Ich sage ›langsam‹; ich möchte das für meine Gegner sagen, nicht für unsere Soldaten. Denn was unsere Soldaten an Tempo hier zurückgelegt haben, ist gigantisch. Auch das, was in diesem Jahr wieder zurückgelegt wurde, ist gewaltig und geschichtlich einmalig. Daß ich die Sachen nun nicht immer so machte, wie die anderen es gerade wollten – ja, ich überlege mir eben, was die anderen wahrscheinlich glauben, und mache es dann grundsätzlich anders.«
Unter dem frenetischen Beifall und Gejohle seiner Anhänger fuhr er fort: »Ich wollte zur Wolga kommen, und zwar an einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber. Aber denken Sie nur nicht, daß ich aus diesem Grund dorthin marschiert bin – sie könnte auch ganz anders heißen –, sondern weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man nämlich dreißig Millionen Tonnen Verkehr ab, darunter fast neun Millionen Tonnen Ölverkehr. Dort floß der ganze Weizen aus diesen gewaltigen Gebieten der Ukraine, des Kubangebietes zusammen, um nach Norden transportiert zu werden. Dort ist das Manganerz befördert worden, dort war ein gigantischer Umschlagplatz. Den wollte ich nehmen, und wissen Sie, wir sind bescheiden, wir haben ihn nämlich! Es sind nur ein paar ganz kleine Plätzchen da. Nun sagen die anderen: ›Warum kämpfen Sie dann nicht schneller?‹ . . .«
Aber der Feind, von dem der Diktator behauptet hatte, er sei für alle Zeiten geschlagen und würde sich niemals mehr erheben, zog Nacht für Nacht seine Stoßarmeen – insgesamt eine Million Soldaten – für den Angriff in die Flanke des Korridors zusammen. Die Tarnung des Aufmarsches kostete Zeit, sonst wäre der zunächst für den 9. November vorgesehene und dann um zehn Tage verschobene Beginn der Offensive am gleichen Tag mit Hitlers Großsprecherei im »Bürgerbräukeller« zusammengefallen.
Am 11. November hatte Generaloberst Paulus seine letzte Kraftanstrengung zur restlichen Eroberung Stalingrads gestartet und die Verteidiger in eine aussichtslose Lage gebracht. Von Jeremenko war das Versprechen, frische Truppen an die letzten Brückenköpfe am Westufer zu entsenden, nicht eingehalten worden. Als Tschuikow am Abend des 18. November seine Stabsoffiziere zu einer Besprechung versammelte, schien es die letzte zu sein; er hatte mehr als das Menschenmögliche getan, aber er war am Ende.
In diese düstere Stimmung platzte ein Telefonanruf.
Er kam aus Marschall Schukows Hauptquartier, und es war nur eine Vormeldung: »In Kürze wird ein Befehl durchgegeben. Halten Sie sich zum Mitschreiben bereit.«
Gegen Mitternacht kam die Mitteilung, daß am nächsten Morgen eine sowjetische Offensive größten Stils anlaufen werde. Gleichzeitig wurde General Tschuikow und seinen Männern befohlen, aus ihren letzten Stellungen die Deutschen in der Stadt anzugreifen, um ihre Kräfte zu binden. »Schukow hatte seine Falle geschickt aufgebaut«, stellt Geoffrey Jukes fest. »Jetzt war er dabei, sie zuschnappen zu lassen.«
Die Nacht zum Donnerstag, dem 19. November, ist naßkalt und trostlos. In Stößen kommt der Wind aus der Kalmückensteppe und rüttelt an den Ruinen der Fassaden, als könnte er sie umstürzen. Der Nebel schluckt die Konturen von Freund und Feind. Der Himmel versteckt sich hinter dickem Schneegewölk, aber hier, an der Stalingrad-Front, greift ohnedies keiner mehr nach den Sternen.
Gegen Mitternacht fällt dichter Schnee, türmt sich zu kleinen Bergen, auf dem nördlichen Industriegelände versuchen die eingeflogenen Pioniere noch immer, die am Steilufer hinter der Geschützfabrik »Barrikade« verschanzten Russen zu überrennen, vergeblich. Mitunter flammt dünner Gefechtslärm am Wolgaufer in Nähe der Altstadt auf. Sonst bleibt es verhältnismäßig ruhig in dieser Nacht. Trotz einiger Vorwarnungen weiß keiner, daß auf den westlichen Don-Brückenköpfen Serafimowitsch und Kremenskaja über 30 000 russische Geschütze auf den Befehl zum Trommelfeuer warten. Vor ihnen, dicht gedrängt. Hunderte fabrikneuer T-34-Panzer, umlagert von Infanteristen, die vom Ural und aus dem Raum Moskau herangeschafft worden waren und die letzten 200 Kilometer in die Bereitstellung in nächtlichen Gewaltmärschen hinter sich gebracht hatten.
Die Stunde X ist auf 6 Uhr morgens angesetzt, aber das Wetter stellt Marschall Schukow die Frage, ob der Angriff nur um Stunden oder zum zweiten Mal auf einen anderen Tag verschoben werden muß. Die vierfach überlegenen Verbände der sowjetischen Luftwaffe, mit denen man auf deutscher Seite nicht rechnet, können in dieser Waschküche nicht starten, aber auch die Bomber und Jäger mit dem Balkenkreuz kommen von ihren E-Häfen nicht hoch.
Zu den erschöpften und weitgehend aufgeriebenen deutschen Einheiten, die endlich aus dem Gefecht gezogen und an den westlichen Rand der Ruinenstadt verlegt wurden, gehören auch die Überlebenden der 29. Infanteriedivision. Sie erhalten Post, warmes Essen, Kellerquartiere. Die Lebensgeister brennen auf Sparflamme, doch sie rühren sich wieder erstmals seit Wochen, zumal einer das Gerücht von draußen bringt, daß sie nunmehr geschlossen ihren Heimaturlaub antreten würden, freilich ohne den langen Metschke. Den Läusetöter hat’s erwischt – nicht das Ungeziefer, nicht die Infektion, sondern eine Handgranate. Grigoleit und Staudigel schaffen den Schwerverletzten gerade in ein Notlazarett, während Ondruschka wieder einmal seine Kosakenstute Paula sucht, die er an den Troß abgeben mußte.
Er kommt zurück, schüttelt den Kopf, haut sich auf seinen Strohsack. Trotz der Notbeleuchtung sieht er, wie miserabel seine Kumpels aussehen. Flackrige Augen, abgezehrte Gesichter, irgendwie mit Hoffnungslosigkeit imprägniert. Sie rauchen hastig, lernen die Feldpostbriefe auswendig, die sie endlich erhalten haben. Sie scheinen nicht zu begreifen, daß sie noch am Leben sind, und vor allem wissen sie nicht, wie lange sie es noch sein werden.
Als einer, an den sie schon nicht mehr gedacht haben, der überfällige Unteroffizier Pinkert, aus dem Heimaturlaub zurückgekehrt, überraschend in der Tür steht, schrecken sie aus ihrer Lethargie hoch und wirbeln durcheinander.
»Mensch, Pinkert, Unteroffizier«, begrüßt Pranner, der Minnesänger, seit langem wieder bei Stimme, den Mann, der im April seinen Heimaturlaub im Kohlenpott angetreten hatte und jetzt, im November, erst zu seiner Einheit zurückkommt. »Wie hast du das geschafft? Kommst grad noch rechtzeitig, ein paar Tage später, und wir wären vermutlich alle schon verreckt.«
»Na, na, na«, erwidert der Neuankömmling. »So schlimm wird’s doch wohl nicht sein.«
»War’s schön?« fragt Ondruschka. »Gassi, Gassi, und das acht Monate lang.«
»Nur keinen Neid«, antwortet der Unteroffizier, wegen seiner Vorliebe für Hühnerfrüchte »Eier-Pinkert« genannt. »Mich hat’s zu Hause erwischt, und sogar gleich zweimal.«
»Und inzwischen haste wohl ’ne ganze Hühnerfarm leergefressen«, versetzt Pranner.
»Zuerst beim Luftangriff in Dortmund«, überhört der zurückgekehrte Urlauber die Anspielung. »Phosphor. Kam in ein Spezialhautlazarett in Köln und dadurch vom Regen in die Scheiße. Trotzdem: Schwein gehabt: Bombensplitter am Rükken und Oberschenkel, ein paar Zentimeter tiefer und –«
»Aber wenigstens zu Hause«, erwidert Ondruschka.
»Tausend Bomber«, sagt Pinkert. »Stellt euch vor: tausend Bomber auf einmal. Fragt nicht, wie die schöne Domstadt jetzt aussieht.«
»Frag nicht, wie’s hier aussieht«, entgegnet der Minnesänger.
»Die Tommies kommen jetzt jede Nacht«, fährt der Unteroffizier fort. »Das sind sture, eiskalte Burschen, keine solchen Weichmänner wie die Russen, die immer gleich davonlaufen.«
»Meinste? Du wirst dich noch gewaltig wundern, oller Eierknacker«, erwidert Ondruschka. »Die Iwans erkennst du nicht wieder. Da gehst eher du stiften als die –«
»Quatsch«, versetzt der Eier-Pinkert.
Der kleine Grigoleit und der Gefreite Staudigel kommen aus dem Notlazarett zurück, und es gibt zunächst einmal eine stürmische Begrüßung.
»Der Notverbandsplatz ist ganz in der Nähe«, erklärt der Arschpauker. »Keine vierhundert Meter. In einem ehemaligen Baulager.«
»Dann können wir das lange Elend ja besuchen und aufmuntern«, sagt Pranner.
»Da müßt ihr euch aber beeilen«, erwidert Staudigel verbissen. »Die meinen, der kratzt heut nacht noch ab.«
»Vielleicht drückst du dich gewählter aus«, staucht ihn Unteroffizier Pinkert zusammen.
»Der Obergefreite Metschke wird nach Mitteilung eines Sanifeldwebels heute nacht noch das Zeitliche segnen«, entgegnet Staudigel mit affektierter Stimme. »Einen Scheißdreck wird er«, verfällt er gleich wieder in seinen üblichen Ton. »Er wird krepieren, und –«
»Halt die Klappe!« fährt ihn Pranner an.
»Ihr seid ja ganz schön auf den Hund gekommen«, stellt der Ex-Urlauber fest.
»Kunststück«, versetzt Staudigel. »Also: Oberleutnant Pletzko tot. Der stille Lipsky stumm für immer. Müller II gefallen. Güßregen hin. Wagenbach zerfetzt. Sellner Granatvolltreffer. Baumann Stalinorgel. Hergenröder Tretmine –«
»Nun hör schon auf mit dieser Scheißlitanei!« stoppt ihn Ondruschka. »Wenn du sie alle aufzählen willst, brauchst du bis morgen früh. Sehr einfach, Unteroffizier«, wendet er sich an Pinkert, »wer hier fehlt, der ist futsch. Bis auf den Läusetöter – und der macht’s ja auch nicht mehr lange.«
Sie suchen ihre Strohsäcke auf. Einige schnarchen, andere zerkauen in Gedanken ihre Feldpostbriefe: Ondruschkas Frau hat nicht die Wunschtochter geboren, sondern einen Sohn. Grigoleits Mutter wurde nach Bayern evakuiert. Und Staudigels Vater hat einen Schlaganfall erlitten. »Ganz harmlos noch, Junge, sagt der Arzt, falls es sich nicht wiederholt«, schrieb die Schwester.
Endlich schlafen auch die letzten, Schulter an Schulter, einander wärmend. Nur wenn einer pinkeln muß, steht er auf und kommt gleich wieder fröstelnd zurück, vom Nebel in einer Minute durchfeuchtet.
Am Morgen ist Pinkert als erster auf den Beinen. »Komm«, sagt er zu Ondruschka. »Vielleicht ist es doch nicht so schlimm mit dem Läusetöter.«
Sie vermummen sich und tigern los, stoßen auf einen jungen Feldunterarzt, der Nachtdienst hatte.
»Metschke?« Er ruft seinem Sani: »Haben wir einen Metschke?«
»Ja«, antwortet der Sani ohne sich umzudrehen. »Dort.« Er weist auf einen zugeschneiten Haufen: »War einer der ersten heute nacht. Muß in der untersten Schicht sein.«
»Tot?« fragte Ondruschka mit heiserer Stimme.
»Den könnt ihr doch nicht einfach so hinlegen und –« schimpft Pinkert.