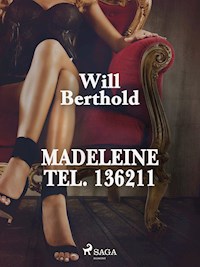Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Inferno
- Sprache: Deutsch
Auch im zweiten Teil der "Inferno"-Reihe schildert Berthold auf beklemmend-informative Weise die Jahre 1940 bis 1942: Historisch äußerst präzise recherchiert stellt er Augenzeugenberichte, Divisions- und Regimentschroniken, private Tagebucheinträge sowie internationale Quellen in Relation und schaffte damit ein unvergleichliches und erschütterndes Zeitdokument über den Zweiten Weltkrieg. Neben den Siegen geht er ebenso auf die sich damals bereits abzeichnenden ersten Niederlagen ein. In seiner aus drei Bänden bestehenden "Inferno"-Serie beschreibt Will Berthold sehr eindringlich aus eigener Erfahrung als ehemaliger Soldat die Gräuel des Zweiten Weltkriegs. Er hatte sich bei Kriegsende geschworen, einen Beitrag zu leisten, dass solch ein Krieg nie wieder geschehen würde und entschied sich dabei für die Schriftstellerei, mit der er viele Menschen erreichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Inferno. Siege und Niederlagen - Tatsachenroman
Band II
Originalausgabe
Saga
Inferno. Siege und Niederlagen – TatsachenromanCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1983, 2020 Will Berthold und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726444681
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Der wasserscheue Seelöwe
Die Einsatzbesprechung auf der Halbinsel Cotentin, wo während der Battle over Britain ein E-Hafen der Jagdflieger neben dem anderen liegt, ist kurz und witzlos. Immer der gleiche Seich: Begleitschutz, angelegt an den Kampffliegerverband, Kanal hin und zurück. Die Jäger sollen die dicken Brummer schützen, aber ihr Sprit reicht dann über der Insel nur noch für 20 Minuten, und damit ist nicht mehr viel Luftkampf zu machen. Sie müssen umdrehen, ihre Schützlinge sich selbst überlassen und hoffen, daß sie mit dem letzten Tropfen zurückkommen. Gestern verlor die Nachbarstaffel vier Me 109, die kurz vor Erreichen der Küste mit leeren Tanks in den Kanal gestürzt waren.
Als dann die zerpflückten Kampfflieger, die sie begleitet hatten, zurückkehrten, mußte sich die Staffel auch noch Vorwürfe über den mangelnden Schutz anhören. Die Beschuldigungen waren ungerecht. Niemand kann länger fliegen, als sein Sprit reicht, und wenn der Befehl des Reichsmarschalls lautet, daß die Schnellsten an der Seite der Langsameren und Langsamsten zu bleiben haben, geschehe, was da wolle, muß das von vornherein schiefgehen.
Staffelkapitän Michalski, der nicht nur verwegen ist, sondern auch Zivilcourage hat, ist bei der ganzen Luftflotte berühmt, weil er vor ein paar Tagen im Offizierskasino dem Kommandierenden General vor allen anderen ins Gesicht gesagt hat, die neue Taktik des frontfernen Reichsmarschalls sei »überflüssig und nutzlos wie ein Eunuchenfick«.
Der Oberleutnant ist einer der Experten, die man bei der Luftwaffe die Jägerasse nennt, und seine Männer vergöttern ihn, nicht nur, weil er das glitzernde Dingsda in seinem Kragenausschnitt trägt. Sie sind ja selbst mit Heldenblech reichlich versehen, die Schlipssoldaten – so nennt man in der übrigen Wehrmacht mit verächtlicher Bewunderung die blaue Waffengattung –, haben die schicksten Uniformen, die schnellste Karriere, die beste Verpflegung, erhalten die höchsten Auszeichnungen und zahlen für ihre Privilegien mit den – nach den U-Boot-Fahrern – blutigsten Verlusten.
»Wenigstens keine Stukas«, sagt der blaßgesichtige, sommersprossige Hinrichs nach der Besprechung und versucht, sich verstohlen mit der Hand in der Hosentasche unterhalb der Koppellinie zu kratzen. Die anderen grinsen schräg. Der Unteroffizier hat von seinem letzten Ausgang nach Abbéville Souvenirs mitgebracht: Sackratten, auch »Matrosen am Mast« genannt.
»Das haste davon, Kamerad Cuprex«, grinst Feldwebel Feugele, er äfft Görings Stimme nach. »Ihr sollt fliegen wie die Vögel, aber nicht vögeln wie die Fliegen.«
»Was weiß ich, wo ich mir das geholt habe«, brummelt Hinrichs verärgert. »Jedenfalls nicht da, wo du denkst.«
»Wo auch immer«, albert Feugele weiter. »Komm nicht zu nahe an uns ran. Mindestens zwei Meter Abstand halten«, fordert er unter dem Gelächter der anderen. »Mensch, du muffelst ja noch durch die Kombination hindurch.«
»Du Arsch«, versetzt Hinrichs wütend. »Wart nur, was du dir noch alles holen wirst.«
Oberleutnant Michalski sieht auf die Uhr. Er schüttelt den Kopf, nimmt einen Schluck aus dem Kochgeschirr, halb Kaffee, halb Cognac, und einen Schuß Pervitin, Fliegerbrause, er zündet sich eine Zigarette an, spitzt die Ohren, als hörte er die Ju-Staffel schon kommen.
Dann betrachtet er seine zerzauste Narhalla: Sieben Mann bloß noch, prächtige Burschen; ein achter liegt im Keller des Lazaretts von Abbéville auf Eis und soll eine anständige Fliegerbeerdigung erhalten, natürlich nur bei schlechtem Wetter; bis dahin werden wohl noch einige dazukommen.
Der Wetterbericht hat für den nächsten Tag ein Tief angekündigt, das sich vom Westen her nähert, so läßt sich dann alles würdig in einem Aufwasch erledigen.
»Stillgestanden!«
Müde werden die Hacken aneinandergeschlagen.
»Ich hatt’ einen Kameraden – «
Der Chor klingt von Mal zu Mal dünner. Immer mehr Geschwaderangehörige können nie mehr singen, und der schlechter ausgebildete Nachschub, der aus Deutschland laufend nachrückt, ist noch nicht recht bei Stimme.
Es ist so weit, der Oberleutnant winkt, und seine Männer kletterten in die Mühlen. Der bullige Feldwebel Sack, der nie den Mund hält, quittiert die Sitzbereitschaft mit den Worten: »Besser ein wunder Hintern als ein kalter Arsch.«
Staffelkapitän Michalski steigt als letzter ins Cockpit; er wartet, bis der zu schützende Ju-88-Verband den kleinen E-Hafen überflogen hat. Feldmarschall Eberhard Milch, der Stellvertreter des Oberbefehlshabers, hatte bei seinem letzten Frontbesuch lange Gespräche mit einigen Besatzungen des neuen »Wunderbombers« geführt, sich ihre Einwände und Mängelbeschwerden in aller Ruhe angehört, ein verständiger Vorgesetzter. Als er wieder in Berlin war, schrieb er in seinen Bericht: »Die Besatzungen fürchten nicht den Feind, sondern die Ju 88.« Dann ließ er – auf Betreiben Görings – die Einheit auflösen und die Besatzungen strafversetzen, Nazipsychologie.
Michalski nickt seinen Bordwarten zu. Die Kuttenzwerge reißen die Bremsklötze von den Rädern, lösen das Kabel, das die Me 109 wie eine Nabelschnur mit dem Anlasserwagen verbindet. Der Propeller dreht sich, wirbelt Staub auf. Der Staffelkapitän jagt seine Maschine über die Graspiste, wird schneller und schneller, nimmt den Knüppel an den Bauch, zieht die Me hoch.
Unter ihnen, an der Steilküste des Cap Gris Nez, üben bayerische Gebirgsjäger die Erstürmung der Klippen von Folkestone, sie winken hinauf und geben es auf, die fliegenden Verbände der Luftwaffe zu zählen, die heute wieder über ihre Köpfe nach England hinwegbrausen. Die um Calais zusammengezogenen Pioniere und Infanteristen sehen mit bloßen Augen die Stelle, an der sie bei der »Operation Seelöwe« landen sollen, sowie die Luftwaffe die Royal Air Force zerschlagen hat. Nach einer ersten Berechnung Görings in vierzehn Tagen. Inzwischen hat er den Zeitraum auf fünf Wochen prolongiert. In dieser Zeit will die Kriegsmarine 1,2 Millionen Tonnen Schiffsraum für den »erweiterten Flußübergang« zusammenziehen, aber, wie der kesse Möllner zu sagen pflegt: »Es läuft nicht so, wie die Geistlichkeit will.«
Entweder hat sich Göring, was die Zahl der feindlichen Abfangjäger betrifft, wieder einmal gründlich verrechnet, oder der Feind stampft Piloten und Maschinen aus dem Boden. Noch dazu Spitfires, die das Himmelsmonopol der Me 109 brechen. Jagdfliegeras Galland, von Göring einmal in Gönnerlaune befragt, was er sich wünsche, erwiderte: »Spitfires, Herr Reichsmarschall.«
Ob die Me oder die Spitfire besser ist, bleibt eine Streitfrage, denn der bessere Pilot, oder zumindest der glücklichere, siegt.
»Wenn ihre Erfahrung mit der Hurricane die Deutschen sorglos gemacht hat«, schreibt in seinem Buch »Die Me 109« der US-Autor Martin Caidin, »so erlebten die deutschen Piloten, die meinten, die Spitfire in die gleiche Kategorie einreihen zu können, eine blutige Überraschung.
Die frühen Luftangriffe gegen englische Ziele brachten auch einen Nachteil der Me-109-E-Serie klar zutage – eine Reichweite, die für die schweren Erfordernisse der Angriffe gegen England viel zu gering war. Schon im Krieg auf dem Kontinent war es notwendig, die Feldflugplätze rasch nach vorn zu verlegen, um im Kontakt mit dem fliehenden Feind zu bleiben. Nur die hervorragende Bodenorganisation machte die Messerschmitts so erfolgreich – dennoch eine eher unsichere Methode.
Eine größere Flugdauer und Reichweite würde die logistische Belastung drastisch erhöht haben, und was ein wenig überraschend ist: Die Deutschen machten nicht sofort Gebrauch von abwerfbaren Zusatztanks, deren sie sich vor dem Beginn des Luftkampfes entledigen konnten.
Natürlich erkannten auch die Deutschen die Notwendigkeit eines Langstreckeneinsatzes für ihre Me 109 E. Die Tatsache, daß die meisten Ziele in Britannien außerhalb der Reichweite der Me 109 E lagen, bedeutete, daß die Bomber über den Zielen ohne Jagdschutz ankamen, und daher steht außer Frage, daß die geringe Reichweite der Me 109 – in der Luftschlacht um England nie verbessert – einer der Hauptgründe für die fürchterliche Niederlage der Luftwaffe war, eine Niederlage, die als einer der Wendepunkte des Krieges angesehen werden kann. Die Me-109-Jäger hatten nie mehr als zwanzig Minuten, in denen sie ihre Bomber gegen angreifende englische Jäger verteidigen konnten. Hätte die Me nur dreißig Minuten mehr Flugzeit besessen, wäre die Luftschlacht von einer kleineren Zahl als der von der Geschichte überlieferten gewonnen worden.«
Bei wolkenlosem Himmel überfliegt die Kampfgruppe den Kanal ohne Feindberühung, aber kurz vor der Küste wird die Formation von Spitfires und Hurricanes abgefangen und gesprengt. Da sich die Piloten des Fighter Command nicht an die Befehle des deutschen Reichsmarschalls halten, kommt die Gruppe, in wilde Luftkämpfe verwickelt, doch noch zu ihrer eigentlichen Bestimmung.
Bei der wilden Kurbelei gelingt Michalski der Trick, den ihm so leicht keiner nachmacht: Er fährt die Landeklappen aus, drosselt den Motor bis zum Äußersten, reißt die Me 109 in die denkbar engste Schleife und kommt von unten, statt aus der Überhöhung anzugreifen. Er überrumpelt den R.A.F.-Piloten, dem man auf der Jagdschule eingetrichtert hat: »Denk an den Hunnen in der Sonne.«
Ein kurzer Feuerstoß.
Michalski verfolgt, wie die brennende Spit nach unten trudelt.
Über Sprechfunk gibt er seinen Leuten den Befehl, die Luftkämpfe abzubrechen und ihre gejagten Schützlinge wieder einzuholen.
Unter ihm liegen normannische Kirchen, idyllische Wasserläufe, Dörfer mit Strohdächern; in 4000 Meter Höhe überfliegt der Oberleutnant eine Kathedrale, deren Türme mit greisen Fingern nach oben zeigen, zum Himmel, der zur Hölle wird. In rollenden Einsätzen, in gestaffelten Höhen greifen seit Stunden Bombenflugzeuge mit dem Balkenkreuz Ziele in Südengland an, werden abgedrängt oder kommen durch, werfen ihre Bombenteppiche ins Ziel oder setzen sie wahllos ins Gelände. Mitunter sieht die Erde von oben aus, als trüge sie eine Gänsehaut.
Kurz bevor die Staffel Michalski umkehren und den Ju-88-Verband sich selbst überlassen muß, gerät die Kampfeinheit in eine Flakfalle. Die erste Ju platzt in der Luft. Feldwebel Sack versucht, im Bügeleisenwalzer aus den Sprengwölkchen herauszukommen. Eine Granate reißt seine linke Tragfläche auf. Aus. Keiner kann hinterher sagen, ob der Pilot noch aus der Maschine gekommen ist oder nicht. Die Begleitjäger müssen jetzt umdrehen, die Ju-88-Gruppe erleidet das über Südengland typische Schicksal. »In 4000 m sind die Lagen noch mittelmäßig, nur störend. In 2000 m und darunter stark und gutliegend«, schreibt in seinem Buch »Kampfgeschwader 51« Wolfgang Dierich. »Immer mehr unserer Kameraden scheren getroffen durch Jäger oder Flak aus. Dreizehn Besatzungen unseres Verbandes kommen nicht zurück. Eine Hurricane der 213. Squadron schießt um 12 Uhr 30 die Maschine des Kommodore ab. Oberst Dr. Fisser fällt, sein Beobachter, Oberleutnant Lüderitz, und Leutnant Schad geraten schwer verwundet in Gefangenschaft.
Die I. Gruppe verliert vier Besatzungen, die II. Gruppe zwei, die III. Gruppe sechs. Nur wenige überleben und geraten in englische Gefangenschaft.
Als der Verband abdreht, stürzen sich Spitfires, Hurricanes und Defiants wie Habichte auf die Zurückkehrenden. Außer den dreizehn abgeschossenen Maschinen werden fast alle durch MG- und Kanonentreffer zum Teil erheblich beschädigt. Major Marienfeld, Kommandeur der III. Gruppe, und Oberleutnant Lange, 9. Staffel, schießen mit ihrer Besatzung je eine Spitfire ab. Besatzung Leutnant Unrau wird über dem Kanal von drei Hurricanes verfolgt. Sein Bordfunker, Feldwebel Winter, schießt eine Hurricane ab. Nachdem ein Motor der Ju ausgeschossen worden war, erreichte sie mit Mühe die französische Küste und konnte – als auch der zweite Motor stehen blieb – nur mit fliegerischem Geschick eine Bauchlandung am äußersten Rand der Steilküste durchführen. Sie zählten, unverletzt ausgestiegen, allein 180 Treffer an ihrer Maschine.«
Über Dünkirchen wurde den sieggewohnten Geschwadern der Luftwaffe der eine oder andere Zahn gezogen; über Südengland fürchten sie jetzt den Biß zu verlieren. Die heimkehrenden Jäger müssen nun selbst sehen, wie sie durchkommen, und sie wissen, daß das englische Fighter Command auch sie angreift, wenn sie auf dem Rückflug wegen Spritmangels keine großen Sprünge mehr machen können. Die Spits und Hurris lauern in großer Höhe, schießen aus der Sonne heran und knallen ab, was ihnen vor ihre acht MGs kommt.
Die Battle over Britain hatte am 13. August 1940 begonnen. Mitte September sollte dann der Seelöwe auf die Insel springen. Die Luftwaffe bot auf, was sie hatte: In Scharen zogen Bomber, Jäger, Zerstörer und Stukas aus frontnahen Basen westwärts. An jedem Tag, an dem es das Wetter erlaubte, war es zu einem beispiellosen Gemetzel gekommen. Immer wieder hatten sich die Staffeln des Fighter Command durch die Verbände der Kampfflieger gepflügt und, ihr Opfer im Visier, abgedrückt, bevor die mit gedrosselten Motoren fliegenden Mes überhaupt eingreifen konnten. Sie flogen ihnen entgegen, und allmählich hatten die deutschen Besatzungen den Eindruck, sie kämpften nicht gegen Engländer, sondern gegen Gespenster.
»Sie stehen immer richtig. Sie verfehlen die Angreifer nie«, schreibt in seinem Buch »Augen durch Nacht und Nebel« Cajus Bekker. »Wenn einer abgeschossen ist, tauchen zwei neue dafür auf. Sie scheinen genau zu wissen, wo die Bomber einfliegen, sie scheinen sogar ihre Zahl schon im voraus zu kennen.
Wie machen sie das? Woher nehmen sie diese verblüffende Sicherheit? Welche geheimnisvolle Kraft gestattet es ihnen, den Flugweg der deutschen Verbände immer wieder zu erkennen?
Auf den Fliegerhorsten in Frankreich zerbrechen sich die Kommandeure der deutschen Kampffliegergruppen den Kopf über diese täglich neu und täglich dringender gestellten Fragen. Denn die Abschußziffern sind hoch, viel zu hoch. Manchmal kommen 20 oder gar 30 Prozent der eingesetzten Maschinen nicht zurück. Andere erreichen nur mit letzter Kraft schwer beschädigt französischen Boden. Doch die Materialverluste wird man noch ausgleichen können. Unersetzlich ist der Verlust der Menschen, der erfahrenen, eingeflogenen Besatzungen.
Sie haben damit gerechnet, daß dieser Kampf nicht leicht werde, daß er nicht in wenigen Tagen siegreich überstanden sein wird. Aber sie haben nicht mit dieser unsichtbaren, unfaßbaren Überlegenheit des Gegners gerechnet, mit diesem ständigen Zur-Stelle-Sein, zur rechten Zeit am rechten Ort.«
Über dem Kanal kommt es zur üblichen Jägeransammlung. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt, starrt gebannt auf die rote Lampe, die den Benzinmangel anzeigt. Auf einmal ist auch die Gruppe Steinhoff zur Stelle, von den Engländern respektvoll die »Abbéville Boys« genannt. Man stiehlt sich von der Front zurück zum E-Hafen. Es herrscht strikte Funkstille, um die Engländer nicht auf die Spätheimkehrer, die ihre Minuten verschossen und ihren Sprit verflogen haben, aufmerksam zu machen.
Hinrichs, der Cuprex-Kamerad, ist zurückgeblieben. Er gerät in Panik. »Ich bin allein, ganz allein«, jammert er, entgegen dem Befehl, in sein Bordmikrophon.
»Halt’s Maul, du dummer Hund«, erwidert einer, der sich heimwärts stiehlt. »Du bist nicht allein. Eine Spitfire hängt an deinem Arsch!«
Möllner stürzt 200 Meter von der Küste entfernt in den Kanal und wird aufgefischt. Dann stellt sich heraus, daß Feugele fehlt. In Gedanken buchen sie ihn schon ab; aber dann meldet er sich von einem anderen E-Hafen, Überlebender einer Bauchlandung wegen Spritmangels. Kurze Zeit später wird der Feldwebel von einem Kübelwagen herangeschafft.
»So hätt’s nun auch wieder nicht pressiert«, sagt Hinrichs, nachdem er ihm zu seinem Fliegergeburtstag gratuliert hat, und schaut nach oben, wo sich der Himmel mit Wolken überzieht wie die Milch mit einer Haut; das heißt, daß morgen endlich wieder einmal Waffenruhe herrschen wird.
Gegen Mittag fahren sie nach Abbéville. Inzwischen ist der kleine Fritzmann seinen Brandwunden erlegen und kann zusammen mit den anderen auf dem Heldenfriedhof beigesetzt werden, und Feugele fragt sich, was es für eine Verschwendung sei, den Hauptmann Feuerbach in einen richtigen Sarg zu legen, wo von ihm in der zerschmetterten Maschine nicht mehr übriggeblieben war, als in ein Fliegerhalstuch geht.
Auch die Nachbarstaffeln haben ihre Toten vom Eis geholt. Sie stehen stramm, als die fünf Jagdflieger der Erde übergeben werden. Sie setzen der Zeremonie angepaßte Gesichter auf, hoffend, daß es bald vorbei sein wird und daß sie nicht das nächste Mal in den Särgen liegen werden.
Dann singen sie: »Ich hatt’ einen Kameraden ...« Heute hatten sie fünf: sie hatten schon über fünfhundert gehabt, sie werden Millionen gehabt haben, wenn der Krieg zu Ende ist, und nicht alle waren Kameraden gewesen, aber ausnahmslos werden sie tot sein.
Der blasse Hinrichs macht schlapp, heult Rotz und Wasser. Feugele scheißt ihn zusammen und hat selbst nasse Augen.
Die Verluste sind furchtbar, nicht nur durch Feindeinwirkung, sondern auch durch Unfälle. Dabei kommt es zu Szenen, die jegliche Kaltblütigkeit überfordern. Der Autor und Stuka-Flieger Valentin Mikula berichtet über einen abgestürzten Kameraden: »Der Flugzeugführer wurde nach fünfzehn Minuten in einen Sanka verladen. Was sie dort an fleischigem Rest verluden, hatte keine Ähnlichkeit mit einem menschlichen Wesen. Der Mund war bis zu den Ohren aufgespalten, die Zähne hingen wahllos aus den Kiefern, er war skalpiert, der Brustkorb deformiert, kein heiler Knochen. Der linke Arm aus der Schulter gerissen, der rechte in sich zusammengestaucht. Das rechte Bein war am Knöchel ab, Hautfetzen zeugten von einer ehemaligen Fortsetzung. Am linken Knie war die Kniescheibe fein säuberlich ausmontiert und blieb unauffindbar. Das Gesäß war verkohlt. Diese Menschenmasse lebte aber noch. Der Arzt spritzte ihm Morphium, damit er weniger wahrnahm. Aber der Lebenshauch, der aus diesem Fleischbündel kam, war durch kein Mittel zu dämmen, er schien geradezu geweckt worden zu sein. Er fluchte über das Mißgeschick und versuchte mit einem klaren Auge aus den Gesichtern der anderen die volle Tragik seines Geschickes abzulesen. Die jungen Flieger, die eben am Notlandeplatz aufsetzten, sahen, wie man nachher aussieht. Bei der Verladung in den Sanka fluchte er auf plattdeutsch im halben Delirium und verschied erst kurz vor dem Luftwaffenlazarett ... Ein normaler Soldat stirbt, wenn seine Zeit abgelaufen ist, ein Stukaflieger muß gestorben werden ...«
Ohne Übergang gehen sie in die Nahkampfdiele. Ausgang bis Mitternacht. Danach zwei Stunden Verlängerung, weil das Wetter inzwischen noch schlechter wurde. Oberleutnant Michalski ist nach der Beerdigung sofort zum E-Hafen zurückgefahren, um die Briefe für die Angehörigen zu drechseln. Obwohl er stets nach dem gleichen Muster strickt, kommt er nicht recht voran, setzt einen Moment lang ab und überlegt, wer den Brief an seine Mutter schreiben wird und wann. Vater hat Michalski keinen; er ist schon im ersten Weltkrieg gefallen.
In irgendeiner schmuddeligen Kneipe, in Gesellschaft noch schmuddeligerer Französinnen, saufen sie sich ihr Weltbild wieder richtig zurecht, klopfen sich an die hochdekorierte Brust und pfeifen auf den Kater, den sie morgen haben werden. Aber morgen ist einsatzfrei, ohnedies ist es wurscht, ob sie mit Haarwurzelkatarrh starten oder nicht. Die Scheiße ist immer die gleiche, und sie sind weit von ihrem Kampfauftrag entfernt, den Himmel über Großbritannien von Feindflugzeugen freizufegen.
»Ich glaube, der Wasserlöwe ist seekrank«, sagt Feugele.
»Kümmere dich lieber um die Rote da hinten«, versetzt Hinrichs, »bevor die anderen sie uns wegschnappen.«
Die Kellner kennen sie schon und bedienen sie freundlich. Sie als Franzosen sind zwar nicht sehr gut auf deutsche Soldaten zu sprechen, aber wenn schon, sind ihnen die Männer vom fliegenden Personal noch am liebsten, weil sie ihre Fliegerzulage am Tresen versaufen und hohe Trinkgelder geben. Gelegentlich fragen sie nach dem einen oder anderen, dessen Namen sie aufgeschnappt haben, und dann gibt es meistens betretene Gesichter, und das heißt: Den hat’s erwischt, oder, wie Güßregen es formuliert: »Jagdflieger leben gut, aber kurz.«
»In der Mitte von dem Teiche schwimmt ’ne nackte Frauenleiche.«
Möllner hebt das Glas zum üblichen Trinkspruch: »Und auf ihren prallen Brüsten frönen Frösche ihren Lüsten.« Sie lachen noch immer über den Kalauer und fallen im Chor ein: »Und durch den Geschlechtskanal windet sich ein fetter Aal. Und der Arsch, der war bemoost –« Sie drohen am Lachen zu ersticken. »Prost!«
Am 19. Juli 1940 war die Reichshauptstadt ein riesiges Flaggenmeer. Begeisterungsstürme fegten über die Straßen. Hitler feierte in Berlins Kroll-Oper seinen Triumph über Frankreich. »In dieser Stunde fühle ich mich verpflichtet«, sagte er unter donnerndem Applaus, »noch einmal einen Appell an England zu richten. Ich glaube dies tun zu können, weil ich ja nicht als Besiegter um etwas bitte, sondern als Sieger für die Vernunft spreche.«
Die Briten lehnten ab. Sie dachten nicht an einen Frieden, so wie der Diktator nie daran gedacht hatte, gegen England Krieg zu führen. Durch eine mißverständliche Äußerung des Fliegergenerals Hans Jeschonnek war das Gerücht aufgekommen, Hitler habe vor Dünkirchen seine Panzer bewußt angehalten, um die Engländer zu schonen. Davon konnte keine Rede sein, aber als der selbsternannte Feldherr jetzt die Invasion auf die Insel anordnete, tat er es seltsam halbherzig.
»Die deutschen Generale waren sich der Risiken voll bewußt, die ihre Truppen eingehen würden, wenn sie das Meer überquerten«, schreibt Liddell Hart. »Sie zweifelten daran, daß Marine und Luftwaffe die Durchfahrt freihalten könnten, und drängten darauf, daß die Invasion auf einer genügend breiten Front durchgeführt werden sollte (von Ramsgate bis Lyme Bay), um die englischen Verteidigungskräfte zu verzetteln und abzulenken. Die deutschen Admirale hatten noch größere Befürchtungen darüber, was geschehen würde, wenn die britische Flotte am Schauplatz auftauchte. Sie hatten wenig oder kein Vertrauen auf ihre eigene Fähigkeit, ein solches Eingreifen zu verhindern. Daher betonten sie, daß dem Plan des Heeres, der nach einer breiten Invasionsfront verlangte, unmöglich Dekkung gegeben werden könne und daß die Überquerung auf einen relativ schmalen, minengeschützten Korridor mit kleineren Heeresstreitkräften beschränkt bleiben müßte – Einschränkungen, die wiederum die Zweifel der Generale vertieften. Vor allem betonte Admiral Raeder, daß die Luftüberlegenheit in der Überfahrtzone unentbehrlich sei.
Nach einer Besprechung mit Raeder am 31. Juli akzeptierte Hitler die Ansicht der Marine, daß ›Seelöwe‹ nicht vor Mitte September gestartet werden konnte. Aber die Operation wurde bis 1941 aufgeschoben, da Göring versicherte, die Luftwaffe könne sowohl das Eingreifen der britischen Marine verhindern als auch die britische Luftwaffe vom Himmel verjagen ...«
Inzwischen wurden von deutscher Seite drei Luftflotten für die »Operation Seelöwe« bereitgestellt. Sie sollte mit einem Donnerschlag eröffnet werden. Die Luftwaffe verfügte dafür über 1000 Bomber, 870 Jäger, 330 Stukas und 270 Zerstörer. Die Ju 87 konnten, ebenso wie die Mes, von E-Häfen am Kanal aus starten. Aus Südnorwegen sollten Ju 88 gegen England fliegen. Die Einsatzzeit hing nur noch vom Wetter ab. Nach Möglichkeit Anflug in den Wolken, Angriff bei strahlendem Sonnenschein. Stichwort des Startbefehls: »Adlertag.«
Die ersten Verbände wurden am 13. August um 5 Uhr 30 über Amiens festgestellt, ein zweiter bei Dieppe, ein dritter über Cherbourg. Das Wetter war ideal, aber sowie die Verbände den Wolkenschutz verließen, waren die Spitfires und Hurricanes da und stürzten sich auf die Angreifer, trafen und wurden getroffen. Während sich die Jäger wilde Luftschlachten lieferten, waren die Kampfflieger ungeschützt. Rund um die Uhr hetzte Göring seine Verbände in die Schlacht, aber nur selten trafen sie die neun ausgesuchten Ziele in Südostengland.
Abfangjäger sprengten auch die zweite Welle noch vor dem Bombenwurf. Und die dritte. Den ganzen Tag tobte eine blutige und erbarmungslose Luftschlacht. Die He 111 zerplatzten am Himmel. Aus den Ju 88 sprangen die Besatzungen in die Gefangenschaft ab. Und die lahmen Ju 87 erwischte es oft noch beim Rückflug über den Kanal. An diesem Tag verloren die Deutschen 55 und die Engländer 13 Flugzeuge. Der Nimbus der Luftwaffe begann zu verblassen.
Der »Adlertag« – eher einer des Pleitegeiers.
Schon bei der Eröffnung der Battle over Britain deutete sich ein Verschleiß- und Abnutzungskampf an, der Werner Mölders – As, Idol und erster General der Jagdflieger – später bekennen ließ: »Ich habe hundert Alpträume erlebt. Als die Luftschlacht zu Ende war, war ich ein alter Mann ...«
Der Adlertag war flügellahm. Am 14. August verhinderte das schlechte Wetter massive Luftoperationen, aber am Donnerstag, den sie den blutigen nennen werden, war alles, was Schwingen hatte, unterwegs auf die Insel. Die Verbände überquerten den Kanal, ließen die weißen Kreidefelsen von Dover hinter sich, zogen zielstrebig über den Garten Englands, die Grafschaft Kent, weiter. Sie hatten keine Feindberührung, als sie die feudalen Herrensitze und verfallenen Burgen, die mittelalterlichen Kathedralen und die riesigen Obstplantagen überflogen. Die Landschaft wirkte schön und friedlich, von keiner Sprengwolke verunstaltet – aber die Idylle erwies sich als trügerisch und hinterhältig.
Kurz vor London, das ein Führerbefehl ausdrücklich zum Sperrgebiet für alle deutschen Flugzeuge erklärt hatte, wendeten die Mes, flogen zum Kontinent zurück. Noch immer keine englischen Jäger im Einsatzraum. Das Fighter Command hatte seine Jagdstaffeln nach hinten verlegt und benutzte die küstennahen Einsatzhäfen nur noch zum Auftanken oder für Notlandungen.
Über dem Kanal begegneten die zurückfliegenden Jäger den ersten Stuka-Staffeln im langsamen Anflug auf die Flugplätze. Mit einem Schlag verwandelte sich Englands südöstliches Paradies in ein feuerspeiendes Inferno. Sperrballons wurden mit Raketen bis zu 1800 Meter hochgeschossen, um Flughäfen und Rüstungszentren vor Tieffliegern zu schützen. Die Flak feuerte wild und zielsicher. Und plötzlich waren die Spits und Hurris da, pickten sich rücksichtslos aus den Verbänden ihre Opfer heraus, sprengten die Angriffskeile noch vor dem Bombenwurf, stellten sich jetzt auch den deutschen Begleitjägern zu verwegenen Zweikämpfen. Die Ju 87 des Sturzkampfgeschwaders 1, die Vorreiter des Angriffs, mußten sich quer durch die britischen Jagdstaffeln quälen. Die langsamen Todesvögel ließen sich über die Tragflächen abrutschen. Die Verfolger schossen an ihnen vorbei wie Jagdhunde an einem kleinen Vierbeiner, der sie mit einem Haken austrickste, aber sie kamen wieder.
Oder sie suchten sich andere Ziele. Verbände von 80 bis 150 Maschinen waren im rollenden Einsatz. Drei Luftflotten setzten jede startklare Maschine ein und brachten so das höchste Aufgebot zusammen, das je während des zweiten Weltkriegs die Insel angreifen sollte. 1786 Flugzeuge waren eine Übermacht, die ausreichen mußte, die Royal Air Force so anzuschlagen, daß ein Kanalübergang unter deutschem Luftschirm zum Ausflug auf die Insel würde.
Die Kampfszenen wechselten ständig, aber die Briten zauberten. Jeder anfliegende Verband wurde schon vor dem Ziel abgefangen und aufs Korn genommen. Wo immer Kampfflugzeuge mit dem Balkenkreuz auftauchten, ob über Middlewallop, West Malling oder Martelsham, die Spitfires standen zum Empfang bereit, immer im rechten Moment, stets am bedrohten Ort. Sie kannten das Angriffsziel, als hätten sie an den Einsatzbesprechungen ihrer Gegner teilgenommen. Es war wie in der Fabel, in der sich der Hase zu Tode hetzt, weil der Igel immer schon vor ihm am Ziel ist.
Die Engländer verfügten über zwei mächtige Trümpfe, von denen ihre deutschen Gegenspieler nichts wußten: In Frankreich hatte ein Geheimkommando die Chiffriermaschine »Enigma« erbeutet, die das deutsche Oberkommando verwandte, und sie auf die Insel geschafft; sie wurde in Bletchley Park installiert. Britischen Wissenschaftlern gelang es, diese elektronische Kassandra in kürzester Zeit in Betrieb zu nehmen. Wenn an die deutschen Kampffliegerstaffeln die Einsatzbefehle ergingen, wußten die Briten bereits im voraus, wo sie zuschlagen würden. Enigma blieb eines der bestgehüteten militärischen Geheimnisse des zweiten Weltkriegs und wurde erst in den letzten Jahren bekannt.
Die zweite Geheimwaffe hätte Göring erkennen müssen, denn die Deutschen verfügten unter dem Namen »Funkmessung« über eine – noch etwas unterentwickelte – gleiche Errungenschaft. Was die Luftwaffenbesatzungen für Spuk hielten, war elektronische Hexerei und hieß Radar. Die gesamte englische Küste war mit einer Kette von elektronischen Stationen überzogen. Die Funktürme der »Chainhome« mit ihrer Höhe bis zu 80 Metern konnten nicht übersehen werden, und sie wurden auch zunächst angegriffen, freilich mit wenig Erfolg.
»Schon über dem Pas de Calais wurden unsere noch in der Sammlung befindlichen Verbände erfaßt und nicht mehr aus dem Radarauge gelassen«, schreibt in seiner Autobiographie »Die Ersten und die Letzten« der deutsche Jagdfliegergeneral Adolf Galland. »Jede unserer Bewegungen projizierte sich auf die nahezu lückenlosen Luftlagebilder in den britischen Jägerleitzentralen, auf Grund deren das Fighter Command in der Lage war, seine Jagdkräfte zum günstigsten Zeitpunkt und am günstigsten Ort in die Schlacht zu führen.
Wir waren auf unser eigenes, menschliches Auge im Kampf angewiesen. Die britischen Jäger konnten sich auf das sichere und um ein Vielfaches weiterreichende Radarauge verlassen. Unsere Einsatzbefehle waren etwa drei Stunden alt, wenn wir in Berührung mit dem Gegner kamen, die britischen nur so viel Sekunden, wie von der Erfassung der jüngsten Lage mittels Radar bis zur Übermittlung des entsprechenden Angriffsbefehls an den in der Luft befindlichen Verband von der Jägerzentrale aus notwendig waren.«
Eine weitere Begünstigung der Engländer war offenkundig: Sie kämpften mit Platzvorteil. Wurde einer ihrer Piloten abgeschossen und konnte sich mit dem Fallschirm retten, saß er unter Umständen schon eine Stunde später wieder in einer Ersatzmaschine. Ein deutscher Flugzeugführer aber geriet in Gefangenschaft und war für die Luftwaffe für den Rest des Krieges verloren. Mit dem neuen englischen Rüstungsminister Lord Beaverbrook saß ein blendender Mann auf dem richtigen Stuhl; er kurbelte die Produktion so an, daß die Briten zweieinhalbmal so viele Jagdflugzeuge bauten wie ihre Gegner.
Zudem war das Fighter Command hervorragend organisiert und geführt. Air Chief Marshal Sir Hugh Dowding, ein schwächlich wirkender Mann mit einem knöchernen Gesicht und leicht stechenden Augen, war ein Sonderling, ein Spiritist, der glaubte, mit seinen abgeschossenen Piloten zu verkehren. Raymond Cartier nennt ihn die »farbloseste und kälteste Persönlichkeit der englischen Fliegerei«. Bei seinen Leuten trug Dowding den Spitznamen »Stuffy«, der Muffel. Er hatte eine Abneigung gegen Uniformen, was ihn nicht daran hinderte, bis Kriegsbeginn 53 Jagdstaffeln aufzubauen und die Spitfire durchzupauken. Sein Hauptquartier war eine Mädchenschule.
Dowding leitete von Bently Priory aus die Battle over Britain, die in erster Linie ein Krieg der Jäger gegen die Jäger war. Er konnte auch auf polnische und französische Piloten zurückgreifen, die sich freiwillig für die Verteidigung Englands gemeldet hatten. Beide Seiten hatten bald ihre Lufthelden, und die Mölders’ und Gallands hießen bei den Briten Sergeant James H. Lacey oder Squadron Leader D. R. S. Bader; sie errangen, gleich ihren Gegenspielern, einen Luftsieg nach dem anderen.
Bader, dem beide Oberschenkel nach einem Flugzeugabsturz amputiert werden mußten, nannte man in England das »Wunder ohne Beine«. Er führte die 242. Staffel. Alarmstart, nachdem über Radar zwei deutsche Pulks mit je dreißig Maschinen gemeldet worden waren. Bader flog auf Südostkurs. Die Bomber standen über Northweald. Die sechs Hurris stellten sich auf die Flächenspitzen, gingen aus der Sonne heraus in die Kurve. Der Group Captain nahm sich die Zweimotorigen vor, versuchend, die gegnerische Formation zu sprengen und durch sie hindurchzufliegen. Der Motor dröhnte. Die Silhouetten der Feindmaschinen wurden groß, größer. Bader erwischte die dritte Welle.
»Während er mit seinen beiden Rottenfliegern herankommt, eröffnet er das Feuer, ist dann plötzlich zwischen den Bombern und stürzt nach unten weg«, schreibt in seinem Buch »Jagdflieger« Edward H. Sims. »Da er so unerwartet durch die Formation durchschießt und nach unten taucht, kurven die erschrokkenen Piloten der Do 17 und Me 110 nach allen Richtungen weg. Die zweite Kette zischt durch die gesprengte Formation und schießt; Bader fängt seinen Sturz ab und zieht wieder hoch – wo er sich nun eines der abgesprengten Flugzeuge aussuchen kann. Im Hochziehen, mit McKnight links und Crowley-Milling rechts hinter ihm, sieht er über sich voraus drei Me 110, die nach rechts kurven. Er nimmt sich den letzten in dieser Formation vor und richtet die Nase seiner Hurricane auf den Zweimot-Jäger. Nach einem Sturz von 3000 Fuß, mit Vollgas, hat er jetzt einen ganz schönen Zahn drauf. Bader beobachtet, wie die Tragflächen der Me 110 in seinem Visier wachsen. Der feindliche Pilot zieht hoch und kurvt scharf nach rechts. Bader folgt ihm. Die Spannweite wächst weiter im Visier. Er holt rasch auf ... Näher ... noch näher. Jetzt ist er dran ... Schußentfernung!
Sein Daumen geht nach unten, und die acht Browning-MGs knattern los. Die Hurricane schüttelt unter dem Feuerstoß. Bader ist so nahe, daß die konzentrierte Garbe genau in die Me 110 hineinfetzt. Stücke fliegen nach hinten ab. An der Flächenwurzel züngeln Flammen auf. Bader sägt jetzt beinahe mit seinem Propeller das Leitwerk des Feindflugeuges an und nimmt den Daumen vom Abzugsknopf. Die zweimotorige Messerschmitt fällt aus ihrem Turn heraus nach unten rechts. Eine schwarze Rauchwolke markiert den Weg ihres Sturzes ...«
Bisher war die Luftschlacht mit Siegen und Verlusten für die Briten wie die Deutschen verlaufen. Beide Seiten holten nicht nur die gegnerischen Flugzeuge herunter, sondern sie logen auch, was die Abschußzahlen anbelangte, das Blaue vom Himmel. Aber es war unübersehbar, daß die Engländer mit der Zeit die Luftüberlegenheit gewinnen würden, womit sie den »Seelöwen« nicht mehr zu fürchten brauchten.
Bisher war die deutsche Befehlsgebung zerfahren gewesen, unkoordiniert, sprunghaft. In der zweiten Phase der Schlacht um England wurde ein neue Taktik erprobt: Kleine Kampfverbände griffen unter starkem Jagdschutz sorgfältig ausgewählte Ziele an, und das waren in erster Linie die Sector Stations, die Jägerleitstände rund um London: Kenley, Biggin Hill, Hornchurch und Northweald. Wenn das Fighter Command seine E-Häfen noch weiter nach hinten verlegen mußte, drohte ihm der Verlust der kurzen Anflugwege; wenn die deutschen Angriffe mit gleicher Heftigkeit weitergeführt würden, konnte die Luftwaffe voraussichtlich binnen einer Woche die Luftherrschaft wieder erringen.
Churchill erkannte es.
Kurz zuvor waren ihm vom US-Geheimdienst Berichte zugespielt worden, daß Hitler ungemein heftig auf die in ihrer Auswirkung eher lächerlichen Bombenangriffe der Briten auf Ziele in Deutschland reagierte.
In der Nacht zum 25. August waren einige versehentlich geworfene deutsche Bomben auf das Londoner Stadtgebiet gefallen. Göring drohte, die Besatzungen vor das Kriegsgericht zu bringen. Churchill, niemals zimperlich, sah jetzt eine Rechtfertigung für einen Gegenschlag: Er brachte 81 Wellington- und Hampden-Bomber für einen Angriff auf Berlin zusammen. Niemand konnte sagen, wie sie die 2000 Kilometer lange Reise überstehen würden. Aber Churchills Spekulation war, daß der Hysteriker Hitler, wenn auch nur einige Bomben auf die Reichshauptstadt fielen, sofort Vergeltungsangriffe auf London anordnen und dadurch die schwer angeschlagenen Jägerleitstände entlasten würde.
Der 25. August, ein Sonntag, war ziemlich bewölkt, so daß die zu dieser Zeit ohnedies mangelhafte Navigation noch erschwert wurde. Nur 29 englische Maschinen kamen überhaupt in die Nähe Berlins; nur einige kreisten über der Stadt und warfen insgesamt 22 Tonnen Bomben auf ihre nördlichen Vororte.
Am nächsten Tag heulten die Sirenen wieder.
Diesmal gab es zwölf Tote und achtundzwanzig Verletzte.
Hitler ging sofort in Churchills Falle: Er ordnete den Zielwechsel seiner Geschwader nach London an.
Das Invasionsheer für die Insel, die seit Wilhelm dem Eroberer im Jahre 1066 kein Feind mehr betreten hat, steht bereit. Trotz aller Bedenken hat die Kriegsmarine den nötigen Schiffsraum zusammengebracht. In Calais spielt sich ein Herr Dix auf, als sei er bereits der für Großbritannien ernannte höhere SS- und Polizeiführer. Er führt eine Liste mit den Namen von mehr als zweitausend Engländern mit sich, die sofort nach der Besetzung der Insel verhaftet werden sollen. Tausende von Plakaten, die vorsorglich gedruckt wurden, fordern die Briten in ihrer Sprache unter Androhung von Strafe auf, sich gegenüber den deutschen Besatzungstruppen loyal zu verhalten. Es fehlt nur noch gutes Wetter und der von Göring immer wieder zugesicherte, lückenlose Luftschirm, unter dem der Seelöwe über Südenglands Steilküste springen soll.
»Die Planungen und Vorbereitungen gingen weiter, und das belagerte England mußte mit ansehen, wie der von Hitler beherrschte Kontinent sich für die Feuerprobe rüstete«, schreibt in seinem Buch »Große Schlachten des Zweiten Weltkriegs« der US-Autor Hanson W. Baldwin. »Anfang September 1940 hatte die deutsche Admiralität 168 Transportschiffe von insgesamt 700 000 Tonnen sowie 1910 Kähne, 419 Schlepper und Trawler und 1600 Motorschiffe bereitgestellt und bereits begonnen, diese Flotte nach Süden in die Kanalhäfen von Rotterdam bis Le Havre zu verlegen. Nach vielen Zwistigkeiten und scharfen Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Wehrmachtsteilen entwarf Hitler einen Kompromißplan, dem zufolge in einem ersten Ansturm 90 000 Mann in breiter Front zwischen Folkstone und Bognor an Land gehen sollten. Die 16., 9. und 6. Armee – 13 Divisionen für den Angriff, 12 als Reserve – sollten den Kanal überqueren, die Ufer stürmen und England erobern.«
Die Engländer erkennen die Gefahr.
»Die R.A.F. greift die vollgestopften Häfen Vlissingen, Ostende, Dünkirchen, Galais und Boulogne an«, schreibt Janusz Piekalkiewicz, »wo über 1000 Flußkähne für die Operation ›Seelöwe‹ bereitliegen und noch einmal 600 weitere flußaufwärts bei Antwerpen. Allein in der Nacht zum 13. September werden im Hafen von Ostende 80 Binnenschiffe versenkt. In der Nacht vom 14. auf den 15. September 1940 wiederholt die R.A.F. die Angriffe gegen Schiffsziele in den Häfen zwischen Boulogne und Antwerpen. Die Transportflotte für ›Seelöwe‹ erleidet besonders in Antwerpen schwere Verluste.«
Der englische Geheimdienst schließt aus der deutschen Truppenkonzentration und aus der Berechnung von Mondlicht wie Flutverhältnissen, daß der Sturm auf die Insel in der zweiten Septemberwoche losgelassen werden soll. Dafür spricht noch ein weiteres Indiz: Reichsmarschall Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe, kommt an die Kanalküste. Er steigt aus seinem mahagonigetäfelten Salonwagen »Asien«, bombastisch, eitel, bramarbasierend, seine kolossale Körperfülle in eine selbstentworfene Kreation in Weiß gepreßt; er nimmt grimmigen Gesichts mit erhobenem Marschallstab die Meldung entgegen. Der Mann, den das Jägeras des zweiten Weltkriegs (der spätere Inspekteur der Bundesluftwaffe, Johannes Steinhoff) »fett, faul und korrumpiert« nannte, heißt bei der Bevölkerung längst »Hermann Meier« – so wollte er heißen, wenn es auch nur einem Feindflugzeug gelänge, die deutsche Reichsgrenze zu überfliegen.
Oberleutnant Michalski, Staffelkapitän im Jagdgeschwader 27, in einer zum Empfang des Reichsmarschalls kommandierten Offiziersgruppe, sieht die roten Saffianstiefel des schwammigen Eisernen, stupst seinen Nebenmann mit dem Ellbogen. »Da siehste, was draus wird, wennste mit ’ner Schauspielerin verheiratet bist«, albert er.
Bis vor kurzem hatte zwischen dem Oberbefehlshaber und den Jagdfliegern ein unbedingtes Vertrauensverhältnis bestanden; es blieb während der Battle over Britain als erstes auf der Strecke. Der nächste Ausfall waren die berühmt-berüchtigten Stukas, sie mußten aus dem Kampf genommen werden, da sie unter R.A.F.-Schlägen vom Himmel gepurzelt waren wie Fallobst. Als nächster Posten stand die Me 110 auf der Verlustliste; statt als Langstreckenjäger die Kampfflieger zu begleiten, mußten die Zerstörer ihrer fehlenden Wendigkeit und zu langsamen Geschwindigkeit wegen selbst den Schutz von Me 109 anfordern.
Auch die deutschen Kampfflugzeuge hatten bei der sich monatelang hinziehenden Luftschlacht keine Siegeschance. Mit zweimotorigen Bombern war höchstens ein Zehntel der Insel zu erreichen; es rächte sich jetzt, daß die Forderung des 1936 abgestürzten Generals Walther Wever nach der Entwicklung eines viermotorigen »Ural«-Bombers aufgegeben worden war.
Diesmal nimmt sich Göring, sonst in viele Spielereien verstrickt, Zeit; er klappert die E-Häfen ab, drohend, jovial, lächerlich und gefährlich, ein Mann, »der wie eine Frau über die in aussichtslosen Unternehmungen erlittenen Verluste weinen konnte« (Herbert Molloy Mason). Göring taucht überraschend auf. Im Gefechtsstand des Jagdfliegerführers Oberst Theo Osterkamp findet er ein Schild mit der Aufschrift: »Welche Führung brauchen die Engländer, wenn sie den Krieg verlieren wollen?«
»Osterkamp, das geht gegen mich«, fährt ihn der Reichsmarschall an. »Das kommt sofort runter!«
Die miese Stimmung auf den E-Häfen ist auch für ihn unüberhörbar. Er hatte befohlen, daß die Jägerkommandeure ihre Gefechtsstände so nahe an die Küste zu verlegen hätten, daß sie den Kanal überblicken könnten. Während Göring über die Klippen des Cap Blanc Nez stapft, hört er Oberst Werner Junck maulen: »Ich werde mir einen neuen Gefechtsstand mitten im Kanal bauen. Bei Flut stehe ich bis zum Hals im Wasser, bei Ebbe stehe ich bis zu den Hüften im Wasser – aber ich werde dem Feind mitten ins Gesicht schauen.«
In seinem Buch »Adlertag« berichtet der britische Autor Richard Collier über Hauptmann Heinz Bär, einen störrischen Sachsen, der vor Görings Augen von einer Spit abgeschossen worden war. »Ein Patrouillenboot hatte Bär aus dem Bach gefischt. Er wurde triefnaß und bis auf die Knochen frierend vor Göring geschleppt. Als der Reichsmarschall ihn wie ein leutseliger Onkel fragte, woran er denn eigentlich im Wasser gedacht habe, antwortete der Sachse ziemlich mißmutig: ›An Ihre Rede, Herr Reichsmarschall – daß England jetzt keine Insel mehr ist.‹«
Schon im Morgengrauen des 7. September herrscht auf den nordfranzösischen E-Häfen der deutschen Luftwaffe die Unruhe vor dem Sturm. Obwohl die Maschinen längst startklar sind, fummeln die Bordwarte noch an ihnen herum. Die Besatzungen wissen, daß der massierte Schlag erst am Nachmittag erfolgen soll, aber sie sind vorzeitig aus ihren Zelten, Baracken und Bauernstuben gekrochen und hören oder verzapfen Latrinenparolen.
Der Angriff gilt Loge.
Eine Stadt dieses Namens ist auf keiner Karte zu finden. Loge steht für London. Der Angriff auf die Weltstadt soll Vergeltung für Berlin sein, zugleich aber die dezimierte Jagdwaffe der R.A.F. – die erwartungsgemäß die Themse-Metropole erbittert verteidigen wird – endgültig vernichten.
»Am 6. September geht beim Geschwader ein Fernschreiben ein«, schreibt in seinem Buch »Kampfgeschwader 4« Karl Gundelach: »›Bis 7. 9. abends ist Einsatzbereitschaft auf höchsten Stand zu bringen.‹ Während die Techniker fieberhaft arbeiten, findet am nächsten Vormittag bei der Fliegerdivision eine Kommandeurbesprechung über den Einsatz statt: Es geht gegen London. Sämtliche Verbände der Luftflotten 2 und 3 sind zu einem Großangriff auf die englische Hauptstadt eingesetzt.«
Wie immer hat Bletchley Park die britische Luftverteidigung gewarnt, wie immer haben die Radartürme die anfliegenden Geschwader vorzeitig ausgemacht. Das Fighter Command nimmt an, daß seine Gegner heute einen letzten vernichtenden Schlag gegen die schwer angeschlagenen Jägerleitstände führen wollen, und schickt die Spits und Hurris im Alarmstart los – ein schwerer, wenn auch nicht unlogischer Fehler.
In unmittelbar aufeinanderfolgenden Wellen fliegen starke Kampfverbände erstmals den Lauf der Themse entlang. Sie lassen die bisher permanent angegriffenen Fighter-Bastionen in Kent und Essex ungestört und ziehen in Richtung London weiter, nehmen an der Themse-Schleife, die sie bald die »große Angstkurve« nennen werden, Maß.
In der Sieben-Millionen-Stadt heulen die Sirenen; sie heulten schon öfter, und immer war es blinder Alarm gewesen. Die Passanten bleiben auf der Straße stehen, die Gäste in den Pubs sitzen. Die Flak wagt zunächst nicht zu schießen, um nicht durch Schrapnells die Zaungäste des Todes zu gefährden. Endlich, als die ersten Reihenwürfe auf die Docks und auf das Arsenal von Woolwich niederrauschen, flüchten sie in die U-Bahn-Stationen.
Die Abwehr wirkt schwach. London ist fast schutzlos. Als die Spitfires und Hurricanes verspätet dorthin geleitet werden, müssen sie herunter, um aufzutanken.
Im Osten der Stadt turnt ein riesiger Rauchpilz nach oben. Dutzende von Bränden suchen sich zu einem Flammenmeer zu vereinigen. Neue Angreiferformationen erscheinen unter starkem Jagdschutz. Aus den Bombenschächten rauscht der Tod. Die Pulks drehen in Richtung Ärmelkanal ab und begegnen neuen anfliegenden Kampfstaffeln, die Begleitjäger sind so unbeschäftigt, daß einige von ihnen auf dem Rückflug die Sperrballons abknallen. Es sieht aus, als metzelten gierige Großwildjäger hilflose Dickhäuter.
Über der Themse steht eine Feuerglocke; sie beleuchtet die Angreifer von unten. In Radio BBC wiederholt ein aufgeregter Feuerwehroffizier immer wieder: »Schickt uns alle Pumpen, die ihr auftreiben könnt! Hier steht die ganze Welt in Flammen! Alle Pumpen, Leute, hört ihr.«
Die Fahrzeuge auf den Straßen jagen in Richtung Osten zu den Dockanlagen; ein endloser Lindwurm, dem Zug der Lemminge gleich. Mitunter stockt die Kolonne, dann krepieren zwischen ihr Bomben, und die Fahrzeuge laufen Slalom um Trichter. Es wird unerträglich heiß. An manchen Stellen kocht der Asphalt. Wer hineintritt, verliert Fuß, Bein, Leben. Der Tod bahnt seine Gassen quer durch London. Die Feuerzangen fressen sich bis zur City durch.
Das bei den Surrey-Docks gestapelte Bauholz brennt lichterloh. 250 Morgen. Das Feuer greift auf die Lagerhäuser über; Farben und Lacke mästen die Vernichtung. Gleich dahinter platzen verzischend Hunderte von Rumfässern. Der Alkohol heizt die Flammen zusätzlich an. Sie greifen auf ein Lagerhaus mit Pfeffer über. Was der Rauch nicht schafft, erledigt schließlich das Gewürz, quält die geröteten Augen, trocknet sie nässend.
Die meisten Bomben krepieren in der Stadtmitte und im Osten Londons. Auch die City steht in Flammen. Die rollenden Angriffe ziehen sich über acht Stunden hin. 625 Kampfmaschinen, begleitet von 648 Jägern und Zerstörern, werfen 300 Tonnen Sprengbomben und 13 000 Brandgeschosse. »Als die Flugzeuge, die je 1 SC 1800 kg ›Satan‹ geladen haben, kurz vor Mitternacht anfliegen, ist das brennende London schon aus 200 km Entfernung auszumachen«, schildert Karl Gundelach den Einsatz des Kampfgeschwaders »General Wever«. Die Dockanlagen bilden einen Feuersaum links und rechts der Themse. Straßen verwandeln sich in Flammenfallen. Aus Kellern werden Tote und Lebende geborgen. Zum ersten Mal sind die gespenstischen Klopfzeichen Eingeschlossener zu hören. Es ist die erste von sechsundachtzig Bombennächten, die London über sich ergehen lassen muß.
»The Blitz« hat begonnen; in den ersten beiden Bombennächten werden 842 Menschen getötet und 2347 verletzt.
Um 20 Uhr 53 waren sich die britischen Generalstabschefs einig, daß die Bombardierung Londons die Einleitung der Invasion auf die Insel sei. Sie lösen das Kennwort »Cromwell – Invasion imminent« aus, womit alle britischen Truppen und Heimwehrleute vor der unmittelbar bevorstehenden Invasion auf die Insel gewarnt werden.
Plötzlich läuten die Kirchenglocken. Wegkreuzungen werden verbarrikadiert, Brücken gesprengt. Auf den verstopften Straßen stranden Militärfahrzeuge. Die Befehlsverbindungen brechen ab. Die Home Guard, die Besenstielarmee, mobilisiert sich. Von Dorf zu Dorf fliegt die Schreckenskunde, daß deutsche Fallschirmjäger abgesprungen seien. Keiner der martialischen Amateurkrieger weiß während des nächtlichen Spuks, was wirklich los ist.
In Dover meldet man, daß Dungeness von den Deutschen längst erobert sei, und in Dungeness entsetzt man sich über die Besetzung Dovers durch die Hunnen. Und tatsächlich sind die Nachrichten, die jetzt von Dorf zu Dorf gehen, etwa so schnell und so schrecklich wie zu Zeiten Attilas. Laufend werden Angriffe deutscher Fallschirmjäger gemeldet, doch nichts ist zu hören außer zackigen Kommandos, Flüchen, Glockengeläute. Und die Motoren neu einfliegender Kampfverbände.
Auf den Hauptstraßen, die landeinwärts nach Canterbury, Maidstone und Horsham führten, standen Truppen neben drei Meter über der Erde angebrachten 2500-Liter-Tanks bereit, schildert Richard Collier, »aus denen sie die vorrückenden Deutschen mit einer Mischung von Benzin und Dieselöl besprühen würden – ein breiter Strahl von 120 Litern in der Minute, der mit einer Temperatur von fast 300 Grad brannte ...«
Die ganze Nacht hindurch steht die Heimwehr auf Posten. Zum ersten Mal nach neunhundert Jahren sind sie alarmiert worden, und die Leute greifen nach den abenteuerlichsten Waffen – von afrikanischen Wurfspeeren bis zu vier Dutzend rostigen Armeegewehren, Modell 1902, Überbleibseln einer Aufführung des Londoner Drury-Lane-Theaters. Um Southampton herum schlafen Truppen der 4. Division voll angekleidet und mit dem Gewehr neben sich schlecht und recht in Omnibussen.
Nicht Angst und Entsetzen verschulden das heillose Durcheinander, sondern der Tatendrang örtlicher Befehlshaber. Churchill, der zufällig auf seinem Landsitz Chequers weilt, weiß nicht, daß in diesen Stunden Gegenstöße gegen feindliche Luftlandetruppen geführt werden, die an allen Orten gesehen werden und doch unsichtbar bleiben. Er schläft tief, und im übrigen gilt seine Anweisung, daß er erst dann geweckt werden dürfe, wenn die USA in den Krieg eingetreten seien.
Selbst bei Tageslicht setzen sich die Jagdszenen in Südengland noch fort. Gerüchte jagen weiterhin durchs Land. Brandmeister Thomas Goodman von der Londoner Feuerwehr, der vorübergehend nach Dover abgestellt ist, hört von einer versuchten Landung in der Sandwiehes-Bucht und behauptet, das Wasser der Küstennähe sei schwarz von toten Deutschen.
Während Göring, umgeben von seinen Offizieren, auf seinem Kommandostand an der Kanalküste unwürdige Freudentänze aufführt, mitten in der Nacht seine Frau anruft und mit überschwappender Stimme in die Muschel schreit: »Ganz London brennt!«, begreift man in Südengland aufatmend: Blinder Alarm.
Der Seelöwe ist nicht gesprungen; er wird auch nicht – wie geplant – am 15. September 1940 springen. Die »Operation Seelöwe« bleibt wasserscheu. Gerade als die Schlacht um England auf dem Höhepunkt steht, eröffnet Hitler seinen Vertrauten, daß er – so bald wie möglich – die Sowjetunion angreifen wird.
Der 15. September ist ein Tag, an dem beide Seiten noch einmal die Entscheidung suchen: 200 deutsche Bomber, begleitet von etwa 600 Jägern, nähern sich wiederum London.
»An diesem Tag kommt es zur grimmigsten, verworrensten und weiträumigsten Schlacht der ganzen Auseinandersetzung – er ist der Ruhmestag für ›Stuffy‹ Dowdings Jäger«, sehreibt Hanson W. Baldwin. »Sie erzielen nach ihren Berichten die meisten Abschüsse der Schlacht; 185 feindliche Maschinen wurden zerstört. Die Deutschen geben 43 Abschüsse eigener Maschinen zu, verloren in Wirklichkeit aber 60. Ihre Bombenangriffe sind militärisch wirkungslos; selbst Görings Rezept ›fünf Jäger pro Bomber‹ konnte die Hurris und Spits nicht ausschalten.«
Am Abend jagen Siegesmeldungen durch London. Zwar sind die Abschußzahlen wieder einmal gewaltig übertrieben, aber es steht fest, daß alle Anstrengungen Görings, die Insel sturmreif zu bomben, vergeblich bleiben. Er bindet seinen Me 109 250-Kilo-Bomben unter den Rumpf – die Flugzeugführer nennen es verächtlich Dodelschleppen – und macht aus Jagdflugzeugen Bluffbomber, aber er kann die Briten damit nur ein einziges Mal überraschen und muß künftige Angriffe in die Nacht verlegen.
London liegt im Bombenhagel. »Business as usual«, spotten die Engländer, oder sie sagen: »London can take it« – London kann es verkraften.
Wenn es dunkel wird, ziehen Tausende von Familien, ausgestattet mit Decken, Matratzen und Thermosflaschen, von den Slums des Eastends in den Westen, weil sie annehmen, daß in den Vierteln der Reichen die Mauern den Bomben besser trotzen würden. Zu vielen Tausenden quellen die Menschen in die U-Bahn-Schächte, Frauen und Kinder, mit Katze und Hund, ohne Panik, fast stumm. Die Aufrufe zur Evakuierung verhallen meistens unbefolgt. Keiner will vor den »lausigen Jerrys« flüchten. Auch die königliche Familie bleibt im Buckingham-Palast, der prompt getroffen wird. Bomben rauschen auf den Tower, in Madame Tussauds Kabinett schmelzen die Wachsfiguren. Alle Bahnhöfe der Stadt werden zerstört. Old Bailey, das berühmte Schwurgericht, und Guildhall, das Rathaus, fallen in Trümmer. Fleet Street, die Pressestraße, brennt aus. Die Ruinen der City überragt die mächtige Kuppel der St.-Pauls-Kirche. Im Hafen und in den Docks bleibt kein Stein über dem anderen.
Die Luftschlacht um England wird sich weit in das Jahr 1941 hineinziehen; ihre Wucht freilich nimmt ab, auch wenn beide Seiten laufend ihre Überlebensrekorde brechen. Ein R.A.F.-Pilot übersteht siebzehn Abschüsse heil; ein anderer springt nackt aus der Badewanne in eine »Spit«, wird von einer Me 109 abgeschossen und gleitet am Fallschirm über Londons Eastend auf die Ruinen zu, kommt inmitten einer Schar aufgebrachter Frauen auf, die ihn mit Nudelhölzern und anderem Küchengerät lynchen wollen. Nur eine Suade ordinärer Cockney-Flüche läßt die Aufgebrachten erkennen, daß es sich bei dem Bruchpiloten im Adamskostüm um einen der Ihren handelt.
Auf Buckhurst in Sussex, dem Gut des Grafen de la Ware, meldet der Butler: »Ein Offizier der deutschen Luftwaffe wartet im Salon und möchte mit Ihnen sprechen, Mylord.« Auf der Cadborough Farm bei Rye findet ein Landarbeiter einen halb im Ziegeldach des Klosetthäuschens eingebrochenen und steckengebliebenen Bruchpiloten. Während der Brite ihn gefangennimmt, sagt der Deutsche in fehlerlosem Englisch: »Ich bin da wohl von einer Scheiße in die andere geraten.«
Die Luftwaffe verliert in 23 Tagen 467 Jäger. Leutnant Erich Hohagen stellt fest: »Der Kanal ist eine Blutpumpe, er saugt immerzu an der Kraft.« Oberleutnant Hans von Hahn, Führer der ersten Gruppe im Jagdgeschwader 3, berichtet: »Es gibt nicht viele bei uns, die nicht mit total zusammengeschossener Maschine oder ohne Propeller im Kanal notgelandet sind.«
Hauptmann Helmut Wick, eine Zeitlang der erfolgreichste deutsche Jagdflieger, konnte keine feste Nahrung mehr vertragen und lebte nur noch von schwarzem Kaffee und englischen Zigaretten. Unteroffizier Delfs lieferte einer eigenen Maschine einen rabiaten Luftkampf, stieg mit dem Fallschirm aus und verfing sich in den Weichen eines Rangiergeleises bei Calais. Sein Staffelkapitän Priller griff einen herannahenden Zug, der Delfs zu zermalmen drohte, frontal an und stoppte ihn mit seinen Bordkanonen.