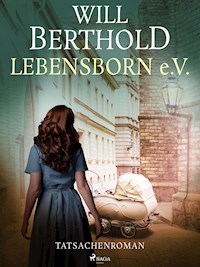Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Unter diesem Titel verbirgt sich eine groß angelegte Chronik des Erfolgsschriftstellers Will Berthold zum Zweiten Weltkrieg. In sieben Kapiteln werden Kriegsschauplätze behandelt, die für die Deutschen im Weltkrieg wegweisend werden sollten. Dem ganzen Buch den Titel gegeben hat das erste Kapitel, in dem die oft tödlich verlaufenden Absprünge der deutschen Fallschirmspringer auf Kreta eindringlich beschrieben werden. Andere Kapitel befassen sich mit dem Überfall auf Russland, der Niederlage bei Stalingrad oder den Kämpfen des Afrikakorps gegen die Briten in Nordafrika. In bewährt geschickter Form verknüpft der Autor Faktenzusammenstellung mit romanhaften Schilderungen, die den Leser in die Geschichten hineinziehen. Hautnah wird dem Leser vom Autor, der den Krieg selbst als Soldat erlebt hat, das Schicksal der Männer im Angesicht des Todes vor Augen geführt. Exzellente Recherche und große Emotionen machen das Buch zu einem bleibenden Leseerlebnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Sprung in die Hölle
SAGA Egmont
Sprung in die Hölle
Genehmigte eBook Ausgabe für Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
Copyright © 2018 by Will Berthold Nachlass,
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de).
Originally published 1987 by Engel Verlag, Germany.
All rights reserved
ISBN: 9788711727201
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Sprung in die Hölle
Im ersten Schatten des Abends sehen die dreimotorigen Flugzeuge aus wie Schwärme dunkler Aasgeier, die mit gebrochenen Schwingen auf ihren Opfern hocken. Pfiffe schallen über den verstaubten E-Flughafen Megara in der Nähe von Athen.
Es ist der 19. Mai 1941 nach 21 Uhr.
In mäßiger Eile quellen die Männer der dritten Kompanie des II. Fallschirmjägerbataillons aus den Zelten. An ihren roten Halstüchern erkennt man sie als Grüne Teufel. Mäßig ausgerichtet treten sie am Appellplatz in Linie zu drei Gliedern an.
»Wir werden morgen früh auf Kreta abgesetzt«, gibt Oberleutnant Karsten den Einsatzbefehl. »Wir springen in ein englisches Zeltlager neben dem Flugplatz bei Malemes. Herrschaften, ich erwarte, daß ihr ausgeschlafen seid.« Der Kompaniechef verzieht das Gesicht. Der drahtige Offizier radiert das Lächeln gleich wieder aus seinem Gesicht: »Wenn wir diesen Flugplatz bis Mittag nicht genommen haben, sind wir im Eimer.« Sein Blick geht über die Front seiner Leute. »Wer soll das schaffen – außer uns.«
Die Kompanie brüllt Zustimmung. Die Männer stehen nebeneinander, hundertfünfzig braungebrannte, sehnige Burschen. Die wenigsten von ihnen wissen, wo Kreta liegt, ob es eine Stadt ist, eine Insel oder ein Land, und manche hätten Kreta vor zehn Minuten noch für eine Frau gehalten.
Die Kompanie tritt weg.
»Na, endlich«, sagt der Gefreite Panetzky mit der Nickelbrille.
Lärmend stimmen ihm die anderen zu. Endlich ist das blödsinnige Herumlungern auf dem durchglühten Feldflughafen vorbei. Schluß mit dem verdammten tintigen Rotwein, in dem sich Panetzky die Füße wäscht, finito auch die schäbigen Erlebnisse in der Athener Vorstadtkaschemme mit den zehn malerisch drapierten Mädchen.
Und dann gibt’s Schnaps. Drei Flaschen pro Gruppe. Gleichzeitig erläßt der Spieß ein Trinkverbot, das er selbst nicht ernst nimmt. Bernhard Ramcke, der es vom Schiffsjungen zum Fallschirmjägergeneral bringen wird, gab ihnen die Devise: »Ihr dürft alles – nur euch nicht erwischen lassen.«
Im rötlichen Glanz der sinkenden Abendsonne läuft die Kompanie auseinander, vorbei an Flugzeugen, an denen das Bodenpersonal schuftet. Behälter mit Waffen, Munition und Proviant werden angeschleppt.
Es ist nicht mehr ganz so heiß, aber noch immer scheuern die Uniformen auf den schweißnassen Körpern. Man hat versäumt, den Grünen Teufeln leichte Tropensachen zu verpassen. Sie werden morgen mit derselben Ausrüstung über Kreta abspringen wie im Vorjahr über Narvik.
Panetzky und Schöller erreichen gleichzeitig das Zelt. Sie knallen die Kochgeschirre mit dem Schnaps auf den Tisch aus Kistenbrettern, Schmidtchen ist damit beschäftigt, Aktfotos mit großer Sorgfalt von der Zeltwand abzumontieren.
»Willst du sie mitnehmen?« fragt Panetzky.
»Worauf du dich verlassen kannst, Kumpel«, antwortet der beste Jäger der Gruppe.
Wolfgang Stahl, als Abiturient mit dem Spitznamen Professor versehen, kniet am Boden und werkelt an seinem Fallschirm.
»Was machst du denn da?« fragt Panetzky lachend.
»Sicher ist sicher«, brummelt der Professor und wird rot. Morgen ist sein erster Einsatz.
»Der Herr Professor haben Schiß, was?« fragt Panetzky mit tückischer Sanftheit.
Paschen erhebt sich langsam, richtet sich auf zu einer imponierenden Länge. »Halt’s Maul!« sagt der Mecklenburger gedehnt. Seine langen Flossen pendeln. »Ich hab’ jedesmal Schiß, daß dieses Scheißding nicht aufgeht. Aber wenn du meinst, daß ich keinen Mumm hab’…«
Die Jäger richten den Brotbeutel, Pistolen, Magazine, Feldflaschen und Spaten zu säuberlichen Haufen zusammen. Erst dann gehen sie an den Schnaps. Er läuft ihnen durch die Gurgel wie der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein.
Sie geben auch dem staksigen Mennler etwas ab, obwohl ihm gar nichts zusteht, da von jeder Kompanie dreißig Mann wegen Platzmangels in der Maschine Zurückbleiben müssen. Der Gefreite hockt herum wie ein Trauerkloß; zwar hat der Kompaniechef einfach bestimmt, wer mit in den Einsatz geht, aber Mennler empfindet es als Schimpf, am Sprung in die Hölle nicht teilnehmen zu können.
Fallschirmjäger haben ihre besondere Moral, ihren eigenen Ehrenkodex. Sie kämpfen weniger, wie es in den Nachrufen heißt, »für Führer, Volk und Vaterland« als für das bunte Halstuch, das sie verbotswidrig tragen, und für die Privilegien, die sie sich anmaßen.
Mennler, zum Beispiel, hat sich in einem Athener Kabuff mit ein paar Gebirgsjägern angelegt, die sich an seine blonde Mazedonierin heranmachen wollten. Es gab eine handfeste Schlägerei, und der Gefreite zog den kürzeren, aber ein deutscher Parachutiste gibt nicht auf, vor allem nicht bei einer Balgerei mit Männern von einem anderen Haufen. Mennler zündete eine Nebelkerze und zog Leine. Am nächsten Tag wurde nach dem Täter gesucht. Alle wußten um seine Heldentat, aber keiner verpfiff den Gefreiten. Die ganze Kompanie erhielt dafür Ausgehverbot, aber darum scheren sich die Grünen Teufel ohnedies wenig. Wenn sie Lust haben abzuhauen, gehen sie weg. Hauptsache, sie sind beim Wecken wieder da.
»Nu schneid kein solches Gesicht, oller Nebelkerzenwerfer«, tröstet ihn Panetzky.
»Halt’s Maul«, kontert Mennler.
»Laß ihn in Ruhe«, sagt Paschen. »Aus einem traurigen Arsch kommt nie ein fröhlicher Furz.«
Der Gefreite will dem Mecklenburger an die Gurgel fahren, aber die anderen treten dazwischen und raten dem aufgebrachten Mennler, zum Alten zu gehen, um doch noch zum Einsatz eingeteilt zu werden.
Der Flugplatz kommt nicht zur Ruhe. Benzinfässer werden über die Startbahn gerollt, Kommandos schwirren durcheinander. Irgendwo plärrt ein Kofferradio: »J’attendrai – le jour et la nuit – j’attendrai toujours.«
Oberleutnant Karsten und Leutnant Petri sitzen vor ihrem Zelt. Mechanisch sehen sie immer wieder auf die Armbanduhr. Mennler pirscht sich seitlich an die Offiziere heran, baut sich auf und grüßt: »Bitte Herrn Oberleutnant sprechen zu dürfen.«
»Was gibt’s denn, Mennler?«
»Bin morgen nicht zum Einsatz eingeteilt«, sagt der Junge und schluckt. »Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, Herr Oberleutnant. Ich will mit.«
»Tut mir leid.« Der Kompaniechef zuckt die Schultern. »Mensch, sind Sie doch froh«, tröstet ihn Leutnant Petri. »Sie würden sich ja doch bloß den Fuß verstauchen.«
Der Gefreite dreht sich um. Unmilitärisch. Wie in der Mädchenschule. Tränen schießen ihm über das Gesicht. Er will sie verbergen, aber da wird es bloß noch schlimmer.
»Scheußlich ist das«, sagt der Oberleutnant zu Petri, »hab’ einfach dreißig Mann bestimmt. Kann ja schließlich nicht selbst zu Hause bleiben, damit noch einer von ihnen mitkommt.«
Stunden später löst sich die Spannung.
»An die Maschinen!« kommt das Kommando.
»Rot scheint die Sonne«, grölen die Soldaten in den grauenden Morgen. »Fertiggemacht!« Lautstark und überzeugt singen sie ihr Lied: »Wer weiß, ob sie morgen uns auch noch lacht…«
Morgen ist heute. Heute hat schon begonnen. Mit Klimmzügen ziehen sich die Fallschirmjäger an den Griffen in die Ju. Schwerbepackt. Einer hinter dem anderen, passieren sie die Hühnerleiter des Schicksals. Der Professor fühlt das Gewicht des Fallschirmsacks schwer im Rücken. Gutmütig haut ihn Schmidtchen, der perfekte Soldat, mit der flachen Hand ins Kreuz: »Nu los, mach schon!« Und auch Mennler ist mit von der Kreta-Partie als Ersatz für einen der eingeteilten Springer, der über Nacht eine Blinddarmentzündung bekam.
Über das Flugfeld braust ein einziger Dauerton. Maschine auf Maschine springt an, speit Kaskaden schwarzer Qualmwolken über das Feld. Zwischen den Flugzeugen jonglieren motorisierte Feldküchen. Es gibt Kaffee mit Schnaps. Verhältnis zwei zu eins. Die Jäger drängen sich in die offene Tür, halten die Kochgeschirre hinaus. Ihre ausgestreckten Arme sehen aus, als griffen sie ein letztes Mal nach einem sicheren Halt.
»Glückliche Reise!« lallt Panetzky.
Und dann kommt die erste Panne: Der Massenstart platzt. Die Luftwaffe machte ihre Rechnung ohne den Sand. Jede Maschine wirbelt eine Dreckwolke auf, die den Start der nächsten für Minuten unmöglich macht. Es herrscht die Finsternis eines Sandsturms. Auf den anderen Feldflughäfen rings um Athen dasselbe Bild: Überall Sand, Verspätung auf Verspätung.
»Wie wenn eine Ziege auf ein Trommelfell scheißt«, flucht Oberleutnant Karsten.
Brummend schwebt die Ju in die Luft. Gleißend und strahlend bricht die Sonne durch die ausgehängte Tür in den Rumpf der Dreimotorigen. Eng nebeneinander sitzen die Männer am Boden. Unter ihnen die Küste Griechenlands. Dann das goldübergossene Mittelmeer.
Die anderen Maschinen kurven ein, sammeln in befohlenen Lufträumen, sammeln verspätet. Ganze Geschwader von Jus tauchen am Himmel auf, ziehen dahin wie ein Schwarm langsamer Störche.
An den offenen Türen stehen die Männer der Todeskommandos, winken einander zu, schneiden Faxen, lachen wie die Kinder.
Auf einmal neigt sich die Ju auf die Seite. Sie zieht eine große Schleife. »Was ist denn los?« brüllt der Oberleutnant in die Kanzel.
»Wir müssen anders anfliegen«, schreit der Pilot zurück. »Zuviel Feuerzauber. Die Tommies haben an der Nordküste ihre ganze Marine zusammengezogen.«
»Das fängt schon hübsch beschissen an.« Der Kompaniechef grinst. »Wie fühlt ihr euch?«
»Prima«, überschreien die Männer den Motorenlärm.
Der Zeitplan gerät durcheinander. Der deutsche Angriff aus der Luft soll in zwei Wellen rollen, weil nicht genügend Transportmaschinen vorhanden sind. Die Formation verliert rasch an Höhe.
Die Fallschirmjäger langen mechanisch nach den Haltegriffen. Das Meer unter ihnen trägt Schaumkronen. Kreta in Sicht. Gelb und verbrannt, sandig und verdorrt. Die Grünen Teufel rappeln sich hoch, starren auf das Land, das sich in wenigen Sekunden in ein Schlachtfeld verwandeln wird. Sand, nichts wie Sand, Steine und wieder Steine. Hügelwellen rauf, Hügelwellen runter.
Plötzlich knallt es an allen Ecken und Enden. Die Männer werfen sich auf den Boden. Es klatscht kurz und trocken. Glas klirrt. Die Ju neigt sich über die Tragfläche. Leuchtspurmunition. Es knattert blödsinnig. Es hört sich an, als ob dumme Jungen Kieselsteine gegen die Metallwand werfen würden.
»Das hält unser Schlitten aus bis ans Ende der Welt«, brüllt der Gefreite Mennler.
»Die da unten brauchen wir nicht mehr aufzuwecken«, stellt der Kompaniechef trocken fest.
Die Ju am linken Flügel trudelt mit brennenden Motoren in die Tiefe. Nur einer kommt heraus, löst sich wie ein dunkler Punkt. Aber der Schirm öffnet sich nicht. Der dunkle Punkt klatscht in den gelben Sand, bleibt breit und schwarz liegen, wie festgedrückt vom Daumen des Schicksals.
Der Kompaniechef steht an der Tür. Neben ihm Paschen, der Absetzer. Das Boschhorn tutet. Der Oberleutnant springt als erster, dann Schmidtchen, dann Panetzky, dann die anderen. Stahl, der Professor, greift zweimal daneben, als er den Schnapphaken festmachen will. Paschen hilft ihm, gibt ihm einen Schwung. Stahl greift ins Leere. Er hört noch, wie ihm Paschen etwas nachschreit. Die Stimme dröhnt ihm noch in den Ohren. Er gleitet nach unten aus 100 Meter Höhe; Mennler folgt ihm.
20 bis 30 Sekunden zwischen Himmel und Hölle. Der Kompaniechef ist der Erde am nächsten. Am dichtesten am Feind. Er starrt nach oben. Großartige Burschen: Die weißen Tupfen der Fallschirme blühen nebeneinander auf wie die Blumen eines enggebundenen Margeritenstraußes. Unten: die Zelte.
Soldaten rennen durcheinander. Gestalten in Khakihemden. Noch 60 Meter bis zur Erde. Von der Erde knallt es dünn und meckernd herauf. In der Zeit zwischen Absprung und Aufkommen ist ein Fallschirmjäger hilflos. So lange hängt er wie tot – und mancher wirklich tot – am Schirm.
Der Oberleutnant bringt die Maschinenpistole in Anschlag. Noch in der Luft fetzt er den ersten Feuerstoß in die Tiefe. Das macht ihm keiner nach. Er pfeift auf die Landung und platzt mitten in die olivgrüne Landschaft, um die khakifarbene Gestalten tanzen. Er landet auf den Beinen, kommt blendend auf. Abrollen, aufstehen. Die Gurte vom Schirm reißen. Eine einzige Bewegung. Schwein gehabt.
Drei, vier, fünf Gestalten hasten auf ihn zu. Der Offizier steht breitbeinig da, die Maschinenpistole in der Hüfte.
Scheppernd rasselt der Feuerstoß aus dem Lauf. Er bedient die MP, als sei er mit ihr aufgewachsen. Mit einem einzigen Stoß mäht er die Heranstürmenden um.
Dann erst erkennt er das Fiasko: Nicht Tommies wollten ihn greifen, sondern Italiener, die ihm begreiflich machen, daß sie Kriegsgefangene sind.
»Ihr Scheißkerle«, brüllt Karsten, »könnt ihr nicht früher eure weißen Rotzfahnen zeigen?«
»Villen Dank, Kamerad, grazie tante«, stottert der Italiener.
Es knallt und blitzt von allen Seiten. Das ist echter Gefechtslärm.
»Los, ab!« brüllt der Kompaniechef seinen Männern zu. »Ihr drei hier ins Loch. Die anderen rechts. Munition sparen! Nur gezielt schießen!«
Die Kompanie sammelt. Viele Verluste, doch keine Zeit zur Inventur. Auf dem rechten Flügel steht die Paschen-Gruppe. Granaten orgeln heran, krepieren im Sand, wirbeln Fontänen aus Dreck und Steinen auf.
Leutnant Petri, der als letzter springen soll, hat ein Granatsplitter noch an Bord der Ju getroffen. Der erste Tote. Stahl, der Professor, pendelt am Fallschirm auf die Bäume zu, deren Äste sich wie Polypenarme nach ihm strecken. Der Schirm verheddert sich in der Krone. Der Junge hängt mit dem Kopf nach unten am Baum. Verzweifelt versucht er loszukommen. Er liegt im Feuer der Engländer. Querschläger zischen an ihm vorbei.
Sinnlos versucht er, ihnen mit dem Kopf auszuweichen wie ein Schuljunge, der Ohrfeigen entgehen möchte.
»Spruuuuuuuuuuuuung!« brüllt Paschen.
Die Gruppe hetzt über die deckungslose Fläche, Richtung Olivenhain. Das Maschinengewehr klirrt an Schöllers Hüfte. Die Reserveläufe pendeln zwischen Panetzkys Beinen.
»Lauf, du Arsch!« brüllt Panetzky dem gemächlicher zukkelnden Schützen I zu.
Panetzky haut sich in Deckung, sucht seine Nickelbrille, setzt sie auf. In diesem Moment sieht er den Professor am Baum. Er verliert den Verstand, heult vor Wut, schreit, tobt, Schaum vor dem Mund. Er vergißt das taktische Ziel, hastet auf den Baum zu, in kurzen Sprüngen. Hinter ihm bauen Schöller und Mommer Lafette und MG zusammen. Eine Kugel klatscht ins Gestänge, reißt Mommer einen Fetzen aus dem Knochensack.
Panetzky geht es zu langsam. Er springt auf, jagt auf den Hain zu, schlägt Haken wie ein Hase, haut sich unter den ersten Baum.
»Hammel!« flucht Schöller. Er beißt die Zähne aufeinander, schießt, wie er noch nie geschossen hat, scharf an Panetzky vorbei, verschafft ihm Luft.
»Ich komme!« brüllt Panetzky. Er ist am Baum, springt hoch, das Kappmesser in der Hand. Zwei-, dreimal versucht er es. Dann gibt er die Deckung auf. Zweige peitschen ihm ins Gesicht. Er säbelt an den Gurten. Links und rechts zischen die feindlichen Geschosse vorbei. Endlich fällt der Professor wie ein Sack zu Boden.
Panetzky zieht ihn hinter den nächsten Stamm. Seine Wahnsinnstat reißt die ganze Gruppe mit. Karsten springt auf, schleudert Handgranate auf Handgranate. Er legt zwischen die beiden und den Feind eine Wand aus Granaten und Feuer.
Panetzky beugt sich über Stahl.
»Willi«, flüstert der Professor.
Panetzky schluckt; in der nächsten Sekunde durchsiebt eine MG-Garbe seinen linken Oberschenkel.
Es ist der 20. Mai, vormittags neun Uhr. Zu dieser Stunde stehen die Fallschirmjäger, aufgeteilt in drei Sturmgruppen, im Kampf gegen eine hoffnungslose Übermacht. Auf der 30 Kilometer breiten Insel soll die Gruppe West – zu ihr gehören Oberleutnant Karsten und seine Männer – den Flugplatz Malemes und die Höhe 107 nehmen. Die Gruppe Mitte ist auf die Hauptstadt Chanea, die Sudabucht und den Flugplatz Rethymnon angesetzt, und die Gruppe Ost hat den Befehl, den Flughafen Heraklion im Sprung zu erobern.
Die fünftgrößte Insel des Mittelmeeres wird zur Hölle. Die eingezeichneten Flakstellungen entpuppen sich als Holzattrappen, dafür landen die Springer inmitten gutgetarnter Stellungen der in hektischen Vorbereitungen zur Festung ausgebauten Insel. Überall springen die Männer aus niedrigster Höhe. Mörderisches Abwehrfeuer empfängt sie. Viele fallen, bevor sie die Erde erreichen. Ganze Kompanien werden falsch abgesetzt. Freund und Feind verkeilen sich am Boden in Nahkämpfen.
Während sie sich in die Erde krallen, fliegen die Jus – dank der Luftüberlegenheit gingen nur sieben Maschinen verloren – nach Athen zurück, um die zweite Welle heranzuschaffen. General Student ist noch immer in Athen. Er hat keine Funkverbindung zu seinen Männern, die in der Falle sitzen. Noch immer weiß er nicht, daß er die Lage viel zu optimistisch eingeschätzt hat.
»In dichten Gruppen wurden die Springer über ihren Angriffszielen abgesetzt«, schreibt W. Haupt. »Sie sprangen an vielen Stellen mitten hinein in den abwehrbereiten Feind, der den Finger am Abzug hatte. Das hatte niemand erwartet. Viele Fallschirmjäger wurden bereits beim Niederschweben vom feindlichen Abwehrfeuer erfaßt und kamen auf der Erde tot oder verwundet an. In dem unübersichtlichen und meist dichtbewachsenen Gelände war es äußerst schwierig, die Waffenbehälter zu finden. Viele Behälter landeten in den Stellungen des Feindes, dem sie ein willkommener Zuwachs seiner Kampfmittel waren. An anderen Stellen wiederum verhinderten die Empire-Truppen durch konzentriertes Abwehrfeuer ein Bergen der Waffenbehälter, wenigstens bei Tage.
Das III. Bataillon des Sturmregiments wurde schon während des Niederschwebens und der Landung von schwerem Abwehrfeuer getroffen. Das Bataillon, dessen Kompanien zudem weit verstreut abgesetzt wurden, erlitt hohe Verluste und war nicht mehr angriffsfähig…«
Während Hitler auf die Schlacht um England konzentriert war, hatte dem Balkan, von jeher Europas Pulverfaß, die Explosion gedroht. Stalin nutzte Hitlers Kraftanstrengung im Westen, um seine Raubpolitik voranzutreiben. Das Baltikum war von ihm kassiert worden. Am 26. Juni 1940 hatte er an Rumänien ein Ultimatum gestellt, Bessarabien und die Bukowina an die Sowjetunion abzutreten. Hitler, der ohne Rumänien die deutsche Kriegsmaschinerie nicht ölen konnte – bei Kriegsbeginn hatte Großdeutschland über eine Reserve von 2,5 Millionen Tonnen Benzin verfügt, die synthetische Produktion ergab weitere 3,5 Millionen Tonnen, aber bereits im ersten Kriegsjahr benötigten Panzer, Flugzeuge und die übrigen Wehrmachtsfahrzeuge 11,5 Millionen –, fürchtete den Ausbruch eines sowjetisch-rumänischen Krieges und gab Bukarest den Rat, der Erpressung nachzugeben, um nicht vom Ölhahn abgeklemmt zu werden.
Der billige Landerwerb der Russen machte nunmehr den Ungarn und Bulgaren Appetit auf rumänisches Gebiet. Der Konflikt drohte zum Waffengang zu werden; eine willkommene Gelegenheit für Rußland, sich das ganze Petroleumland einzuverleiben und dadurch Hitler wirtschaftlich in die Hände zu bekommen.
Die Achsenmächte schafften am 30. August 1940 – unter dem Eindruck der an der Grenze aufmarschierten sowjetischen Divisionen – durch den sogenannten zweiten Wiener Schiedsspruch gewaltsamen Frieden, gegen den wiederum Moskau protestierte. Zu den »Brandenburgern« und den »Lehrtrupps«, die sich bereits in Rumänien aufhielten, kamen noch getarnte SS-Verbände, die General Ion Antonescu, dem Chef der profaschistischen »Eisernen Garde«, bei der Machtergreifung behilflich waren.
Das widernatürliche Bündnis zwischen der Sowjetunion und Großdeutschland zeigte bald nach Hitlers noch geheimem Entschluß, die UdSSR zu überfallen, die ersten Risse. Trotzdem erklärte sich Stalin am 25. November 1940 bereit, dem Dreimächtepakt Deutschland-Italien-Japan beizutreten, falls die neuen Partner seine Landnahmen billigten. Moskaus treuherzige Brutalität brachte nichts, denn Hitler hielt sein rotes Pendant hin und arbeitete bereits am »Fall Barbarossa«.
Die Lage auf dem Balkan war halb stabilisiert. Nicht die Russen, sondern Benito Mussolini, Hitlers Nachahmer, warf die Funken in das Pulverfaß. Er war eifersüchtig auf die militärischen Erfolge seines Achsenpartners und verärgert, weil er von Hitlers einsamen Entscheidungen niemals vorher in Kenntnis gesetzt worden war.
Jetzt wollte Mussolini auf dem Balkan Beute machen.
Obwohl der deutsche Diktator jede nachrichtendienstliche Tätigkeit in Italien untersagt hatte, bekam er Wind vom Tatendrang des Duce und verabredete sich schleunigst mit ihm in Italien. Als er in Florenz aus dem Zug stieg, wurde er von einem gleichziehenden Verbündeten empfangen. »Führer, wir marschieren!« begrüßte Mussolini seinen Gast. »Heute früh im Morgengrauen haben die siegreichen italienischen Truppen die albanisch-griechische Grenze überschritten.«
Sie kamen nicht weit. Schon bei Hitlers Rückkehr nach Deutschland wurden die Rückschläge offenkundig. Schlimmer aber war, daß die englische Nahostarmee von Ägypten aus den bedrängten Griechen zu Hilfe kam, und das bedeutete: Krieg auf dem Balkan. Es drohte die Gefahr, daß die griechisch-englischen Truppen vom Süden her die traditionell deutsch-freundlichen Bulgaren angreifen und dann nach Rumäniens Schwarzem Gold greifen würden.
Mitte Februar hatte Hitler in Rumänien eine Armee von 680000 Mann zusammengezogen. Am 28. überschritt sie die Donau und besetzte strategische Punkte in Bulgarien, das dem Dreimächtepakt »beitrat«.
Die Jugoslawen, unter Druck gesetzt, folgten zögernd diesem Beispiel. Es kam, bevor Hitler noch Griechenland angreifen konnte, zu einem Aufruhr der Bevölkerung und einem Regierungssturz. Der deutsche Gesandte in Belgrad wurde von Aufgebrachten angegriffen und bespuckt. Hitler bekam einen seiner berüchtigten Wutanfälle und beauftragte Göring, Belgrad in rollenden Angriffen zu zerstören.
Um seine Strafexpedition vornehmen zu können und die Engländer aus Griechenland hinauszuwerfen, verschob er die Operation »Barbarossa« zunächst um vier Wochen.
»Diese Verzögerung des Angriffs auf Rußland«, konstatiert William L. Shirer, »war wohl die verhängnisvollste Einzelentscheidung in Hitlers Laufbahn. Es ist kaum übertrieben, wenn man feststellt, er habe damit seine letzte Chance vertan, den Krieg zu gewinnen.«
Noch im gleichen Jahr werden Hitler die Generale vorrechnen, daß sie diese vier Wochen um den Sieg in Rußland vor Wintereinbruch gebracht hätten.
Blitzkrieg auf dem Balkan. Er lief wie immer. Oder noch schneller. Am 6. April rollten – ohne Kriegserklärung – deutsche Panzer von Bulgarien und Ungarn aus gegen Jugoslawien und Griechenland. Gleichzeitig wurde Belgrad von Kampfflugzeugen angegriffen und in eine Trümmerwüste verwandelt; drei Tage und Nächte kreisten sie über der gequälten Stadt, die keine Luftabwehr besaß und Hitlers Unmenschlichkeit mit 17000 Toten bezahlte.
Am 7. April war schon der Verkehrsknotenpunkt Skopje erreicht. Am 12. standen die Kampfwagen mit dem Balkenkreuz bereits vor Belgrad. Der Fall der Hauptstadt gab das Signal zum Auseinanderfallen des Vielvölkerstaates; die alten Gegensätze zwischen Serben, Kroaten und Slowenen brachen auf wie ein Geschwür. Kroatische Truppen meuterten; ganze Einheiten liefen geschlossen zum Gegner über. Am 15. April erreichten die Panzerspitzen Sarajewo; einen Tag später streckten 344000 jugoslawische Soldaten bedingungslos die Waffen.
Die Griechen wehrten sich mit Todesmut; sie waren – wie ihnen Hitler bestätigte – die einzige Erdarmee, die den Stuka-Angriffen je standgehalten hatte. Sie verschanzten sich in der vorbildlich ausgebauten Metaxas-Linie, während ihre australischen und neuseeländischen Bundesgenossen aus ihren Stellungen am Olymp geworfen wurden und ihr Dünkirchen auf dem Balkan, die Verschiffung nach Kreta und Ägypten, unter weitgehender Zurücklassung des Kriegsmaterials vorbereiteten.
Deutsche Fallschirmjäger sprangen bei Korinth ab, öffneten den Isthmus und den vorrückenden deutschen Truppen den Sperriegel bei den Thermopylen; diesmal gab es keinen Leonidas, der die Angreifer an der historischen Landenge aufhalten konnte. 50000 Mann englischer Truppen flüchteten im letzten Moment, mit König Georg II. von Griechenland. Am 27. April rückten deutsche Panzer in Athen ein. Auf der Akropolis wehte die Hakenkreuzfahne.
»Was Mussolini den ganzen Winter über nicht gelungen war, erledigte Hitler im Frühjahr in ein paar Tagen«, schreibt in dem Buch »Geheime Kommandosache« William L. Shirer.
»Trotz allen Stolzes auf seine Siege hatte Hitler weder begriffen, welchen Schlag sie für England bedeuteten noch wie verzweifelt die Lage des Empire war. Statt seine Erfolge im Mittelmeerraum zu nutzen, waren seine Gedanken schon wieder bei Rußland. ›Ob es späterhin möglich sein wird‹, erklärte er, ›die Offensive gegen den Suezkanal zu eröffnen und schließlich die Engländer aus ihrer Position zu vertreiben, kann nicht eher entschieden werden, als bis die Operation ,Barbarossa’ durchgeführt ist.‹
Die Vernichtung der Sowjetunion kam zuerst; alles andere mußte warten. Das war, wie wir heute wissen, ein entscheidender Fehler. Hitler hätte in diesem Augenblick mit einem Bruchteil seiner Kräfte dem britischen Imperium einen schweren, vielleicht tödlichen Schlag versetzen können; aber das erkannte er nicht.«
Der Blitzkrieg auf dem Balkan hatte auf deutscher Seite nur 1206 Gefallene, 3901 Verwundete und 548 Vermißte gekostet, doch General Kurt Student, der sich in Holland einen Kopfschuß geholt hatte, wußte, wie man die Zahl der eigenen Verluste in die Höhe treibt: Er schlug Hitler vor, mit seinen Fallschirmjägern Kreta oder Malta aus der Luft zu nehmen.
Der Diktator schwankte zunächst mit der Entscheidung und dann zwischen beiden Inseln. Schließlich entschied er sich für Kreta, was von der günstigsten Position aus, vom Peloponnes, dem südlichen Griechenland, ein Sprung von 100 Kilometern auf die Insel war. Kreta hat eine Seefront von 260 Kilometern und Berge, die sich bis in 2500 Meter Höhe recken. Der Hauptangriff war im dichter besiedelten Nordteil vorgesehen. Im Mittelabschnitt gab es nur eine enge, steinige Bergstraße, die der Verteidiger Kretas später die »Via dolorosa« nannte, nachdem über sie der problematische Rückzug seiner Truppen erfolgt war.
Hitler befahl, auch Gebirgsjäger von Kleinschiffen und Motorseglern mehr oder weniger heimlich – die Deutschen beherrschten den Luftraum, die Engländer das Meer – auf die Insel zu schaffen, die von dem neuseeländischen General Bernard Freyberg mit 10258 griechischen und 32382 Empire-Soldaten sowie der gesamten Mittelmeerflotte verteidigt wurde.
Die deutsche Feindaufklärung war miserabel gewesen. Man nahm zwar an, daß Kreta von schlechten Soldaten überschwemmt sei, bedachte aber nicht, daß der Verteidiger, ein notorischer Kriegsheld, über Eliteverbände verfügte. Schon Wochen vor der »Operation Merkur«, wie der Tarnname des Inselsprungs lautete, hatten die Engländer den deutschen Code geknackt und alle Angriffsvorbereitungen in Klartext übersetzt.
Freyberg kannte die Landestellen der Fallschirmjäger und brachte seine Truppen in die entsprechenden Positionen. Was ihm fehlte, waren Flugzeuge. Man hatte sie, der befürchteten Invasion wegen, nach Ägypten geschafft und die Flugplätze weitgehend zerstört, um sie für die Deutschen unbrauchbar zu machen. Schwerpunkte von Angriff wie Verteidigung lagen auf dem Westteil der Insel bei Malemes und bei Heraklion im Osten, wie um die Suda-Bucht, den britischen Flottenstützpunkt.
Am 14. Mai hatten die Luftangriffe deutscher Kampfflugzeuge des VIII. und XI. Fliegerkorps begonnen, die die Landung vorbereiten sollten. Aber es ergaben sich ungeheure Schwierigkeiten: Die Maschinen mußten von Hand aus Fässern betankt werden: 3,6 Millionen Liter Sprit. Es kam zu Verzögerungen bei den Luftangriffen. Da die Insel noch nicht sturmfrei gebombt war, wurde die »Operation Merkur« zunächst auf den 18., dann auf den 20. Mai verschoben.
Die Luftwaffe stellte 450 Kampfflugzeuge, 502 Transportmaschinen, 60 Lastensegler, vier Fallschirmjägerregimenter und Einheiten der 5. Gebirgsdivision, insgesamt ein 24000-Mann-Invasionsheer, bereit. Die Fallschirmwaffe war seit ihrer Feuertaufe in Holland erheblich verstärkt und verbessert worden. Sie verfügte jetzt über eine eigene Artillerie, ein spezielles Leichtgeschütz mit einem Kaliber von 10,5 Zentimetern; ein Drittel des Pulvergases entwich beim Abschuß nach hinten. Je eine Kanone schwebte an fünf Fallschirmen zur Erde.
Fallschirmjägern wachsen, sobald sie die Erde berühren, gleich Antäus, dem Riesen der Antike neue Kräfte, aber auf Kreta schienen sie von vornherein auf verlorenem Posten zu kämpfen, denn sie konnten das Überraschungsmoment nicht nutzen. Auf dem Flugplatz Heraklion kamen die Verwegenen mitten unter englischen Panzern auf, wurden zusammengeschossen, überrollt, zerquetscht und zermalmt, bevor sie eine Chance hatten, sich vom Fallschirm zu lösen.
Auch bei der zweiten Welle verzögern Kaskaden von Staub den Einsatz der Verstärkungen bis zu dreieinhalb Stunden. Die Verbände müssen in falscher taktischer Reihenfolge starten. Sie versammeln sich nicht mehr geschlossen über ihren Zielräumen. Der Feuerschutz der Bomber und Zerstörer verpufft ins Nichts. Der Nachschub landet zum größten Teil beim Feind.
Beim Anflug stürzt der Führer der Gruppe Mitte, Generalleutnant Süssmann, mit seinem Lastensegler auf dem Felsen der Insel Ägina tödlich ab. Generalmajor Meindl, der Führer der Gruppe West, wird gleich nach der Landung schwer verwundet. Nach dem Absetzen der Fallschirmjägerverbände fehlt beim Luftlandekorps in Athen noch immer jede Nachricht.
Der Gruppe Mitte gelingt es nicht, den Flugplatz Rethymnon zu nehmen. Der Vorstoß in die Suda-Bucht bleibt im starken Abwehrfeuer liegen. Am Abend des ersten Einsatztages ist keiner der drei Flugplätze erobert. Alle deutschen Anstrengungen konzentrieren sich jetzt auf den E-Hafen Malemes. Von der Höhe 107 aus beherrscht der Feind das Gelände durch konzentriertes Abwehrfeuer. »Wer Malemes erobert, gewinnt die Schlacht um Kreta«, hatte ein britischer Militärhistoriker festgestellt.
In Fischkuttern und Nußschalen aller Art versuchen Gebirgsjäger über die See die Insel zu erreichen. Sie waren 1500 Kilometer quer durch den Balkan getippelt, um hier vor Erreichen der Küste von englischen Verbänden versenkt zu werden.
Hiobsbotschaften auf Hiobsbotschaften: Die 12. Kompanie des Fallschirmjägerregiments III wird über einem Stausee abgesetzt. Die meisten Männer können sich nicht aus den Gurten befreien und ertrinken. Die Nachbarkompanie, die 10., springt bei Daratsos selbstmörderisch in die Feindstellung. Trotzdem gelingt es einem Zug, in ein Lager einzudringen und vierhundert Gefangene zu machen. Beim Abtransport erhalten die Grünen Teufel starkes MG- und Granatwerferfeuer. Die wenigen Überlebenden werden nun selbst Gefangene ihrer wieder befreiten Gefangenen.
König Georg II. von Griechenland hielt sich beim Angriff auf Kreta in einem Landhaus auf. Vom Fenster aus verfolgte er, wie es in nur 100 Metern Entfernung die weißen Fallschirme vom Himmel regnete. Der Monarch lief kopflos davon, flüchtete mit seinem Gefolge zu Fuß über das Gebirge, schlug sich zur Südküste durch. Am 24. nachts begab er sich an Bord eines britischen Zerstörers, der ihn nach Ägypten schaffte. Von dort aus forderte die griechische Majestät die kretische Bevölkerung auf, bis zum letzten Schuß Widerstand zu leisten. Seine Behauptung, die deutschen Todeskommandos bestünden aus Zuchthäuslern und Sittlichkeitsverbrechern, hatte bei der naiven Bevölkerung der Insel verheerende Wirkung: Verwundete wurden massakriert, Tote verstümmelt.
Die Nacht nach dem ersten Einsatztag senkt sich über Bilder des Grauens. Jeder Meter, den der verwegene Haufen erobert hat, ist mit Blut getränkt. Zu dieser Stunde erwägt Generaloberst Student, der Befehlshaber der »Operation Merkur«, den Abbruch der Schlacht um Kreta. Nur weil er seine 7000 bereits abgesetzten Fallschirmjäger nicht im Stich lassen will, entschließt er sich zur Flucht nach vorne: Er wirft seine letzten Reserven in die Schlacht.
Der gegnerische General Freyberg erbeutet den Regimentsbefehl, aber vorübergehend reißt auch die Verbindung zu seinen Truppen ab. So erfährt er nicht rechtzeitig, daß sie dabei sind, sich von dem umkämpften Flugplatz Malemes zurückzuziehen.
Mit dem Tageslicht kommen die deutschen Flugzeuge wieder und kämpfen die britische Marine nieder. Im Verlauf der Acht-Tage-Schlacht versenken sie die Kreuzer »Gloucester«, »Fiji«, den Flakkreuzer »Calcutta«, die Zerstörer »Kelly«, »Kashmir«, »Juno«, »Hereward«, »Imperial« und »Greyhound«. Beschädigt wurden die Schlachtschiffe »Barham«, »Warspite«, »Valiant« und der Flugzeugträger »Formidable«, die Kreuzer »Orion«, »Ajax«, »Perth«, »Dido«, »Naiad« und der Flakkreuzer »Carlisle«, außerdem die Zerstörer »Napier«, »Nizam«, »Kelwin«, »Nubian« und »Decoy«.
Als die Kompanie Karsten am Nachmittag des zweiten Einsatztages, unterstützt von Nachbarverbänden, die Höhe 107 nach dreistündigem Kampf erstürmt hat, verfügt sie höchstens noch über die Kampfstärke eines Zugs.
Sie mußten zusehen, wie Proviant und Munition beim Feind landeten, hatten selbst die Beutemunition verschossen, mit Handfeuerwaffen einen englischen Panzerangriff abgewehrt, eine Flakstellung erobert und erlebt, wie Schmidtchen, der perfekte Soldat, von verhetzten kretischen Bauern mit Mistgabeln und Dreschflegeln gelyncht worden war.
Unter den Männern liegt das Meer. An der Küste werden Hunderte toter Gebirgsjäger angeschwemmt.
»Mir nach!« brüllt der Oberleutnant.
Seine Restkompanie rast mit Waffen und Geräten die in drei Stunden erkämpfte Höhe auf der anderen Seite in drei Minuten hinunter. Am Horizont sieht man die Staubfahnen der sich vom Flugplatz absetzenden Engländer.
Der letzte Widerstand wird einfach überrannnt. Gerade will der Offizier eine kurze Schnaufpause einlegen, als ein Melder des Bataillons auf einem Motorrad heranbraust.
»’ne Norton«, sagt der Melder zuerst und deutet stolz auf das Beutekrad. »Die Kompanie soll den Flugplatz räumen, damit die Transportmaschinen landen können.«
»Landen?« fragt der Offizier. »Hier? … Na, mir soll’s recht sein.«
Während die Männer beginnen, die Benzinfässer wegzurollen, nimmt die britische Artillerie Maß am Flugplatz. Gleichzeitig setzt die erste Maschine zur Landung an. Sie setzt auf. Bruch. Dann kommen die Jus in Rudeln. Formationsflug. Sauber ausgerichtet. Sie verlieren rasch Höhe, fliegen den brennenden Flugplatz an. Einige zerplatzen im Tiefflug, andere stehen in Flammen, bevor sie ausgerollt sind. Die Salven des Feindes fahren zwischen die landenden Jus, die sich wie betuliche Glucken niederlassen wollen. Der Tod frißt sich satt am Flugplatz Malemes.
Und in allen Maschinen sitzen Gebirgsjäger, kreuzbrave Burschen aus Oberbayern, aus dem Allgäu, aus Tirol. Die meisten von ihnen sterben, bevor sie wissen, was auf Kreta gespielt wird.
Die Männer der Kompanie Karsten müssen ohnmächtig zusehen, wie die Soldaten mit dem Edelweiß von der feindlichen Artillerie durch den Wolf gedreht werden. Sie starren auf die Maschinen, die heil gelandet sind und sofort starten, wenn sich die menschliche Fracht durch das Ausstiegsluk gezwängt hat. Zwei Maschinen stoßen über dem Platz zusammen. Wie Bretter knallen sie zu Boden.
Die nächsten setzen zur Landung an, die sicheren Bruch bedeuten muß. Der Qualm breitet sich wie eine schmutzige Decke über das blutige Drama. Er nimmt die Sicht, treibt Tränen in die Augen, dringt in die Lungen. Er verbirgt einen Moment lang, wie sich aus dieser brennenden, donnernden Hölle Menschen erheben, sich zu Gruppen formieren, aus dem Feuer hasten und sich zum Einsatz melden.
Der lange Paschen haut sich beim Anblick der eben gelandeten Soldaten mit dem Edelweiß einfach in den Sand und heult wie ein Kind.
Kretas erster Flugplatz ist in deutscher Hand, die Verstärkung – wenn auch nur mit einem Bruchteil ihrer Sollstärke – gelandet, der Weg in das Innere der Insel frei.
Eine Woche nach Beginn der Operation wird der Widerstand der Hauptstadt Chania gebrochen, einen Tag später die Suda-Bucht genommen. Bei den Kämpfen fällt als einer der letzten der Gefreite Mennler, der unbedingt hatte dabei sein wollen.
Erst am 24. Mai – mit einer Verspätung von vier Tagen, an denen Hunderte von Müttern, ohne es zu wissen, bereits ihre Söhne verloren hatten – wagt es der deutsche Wehrmachtsbericht, den ersten Angriff auf eine Insel aus der Luft bekanntzugeben. »Die Gesamtoperationen verlaufen weiter planmäßig«, heißt es am Schluß der Meldung.
Am 27. Mai befiehlt General Freyberg die Evakuierung der Insel. Er bringt es fertig, in vier aufeinanderfolgenden Nächten unter Einsatz aller Flottenkräfte 17000 Mann – über die Hälfte des britischen Expeditionskorps – vom offenen Strand weg zu verschiffen. Die Engländer verloren an Toten, Verwundeten und Gefangenen rund 15000 Mann, zusätzlich 2011 Marinesoldaten.
Kaum erobert, verliert das deutsche Oberkommando, vollauf beschäftigt mit den Vorbereitungen des Rußlandfeldzugs, die Insel fast aus dem Auge.
Hitler überreicht General Student, der die »Operation Merkur« vorgeschlagen, durchgesetzt und befehligt hatte, das Ritterkreuz mit der Bemerkung: »Kreta hat gezeigt, daß die großen Tage der Fallschirmjäger vorbei sind; sie können nur für Überraschungsangriffe verwendet werden, und das wird in Zukunft nicht möglich sein.«
Sehr bald schon wird der Krieg im Mittelmeer und in Nordafrika beweisen, daß man die falsche Insel erobert hat, denn Malta, von Churchill als ein »unsinkbarer Flugzeugträger« bezeichnet, hatte die strategisch weit größere Bedeutung.
Für diese nachträgliche Feststellung sind 2071 deutsche Soldaten gefallen, 2594 wurden verwundet, 1780 vermißt.
Die Alliierten aber beginnen, gestützt auf die Erfahrungen von Kreta, die Fallschirmjäger als kriegsentscheidende Waffengattung zu einem Zeitpunkt aufzubauen, an dem Hitler sie, trotz ihres Wagemuts von Kreta, bereits abgeschrieben hat.
Der erfrorene Sieg
Der Frühling bringt Störche nach Rußland, Störche und noch ganz andere Vögel, die nicht zu sehen und nicht zu hören sind. Und auch nicht zu orten, denn die Sowjets haben noch kein Radar. Speziell umgerüstete Maschinen der deutschen Luftwaffe starten heimlich jeden Tag, den das Wetter freigibt, sie sind unbewaffnet, und sie schrauben sich über ihren E-Häfen in gewaltige Höhen. Offiziell wissen nicht einmal die Männer vom Bodenpersonal, wohin die Reise ihrer Flugzeuge geht.
Ende Oktober 1940 hatte Hitler persönlich den Befehl zu diesen Schleichflügen erteilt. Mit dem Ende des Winters waren die Vorbereitungen abgeschlossen, und vier Staffeln des auf Fernaufklärung spezialisierten Geschwaders Rowehl können in Ostpreußen, in Westpolen, in Budapest und Bukarest zu geheimen Flügen über Rußland starten. Ausgesuchte Besatzungen vermessen den nächsten Kriegsschauplatz.
Die gute alte He 111, eigentlich schon im Pensionsalter, klettert mit Spezialausrüstung doch noch 9000 Meter hoch. Die modifizierte Ju 88 schafft sogar 12000 Meter, im Frühjahr 1941 eine Rekordhöhe. Es ist das Jahr, in dem Hitler den Zenit seiner Macht erreicht, der Krieg aber zum Weltkrieg eskaliert. Entgegen allen Warnungen sucht der Diktator seinem Programm gemäß »Lebensraum« im roten Osten, ein »deutsches Indien«.
Auf Himmelsspione, die sich in so großer Höhe tummeln, sind die Sowjets nicht gefaßt, und so kreisen sie unentdeckt in der Stratosphäre – oder knapp unterhalb – zwischen dem Schwarzen Meer und dem Ilmensee, über Weißrußland und der Ukraine. Die einsamen Besatzungen stoßen tief in ein unermeßlich weites Land vor, aber sie kommen nicht einmal bis Moskau. Die Orte hinter der Hauptstadt der Sowjetunion bleiben böhmische Dörfer, verteilt auf Tausende von Kilometern.
Die systematische Auswertung des Bildmaterials macht wenigstens Westrußland durchsichtig. Die Luftaufnahmen werden zusammengesetzt wie Steinchen zu einem Mosaik. Es gibt bald keine militärische und keine wirtschaftliche Bastion mehr, die der deutsche Generalstab nicht kennt. Alle Flugplätze, auch die getarnten, sind erkundet.
Nach jedem Rückflug vergattert man die Besatzung aufs neue zu äußerster Vorsicht bei ihren Einsätzen. Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion sollen bis zum letzten Tag vor dem Überfall intakt bleiben. Die Russen liefern pünktlich und täglich Erdöl, Futtergetreide, Holz und Baumwolle.
In Anknüpfung an die Kreuzzüge bereitete Hitler seinen »letzten großen Feldzug des Krieges«, den Überfall auf Rußland, unter dem Decknamen »Barbarossa« vor. Die Wehrmacht hat jetzt eine Stärke von 180 Divisionen. Mehr als drei Viertel aller deutschen Soldaten werden heimlich nach Osten geschafft. »Wenn ›Barbarossa‹ steigt«, erklärt der Diktator bereits am 3. Februar 1941, »hält die Welt den Atem an und verhält sich still.«
Zwischen der Arktis und dem Schwarzen Meer vollzieht sich auf einer Frontbreite von 3200 Kilometern, vorwiegend im Schutz der Nacht, ein militärischer Aufmarsch, wie es ihn noch nie gegeben hat und wie er auch notwendig ist, wenn ein Koloß wie die Sowjetunion – laut Planung – in fünf Monaten zerschmettert werden soll. Typisch für die Tarnung zur neuen Front sind zum Beispiel die Bewegungen des Panzerregiments 35, das vorübergehend wie Gott in Frankreich an der Sonnenküste von Bordeaux gelebt hatte: Per Bahn rollten die Panzer an die Schweizer Grenze, danach nach Straßburg, über den Rhein und quer durch Deutschland nach Fulda. Es ging weiter in das Protektorat Böhmen und Mähren und dann in das Burgenland. Nach zehn Tagen stahl sich der Transport bei Nacht und Nebel nach Böhmen zurück auf den Truppenübungsplatz Warthelager und dann in die Bereitstellung im Rahmen der Heeresgruppe Mitte, 100 Meter hinter dem Bug.
»Wir hoben Splittergräben aus und tarnten unsere Fahrzeuge bis zur Unkenntlichkeit«, erinnert sich Hans Schäufler. »Alles ist ruhig. Kein Licht, kein Laut, kein Flugzeug, kein Fahrzeug, kein Soldat ist zu sehen. Die Welt um uns ist wie gelähmt. Jede Bewegung ist erstarrt. Eine beängstigende Ruhe ist um uns, eine bedrückende Unruhe in uns. Wir alle ahnen, daß uns nur noch Stunden von einem Inferno trennen. Was wird die nächste Zukunft bringen? – Welchen Preis wird sie von uns fordern? – Wir sprechen nicht darüber. Eine unbekannte Enge, fröstelnde Kälte schnürt uns die Brust ein.«
3,2 Millionen deutsche Soldaten, aufgeteilt in 19 Panzerdivisionen, 16 motorisierte und 118 Infanteriedivisionen, ergänzt durch ungarische, slowakische, rumänische und später auch finnische Einheiten, stehen bereit. 600 000 Motorfahrzeuge sind vollbetankt und fast 3000 Flugzeuge der von der Luftschlacht über England schwer dezimierten Geschwader warten auf den Befehl zum Blitzstart. Den Hauptstoß soll die Heeresgruppe Mitte unter Generalfeldmarschall von Bock führen und nach Minsk und dann nach Smolensk vordringen. Die Heeresgruppe Süd führt Generalfeldmarschall von Rundstedt; sie wird in Richtung Kiew vorstoßen. Die Heeresgruppe Nord hat sich in Ostpreußen bereitgestellt, um die baltischen Ostseehäfen zu besetzen, Leningrad und Kronstadt zu stürmen und in Karelien die Verbindung mit der finnischen Armee herzustellen.
Bereits am 18. Dezember 1940 hatte Hitler die berüchtigte Weisung Nummer 21 erlassen: »Die deutsche Wehrmacht muß darauf vorbereitet sein, auch vor Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrußland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen. Das Heer wird hierzu alle verfügbaren Verbände einzusetzen haben, mit der Einschränkung, daß die besetzten Gebiete gegen Überraschungen gesichert sein müssen. Für die Luftwaffe wird es darauf ankommen, für den Ostfeldzug so starke Kräfte zur Unterstützung des Heeres freizumachen, daß mit einem schnellen Ablauf der Erdoperationen gerechnet werden kann und die Schädigung des ostdeutschen Raumes durch feindliche Luftangriffe so gering wie möglich bleibt. Diese Schwerpunktbildung im Osten findet ihre Grenze in der Forderung, daß der gesamte von uns beherrschte Kampf- und Rüstungsraum gegen feindliche Luftangriffe hinreichend geschützt bleiben muß und die Angriffshandlungen gegen England, insbesondere seine Zufuhren, nicht zum Erliegen kommen dürfen. Der Schwerpunkt des Einsatzes der Kriegsmarine bleibt auch während des Ostfeldzugs eindeutig gegen England gerichtet. Den Aufmarsch gegen Sowjetrußland werde ich gegebenenfalls acht Wochen vor dem beabsichtigten Operationsbeginn befehlen. Vorbereitungen, die eine längere Anlaufzeit benötigen, sind – soweit noch nicht geschehen – schon jetzt in Angriff zu nehmen und bis zum 15. Mai 1941 abzuschließen. Entscheidender Wert ist jedoch darauf zu legen, daß die Absicht eines Angriffs nicht erkennbar wird.«
Der Balkan-Feldzug hatte Hitlers ungestüme Pläne um mehr als vier Wochen verschoben. Er ist in Zeitdruck geraten, denn er möchte noch vor Einbruch des berüchtigten russischen Winters die Sowjetunion erledigt haben. Militärisch gesehen ist der Diktator ein nicht unbegabter Dilettant. Persönliche Eingriffe in Polen und in Frankreich hatten tatsächlich – trotz entgegengesetzter Vorhersagen geschulter Generalstäbler – zu großen Erfolgen geführt. Dafür wird die Wehrmacht einen unerträglichen Preis bezahlen müssen, da Hitler, sich nunmehr für ein strategisches Genie haltend, immer einsamere und gefährlichere Entscheidungen trifft. Widersprüche läßt er nicht zu und löst bei Fehlschlägen, die er verschuldet, rücksichtslos seine Heerführer ab.
Es gab viele Einwände gegen einen Krieg mit Rußland. Einige Generäle erinnerten sich der Worte, die der letzte russische Zar einmal zum deutschen Kaiser gesagt hatte: »Rußland greift man nicht an; es ist kein Land, sondern ein Kontinent.« Auch der Untergang des großen Napoleon, der durch seinen Einfall in Rußland 1812 eingeleitet worden war, lag noch im Geschichtsbewußtsein vieler Militärs, aber noch näher die Erinnerung an den verhängnisvollen Zweifrontenkrieg, den sie 1914–18 zu führen gehabt hatten. Generaloberst Kurt Freiherr von Hammerstein, der ohnedies gelegentlich Hitler als »braunen Halunken« bezeichnete, hielt es von vornherein für ausgeschlossen, den Krieg im Osten gewinnen zu können.
»Niemand, kein Ratgeber, nicht die ›Tradition‹, kein Gefühl der Revanche hat Hitler dazu überredet oder gedrängt«, stellt Herbert Michaelis fest. »Selbst Göring, mittlerweile vieler seiner Illusionen beraubt und zur Resignation geneigt, suchte den russischen Krieg zu verhindern, ebenso der Großadmiral Raeder, der seine maritimen Pläne durch die russische Zielsetzung verdrängt sah. Auch Ribbentrop und Keitel erhoben ihre gewichtlosen Stimmen zu vorsichtiger Warnung, der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, von Weizsäcker, ebenso wie der Chef der Abwehr, Admiral Canaris. Weizsäcker schrieb an Ribbentrop: ›Rußland ist kein potentieller Verbündeter der Engländer. England und Rußland schlagen – das ist kein Programme.‹«
Hitler war von vornherein auf einen Krieg gegen die verhängnisvoll unterschätzte Sowjetunion fixiert. Rassendünkel, Landgier, ideologische Gegensätze zwischen den nationalsozialistischen und den kommunistischen Diktaturen, die sich bei näherer Betrachtung doch auch sehr ähnelten, waren die Motivation. Dazu kam die Raubpolitik Stalins, der, Hitlers Krieg im Westen ausnutzend, beherzt zugegriffen hatte: Die baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen waren jetzt der Sowjetunion ganz einverleibt, auf dem Balkan den Rumänen Bessarabien und die Nordbukowina geraubt. Damit hatte die Sowjetunion im Zuge einer hemmungslosen imperialistischen Machtpolitik zwei Millionen Menschen und 450000 Quadratkilometer Land unter die Stiefel der Rotarmisten gebracht.
Hitler verfolgte den russischen Drang nach Westen mit zunehmendem Groll. Die Beziehungen zwischen Berlin und Moskau wurden, trotz aller verbalen Beteuerungen, gespannter: »Es war schließlich nicht dasselbe, ob Stalin und Hitler gemeinsam Dritte hereinlegten, oder ob sie nun anfingen, einander hereinzulegen.« (William L. Shirer)
Der Aufmarsch stand. Diesseits der Demarkationslinie beobachtete Panzergeneral Guderian, wie russische Kadetten in der alten Zitadelle von Brest-Litowsk den Parademarsch übten. Er würde die Stadt, die er schon einmal erobert hatte, mit seinen Schützen ein zweites Mal nehmen müssen, während seine Panzer über den Bug setzen und links und rechts der Stadt voranstürmen sollten.
Unentwegt rollten russische Materialtransporte nach Westen; 52 Prozent ihres gesamten Exports lieferte die Sowjetunion nach Deutschland, darunter so viel Öl, daß nach dem Zusammenbruch Frankreichs abenteuerliche alliierte Pläne aufgefunden wurden, die Erdölfelder Bakus und des Kaukasus durch Fernflugzeuge in Brand zu bomben. Jetzt wollte sie Hitler binnen weniger Wochen erobern. »Wir brauchen nur die Tür aufzustoßen«, hatte er zu seinen Generälen gesagt, »und das ganze morsche Gebäude wird zusammenkrachen.«
Ostpreußen, Juni 1941, der heißeste Sommer seit Jahren. Die Luft steht wie Brackwasser. Die Sonne sticht so wild vom Himmel, als wollte sie den Männern des Spezialkommandos Brandenburg die Zunge im Mund austrocknen, aber dagegen haben sie ein hochprozentiges Hausmittel.
Männer, vorwiegend der 10. Kompanie, sind von Federn auf Stroh gekommen. Seit Tagen lungern sie in einer Feldscheune herum, warten, daß die Zeit vergeht, hören sich die Prahlereien des dicken Melchior über seine rumänischen Abenteuer an.
»Zuletzt hab’ ich ’ne eigene Villa am Stadtrand von Bukarest gehabt«, gibt er an, »Fressen und Saufen in Hülle und Fülle. Und Weiber, Weiber, kann ich euch sagen: pechschwarze Haare, Glutaugen und Figuren, solche Apparate«, sagt er und malt mit den Händen irre Konturen in die Luft.
»Stimmt das, Jonas?« fragt der kleine Cerny.
»Im Prinzip schon«, bestätigt der Prophet und grinst. »Aber keine hat den Dicken rangelassen.«
Der Haufen lacht müde und döst weiter. Das Spezialkommando in Schönwalde bei Allenstein besteht aus jungen Spunden neben alten Hasen; sie schieben eine ruhige Kugel. Der Dienstbetrieb läuft am langen Zügel, ein bißchen Leben vor dem Sterben: Jonas, Oberleutnant Schübler und sogar der dicke Melchior können, im Gegensatz zu den Neuen, den nächsten Wahnsinnsbefehl abwarten und lassen sich lieber von der Sonne grillen als von Canaris verheizen.
Gefahr ist ihr Geschäft, und der Krieg hat jetzt viele Umschlagplätze: In Nordafrika mußte General Rommel den geschlagenen Italienern zu Hilfe kommen. Während überall Brandenburger an den Brennpunkten in Tarneinsätzen die Vorhut bildeten, verbietet der Wüstenfuchs jedes Unternehmen in der Kluft des Gegners. Dabei entgeht er nur mit Glück einem britischen Kommandounternehmen, dessen Teilnehmer in deutscher Uniform auftraten.
Was man in Ostpreußen von ihnen verlangen wird, erfahren Schübler und seine Männer wie immer auf den letzten Drücker: Erntehilfe, hieß es zunächst. Dann faselte der Kommandant etwas von einer Art Manöver. Eine Spezialtruppe soll Erntehilfe leisten? Manöver mitten im Krieg? Im Osten braut sich ein erbarmungsloser Kriegsschauplatz zusammen.
Für das Unternehmen »Barbarossa«, Hitlers Überfall auf Rußland, stellen sich auf deutscher Seite 153 Divisionen mit über drei Millionen Soldaten bereit, unterstützt von drei Luftflotten. Es wimmelt von Feldgrauen längs der Demarkationslinie, wie man die Grenze nennt, seitdem Hitler und Stalin sich einträchtig Polen unter den Nagel gerissen haben. Wohin man sieht, Panzerfahrzeuge, Artillerieeinheiten, Nachschubkolonnen, Sturmpioniere.
Lauter Erntehelfer – es wird eine blutige Ernte werden.
Ein motorisiertes Infanteriebataillon zieht an der Feldscheune vorbei und bläst den Männern der Kommandotruppe Staubfahnen in das Gesicht.
»Diese Ferkel«, schnauft und schimpft Melchior gleichzeitig.
»Da ist doch was los?« fragt der kleine Cerny, der mit den Augen die vorbeiziehende Einheit verfolgt. Er ist erst achtzehn, leidet unter seinem tschechischen Namen und hat sich deshalb freiwillig zu den Brandenburgern gemeldet, Frischware des Heldentods.
»Wo mehr als zwei Brandenburger auf einem Haufen stehen«, erwidert der Dicke zwischen Stolz und Beklemmung, »ist immer was los, mein Junge.« Er wischt sich mit den Händen den Schmutzfilm aus dem Gesicht. »Und heute abend binden wir was los.«
»Da seh’ ich schwarz«, mischt sich der Gefreite Pfänder in das Gespräch. »Wenn die Ostpreußen so viele Weiber hätten wie Gäule –«
Endlich kommt der Abend. Er bringt kaum Abkühlung.
»Kommt, Freunde«, sagt Melchior, die Betriebsnudel, »wir verpissen uns nach Allenstein.«
Auf Allenstein sind sie nicht mehr scharf, aber die meisten schließen sich doch dem Stadtbummel durch die Hauptstadt des südlichen Ostpreußens an, obwohl sie schon alle Sehenswürdigkeiten kennen: die gotische Sankt-Jakobi-Kirche, das alte Bischofsschloß, das Hohe Tor und das Neue Rathaus. Und natürlich auch die Cafés und Restaurants, in denen es vor Soldaten wimmelt.
»Der reinste Männergesangverein«, sagt Pfänder verdrossen.
»Die Konkurrenz schläft nicht«, entgegnet Melchior. »Aber um 22 Uhr müssen die in die Koje, verstehste?«
»Die Offiziere auch?« fragt Jonas und deutet mit den Augen auf ein paar junge Leutnants in Damenbegleitung.
Tatsächlich leert sich die kleine Tanzdiele mit Tanzverbot gegen 22 Uhr. Melchior peilt eine rundliche Landpomeranze an.
»Einen Schönheitspreis kriegt die nicht«, sagt Pfänder fachkundig.
»Wart’s ab«, erwidert der Dicke. »Die wird von Stunde zu Stunde schöner.«
Sie sitzen nebeneinander an der Theke, aber anstatt der Mädchen, auf die sie warten, kommen die Kettenhunde. Feldgendarmerie: ein Leutnant, ein Feldwebel, ein Obergefreiter. Ein paar Soldaten und ein Offizier verkrümeln sich freiwillig. Die Streife räumt das Lokal, stapft dann auf die Theke zu.
»Wir haben Ausgang bis zum Wecken«, sagt Melchior und präsentiert eine schriftliche Bescheinigung.
»Ihr habt wohl ’nen Gönner im Führerhauptquartier«, erwidert einer der Kettenhunde.
»Wir sind wir«, albert der Dicke, »und schreiben uns uns.«
Und dann sieht er die Rote. Eine Wucht: feines, blasses Gesicht, rotblonde Haare, giftgrüner Pullover, der sich über gutsitzenden Rundungen wölbt.
»Nun zeig, was du kannst, Casanova«, fordert Pfänder Melchior zur Blamage auf.
Viel Zeit ist nicht zu verlieren. Die Offiziere in der Ecke nehmen schon Maß mit den Augen, als sich der Dicke von der Bar wegstemmt und Kurs auf die Rotgrüne nimmt.
»Schon wieder ein Fuchs und keine Flinte«, packt er seinen geballten Charme aus.
»Schon wieder ein Affe und kein Käfig«, läßt sie ihn abfahren.
Die Kumpels krümmen sich vor Lachen, zumal jetzt auch noch der Begleiter der Angesprochenen an die Theke kommt.
Sie sitzen und saufen. Um ein Uhr ist Polizeistunde, sie wird verlängert. Um zwei Uhr machen sie sich auf die Socken, stapfen durch den Wald und singen böse Lieder. Sie werden dreimal kontrolliert, und die Feldstreifen können es nicht fassen, daß Gefreite und Unteroffiziere in diesen Tagen Urlaub bis zum Wecken haben.
Schließlich landen sie in ihrer Feldscheune.
»Außer Spesen nichts gewesen«, sagt der kleine Cerny.
»Morgen ist auch noch ein Tag«, brummelt Melchior – und erfährt Sekunden später, daß es ein Irrtum ist.
»Ab sofort Ausgangssperre«, empfängt sie Oberleutnant Schübler. »Alarm.«
»Warum?« mault Pfänder.
»Das wird Canaris persönlich erklären«, spottet der Oberleutnant, »falls er Zeit dazu hat.«
Von Schlaf keine Rede. Latrinenparolen blühen auf und verwelken sofort. Die Jungen, die es nicht erwarten können, sind aufgezogen wie überdrehte Uhrwerke.
»Nehmt doch euer bißchen Grütze zusammen«, sagt Jonas schließlich gereizt. »Ihr seht doch schon seit Tagen diesen Aufmarsch. Meint ihr, daß die Panzer spazierenfahren?«
»Du hast wohl die Weisheit mit dem Löffel gefressen«, entgegnet Pfänder.
»Ich hab’ meine Erfahrungen«, antwortet der Prophet. »Wenn ihr noch was vom Leben haben wollt, haut euch aufs Stroh und pennt. Morgen fängt der Krieg an. Für euch voraussichtlich einen Tag früher als für die anderen.«
»Was für ein Krieg?« fragt Cerny entgeistert.
»Gegen Rußland natürlich, du Armleuchter«, entgegnet Jonas grob.
Melchior und sein Anhang halten es für Unfug, während Pfänder lauthals verkündet, daß im Osten wenigstens etwas zu holen sei.
»Da haste recht«, schließt der Prophet die Debatte, »’nen kalten Arsch könnt ihr euch da holen.« Als einziger Überlebender des Holland-Kommandos an der Maas-Brücke hat er einschlägige Erfahrungen. Jonas wurde zusammengeflickt, um bei Gelegenheit wieder zusammengeschossen zu werden.
Die Blässe des dämmernden Tages verwandelt sich rasch in Hitze. An einem Ziehbrunnen bringen die Brandenburger ihre Morgenwäsche hinter sich. Ein dicker Laster brummt auf die Feldscheune zu. Pakete werden abgeladen.
»Nur rein in die gute Stube«, albert Melchior.
Und dann vergeht es ihm: Eines der Pakete platzt. Als er neugierig den Inhalt beschnuppert, stößt er auf die grüne Uniform der Roten Armee.
»Also doch Rußland«, sagt er erschrocken.
»Auf zum fröhlichen Maskenball«, befiehlt Oberleutnant Schübler mit durchaus unlustigem Gesicht.
Vorbei sind Langeweile und Blödelei. Die Männer der Gespenstereinheit stehen und starren auf die neuen Tarnuniformen.
»Da ist vielleicht wieder ein Ding im Busch«, sagt der dicke Melchior, während der kleine Cerny mit fiebrigen Augen behutsam das Zeug anfaßt, wie ein Pennäler sein erstes Mädchen.
Der Schweiß quillt ihnen aus den Poren, malt Schmutzbahnen in die jungen Gesichter. Es kommt nicht nur von der Hitze, die Angst schnürt ihnen die Kehle zusammen, aber das würden sie nie zugeben.
»Sind das eigentlich gute Soldaten?« fragt Cerny, der Blondschopf.
»Wer?« entgegnet Melchior gereizt.
»Die Russen.«
»Ach, Scheiße«, winkt der Dicke ab. »Schon mal was von Tannenberg gehört?«
Gerade als sie mit der Kostümprobe beginnen wollen, prescht ein Kradmelder an und holt Schübler zum Kompaniegefechtsstand.
»Packt das Zeug wieder ein und legt Stroh darüber«, befiehlt er. »Wartet, bis ich zurück bin. Sprecht mir mit keinem über diese komischen Dinger.« Er nickt ihnen zu.
»Gekados«, brummelt er noch, das heißt: Geheime Kommandosache. Die Verletzung der Schweigepflicht ist mit der Todesstrafe bedroht.
Er schwingt sich in den Sattel des Motorrades. Der Melder gibt Gas, dreht auf, als seien die Russen schon hinter ihm her. Der holprige Feldweg rechnet ihnen die Schlaglöcher einzeln vor. Der junge Leutnant flucht wie ein Roßkutscher, aber endlich erreichen sie das Schulhaus, den Kompaniegefechtsstand.
Von hier aus hat der Lehrer seine Schüler in die Ferien geschickt. Von hier aus wird der Hauptmann seine Brandenburger in den Tod jagen.
Schübler will eine Meldung bauen, aber der Alte winkt ab und fragt trotz des gerade befohlenen Alkoholverbots: »Cognac oder Korn?«
»Milch«, erwidert der Oberleutnant mit angezogenen Mundwinkeln.
»Schon gut, mein Junge«, sagt der Hauptmann. »So pedantisch brauchen Sie nun auch wieder nicht zu sein.« Er gießt ihm einen ein. »Prost, Schübler. Via Berlin kommen ein paar brenzlige Sachen auf uns zu. Die schärfste habe ich für Sie reserviert. Das ist doch wohl in Ihrem Sinn?« lockt er ihn in die Falle.
»Jawohl, Herr Hauptmann.«
»Wie steht’s mit Ihrem Russisch?«
»Zwanzig Worte«, antwortet der Zugführer stolz, hält Nachinventur und verbessert: »Vielleicht sogar fünfundzwanzig.«
»Könnte nicht schaden, wenn Sie noch ein paar dazulernen«, empfiehlt der Hauptmann. »Drehen Sie sich mal um und gehen Sie an die Wand.«
Schon beim Betreten des Klassenzimmers war Schübler die Generalstabskarte in riesiger Größe aufgefallen. Durch die Mitte geht ein roter Strich wie ein blutiger Schnitt.
»Die Demarkationslinie«, erläutert der Chef. »Hier ist unser Standort. Und da, ungefähr bei Plaska, schleichen Sie sich auf die andere Seite. Keine Angst; Sie brauchen nicht bis Leningrad. Suchen Sie mal Lipsk.«
»Gefunden«, sagt der Leutnant nach ein paar Sekunden.
»Sehen Sie den Fluß Bobr? Hier ist eine Brücke. Gut hundert Meter lang, aus Holz –«
»Und die soll ich kassieren?« fragt Schübler.
»Sie sind ein Schnelldenker. Kassieren und halten, bis unsere Panzer die zwanzig Kilometer geschafft haben.«
»Weiter nichts?« fragt der junge Offizier anzüglich. »Also die gleiche Scheiße wie in Holland?«
»Das schon«, versetzt der Hauptmann gedehnt. »Aber inzwischen haben wir ja ’ne Menge dazugelernt.«
»Hoffentlich«, erwidert Schübler. »Ich sterb’ nämlich an ’ner deutschen Kugel genauso ungern wie an einer russischen.«
»Vorläufig leben Sie ja noch«, entgegnet der Alte. »Schübler«, kommt er wieder zur Sache, »Sie suchen sich Ihre Leute selber aus. Ich lasse Ihnen freie Hand. Ich würde Ihnen raten, nicht viele mitzunehmen. Je weniger sich auf die Socken machen, desto weniger können auffallen.«
»Und draufgehen«, ergänzt der Oberleutnant sachlich.
Sein Auftraggeber nickt unfroh. »Ich schicke mehrere Trupps los. Alle im Tarneinsatz. Verschiedene Ziele. Deshalb darf kein Schuß fallen, bevor der neue Krieg gezündet wird. Ungefähr um drei Uhr dreißig.«
»Da erklären uns die Russen den Krieg?«
»In etwa«, versetzt der Alte. »Fragen Sie doch nicht so dämlich, Schübler. Sie wissen doch, daß der Führer seine eigenen Ideen hat.«
»Und was bekomme ich mit?« fragt der Leutnant.
»Eine Straßenkarte. Einen polnischen Lotsen. Und Waffen, so viel Sie wollen«, versichert der Hauptmann rasch. »MPs, Handgranaten. Sogar ein leichtes MG.«
»Bestens«, entgegnet Schübler. »Und wie lange habe ich Zeit, meine Leute auf die russischen Waffen umzuschulen?«
»Wieso die russischen?« Der Kompaniechef gießt noch einmal zwei Doppelstöckige ein. »Ihr nehmt deutsche mit. Nachts sind alle Katzen schwarz.«
»Das ist ja Wahnsinn –«
»Ganz recht, Schübler«, stimmt ihm der Einsatzleiter voll zu. »Aber der Wahnsinn beginnt doch bereits, wenn man sich zu einem solchen Sauhaufen wie dem unseren meldet… Alles klar?« fragt der Hauptmann.
»Wann geht das los?« entgegnet sein Oberleutnant.
»Heute bestimmt nicht mehr. Vielleicht morgen. Oder übermorgen. Nitschewo.« Er legt den Arm um die Schulter des Jungen, begleitet ihn an die Tür.
Er wird wieder ordentlich durcheinandergerüttelt, aber nicht deswegen zischt er den Kradmelder an: »Fahren Sie langsam, Mann!«
Es ist nur Zeitgewinn. Je näher er auf die Feldscheune zurollt, um so mulmiger wird ihm. Er muß seine Wahl treffen, und dabei wird es lange Gesichter geben. Weiß der Teufel, warum sie so darauf erpicht sind, verheizt zu werden.
Aber zehn Finger reichen nicht aus, um die Gründe abzuzählen. Erst einmal wußte bei der freiwilligen Meldung keiner, was ihm blühen wird. Die Volksdeutschen wurden wegen ihrer Sprachkenntnisse schon vor ihrer richtigen Einbürgerung zu Brandenburg geschanghait. Der dicke Melchior hat sich wegen der besseren Verpflegung gemeldet, der kleine Cerny, weil er unter der vermeintlichen Schande seines tschechischen Namens leidet. Jonas war einst von seinem Freund Schübler mitgezogen worden und der Oberleutnant von einem Vetter im Canaris-Hauptquartier. Einige grüne Jungs verdingten sich an Brandenburg, um rasch zu Orden zu kommen, mit denen sie ihren Mädchen imponieren wollten, und die Spitze stellt der schweigsame Feldwebel Dörner dar, der in die Geistertruppe überwechselte, weil ihm seine Frau Hörner aufgesetzt hat.
»Habt ihr gezählt, wie viele Scheißuniformen das sind?« fragt Schübler nach seiner Rückkehr.
»Zehn«, meldet Feldwebel Dörner als Rangältester.
»Ein bißchen knapp, was?« erwidert Schübler mit einem faulen Grinsen. »Dadurch ergibt sich zwangsläufig die Frage, wer freiwillig zu Hause bleibt.«
Keiner meldet sich. Wie erwartet.
»Feldwebel Dörner und du, Prophet«, sagt er, »ihr meldet euch sofort beim Kompaniegefechtsstand. Ab nach Kassel!«
Wenn er sich dazu rechnet und den polnischen Führer, bleiben ihm nach Adam Riese noch sechs Uniformen. »Hand hoch, wer spricht Russisch?«
Fast alle melden sich.
»Macht keinen Quatsch, ihr Krummstiefel.« Der Zugführer wendet sich an Pfänder, den Baltendeutschen. »Überprüfen Sie mal die Sprachkenntnisse der Jungens, aber flugs.«
Der dicke Melchior besteht. Schübler nimmt ihn gerne, denn der Kerl ist stur wie ein Panzer. Auch mit Freudenreich ist der Leutnant zufrieden; der Mann hat immer Dusel, und das ist genau das, was sie brauchen: verdammt viel Glück. Sawitzky spricht fließend Polnisch. Dem schlaksigen Zwecker hat er den nächsten Einsatz versprochen.
»Letzte Uniform«, ruft er wie bei einer Versteigerung. »Zwei bleiben übrig, einen können wir noch gebrauchen.«
Für die engste Wahl stellen sich Gruber und der kleine Cerny als erbitterte Kandidaten.