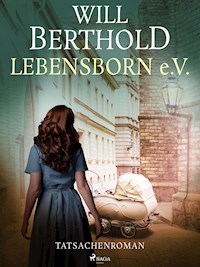Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In diesem packenden Tatsachenroman gelingt es dem Autor, den Wahnsinn eines entsetzlichen Eroberungskrieges aufzuzeigen. Denn seine Bilanz liest sich furchtbar: 14 Millionen deutsche Zivilisten, Kinder, Frauen und Greise, werden aus ihrer Heimat verjagt. Über sieben Millionen von ihnen fliehen Ende 1944, Anfang 1945 vor den anrückenden Russen. Unzählige von ihnen erfrieren, ertrinken, verhungern auf diesem unglaublichen Leidensweg. Viele, die sich schon in Sicherheit wähnen, werden von den Amerikanern zu den Sowjets zurückgetrieben. Das Schicksal dieses Heeres von Flüchtlingen schildert Will Berthold am Beispiel dramatischer Einzelschicksale aus dem "großen Treck". Ein grausames Stück Zeitgeschichte wird hier lebendig und erinnert an den hohen Preis des Krieges.Will Berthold (1924–2000) war einer der kommerziell erfolgreichsten deutschen Schriftsteller und Sachbuchautoren der Nachkriegszeit. Seine über 50 Romane und Sachbücher wurden in 14 Sprachen übersetzt und erreichten eine Gesamtauflage von über 20 Millionen. Berthold wuchs in Bamberg auf und wurde mit 18 Jahren Soldat. 1945 kam er vorübergehend in Kriegsgefangenschaft. Von 1945 bis 1951 war er Volontär und Redakteur der "Süddeutschen Zeitung", u. a. berichtete er über die Nürnberger Prozesse. Nachdem er einige Fortsetzungsromane in Zeitschriften veröffentlicht hatte, wurde er freier Schriftsteller und schrieb sogenannte "Tatsachenromane" und populärwissenschaftliche Sachbücher. Bevorzugt behandelte er in seinen Werken die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg sowie Themen aus den Bereichen Kriminalität und Spionage.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Die große Flucht
SAGA Egmont
Die große Flucht
Die große Flucht (Der große Treck)
Copyright © 2017 by Will Berthold Nachlassrepresented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1975 by Hestia Verlag, Germany
Copyright © 1975, 2017 Will Berthold Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711727287
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Teil 1Ostpreußen
Sie kommen, von Norden wie von Osten. Mit Hunderttausenden von Infanteristen und Tausenden von Panzern. Es ist der 16. Oktober 1944, und in weniger als einem Jahr ist die Rote Armee von der Krim bis an die deutsche Grenze gestürmt und drängt nach Ostpreußen, das offen vor ihr liegt wie ein Scheunentor. Die Ernte ist unter Dach, aber kassieren werden sie die Russen oder die Flammen. Der Altweibersommer verwandelt sich in einen blutigen Herbst.
Finnland hat sich den Sowjets ergeben. Bulgarien ist in den Krieg eingetreten. Griechenland wurde geräumt. Rumänien machte Schluß, und die Sowjets rüsten zum Marsch auf Budapest und Wien. Im Norden ist die Kurland-Armee eingeschlossen und kann nur noch über See versorgt werden. Zwar halten in Italien die deutschen Linien im Apennin noch, aber im Westen rasseln Eisenhowers Panzerspitzen in Richtung Trier und Aachen. Die Anglo-Amerikaner machen sich fertig für den Sprung über den Rhein.
Das Ruhrgebiet ist zerstört. Die deutschen Großstädte liegen im Bombenhagel. In einer Lagebesprechung im Führerhauptquartier stellt Generaloberst Guderian fest: »Die Ostfront ist wie ein Kartenhaus; wird sie an einer Stelle durchstoßen, so fällt sie zusammen.« Obwohl damit zu rechnen ist, daß die Sowjets sie an allen Stellen durchbrechen werden, überschlagen sich im Großdeutschen Rundfunk die Siegesmeldungen über die angeblich verheerende Wirkung der V-2-Raketen in der britischen Hauptstadt – aber London ist weit, und der Russe nah.
»Vielleicht zwanzig, bestenfalls fünfundzwanzig Kilometer«, sagt Werner Held, Hauptmann und Bataillonskommandeur. Seine Einheit ist in Ostpreußen stationiert, und er ist auf das Gut Zerkaulen zwischen Rominten und Buylien, südlich von Gumbinnen, gekommen, um seinen Schwiegervater zu warnen. »Der Iwan kann vielleicht schon morgen hier sein.«
»So bald?« fragt der alte Zerkaulen erschrocken. Er ist ein Mann Anfang sechzig mit silbergrauen Haaren und gütigen Augen, deren Blick immer ein wenig nach innen gekehrt wirkt, mehr Privatgelehrter als Gutsbesitzer. Seine Welt ist die Antike. Deshalb hat er auch seinen Töchtern lateinische Namen gegeben: Prisca heißt die älteste, Claudia die zweite und Jucunda das Nesthäkchen.
»Im Norden sind sie durchgebrochen«, erwidert Held müde. »In Memel ist der Teufel los. Heydekrug wurde geräumt. In der Elch-Niederung jagen die T 34 die Zivilisten von den Straßen. Hast du schon mal gesehen, wie Rinder in den Sümpfen verrecken? Hast du schon erlebt, wie die Tiere verzweifelt um sich schlagen, immer tiefer sinken, die Augen verdrehen und brüllen, brüllen – bis sie ersticken. Und du stehst daneben und kannst nichts tun, und –«
»Werner, bitte –«sagt Prisca.
»Besser, ihr hört, was draußen vorgeht«, entgegnet der Hauptmann rauh, »als ihr erlebt es.«
Eine Kette von Detonationen unterbricht ihn. Er steht auf, geht ans Fenster. Er zieht den linken Fuß ein wenig nach: ein Souvenir an Kreta, wo er 1941 als Fallschirmjäger eingesetzt war. Jetzt ist die Zeit der »Grünen Teufel« vorbei. Die Elitetruppe, der er angehörte, wird seit langem wegen Spritmangels im Erdeinsatz verheizt. Was blieb, sind die vielen Narben am Körper, die Orden an der Brust und dieses glitzernde Dingsda am Hals, das Ritterkreuz.
Werner ist überraschend gekommen, und er kürzte die Wiedersehensfreude ganz gewaltig ab, küßte Prisca und hob seinen Jungen auf den Arm. Der dreijährige Fabian wollte tapfer sein gegenüber diesem fremden Mann und lächelte ihn ein wenig verkrampft an.
Werner Held hat nur einen Tag Urlaub genommen, denn wenn schon die Panzerfahrzeuge seines Bataillons bloß auf dem Papier vorhanden sind, dann sollte wenigstens der Kommandeur bei seiner Einheit sein. »Sonderurlaub zwecks Sicherung der bürgerlichen Existenz«, steht in seinen Marschpapieren – aber ein paar Stunden sind wohl zu wenig, um eine Familie, die in der sechsten Generation auf dem gleichen Grund und Boden lebt, zu überreden, unverzüglich die geliebte Heimat zu verlassen, um das nackte Leben zu retten.
Die Scheiben klirren im Rhythmus der Druckwellen. Am Horizont steigen dunkle Rauchsäulen hoch.
»Was ist das?« fragt die Schwiegermutter erschrocken.
»Luftangriff auf Gumbinnen«, antwortet der Offizier. Die alte Soldatenstadt, das Potsdam Ostpreußens, steht in Flammen.
»Luftangriffe gibt’s im Westen viel mehr«, sagt Martha Zerkaulen. »Vielleicht siehst du doch ein bißchen zu schwarz, Werner. Schließlich gibt es ja auch noch den Ostwall.«
»Der hält die Sowjets drei Stunden und drei Minuten auf«, versetzt der Hauptmann sarkastisch. »Drei Stunden brauchen die Iwans zum Lachen, und drei Minuten zum Stürmen.«
Rechts neben ihm sitzt Prisca, die Jugendfreundin, die er heiratete. Eine blonde, ruhige Frau von herber Schönheit. Sie verstehen sich blendend, aber das ist auch keine Kunst, wenn die Gemeinsamkeit von Feldpostbriefen und Genesungs-Urlauben lebt.
Claudia, links von ihm, ist ganz das Gegenteil ihrer Schwester und eigentlich der Erbsprung in der Familie: braune Augen, dunkle Haare und sogar ein Schuß südländischen Temperaments. Sie ist zwar schon zweiundzwanzig, aber beim Reiten noch immer mehr Junge als Mädchen.
Jucunda, das Nesthäkchen, lebt als Studentin in Königsberg.
»Macht euch nichts vor«, sagt Held. »Die Russen können morgen schon hier sein. Übermorgen ganz bestimmt.«
»Und was sollen wir tun?« fragt der Gutsherr gepreßt.
»Verschwinden«, erwidert sein Schwiegersohn hart. »Und zwar sofort!«
Es ist eine Schlacht mit verkehrten Fronten: Die Jungen, sonst den Parolen der Partei gegenüber aufgeschlossener als die Alten, begreifen, daß es um die Entscheid dung über Leben oder Sterben geht. Prisca und Claudia sind sich darüber im klaren, was ihnen droht, wenn sie den Russen in die Hände fallen. Die Eltern erinnern sich noch an das Wunder des Ersten Weltkrieges, als Hindenburg die russische Dampfwalze zertrümmerte, an die hunderttausend Russen in Gefangenschaft führte, und dadurch die Ostfront für die ganze Dauer des Krieges stabilisierte. Aber Hindenburg, der Sieger des Ersten Weltkrieges, wird bald, in seinem Sarkophag aus dem Tannenberg-Mahnmal gerissen, noch im Tode zum Flüchtling des Zweiten Weltkrieges werden. Wenn die Partei schon nicht für die Lebenden sorgt, dann wenigstens für diesen Toten.
»Wir haben ja nicht einmal einen Packbefehl«, sagt der alte Zerkaulen.
»Dann machen wir es ohne«, antwortet Werner Held. »Und zwar gleich jetzt, bevor ich zurück muß.«
Das Bataillon Held ist dreißig Kilometer weiter nordwestlich in Stellung. Der Hauptmann hat es erst vor ein paar Wochen übernommen. Sein eigener Verein war wieder einmal aufgerieben worden. Als Werner hörte, daß die Luftwaffen-Division Hermann Göring in Ostpreußen eingesetzt würde, ließ er sich zu dieser Einheit versetzen. Daß er den Namen Görings jetzt am Ärmel trägt, ist ihm egal, dem Königsberger Professoren-Sohn kommt es nur auf seine Heimat an.
»Die Lage kann nicht so schlimm sein«, leistet Martha Zerkaulen letzten Widerstand. »Sonst hätte die Partei einen Räumungsbefehl gegeben.«
»Hast du eine Ahnung, Mama«, entgegnet Werner. »Ich hab’s erlebt. Entweder kommt die Treck-Erlaubnis überhaupt nicht – oder gleichzeitig mit den Russen.« Er steht auf. »Kommt, Mädchen«, sagt er mit erzwungener Fröhlichkeit und hakt sich bei Frau und Schwägerin unter: »Helft mir!«
Sie gehen zu dritt über den Gutshof, den sie nun verlassen müssen. Der Altweibersommer zieht seine Fäden, die Herbstsonne hängt in den Kronen der Eichen, als könnte auch sie sich nicht vom Gut trennen – so wie die Menschen.
Werner Held schluckt. Er, der Königsberger, ist zwar hier nicht aufgewachsen. Und doch – dieser Abschied fällt auch ihm schwer. Wenn er sich nicht zusammennimmt, wird er noch weich vor Prisca und Claudia, statt ihnen Mut zu machen.
Mit langen Schritten geht er in die Werkstatt. Die Frauen haben Mühe, ihm zu folgen.
Jean, der französische Kriegsgefangene aus der Provence, kommt auf ihn zu. »Isch fertig«, sagt er und zeigt auf sein Meisterwerk. »Tres comfortable.«
»Mensch«, sagt Claudia überrascht. »Geländegängige Autoreifen an einem Pferdewagen. Hast du sie organisiert, Werner?«
»Beute«, entgegnet der Schwager mit einem erzwungenen Lächeln. »Selbstgeschossen. Jean wird euch in dieser Luxuskarosse kutschieren. Dich, Prisca und den Jungen.«
»Und die Eltern?« fragt Prisca.
»Für sie wird der zweite Wagen gerade fertiggemacht«, antwortet der Hauptmann.
Er geht um den geräumigen Wagen herum, dessen Seitenteile mit Holz verkleidet sind. Eine wetterfeste Plane wölbt sich wie eine Krinoline darüber. Er nickt zufrieden, zieht einen Wisch aus der Tasche und macht sich auf den Weg zu den Stallungen.
»So, Mädchen«, sagt er, »nun spiel ich den Ortsbauemführer, der liebe Gott mit der Peitsche.« Er horcht einen Moment auf den Gefechtslärm, der näherzukommen scheint, aber vielleicht ist es nur der Wind. »Zuerst mal die Pferde.« Er liest von seinem Handzettel ab: »Nur gute und ausdauernde Tiere sind zu nehmen. Die Auswahl der für den Treck vorgesehenen Wagen, Geschirre und Pferde ist an Ort und Stelle durch den Ortsbauemführer zu treffen.«
Der Rappe Kasimir wendet den Kopf zum Hauptmann und wiehert zur Begrüßung. Held klopft ihm auf die Kruppe, geht weiter zu den Fuchsstuten Liese und Hilda, schiebt dem Hengst Jaromir ein Stückchen Würfelzucker ins Maul. Welche Pferde soll er für den Treck einteilen, welche zurücklassen? Und welche werden das bessere Schicksal haben?
Flucht ist Scheiße, denkt er und hat plötzlich nasse Augen. Er verläßt die Box; er hat noch drei Pferdeställe vor sich, von den Rinderbeständen nicht zu reden.
Die vorgeschobene Provinz Ostpreußen, dieser Balkon über dem Osten, ist die Kornkammer, in der jedes zehnte Brot wächst, das in Deutschland gegessen wird. Und das klassische Land des Pferdes; auf riesigen Weiden, auf den natürlichen Koppeln zwischen Memel und Weichsel, tummeln sich fast eine halbe Million Stuten, Wallache, Hengste und Fohlen. Ganz in der Nähe von Zerkaulen liegt das Hauptgestüt Trakehnen, die berühmte Warmblutzucht. Um den Trakehner, dieses Spitzenprodukt der Pferdezucht, reißt sich seit Jahrhunderten die ganze Welt.
An diesem 16. Oktober hat der Landesstallmeister bereits die Gauleitung beschworen, die Koppeln räumen zu dürfen. Aber Erich Koch, der wildgewordene Kleinbürger mit dem Biergesicht, lehnt ab, während er die Pferde seines eigenen Gestütes Krasne im Kreis Zichenau in Sicherheit bringen läßt.
Der Landesstallmeister bittet, droht, schimpft, versucht es immer wieder.
»Wenn die Russen wirklich kommen«, erwidert der Reichsverteidigungs-Kommissar wörtlich, »können die Pferde ja im Wettlauf mit den roten Panzern ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.«
Auf Räumung ohne Befehl steht Todesstrafe. Stunden später kommen die Russen. Frauen und Kinder laufen mit den Panzern um ihr Leben. Die meisten schaffen es, aber ihre Väter und Männer, die ihre edlen Pferde nicht im Stich lassen wollen, werden von den Rotarmisten eingeholt und erschossen.
Schwere Kämpfe in den Kreisen Tilsit – Rangsit, Schloßberg, Ebenrode und Goldap. Auch in Angerapp kommt das Trommeln der Front immer näher. Der Landrat gehört zu den Männern, die beim Weltuntergang Haltung bewahren. Er ruft in Königsberg an und drängt auf Räumungserlaubnis.
»Ihr habt wohl die Hosen voll«, erwidert Organisationsleiter Dargel. »Von einem Durchbruch der Russen ist hier nichts bekannt«.
»Sie stehen nur ein paar Kilometer vor uns«, meldet der Landrat: »Ihre Panzer können in einer halben Stunde hier sein«.
»Schießen Sie einfach ein paar Flüchtlinge über den Haufen, um die Disziplin wieder herzustellen. Die Frauen sollen Wasser heiß machen und den Russen auf die Köpfe gießen«, ist die Antwort.
Die Frauen schlachten Geflügel, als brauchte man für die Flucht ohne Gnade nur einen Tagesproviant. Wer ein Schwein schlachtet, riskiert seinen Kopf.
»Was ist mit Roger?« fragt Werner Held den Franzosen Jean nach seinem Kumpel.
»Der schlachtet schon das zweite Schwein«, versetzt der Poilu grinsend.
»Um Gottes willen«, sagt Prisca erschrocken: »Schwarzschlachtung kann ihm den Kopf kosten.«
»Es wird bloß keiner mehr da sein, um ihn zu köpfen«, konstatiert ihr Mann.
Er läßt die beiden Fluchtfahrzeuge mit Matratzen, Dekken, Schlafsäcken beladen. Dann beauftragt er seine Frau, alle Urkunden, Personalpapiere, Sparkassenbücher, Wertpapiere, sonstige Dokumente und Schmuckstücke herbeizuschaffen.
»Reservehufeisen brauchen wir noch«, ruft er Jean zu. »Auch Draht, Werkzeuge, Eimer, Sensen, Reservedeichseln.«
»Und ich steh so herum«, beklagt sich Claudia.
»Hör zu«, sagt der Hauptmann. »Du bist die Härteste. Wenn irgend etwas passiert, übernimmst du die Treckführung. Ich weiß, daß ich mich auf dich verlassen kann.« Er verfolgt, wie die Gutsarbeiter Futtermittel herbeischleppen, und fährt fort: »Und jetzt geh und stell eine Hausapotheke zusammen, Claudia. Ich fürchte, ihr werdet sie brauchen.«
Er hakt Stück um Stück von seiner Liste ab, ein unbestechlicher, genauer, ja sturer Lademeister. Nichts Wichtiges darf fehlen, nichts Unwichtiges soll die Wagen belasten.
Als Martha Zerkaulen die wertvolle Standuhr anschleppt, sagt er: »Nein, Mama.«
»17. Jahrhundert –« protestiert sie. »Ein unersetzliches Stück.«
»Ist ja nur vorübergehend«, antwortet Werner. »Ihr kommt doch wieder zurück.«
Prisca sieht ihren Mann an, der so miserabel lügt. Es ist einer der Gründe, warum sie ihn mag. Aber wer kann schon überzeugend lügen, wenn es darum geht, Heim und Hof aufzugeben? Die Heimat wirft man nicht weg wie zerrissene Socken. Heimat ist, wo man seine erste Liebe in die Rinde schnitt, wo Oma am Friedhof liegt, wo die Kinder aufwuchsen, wo man seinen festen Platz auf der Kirchbank hat und wo sich der Fleiß von Generationen in Besitz verwandelte.
Dann erscheint der Gutsherr mit einem großen Koffer voller Bücher. Werner Held weiß, daß er die ganze Flucht gefährden würde, wenn er nicht nachgäbe. Also läßt er das schwere Stück auf einem Wagen verstauen.
Polnische und russische Arbeiter helfen willig beim Verladen. Manche wirken traurig, als verlören sie ihr eigenes Mustergut.
»Bestecke, Kochtopf, Spiritus«, kontrolliert Werner: »Habt ihr Schnaps? Und genügend Wintersachen?«
»Aber glaubst du denn, daß wir noch in den Winter kommen?« fragt Prisca.
»Besser, man rechnet mit jeder Möglichkeit«, sagt Werner und zählt weiter auf: »Dicke Wollhandschuhe. Zwei Paar für jeden. Stiefel. Wollstrümpfe. Denk auch bei den Kindersachen daran.«
Er blickt auf die Uhr. Er muß zurück. Die Sache geht ihm mehr an die Nieren, als er dachte. In diesem Moment sieht er seinen Fahrer mit der üppigen Polin Sinaida herumschäkern.
»He, Schneider!« schreit er über den Hof: »Auspussiert! In zehn Minuten müssen wir zurück.«
Der Fahrer kommt näher. »Die wollen alle mit, Herr Hauptmann«, meldet er.
»Wer?« fragt Werner. »Die Frauen? Die Polen?«
»Jawohl, Herr Hauptmann«, antwortet sein Fahrer, »Auch die drei Russen.«
»Kluge Jungs«, erwidert der Offizier und überlegt: Für fünf Familienangehörige – die Jüngste, in der Familie Juca genannt, ist als Medizinstudentin an der Uni Königsberg aus der Schußlinie – und die zwei Franzosen reichen zwei Wagen. Für dreizehn Polen und drei Russen sind noch einmal fünf Gespanne erforderlich, das heißt, daß mindestens fünfzehn weitere Pferde gerettet werden können.
Gespannt erwarten die ausländischen Arbeiter die Entscheidung des jungen Herrn. Große Unterschiede zwischen Herr und Knecht sind in Ostpreußen zu keiner Zeit üblich gewesen. Auch nicht zwischen den Deutschen und ihren ausländischen Arbeitern, und auch nicht im Krieg. So ist es nicht nur bei den Zerkaulens, sondern fast überall im Land. Diese gute Behandlung trägt Früchte. Als alle Dämme brechen, als der Selbsterhaltungstrieb viele Menschen zu Bestien macht, werden sich in Ostpreußen die zurückbleibenden Zwangsarbeiter wegen der guten Behandlung fast nie zu Gehässigkeiten gegen ihre gestürzten Herren hinreißen lassen, ja sie werden sich häufig schützend vor sie stellen.
»Wer will, kann mit«, entscheidet Hauptmann Held. »Roger soll weiterschlachten.«
Seine Worte lösen eine erhöhte Aktivität aus. Weitere Wagen werden fertiggemacht, Kisten und Bündel darauf verstaut.
Hauptmann Held versteht nicht ganz, warum sich diese Menschen im Augenblick ihrer nahen Befreiung für ein hartes Flüchtlingsschicksal entscheiden. Aus Anhänglichkeit? Aus Angst, als Kollaborateure erschossen zu werden?
Held stapft ins Herrenhaus zurück, drückt seinem Schwiegervater die Hand, küßt seine Schwiegermutter auf die Wange, zieht Prisca an sich, wirft einen Blick auf den schlafenden Fabian, nickt Claudia zu.
»Und macht euch häßlich, Mädchen«, sagt er. »So häßlich ihr könnt. Für den Fall, daß euch die Russen einholen sollten.« Sein Ratschlag ist so dumm, als würde er einem Riesen empfehlen, künftig als Liliputaner aufzutreten.
Prisca bringt ihn zur Tür. Noch ein rascher Kuß, dann dreht er sich um. Schließlich hat er gelernt, schnell Abschied zu nehmen, von den Lebenden und von den Toten.
»Und paß auf dich auf«, hört er seine Frau noch sagen, bevor er in der Dunkelheit verschwindet.
Räder müssen rollen für die Flucht. Hunderttausende von Rädern unter unzähligen Wagen, in den Achsen scheppernd, von scheuenden Pferden gezogen, von Rotarmisten gehetzt, an die Armeegeneral Tschernjachowski, Oberbefehlshaber der 3. Weißrussischen Front, den Tagesbefehl gerichtet hat:
»Gnade gibt es nicht – für niemanden, wie es auch keine Gnade für uns gegeben hat. Es ist unnötig, von Soldaten der Roten Armee zu fordern, daß Gnade geübt wird. Sie lodern vor Haß und vor Rachsucht. Das Land der Faschisten muß zur Wüste werden so wie unser Land, das sie verwüstet haben. Die Faschisten müssen sterben, wie auch unsere Soldaten gestorben sind.«
Die Zerkaulens sind nur Statisten in dem dreckigsten Millionenspiel, das die Geschichte sich je ausgedacht hat. Allein 2 653 000 Ostpreußen sind die Mitwirkenden und bringen ihr Leben als Einsatz. Und die Menschen aus den nördlichen und nordöstlichen Kreisen, die ersten Flüchtlinge, müssen zweimal auf die Spiel- und Schlachtbank.
Wie besprochen, zieht der Treck aus Zerkaulen auf eigene Faust im Morgengrauen des 17. Oktober los. Jeder Wagen ist mit zwei Pferden bespannt und zieht hinter sich noch ein Fohlen her. Auf dem Kutschbock des ersten Wagens sitzt Jean, der Franzose, im Innern sind die beiden Töchter und der kleine Fabian, im nächsten Gespann die Eltern, die sich gegenseitig daran erinnern, daß sie ihrem Schwiegersohn versprochen haben, sich nicht umzudrehen. Ihnen folgen, im Abstand von jeweils zwanzig Metern, die fünf Leiterwagen der polnischen und russischen Dienstleute.
Die Kolonne hat einen weiten Weg vor sich, aber nach drei Kilometern wird sie bereits gestoppt. Die Männer, zwischen 16 und 60 Jahre alt, vor zwei Tagen eingezogen, mit Gewehren aus dem Ersten Weltkrieg bewaffnet und mit je drei Schuß Munition versehen, werden von einem Parteibonzen kommandiert. Sie schauen teilnahmslos zu, wie der brüllende Hoheitsträger den Treck wenden läßt und ihn in Richtung Romintener Heide schickt. Genau dahin, woher die Russen kommen.
Außer Sichtweite kehren die Flüchtlinge wieder um und warten. Dadurch verlieren sie den rettenden Vorsprung, denn sie kommen erst weiter, als der Goldfasan eineinhalb Tage später türmt.
Im Raum Gumbinnen greift die Rote Armee mit zwei starken Stoßkeilen an. Der nördliche kommt aus Richtung Ebenrode und bleibt am Bahnhof von Trakehnen liegen. Aber auf der Südflanke rollen Stalins Panzer am 19. Oktober an Gumbinnen vorbei, walzen einen dünnen deutschen Infanterie-Schleier nieder, wühlen sich weiter nach Westen.
Nur vereinzelt stoßen sie auf deutsche Widerstandsnester, die dann durch Artillerie ausgeschaltet werden. So überrennen die Sowjets Ortschaft um Ortschaft. Häufig kommt es vor, daß ihnen aus den Häusern noch die deutsche Rundfunkpropaganda entgegendröhnt: »Jedes Haus eine Burg. Jedes Dorf eine Festung.«
Vor Nemmersdorf muß der Treck aus Zerkaulen einer motorisierten Infanterie-Einheit, die auf dem Rückzug ist, Platz machen. Ein Kradmelder hält auf der Höhe des ersten Gespanns. »Haut bloß ab!« brüllt er zu Claudia hinauf. »Das sind Säue. Die bringen alles um.« Er dreht das Gas auf. »Sogar die Kinder«, schreit er noch und rast weiter.
Vor dem Sturm herrscht in dem kleinen Ort Nemmersdorf Friedhofsruhe. Der Treckbefehl kam erst, als die russischen Panzer in unmittelbarer Nähe waren. Einen Tag vorher hätten sie noch eine Chance gehabt. Aber jetzt, unter Direktbeschuß, können sie weder anspannen noch aufladen. Was sollen sie also tun?
Ein paar Arbeiter versuchen, über den kleinen Fluß zu entkommen. Alte Ehepaare wie die Wagners und die Hobeks, der Viehhändler Brosius oder das 70jährige Fräulein Berta Aschmoneit flüchten in die Kirche. Die Kalchers verkriechen sich in ihrem Haus.
Ein paar Frauen flüchten in das Gasthaus »Weißer Krug«. In stockenden Gesprächen reden sie sich Mut zu, versichern sich gegenseitig, daß die Russen gar nicht so schlimm seien. Die Alten wissen es ja noch von Anno 14 her. Natürlich, die Russen haben Häuser angezündet und Scheunen, aber schließlich haben die meisten Deutschen es überlebt.
Der Zerkaulen-Treck passiert die Kirche mit dem charakteristischen Turmaufbau. Ein mächtiger Klotz, auf dem noch ein kleines Türmchen sitzt; es sieht aus wie eine Burgzinne, aber dieses Gotteshaus ist keine feste Burg.
Jean treibt die Pferde an, gibt Claudia ein Zeichen, in den Wagen zu kriechen, aber sie bleibt, dreht sich um, lächelt Prisca zu, die den dreijährigen Jungen mit den grauen Augen seines Vaters umklammert.
Das letzte Haus von Nemmersdorf. Weiter. Die braven Pferde jagen schnaubend vorwärts. Hundert Meter Abstand zum nächsten Wagen. Auch Roger kann gut mit den Gäulen umgehen, und die Gummiräder machen ihnen das Ziehen leichter.
Dann wird es laut in Nemmersdorf. Ein versprengter deutscher Panzer jagt mit Vollgas über die Ortsstraße. Die Frau des Gendarmen stürzt aus dem Haus, zwei Kinder an der Hand, bleibt stehen, winkt verzweifelt.
Zu spät. Der »Tiger« jagt vorbei, mit rasselnden Ketten, die ihr Dreck in die Augen werfen. Sie steht benommen da, starrt dem letzten deutschen Panzer nach, dessen Besatzung sie vielleicht gar nicht gesehen hat. Die Kinder schreien, aber bei dem Höllenlärm ist nichts zu hören. Die Mutter zieht ihre Kinder ins Haus zurück.
Noch ein Fahrzeug. Ein Panzerspähwagen. Der Fahrer hält. Die Frau hievt die Kinder hoch, steigt ein – und starrt entsetzt in das Gesicht eines sowjetischen Offiziers.
»Frau, nix Angst«, beruhigt er sie und studiert seine Straßenkarte.
Das gepanzerte Fahrzeug fährt wieder an. Der Offizier sichert vorsichtig nach allen Seiten, schaut wieder auf seine Karte. Als er das Wegschild nach Sodehnen sieht, hält er an.
»Frau, snell«, sagt er zu der Verstörten: »Russki hinter mir. Nix gutt. Stalinschüler.«
Sie steigt aus; der Offizier reicht ihr die Kinder. Als sie querfeldein hetzt, fällt ihr ein, daß sie sich nicht einmal bedankt hat.
Von irgendwo dröhnen Lautsprecher: »Deutsche, werft die Waffen weg! Hebt die Hände hoch! Es passiert euch gar nichts. Die Rote Armee garantiert es euch.«
Jean hört den Aufruf. Er sieht Claudia an; sie schüttelt den Kopf. »Weiter – so schnell wie möglich.«
Dann kommen sie. Von der Flanke. Ein ganzes Rudel Panzer, sieben oder acht T 34. Der erste, noch 300 Meter entfernt, schneidet den Fluchtweg ab, feuert.
Der Rappe Jaromir geht senkrecht hoch, scheut, bricht aus. Kasimir will nach der anderen Seite durchgehen. Der Wagen rast im Zickzack hin und her. Endlich hat Jean die Tiere wieder in der Hand.
Plötzlich platzt der vordere Russenpanzer wie eine faule Konserve. Sekunden später wird der Turm des zweiten weggefetzt. Ein einsames deutsches Panzerabwehrgeschütz hat die Russen unter Feuer genommen. Die anderen T 34 haben die Stellung erkannt, wenden und rollen auf sie zu. Der Kampf ist kurz und mörderisch …
Inzwischen schafft der vordere Wagen den Durchbruch. Wild galoppieren die beiden Rappen davon, Jean hat sie sicher in der Hand. Die anderen sechs Fuhrwerke aus Zerkaulen entkommen den anrollenden vier Stahlkästen mit dem roten Stern jedoch nicht mehr.
Der vorderste T 34 ist noch zwanzig Meter von dem Wagen entfernt, auf dem Roger das alte Gutsbesitzer-Ehepaar fährt. Verzweifelt schlägt der Franzose auf die Pferde ein.
Der T 34 erfaßt das Fuhrwerk von der Seite. Die Ketten zermalmen die Stuten Hilda und Liese. Während der Wagen in den Graben kippt, stürzt Roger vom Wagen. Die Ketten quetschen ihm die Oberschenkel ab. Roger überbrüllt den Gefechtslärm, bis ihm der nächste Panzer das zuckende Gesicht zermalmt.
Ein anderer T 34 rollt die Kolonne von hinten auf, fährt über die brechenden Wagenräder, über brüllende Verwundete hinweg, verwandelt Menschen, das Ebenbild Gottes, in Abdrücke von Gliedketten.
Infanteristen, die auf den Panzern aufgesessen waren, durchwühlen das Fluchtgepäck in den umgestürzten Wagen nach Schmuck und Schnaps.
Die Lebenden werden herausgezogen. Männer rechts raus – zum Erschießen. Jan, der polnische Ackerknecht, kann Russisch. Er redet auf die Soldaten ein. Vergeblich.
»Hast du dir wehgetan, Vater?« fragt Martha Zerkaulen ihren Mann, der sich aus seinen Büchern herauswühlt: Livius, Vergil, Cäsars »Gallischer Krieg«. Ein barbarischer Krieg war das vor zweitausend Jahren, aber der interessiert die Eroberer nicht; sie führen ihren eigenen – und der ist nicht humaner.
Ein sowjetischer Unterleutnant stößt den Gutsherrn ein paar Meter zur Seite, brüllt ihn an, hält ihm die Pistole an die Schläfe.
Ein dünner Knall. So schnell stirbt ein Mensch …
Sinaida zieht ihre Herrin in den Wagen: »Nix deutsch«, raunt sie ihr zu, bindet ihr ein geblümtes Kopftuch um, wirft ihr einfache Kleidung über: »Du Polski.« Sie legt den Finger an den Mund.
Die anderen Arbeiter nehmen Martha Zerkaulen in die Mitte, schirmen sie mit ihren Körpern ab. Wie viele Ostpreußen spricht die Gutsherrin ein bißchen Polnisch. Sie hört, daß ihre Arbeiter von den Russen mit dem Tod bedroht werden, falls sie einen Deutschen verstecken.
Alle halten dicht. Die Russen weisen ihnen einen zerschossenen Bauernhof in der Nähe als Unterkunft an. Die Überlebenden des Trecks stützen Frau Zerkaulen, und zwei Knechte schleppen, in eine Decke eingewickelt, den toten Gutsbesitzer hinterher.
Nachts begraben sie ihn heimlich im Garten. Die russischen Bewacher sind unterwegs, um Beute zu machen. Sie kommen nicht mehr zurück, und Martha Zerkaulen begreift, daß nur überlebt, wer von den Russen vergessen wird – und selbst vergessen kann.
Zwei Tage lang lebt sie unter den Landarbeitern, ißt, was man ihr reicht, gewöhnt sich an die Sprache und beginnt zu hoffen, daß wenigstens ihre Töchter und ihr Enkelkind durchgekommen sind.
Dann werden die Polen unruhig. Der Gefechtslärm flammt wieder auf.
»Die Deutschen kommen zurück«, sagt Jan, der Ackerknecht. Und man weiß nicht, ob bei ihm die Angst oder die Hoffnung überwiegt.
Das Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 2, »Hermann Göring« wirft den Feind zurück. Das Bataillon Held wurde überraschend mit Panzerfahrzeugen, Sprit und Munition ausgerüstet. Nun fährt der junge Kommandeur in einem offenen Schützenpanzerwagen an der Spitze.
Wenn er an einem überrollten Treck mit toten Flüchtlingen und aufgedunsenen Pferdekadavern vorbeikommt, läßt er halten. Er springt ab und atmet erst auf, wenn er feststellt, daß auf den Wagenschildern nicht Zerkaulen steht.
Bei Sodehnen kämpft sein Bataillon eine russische Panzerkolonne nieder. Dann ist der Weg frei nach Nemmersdorf – dem Ort, der zu einem Begriff des Schreckens wird. So wie andere Stätten, an denen entsetzliche Kriegsverbrechen geschahen: Katyn, Oradour, Lidice.
Vor dem Ort stößt Werner Held auf eine überrumpelte deutsche Feldwache: vier Infanteristen, mit durchschnittenen Kehlen. Er erreicht das Gasthaus »Weißer Krug«, von dem rechts eine kleine Straße zu den umliegenden Gehöften führt. Vor dem ersten Anwesen steht ein Leiterwagen. An ihm hängen vier nackte Frauen, gekreuzigt, durch die Hände genagelt.
»Stopp!« ruft Werner Held seinem Fahrer zu, springt ab, lehnt sich gegen einen Baum und wundert sich, daß man auch noch mit einem leeren Magen kotzen kann.
Das gleiche Bild vor dem »Roten Krug«. An den Scheunentoren hängen gekreuzigte Frauen.
In der »Dokumentation der Vertreibung der Deutschen«, herausgegeben von der Bundesregierung, ist der Erlebnisbericht eines Volkssturmmattnes veröffentlicht. Darin heißt es (Band I/1, Seite 7):
»Wir fanden in den Wohnungen insgesamt 72 Frauen, einschließlich Kindern und einem alten Mann von 74 Jahren, die sämtlich tot waren, fast ausschließlich bestialisch ermordet, bis auf wenige, die Genickschüsse aufwiesen. Unter den Toten befanden sich auch Kinder im Windelalter, denen mit einem harten Gegenstand der Schädel eingeschlagen war.
In einer Stube fanden wir auf einem Sofa in sitzender Stellung eine alte Frau von über 80 Jahren vor, auch bereits tot. Dieser Toten fehlte der halbe Kopf, der anscheinend mit einer Axt oder einem Spaten von oben nach dem Hals weggespalten war.
Diese Leichen mußten wir auf den Dorffriedhof tragen, wo sie dann hegenblieben, weil eine ausländische Ärztekommission sich zur Besichtigung der Leichen angemeldet hatte. So lagen diese Leichen dann drei Tage, ohne daß diese Kommission erschien.
Inzwischen kam eine Krankenschwester aus Insterburg, die in Nemmersdorf beheimatet war und hier ihre Eltern suchte. Unter den Ermordeten fand sie ihre Mutter von 72 Jahren und auch ihren alten Vater von 74 … Die Schwester stellte dann fest, daß alle Toten Nemmersdorfer waren.«
Dr. Heinrich Amberger, damals Oberleutnant in einer Fallschirmjäger-Kompanie, berichtet an Eides Statt:
»Am Straßenrand saß, zusammengekauert, eine durch Genickschuß getötete alte Frau. Nicht weit davon lag ein mehrere Monate alter Säugling, der durch einen Nahschuß durch die Stirn (stark verbrannter Einschuß, faustgroßer Ausschuß am Hinterkopf) ermordet worden war.
Eine Anzahl Männer waren durch Schläge – wohl mit Spaten oder Gewehrkolben – in das Gesicht getötet worden. In mindestens einem Fall war ein Mann an ein Scheunentor genagelt worden.
Aber nicht nur in Nemmersdorf selbst, sondern auch in den benachbarten, zwischen Angerapp und Rominten gelegenen Ortschaften, die bei dem gleichen Gegenangriff von russischen Truppen gesäubert wurden, wurden zahllose gleichartige Fälle festgestellt. Lebende deutsche Zivilisten habe ich weder in Nemmersdorf noch in den Nachbarortschaften angetroffen …«
Die Toten von Nemmersdorf werden in zwei Massengräbern beigesetzt, aber sie kommen nicht zur Ruhe. Endlich trifft die Ärztekommission aus Genf ein. Die Ermordeten werden noch einmal exhumiert und auf ausgehängten Scheunentoren und Böcken aufgebahrt. Die Untersuchung ergibt, daß sämtliche Frauen, darunter auch Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren, vor der Ermordung vergewaltigt worden waren.
Übertrieben interessieren sich die Ärzte aus neutralen Ländern nicht für die Greuel von Nemmersdorf: Sowjetische Kriegsverbrechen sind im Oktober 1944 wenig gefragt; in vielen Zeitungen der Welt überschlagen sich die Berichte über die deutschen.
»Wenn Sie noch zehn Minuten Zeit haben«, sagt der Ortskommandant von Nemmersdorf zu einem Arzt aus der Welsch-Schweiz, »dann zeige ich Ihnen noch an die fünfzig französische Kriegsgefangene, die von Rotarmisten liquidiert worden sind«.
»Sie meinen Männer in französischen Uniformen?« erwidert das Kommissionsmitglied.
»Jetzt branchen Sie nur noch zu sagen, daß wir ihnen fremde Uniformen angezogen haben«, fährt ihn der Offizier gereizt an.
»Nein«, erwidert der Schweizer. »Aber die Uniform ist noch kein Beweis.«
»Genickschuß auch nicht?… Und diese armen Teufel hier von Nemmersdorf?«
»Das ist schrecklich«, antwortet der Arzt, zuckt die Schultern und geht.
Zu dieser Zeit ist das Bataillon Held weiterhin im zügigen Vormarsch. Während einer Gefechtspause meldet sich über Sprechfunk der Regimentskommandeur.
»Hören Sie, Held«, sagt der Oberst. »Ich hab hier einen Polen, der Stein und Bein schwört, daß er Sie kennt. Er heißt Jan, ist aus Zerkaulen, und …«
»Ich komme sofort«, erwidert der Hauptmann, übergibt sein Bataillon einem Kompaniechef und rumpelt in seinem Kübelwagen los.
Stockend berichtet ihm der langjährige Ackerknecht aus Zerkaulen die Vorfälle und führt ihn zu dem zerschossenen Hof.
Martha Zerkaulen ist im Garten allein. Werner tritt neben sie, legt den Arm um ihre Schulter. Einen Moment stehen sie schweigend.
»Du mußt hier weg, Mama«, sagt er leise.
»Aber jetzt doch nicht, wo Prisca und Claudia zurückkommen …«
»Sie werden nie mehr zurückkommen, Mama«, erwidert er und setzt in Gedanken hinzu: hoffentlich.
Werner Held hat eine Vorahnung von dem Milhonen-Drama der endlosen Flüchtlingskolonnen, die in einem Meer von Blut und Tränen nach Westen ziehen. Von den mehr als 277 000 Ostpreußen, die auf der Flucht erfrieren, verhungern oder ertrinken, oder von Bomben zerfetzt, von Granaten zerrissen, von Panzern zerquetscht, von Sowjets ermordet werden.
Es ist die letzte Weihnacht in Ostpreußen, aber es leuchtet kein Stern. Man denkt mehr an Nemmersdorf, als an Bethlehem, mehr an den Untergang des Abendlandes als an die Geburt des Menschensohns im Morgenland.
Zum letzten Mal brennen in Deutschlands östlichster Provinz die Lichterbäume, glänzen Kinderaugen, und schmoren die Bratäpfel auf den Kachelöfen. Es ist behaglich warm in den festlich geschmückten Wohnstuben. Das Land der tausend Seen, das alle Jahre wieder unter einer hohen Schneedecke erstarrt, ist auf lange, strenge Winter eingerichtet.
Das größte Geschenk, das man sich an diesem noch friedlich anmutenden Weihnachtsabend im Kriege macht, ist die Hoffnung, daß die Heimat erhalten bleibt. Man läßt die Kerzen nicht ganz abbrennen, denn mit Sicherheit folgt im nächsten Jahr wieder eine Weihnacht, und selbst wenn bis dahin Frieden sein sollte, gibt es bestimmt Wichtigeres zu tun, als Wachskerzen zu ziehen.
»Vornehm geht die Welt zugrunde«, raunt Claudia ihrer älteren Schwester zu, als der Gastgeber das Zimmer betritt. Er trägt einen dunklen Anzug, weißes Hemd und Silberkrawatte – aber was im ersten Augenblick wie Snobismus aussieht, ist nur Trotz, gemischt mit Hilflosigkeit.
»Ich trinke auf Ihre baldige Heimkehr«, prostet der Gutsherr Schmidke seinen Gästen zu.
Eigentlich sind sie Zwangsgäste, vom Gauleiter einquartiert, der bestimmte, daß die Flüchtlinge aus dem Kreis Gumbinnen geschlossen im Kreis Osterode aufgenommen werden. So sind sie in der Heimat und doch nicht zu Hause, haben den ersten Russensturm überstanden, um jetzt in das Inferno zu geraten.
Da die beiden Schwestern aus Zerkaulen schon vor drei Wochen angekommen sind, haben sie im Haus ein Zimmer erhalten. Ihre Pferde stehen im Stall. Außer ihnen hat Herr Schmidke, der Witwer ist, noch weitere Flüchtlinge aufgenommen; insgesamt siebzehn Frauen, sechs Kinder und einen Greis.
Neunundsiebzig ist Grawutke der Älteste, und Priscas Junge Fabian mit drei Jahren und vier Monaten der Jüngste.
»Du sollst auch nicht trocken sitzen«, sagt der Gastgeber launig und schenkt dem Kleinen Limonade ein.
»Danke schön«, antwortet Fabian artig und deutet eine kleine Verbeugung an. Er hat die grauen Augen seines Vaters und dessen schmales Gesicht. Er ist staksig wie das Fohlen, das sie auf der Flucht fanden und hinten am Wagen angebunden haben.
Auf den Tischen stehen Speisen, die das Land bietet: Gänse-Weißsauer, Schmandschinken, der eigentlich nur ein raffiniert aufgemachter Kasseler Rippensper ist, Schmunzelsauce, daneben selbstgebrauter Bärenfang, der sündige Honigschnaps, und dazu ein Kuchen nach dem Rezept der Großmama: »Man nehme Mehl nach Bedarf, fünf Eier und fünfhundert Gramm Bienenhonig usw.« Tataren-Kuchen nennt sich das. Der Honig spielt in der ostpreußischen Küche eine bedeutende Rolle wie die Tataren in der ostpreußischen Geschichte. Sie kamen immer wieder wie die Pest, zündeten die Dörfer an, töteten die Männer, verschleppten die Frauen. Sie fielen so oft über Masuren her, daß der Volksmund behauptet, die Seen seien dunkel vom Blut der Erschlagenen.
Der Tatarensturm dieses Jahrhunderts kommt – abgesehen von den Einbrüchen im Regierungsbezirk Gumbinnen – an der Grenze zum Stehen. Die Ostfront ist siebenhundert Kilometer lang. Sie reicht von den Karpaten bis an die Memel. Die Sowjets nutzen die Zeit, ihren Nachschub zu organisieren und Reserven heranzuführen; sie haben aus Hitlers Fehler 1941 vor Moskau gelernt.
Zwar lassen die Aussagen von Überläufern und Kriegsgefangenen auf eine bevorstehende Offensive der Roten Armee schließen – deren Planung bis zum letzten Gefecht in Berlin reichen soll –, doch Hitler hält die Berichte des Generals Gehlen für Hirngespinste und einen bevorstehenden Russensturm für den »größten Bluff seit Dschingis Khan«.
Denn seit dem Gegenstoß bei Nemmersdorf steht die Front. Im bescheidenen Maße scheint sich das ostpreußische Wunder von 1914 zu wiederholen, und selbst in der Hauptkampflinie herrscht Ruhe, als respektierten die Sowjets die stille heilige Nacht.
Aber ihre Weihnachtsbotschaft lautet anders als die Friedensbotschaft des Evangeliums. »Junger Krieger«, heißt es in einem Aufruf an die sowjetischen Jugendverbände, »für das Leben jedes sowjetischen Menschen nimm zehn Deutschen das Leben. Denke daran, daß ein Tag, an dem du keinen einzigen Deutschen getötet hast, ein verlorener Tag war.«
»Erzittere, Deutschland!« steht in »Bojewaja Trewoga«, einer Soldatenzeitung. »Erzittere, verfluchtes Deutschland! Wir werden dich mit Feuer und Schwert durchziehen und in deinem Herzen den letzten Deutschen, der russischen Boden betreten hatte, erstechen.«
Die Antwort auf diese Haßgesänge hieß zunächst einmal Nemmersdorf. Nackte, gekreuzigte Frauen, an Scheunentore genagelt, zuvor von rasenden Soldaten vergewaltigt, verbreiteten ein Grauen, das die Sowjet-Marschälle auch als taktische Waffe einsetzten, um das rückwärtige Aufmarschgebiet der deutschen Wehrmacht durch Flüchtlingskolonnen hoffnungslos zu verstopfen.
Die Rote Armee sammelt sich zum Sturm: Kirgisen, Usbeken, Turkmenen, Tscherkessen, Georgier, ein Völkergemisch, stellen sich bereit zum Angriff auf Deutschland. An diesem Abend ist Claudia, die sonst immer aussieht wie ein Pferdejunge, festlich gekleidet.
Nachdem ihnen bei dem Angriff der sowjetischen Panzer der Durchbruch gelungen war, wartete sie auf das Gros ihres Trecks mit den Eltern. Sie hörte, daß die Russen durch den deutschen Gegenstoß zurückgeworfen wurden, aber sie durften nicht zurück, sondern wurden wie alle anderen Flüchtlinge aus den östlichen in die westlichen oder südlichen Kreise Ostpreußens umgeleitet.
Es war ein weiter Weg über schmale Straßen, vorbei an Rinderweiden, Pferdekoppeln, Gehöften, Gütern und Dörfern – 51,6 Prozent der Bewohner Ostpreußens lebten in Gemeinden unter zweitausend Einwohnern –, und die meisten Häuser waren noch heil, aber die Menschen standen mit verstörten Gesichtern davor: »Warum haut ihr ab?« fragten sie verbittert. »Warum bleibt ihr nicht?«
Stunden später pachten auch sie ihre Sachen und reihten sich ein in den Zug der Trostlosigkeit.
»Entschuldigt mich mal«, sagt Claudia und verläßt die festliche Tafel.
Prisca, ihre Schwester, sieht ihr lächelnd nach. »Sie paßt wirklich besser auf die Pferdekoppel als in die gute Stube«, stellt sie ohne Bosheit fest. Prisca Held ist schlank und blond. Ohne es zu wollen, fällt sie auf in dieser uniformierten Zeit. »Und jetzt gehst du zu Bett, Fabian«, sagt sie.
»Jetzt schon?« protestiert der Junge und verteilt dann doch Gute-Nacht-Küsse.
Claudia geht über den Hof. Die Tiere kennen ihren Schritt. Kasimir, der Rappe, wiehert, der Hengst Jaromir hebt den Kopf, und zwischen beiden steht Jean, der Franzose – und da sind ihre drei Lebensretter beisammen.
»Pourquoi du nicht kommst zu uns, Jean?« fragt Claudia in ihrem drolligen Deutsch-Französisch.
»Toute de suite, Mademoiselle«, erwidert Jean, der aus der Provence stammt. »Isch bientôt fertisch.«
Der junge Franzose hat seinen Kaffee bitter getrunken und den Zucker den Pferden gegeben. Sie stehen prächtig im Geschirr und haben sich von den Strapazen der Flucht erholt. Claudia und Jean betreuen sie bestens. Sie wissen, sie werden die Pferde noch brauchen. Ihr Wagen steht bereit, gewissermaßen ständig unter Dampf. Futter für die Tiere ist geladen, das Gepäck kann mit ein paar Handgriffen verstaut werden.
»Also, du kommst nach!« ruft Claudia dem Franzosen zu und kehrt in die Weihnachtsrunde zurück.
Die Stimmung verebbt, bevor sie überhaupt aufkam. Prisca sitzt am Bett des Jungen. Höchste Zeit, daß er einschläft. Zehnmal schlägt die Uhr an der Dorfkirche dumpf.
Dann klingelt das Telefon.
»Major Held.« Aufgeregt winkt der Hausherr Claudia zum Apparat.
»Bist du befördert worden?« fragt sie ihren Schwager.
»Du brauchst mir nicht zu gratulieren«, erwidert Werner.
»Moment, ich ruf Prisca.«
»Bleib!« sagt er hart. »Gut, daß du am Apparat bist.«
»Wo steckst du?« fragt Claudia.
»Irgendwo«, erwidert der Offizier, ein perfekter Soldat, der seinen Einsatzort nicht nennt, auch wenn der Krieg schon im Eimer ist. »Ich möchte, daß ihr weiterfahrt. Sofort. Mit dem Zug.«