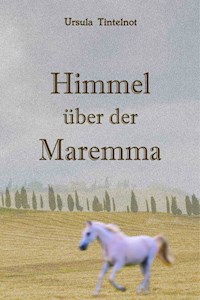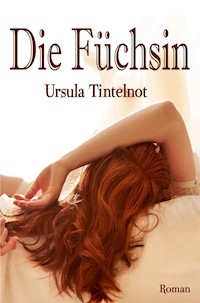
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ihre Lebenswelten könnten nicht unterschiedlicher sein. Valerie, eine erfolgreiche Autorin lebt in ihrer luxuriösen Eigentumswohnung in einem angesagten Quartier in Hamburg. Sie lebt allein, ohne feste Bindung, mit ihrer Katze. Ihr Leben zwischen exquisiten Empfängen und anstrengenden Lesereisen ist vergleichsweise glamourös. Adam ist durch einen Schicksalsschlag alleinerziehender Vater eines Eineinhalbjährigen und Besitzer einer Gärtnerei, vor den Toren der Stadt, auf dem platten Land geworden. Valerie kennt seinen Vornamen. Für Adam bleibt sie die Namenlose, die Füchsin, wie er sie bei sich nennt. Nach einer zufälligen, kurzen Begegnung, bleibt beiden eine unstillbare Sehnsucht nacheinander. Immer wieder sehen sie sich im Gewühl der Großstadt ohne sich näher zu kommen. Keiner von beiden ergreift die Initiative. Beide sind verletzt in ihrer ganz eigenen Weise und fürchten, noch einmal verletzt zu werden. Ihre Lebenswelten könnten nicht unterschiedlicher sein. Valerie, eine erfolgreiche Autorin lebt in ihrer luxuriösen Eigentumswohnung in einem angesagten Quartier in Hamburg. Sie lebt allein, ohne feste Bindung, mit ihrer Katze. Ihr Leben zwischen exquisiten Empfängen und anstrengenden Lesereisen ist vergleichsweise glamourös. Adam ist durch einen Schicksalsschlag alleinerziehender Vater eines Eineinhalbjährigen und Besitzer einer Gärtnerei, vor den Toren der Stadt, auf dem platten Land geworden. Valerie kennt seinen Vornamen. Für Adam bleibt sie die Namenlose, die Füchsin, wie er sie bei sich nennt. Nach einer zufälligen, kurzen Begegnung, bleibt beiden eine unstillbare Sehnsucht nacheinander. Immer wieder sehen sie sich im Gewühl der Großstadt ohne sich näher zu kommen. Keiner von beiden ergreift die Initiative. Beide sind verletzt in ihrer ganz eigenen Weise und fürchten, noch einmal verletzt zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Füchsin
Ursula Tintelnot
Roman
Impressum
Copyright: © 2021 Ursula Tintelnot
Umschlagsfoto: © GSPictures
Covergestaltung: © Medusa Mabuse
Buchsatz: © Medusa Mabuse
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten
Klappentext:
Ihre Lebenswelten könnten nicht unterschiedlicher sein. Valerie, eine erfolgreiche Autorin lebt in ihrer luxuriösen Eigentumswohnung in einem angesagten Quartier in Hamburg. Sie lebt allein, ohne feste Bindung, mit ihrer Katze. Ihr Leben zwischen exquisiten Empfängen und anstrengenden Lesereisen ist vergleichsweise glamourös.
Adam ist durch einen Schicksalsschlag alleinerziehender Vater eines Eineinhalbjährigen und Besitzer einer Gärtnerei, vor den Toren der Stadt, auf dem platten Land geworden. Valerie kennt seinen Vornamen. Für Adam bleibt sie die Namenlose, die Füchsin, wie er sie bei sich nennt.
Nach einer zufälligen, kurzen Begegnung, bleibt beiden eine unstillbare Sehnsucht nacheinander. Immer wieder sehen sie sich im Gewühl der Großstadt ohne sich näher zu kommen. Keiner von beiden ergreift die Initiative. Beide sind verletzt in ihrer ganz eigenen Weise und fürchten, noch einmal verletzt zu werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Lesung
2 Juni
3 Juni
4 Juni
5 Juli
6 Juli
7 Ende Juli
8 Juli
9 Ende Juli
10 August
11 August
12 August
13 August
14 Oktober
15 Oktober
16 Januar
17 Mai
18 Mai
19 Juli
20 Juli
21 Sommer
22 Sommer
23 Sommer
24 August
25 Ende August
26 Dezember
27 Mai Juni
28 Juni
Über die Autorin und weitere Werke
1 Lesung
Adam sitzt mit einem schlafenden Kind auf dem Schoß in einem weiten Raum. Schwarze Eisenstreben überwölben die hohe Decke der ehemaligen Fabrikhalle. Jetzt, nach der Lesung, stehen die Tore offen. Gruppen von Rauchern auf dem gepflasterten Vorplatz, Gedränge an der Bar. Die Tische sind nicht alle besetzt.
»Ben möchte Sie kennenlernen.«
Die, die er anspricht ist … so alt wie er? Vielleicht. Attraktiv? Sehr attraktiv. Hat sie zu viel getrunken? Er ist stocknüchtern.
»Ihr Ben schläft gleich ein.« Sie lacht leise.
»Das ist ein Täuschungsmanöver. Er tut nur so.«
Er betrachtet sie, möchte sie noch einmal zum Lachen bringen. Schön geschwungene Lippen. Augen, grau oder grün? Das kann er nicht erkennen. Unter gesenkten Lidern blickt sie das Kind an. Nicht ihn. Ihre Finger spielen mit einer langen, hauchdünnen Silberkette über ihrem Dekolleté. Ein halb geleertes Glas in ihrer Hand. Sicher nicht das erste, denkt er. Sie macht einen Schritt von ihm weg. Eine leichte Unsicherheit. Ihre Hand greift Halt suchend eine Stuhllehne.
»Wie gefielen Ihnen die Gedichte?«
Sie zögert. »Zu viel Todessehnsucht.«
Ja, die Gedichte drehten sich um Tod, Einsamkeit und Verlassenheit. Passend zu seiner eigenen Seelenlage.
Sie wühlt in ihrer Umhängetasche. Eine zerknitterte Zigarettenpackung kommt zum Vorschein. Ihre Hand zittert leicht. Das Feuerzeug findet sie in der Tasche ihres Jacketts. Sie atmet den Rauch tief ein und hält ihm nach kurzem Zögern die Packung entgegen.
»Nein, danke. Ich habe aufgehört.«
»Vernünftig.«
Sie zieht den Stuhl zu sich heran und setzt sich halb abgewandt von ihm, so, dass sie in den Raum sehen kann.
Er betrachtet ihre hohe Stirn, die gerade Nase, das Kinn. »Die Beschäftigung mit dem Tod ist legitim.«
»Sicher.« Sie dreht den Kopf in seine Richtung.
Unwillkürlich fragt er sich, wie es wäre, diese Lippen zu küssen, die sich gerade um die Zigarette schließen. Sie raucht gierig.
»Ich bin Adam«, sagt er schnell. Er will nicht, dass sie geht, kann den Blick nicht von ihr wenden. Üppiges dunkelrotes, von einem Band im Nacken zusammengehaltenes Haar. Die Lider schwer über schmalen Augen.
Die Füchsin, die seit einiger Zeit um sein Haus herumschleicht, fällt ihm ein. Eine hochbeinige elegante Fähe, mit ungewöhnlich dunklem rotem Fell. Eine Füchsin, denkt er. Eine Füchsin mit einer verletzten Pfote. Ihm ist ihr leichtes Hinken aufgefallen.
Sie ist ungewöhnlich. Sicher die auffallendste unter all den Frauen. Sie hat so etwas wie einen Panzer um sich, unsichtbar, aber ein Panzer.
Er blickt sich um. Es gibt nur wenige Männer hier. Wie so oft sind die Frauen auch bei dieser Lesung in der Überzahl. Er interessiert sich für Gedichte, Literatur überhaupt. Und für Kräuter und Giftpflanzen. Er züchtet sie, baut sie an und fotografiert sie. Seine Erkenntnisse schreibt er akribisch auf.
Als er wieder in ihre Richtung schaut, ist sie nicht mehr da. Auf dem Tisch liegt ihre Zigarettenpackung, daneben das Feuerzeug. Ohne nachzudenken, steckt er beides ein. Im Ausgang sieht er kurz ihr Profil. Glanz auf ihrem Haar. Dann ist sie fort. Verdammt! Er hätte gerne mehr von ihr gewusst. Sie hat nicht einmal ihren Namen genannt. Er erhebt sich, als das Kind auf seinem Schoß sich regt.
»Wir gehen heim«, flüstert er.
Der kleine Junge legt die Arme um Adams Hals und schmiegt sich an ihn. »Dada«, flüstert er und schläft wieder ein.
Der rote Pritschenwagen ist alt und nicht sehr sauber. Ein Auto, dem man den Gebrauch ansieht. Ein Nutzfahrzeug, kein Statussymbol. Er schnallt das Kind im Kindersitz fest, schiebt die Tür so leise wie möglich zu und geht um den Wagen herum, um auf der anderen Seite einzusteigen.
Benjamin, denkt er, müsste in seinem Bettliegen, nicht mit mir an nächtlichen Veranstaltungen teilnehmen. Er bleibt eine Weile sitzen, ohne den Wagen zu starten, und starrt auf den regenfeuchten Asphalt. Ein kurzer warmer Sommerregen, der keine Abkühlung bringt. Adam fährt erst los, als der Regen nachlässt. Er hat wieder nicht an die defekten Scheibenwischer gedacht. Morgen, denkt er.
Diese Frau geht ihm nicht aus dem Kopf. Er ärgert sich, dass er sie hat gehen lassen. Eine Frau ohne Namen, eigentümlich vertraut.
Ben schnarcht leise, sein Köpfchen ist zur Seite gefallen. Mit beiden Händen hält er einen kleinen Stoffhund an die Brust gedrückt. Adam fragt sich nicht zum ersten Mal, wie er mit einem knapp Zweijährigen zurechtkommen soll. Seine Gedanken wandern zum dunkelsten Tag seines Lebens. Dem Tag, an dem seine Schwester starb und ihm ihr Leben hinterließ.Er hat es angenommen.
Jetzt startet er seinen Wagen. Fünfundvierzig Minuten später sieht er die Dächer der Gewächshäuser, glänzend nass vom Regen. Daneben die Scheune und das große alte Steinhaus. Vorsichtig biegt er in den Hof ein und parkt direkt vor der Haustür. Die Füchsin sitzt reglos zwischen den Gewächshäusern. Er hebt Ben aus seinem Sitz und bringt ihn, ohne ihn zu wecken, ins Bett.
2 Juni
Valerie hat es nicht eilig. Sie lebt allein mit ihrer Katze. Abgesehen von ihren Besuchen im Verlag hat sie einen einsamen Job.
Sie schreibt Liebesromane, obwohl sie an die Liebe nicht mehr glaubt, seit sie ein Teenager war, und die Kolumnen, die sie in verschiedenen Zeitschriften unterbringt, handeln nicht von Liebe, sondern von deren Nichtvorhandensein. An Abenden wie diesem gönnt sie sich Ausgang. Sie zieht um die Häuser, geht in ihre Stammkneipe, ins Theater und gelegentlich in die Oper oder besucht eine Lesung. Allein oder in Gesellschaft.
Wie hieß noch der kleine verschlafene Kerl? Ben? Auf die Idee, ein Kleinkind in die Nacht mitzunehmen, konnte nur ein Mann kommen. Sein Sohn? Vielleicht. Hat das Kind denn keine Mutter?Warum geht mir dieser Mann nicht aus dem Kopf?
Ihr Taxi hält vor einem hohen Stadthaus. Ein Altbau, vor Jahren renoviert, wie viele der Häuser hier. Oft mit Hinterhöfen, manche bepflanzt und zu idyllischen Gärten oder Spielplätzen umfunktioniert.
Wo ist der verflixte Hausschlüssel? Sie wühlt blind in ihrer Tasche, bis sie das kühle Metall spürt. Hinter sich hört sie gedämpft den Verkehr. Gelächter aus offenen Fahrzeugen, von den Balkonen der umliegenden Häuser. Die Nacht ist noch nicht zu Ende. Musik und der süße Duft von Phlox erfüllen die Luft.
Bevor sie aufschließen kann, öffnet sich die Haustür. Ein junger Mann hält ihr die Tür auf und verschwindet grußlos in der Dunkelheit. Im ersten Stock kracht eine Tür mit lautem Knall zu. Sie fragt sich, warum das Paar noch zusammenlebt. Kein Tag vergeht ohne lautstarke Auseinandersetzungen.
Sie steigt in den zweiten Stock, öffnet ihre Tür und hängt den Schlüsselbund an den dafür vorgesehenen Haken daneben. Ein leiser Plumps. Gleich darauf streicht die Katze um ihre Beine. Nachdem sie die Sandalen von den Füßen geschüttelt hat, nimmt sie die Katze auf den Arm und geht mit ihr in die Küche. Sie steckt die Nase in ihr Fell. Lieber die Katze als Magnus. Er hat das Tier bei ihr gelassen, er selbst hat den Aufwand nicht gelohnt. Sie drückt die Katze an sich.
Valerie liebt ihre Wohnung, ihr Alleinsein. Sie ist nicht dafür gemacht, mit jemandem zusammenzuleben. Die Wohnung ist großzügig geschnitten und mehr als sparsam möbliert. Ein bequemer Sessel. Ein paar Sitzmöbel von angesagten Designern. Küche und ein großes Wohnzimmer gehen ineinander über, ein separates Schlafzimmer, ein kleines Gästezimmer. In allen Räumen brennt Licht. Sie lässt es an, wenn sie die Wohnung verlässt.
Jetzt öffnet sie eine Dose für die Katze und sieht ihr, gegen den Küchentresen gelehnt, eine Weile beim Fressen zu.
Auf der Arbeitsplatte liegt das fertige Manuskript neben dem Drucker. Morgen wird sie es in den Verlag bringen. Gerade noch geschafft. Die Abgabetermine sind streng getaktet. Das neue Buch soll zur Buchmesse im Oktober herauskommen. Sie streicht über den Titel und sieht, dass der Anrufbeantworter blinkt. Sie lässt ihn blinken, dann drückt sie entschlossen auf eine Taste. Löschen. Ihr Verlag, ihre Mutter oder Magnus. Auf keinen von ihnen ist sie scharf.
Sie holt den Weißwein aus dem Kühlschrank, schenkt sich ein Glas ein und verlässt die Küche. Die Flasche nimmt sie mit. Valerie öffnet die Balkontür. Sie ist keine Blumenliebhaberin, aber sie liebt den Duft von Kräutern. Weißer Thymian, Majoran, Zitronenmelisse, Basilikum und Rosmarin wachsen üppig in großen grauen Kübeln. Bequeme Stühle, ein Tisch und eine breite Liege. Sie lehnt am Geländer und trinkt einen Schluck. Im Glas erkennt sie ihr Spiegelbild. Sie weiß nicht, wie lange sie hier steht. Um sie herum ist es still.
»Wir gehen schlafen«, verkündet sie der Katze.
Die Katze sitzt bewegungslos auf dem Tisch und fixiert sie. Nur die Schwanzspitze zuckt. Als Valerie im Bett liegt, starrt sie die Decke an und denkt an Magnus. Sie wartet auf den Schmerz, aber da ist nichts, sie vermisst ihn nicht, keine Trauer, kein Gefühl. In ihr bleibt es still.
Über das Bild von Magnus schiebt sich ein anderes. Adam. Verflucht, warum ist sie nicht einfach weggelaufen, als sie ihn im Foyer der Fabrikhalle entdeckt hat?
Du weißt, warum.
Die Ähnlichkeit dieses Mannes mit Samuel, ihrer ersten und einzigen Liebe, war frappierend, hatte ihre Knie weich werden lassen. Auch wenn sich beim Näherkommen die Ähnlichkeit verloren hatte. Die Anziehungskraft war geblieben. Das Gefühl, diesen Mann zu kennen. An die Stuhllehne geklammert, hatte sie sich setzen müssen. Nie mehr hatte sie gefühlt wie damals, bis heute.
Du bist geflohen, wie du immer fliehst, wenn es um Gefühle geht, denkt sie.
Valerie wird vom Telefon geweckt. Stöhnend zieht sie sich ihr Kissen über den Kopf. Um diese Uhrzeit kann nur es eine sein. Ihre Mutter.
»Valerie, ich weiß, dass du da bist.«
Warum ruft diese Frau immer so früh an? Für sie besteht doch keine Veranlassung, zu nachtschlafender Zeit aus dem Bett zu springen. Ihre Mutter hat keinen Beruf, sie muss das Haus nicht verlassen wie die Mehrzahl ihrer Geschlechtsgenossinnen. Sie berichtigt sich, warum rufst du überhaupt an, Mutter?
Sie selbst hat einen Anlass aufzustehen, jetzt. Ein Termin mit ihrer Lektorin im Verlag. Auf ihrem Weg ins Bad füllt sie Wasser und Futter für die Katze in zwei Näpfe und setzt Kaffee auf. Nach dem zweiten Anruf ihrer Mutter an diesem Morgen nimmt sie nun doch ab.
»Grace hier. Endlich«, hört sie ihre Mutter, als ob sie es nicht wüsste. Für Valerie ist sie immer nur Grace, Mutter mache sie alt.
»Ich bin in Eile.« Sie mustert sich im Spiegel.
»Das bist du immer.«
»Ich habe einen Beruf.«
»Du schreibst, das ist etwas anderes. Ich möchte euch zum Abendessen sehen.«
»Wen meinst du mit euch. Soll ich die Katze mitbringen?«
Valerie hört ihre Mutter einatmen.
»Sei nicht albern.«
Wenn ich in deiner Gegenwart etwas nicht fühle, Mutter, ist es der Wunsch, albern zu sein.
Dann Grace Stimme: »Was ist denn mit Magnus? Er ist reizend und so gut erzogen.«
»Das ist die Katze auch. Wir haben uns getrennt. Die Katze hat er dagelassen.«
»Kannst du nicht einmal einen Mann halten?« Grace dehnt das einmal theatralisch. »Ich nehme an, dass du nicht mehr lange fruchtbar bist?«
Valerie holt tief Luft. »Ich bin zweiunddreißig, nicht hundert. Im Verlag erwartet man mich.«
»Eine Frau muss einen Mann finden, bevor sie völlig abstoße…«
Valerie knallt den Hörer auf die Station und fragt sich, warum die Gespräche mit ihrer Mutter immer zu einem Schlagabtausch gelingen. Die Katze verschwindet mit eingeklemmtem Schwanz unter einem Sessel. Warum ärgert sie sich immer wieder über ihre Mutter? Aber natürlich weiß sie es. Sie ist übergriffig und so taktlos, dass sie jedes Mal zusammenzuckt.
Valerie läuft die Stufen hinab, zieht die Haustür hinter sich zu und steigt in das wartende Taxi. Ihr Manuskript hat sie unter den Arm geklemmt, eine Umhängetasche über der Schulter. Da die Datei längst bei Ruth liegt, ist es nicht nötig, es mitzunehmen, aber sie will noch ein paar Stellen, die sie markiert hat, mit der Lektorin besprechen. Sie starrt blicklos aus dem Fenster. Erst als das Taxi den Mittelweg überquert, um über die Alsterchaussee den Harvestehuder Weg anzusteuern, wird sie wach. Sie muss sich auf die kommenden Gespräche konzentrieren.
Das rechteckige Gebäude des Verlages Neumeyer & Roth liegt in einem schönen parkähnlichen Gelände an der Außenalster. Ruth erwartet sie. Die Cheflektorin ist längst zu einer Freundin geworden. Sie hat von Anfang an ihre Romane betreut.
»Wie immer ein paar Minuten zu spät.« Ruth umarmt sie. »Macht nichts, der Kaffee kommt gleich. Der Chef will dich nachher auch noch sehen, aber erstmal machen wir uns an die Arbeit.« Sie lacht und zieht sie in ihr Büro.
Valerie legt ihr Manuskript auf den ausladenden Schreibtisch und lässt sich stöhnend in einen Sessel fallen. »Meine Mutter«, klagt sie.
»Was hat sie wieder angestellt?«
Statt einer Antwort fragt sie: »Bin ich eigentlich schon völlig abstoßend?«
Ruth lacht ihr Lausbubenlachen und nickt. »Du siehst grässlich aus.«
Was sie sieht, ist alles andere als reizlos. Eine attraktive, erfolgreiche Frau, die nicht ahnt, wie verführerisch sie ist. Warum weiß Valerie das nicht?
»Wie kommst du jetzt da drauf?«
Valerie schildert den morgendlichen Anruf.
»Warum telefonierst du überhaupt noch mit ihr?«
Valerie steht auf und tritt ans Fenster. Sie blickt auf die glitzernde Alster und auf die im Sonnenlicht kreuzenden weißen Segel. Auf diese Frage weiß sie keine Antwort. Sie hat sie sich selbst schon tausendmal gestellt.
3 Juni
Adam steht seit fünf Uhr im Gewächshaus. Ben schläft noch. Er hört sein leises Atmen aus dem Babyphone, das er neben blühendem Salbei deponiert hat. Seit er Benjamin bei sich hat, steht er früh auf, um so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen. Nichts hat ihn auf den Tag im letzten November vorbereitet. Er greift nach einer Pflanzkiste und zieht sie zu sich heran. Nicht daran denken! Aber er kann es nicht verhindern. Vor seinem inneren Auge taucht das sanfte schöne Gesicht seiner Schwester auf. Ben hat viel von ihrer Sanftheit, denkt er. Er blickt über die großen Metalltische. Es war Semeles Gärtnerei nach dem Tod des Vaters gewesen. Adam ist Biologe.
»Es ist nicht mein Ding, mir die Hände schmutzig zu machen«, hatte er lachend erklärt, als es um die Nachfolge ging.
Sein Vater gab seine Gärtnerei gerne in die Hände seiner Tochter und ließ seinen Sohn studieren. Jetzt steht Adam hier und packt die Pflanzkisten, die heute ausgeliefert werden sollen, er macht genau das, was er nie machen wollte, er macht sich die Hände dreckig. Er weiß, wie sehr sein Vater und seine Schwester die Gärtnerei geliebt haben. Adam kann sie nicht aufgeben. Schon deshalb nicht, weil sie alles ist, was Ben von seinem kleinen Leben geblieben ist.
»Wuff.«
Adam läuft los. Ben kann es nicht ertragen, alleine zu sein, besser, ohne ihn zu sein. Die kleine Hündin Bella flitzt vor ihm her. Auch sie ein Erbe seiner Schwester. Adam ist eher ein Katzenmensch. Mit dem Tod seiner Schwester und seines Schwagers ist er Mutter und Vater zugleich.
Sie waren auf dem Rückweg von seiner Party ums Leben gekommen. Er fühlt sich schuldig. Natürlich ist es nicht seine Schuld, aber er kann den Gedanken einfach nicht abschütteln. Er sieht die Polizistin mit einem weinenden Kleinkind auf dem Arm noch vor sich stehen.
»Ich muss Ihnen leider mitteilen … Sind Sie der einzige lebende Verwandte?«
Seit dieser Zeit hat er Ben bei sich. Wochenlang trägt er ihn auf dem Arm oder auf den Schultern. Sobald er ihn absetzt, klammert sich der Junge an ihn wie ein Äffchen. Einschlafen ohne Adam, Fehlanzeige. Duschen alleine kommt nicht in Frage. Zu Anfang war es lästig, jetzt, nach acht Monaten, fehlt ihm etwas, wenn der Kleine mal nicht auf seinen Schultern hockt. Ben sitzt im Bett, den Blick fest auf die Tür gerichtet. Er weint nicht, er wartet. Adam kämpft gegen die Tränen an. Er nimmt den Jungen auf den Arm und küsst ihn aufs aschblonde Haar. So blond und widerborstig wie sein eigenes.
»Guten Morgen, mein Kleiner. Auf geht’s. Jetzt gibt’s Frühstück.«
Ben schlingt seine Ärmchen um Adams Hals. »Dada.«
»Ich bin da. Und schau, da ist auch Bella.«
»Bella«, wiederholt Ben.
Die Hündin sieht ihn aus hellblauen Augen an. Ein Ohr hängt bekümmert nach unten, das andere steht fragend in die Höhe. Sie zeigt ein schiefes Lächeln, wenn sie eine Lefze hochzieht.
Eine Schönheit ist sie nicht, denkt Adam. Aber seine Schwester mochte sie. Und auch Ben liebt sie. Er lässt ihn nur los, um hinter Bella herzulaufen. Das gibt ihm die Zeit, sein Müsli vorzubereiten. Wickeln, waschen, füttern, alles ist zur Routine geworden.
Vor der Tür wird es laut. Ein Moped rattert über den Hof.
»Hinnerk«, sagt Adam.
Ben nickt und schiebt sich einen Löffel Müsli in den Mund. Er spricht nicht viel.
»Moin, bin da.« Hinnerk steckt den Kopf durch die Tür, winkt kurz und geht in Richtung der Gewächshäuser. Auch Hinnerk spricht nicht viel.
Der Morgen ist noch frisch, aber die Luft erwärmt sich fühlbar. Es wird wieder ein warmer Tag werden. Ben kratzt sorgfältig seine Schüssel sauber.
Mehrmals hat eine Dame vom Sozialamt Adam besucht:
»Ben gehört in einen Kindergarten. Er ist in seiner Entwicklung zurück.«
»Was meinen Sie damit?«
»Er spricht nicht, geht nicht auf mich zu, wie … norm… andere Kinder es tun würden.«
Er verkniff sich eine scharfe Antwort. Ich würde auch nicht auf dich zugehen, Zicke. Er verkniff sich auch den Hinweis, dass Ben den Unterschied zwischen Salbei, Thymian, Rosmarin und noch so einigen anderen Kräutern kennt.
»Und, soweit ich sehen kann, ist er auch noch nicht trocken.«
»Das war ich in seinem Alter auch noch nicht«, sagte er. »Ich habe noch mit fünf in die Hose gepisst, und wenn mein Neffe das möchte, darf er das auch.«
Er grinst, als ihm diese Szene einfällt, und stellt Bens inzwischen säuberlich leer gekratzte Schüssel in die Spüle.
»Wir gehen jetzt arbeiten«, sagt er und hebt Ben vom Kinderstuhl.
Hinnerk ist dabei, die gepackten Kisten auf dem Pritschenwagen zu stapeln. Das Auto mit der Aufschrift: S. Frank Gartenbau steht jetzt vor den Glashäusern.
S. Frank steht für: Simon, seinen Vater, und Semele, seine Schwester. Er hat es nicht über sich gebracht, seinen eigenen Buchstaben davorzusetzen. Nicht einmal die Website hat er aktualisiert. Er vermisst sie beide noch zu sehr. Vielleicht würde eines Tages ein B für Ben dazu kommen.
»Ist das alles?« Hinnerk steht vor ihm und deutet auf die Kisten.
»Nein, eine fehlt.« Adam konsultiert ein kleines Heft, das er aus der Tasche seiner Jeans zupft. »Hier. Thymus praecox, weißer Thymian.«
Ben zieht ihn zielsicher in die richtige Richtung, dorthin, wo die vorgezogenen Thymianpflanzen stehen.
»Sehr gut, mein Kleiner.«
Hinnerk lacht. »Du musst ihm bald Gehalt zahlen. Auf mich kannst du dann verzichten.«
Adam nickt. »Nur das mit dem Führerschein muss noch warten.«
Er packt noch eine weitere Kiste mit den winterharten Pflanzen und klebt einen Zettel mit der Adresse an die Seite. Hinnerk ist schon immer hier gewesen. Er ist mit Leib und Seele Gärtner. Er wüsste nicht, was er ohne ihn tun sollte. Adam spürt ein Ziehen. Er wäre gerne selbst gefahren, aber das macht er nicht. Die Bestellungen auszufahren und die Bepflanzung der Stadtbalkone und Gärten überlässt er Hinnerk. Er fühlt Bens Hand in seiner. Es ist richtig, was er tut. Ben setzt sich nicht gerne in ein Auto.
Adam nimmt sich den Ordner mit den Bildern. Von jedem der Balkone macht Hinnerk ein paar Aufnahmen, natürlich mit der Erlaubnis der Besitzerinnen, manchmal sogar mit einem Selfie seiner Kundinnen. Fast immer sind es Frauen, die sich an seine Firma wenden. In Gedanken fährt er mit Hinnerk durch Hamburg, liefert die bestellten Pflanzen aus und pflanzt sie auf Wunsch gleich in Kübel und Kästen ein. Soweit er sehen kann, hat er seit dem Tod seiner Schwester keine Kunden verloren. Hinnerk hat offensichtlich sehr gute Arbeit geleistet. Die Frauen mögen Hinnerk. Aber Adam hütet sich, das auszusprechen. Mit seiner tiefen Stimme und der ruhigen Art wirkt Hinnerk vertrauenswürdig. Er klappt den Ordner zu. Es gibt viel zu tun.
Er geht mit Ben zu dem kleinen, mit roten Ziegeln ummauerten Garten hinter den Glashäusern. Dort pflanzt er Heilkräuter an. Heilkräuter, die immer auch Giftkräuter sind. Deshalb schärft er Ben eindringlich ein, dass er nie, niemals ohne ihn, diesen Teil des Gartens betreten darf. Aber Ben geht ohne ihn nirgendwo hin. Darüber muss er sich noch keine Sorgen machen. Vor der roten Ziegelmauer blüht die schönste und höchste seiner Pflanzen, der tiefblaue Eisenhut, giftig bis in jede seiner Fasern.
Eine Giftpflanze mit krimineller Vergangenheit. Sie musste über Jahrhunderte als Mordinstrument herhalten. In all ihren Pflanzenteilen steckt Alkaloid Aconitin, das bereits in geringen Mengen tödlich wirkt. Die tödliche Dosis bei Erwachsenen liegt bei zwei bis vier Gramm der Wurzel. Das entspricht ein bis zehn Milligramm Aconitin pro Kilogramm Körpergewicht. Der Tod tritt meist innerhalb weniger Stunden ein, durch Herzversagen und Atemlähmung.
Der berühmteste Mord mit Eisenhut hatte sich wohl an Kaiser Claudius im alten Rom zugetragen. Seine Gattin und ihr Leibarzt sollen ihm giftige Pilze unter das Essen gemischt haben. Er konnte sich danach noch in seine Gemächer schleppen, in der Absicht, mit einer Vogelfeder einen Würgereiz hervorzurufen. Diese Vogelfeder allerdings war getränkt mit einem Extrakt aus Eisenhut, was letztendlich zu seinem Tod geführt haben soll.
Ben bleibt ein Stück weit davon entfernt stehen, wie Adam es ihm beigebracht hat. Selbst die Berührung ist gefährlich.
4 Juni
Valerie klopft, wartet aber nicht auf ein Herein, bevor sie die Tür öffnet. Viktor sitzt hinter seinem riesigen, unaufgeräumten Schreibtisch. Das Büro ist angenehm kühl. Er erhebt sich und schließt sein zweifellos nicht von der Stange gekauftes Jackett, als sie eintritt.
Wie gut er aussieht, denkt sie.
Mit einem kaum unterdrückten Tadel in der Stimme sagt er: »Du hast es mal wieder geschafft, uns alle in Atem zu halten.«
Valerie verzieht die Lippen.
»Das hält dich so unverschämt jung.«
Sie strahlt ihn an. Sie weiß, dass er sich ärgert, wenn sie Termine nicht einhält.
Er geht drei Schritte auf sie zu, küsst sie auf den Mund und legt eine Hand besitzergreifend auf ihren Rücken. »Wann sehen wir uns mal wieder außerhalb dieses Büros? Ich könnte heute in der Stadt bleiben.«
Zu forsch für ihren Geschmack. Sie löst sich von ihm und nimmt Platz auf dem Stuhl vor seinem Schreibtisch. Das gibt ihr die nötige Distanz. Sie will sich nicht noch einmal mit ihm einlassen. Er war nichts als eine Affäre, redet sie sich ein, und doch hat die Trennung von ihm Spuren hinterlassen. Sie will nicht an seine Frau und seine Kinder denken. Ihr fällt dennoch die weiße Villa an der Elbchaussee ein, mit einem traumhaft schönen Blick auf die Elbe. Valerie hat kein schlechtes Gewissen. Sie lächelt. Ihre moralischen Standards sind nicht gerade antiquiert. Wenn sie ehrlich ist, zieht sie Affären mit verheirateten Männern vor. Sie reden nicht über ihre Eroberungen und gehen nach angemessener Zeit wieder. Nichts von Dauer.
»Wie geht es deiner Frau und den Kindern?«, fragt sie, statt seine Frage zu beantworten.
»Ich hab’s verstanden«, sagt er lächelnd. »Wie geht es deinem Katzenmann?«
Nur noch Katze, kein Mann, denkt sie. Sie antwortet nicht.
Er nimmt das neue Exposé vom Tisch. »Du bist ja fleißig. Ich lese es durch. Hat Ruth es schon gesehen?«
»Wir haben kurz darüber gesprochen.« Valerie weiß, wie viel Viktor von der Meinung seiner Cheflektorin hält. Ruth hat ein gutes Gespür für die Themen der Zeit und eine untrügliche Nase, was bei Valeries Leserinnen ankommt.
Er nimmt einen Bogen Papier aus einer Schublade und legt einen Füller darauf. Valerie unterschreibt einen weiteren Vertrag.
Viktor beobachtet sie beim Schreiben. Sie sieht bezaubernd aus, denkt er, und sie ist verdammt anziehend. Valerie ist eines der Zugpferde seines Verlages. Jedes ihrer Bücher wird zum Bestseller. Sie besitzt eine geschliffene Sprache, und ihre Texte sind voller Humor. Interessant ist die Diskrepanz zwischen den Romanen und den Artikeln, die sie in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht. Dort verwandelt sie sich in eine Zynikerin, die zweifelt, fragt und verblüffende Zusammenhänge aufdeckt. Er liest sie ausnahmslos.
»Danke«, sagt er, als sie das Papier über die Tischplatte reicht. »Sagst du mir etwas über den Inhalt?«
»Nein.«
Valerie erhebt sich. Der schmale Rock ihres ärmellosen Leinenkleides lässt nur die Fesseln sehen. Beim Gehen öffnet er sich bis zu den Knien. Viktor erhebt sich ebenfalls. Sie ist bereits an der Tür, als er sie erreicht.
»Lies es durch«, sagt sie, »und sag mir, was du davon hältst.«
Viktor nimmt ihre Hand und haucht einen Kuss darauf.
»Mach ich. War schön dich zu sehen.«
Valerie verlässt das Verlagshaus. Sie geht langsam den Harvestehuderweg entlang. Zu ihrer Linken glitzert die Alster im Sonnenlicht. Segelboote.
Eine Postkarte, denkt sie, biegt in die Alsterchaussee ein, überquert den Mittelweg und läuft bis zur Hallerstraße. Die Gärten und Häuser nimmt sie kaum wahr. Am U-Bahnhof gibt sie auf. Die neuen Riemchensandalen drücken und sind nicht halb so bequem, wie sie aussehen.
»Paulsenplatz«, ächzt sie, wirft sich in die Polster des Taxis und löst die Riemchen an ihren Füßen.
»Bleibt es dabei?« Der Taxifahrer grinst.
»Versprochen«, sagt sie.
Den Nachmittag verbringt sie auf dem Balkon. Die Pflanzen duften und glänzen vor Nässe. Sie träumt von einem kühlen Glas Wein, einem Stück Käse am Abend nur mit ihrer Katze. Aber sie ist mit Ruth verabredet.
Valerie trifft ihre Freundin in der weiten Halle, in der auch die Lesung vor einigen Tagen stattgefunden hat. Ruth hat Karten für ein afrikanisches Tanztheater in der Fabrik. Tanz interessiert sie nicht, sie geht ihrer Freundin zuliebe mit. Ruths Armreifen klirren, wenn sie ihr Glas zum Mund führt. Sie stehen an der Theke, wo man in der Pause oder nach der Vorführung ein Glas Wein oder Prosecco trinken kann.
»Erwartest du jemanden?« Ruth sieht sich um.
»Nein. Wie kommst du darauf?«
»Weil du mich den ganzen Abend über noch nicht angesehen hast. Stattdessen hast du diesen suchenden Blick.«
Valerie hat tatsächlich an ihn gedacht. Vielleicht kommt er ja öfter hierher?
Sie spürt eine leichte Wärme auf den Wangen und beschließt, die halbe Wahrheit zu erzählen. Dann denkt sie, dass es überhaupt keine Wahrheit gibt, keine halbe und auch keine ganze. Unwillig über sich selbst schüttelt sie den Kopf.
»Also was ist?« Ruth lässt nicht locker.
»Gar nichts. Ich habe bei der Lesung neulich hier einen Mann gesehen.«
»Aha.« Ruths Brauen fahren interessiert in die Höhe. Armreifen und Ketten klingeln bei jeder Bewegung.
Sie sieht aus, als habe sie sich für diesen Abend mit bunten Perlen und Reifen folkloristisch aufgepeppt, aber es steht ihr gut. Ruth kann alles tragen, und sie ist unbestreitbar sexy. Kein Mann, der nicht einen Blick riskiert, denkt Valerie.
Sie sieht an ihrem eigenen schlichten schwarzen Kleid hinab. Dazu trägt sie eine lange schmale Silberkette und rote Pumps. An ihr klingelt nichts. Sie lächelt. Ruth sendet Signale an ihre Umgebung: Hey Leute, hier spielt die Musik. Und das tut sie mit Erfolg.
»Er war etwa zwei Jahre alt«, sagt Valerie jetzt »und saß auf dem Schoß seines Vaters. Ich nehme jedenfalls an, dass es sich um den Vater handelte. Keine Ahnung, wir haben nicht miteinander gesprochen.«
Sie weiß nicht, warum sie Ruth verschweigt, dass sie doch miteinander gesprochen haben. Es ist nicht wichtig, denkt sie. Warum kann sie sich dann an jedes Wort erinnern? Adam und Ben.
Ruth, denkt sie, hat nicht besonders viele Freunde, aber ganze Rudel von Bekannten. Sie weiß nicht mehr, wie oft ihre Freundin heute schon gegrüßt worden ist. Ruth kennt Gott und die Welt, weiß aber ihr Privatleben sehr sorgfältig zu schützen. Allerdings kann sie mit Gefühlen besser umgehen als sie selbst.
Valerie fällt plötzlich ein, dass sie ihre Kolumne für eine Zeitschrift nicht länger aufschieben kann. Die Redaktion braucht ihren Text morgen, und sie hat noch nicht einmal damit angefangen. Ausgerechnet über Gefühle soll sie schreiben.
»Ich muss gehen.«
In Gedanken ist sie schon bei der Arbeit, die vor ihr liegt. Valerie lässt sich von Ruth in den Arm nehmen, eine Körperlichkeit, die sie nur wenigen erlaubt. Diese künstliche Herzlichkeit hat ihr nie gefallen.
5 Juli
Adam studiert alte Rezepte. In der Nacht, wenn Ben fest schläft, sitzt er über seinen Büchern. Sein kostbarster Besitz ist ein abgegriffenes schwarzes Büchlein mit der schlichten Aufschrift Gift-Buch. Kein gedrucktes Buch, sondern eine Kladde, handgeschrieben von 1534. Er liest: Steppenraute, Tollkirsche, Quecksilber, Giftpilze, Geifer und Galle von Gifttieren. An Betäubungsmitteln (medicinaestupefactoriae) nennt der Verfasser: Bilsenkraut, Alraune, Opium, Giftlattich und Mohn; diese töten nur bei Überdosierung. Sehr beruhigend, denkt er.
Adam schaut auf, als Bella ein leises Knurren von sich gibt. In den Julinächten wird es nicht wirklich dunkel. Adam legt sein Heft zur Seite und tritt ans geöffnete Fenster. Vielleicht ein Fuchs oder ein anderes Tier, das sich an seinem Haus vorbeistiehlt. Bella sieht aufmerksam zu ihm auf.
Ist da ein Schatten, eine verstohlene Bewegung? Eine Weile bleibt er noch am Fenster stehen, aber nichts rührt sich.
»Da ist nichts, Bella«, sagt er.
Die Hündin trottet zurück zum Tisch und lässt sich seufzend auf den kühlen Steinboden fallen. Adam nimmt eine angebrochene Flasche Gavi aus dem Kühlschrank, schenkt sich ein Glas ein und geht damit an den Küchentisch. Er setzt die Kopfhörer auf und lauscht dem unfassbar süßen Sopran der Sängerin: »Porgi Amor … Hör mein Flehn, o Gott der Liebe …«
Er denkt an die Frau ohne Namen. Sie hat sich in seine Seele gebrannt. Immer wieder hört er sie leise lachen. Sieht ihren forschenden Blick.
Seit er Ben bei sich hat, ist Adam oft allein. Es überrascht ihn, wie sehr ihm dieses Leben gefällt. Sein Handy leuchtet auf. Christina! Auf dem Bildschirm erscheint ihr Gesicht. Das Foto hat er selbst gemacht. Sie lacht ihn an, ihr langes Haar flattert im Wind und verschwimmt im gleißenden Gelb des Rapsfeldes im Hintergrund. Er hat sie nicht vergessen, sie passt nur nicht mehr in sein Leben. Keine Frau der Welt hält einen Mann aus, auf dessen Hüfte oder Schultern über Wochen ein kleines Kind hockt. Das hat sie ihm bei ihrer letzten Begegnung sehr deutlich gemacht. Er setzt die Kopfhörer ab und nimmt den Anruf an.
»Adam, bist du das?« Ihre Zunge stolpert.
Sie ist betrunken, denkt er. »Christina.«
»Ich will dich wiedersehen.«
Er denkt an die letzten Auseinandersetzungen. »Ich glaube, das ist keine gute Idee.«
»Aber ich vermisse dich.«
Dieses andere Gesicht schiebt sich über das Christinas, nicht so jung, aber faszinierend. Das Gesicht einer Frau, die so präsent ist wie keine, die er kennt. Er hört sie leise lachen, die Namenlose. Ihr glänzendes Haar. Sein Puls beschleunigt sich.
»Adam, bist du noch dran?«
»Was?«
»Ich könnte morgen zu dir rausfahren. Lass uns reden.«
Er gibt nach. Dann legt er auf. Es ist fair, denkt er, mit ihr zu reden.
Adam starrt auf das Handy. Eigentlich weiß er, dass es nichts mehr zu sagen gibt. Als er aufschaut, steht Ben in der geöffneten Küchentür.
Adam nimmt den Jungen auf den Arm und geht mit ihm zum Fenster. Sie sehen beide hinaus auf die Apfelwiesen. Ein durchsichtiger Schleier aus Dunst liegt über allem. Die frühen Äpfel sind reif.
»Morgen pflücken wir Äpfel, Ben.«
Der Junge nickt verständig.
»Und jetzt gehen wir beide schlafen.«
Adam legt Ben in das altmodische Doppelbett, in dem seine Eltern schon geschlafen haben. Als er ins Bett kriecht, spürt er Bens tastende Hand auf seinem Gesicht. »Ich bin da, mein Kleiner.«
Gleich darauf hört er Bens ruhige Atemzüge.
Auf dem Dielenboden leises Klacken von Bellas Krallen. Ein Mann, ein Junge und ein kleiner Hund. Mit den Gedanken an die Arbeit morgen schläft er ein.
Das Rattern des Traktors weckt Adam in der Frühe. Er hält direkt vor der Haustür.
Das muss Hannah sein. Hannah ist Hinnerks Tochter. Sie ist neunzehn. Ein hübsches, kräftiges Mädchen, das nie weit über die Marsch hinausgekommen ist. Sie ist eigenwillig und wissbegierig. Ihr Vater hält sie für schwer erziehbar. Seit dem Tod der Mutter versorgt sie ihren Vater und hilft Adam bei der Ernte. Hinnerk ist ihm dankbar, dass er seine Tochter beschäftigt. Hannah kennt sich aus mit Pflanzen und weiß, wie man Äpfel pflückt, ohne den Baum zu beschädigen. Allerdings ist ihm ihre Anhänglichkeit manchmal zu viel.
Leise steht er auf. Ben schläft zusammengerollt wie ein Welpe. Adam steigt in seine Hosen und läuft barfuß zur Tür.
Hannah schenkt ihm ein strahlendes Lächeln. Der Wind zerrt an ihrem weiten Blaumann und reißt ihr fast das Tuch vom Kopf. »Moin, Adam.«
»Moin, Hannah.«
Er hebt den Kopf. Weiße Sommerwolken ziehen schnell über den Himmel. »Wenn wir Glück haben, hält das Wetter.« Adam begrüßt auch die beiden Männer, die vom Traktor springen.
»Piet, Jan.«
»Moin.«
»Fangt auf der hinteren Wiese an und nehmt den Hänger aus der Scheune. Ich bin in einer halben Stunde bei euch.«
Ben wird gleich aufwachen. Adam geht in die Küche, setzt Kaffeewasser auf und nimmt Joghurt und Milch aus dem Kühlschrank. Danach schält er einen Apfel und schneidet ihn in kleine Stücke. Die Milch füllt er in einen Becher. Joghurt und Apfelstücke mischt er in einer Schüssel und gibt eine Handvoll Rosinen darüber.
»Dada!« Ben nennt ihn selten beim Namen.
Adam lächelt. Dada klingt wie eine Mischung aus Papa und Adam.
»Moin, Kleiner. Ausgeschlafen?« Er nimmt Ben auf den Arm und geht mit ihm ins Badezimmer. Die Windel ist seit ein paar Tagen trocken. Er wagt nicht, es anzusprechen, deshalb fragt er ihn: »Möchtest du eine neue Windel haben?«
»Ne!« Ben schüttelt energisch den Kopf.
»Gut.« Adam nimmt Bens winzige Latzhosen und hilft ihm beim Anziehen.
»Apfel flücken?« Ben schaut ihn fragend an. Er hat es nicht vergessen, und er hat gesprochen.
Das wird ein guter Tag, denkt Adam.
»Erst frühstücken, dann arbeiten«, sagt er.
6 Juli
Valerie bezahlt den Chauffeur und steigt aus dem Taxi. Die Front des Hauses ist erleuchtet. Sie fragt sich, ob das nötig ist und beantwortete sich die Frage gleich selbst mit einem klaren Nein. Es gibt ein Wort dafür: Lichtverschmutzung.
Die Mauern der beiden ersten Etagen sind cremefarben gestrichen und noch ohne Graffiti, die oberen drei leuchten in einem kräftigen Rot, nur unterbrochen von weißen Fensterrahmen. Es ist ein schönes altes Mietshaus. Vier kleine Balkone, schwarz umgittert, hängen an der Vorderseite. Ihr Balkon, sie hat Glück, hängt an der Seite. Von dort hat sie den Blick auf einen begrünten Platz mit hohen Bäumen, einem Kinderspielplatz und den Eingang. Sie bleibt einen Moment auf dem gepflasterten Vorplatz stehen. Nur zwei Wohnungen sind noch beleuchtet. Ihre eigene im zweiten Stock und die darunter, in der das junge, ewig streitende Paar wohnt.
Sie kramt in ihrer Tasche nach dem Haustürschlüssel, schließt auf und tastet nach dem Lichtschalter. Dann hört sie Lärm. Sie bleibt stehen und lauscht. Sekunden später wird über ihr eine Tür aufgerissen. Der junge Mann aus der Wohnung im ersten Stock rennt, ohne sie wahrzunehmen, an ihr vorbei. Langsam steigt Valerie die Stufen hinauf. Wieder bleibt sie stehen. Sie hört die Frau schluchzen. Soll sie fragen, ob sie Hilfe braucht? Valerie seufzt. Sie möchte nichts als einen ruhigen Abend, den sie nutzen will, um ihren Artikel zu schreiben. Ihr Finger legt sich ganz ohne ihren Willen auf die Klingel neben dem Schild, das verkündet, dass hier Klaus Weber und Katja Vogel wohnen. Webervogel, Valerie lächelt. Das Schluchzen im Innern der Wohnung wird leiser und verstummt. Eine belegte Frauenstimme fragt: »Wer ist da?«
»Valerie. Ich wohne im zweiten Stock. Brauchen Sie Hilfe?«
»Nein, gehen Sie!«
»Gute Nacht.« Valerie kommt sich dämlich vor. Aber sie kann verstehen, dass Katja sich in dem Zustand, in dem sie sich zweifellos gerade befindet, nicht zeigen will. Als sie ihre Wohnungstür öffnet, streicht die Katze maunzend um ihre Beine.
»Ich hab dich zu lange alleine gelassen.«
Magnus hat der Katze keinen Namen gegeben. Sie tauft sie auch nicht. Sie denkt an Frühstück bei Tiffany. In dem Film wird der Kater auch nur Kater gerufen.
Valerie öffnete eine Flasche Barolo. Sie gießt sich ein Glas ein und setzt sich an ihren Schreibtisch. Der erste samtige Schluck. Auch der Wein, wie die Katze, Magnus‹ Hinterlassenschaft. Die Katze liegt auf dem Tisch neben dem Laptop und starrt sie aus ihren schönen Augen an. Valerie denkt an den wunderbaren ersten Abend mit Magnus. Er hat sie überrascht, damals. Nicht daran denken, befiehlt sie sich. Mach deinen Artikel fertig. Sie öffnet den Computer, richtet die Seite ein und schreibt.
Wo wir fühlen, was wir fühlen.
Immer mehr Neurowissenschaftler beschäftigen sich inzwischen mit der Frage, wo sich der Sitz der Emotionen befindet, und glauben Sie mir, die Antwort ist nicht das Herz. Herz, Gefühl und Liebe haben nichts miteinander zu tun. Wenn Ihr Herz schneller klopft, wenn Sie den Liebsten sehen, heißt das nicht, dass die Liebe dort ihren Platz hat, Ihr Herz klopft auch schneller, wenn Ihnen die S-Bahn vor der Nase wegfährt oder Sie in Hundescheiße treten. Schuld an Ihren Gefühlen sind bestimmte Hirnregionen, nichts weiter …
Man könnte sogar sagen, dass die Liebe ihren Sitz in der Niere hat …
Als Folge des Verliebtseins treten alle anderen Gefühle in den Hintergrund. Die Stimmung ist gehoben, eine Vielzahl von Botenstoffen verändern ihre Konzentration in Gehirn und Körper. So erhöht das während der Verliebtheit im Nebennierenmark ausgeschüttete Adrenalin direkt den Puls. Herzklopfen …
Hier wandern ihre Gedanken doch wieder zu Magnus:
Wildtaube mit Honig und Pappardelle an