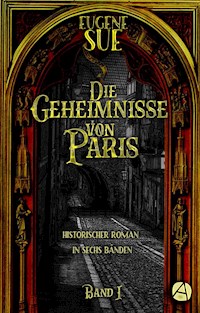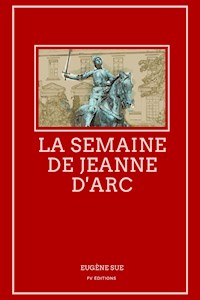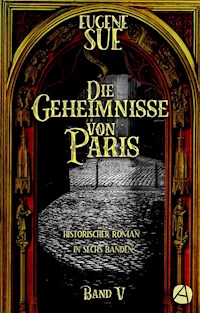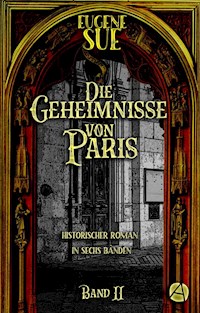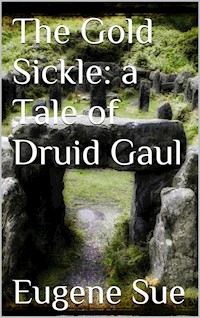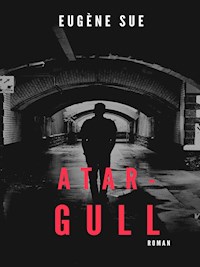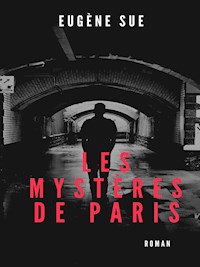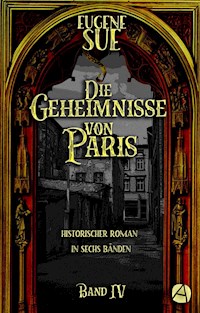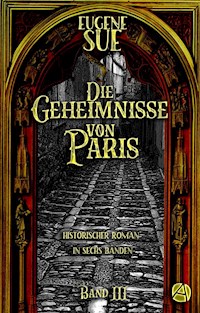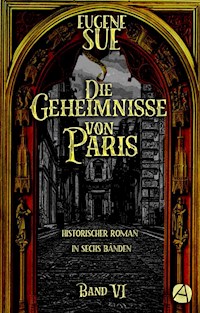1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Die Geheimnisse von Paris" entführt der französische Schriftsteller Eugène Sue seine Leser in die pulsierende Metropole des 19. Jahrhunderts, wo sich soziale Spannungen, Geheimnisse und Intrigen entfalten. Durch einen fesselnden Erzählstil, der melodramatische Elemente mit einer scharfen sozialen Analyse verbindet, beleuchtet Sue die Abgründe der Pariser Gesellschaft. Die Geschichte verwebt das Schicksal einzelner Charaktere, deren Lebenswege sich vor dem Hintergrund der politischen Unruhen und sozialen Ungleichheiten der damaligen Zeit kreuzen. Der Roman bietet nicht nur spannende Unterhaltung, sondern auch eine kritische Reflexion über Klassenunterschiede und Moral. Eugène Sue, geboren 1804 in Paris, war ein bedeutender Vertreter des Serienromans im 19. Jahrhundert. Seine Erfahrungen als Arzt und seine politischen Aktivitäten prägten sein literarisches Schaffen maßgeblich. Sue gilt als einer der Vorreiter des Realismus, und durch seine Werke wollte er soziale Missstände aufzeigen und zur Verbesserung der Lebensumstände der Unterprivilegierten anregen. Sein Engagement für soziale Gerechtigkeit und die Darstellung des einfachen Volkes sind zentrale Aspekte seiner Schriftstellerei. "Die Geheimnisse von Paris" ist nicht nur ein packender historischer Roman, sondern auch ein bedeutendes Zeitzeugnis, das aktuelle Fragen der sozialen Gerechtigkeit anspricht. Der Leser wird in eine faszinierende Welt eintauchen, die sowohl unterhält als auch zum Nachdenken anregt. Dieses Buch ist ein unabdingbarer Bestandteil jeder Sammlung von französischer Literatur und ein Muss für alle, die sich für die komplexen Wechselwirkungen von Gesellschaft und Individuum interessieren. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Geheimnisse von Paris (Historischer Roman)
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Zwischen glitzernden Boulevards und finsteren Hinterhöfen entfaltet sich der beharrliche Widerstreit von öffentlichem Glanz und verborgenem Elend, in dem Masken fallen, Zufälle wie Weggabelungen wirken, und die Frage, ob Gerechtigkeit in einer von Klassenschranken, Begierden und Not zerrissenen Metropole überhaupt möglich ist, sich in Gesichtern, Gassen und Stimmen spiegelt, während die Stadt zugleich Bühne, Schicksalsmaschine und Komplize ist und einzelne Gesten der Barmherzigkeit ebenso weit reichen müssen wie Intrigen, die aus den Schatten der Großstadt mit kalter Konsequenz in das Licht der Salons greifen.
Die Geheimnisse von Paris, verfasst von Eugène Sue, zählt zu den prägenden sozialkritischen Großstadtromanen des 19. Jahrhunderts. Das Werk spielt im Paris der 1840er Jahre und erschien 1842–1843 erstmals als Fortsetzungsroman in einer Zeitung; es machte die dramaturgische Kraft des Feuilletons einer breiten Leserschaft zugänglich. Statt eines historischen Rückblicks im engeren Sinn bietet der Text eine Gegenwartsnahaufnahme seiner Zeit, deren Schauplätze heute historisch wirken. Die Erzählung bewegt sich zwischen Armenquartieren und prunkvollen Salons, zwischen Gassen, Märkten und Höfen. Sie stand am Beginn einer Mode der Stadtgeheimnis-Romane, die europaweit Nachhall fand.
Zu Beginn tritt eine rätselhafte Figur in die Armenviertel, ein behutsamer Beobachter und entschlossener Helfer, der den Nächten lauscht und den Gesichtern vertraut, ohne sich sogleich zu erkennen zu geben. Aus einer zufälligen Begegnung mit einer gefährdeten jungen Frau entwickelt sich ein Netz von Wegen, das Schicksale zusammenführt, Grenzen überschreiten lässt und die Stadt wie ein Labyrinth aus Stimmen und Spuren erfahrbar macht. Die Ausgangssituation bleibt bewusst konzentriert: Hilfe im Verborgenen, Gefahr im Offenen, und dazwischen moralische Bewährungsproben, deren Ausgang ungewiss bleibt und deren Beweggründe erst allmählich ans Licht treten.
Das Leseerlebnis ist geprägt von erzählerischem Atem, der Spannung mit sozialer Beobachtung verbindet. Sues Stimme ist zugleich mitfühlend und anklagend, getragen von einer allwissenden Erzählinstanz, die plastische Szenen entwirft, Figuren moralisch befragt und doch ihre Würde ernst nimmt. Der Ton oszilliert zwischen melodramatischer Zuspitzung, feuilletonistischer Lebendigkeit und nachdenklicher Ruhe. Der Stil setzt auf klare Kontraste, überraschende Übergänge und episodische Verdichtungen, die aus der seriellen Veröffentlichung resultieren. Kapitel enden oft an Neuralgien, die zum Weiterlesen drängen, während detailreiche Milieuschilderungen die Wahrnehmung für Gesten, Räume und Rituale schärfen.
Thematisch spannt der Roman einen Bogen von Armut, Ausbeutung und Kriminalität zu Fragen nach Verantwortung, Gnade und den Grenzen des Rechts. Er untersucht die Mechanismen einer Stadt, die anonym macht und zugleich alles sichtbar werden lässt, und er zeigt, wie Klassenschranken Leben formen, Entscheidungen prägen und Schicksale verkeilen. Die Spannung zwischen individueller Schuld und gesellschaftlicher Verstrickung wird ebenso ausgelotet wie die zerbrechliche Möglichkeit von Solidarität. Frauen- und Kinderfiguren, prekäre Existenzen und Außenseiter rücken in den Fokus, nicht als Folie für Sensation, sondern als Maßstab dafür, wie eine Gemeinschaft über sich selbst Rechenschaft ablegt.
Für heutige Leserinnen und Leser bleibt das Buch relevant, weil es Fragen stellt, die in modernen Metropolen fortbestehen: Wie viel Unsichtbarkeit produziert Wohlstand? Welche Verantwortung tragen Öffentlichkeit, Presse und Politik für die Lebenslagen an den Rändern? Wie lässt sich Hilfe leisten, ohne herablassend zu werden? Die serielle Erzählweise erinnert an gegenwärtige Formen des episodischen Erzählens, während die sozialen Beobachtungen eine überraschende Zeitgenossenschaft entfalten. Zugleich sensibilisiert der Text für Sprache und Bilder seiner Epoche: Manches Pathos und manche Zuspitzung markieren den historischen Abstand und eröffnen Räume für reflektierte Lektüre.
Die Geheimnisse von Paris zu lesen heißt, in ein vielstimmiges Stadtpanorama einzutreten, das Emotion, Erkenntnis und Spannung miteinander verknüpft. Der Roman bietet die sinnliche Dichte einer Reportage, die moralische Hartnäckigkeit einer Stellungnahme und den Sog einer Abenteuergeschichte. Er lädt dazu ein, die eigene Wahrnehmung von Stadt, Klasse und Handlungsmacht zu prüfen und die Grenzen des Sichtbaren neu zu verhandeln. Wer sich auf dieses Geflecht aus Wegen, Gesten und Blicken einlässt, findet einen Text, der Vergnügen und Verantwortung ins Gleichgewicht bringt und dessen Fragen weit über seine Entstehungszeit hinausreichen.
Synopsis
Der Roman Die Geheimnisse von Paris von Eugène Sue erschien 1842–1843 zunächst als Fortsetzungsserie in einer Zeitung und entfaltet ein breit angelegtes Panorama der französischen Hauptstadt. Im Mittelpunkt steht ein inkognito agierender Aristokrat namens Rodolphe, der die Elendsviertel aufsucht, um Unrecht aufzudecken und bedrängten Menschen beizustehen. Statt einer bloßen Kriminalhandlung organisiert der Text ein Geflecht aus Episoden, in denen Arm und Reich, Gaunerwelt und Salongesellschaft einander spiegeln. Gleich zu Beginn verankert Sue die soziale Frage als Leitmotiv: Armut, Ausbeutung und moralische Verrohung erscheinen nicht als Einzelvergehen, sondern als Folgen eines umfassenden städtischen Gefüges.
Die Handlung setzt in den Vorstädten ein, wo Rodolphe in einem verrufenen Wirtshaus eine junge Frau vor Übergriffen bewahrt. Sie nennt sich Fleur-de-Marie und steht exemplarisch für jene, die zwischen Abhängigkeit, Gewalt und dem Versprechen eines besseren Lebens zerrieben werden. Aus der spontanen Rettung erwächst für Rodolphe eine Aufgabe: Er will die Mechanismen verstehen, die Menschen in die Kriminalität treiben, und ihnen Auswege eröffnen. Begegnungen mit Kleinkriminellen, Mittellosen und gedemütigten Arbeiterinnen liefern ihm Einblicke in Netzwerke von Hehlern, Zuhältern und Betrügern, deren Macht vor allem daraus erwächst, dass Behörden und Wohltätigkeitsstrukturen versagen oder wegsehen.
Rodolphe agiert dabei mit Verkleidungen, Lockspitzeln und diskreten finanziellen Mitteln. Er sucht einzelne Schicksale auf, sorgt für sichere Unterkünfte, Arbeitsmöglichkeiten oder medizinische Hilfe und setzt zugleich auf die moralische Läuterung von Tätern, die er für verführte Opfer der Umstände hält. Diese Doppelstrategie – Hilfeleistung und verdeckte Ermittlung – schafft ihm Verbündete in den Armenquartieren, aber auch Feinde, die sein Eingreifen als Gefahr für ihre Einkommensquellen begreifen. Sues Erzählweise verschränkt intime Milieustudien mit spannungsreichen Konfrontationen und lässt erkennen, dass individuelle Rettung nur gelingen kann, wenn die Ursachen der Not sichtbar gemacht und öffentlich verhandelt werden.
Ein erster großer Wendepunkt ergibt sich, als Rodolphe auf organisierte Gewalt trifft, die weit über spontane Straßendelikte hinausgeht. Ein skrupelloser Anführer instrumentalisiert Kinder und Schutzlose, während eine ältere Intrigantin Opfer erpresst und denunziatorisch kontrolliert. Parallel führt die Spur aus den Hinterhöfen in bürgerliche Amtsstuben: Ein angesehener Notar, öffentlich fürsorglich, agiert im Verborgenen als Ausbeuter. Der Roman markiert damit die Durchlässigkeit zwischen Unterwelt und respektabler Gesellschaft. Rodolphe erkennt, dass die Verbrechen an der Basis von systematischem Betrug, Heuchelei und Komplizenschaften oben profitieren, und richtet seine Ermittlungen nun gleichermaßen nach unten wie nach oben.
Mit zunehmendem Umfang verlagert die Erzählung einzelne Stränge in bürgerliche Salons und aristokratische Häuser. Dort zeigen sich Abhängigkeiten, die Statusgrenzen unterlaufen: schuldengeplagte Familien, korrumpierte Vormünder, eigennützige Heiratspläne. Schrittweise treten verborgene Verwandtschaften, frühere Fehlentscheidungen und lange verdrängte Verantwortlichkeiten zutage, die Rodolphes Engagement in überraschender Weise berühren, ohne dass die genaue Auflösung vorweggenommen wird. Dadurch verschiebt sich die Fragestellung: Geht es um die moralische Besserung einzelner oder um die Korrektur ganzer Lebensläufe, die durch Herkunft, Zufall und Machtverhältnisse geprägt wurden? Die Spannung erwächst nun aus Enthüllungen, die persönliche Schicksale mit dem städtischen System verbinden.
Zentral sind die Institutionen, die Elend verwalten: Gefängnisse, Hospitäler, Armenanstalten und Polizeibehörden. In episodischen Szenen lässt Sue die Stimmen von Häftlingen, Kranken und Dienstboten hörbar werden; ihre Erzählungen bündeln sich zu einer Indizienkette über strukturelles Versagen. Der Roman konfrontiert repressive Strafen mit Versuchen sozialer Rehabilitation und prüft, ob Mitleid, Bildung und Arbeit Alternativen zu Angst und Gewalt bieten. Gleichzeitig reflektiert er die Grenzen wohlmeinender Patronage: Hilfsangebote können Abhängigkeiten stabilisieren, wenn Besitz und Autorität unangetastet bleiben. Diese Ambivalenz verschärft Rodolphes Dilemma zwischen privater Rettungstat und dem Anspruch auf gerechte, öffentliche Ordnungen.
Ohne die endgültigen Entwicklungen vorwegzunehmen, steuert der Roman auf eine Abrechnung mit persönlichen Schuldzusammenhängen und gesellschaftlichen Strukturen zu. Die Geheimnisse von Paris verbindet melodramatische Zuspitzungen mit einer politischen Agenda: die unsichtbaren Zonen der Metropole sichtbar zu machen und bürgerliche Leserinnen und Leser für Verantwortung jenseits symbolischer Wohltätigkeit zu gewinnen. Das Werk prägte den Typus der Großstadtenthüllung und wirkte über Frankreich hinaus auf Literatur und Reformdiskurse. Seine bleibende Aussage liegt in der Verknüpfung von Empathie und Systemkritik: Menschliche Anteilnahme ist notwendig, reicht aber nicht aus, wenn die Ursachen des Elends bestehen bleiben.
Historischer Kontext
Das Werk entstand und spielt im Paris der frühen 1840er Jahre unter der Monarchie Louis-Philippes (1830–1848). Prägende Institutionen waren die Präfektur der Seine, die Pariser Polizeipräfektur, die Gerichte und Gefängnisse wie La Force, Sainte-Pélagie und Bicêtre, daneben die Erzdiözese Paris, Hospitäler wie das Hôtel-Dieu sowie kommunale Wohlfahrtseinrichtungen. Die 1833 erlassene Guizot-Schulreform stärkte die Alphabetisierung und damit die Presse, deren Reichweite im Juli-Königtum stark wuchs. Urban prägt ein vor-haussmannsches Paris mit engen, gesundheitsgefährdenden Gassen. Der Präfekt Rambuteau (seit 1833) leitete erste Sanierungsmaßnahmen ein, ohne die strukturellen Missstände zu beseitigen, die den gesellschaftlichen Hintergrund des Romans bilden.
Rasches Bevölkerungswachstum und Zuwanderung in den 1830er/1840er Jahren verschärften die soziale Spaltung. In Elendsquartieren der Île de la Cité und der Faubourgs Saint-Marcel und Saint-Antoine lebten Tagelöhner, Heimarbeiterinnen und Kleingewerbe dicht gedrängt in möblierten Untermietshäusern (garnis). Die Choleraepidemie von 1832 machte mangelhafte Wasserversorgung und Hygiene sichtbar. Prostitution wurde polizeilich registriert und medizinisch überwacht; Alexandre Parent-Duchâtelet beschrieb sie 1836 als städtisches System. Kinder arbeiteten lange in Werkstätten und Fabriken, bis das Gesetz von 1841 Mindestalter und Arbeitszeiten beschränkte. Diese Realität von Prekarität, Krankheit und kontrollierter Moral bildet den sozialen Resonanzraum, den Eugène Sue literarisch aufgreift.
Die Julimonarchie entstand aus der Revolution von 1830 und blieb politisch umstritten. Republikanische und sozialistische Zirkel organisierten sich konspirativ; in Paris kam es 1832, 1834 und 1839 zu Aufstandsversuchen, die staatlich niedergeschlagen wurden. Nach dem Attentat Fieschis 1835 verschärften die Septembergesetze die Presse- und Versammlungsfreiheit, dennoch florierten große Tageszeitungen. Das parlamentarische System stützte sich auf ein Zensuswahlrecht und begünstigte Finanz- und Besitzeliten. Zwischen sozialer Unsicherheit unten und bürgerlicher Selbstsicherheit oben entstand ein Klima scharfer Klassengegensätze. Diese politischen Spannungen liefern einen Schlüssel zum Verständnis der im Roman gezeichneten Begegnungen zwischen Unterwelt, Behörden und vornehmen Kreisen.
Die Geheimnisse von Paris erschien 1842–1843 als Fortsetzungsroman im Journal des débats und nutzte das Feuilleton als Massenmedium. Steigende Lesefähigkeit, Vorlesekreise in Werkstätten und Cafés sowie der tägliche Rhythmus der Presse verstärkten die Wirkung. Cliffhanger strukturierten die Lektüre und verknüpften Unterhaltung mit aktueller Sozialdarstellung. Zeitgenossen wie Balzac und Dumas nutzten ähnliche Publikationsformen, doch Sues Stoffe erzielten außergewöhnliche Reichweite und prägten die Erwartung an den urbanen Sensationsroman. Die kommerzielle Presse profitierte, während Leserinnen und Leser eine kontinuierliche, quasi-journalistische Erkundung der Stadt erhielten – ein Kontext, der die Aufnahme des Werkes entscheidend bestimmte.
Sues Roman traf auf lebhafte Debatten über Armut und Ordnung. Saint-Simonisten und Fourieristen propagierten Reformmodelle; sozialkatholische Initiativen wie die 1833 gegründete Société de Saint-Vincent de Paul förderten organisierte Caritas. Alexis de Tocquevilles Schriften zum Pauperismus (1835) und Villermés Untersuchung der Fabrikarbeiter (1840) popularisierten empirische Sozialdiagnosen. In der Strafrechtsreform stritten Befürworter des Pennsylvania- und des Auburn-Systems; die 1839 gegründete Erziehungsanstalt Mettray verkörperte eine neue Jugendstrafpädagogik. Diese Diskurse rahmen Sues Darstellung von Elend, Wohltätigkeit und Kontrolle: Er verzahnt literarisch Beobachtungen, die zeitgleich in medizinischen, juristischen und administrativen Diskursen verhandelt wurden.
Das zeitgenössische Bild von Kriminalität wurde stark durch Presseberichte und Memoiren geprägt. Eugène-François Vidocqs Erinnerungen (1828–1829) popularisierten die Sûreté und den Typus des Detektivs mit Unterweltskenntnis. Paris verfügte über spezialisierte Polizeibüros, eine aktiv berichtende Tagespresse für faits divers und öffentlich zugängliche Schwurgerichtsverhandlungen. Verurteilte wurden in Pariser Haftanstalten oder in die Bagnes von Toulon und Brest gebracht. Die rechtliche Grundlage bildete der Code pénal von 1810. Sues Roman nutzt dieses institutionelle Umfeld, um Begegnungen zwischen Polizei, Justiz, Menschen in Armut und wohlhabenden Kreisen zu arrangieren, wodurch gesellschaftliche Hierarchien und administrative Routinen sichtbar werden.
Topografisch zeigt der Roman ein vorhaussmannsches Paris mit verwinkelten Gassen, brüchigen Mietskasernen und unzureichender Kanalisation. Präfekt Rambuteau ließ ab 1833 Brunnen, Bäume, Bürgersteige und erste sanitäre Anlagen anlegen, doch viele Viertel blieben überfüllt und krankheitsanfällig. Die öffentliche Morgue am Quai de la Cité zog Besucher an und machte Tod und Anonymität städtisch sichtbar. Debatten über Abrisse auf der Île de la Cité begannen, wurden aber erst später umgesetzt. In dieser Landschaft sucht ein verkleideter Aristokrat im Roman Kontakt zu Armen, Arbeiterinnen und Kriminellen – ein erzählerisches Verfahren, das soziale Trennlinien überschreitet.
Die Veröffentlichung erzielte einen außergewöhnlichen Publikumserfolg und steigerte die Auflage des Journal des débats deutlich. Übersetzungen und Nachahmungen folgten rasch; das europäische Genre der Großstadtgeheimnisse etablierte sich, etwa mit Paul Févals Les Mystères de Londres (1843–1844) und G. W. M. Reynolds’ The Mysteries of London (ab 1844). Geistliche und Konservative kritisierten die Sensationslust, Reformkreise verwiesen auf die anschauliche Darstellung städtischer Not. Das Buch fungiert als Kommentar zur Julimonarchie: Es bündelt zeitgenössische Diskurse über Armut, Moral und staatliche Kontrolle und trug zur öffentlichen Sensibilisierung im Vorfeld der Umbrüche von 1848 bei.
Die Geheimnisse von Paris (Historischer Roman)
Erster Teil
1. Die Kaschemme
Was ist Kaschemme[1]? In der Gauner- und Mördersprache ein Gasthaus. Natürlich eines der niedrigsten Gattung. Sein Wirt ist gemeinhin ein Sträfling, der seine Jahre »abgemacht« hat. Zuweilen steht es auch unter dem Zepter einer ehemaligen Zuchthäuslerin. Was in einer solchen Kaschemme verkehrt, ist immer nur der Auswurf der Gesellschaft: Galeerensträflinge, Verbrecher aller möglichen Art.
In der Kaschemme sucht die Polizei, sobald ein Verbrechen verübt worden ist, den Schuldigen und findet ihn auch in der Regel zwischen hier verkehrenden Gästen.
Es war im letzten Monat des Jahres 1838, am 13. Dezember. Ein kalter, regnerischer Abend. In einer dürftigen Bluse passiert ein Hüne von Mann den Pont-au-Change, zur innern Stadt hinein, um sich in dem schauerlichen Gewirr von finsteren, engen Gäßchen zwischen dem Justizpalast und der Notre-Dame-Kirche zu verlieren.
Es stürmte heftig. In dem schwärzlichen Wasser, das in der Gassenmitte entlangfloß, spiegelte sich das bleiche Licht der vom Winde geschaukelten Laternen. Der Mann hatte die Rue des Poix erreicht, die mitten im alten Paris liegt, und ging, seitdem er spürte, daß er vertrauten Grund und Boden unter den Füßen hatte, in langsamerem Tempo. Vom Justizpalaste schlug es zehn. Unter den niedrigen, gewölbten Türen, die zu Höhlen zu führen schienen, hockten Weiber, mit halblauter Stimme Stücke aus Volksliedern vor sich hin trällernd. Eins von den Weibern mußte dem Hünen von Mann bekannt sein, denn er blieb vor ihm stehen und faßte es am Arme.
»'n Abend, Schuri!« sagte das Weib ängstlich und versuchend, ein paar Schritte zurückzuweichen. – Der Blusenmann erwiderte: »Hab mich also nicht geirrt? Bist doch die Schalldirn? Nun, laß Schnabus kommen, wenn du nicht Appetit hast auf blaue Flecke und lahme Knochen.« – »Ich hab doch kein Geld,« versetzte, am ganzen Leibe zitternd, das Mädchen, das wie jedermann schreckliche Furcht vor Schuri, dem Blusenmanne, hatte. – »Ei, ei! Wie du lügen kannst!« rief der Blusenmann und versetzte dem unglücklichen Mädchen einen Fausthieb in den Unterleib, daß sie vor Schmerz laut aufschrie.
Doch gleich darauf rief er: »Warte, Kanaille! Du hast mich mit der Schere gestochen. Das will ich dir heimzahlen!« – Und wie von der Tarantel gestochen, raste er hinter ihr her in dem dunklen Flure.
»Bleib mir vom Leibe, Schuri!« rief das Mädchen resolut, »oder ich stech dir die Okulori aus. Hättest du mich nicht geschlagen, hätt ich dir nichts getan!« – »Warte, Luder! Jetzt hab ich dich ... Nun sollst du mit mir tanzen!« Und dabei packte er mit seiner großen, derben Faust ihre kleine zarte Hand.
»Die Reihe zum Tanz wird an dich kommen,« sagte da eine Mannesstimme. – »Oho! Bist du es, Rotarm? Gib Antwort, aber greif nicht so derb zu!« – »Ich bin der Rotarm nicht,« sagte die Stimme wieder. – »Mir schnuppe, wer du bist,« rief der Schuri; »aber wem gehört denn die kleine Pfote in meiner Tatze?« – »Mir nicht, aber dem andern da!« sagte die Stimme.
Die Pfote, mit einer Haut so weich und zart wie Seide, unter der sich aber Sehnen und Muskeln wie von Stahl spannten, packte den Schuri an der Gurgel. Mittlerweile war die Schalldirne an das andere Ende des Hauseingangs geflohen und rannte nun mehrere Stufen einer steilen Treppe hinauf. Dann blieb sie stehen und sagte zu ihrem unbekannten Beschützer: »Dank schön dafür, daß Ihr mit mir gehalten! Jetzt bin ich aus dem Schlamassel. Nun laß ihn los und sieh dich vor! Hasts zu tun mit dem Schuri!« – »Und ich bin Sündenkitscher, der nicht tampert,« erwiderte, ihrer Worte nicht achtend, der Unbekannte.
Dann war alles still, dann hörte man ein paar Minuten lang Ringen ... Dann rief eine rauhe Stimme – die des Banditen, der sich mit aller Gewalt von seinem Widersacher loszumachen suchte, was ihm aber nicht gelingen wollte, da dieser über eine außergewöhnliche Kraft gebot.– »Soll ich dich kapores machen?« rief der Bandit, »berappen sollst du mir für die Schalldirne und für deinen eigenen Part!« Dabei knirschte er mit den Zähnen, als wenn sie ihm brechen sollten.
»Kapores machen? Ich berappen? Ich dich?« versetzte der Unbekannte, »ja doch, mit Knochenmehl und Faustschmalz!« – »Läßt du meine Krawatte nicht los,« ächzte der Bandit, »beiß ich dir deinen Zinken ab, Hund verfluchter!« – Aber die letzten Worte klangen nur noch dumpf, denn der Kerl war schon dem Ersticken nahe. – »Na, da schaff dir nur erst längere Zähne an,« hohnneckte der andere, »denn mein Zinken ist kurz, und mit deinen Okulori wirds auch bald hapern, zumal es recht finster hier ist.« – »Dann tritt mit unter die Laterne!« – »Meinetwegen,« erwiderte der Unbekannte, »dort können wir einander begaffen.« – Mit diesen Worten zerrte er den Banditen an dem Halstuche bis zur Tür und von da bis auf die Straße hinaus, die aber auch nur matt von der Laterne erhellt wurde. Der Bandit wankte, aber bald glückte es ihm, Halt auf den Beinen zu gewinnen. Nun packte er den Unbekannten mit neuem Ungestüm, dessen schlanker Körper die unglaubliche Kraft nicht ahnen ließ, die ihm innewohnte. Wenngleich der Bandit ein wahrer Riese war, dem es an Gewandtheit im Faustkampfe nicht fehlte, so fand er hier doch seinen Meister, denn der Unbekannte bearbeitete den Kopf seines Feindes mit einem Hagel von Faustschlägen, die aber ganz abwichen von dem gewöhnlichen Komment unterm Volke, sich vielmehr des berühmten Londoner Boxers Jack Turner würdig erwiesen und den Schuri auf zweifache Weise betäubten, daß er zuletzt wie ein vom Metzger getroffener Stier auf die Erde schlug und zwischen den Zähnen murmelte: »Ich bin kaput! Hast mich richtig kaput gemacht, wie ichs mit dir wollte!«
»Läßt er ab, dann laßt auch Ihr ihm Ruh!« rief das Mädchen von der Schwelle her, auf die sie sich während des Ringkampfes der beiden Männer gewagt hatte; dann sagte sie mit maßlosem Staunen: »Aber wer seid Ihr denn? Außer dem »Meister Bakel« kann den Schuri doch keiner meistern. Aber Ihr sollt bedankt sein, Herr, denn wenn Ihr mir nicht beigesprungen wäret, hätt er mich kalt gemacht, der Rasende!«
Statt dem Mädchen Antwort zu geben, hörte der Unbekannte aufmerksam auf ihre Stimme. Einen so lieblichen, frischen Klang hatte er noch nie vernommen. Er versuchte, ihr ins Gesicht zu sehen, aber dazu war es zu finster und der Laternenschein zu matt. Ein Paar Minuten lag der Bandit da, ohne ein Glied zu rühren; dann bewegte er erst die Beine, dann die Hände; endlich gelang es ihm, sich in die Höhe zu richten ... Die Schalldirne flüchtete wieder nach dem Hausflur und zog ihren Beschützer am Arme hinter sich her ... »Vorgesehen!« flüsterte sie; »er könnte den Stiel leicht umdrehen.« – »Keine Bange, Kindchen, keine Bange!« erwiderte der Unbekannte; »falls er mit der ersten Tracht nicht genug hätte, steht ihm gern eine derbere zur Verfügung.«
Der Bandit hörte die Worte ... »Hast recht,« sagte er, »für heute Hab ich satt; aber verreden mag ichs nicht, daß wir noch einmal aneinander geraten.« – »He? Verlangts dich wirklich nach frischen Sengen?« rief der Unbekannte in drohendem Tone, »ich sollte meinen, daß ich ehrlich genug an die Arbeit gegangen wäre?« – »Na, das muß dir der Neid lassen, Kamerad,« sagte der Bandit, aber in mürrischem Tone, »hast deine Sache gut gemacht und durchaus ehrlich angefangen, aber...« – »Aber... was?« versetzte der Unbekannte, einen Schritt näher auf den Banditen zutretend. – »Aber,« sagte dieser, ich hab meinen Meister gefunden, und – ob früher oder später – du findest den deinigen auch einmal, wenn es dir auch fürs erste, seit du den Schuri untergekriegt, in unserm Alt-Paris nicht fehlen kann. Alle Dirnen werden dir zu Füßen liegen, und kein Kaschemmenvater wird riskieren, dir einen Pump zu weigern. Aber wer bist du? Du sprichst jenisch, als wärst du unter Jenischleuten aufgewachsen?« – »Na komm, trinken wir ein paar Stampferle mitsammen,« sagte der Unbekannte, »bekannt werden wir bald miteinander sein.« – »So laß ichs mir gefallen«, erwiderte der andere, »mit den Fäusten verstehst du ja zu arbeiten. Schockschwerenot, hast du mir den Schädel traktiert! Das ging wie bei, Hammer und Ambos. Ein ganz neues Manöver! Darin mußt du mir Stunde geben.« – »Ei! im Moment, sofern es dir recht ist.« – »Aber bloß nicht wieder auf meinem Schädel als Amboß. Mir funkelts ja noch jetzt vor den Augen. Sag mal, kennst du den Rotarm, aus dessen Hause du tratest?« – »Rotarm?« wiederholte der Unbekannte, durch die Frage verblüfft, »was willst du mit Rotarm? Verstehe dich nicht. Wohnt Rotarm hier?« – »Ja, solo. Hat seine Gründe dazu, von Nachbarn und guten Freunden Abstand zu nehmen,« erwiderte der Bandit mit seltsamem Lächeln. – »Um so besser für ihn,« sagte der Unbekannte, der keine Lust zur Weiterführung der Unterhaltung zu haben schien, »kenne weder einen Rot- noch einen Schwarzarm. Bin, weils regnete, bloß auf einen Moment hier unters Dach getreten. Du wolltest dem Mädel an den Kragen, und dafür habe ich dich verhauen, das ist die ganze Geschichte.« »Na, was du nicht sagen willst, laß sein. Ich schere mich nicht um deine Geheimnisse. Wer mit Rotarm zu tun haben will, stellt sich nicht auf den Markt und posaunts aus. Also reden wir nicht weiter davon!« – Darauf wandte er sich zu dem Mädchen. »Na, du bist ja ein ganz gutes Mädel, Schalldirne, ein Wort, ein Mann! War, wenn du mich auch mit der Schere stachst, doch nett von dir, den Kerl da nicht schärfer über mich zu hetzen. Komm, trink mit uns, der Hitzkopf berappt.«
Die drei Leutchen waren nun ein Herz und eine Seele und traten in die Kaschemme. Ein Kohlenträger, auch ein Hüne von Gestalt, hatte sich, während die beiden Männer zusammen gekämpft hatten, behutsam in einen andern Hausflur begeben und abgewartet, wie die Rauferei ausgehen werde. Jetzt folgte er den drei Leutchen in die Kaschemme. Vor der Tür suchte er dem Unbekannten an die Seite zu gelangen und flüsterte ihm auf englisch und in behutsam warnendem Tone zu: »Sehen Sie sich vor, gnädiger Herr, sehen Sie sich vor!«
Mit den Achseln zuckend, trat der Unbekannte durch die Tür und verschwand hinter dem Banditen und dem Mädchen in der Gaststube.
2. Wirtin und Gäste
Die Kaschemme führte das Schild »Zum weißen Kaninchen« und stand mitten in der Rue des Poix. Sie nahm das Erdgeschoß eines hohen Hauses ein, dessen Fassade aus zwei sogenannten Fallbeilfenstern bestand. Ueber der Tür einer dunklen gewölbten Flur stand: »Hier ist Nachtquartier zu haben.« – Die Gaststube ist ein großer, niedriger Saal mit verräucherter Decke und von Qualm und Rauch geschwärzten Balken, der durch das rötliche Licht eines Ueberrestes von Wandleuchter erhellt wird. An jeder Seite der großen Stube steht ein halbes Dutzend Tische, die wie die dazu gehörigen Bänke an der Wand festgemacht sind. Im Hintergrunde führt eine Tür nach der Küche; eine andere kleinere Tür führt rechts vom Schenktische auf den Flur hinaus, über den man gehen muß, um zu den Löchern zu gelangen, in denen es für 3 Sous[2] eine Schütte Stroh statt eines Bettes gibt.
»Mutter Ponisse« heißt die Wirtin dieser Kaschemme. Ihre Geschäfte sind dreifacher Art: sie beherbergt Leute zur Nacht, unterhält einen Ausschank verbunden mit Kneipe und verleiht schmutzige Garderobe an die noch schmutzigeren Geschöpfe, die sich in diesen schmutzigen Gassen wie Schmeißfliegen umhertreiben. Sie zählt 40 Jahre, ist alt, groß, korpulent und hat einen Anflug von Bart. Ihre Stimme hat einen fast männlichen Klang, ist rauh und heiser. Ihre starken Arme und großen Hände weisen auf große Körperstärke. Von reichlichem Schnapsgenuß hat ihr Gesicht eine Kupferfarbe bekommen.
Auf dem Schenktische stehen allerhand Zinnmaße und Krüge, um die eiserne Reifen gelegt sind. Auf einem Wandbrette stehen allerhand Gläser, die allerhand Liköre enthalten: solche von grünlicher und solche von rötlicher, auch ein paar von goldgelber Farbe.
Neben der Wirtin hockt eine große, schwarze Katze mit gelben Augen, die der Hausteufel der Kaschemme zu sein scheint. Hinter dem Gehäuse einer altertümlichen Wanduhr hängt ein Zweiglein geweihten Osterbuchsbaums, dessen Anwesenheit sich nur erklären läßt, wenn man den Satz gelten läßt, daß das menschliche Gemüt ein unergründlicher Abgrund von Widersprüchen ist.
Zwei Kerle von polizeiwidrigem Aussehen, mit struppigem Barte, kaum mit Lumpen bedeckt, sitzen an einem Tische bei einem Weinkruge, trinken aber kaum einmal, sondern sind in reger, wenn auch leiser Unterhaltung begriffen. Der eine hat eine bleiche, fast bleifarbene Haut. Das Gesicht wird von einer schäbigen griechischen Mütze fast bis zu den Brauen bedeckt. Sein linke Hand hält er fast immer unter dem Tische und läßt, wenn er sich ihrer einmal bedienen muß, so wenig wie möglich davon sehen.
Ein Stück weiter vom Tische entfernt sitzt ein junger Mensch von knapp 16 Jahren mit bartlosem, ebenfalls bleichem Gesicht und mattem Blicke. Um den Hals herum hängt ihm langes, schwarzes Haar. Dieses Musterexemplar frühzeitigen Lasters raucht aus einer kurzen Tonpfeife und trinkt aus einem kleinen Kruge elenden Fusel.
Von den übrigen Gästen läßt sich weiter nichts Besonderes sagen; es sind Männer und Weiber, aber die ersten sind in der Ueberzahl. Sie sehen alle roh und tierisch aus, lärmen und schreien, reißen Zoten und sitzen, wenn sie sich ausgetobt haben, in dumpfem Schweigen beisammen.
Zu diesen Gästen gesellten sich unser Unbekannter, der Bandit und die Dirne. Jetzt können wir uns den Schuri genau ansehen: er ist, wie gesagt, ein Hüne von kolossalen Körperverhältnissen, mit aschblondem, fast weißlichem Haar, dichtverwachsenen Brauen und feuerrotem Backenbart von erstaunlicher Länge. Sonnenbrand, Elend und harte Arbeit im Bagno haben ihm die fast allen Galeerensträflingen eigentümliche Bronzefarbe gegeben. Sein Gesichtsausdruck verrät mehr brutale Verwegenheit als wilde Notzeit; wer aber seinen Hinterschädel aufmerksam betrachtet, findet dort die Kennzeichen für Mordsucht stark ausgeprägt.
In seltsamer Anomalie zeigen die Gesichtszüge der Schalldirne einen madonnenhaften Ausdruck, wie er zuweilen auch bei tiefster Verworfenheit erhalten bleibt. Die Dirne steht im 17. Jahre. Ihr Gesicht ist oval geschnitten, die großen blauen Augen werden von langen Wimpern beschattet; auf den runden roten Wangen liegt noch der erste Jugendglanz; ihr kleiner purpurroter Mund und herrliches Blondhaar, ihre feine gerade Nase und ein allerliebstes Grübchenkinn machen es erklärlich, daß die Dirne fast alle Männer dieser verbrecherischen Welt bezaubert, hat doch schon ihre Stimme allein durch ihren reinen harmonischen Klang den unbekannten Mann in Fesseln geschlagen. Sie sang vortrefflich, und dieses Talent hatte ihr in der Kaschemme den Rufnamen der Schalldirne eingetragen, der im Rotwelsch soviel wie Primadonna bedeutet. Neben ihm führte sie auch noch den Namen »Marienblümchen«, der im Rotwelsch beliebten Umschreibung für Jungfrau.
Ihr Beschützer, ein Mann von höchstens 30 Jahren, den wir mit dem Namen Rudolf benennen wollen, war von Mittelgröße. Sein schlanker, wohlproportionierter Körper verriet nicht im geringsten jene erstaunliche Kraft, die er im Kampf mit dem Banditen an den Tag gelegt hatte. Sein Gesicht war regelmäßig und schön, für einen Mann vielleicht zu schön. Sein Teint von zartem Weiß, seine halbgeschlossenen Augen, seine ungezwungene Haltung, sein sarkastisches Lächeln ließ einen blasierten Menschen vermuten, dessen Konstitution durch übermäßigen Lebensgenuß wenn auch nicht zerrüttet, so doch geschwächt ist. Und doch hatte Rudolf mit seiner schmächtigen, zierlichen Hand einen der verwegensten und stärksten Banditen von Paris bezwungen. Sein Blick verriet hin und wieder einen Hang zur Melancholie, und sein Gesicht rührendes Mitleid. Wenn aber sein Blick, was fast häufiger der Fall war, einen harten, boshaften Ausdruck annahm, dann machte auch der mitleidige Zug einem grausamen Platz, der jede gefühlvolle Regung auszuschalten schien.
In dem Kampfe mit dem Banditen hatte Rudolf keine Spur von, Zorn oder Haß gegen den ihm nicht gewachsenen Gegner gezeigt, sondern war ihm im Vertrauen auf seine Kraft, Gewandtheit und Gelenkigkeit nur mit Verachtung entgegengetreten. Im übrigen bekam Rudolf durch sein Benehmen und seine Gewandtheit, mit der er die Gaunersprache redete, eine vollständige Aehnlichkeit mit den Gästen der Wirtin. Um den schlanken Hals hatte er ein schwarzes Tuch geschlungen, dessen Enden auf den Kragen seiner verblichenen Bluse fielen. Die plumpen Schuhe, in denen seine Füße steckten, waren mit einer doppelten Reihe von Nägeln beschlagen, und außer seinen schönen Händen unterschied ihn kaum ein einziger Zug von den in der Kaschemme sitzenden Gästen.
Beim Eintritt legte der Bandit Rudolf eine seiner großen Hände auf die Achsel und sagte: »Es lebe der Mann, der den Schuri bezwungen! Jawohl, Kameraden, bezwungen! Und selbst Meister Bakel wird seinen Meister in ihm finden. Dafür stehe ich ein.«
Bei diesen Worten richteten sich aller Blicke, von der Wirtin bis zu dem geringsten Gaste hinunter, auf Rudolf, und zwar mit einem deutlich sichtbaren Zeichen von Angst und Sorge. Ein paar zogen Gläser und Krüge an den Tischrand zurück, um Rudolf Platz zu machen; andere traten zu dem Banditen, um sich mit leiser Stimme über den Unbekannten zu unterrichten, der sich auf so gloriose Weise in ihren Kreisen eingeführt hatte. Die Wirtin hatte den neuen Gast inzwischen mit ihrem holdseligsten Lächeln bewillkommt. Was noch nie im »Weißen Kaninchen« passiert war, sie war aufgestanden und hatte sich bei Rudolf erkundigt, womit sie ihm dienen könne. Einer der beiden Männer polizeiwidrigen Aussehens, von dem wir bereits sagten, daß er die linke Hand versteckt hielt, fragte die Wirtin, die für Rudolf den Tisch abwischte: »Ist Bakel noch nicht dagewesen?« – »Nein,« versetzte die Wirtin, »aber gestern ist er mit seiner neuen Gesponsin dagewesen.« – »Wer ist das?« – »Hältst du mich etwa für einen Spitzel? Soll ich gar meine Kunden verpetzen?« erwiderte die Wirtin rauh und ablehnend. – »Ich werde heute abend,« sagte der Räuber, »mit ihm zusammenkommen. Wir haben Geschäfte miteinander.« – – »Wird was Schönes sein, du Sündensohn!« – »Oho! Wovon lebt Ihr denn als von uns Sündensöhnen?«
Marienblümchen hatte dem jungen Menschen mit dem bleichen Gesicht, als sie in die Kaschemme trat, mit freundlichem Lachen zugenickt. Schuri sagte zu ihm.: »He, Barbillon, noch immer Schnaps?« – »Lieber hungern, als keinen Schnabus, und lieber in Holzschuhen laufen als ohne Tabak in der Pfeife,« versetzte der andere mit hohler Stimme, ohne sich vom Platze zu rühren, und gewaltige Rauchwolken von sich blasend.
»Guten Abend, Mutter Ponisse,« sagte die Schalldirne. – »Guten Abend, mein Blümchen,« erwiderte die Wirtin, die Kleidungsstücke musternd, die das Mädchen von ihr geliehen hatte. – »Dir was auf den Leib zu ziehen,« sagte sie, »macht einem Freude, bist du doch reinlich und sauber wie ein Kätzchen. Hab dich ja auch erst zur Dirne aufgezogen, seit du aus dem Kasten kamst. Aber man muß es dir lassen, ein besseres Mädel als dich gibts in unserm ganzen Paris nicht.«
– Das Mädchen schien auf diese Worte der alten Zuchthäuslerin nicht sonderlich stolz zu sein, denn sie ließ den Kopf tief auf die Brust sinken.
Während nun die drei bei ihrer Mahlzeit saßen, trat eine neue Person herein: ein Mann von mittlerem Alter, gewandt und kräftig, in Jacke und Mütze, der an das Leben in Kaschemmen gewöhnt zu sein schien, verlangte er doch in der Gaunersprache, die hier nur üblich war, sein Abendessen. Obgleich er kein Stammgast war, fand er bald keine Obacht mehr, denn Banditen erkennen ihresgleichen ebenso scharf wie ehrliche Leute und wissen vielleicht genauer noch als diese, was sie von jedem einzelnen der ihrigen zu halten haben. Er hatte sich so gesetzt, daß er die beiden Männer von polizeiwidrigem Aussehen, von denen der eine nach Bakel gefragt hatte, scharf ins Auge fassen konnte, ohne daß einer von ihnen es gewahr werden konnte. Bald war die auf einen Moment unterbrochene Unterhaltung wieder im Gange. Schuri zeigte trotz seiner Verwegenheit eine gewisse Unterwürfigkeit gegen Rudolf und getraute sich nicht mehr, ihn zu duzen. So wenig Respekt er vor Recht und Gesetz hatte, so viel Respekt hatte er vor Leibeskraft.
»Ein Wort, ein Mann,« sagte er zu Rudolf, »erzählen wir uns, wer wir sind, damit wir bekannt zusammen werden.« – »Mach du den Anfang,« versetzte Rudolf. – »Albino von Farbe, entlassener Bagnosträfling, Holzflösser am Kai, im Winter vor Kälte halbtot, im Sommer vor Hitze gedörrt, so ist mein Charakter,« sagte der Bandit; »wer aber sind Sie? Ich sehe Sie zum ersten Male in unserem Alt-Paris.« – »Ich bin Fächermaler und heiße Rudolf.« – »So? Fächermaler? Nun, deshalb haben Sie so weiße Hände! Scheint auch zu dem Geschäft ein gutes Teil von Leibeskraft zu gehören, vorausgesetzt daß Ihre Kameraden ebenso sind wie Sie! Warum kommen Sie aber in eine Kaschemme, wenn Sie Arbeiter sind, und zweifelsohne ehrlicher Arbeiter? Hier gibt es doch bloß Kerle aus dem Bagno, die sich anderwärts im Lande nicht sehen lassen dürfen.« – Ich komme her, weil mir an guter Gesellschaft gelegen ist.« – »Hm,« sagte der Bandit, zweifelsvoll den Kopf schüttelnd, »Sie scheinen mir nicht zu trauen und haben wohl auch nicht so unrecht. Indessen erzähle ich gern, wenns Ihnen recht ist, meine ganze Geschichte. Aber eine Bedingung stelle ich dabei: daß Sie mich über die Stöße unterrichten, mit denen Sie mich traktiert haben.« – »Warum nicht? Wenn Ihr weiter nichts wollt? Erzählt also, und dann mag mir das Mädchen sagen, wie es mit ihr steht.« – »Hab nichts dawider,« versetzte das Mädchen. – »Aber Sie bleiben uns dann Ihre Geschichte nicht schuldig?« fragte der Bandit. –»Nein. Kann ja gleich den Anfang machen,« sagte Rudolf. –
»Fächermaler,« sagte das Mädchen, »ein hübsches Geschäft!« – »Wieviel bringts denn ein für den Tag?« fragte Schüri. – Hier bis fünf Franks, doch nur im Sommer, weil da die Tage lang sind. Es gibt nämlich bloß Stücklohn.« – »Sie machen Wohl oft blauen Montag?« – »Ja, so lange mein Geld reicht. Sechs Sous brauche ich für Nachtquartier, vier für Tabak: macht zehn Sous; dann vier Sous für Frühstück und fünfzehn für Mittagbrot, ein paar noch für Schnaps, macht also auf den Tag etwa dreißig Sous. Wer braucht da die ganze Woche zu arbeiten? Da ists doch gescheiter, man läßt sichs die übrige Zeit Wohl sein!« – »Und Ihre Angehörigen?« fragte das Mädchen. – »Die hat die Cholera morbus weggerafft,« versetzte Rudolf. – »Was waren denn Ihre Eltern?« fragte sie weiter. – »Lumpensammler, hatten unter der Halle ihren Stand. Der Vormund verkaufte alles, was da war, und gab mir dreißig Francs als Erlös.« – »Und wer ist Ihr Brotherr?« – »Borel in der Rue des Bourdonnais. Ein Protz und ein Filz, der jeden Arbeiter bis aufs Blut quetscht. Seit meinem fünfzehnten Jahre bin ich bei ihm in der Lehre gewesen. Wohne jetzt in der Rue de la Juiverie, im vierten Stock und heiße Rudolf Durand. Da habt Ihr meine Geschichte,« – »Nun mag die Schalldirne erzählen,« sagte Schuri; »ich warte mit meinem Histörchen bis zuletzt.«
3. Was die Sängerin zu erzählen hatte
»Wir fangen von vorne an,« sagte der Schuri: »wer sind deine Eltern?« – »Die hab ich nicht gekannt,« sagte das Mädchen. – »Schnurrig, Mädel. Da sind wir von gleicher Familie!« – »Du bist auch Waise, Schuri?« – »Jawohl, von der Straße, wie du, mein Kind.« – »Und wer hat dich erzogen?« fragte Rudolf. – »Weiß ich nicht. Kann nicht weiter zurückdenken, als bis zu meinem siebenten oder achten Jahre. Da bin ich bei einem alten Weibe gewesen, das die Eule genannt wurde.« – »Oho!« rief der Bandit. – »Ja, für sie mußte ich auf dem Pont-Neuf Gerstenzucker feil halten. Brachte ich weniger als zehn Sous mit heim, bekam ich Prügel und nichts zu essen.« – »Die Frau war nicht deine Mutter? Das weißt du bestimmt?« fragte Rudolf. – »Ganz bestimmt! Hat mir das Weib doch oft genug vorgeworfen, ich hätte weder Vater noch Mutter, sondern sie hätte mich auf der Straße aufgelesen. Frühmorgens mußte ich nach Montfaucon[3] hinaus, Regenwürmer zum Angeln zu suchen, denn tagsüber trieb das Weib unter der Notre-Dame-Brücke einen Handel mit Angelruten.« – »Na, bis Montfaucon ists ein derber Weg, der dir aber recht gut bekommen zu sein scheint. Bist ja gerade gewachsen wie eine Tanne,« sagte der Bandit; »und die schmale Kost scheint dir auch ganz gut bekommen zu sein, denn sie hat dir eine Wespentaille geschaffen. Hast also keine Ursache Zu klagen!« – »Aber es hat Prügel genug gesetzt, und wenn mich das Weib schlug, bin ich immer beim ersten Schlag umgefallen. Dann hat sie mich mit Füßen getreten und geschrien, ich hätte gar keine Bouillon in den Knochen, so rund und fett wie ich sei. Anders als Balg hat sie mich gar nicht gerufen, das war mein Taufname.«
»Na, mir ists ebenso gegangen. Mich hat man nie anders als Hund gerufen! Komisch, Mädel, wie ähnlich die Dinge doch zwischen uns liegen!« – Das Mädchen, das sich vor Rudolf zu schämen schien, rückte näher zu dem Banditen heran, der sie nun fragte, was sie weiter am Tage getrieben, nachdem sie von Montfaucon zurückgekehrt sei. – »Bis gegen Abend mußte ich betteln,« sagte das Mädchen, »und sobald es mir einfiel, etwas Essen zu fordern, bekam ich allemal Prügel, und wenn mich hungerte, schickte sie mich mit einem kleinen Mäßchen voll Gerstenzucker auf den Pont-Neuf. Ob ich dort vor Kälte zitterte wie Espenlaub, das hat sie nie gekümmert.« – »Schon wieder ganz, wie es mir gegangen ist,« sagte der Schuri, »mir ists ebenso gegangen.« – »Dort mußte ich stehen bis gegen elf. Die Passanten haben mir manchmal ein paar Sous in die Hand gedrückt, weil meine Tränen sie rührten. Mit der Zeit gewöhnte ich mich an die Prügel. »Wenn ich nicht weinte, war die Alte immer außer sich, und um sie recht zu ärgern, lachte ich dann immer aus vollem Herzen, sobald sie zum Schlage ausholte. Abends habe ich, statt Gerstenzucker zu verkaufen, immer gesungen wie eine Lerche, wenngleich es mir wahrlich nicht nach Singen zumute war.« – »Glaubs dir,« sagte Rudolf. – »Einmal fielen, als ich mit Regenwürmern von Montfaucon heimging, Gassenjungen über mich her und raubten mir mein Körbchen. Was meiner wartete, wußte ich: Prügel, aber nichts zu essen! Da hat mich die Alte nicht geschlagen, sondern mich anders gemißhandelt, mir an den Schläfen die Haare ausgerissen, wo es bekanntlich am meisten schmerzt.« – »Sackerment! Das geht ins Aschgraue!« rief der Bandit, mit der Faust auf den Tisch schlagend und die Brauen finster zusammenziehend. »Ein Kind prügeln, geht schließlich noch an; aber Kinder mißhandeln, das ist wider alle Moral!«
Rudolf hatte dem Mädchen aufmerksam zugehört. Die Teilnahme, die der Bandit für das Mädchen fühlte, setzte ihn in Verwunderung.
»So gings noch ein paar Tage. Da kam ich wieder einmal heim mit nur drei Sous Einnahme. Da schrie die Alte: ich fräße alle Tage für sechs Sous, und es fiele ihr nicht ein, mich umsonst noch länger zu füttern. Es war im Winter, und ich hatte bloß eine dünne Leinwandfahne auf dem Leibe, weder Strümpfe noch ein Hemd, bloß Holzschuhe. Die Alte packte mich bei der Hand. Am meisten erschreckte es mich, daß sie nicht fluchte, sondern auf dem ganzen Wege hin bloß zwischen den Zähnen murmelte. In die Rue Mortellerie ging unser Weg nach einem alten, schmutzigen Hause, das eine Schenke hatte. Die Alte ging zu dem Wirte und trank einen halben Liter Schnaps. Das war ihr reguläres Maß. Sie legte sich deshalb auch immer betrunken zu Bette. Ich fiel vor ihr auf die Knie und bat sie flehentlich, mich nicht in schlimmeres Unglück zu bringen. Sie sah mich böse an mit ihrem einen Auge – denn sie war einäugig – und zischte mir giftig zu, sie wollte mir schon zeigen, was man mit solch fauler Kreatur machen müsse, um ihr Lust zur Arbeit zu machen. Sie zerrte mich hinter sich her und eine schmale Stiege hinauf in eine elende Bodenkammer. Dort trat sie zu einem Regale und nahm eine Zange aus einem Fache, womit sie mir – einen Zahn ausreißen wollte, um mich zu quälen und mich häßlich zu machen.« –
Die beiden Männer schrieen so ergrimmt auf, daß die anderen Gäste sich verwundert nach ihnen umdrehten... »Und hat sie dir den Zahn wirklich ausgerissen?« fragte Rudolf. – »Freilich,« sagte das Mädchen, »und hat dabei meinen Kopf zwischen ihre Knie genommen und mich festgehalten wie in einem Schraubstocke. Halb mit der Zunge, halb mit ihren Krallen von Fingern hat sie ihn ausgerissen und mir dann, um mich recht zu erschrecken, zugeschrieen, sie wolle mir nun, wenn ich weiterhin so faul bliebe, täglich einen weiteren Zahn ausreißen, und wenn ich keinen mehr im Munde hätte, mich in die Seine schmeißen, wo sich die Fische an mir laben sollten.«
Was Rudolf sympathisch berührte, war, daß aus dem Munde des Mädchens kein einziges Wort des Hasses gegen das alte Weib fiel, so Schweres sie auch von ihrer Grausamkeit erduldet hatte.
»Am andern Tage,« erzählte das Mädchen weiter, »ging ich nicht auf die Würmersuche nach Montfaucon, sondern flüchtete nach dem Pantheon, und bin den ganzen Tag gelaufen, bloß um recht weit weg von der bösen Frau zu kommen. Ich fürchtete mich zu sehr vor ihr. Die Nacht habe ich unter einem Holzhaufen auf einem Stätteplatze kampiert. Gehungert hats mich schrecklich, ich habe Holzrinde dagegen gekaut, und bin endlich darüber eingeschlafen. Als es Tag wurde und Leute kamen, bin ich tiefer hinein in den Holzstoß gekrochen, wo es ganz hübsch warm war, fast wie in einem Keller. Am andern Tage – ich wagte mich nicht hervor – habe ich wieder Birkenrinde gekaut und wollte wieder einschlafen, als ich Hundegebell vernahm. Ich wurde munter und lauschte. Das Gebell kam immer näher. Dann hörte ich eine Männerstimme. »Es muß doch jemand sich auf dem Hofe versteckt haben. Sonst würde doch mein Hund nicht bellen.« – »Sicher doch Diebe! Wer sonst?« sagte eine andere Stimme. Dann riefen beide Stimmen: »Such, such!« und da ich fürchtete, von dem Hunde gebissen zu werden, fing ich laut zu schreien an. »Höre doch,« sagte die eine Stimme wieder, »das klingt doch ganz, als wenn ein Kind schriee!«
Und nun hörte ich, wie der Hund zurückgerufen wurde. Dann sah ich Laternenschein. Ich kroch aus dem Holzstoße heraus. Ein dicker Mann mit einem Jungen stand vor mir. »Was willst du auf meinem Hofe, Spitzbübin?« fragte er mich. – Ich erzählte ihm, wie schlecht es mir gegangen; er aber rief: »Papperlapap! Ich lasse mir nichts weismachen. Du willst mich bemausen!« Dann befahl er dem Jungen, auf die Polizei zu gehen, besann sich aber und sagte, er wolle mich gleich lieber selbst hinschaffen. Dort sagte ich, daß ich weder Heimat noch Eltern hätte. Ich wurde in ein Besserungshaus gebracht, wegen Vagabondierens, und war den Richtern aus tiefstem Herzen dafür dankbar, denn im Gefängnisse bekam ich zu essen und keine Prügel, lernte auch nähen, war aber faul und sang lieber, statt zu arbeiten.«
»Weil du eben eine geborene Nachtigall bist,« erwiderte Rudolf lächelnd. – »O, Sie sind recht artig gegen mich, Herr Rudolf,« sagte das Mädchen, »und seitdem heiße ich nun die Schalldirne, statt Balg, wie mich die alte Hexe immer nannte. Mit meinem sechzehnten Jahre wurde ich aus der Besserungsanstalt entlassen. An der Tür traf ich die Wirtin mit ein paar andern alten Frauen, die früher schon in der Besserungsanstalt gewesen waren und mit den Mädchen, die mit mir dort waren, auf recht gutem Fuße standen. Sie sagte mir, sie hätte gute Arbeit für mich, wenn ich zu ihr ziehen wollte. Ich dachte aber, du kannst ja nähen, bist jung und willst auch das Leben ein bißchen genießen. In der Besserungsanstalt hatte ich doch soviel gearbeitet, daß ich beim Austritt bare 300 Francs ausgezahlt bekam, und das kam mir vor wie ein Vermögen. Aber das Geld war bald zu Ende. Ich hatte mir ein Stübchen gemietet. Ich bin eine große Blumenfreundin und hatte mir mehrere Stöckchen gekauft, brauchte auch ein besseres Kleid und einen Schal und bin ein paarmal ins Boulogner Wäldchen hinaus auf einem Esel geritten. Als ich noch etwa fünfzig Francs übrig hatte, versuchte ich es mit Näharbeit; aber überall wies man mir die Tür. Drei Tage darauf begegnete ich zufällig wieder der Wirtin und einer alten Frau. Sie hatten mich wohl, seit ich aus der Besserungsanstalt gegangen war, nicht aus den Augen gelassen, ich hatte es wahrscheinlich nur nicht bemerkt. Jetzt wußte ich nicht, wovon ich mein Leben fristen sollte, und so ging ich mit den Weibern mit. Ich bekam nun Schnaps von ihnen zu trinken, und bin so geworden, was ich jetzt bin.«
»Ich verstehe,« sagte der Bandit, »und kenne dich nun.« – »Dir scheint es gar nicht recht zu sein, daß du uns deinen Lebenslauf erzählt hast?« fragte Rudolf. – »Ich habs zum ersten Male in meinem Leben getan,« sagte die Sängerin, »und ein Rückblick in meine Vergangenheit muß mich ja trüb stimmen. Ach, wie schön mag es sein, als ehrlicher Mensch dazustehen.« – »Ehrlich? ehrlich?« rief Schuri, »dann spiele die Posse, versuchs, und du wirst sehen, wie weit du damit kommst.« – »Ehrlich?« sagte das Mädchen, »aber wie soll ich es sein können? Was ich auf dem Leibe trage, gehört meiner Wirtin. Wohnung und Essen bin ich ihr schuldig. Weg von hier kann ich nicht, sie ließe mich auf der Stelle als Diebin festnehmen. So lange ich mich nicht auslösen kann, gehöre ich ihr mit Leib und Seele.« – Ein Schauder überrieselte sie, als sie diese Worte sprach. Dann wandte sie sich zum Schuri und bat um einen Schluck zu trinken ... »Nein, keinen Wein,« sagte sie, als er ihr das Glas hinhielt, »Schnaps, Schnaps, den kann ich besser vertragen, wenigstens betäubt er schnell.«
4. Schuris Geschichte
Der vor kurzem eingetretene Gast hielt noch immer die beiden Männer mit dem polizeiwidrigen Aussehen im Auge, besonders den, der immer die linke Hand zu verstecken suchte. Beide hatten während der Erzählung der Sängerin mehrmals leise miteinander gesprochen und ängstlich nach der Tür geguckt. Der mit der griechischen Mütze sagte zu seinem Kameraden: »Bakel kommt nicht. Wenn ihn der Kamerad bloß nicht erschlagen hat!« – »Du meinst, um sich seinen Anteil mit anzueignen? Das wäre nun freilich sehr dumm für uns, denn wir hätten die Gelegenheit dann umsonst ausbaldowert.«
Der Neueingetretene saß zu weit von ihnen, um die Worte verstanden zu haben; er hatte aber wiederholt in ein Papier geguckt, das er aus seiner Mütze langte, aber gleich wieder darin versteckte. Dann stand er vom Tische auf und verschwand, ohne daß es jemand aufzufallen schien. Gerade als er hinausging, war Rudolfs Blick nach der Tür hin geglitten. Auf der Straße sah er den Kohlenträger mit seinem rußgeschwärzten Gesicht stehen und hatte Zeit genug, ihm durch eine ungeduldige Gebärde zu verstehen zu geben, daß ihm diese Aufsicht im höchsten Grade zuwider sei. Der Kohlenträger ließ sich aber hierdurch nicht beirren, sondern verhielt sich nach wie vor in der Schenke. Die Sängerin fand in dem Glase Schnaps, das sie getrunken, ihre Munterkeit nicht wieder, schien vielmehr in die finstersten Gedanken Zu versinken. Ein paarmal hatte sie, als sie Rudolfs festem Blicke begegnete, die Augen niedergeschlagen, ohne sich von dem Eindruck, den der Unbekannte auf sie machte, Rechenschaft geben zu können. Seine Gegenwart bedrückte sie sehr. Sie warf sich vor, dem Manne, der sie aus der Gewalt des Banditen befreit hatte, geringe Dankbarkeit entgegenzubringen. Es tat ihr fast leid, vor ihm die Beichte ihres Lebens abgelegt zu haben. Schuri dagegen war in der besten Laune, höchst mitteilsam und gesprächig. Vor Rudolfs manierlichem Benehmen war sein Groll, in ihm den Meister gefunden zu haben, schnell gewichen. Sein Glas austrinkend, hub er an:
»Sängerin, du hast wenigstens noch die alte Eule gehabt, wenn sie auch wert ist, daß der Teufel sie bei lebendigem Leibe holte. Bis zu der Zeit, da du als Landstreicherin eingesperrt wurdest, hast du wenigstens ein Dach überm Haupt gehabt; ich aber kann mich nicht besinnen, bis zu meinem neunzehnten Jahre, in welchem ich Soldat wurde, in einem Bette geschlafen zu haben.« – »So? Du hast gedient. Schuri?« fragte Rudolf. – »Drei Jahre,« versetzte Schuri, »davon aber später! Die Steine am Louvre, die Gipsöfen in Clichy und die Steinbrüche in Montrouge waren die Gasthäuser meiner Jugend. Mir schwebt düster vor, als hätte ich in meiner Kindheit mit einem alten Lumpensammler das Land durchpilgert und hätte mit dessen Kratzeisen manchen Hieb über den Buckel bekommen. Dann bin ich in Montfaucon bei Abdeckern gewesen und habe die Pferde mit abgestochen. Da mag ich wohl zehn bis zwölf Jahre alt gewesen sein. Es hat mir manchmal das Herz zerschnitten, wenn ich wieder so ein armes Tier in den letzten Zuckungen liegen gesehen habe. Nach vier Wochen hatte ich mich aber daran gewöhnt, und auf der Abdeckerei[4] hatte keiner so scharfe Messer wie ich. Aber was bekam ich für meine Mühe? Von einem an irgend einer Krankheit krepierten Tier einen Fetzen Fleisch, denn die abgestochenen wurden an die Garköche in der Gegend verkauft, die es ihren Gästen bald als Hirsch, bald als Rindfleisch vorsetzten, je nachdem. Aber ich war trotzdem der glücklichste Mensch, wenn ich mein Stück Pferdefleisch in Händen hielt, und flink wie ein Fuchs war ich damit bei einem Gipsofen, um es mir mit Erlaubnis der Brenner auf den Kohlen zu braten.«
»Aber wie heißt du? Welchen Namen führtest du damals?« fragte Rudolf. – »Ich war damals fast weißer als jetzt, und die Augen waren mir mit Blut unterlaufen. Darum wurde ich immer nur Albino genannt.« – »Aber deine Eltern?« – »Die haben ebenda gewohnt, wo die Eltern unserer Sängerin. Und wo ich geboren bin? An der erstbesten Straßenecke, rechts ober links.« – »Und wie lange warst du in der Abdeckerei?« fragte Rudolf. – »Kanns nicht einmal sagen! Ich hatte mich zuletzt so in die Wut hineingearbeitet, daß ich, wenn ich einmal beim Abstechen war, wie toll drauflos stach und alle Häute verdarb. Das bekam der Meister satt und jagte mich schließlich weg. Nun suchte ich mir Arbeit bei Metzgern, denn für dies Gewerbe hatte ich immer eine gewisse Vorliebe. Aber da kam ich schön an! Diese hochnäsige Sippe verachtete mich ganz ebenso, wie ein Schuhmacher einen Flickschuster. Da habe ich Arbeit in den Montrouger Steinbrüchen gesucht, aber ich habe es bloß zwei Jahre ausgehalten. Dann bin ich zum Militär gegangen und habe einen prächtigen Grenadier abgegeben. Leider gab es damals keinen Krieg, sonst wäre ich vielleicht was Besseres geworden. In die vermaledeite Friedensdisziplin habe ich mich aber nicht finden können, und als mich eines Tages der Sergeant derb herannahm, kam es zwischen uns zur Rauferei, und da packte mich die alte Lust am Messerstechen, die mir noch von der Abdeckerei in den Gliedern steckte, ich stach den Sergeanten nieder und verwundete zwei Soldaten auf den Tod.«
Der Mörder ließ den Kopf sinken und verhielt sich eine Weile schweigend.
»Ich wurde überwältigt, eingesteckt und sollte füsiliert werden, wurde aber zu Zuchthaus begnadigt, weil ich einmal zwei Kameraden aus der Marne gefischt hatte, wo sie ohne mich elendiglich ertrunken wären. Als ich von der Begnadigung hörte, war ich so fuchswild, daß ich meinen Verteidiger fast an der Kehle gepackt hätte. Im Zuchthause zu vegetieren, war mir schrecklicher als ein schneller Tod. Drum habe ich es auch zweimal probiert, selbst Hand an mich zu legen, einmal durch Grünspan, das andere Mal wollte ich mich mit meiner Kette erdrosseln, aber ich bin nun einmal stark wie ein Ochse und zäh wie Sohlenleder. Vom Grünspan bekam ich einen Heidendurst und von der Kette bloß ein blaues Naturhalsband. Dann schwand der Selbstmordrappel; die Lust am Leben erwachte wieder, und ich fügte mich ins Bagnoleben wie andere auch. Dort hab ich unsern Meister Bakel kennen gelernt, der mich einmal ebenso verprügelt hat, wie Sie vorhin.«
»So? Er ist also auch Galeerenkandidat?« fragte Rudolf. – »Ja, war auf Lebenszeit verurteilt, ist aber geflohen.« – »Und nicht verraten worden?« – »Ich werde mich doch hüten, ihn anzuzeigen, habe ich doch schon einmal, wie gesagt, seine Fäuste gekostet!« – »Und auch die Polizei ist seiner nicht habhaft geworden? Besitzt sie denn sein Signalement nicht?« – »Bakel würde selbst der Teufel nicht mehr erkennen, wenn er ihm aus der Hölle entwischt wäre! Was an ihm kenntlich, hat er schon längst von seinem Leibe ausgemerzt.« – »Was Ihr sagt!« – »Ja, zuerst hat er sich die Nase abgesäbelt, die fast eine halbe Elle lang war; dann hat er sich das Gesicht mit Vitriol verbrannt.«
»Also sich ganz unkenntlich gemacht?« – »Er ist ein halbes Jahr aus Rochefort weg, und seitdem sind ihm wohl an hundert Gendarmen und Polizisten in den Weg gelaufen, ohne daß ihn einer wiedererkannt hätte.« – »Weshalb ist er ins Bagno gesteckt worden?« – »Weil er gefälscht, gestohlen, gemordet hat. Bakel heißt er deshalb, weil er wie gestochen schreibt und ein grundgescheiter Mensch ist.«
»Ueber kurz oder lang spinnen sie ihn doch wieder ein,« meinte Rudolf. – »Ihrer zwei gehören aber wenigstens dazu, ihn dingfest zu machen, denn er trägt unter seiner Bluse immer ein paar scharfgeladene Pistolen und einen Dolch.« – »Was hast du denn getrieben, seit du wieder in Freiheit bist?« – »Ich verdiene mir auf dem Holzhofe am Sankt-Pauls-Kai, was ich zum Lebensunterhalt brauche.« –
»Warum bist du aber hier im alten Viertel? Ein Dieb bist du doch im Grunde genommen nicht.« –
»Und wo sollte ich mich sonst aufhalten? Ich bin hier unter meinesgleichen und liebe nun mal Gesellschaft. Dabei bin ich gefürchtet wie das Feuer, und die Polizei kann mir nicht an den Kragen als höchstens mal wegen einer Rauferei, und darauf steht keine höhere Strafe als 24 Stunden Arrest.« – »Und bei alledem fühlst du dich doch nicht glücklich?« – »Nun, manchem gehts freilich noch schlechter als mir. Mich plagt bloß immer der Teufel, wenn meine schlimmen Träume von dem Sergeanten und den Soldaten kommen, die ich habe ins Gras beißen lassen. Wäre das nicht, könnte ich ruhig sterben wie jeder andere fromme Mensch, sei es im Krankenhause, sei es an irgend einer Straßenecke. Gern denke ich freilich nicht an den Tod,« und bei diesen Worten klopfte er an einer Ecke des Tisches seinen Pfeifenkopf aus.
5. Eine Verhaftung
Der Mann, der einen Augenblick hinausgegangen war, kam jetzt mit einem andern breitschultrigen Manne wieder, aus dessen Gesicht Mut und Entschlossenheit leuchteten ... »Na, Borel,« sagte er zu ihm, »das nenne ich ein feines Zusammentreffen! Nur immer herein! Trink ein Glas Wein mit!« – Schuri rückte Rudolf näher, auch die Schalldirne, dann flüsterte er, auf die beiden Eingetretenen weisend: »Vorsichtig! Es gibt was ... es ist ein Spitzel ... Augen und Ohren offen gehalten!«
Die beiden Banditen – der mit der griechischen Mütze, der schon einige Male nach Bakel gefragt hatte, und sein Kumpan – standen zusammen auf und machten ein paar Schritte zur Tür hin. Aber die beiden Polizisten stießen einen seltsamen Ruf aus und packten sie. Nun begann ein wildes Ringen. Im andern Augenblick drangen andere Polizisten in die Kaschemme, und vor der Tür blitzten Flintenläufe.
Der Kohlenträger benützte den Tumult, um auf die Schwelle zu treten und Rudolf einen Wink zu geben, indem er den rechten Zeigefinger an die Lippen führte. Rudolf winkte ihm aber ebenso schnell wie gebieterisch, sich zu entfernen, und verfolgte die weiteren Vorgänge mit aufmerksamen Blicken.
Der Mann mit der griechischen Mütze schrie und heulte vor Wut. Halb auf dem Tische liegend, schlug er so wild um sich, daß ihn drei Polizisten kaum halten konnten. Sein Genosse war wie zu Boden geschmettert. Er sah leichenblaß aus, und seine Kinnlade zitterte krampfhaft, aber er widersetzte sich nicht, sondern hielt ruhig die Hände hin, um sich die Handschellen anlegen zu lassen. Die Wirtin war an dergleichen Auftritte gewöhnt und verhielt sich ruhig hinter dem Schenktische.
»Was haben die beiden Menschen verbrochen?« fragte sie einen der Polizisten, mit dem sie bekannt war, und der als Borel angesprochen worden war. – »Gestern in der Sankt-Christoph-Straße eine alte Dame ermordet, um sie zu berauben. Die Arme hat kurz vorm Verscheiden noch ausgesagt, sie habe einen der beiden Räuber in die Hand gebissen. Wir hatten gleich Witterung, und mein Kamerad war vorhin ein paar Augenblicke allein hier, sich zu vergewissern, daß wir auf der rechten Fährte seien. Jetzt haben wir die beiden Mordgesellen.«
Den mit der griechischen Mütze mußten die Gendarmen mit Gewalt in den grünen Polizeiwagen heben, der andere, der wie Espenlaub zitterte, konnte sich auf den Füßen nicht halten. Auch er wurde von Polizisten in den Wagen geschoben.
»Mutter Ponisse,« sagte Polizist Borel, »lassen Sie sich vorm Rotarm warnen. Es ist ein boshafter Wicht, der Sie leicht bloßstellen könnte. Vor allem nehmen Sie weder ein Paket noch sonst etwas von ihm in Verwahrsam. Sie machten sich sonst der Hehlerei schuldig.« – »Keine Sorge, Herr Borel! Vorm Rotarm fürchte ich mich wie vorm Teufel. Weiß man doch nie, wohin er will und woher er kommt ... Letztmals hieß es, er käme aus Deutschland herüber.«