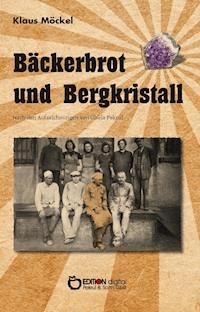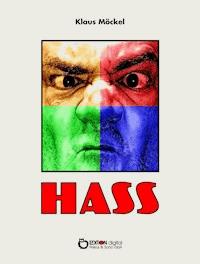7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Schriftsteller Rubin, angesehen und von sich überzeugt, erhält unter mysteriösen Umständen eine Einladung. Er soll in einem ihm unbekannten Klub aus Werken lesen, zu denen er nicht mehr steht oder die er noch gar nicht geschrieben, die er bestenfalls angedacht hat. Er sieht sich gefoppt und herausgefordert. Mit gemischten Gefühlen besteigt er den Wagen, der ihn zu einem fremden Ziel entführt. Die Reise ins Jahr 2079 bringt dem Dichter ungewöhnliche Begegnungen und bizarre Überraschungen. Er wird mit einer Zeit konfrontiert, die er sich so nicht vorgestellt hat, vor allem aber mit sich selbst und einem Urteil der Nachwelt zu seinen Werken, das ihm überhaupt nicht gefällt. Diese Konstellation "bietet dem Autor so viel Gelegenheit zu Verwicklungen und Verwirrungen", schrieb nach dem Erscheinen des Buches ein Rezensent aus Bern, "dass man aus dem Schmunzeln nicht mehr herauskommt und voller Spannung auf den Fortgang der halb realen, halb surrealen Geschehnisse wartet... Dem Ostberliner Übersetzer, Lyriker und Erzähler ist mit diesem vom Umfang her kleinen Roman ein Volltreffer gelungen..." Diesem Urteil ist nur noch hinzuzufügen, dass die amüsante Geschichte in der Zwischenzeit nicht das Geringste von ihrer Frische eingebüßt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Klaus Möckel
Die geheimnisvolle Einladung
ISBN 978-3-86394-168-0 (E-Book)
Für Aljonna
Die Druckausgabe erschien erstmals 1976 im Verlag Neues Leben Berlin unter dem Titel "Die Einladung".
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Der Autor versichert, alle Namen frei erfunden und Ähnlichkeit mit lebenden Personen nicht beabsichtigt zu haben. Sollte sich dennoch jemand getroffen fühlen, so ist er gemeint.
1. Kapitel
Sie lag vor mir auf dem Schreibtisch - ein einfach gefaltetes Stück festen weißen Kartons, von dem ein schwacher silbriger Glanz ausging. Ein Schimmer, wie ihn bestimmte mit Perlmutt eingelegte Gegenstände besitzen. Sie lag da, eine bescheidene Klappkarte, und fiel unter den anderen Papieren auf. Sieh an, so etwas Schlichtes und zugleich Elegantes bringen wir also fertig, wenn wir nur wollen, dachte ich. Ich nahm die Karte zur Hand, las das schwarz gedruckte Wort EINLADUNG vorn auf der ersten Seite und betrachtete flüchtig die Skizze, die sich unterhalb dieses Wortes befand. Es war eine Federzeichnung, ein Plan vielleicht, von dem ich nicht wusste, was er darstellte, der mir aber irgendwie bekannt vorkam. Linien, Punkte, Kreise, schraffierte Flächen mit einer eigenartig leuchtenden Tusche ausgeführt - wäre ich mit meinen Gedanken mehr bei der Sache gewesen, mir hätte schon damals etwas auffallen müssen.
Aber ich war nicht bei der Sache; ich hatte die Karte eher unbewusst in die Hand genommen; innerlich beschäftigte ich mich schon mit den Tagesarbeiten, und so bemerkte ich nichts. Ich kam auch nicht dazu, die Klappkarte aufzuschlagen und den Text zu lesen - irgendwas musste ja drinstehen -, denn ich wurde durch Maren, meine Frau, abgelenkt, die nach mir rief, weil sie zur Kosmetikerin wollte und wieder einmal ihre Wagenschlüssel nicht fand. Wenn Maren etwas suchte, war es vorbei mit der Konzentration. Ihre nichtigen, aber stets vorrangigen Probleme! Früher hatte ich das nicht gesehen, früher war ich in vielerlei Hinsicht blind gewesen, doch jetzt...
Leicht verärgert legte ich die EINLADUNG auf den Tisch zurück, verschob die Angelegenheit auf später. Dachte auch nicht mehr an sie, als das mit den Wagenschlüsseln geklärt war. Es war ein frischer, sonniger Herbstmorgen, und ich hatte es mir seit langem zur Gewohnheit gemacht, an solchen Tagen keine Zeit auf Nebensächlichkeiten zu verwenden. Auf Nebensächlichkeiten, zu denen ich vier Fünftel meiner Post zählte: Zuschriften irgendwelcher Nörgler, Zeitungskritiken, die mir der Verlag oder wohlmeinende Freunde zusandten, Invitationen. Nein, alles das konnte warten; meine Zeit war zu kostbar, um mit Kram vertan zu werden. Ich wollte gleich nach dem Frühstück ans Diktieren gehen, und wenn am Nachmittag Irene, die Schreibhilfe, kam, würde sie das zweite Band besprochen vorfinden. Denn ich war gerade in den letzten Tagen gut in Schwung gekommen und musste das Eisen hämmern, solange es glühte. Einen großen Anlauf hatte ich für dieses Bändchen, meine „II. Poetische Reise", gebraucht - Dichtung war eben nichts, was man auf Bestellung schuf -, doch nun flossen mir die Gedanken und Bilder in die Feder. Zum Glück, denn durch Presse, Funk und Fernsehen war schon einiges über das Projekt an die Öffentlichkeit gedrungen. Noblesse oblige. Mein Publikum, eine, wie ich mit einigem Stolz vermerken darf, für einen Poeten relativ große und treue Leserschar, sah dem Buch mit Ungeduld entgegen. Ihnen, meinen Anhängern, wusste ich mich verpflichtet, und es wäre ungerecht gewesen, sie wegen zweitrangiger Dinge warten zu lassen.
Aus diesen verständlichen Gründen also vergaß ich die EINLADUNG, nachdem ich sie auf den Schreibtisch zurückgelegt hatte, sofort. Mitunter verhält man sich wie ein Briefmarkensammler, der über seinen mehr oder weniger wertvollen Stücken die für das Leben oft wichtigeren Dinge außer Acht lässt. Wenigstens so lange, bis er mit der Nase darauf gestoßen wird. Soll ich es Glück nennen, dass mir in der Folge mit dieser Klappkarte nicht widerfuhr, was mir mit so mancher Einladung des Schriftstellerverbandes, des PEN-Klubs, der Akademie der Künste passierte: dass sie sich von selbst erledigte? Dass sie wegen Terminüberschneidung in den Papierkorb wanderte, oder weil ich erst wieder an sie dachte, als der angegebene Zeitpunkt längst vorüber war? Glück, schicksalhafte Fügung - ich halte nicht viel von solchen Worten. Aber vielleicht muss man in dieser ersten Phase, da ich den Text noch nicht gelesen, den Stachel, der in ihm verborgen war, noch nicht gespürt hatte, darüber sprechen. Trotz der Stöße, des Schlägehagels, der später auf mich niederprasselte und den ich bis jetzt noch nicht völlig verwunden habe. Hätte ich jedenfalls gewusst, was sich hinter dieser EINLADUNG verbarg, ich wäre keineswegs so ruhig frühstücken gegangen, als Maren endlich verschwunden war. Und ich hätte in den nächsten Tagen kaum soviel Zeit auf die „II. Poetische Reise" verwandt, ein Werk, das ich heute, nach dieser Erfahrung, trotz allen Lobs in der Presse nicht mehr für gar so wertvoll halten kann.
2. Kapitel
Aber ich will an dieser Stelle meines Berichts noch nicht von meinen früheren Büchern sprechen, sondern von der Klappkarte mit dem unaufdringlichen Silberglanz, denn sie brachte sich mir einige Tage später wieder in Erinnerung. Mein Kater Chagall war's, der über den Schreibtisch strich - erzürnt wegen irgendeines Insekts, das sich nicht erwischen ließ - und mit einem heftigen Schlag seines Schwanzes den Stapel unerledigter Korrespondenz umwarf. Die Briefe verteilten sich über die Tischplatte - ein paar wichtige Schreiben waren darunter: die Anfrage eines südamerikanischen Verlegers wegen einer Lizenz, der Vorschlag des Fernsehfunks, an einem Film über Hölderlin mitzuarbeiten -, doch mein Blick blieb ungewollt an jener EINLADUNG hängen. Sie war aus der Menge der Papiere herausgerutscht, glitt langsam über die Schreibtischkante und segelte, während Chagall mit einem eleganten Satz aufs Fensterbrett sprang, quer durchs Zimmer. An der Tür blieb sie aufgeschlagen liegen. Weshalb ich die übrigen Briefe sein ließ und erst einmal sie aufhob. Diesmal aber fand sich niemand, der mich abgelenkt hätte.
Chagall hatte sich, vielleicht wegen des Wirrwarrs, der durch ihn entstanden war, beruhigt: Er leckte sich, auf dem Fensterbrett sitzend, hingebungsvoll die Pfote. Was mich anging, so stand ich an der Tür, las erstmals den Text der Klappkarte und war im Gegensatz zu dem Kater merkwürdig erregt. Es handelte sich um einen sonderbaren Text, der mich sowohl vom äußeren Schriftbild als auch vom Inhalt her verblüffte. Eine ähnliche EINLADUNG hatte ich noch nie bekommen. Ich drehte die Karte in den Händen hin und her, ich schaute mir den Text ein zweites Mal an, ich versuchte, die Zeilen für einen Scherz zu nehmen. Für einen Scherz in mehrfacher Hinsicht. Aber obwohl ich mich bemühte, die Sache leichthin abzutun, war ein Gefühl der Unruhe in mir, das ich nicht einfach beiseite schieben konnte. Ich war erregt und gereizt. Schon bei diesem ersten indirekten Kontakt mit den Leuten, die mir das da geschickt hatten, fühlte ich mich irgendwie herausgefordert.
„Wir bitten sie sehr herzlich, geehrter herr behrend", las ich also rechts innen, schwarz auf weißlich glänzendem Untergrund, „uns am 4. Oktober des laufenden jahres aus ihren bekannten werken 'beginn' und 'spätes memorial' zu lesen. Die Veranstaltung soll 20.00 uhr im klub äonid stattfinden. Wir legen besonderen wert auch auf das gespräch mit ihnen, einem Schriftsteller, der sich nach jahren des suchens und irrens so kompromißlos zur Wahrheit bekannt hat. Wir erlauben uns, ihnen einen wagen zu schicken und sie gegen 18.00 uhr von ihrem haus abzuholen." Gezeichnet war der Text mit „ev-klub äonid" und einem Schnörkel, den ich nicht entziffern konnte.
Das Schreiben war ohne Zweifel an mich gerichtet, wenn ich auch nirgendwo einen Umschlag mit einer Adresse entdecken konnte, in dem es gesteckt hatte, und wenn mir der Inhalt auch höchst konfus erschien. Der Beweis dafür, dass ich gemeint war: Ich hatte vor vielen Jahren mit einem Gedichtband „Beginn" debütiert, mein Geburtsname war Behrend, und als Titel für einen Band Erinnerungen, den ich plante, waren mir tatsächlich die Worte „Spätes Memorial" durch den Kopf gegangen. Eine Verwechslung war ausgeschlossen: Es gab keinen zweiten Autor, auf den diese Fakten zutrafen. Bei der Erwähnung des letzten Werkes freilich wurde die Sache bereits kurios. Es würde - wenn überhaupt - erst in ein paar Jahren vorliegen, und ich war mir sicher, mit niemandem bisher, nicht einmal mit meinen engsten Freunden, über diese Idee gesprochen zu haben. Oder gar über den eventuellen Titel. Konnten die Leute, die sich an mich wandten, Gedanken lesen? Und wenn, warum redeten sie mich nicht mit meinem Schriftstellernamen Rubin an, den jedermann kannte? Vielleicht deshalb nicht, weil ich jenen ersten Band noch unter dem Namen Behrend veröffentlicht hatte? Aber der „Beginn", dieses schmale Büchlein, lag mehr als zwanzig Jahre zurück, und schon mein zweites Werk war unter meinem Pseudonym erschienen, das mir übrigens auch Erfolg gebracht hatte. Jedermann oder wenigstens jedermann, der sich mit meinen Büchern und meinem Leben beschäftigte, wusste, dass ich von den Gedichten aus „Beginn" nicht mehr allzu viel hielt, dass ich schon in meinem nächsten Band, der „Windharfe", andere Töne angeschlagen, eine Wende vollzogen hatte. Dass eigentlich die „Windharfe" trotz gewisser plakativer Passagen, über die ich jetzt nur noch lächeln konnte, meinen eigentlichen Anfang bedeutete. Spielten die Absender der Klappkarte auf diesen Wandel an, wenn sie mich so nachdrücklich als einen Suchenden und Irrenden bezeichneten? Warum aber wollten sie dann, dass ich ausgerechnet aus dem „Beginn" las, was ich übrigens seit einer Ewigkeit nicht getan hatte? Die Stücke dieses Puzzlespiels passten nicht zusammen, und die Angelegenheit wurde noch unklarer, wenn ich an meine letzten Bücher dachte, die doch viel wichtiger als die ersten Werke waren, hier aber gar nicht erwähnt wurden. Nein, es war kein Scherz, es war, wenn ich es mir recht überlegte, eher eine Provokation. Vielleicht war das mit der Wahrheit, die ich gefunden haben sollte, ironisch gemeint. Kein Lob, sondern geschickt verkleideter, unverschämter Tadel.
Doch wenn mich jemand an der Nase herumführen oder gar angreifen wollte, dann war noch immer unerklärlich, wie er auf das „Späte Memorial" gekommen war. Die Kleinschreibung in der EINLADUNG, das elegante Äußere der Klappkarte, der sonderbare Text, die Geschichte mit dem EV-KLUB ÄONID, von dem ich noch nie etwas gehört hatte (und die Stadt, in der ich seit vielen Jahren lebte, war wahrlich nicht groß), erstaunten, ja beunruhigten mich, aber geradezu ein Rätsel gab mir die Anspielung auf den noch nicht vorhandenen Erinnerungsband auf. Sollte ich etwa doch mit Maren gesprochen haben oder vielleicht mit Franziska kürzlich im Studio? Ich begann an Telepathie zu glauben, an Gedankenübertragung, und versuchte, mich wie ein Gefangener, der vor den Untersuchungsrichter treten muss, an jedes Gespräch der zurückliegenden Wochen zu erinnern. Aber ich brachte kein Licht in die Finsternis. Es blieb mir völlig schleierhaft, wer die Verfasser der EINLADUNG von meiner noch unausgesprochenen Absicht unterrichtet haben konnte, mich an meine Lebensaufzeichnungen zu setzen.
3. Kapitel
Bis zum vierten Oktober war noch eine ganze Woche Zeit, doch die EINLADUNG lag da, und sie beschäftigte mich mehr, als ich es wahrhaben wollte. Ihr Auftauchen machte mich gewissermaßen misstrauisch gegen mich selbst. Ich versuchte herauszubekommen, wie das Schreiben ins Haus gelangt war, denn ein Poststempel war nirgendwo zu entdecken. Aber weder meine Frau noch die Schreibhilfe noch das Mädchen, das zweimal in der Woche die Räume saubermachte, konnten sich erinnern. Im Gegenteil: Alle drei stritten sie entschieden ab, die EINLADUNG je in der Hand gehabt zu haben. „Ganz unmöglich", erklärte Maren mit kühler Bestimmtheit, „ich habe die Karte nie gesehen. Wer weiß, welcher Witzbold sie dir unterwegs zugesteckt hat. Mit der Post ist sie jedenfalls nicht gekommen." Die anderen Frauen äußerten sich zurückhaltender, aber ähnlich. Sie hatten im Übrigen kaum etwas mit der Korrespondenz zu tun, und ich sah keinen Grund, an ihren Aussagen zu zweifeln.
Ich kam mir vor wie ein Soldat, der aus dem Hinterhalt beschossen wird. Meine bescheidenen Bemühungen, herauszubekommen, wem ich - wider jede eigene Erinnerung - etwas von dem noch nicht einmal konzipierten Buch erzählt haben könnte, endeten ergebnislos. Maren, die ich vorsichtig auszuhorchen versuchte, hatte offensichtlich keine Ahnung. „Memoiren? Du mit deinen zweiundfünfzig Jahren? Du willst dir doch nicht schon jetzt einen Grabstein setzen?" Nein, sie verstellte sich nicht. Wir waren mehr als zwanzig Jahre verheiratet, und wenn wir uns auch Stück um Stück auseinander gelebt hatten, ich kannte sie, ihre Stimme und Gestik, ihre Reaktionen, zu gut, um zu vermuten, dass sie ein doppeltes Spiel trieb. Im Gegenteil. Hätte ich ihr von dem Projekt erzählt, wüsste die halbe Republik Bescheid. Sie hätte den Plan des großen Meisters sofort ausposaunt, hätte beim Verlag durchblicken lassen, welches einmalige Stück Literatur da im Entstehen war, hätte bedeutungsvolle Hinweise an die Presse und die zuständigen Kulturinstanzen gegeben. Das unter anderem war es, was mich mit ihr auseinander gebracht hatte: Ihr Drang, die Beschützerin zu spielen, die Hand über mein Werk zu halten, mich im Bewusstsein, dass ihr alle Türen offen standen, herumzureichen. Dabei hatte sich die Lage längst geändert. Rubin war als Dichter und Nachdichter anerkannt, er brauchte keine solche Hilfe mehr, musste sich im Gegenteil vor der Neugierde der Öffentlichkeit in Acht nehmen. Was zu Beginn unserer Ehe - ich gebe es zu - von einem gewissen Wert für mich gewesen war, wurde zum Ballast. Sie wusste das auch, konnte aber nicht gegen ihre Natur an. Es war stärker als sie, sie glaubte es ihrem Ruf schuldig zu sein, dem Image einer weltgewandten Frau, die von jeher alles arrangiert und durchgesetzt hatte.
Maren also konnte mit der EINLADUNG nichts zu tun haben, ein wenig anders freilich verhielt es sich bei Franziska. Ihr wäre ein solch sonderbarer Spaß vielleicht zuzutrauen gewesen. Franziska, über deren Vorhandensein meine Frau erhaben hinwegschaute, war im Rundfunkstudio unseres Ortes für Kunst und Literatur verantwortlich und wesentlich jünger als ich. Sie war ihrer Natur nach alles andere als elfenbeinglatt, aber eben die Haken und Kanten an ihr reizten mich. Ich sehe sie noch als Studentin vor mir: Sie hatte so gar nichts von der Eleganz und Würde Marens, ging meist Mini oder in zu kurzen, ausgewaschenen Jeans und Pullis, die einen Streifen Haut überm Hosenbund freigaben. Sie trug das blonde Haar kurz wie ein Junge und dicksohlige Sandalen, die gerade in Mode kamen. Sie schleppte fast immer eine mit Manuskripten und Broschüren voll gestopfte Männeraktentasche mit sich herum und setzte sich auf die erstbeste Treppenstufe, um schnell was nachzuschlagen. Beim Einfangen fliegender Blätter auf einer solchen Treppe hatte ich Bekanntschaft mit ihr geschlossen. Sie studierte Kunsterziehung. Wir diskutierten über gotische und romanische Architektur, über Glas- und Wandmalerei, über Matisse und Picasso, und ich hatte mich lange nicht so jung gefühlt wie an jenem Tag. Sie tat, als würde sie mich nicht kennen, und die Rolle der Anonymität, die ich hier spielen durfte, gefiel mir. Später setzte ich allerhand Zeit, Mühe und Geld daran, sie ins Bett zu kriegen, aber sie leistete Widerstand bis zu jenem Augenblick, den ich wohl nie vergessen werde. Ein denkwürdiges Erlebnis! Wir fuhren bei strahlendem Sonnenschein mit meinem Fiat über Land, und ich war knurriger Stimmung, weil ich bei ihr nicht vorankam. Ich überlegte sogar, ob ich die Sache nicht aufgeben sollte, was aber wiederum meine Eitelkeit verletzt hätte und absolut nicht meine Art war - ich blieb nie auf halbem Wege stehen. Wir schwiegen beide. Ich, weil ich keine Lust zum Reden hatte, sie, weil sie merkte, was los war. Sie musterte mich verstohlen von der Seite, spöttisch, wie mir schien. Und dann, plötzlich, bat sie mich anzuhalten. Ich habe noch genau die Landschaft vor Augen. Ein sandiger, leicht abschüssiger Weg, ein Wiesenhang, mit Erlenbüschen durchsetzt, ein Bach, der reichlich Wasser führte, und auf der anderen Seite, wieder ansteigend, Gemüsefelder, erneut Buschwerk, ein Streifen Wald in Hufeisenform.
Wir stiegen aus, sie nahm eine Decke vom Rücksitz. „Komm", sagte sie, „drüben an dem Abhang."
Ihre Worte waren nicht ganz klar, aber ihre Augen funkelten, und ich begriff sofort. Ich begriff, als ich einen zweiten Blick auf den Bach warf und auf die vier, fünf Frauen, die gleich dahinter zwischen Kohlrabi- oder Kohlköpfen wirtschafteten. Der Ausflug nach Leipzig, den ich ihr vorige Woche vorgeschlagen hatte, die Übernachtung in einem Interhotel, im nahe gelegenen Forsthaus, in einem Bungalow, der Freunden gehörte - auf all das war sie nicht eingegangen. Und nun diese Szenerie. Ich hatte nichts gegen freie Natur, warum auch. Aber musste es gerade eine solche Stelle sein?
„Hier gefällt es mir nicht, fahren wir weiter."
Doch sie war schon unterwegs, tat, als höre sie mich nicht. Was blieb mir anderes übrig, als ihr zu folgen. Mit gemischtem Gefühl, aber immerhin mit Gefühl. Das bei dem Wippen ihres kurzen Wildlederrockes an Stärke zunahm. Abwarten und sehen, was sie vorhatte! Sie war bereits am Bach, zog ihre Sandaletten aus und begann durch das grünliche, heftig dahingurgelnde Wasser zu waten. Es war ziemlich tief, reichte ihr stellenweise übers Knie, schwappte bisweilen noch höher. Unentschlossen blieb ich stehen, schaute auf meine beigefarbenen, modisch geweiteten Hosenbeine. „Und wie soll ich das anstellen?"
„Krempel dir die Hosen hoch wie andere Männer auch", sagte sie lauter als notwendig, so dass die Frauen, die ohnehin aufmerksam geworden waren, von ihrer Arbeit abließen und interessiert herüberblickten.
„Komm zurück, wir fahren ins Waldcafe."
Sie war drüben angelangt und kletterte bereits den Hang hinauf. Mit der Decke und den Schuhen in der Hand. Sie hatte kräftige und doch schlanke Beine. Wie vorher hielt sie es nicht für nötig, Antwort zu geben. Sie schüttelte sich vielmehr, wie mir schien, vor Lachen, als ich, mit der einen Hand die Schuhe, mit der anderen recht und schlecht die hochgewickelten Hosenbeine festhaltend, unter den spöttischen Blicken und Bemerkungen der LPG-Bäuerinnen durch das sprudelnde Wasser stolperte. Ich war wütend, fand mich lächerlich, hätte sie am liebsten vermöbelt, dennoch folgte ich ihr. Warum ich auf ihre alberne Idee einging? Weil mir ihre entschiedene Haltung sagte: Es gab nur das oder die Trennung. Vor dem Bruch aber schreckte ich zurück, Franziska war mir - heute weiß ich es - bereits unentbehrlich geworden. Ich konnte nicht auf sie verzichten. Und so ertrug ich's, dass sie sich amüsierte, während ich mein Fußbad nahm. Später, als wir nackt auf der Decke lagen und zwischen den Büschen hervor auf die Frauen schauten, die wieder ihrer Tätigkeit nachgingen, fragte ich meine Freundin, was sie getan hätte, wenn ich ihr nicht hinterher marschiert, ohne sie davongefahren wäre.
„Das hätte mir dann sehr leid getan", erwiderte sie, „sehr, sehr leid. Aber ich hätte es nicht ändern können. Da hätten wir unsere Freundschaft wohl begraben müssen."
„Und warum alles so auf die Spitze treiben, warum unbedingt dieses Schauspiel: den Bach, meine aufgekrempelten und trotzdem nassen Hosen, die Frauen, die uns beobachtet und sich über mich lustig gemacht haben?"
Sie lachte und zog mich zu sich nieder. „Weil ich dich einmal vor einem Publikum sehen wollte, das dir nicht von vornherein ergeben ist. In einer Umgebung, die nicht du ausgewählt hast. Weil ich wissen wollte, ob es einmal auch nach meinem Wunsch geht. Übrigens sahst du gar nicht so schlecht aus bei dieser Übung. Natürlicher, als bei manchen deiner Lesungen und Vorträge." Und als ich aufbegehren wollte: „Komm, lass das jetzt. Dass ich ein wenig verrückt bin, damit musst du dich schon abfinden."
Die Prise Salz, das Quäntchen Pfeffer, das ich brauchte. Der Haken und Kanten wegen liebte ich Franziska, wusste aber auch: Eine kleine Hinterhältigkeit von Zeit zu Zeit war ihr zuzutrauen. Obwohl ich zwischen uns von Anfang an alles klargestellt hatte - keine neue Abhängigkeit an Stelle der alten - verübelte sie mir doch, dass ich mich nicht scheiden ließ. „Nicht, dass du mich unbedingt heiraten sollst, bei unserem Altersunterschied würde ich mir das sowieso überlegen, aber warum musst du aufrechterhalten, was ohnehin am Zusammenfallen ist." Ich redete von gewachsenen Verpflichtungen, von Bindungen, die sich nicht so plötzlich zerreißen ließen. Sie hörte mir gar nicht erst zu, setzte aber bei der nächsten Gelegenheit von neuem an. Dennoch, was die EINLADUNG betraf, bei Franziska wäre der Spaß logischer, der Angriff zielgerichteter gewesen. Und wie erwähnt, auch mit ihr hatte ich meines Erachtens nie vom „Späten Memorial" gesprochen.
Man konnte die Angelegenheit drehen und wenden, wie man wollte, sie blieb gleich mysteriös. Ja, sie wurde noch eigenartiger, wenn man sich genau die schon genannte Skizze auf der Vorderseite der Klappkarte ansah. Ich sagte bereits, sie erinnerte mich an etwas. Franziska, mit der ich das Problem der EINLADUNG nach allen Seiten hin durchsprach, brachte mich auf den Gedanken, dass es sich um eine Karte unserer Stadt handeln könnte. Um einen großzügig gezeichneten geographischen Aufriss. „Diese Kegel im Norden und Süden", sagte sie, „das sind die Hügel; die Schlangenlinie zwischen ihnen, die Geraden und die winzigen Rechtecke stellen den Fluss, die Straßen und Häuser dar. Hier der Engelsplatz, die Kathedrale, der Bebelring und die Schillerallee. Das da könnte das Rathaus und das unser Interhotel sein. Die kleinen Kreise hier sollen bestimmt die Turmruinen am alten Wall bezeichnen." Und sie fand noch eine Reihe anderer Punkte und Symbole heraus, die genau ins Bild unserer Stadt passten.
Ihre Argumentation war einleuchtend, dennoch harmonierten einige Töne des Lieds auch hier nicht. Zunächst: Unsere eng in einem Talkessel zusammengedrängte Stadt musste sich, wenn man dieser Karte folgen wollte, zwischen den Hügeln hindurchgequetscht und eine recht große Ausdehnung genommen haben. Wenn ich in etwa den Standort meines Hauses bestimmen wollte, stellte ich verblüfft fest, dass es sich auf einer schraffierten Fläche befand, die Gott weiß was darstellen konnte. Das Haus lag aber ein wenig abgelegen am Stadtrand. Dort, wo sich Gärten und Felder dehnten, sah es auf der Karte wie nach einem riesigen Wohnkomplex aus. Und beim Betrachten weiterer Einzelheiten wurde mir die Angelegenheit immer unklarer.
Besonders auffällig und verwirrend war die Sache mit dem Pfeil. Im Zentrum der Skizze nämlich zeigte eine winzige Pfeilspitze auf ein kleines Rechteck. Was das bedeuten sollte, war wirklich nicht schwer zu erraten. Wenn dieser EINLADUNG irgendeine wenn auch noch, so verborgene Logik innewohnte, dann musste es sich hier um den Sitz jenes Klubs handeln, in dem ich die Ehre haben sollte, meine ersten unreifen Gedichte beziehungsweise meine nur sehr vage ins Auge gefassten Erinnerungen vorzulesen. Ein Gespräch zu führen, „weil ich mich so kompromisslos zur Wahrheit bekannt hatte". Unter dem Namen Behrend, der mir schon völlig fremd geworden war. Aber abgesehen davon, dass ich und niemand, mit dem ich darüber sprach, etwas von einer solchen Gesellschaft wussten, gab es an dieser Stelle auch kein rechteckiges Gebäude. Ganz im Gegenteil. Es gab einen riesigen Platz, auf dem sich ein ebenso riesiger dreieckiger Turm erhob. Seit ungefähr zehn Jahren, bestimmt für alle Ewigkeit.
Nein, es konnte sich nicht um eine Karte unserer Stadt handeln, allein das Recht- an Stelle des Dreiecks lieferte den klaren Gegenbeweis. Denn dass sich der Zeichner in diesem Punkt geirrt hatte, war wirklich undenkbar. Zuviel Wirbel hatte der Bau des dreieckigen Turms ausgelöst. Er passte - jedenfalls nach Meinung des überwiegenden Teils der Bewohner, der in- und ausländischen Touristen - überhaupt nicht in die Landschaft. Er wirkte wie eine Säule in einem Vorgarten, wie ein Meeresriff in einem Karpfenteich. Er erdrückte die kleinen jahrhundertealten Fachwerkhäuser, überragte aber auch die neuen modernen Gebäude um ein Unmäßiges. Das Interhotel, das Hochhaus des VEB Messgeräte, der erst kürzlich errichtete Wohnungskomplex am Anger wirkten neben ihm wie eine Streichholzschachtel neben einem Schirmständer. Schon von weitem, wenn man über die Autobahn auf die Stadt zurollte, sah man ihn zwischen den Hügeln hervorspießen. Plump und irgendwie nackt, trotz seiner weißglänzenden Aluminiumverkleidung, ragte er empor, ein Schiffsmast ohne Segel, der die Stadt zum Wrack machte.
Es hatte von Anfang an Proteste gegen die Errichtung dieses Turms gegeben; gleich als das Projekt der Öffentlichkeit unterbreitet worden war, hatten die Stadtverwaltung und die lokale Presse eine Menge erregter Briefe erhalten. Ein Bekannter Marens, der in der Redaktion unseres Bezirksorgans, des „Freien Tages", arbeitete, wusste von Schreiben zu berichten, in denen Ärzte, Lehrer, aber auch Arbeiter des VEB Messgeräte und der Landmaschinenfabrik verlangt hatten, von diesem Bau Abstand zu nehmen. Die Absender der Briefe hatten sich zum Teil durch die Blume, zum Teil sehr direkt geäußert. Sie hatten auf die kulturellen Traditionen des Ortes verwiesen, auf die Disproportionen, die in der Architektur entstehen würden, auf die Tatsache, dass es in anderen Städten der Republik ja auch gelungen sei, moderne, dem Sozialismus entsprechende harmonische Lösungen zu finden. „Erbaut ist so ein Monstrum schneller als abgerissen", hatte ein Ingenieur geschrieben, „in hundert Jahren wird man mit Fingern auf uns zeigen."
Doch trotz dieser Verwahrungen und Einsprüche war der Turm unablässig emporgewachsen. Das Argument der Konstrukteure: Der VEB Messgeräte brauche, um international konkurrenzfähig zu bleiben, unbedingt ein Forschungshochhaus, und die gedrängte Lage der Stadt ließe nur diese eine Möglichkeit zu. Der Zahn tut weh, doch man kommt nicht ohne ihn aus, sagten einsichtige Leute. Freilich nur bis zu dem Augenblick, da das Gebäude fertig war. Da nämlich stellte sich plötzlich heraus, dass der Messgerätebetrieb den Hochbau nun doch nicht benötigte. Die einen behaupteten, das Projekt sei von vornherein viel zu aufgeblasen gewesen, die notwendige Forschungsarbeit durchaus in den bisherigen Gebäuden durchführbar, die anderen, die Höhe des Turms bringe Schwingungen mit sich, die den exakten, auf Tausendstel Millimeter berechneten Messungen abträglich seien. Jedenfalls war die Empörung allgemein. Die Kritik, der Spott schlugen in Sarkasmus um. Doch der Turm stand. Ein Fels in einer Schlacht, die nicht einmal richtig stattgefunden hatte. Die Konstrukteure wuschen sich die Finger in Unschuld - sie hatten die optimale Lösung gesucht. Die Stadtväter, einigermaßen ratlos und bemüht, aus der Not eine Tugend zu machen, brachten die Technische Hochschule, das Pädagogische Institut, das Musikseminar „Ludwig van Beethoven", zwei komplette Oberschulen und den Kulturbund in diesem Gebäude unter. Ein Durcheinander verschiedenartigster Institutionen, die sich wohl oder übel in den neuen, für sie ziemlich ungeeigneten Unterkünften einrichten mussten.
Was mich betraf, so hatte ich mich mit dem Gedanken an das dreieckige Ungetüm nur schwer vertraut machen können, hatte mich jedoch mit Anstand ins offensichtlich Unvermeidliche gefügt. War auch, wie viele meiner Freunde, von den Geschehnissen überrollt worden. Abgelenkt durch eine Lyrikdiskussion, durch einen zähen Streit zwischen Dichtern und Germanisten um das Subjektive in der Poesie, der gerade die Gemüter erregte, hatte ich geglaubt, keine Sekunde meiner Zeit für dieses Problem erübrigen zu können. Hatte, wie ich jetzt zugeben muss, die Augen bewusst vor der Tatsache verschlossen, dass sich alles in mir gegen die scheinbare Notwendigkeit dieses Baus wehrte. Später dann, bei einem Gespräch, von dem ich zu diesem Zeitpunkt meiner Niederschrift noch nicht berichten will, wurde ich gefragt, weshalb ich geschwiegen hatte. Zumal meine Stimme ja, was nicht abzustreiten war, Gewicht besaß. Ich versuchte, mich mit meiner Einsicht ins Nötige zu rechtfertigen und damit, dass später, nach Fertigstellung des Turms, ohnehin nichts mehr zu ändern gewesen wäre. Aber meine Diskussionspartner waren da anderer Ansicht. Wenn das anscheinend Nötige so wider allen Geschmack verstößt, sagten sie, muss man sich einfach zu Wort melden. Wenn der Unsinn schließlich offenbar wird, gibt es, schon um einer Wiederholung des Vorfalls entgegenzuwirken, keine Zurückhaltung mehr.
Doch um zum Ausgangspunkt der Angelegenheit zurückzukehren - das Rechteck am falschen Platz setzte den Tupfen aufs I. Was nicht sein konnte, war nicht, und ich war mir nun endgültig sicher, dass die Skizze nichts mit einem Plan unserer Stadt gemein hatte. Und da mir niemand einen Hinweis auf den EV-KLUB ÄONID geben konnte, blieb mir nach wie vor verborgen, von wem die EINLADUNG stammte, wo und vor welchem Publikum ich am Abend des vierten Oktober lesen sollte.
4. Kapitel
Mein Haus, ein roter Backsteinbau, den ich nach meinen ersten größeren Erfolgen, nach meiner Auszeichnung mit dem Nationalpreis hatte errichten lassen, befand sich etwa eine Stunde vom Zentrum entfernt. Eine Stunde, wenn man zu Fuß ging, mit dem Wagen waren es nur wenige Minuten. Franziska, die sich in den letzten Tagen vor dem vierten Oktober fast mehr mit der EINLADUNG beschäftigte als ich, die mich einerseits damit hänselte, andererseits kein Hehl aus ihrer Neugierde machte, maß vor allem diesem Umstand Bedeutung bei. „Warum wollen sie dich bereits achtzehn Uhr von zu Hause abholen, wenn die Veranstaltung erst zwanzig Uhr beginnt?", sagte sie einmal, als wir (ich glaube, es war am Sonnabend vor dem genannten Termin) im „Wein-ABC" zu Mittag aßen. In ihrem türkisfarbenen Hosenanzug mit den verrückt breiten Aufschlägen saß sie da - das solideste an Kleidung, was sie jetzt, da sie doch einen ernsthaften Posten ausfüllte, zu bieten hatte - und starrte nachdenklich auf ihr Rinderfilet. „Warum bereits achtzehn Uhr?" Sie schien die Lösung des Problems in diesem Detail zu vermuten. Dann, während sie sich ein winziges Eckchen von dem Fleisch absäbelte und, um den blasierten Kellner zu schockieren, auffällig mit der Gabel ins Kompott langte, fügte sie hinzu: „In zwei Stunden kommt man bis Erfurt oder Dresden."
Die Zeitspanne war wirklich überraschend groß: eine Spur, die möglicherweise aus der Stadt hinausführte. Die entscheidenden Punkte rückten dadurch allerdings auch nicht besser ins Licht. „Meinetwegen bis Erfurt oder Dresden", erwiderte ich deshalb, „wir können ja auf der Landkarte alle in Frage kommenden Orte durchgehen. Nur bin ich weder Kriminalist noch gewillt, meine Zeit mit Rätselraten zu verbringen. Und der Hinweis auf das 'Späte Memorial' bleibt wohl nach wie vor rätselhaft. Wie ich es auch betrachte, ich muss irgendwo eine Andeutung gemacht haben. Die Absender der Klappkarte nutzen das aus, um mich auf den Arm zu nehmen. Wahrscheinlich passen ihnen mein Erfolg, meine ganze Richtung nicht. Jedenfalls halte ich's für sinnlos, weitere Mutmaßungen anzustellen. Warten wir die paar Tage bis zum Vierten ab. Dann wird sich erweisen, was das für ein Schwindel ist."