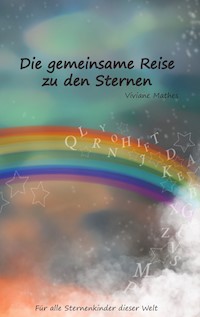
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In "Die gemeinsame Reise zu den Sternen", geht es um den Fachbereich: Lebensbegrenzende Diagnosen in der Schwangerschaft. Betroffene können in diesem Buch nachschlagen, an welche Organisationen sie sich wenden können und/ oder welche Wege ihnen offen stehen. Ebenso gibt es rechtliche Hinweise und Hilfen, nach denen sich Betroffene richten können und/ oder wenden können. deinSternenkind, HopesAngel und Handgemachtes e.V. sind nur einige der genannten Organisationen und Stiftungen, mit denen zusammengearbeitet wurde. Ebenso richtet sich dieses Buch an Ärzte, Nicht-Betroffene und Fachangestellte, denen Betroffene die Augen öffnen möchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Während andere Kinder laufen lernen, lernen unsere Kinder mit den Engeln zu fliegen.
Für meine Tochter Emilia, die ich stets in meinem Herzen trage
Inhalt
Fremdwörterverzeichnis
Die gemeinsame Reise zu den Sternen
1. Sternenkinder
2. Warum?
3. Verschiedene Diagnosestellungen und Gesetzeslage
4. Frau Tod
Triggerwarnung
5. Kastanchen
6. Zwei Tage reine Liebe
7. Ich - die Sternenoma
8. Johann rockt im Himmel weiter
9. Tagebuch für einen Stern
10. Auch ich darf vermissen!
11. Der Rhythmus des Herzens
12. Trauer um Sternenkinder
13. Hilfen für Betroffene und Angehörige
14. Als Geschwisterkinder und Trauer
15. Öffentlichkeitsarbeit eines Sternenpapas
16. Dein Sternenkind
16.1.
Patricia von
dein Sternenkind
17. Hope’s Angel
18.
Handgemachtes e.V.
19. Ein Arzt erzählt…
20. Die Sterne, die niemand wollte
21. Bestattungen von Sternenkindern
22. Vorbereitungen & Rechtliches
23. Verarbeitung der Trauer
24. Hilfe für Nicht-Betroffene
25. Regenbogenbabys
26. Anlaufstellen
27. Anhang
Danksagung
Die Reise endet nie
Quellenverzeichnis
In Gedenken an Emilia und die Sternenkinder, die bei ihr auf den Wolken sitzen und auf ihre Eltern hinabblicken.
Fremdwörterverzeichnis
Amniozentese: Bei dieser Untersuchung wird durch die Bauchdecke der Mutter eine Fruchtwasserprobe entnommen. Diese wird in einem Labor angelegt und auf Anomalien/Gendefekten/Chromosomenstörungen untersucht.
Anenzephalie: Gendefekt, bei dem die Schädeldecke nicht geschlossen und/oder nicht vorhanden ist. Schwerste Form der Fehlbildung des Neuralohrdefektes. Diagnose: nicht überlebensfähig.
Chorionzottenbiopsie: Hier wird von der Plazenta (Mutterkuchen und Versorgung des Ungeborenen) eine Probe durch die Bauchdecke genommen und auf Anomalien/ Abweichungen untersucht.
CTG: Aufzeichnung der Herztöne des Kindes in der Schwangerschaft. Geben Auskunft über die Verfassung des Kindes. Aufzeichnungen erfolgen über die Bauchdecke der werdenden Mutter.
Degum I-III: Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin, Zusatzqualifikation eines Gynäkologen. Für die Feindiagnostik muss ein Arzt mindestens die Degum Stufe II erreicht haben.
Einleitung der Schwangerschaft: Durch Gabe von wehenfördernden und/oder vorbereitenden Medikamenten, in Form von Hormonen, wird die Geburt des Kindes ausgelöst.
ET: Entbindungstermin; laut Tabelle errechneter Geburtstermin eines Babys.
Harmony-Test: Beim Harmony-Test werden speziell nach den Gendefekten: 16/18/21 gesucht. Eine andere Ausführung des Harmony-Tests kann mit Geschlechtsbestimmung gemacht werden.
Hydrops fetalis (Generalisierte Flüssigkeitsansammlung):
Eine generalisierte Flüssigkeitsansammlung im Baby. Das betroffene Baby leidet dabei an einer Bauchwassersucht. Hier sammelt sich das Wasser in der Bauchhöhle an, dies führt später zu Atembeschwerden und Atemnot. Diese Wasseransammlungen können auch in anderen Weichteilen des Körpers auftreten, zumeist in zwei Komponenten.
Eine Behandlung ist in den meisten Fällen möglich muss jedoch nicht von Erfolg geprägt sein. Die Überlebenschancen stehen je nach Stadium des Hydrops fetalis von Überleben zu Nicht-Überlebensfähig.
Kreißsaal: Räume in einem Krankenhaus, in denen Kinder auf die Welt kommen.
Nicht überlebensfähig: Gestellte Diagnose eines Arztes, bei der das Kind nicht lebensfähig ist. Schwerste Fehlbildungen führen dazu, dass der Körper die lebenswichtigen Funktionen außerhalb des Mutterleibes nicht ausführen kann.
Nackenfaltenmessung: Bei dieser Untersuchung wird die Nackenfalte des Fötus vermessen. Sollte der Wert Abweichungen von der „Norm“ ergeben, kann dieser eventuell ausschlaggebend für Gendefekte oder Chromosomenstörungen sein.
Passive Sterbehilfe: Medikamentöse Gabe von Schmerzmitteln bei Neugeborenen zur Erleichterung des Sterbeweges.
Organscreening: Das Organscreening wird innerhalb der zweiten, großen Ultraschalluntersuchung durchgeführt. (18+0-21+0) Hierbei werden gezielt die Organe des Ungeborenen angesehen und kontrolliert.
Schwangerschaftsabbruch: Beendigung einer Schwangerschaft vor der errechneten 14. SSW.
Schwangerschaftstest: Test, der mithilfe des HCG-Hormones nachweisen kann, dass eine Frau schwanger ist.
Spätabbruch: Beendigung der Schwangerschaft nach der errechneten 14. SSW.
SSW: Schwangerschaftswoche
Sternenkinder: Kinder oder Babys, die nicht mehr leben und von ihren Eltern und deren Angehörigen vermisst werden.
Stille Geburt: Eine Geburt, bei der das Kind nicht mehr lebt und nicht schreien wird, wird als sogenannte Stille Geburt bezeichnet.
Triploidie: Chromosomenstörung des Kindes. Verschiedene Varianten möglich. Diagnose: Nicht überlebensfähig.
Trisomie: Gendefekt. Formen: Trisomie 13/16/18/21. Bei diesem Gendefekt fehlen den Kindern Chromosomen. Diagnose: Nicht überlebensfähig: Trisomie 13/16. Überlebensfähig: Trisomie 18/21
Die gemeinsame Reise zu den Sternen
Eines Tages begann die Reise, in der Nacht und auch ganz leise. Ein kleiner Stern stieß sich vom Himmel ab, in seiner ganzen Pracht und auch ganz sacht.
Der lange Weg zum Ziel, vielleicht war dem Stern das doch alles zu viel? Doch die Ankunft gelang, eine neue, gemeinsame Reise begann.
Das Sternchen übte jeden Tag, Es wurde wirklich richtig stark. Als eines Tages, ach du Schreck, das kleine Sternchen sich nur noch versteckt.
Es will sich nicht zeigen, will nur noch verweilen, mag wieder hoch am Himmel stehen, und all die anderen Sternchen leuchten sehen.
So flog das Sternchen wieder in den Himmel hoch,
seine Eltern findet dort nun Trost, denn auch das Sternchen kann vermissen, das müsst ihr als Eltern alle wissen.
In Gedenken an alle Sternenkinder dieser Welt und deren Eltern, die zurückbleiben.
1. Sternenkinder
In diesem Buch dürft ihr kreuz und quer lesen.
Es wurde nicht ausschließlich nach Seitenzahlen oder Kapiteln geschrieben, sondern nach Interesse, Hilfestellungen und Erzählungen sortiert.
„Was sind Sternenkinder?“, lautet meine erste Frage an euch. Vielleicht gibt es unter den Lesern schon einige, die mit diesem „Begriff“ etwas anfangen können. Für den Rest werde ich nun für den Anfang näher darauf eingehen.
Viele von uns sind Theoretiker. Für fast alles möchten wir eine Erklärung finden und suchen teilweise so lange danach, bis wir eine gefunden haben. Doch gibt es wirklich für alles eine Erklärung?
Der Begriff Sternenkinder hat seinen Ursprung von der kindlich-religiösen Vorstellung. Früher wurden tote Babys als Missgeburten oder Fehlgeburten bezeichnet – gut, dass dies heute nicht mehr (oder nur teilweise) der Fall ist. Ich persönlich finde die Vorstellung falsch, mein Kind als solches zu bezeichnen, denn Eltern lieben ihre Kinder, auch wenn das Kind eine Behinderung hat oder „besonders“ ist.
Im Koran gibt es eine wundervolle, kleine Geschichte zum Tod eines Kindes: Wenn ein Kind stirbt, dann nimmt Gott/ Allah die Seele des Kindes mit. Dabei ist er sehr vorsichtig und es soll so sein, als würde er eine Feder mit in den Himmel nehmen. Diese schwebt dann an seinem Finger gen Himmel hinauf.
Es gibt viele dieser kindlich-religiösen Vorstellungen. Eine andere wiederum besagt: Wenn ein Kind oder ein Baby stirbt, dann löst sich die Seele in tausend kleine Schmetterlinge auf und fliegt in den Himmel.
Ich bin ein großer Fan des Buches Der kleine Prinz. In diesem sagte der kleine Prinz einmal zum Fuchs: Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen lache. Du allein wirst Sterne haben, die lachen.
Antoine de Saint-Exupéry, der Autor dieses Buches, traf damit meine eigene Vorstellung. Wir Eltern vermissen unsere Kinder sehr und suchen deshalb immer wieder, vor allem am Anfang, nach einem Ort, wo sich unser Kind nun befindet. Nun stelle ich mir immer vor, dass meine Tochter auf einem Stern lebt, es ihr gut geht und sie lacht.
Interessehalber fragte ich eine Suchmaschine des Internets nach dem Wort „Sternenkind“: Zitat: Als Sternenkind, seltener als Schmetterlingskind oder Engelskind, werden verstorbene Kinder bezeichnet, insbesondere wenn sie vor, während oder bald nach der Geburt verstorben sind. Der Begriff wurde mit der Zeit immer mehr für früh verstorbene Kinder verwendet.
Ich habe lange über diese Definition nachgedacht. Nun ja, „früh verstorbene Kinder“… Was genau bedeutet dieser Ausdruck? Die Zeitangabe hat mich tatsächlich etwas geärgert. Nicht jede Mutter oder jeder Vater eines Sternenkindes hatte die Möglichkeit, sein Kind lebend kennenzulernen. Aufgrund dessen überlegte ich mir eine eigene Definition: Sternenkinder sind Kinder oder Babys, die sich nicht mehr bei ihren Eltern befinden. Ein Kind, welches starb und die Zukunft nicht (er-)leben kann.
Viele Menschen wissen leider gar nicht, was Sternenkinder sind. Als ich einmal mit einem guten Freund sprach und diesem von meiner verstorbenen Tochter erzählte, erwähnte ich sie als Sternenkind. Er sah mich verwirrt an und fragte, wieso ich meine Tochter so bezeichnen würde. Ich erklärte ihm meine „Theorie“ und sagte: „Meine Tochter starb, doch jetzt befindet sie sich, in meiner Vorstellung, auf einem wunderschönen Stern.“
Eine Zeit lang sah er mich verwirrt und mitleidig an und sagte: „Ich weiß nicht, was ich sagen soll.“
„Gar nichts“, antwortete ich lächelnd. Immerhin hatte er ehrlich gesagt, was er meinte, das war das Wichtigste.
Zum Ende unseres Dialoges hin erwähnte er dann, eher beiläufig: „Die Vorstellung ist aber sehr schön, dass deine Tochter auf einem Stern sitzt.“
Ich denke: Viele unserer Mitmenschen können unseren Schmerz nicht verstehen, doch vielleicht ist es manchmal hilfreich zu wissen, was unsere Sternenkinder – und uns – ausmacht.
Ärzte wissen im Allgemeinen, was ein Sternenkind ist. Doch vielleicht gibt es unter den Nicht-Betroffenen, die dieses Buch lesen, einige, die mit diesem Begriff nichts anfangen können?
Wichtig ist eines: Sternenkinder sind Kinder oder Babys, die von ihren Eltern sehr geliebt werden.
Viele können gar nicht verstehen, warum Eltern und Betroffene über ein Sternenkind trauern. Da ihr nun wisst, was ein Sternenkind ist, könnt ihr ein wenig nachvollziehen, wie sich Eltern fühlen. Ein Sternenkind bringt immer Trauer und Kummer mit sich. Ein Sternenkind gehört(e) zur Familie, war für die Eltern ein Teil von ihrem Leben und wird vermisst. Wir befinden uns mitten auf der Reise zu den Sternen. Wie ihr wisst, werden wir den Tod alle einmal kennenlernen. Selten machen wir uns Gedanken darüber, oft erst dann, wenn wir etwas älter sind. Wenn wir einschlafen, verschwenden wir keinerlei Gedanken darüber, ob wir am nächsten Morgen wieder aufwachen. Die Eltern eines Sternenkindes denken oft an den Tod, denn er ist Teil von ihrem Leben und von dem ihres Kindes. Ein Sternenkind bringt immer Trauer mit sich und die Anfangszeit ist sehr schwierig für alle Eltern. Inzwischen gibt es Wege und Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. Viele Angehörige, Verwandte oder Bekannte sind der Meinung, dass man es einfach akzeptieren sollte, dass das Kind nicht mehr lebt – man kann es nicht rückgängig machen.
Dazu sage ich immer: „Ich werde niemals akzeptieren, dass meine Tochter nicht mehr lebt, doch ich musste es annehmen und es wie eine Art Türe sehen. Wenn sich eine Türe schließt, wird sich die nächste öffnen.“
Doch eines sage ich auch dazu: „Verschließt eure Augen nicht für die Trauer der Eltern. Sie haben einen Sohn, eine Tochter, ein Familienmitglied, einen Menschen, ihr Kind verloren und haben das Recht darauf, traurig zu sein und ihrem Kummer Ausdruck zu verleihen.“
Ich fordere mit diesem Buch und den Seiten und Geschichten, die hier gedruckt wurden, auf: Sprecht. Redet über unsere Kinder, die nicht mehr leben. Für uns haben sie gelebt und bleiben für immer in unseren Herzen. Wir mussten alle einen Verlust verkraften, wir haben eine geliebte Person oder sogar mehrere verloren und unser Kind/unsere Kinder sind Menschen wie du und ich.
Nehmt das wahr und fangt an, zu verstehen.
2. Warum?
„Warum?“ist eine der häufigsten Fragen auf der Welt.
So nun: „Warum schreibe ich dieses Buch und warum über das Thema Sternenkinder?“
Bevor ihr nun anfangt in diesem Buch zu blättern, müsst ihr einiges über den Inhalt des Buches wissen. Alles, was ich aufgeschrieben habe, ist wahr und ich habe kein Blatt vor den Mund genommen.
Die gemeinsame Reise zu den Sternen richtet sich nicht nur an Eltern, die ihr Kind verloren haben, sondern auch an die, die in ihrem Umfeld mit dem Thema arbeiten. Hebammen, Ärzte, Trauerbegleiter, Organisationen und Stiftungen wirkten in diesem Buch mit und engagieren sich für die Verbreitung der Geschichte der Sternenkinder.
Eines ist noch speziell: Die Seiten richten sich auch an Menschen, die sich die Hände vor das Gesicht halten und dem Thema Sternenkinder bis jetzt aus dem Weg gegangen sind. Viele Menschen der heutigen Gesellschaft übergehen dieses Thema und sind der Meinung, dass Kinder, die nicht lebend oder tot auf die Welt kommen, keine Bedeutung haben. Daran möchte ich etwas ändern!
Natürlich darf jeder in diesem Buch lesen, denn es ist nicht nur mit Hass, Schmerz und Trauer geschrieben worden. So viel Liebe floss in jede einzelne Seite. Ich möchte hiermit Augen öffnen und Hände von Gesichtern reißen.
Meiner Meinung, und auch der vieler Organisationen und fachbezogenem Personal nach, sollten viel mehr Personen an diesem Thema teilhaben. Menschen sollten der Thematik, mit der sich dieses Buch beschäftigt, nicht aus dem Weg gehen, sondern sich damit auseinandersetzen.
Auch werdende Mütter und Väter, die eine schwerwiegende Diagnose für ihr Kind bekommen, sollten die Möglichkeit haben, sich genauestens zu informieren und beraten zu lassen. Aus eigener Erfahrung kann ich nämlich sagen, dass nicht alle Ärzte den Wunsch hegen (oder sich gefühlt keine Zeit nehmen), die Eltern zu informieren oder über ihre Möglichkeiten aufzuklären. Leider verschieben wir in Deutschland immer wieder die Möglichkeiten der Informationen. Wir bekommen nur das erzählt, was man uns letztendlich erzählen soll. Über andere Dinge werden wir im Unklaren gelassen.
Vielleicht können nach diesem Buch einige von euch das Wissen darin und die Erfahrungsberichte nutzen und weitergeben.
Hinzu kommt, dass alle hier erwähnten Vereine, Organisationen und Personen eine Frage beantworten: Was kann ich, als (Nicht-)Betroffener, Angehöriger oder Freund, in solch einer Extrem-Situation machen und wie verhalte ich mich?
Viel häufiger sollte in unserer heutigen Gesellschaft über das Thema Tod von Sternenkindern gesprochen und darauf eingegangen werden.
Wenn werdenden Eltern das Kind verstirbt oder Eltern das Kind stirbt, werden Freunde und Familie in zu vielen Fällen zu Bekannten. Wenn es geschieht, dann leider meist durch Unwissenheit und Angst.
Ich bin ehrlich: Auch ich wusste früher nicht, wie ich mich verhalten soll. In meiner eigenen Familie gab es einen Todesfall. Die Frau meines Großonkels brachte eine schwerkranke Tochter auf die Welt (Trisomie 16) und diese verstarb kurz nach der Geburt.
Als ich die Mutter ein halbes Jahr später auf der Straße traf, mit ihren zwei lebenden Kindern, konnte ich nichts äußernoder mein Beileid ausdrücken. Das tat mir unglaublich leid.
Am liebsten hätte ich gesagt: Es tut mir leid, denn ich bin auch Mama. Aber ich traute mich nicht, es erschien mir unangemessen.
Inzwischen denke ich anders darüber: Hätte ich damals schon gewusst, wie sehr es schmerzt, sein Kind in den Himmel ziehen zu lassen, hätte ich gesagt: „Egal was ich nun sage, es wird immer weh tun, aber ich bin in Gedanken bei dir.“
Aus Fehlern lernt man und inzwischen führte ich ein sehr ausgiebiges Gespräch mit der Dreifach-Mama, deren eines Kind immer in ihrem Herzen wohnt.
Alle hier erwähnten Personen, Vereine und Stiftungen gaben mir ihre Erlaubnis, über sie zu schreiben. Es fühlte sich an, wie in kaltes Wasser zu springen und sich dem Thema Tod, Angst und Schmerz zu stellen.
Für mich war es das Schlimmste, zu sehen, durch wie viel Schmerz und Trauer die einzelnen Personen gehen mussten. Oft kamen Unverständnis und die Uneinsichtigkeit von Nicht-Betroffenen und Ärzten hinzu, was alles noch schlimmer machte.
Trauer ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn es um den allgemeinen Verlust geht. Bei Sternenkindern ist dies nochmal ein weit größerer Aspekt. Wir Menschen sind alle sehr unterschiedlich. In unserem Charakter, wie auch in unserer Psyche und Art.
Nathalie Himmelrich schrieb dazu in ihrem Buch (Trauernde Eltern, im Englischen: Griefing Parents): Man kann keine Anleitung für Trauer verfassen, denn jeder trauert auf seine eigene Weise.
Wir gehen im Leben alle unseren „eigenen“ Weg, doch nun können Menschen, die dieses Buch lesen, einige von uns begleiten. Ihr könnt euch ein Bild über Trauer und ihre verschiedenen Wege machen. Ebenso werden in diesem Buch verschiedene Stiftungen und Vereine vorgestellt, die sich speziell mit dem Verlust von Kindern beschäftigen und von denen auch ich einiges lernen durfte.
Die Hektik ist eine grenzenlose Straße, auf der viel zu oft überholt wird.
-Viviane Mathes
Es gibt nicht nur Hilfen für Paare und Betroffene, sondern auch für Personen, die kein Sternenkind haben, aber zum Umfeld der Betroffenen gehören. Hier kommt eine entscheidende Frage auf: „Was macht Trauer mit den Eltern? Und warum empfinden diese so?“
Auch, wenn das jetzt radikal klingt: Jedem kann der Tod eines Kindes passieren.
Hier werde ich auch die Geschichte von mir und meiner Tochter erzählen. Denn nun kommen wir zu der Antwort auf die Frage ganz zu Anfang: Warum?
Durch meine Tochter entstand dieses Buch. Sie war der ausschlaggebende Punkt, dass ich wieder anfing zu schreiben. Durch ihren bevorstehenden Tod packte mich so eine Wut, über Unverständnis in der Familie bis hin zu Kontaktabbrüchen, dass ich aufklären wollte, was es bedeutet, sein Kind zu verlieren.
Verwandte sollen verstehen, was Angehörigen helfen kann und was nicht. Mediziner und Hebammen müssen verstehen, was Betroffenen in diesen Situationen helfen kann und Betroffene müssen wissen, wo sie Hilfe finden. Vor allem möchte ich mich noch einmal kurz an die Mediziner unter euch wenden:
Wir Mütter und Väter lieben unsere Kinder, egal, ob behindert, tot oder ungeboren und zum Tode verurteilt und wir wünschen uns Sensibilität von euch. Wir, die Betroffenen, möchten niemanden verurteilen, weil er oder sie eine bestimmte Entscheidung getroffen hat oder ein Arzt/Hebamme sich nicht konform verhielt. Nein. Wir möchten euch die Augen öffnen und zeigen, was uns verletzt oder geholfen hat.
Ob ihr euer Kind auf natürliche Weise gehen lassen musstet oder ein Abbruch stattfand: Es ist eure eigene Trauer. Niemand sollte sich das Recht herausnehmen und sagen, was richtig oder falsch ist.
Wir alle haben unseren ganz eigenen Pfad beschritten und unsere ganz persönliche Geschichte dabei erlebt. Jede Meinung sollte akzeptiert und jeder Glaube toleriert werden.
Ich bin nur meine eigene Expertin durch meine eigene Trauer geworden. Wie ihr letztendlich trauert, ist euer Weg, den ihr nicht alleine gehen müsst. Wenn ihr Hilfen und Angebote braucht, so lasst sie euch geben. In den letzten Kapiteln wird ausführlich über Hilfsangebote berichtet.
3. Verschiedene Diagnosestellungen und Gesetzeslage
Ich möchte zuvor auf die Diagnosestellungen von Babys im Mutterleib eingehen. Falls ihr Betroffene seid und schon Fachwissen über „Krankheiten“ gesammelt habt, könnt ihr dieses Kapitel auch gerne überspringen.
In Deutschland gibt es verschiedene Arten der Diagnosestellung von Babys, oder, wie Ärzte in diesem Bereich immer so gerne sagen: Föten.
Viele Gendefekte oder „Mängel“ (an dieser Stelle merke ich an, dass ich ab nun Besonderheiten für das Wort Defekt verwenden werde) lassen sich in der heutigen Zeit schon vor der 12. SSW feststellen. Doch viele Besonderheiten oder Krankheiten bleiben bis zur 20. SSW unentdeckt. Dies muss nicht am behandelnden Gynäkologen liegen; meistens liegt es daran, dass es mehr Krankheiten und Besonderheiten gibt, als manche vielleicht denken mögen. Zudem lassen sich gewisse Merkmale erst zu einem späteren Zeitpunkt diagnostizieren, da diese zuvor im Ultraschall nicht erkennbar oder nachweisbar sind.
Die Medizinstudien und Möglichkeiten sind in Deutschland schon weit fortgeschritten. Inzwischen gibt es unter anderem auch Möglichkeiten, das Kind schon in der bestehenden Schwangerschaft zu operieren und Besonderheiten oder Krankheiten zu behandeln.
Doch fangen wir von vorne an:
Wenn eine Frau feststellt, dass sie ein Kind erwartet, geht sie zum Arzt. Dieser stellt eine bestehende Schwangerschaft fest (wenn das Herz des Kindes schlägt). Die regulären Vorsorgeuntersuchungen finden im Abstand von vier Wochen statt. Vorsorgeuntersuchungen setzen sich aus dem Abtasten des Höhenstandes der Gebärmutter und der Kontrolle des Muttermundes zusammen. Drei große Ultraschalluntersuchungen sind ebenfalls angesetzt.
Auch bei der werdenden Mutter wird auf die Gesundheit geachtet. Wenn der Herzschlag beim Baby festgestellt wird, dann wird der Mutter Blut abgenommen und dieses wird auf bestimmte Werte kontrolliert (Eisen, Blutgruppe, HCG-Gehalt u.v.m.). Schon diese Werte können aussagekräftig für eine „Störung“ der bestehenden Schwangerschaft sein.
In den Schwangerschaftswochen 9 –12, 19–21 und 29–32 wird ein regulärer Ultraschall empfohlen. Bei diesem kontrolliert der Frauenarzt Gewicht, Größe und kann bereits Auffälligkeiten entdecken. Leider sind Beurteilungen der Ultraschallbilder in den Wochen 4–12 selten aussagekräftig.
In der heutigen Zeit gibt es schon enorme Chancen, vor diesen Schwangerschaftswochen die Verfassung des Kindes zu überwachen.
Die Möglichkeit der Nackenfaltenmessung kann schon zwischen der 10. und 14. SSW durchgeführt werden. Dieser „Test“ ist jedoch weniger aussagekräftig als der Harmony-Test.
Bei der Nackenfaltenmessung wird die Nackenfalte des Fötus vermessen. Sollte der Wert Abweichungen ergeben, wird zu einem genaueren Harmony-Test geraten. Dieser wird bei Abweichung der Norm von der Krankenkasse übernommen.
In der 11. SSW gibt es dann die Möglichkeit, einen sogenannten Harmony Test zu machen. Die Kosten für beide Untersuchungen (Harmony Test und Nackenfaltenmessung) muss die Schwangere selbst tragen (siehe Abweichung oben). Es gibt zwei Varianten des Harmony Tests. Bei der ersten Variante wird nach den Trisomien 13/18/21 gesucht und das Geschlecht mitbestimmt. Bei der zweiten Variante wird das Geschlecht nicht mitbestimmt. Die Verfahren der beiden Methoden sind dieselben: Das Blut der Mutter wird auf kindliches Erbgut untersucht. Dieses Erbgut kann aussagen, ob eine Trisomie (18; 13; 21) vorliegt. Bei diesem Verfahren kann somit auch das Kniefelter- und Turnersyndrom ausgeschlossen werden. Sollte das Ergebnis des Harmony Tests weniger erfreulich ausfallen, so raten die meisten Ärzte zu einer genauen Diagnosestellung in Form einer Chorionzottenbiopsie oder Amniozentese.
Diese beiden Begriffe rühren zum einen von der Plazenta (sie versorgt das Kind mit Nährstoffen von der Mutter) und zum anderen von der Fruchthöhle (Fruchtblase). Beide Untersuchungen werden ambulant durchgeführt und von der Krankenkasse übernommen. Wenn sich jedoch ein Paar selbst dazu entschließt, diese durchführen zu lassen, müssen sie die Kosten selbst tragen.
Chorionzottenbiopsie: Mit der Chorionzottenbiopsie wird eine Gewebeprobe des Mutterkuchens (Plazenta) entnommen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Eine Methode wird über die Bauchdecke durchgeführt, die andere, eher seltenere Möglichkeit, wird vaginal durchgeführt. Beide Varianten bergen Risiken, über die der behandelnde Arzt aufklären muss. Die Zellen der Plazenta werden in einem Labor analysiert und können Erkenntnisse über diverse Besonderheiten oder Krankheiten liefern. Ergebnisse erhält man spätestens zwischen zwei und sieben Tagen.
Amniozentese: Bei der Amniozentese wird der Frau Fruchtwasser durch die Bauchwand mit einer langen Nadel entnommen. Dieses wird in einem Labor angesetzt und auf Anomalien oder fetale Infektionen getestet. Das Ergebnis erhält man zwischen 14 und 21 Tagen danach.
Wie ihr sehen könnt, sind also schon vor der vollendeten 12. SSW einige Untersuchungen möglich. Wenn eine Frau sich jedoch gegen diese Tests entscheidet, da sie teilweise auch nicht nötig sind, kann es passieren, dass eine Krankheit oder ein Gendefekt vorerst übersehen wird.
Ich möchte kurz anmerken, dass ich auf keinen Fall irgendjemanden überreden möchte, diese Untersuchungen machen zu lassen.
Beim zweiten großen Ultraschall (gesetzlich findet dieser zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche statt), dem sogenannten Organscreening, wird bei einer normalen Kontrollultraschalluntersuchung das Kind im Bauch vermessen und die Organe kontrolliert; d.h., ob alles vorhanden ist und ob sich das Kind gesund entwickelt. Es gibt immer wieder leichte Abweichungen der Norm von Größe und Gewicht, dies ist normal. Viele Frauenärzte führen diesen jedoch erst in der 20. SSW durch, da hier auf dem „Bild“ genaueres erkennbar ist, weil das Kind schon eine bestimmte Größe aufweisen kann. Sollte der Frauenarzt eine Besonderheit feststellen, oder sich mit dem Ergebnis seiner Untersuchung unsicher sein, bekommt die Patientin eine Überweisung in die Pränataldiagnostik. (Pränataldiagnostik=Feindiagnostik; pränatal= der Geburt vorausgehend).
Wenn bei dieser Untersuchung festgestellt wird, dass z.B. enorme Abweichungen der Größe oder des Gewichtes vorliegen oder etwas nicht genau erkennbar ist, bekommt man eine Überweisung in die Pränataldiagnostik.
In der Pränataldiagnostik arbeiten Ärzt/innen, die eine besondere Schulung oder Weiterbildung in Bezug auf bevorstehende Geburten haben.
DEGUM ist eine Fachgesellschaft und setzt sich aus fast allen medizinischen Bereichen zusammen. Diese Bereiche fördern die Ultraschall-Forschung und beteiligen sich an der Ausbildung für die Anwendung beim Schallen. Ärzte mit dem Titel DEGUM müssen bestimmte Fertigkeiten in der Ultraschalldiagnostik vorweisen. Sie können „Besonderheiten“ erkennen, die anderen Ärzten verborgen bleiben. DEGUM wird in drei verschiedene Bereiche geteilt.
Zur Erläuterung: Fast alle Gynäkologen in einer „normalen“ Praxis besitzen das DEGUM I.
Dieser Arzt muss „lediglich“ feststellen können:
1. Wann der errechnete Geburtstermin ist (ET)
2. Ob es eine Ein-Kind oder eine Mehrlingsschwangerschaft (Zwillinge oder mehr) ist
3. Ob mit dem Mutterkuchen (Plazenta) alles in Ordnung ist
4. Fruchtwasserkontrolle
5. Vermessen des Körpers (Thorax, Oberschenkel, Rumpf)
Dies heißt im Klartext, dass der Arzt nicht einmal erkennen muss, ob das Kind zwei Arme hat. Wiederum bedeutet dies, dass ein Frauenarzt mit dem DEGUM I keine Besonderheiten erkennen muss.
Für die Feindiagnostik, in größeren Kliniken oder spezialisierten Praxen, muss man die Auszeichnung DEGUM II besitzen. Der Untersuchende, mit der Qualifikation DEGUM II, darf Besonderheiten „suchen“ und diese auch einordnen und feststellen.
Die Qualifikation DEGUM II kann man erlernen. Die meisten größeren Praxen, Kliniken und UNIs geben der werdenden Mutter erst einen Termin ab der 20. SSW, da hier das Kind schon gut erkennbar ist und somit Besonderheiten besser festgestellt werden können.
Beispiele für Besonderheiten sind unter anderem
• Defekte Bereiche in der Wirbelsäule
• Gaumenspalte
• Loch in der Herzscheidewand
Ärzte mit der Qualifikation DEGUM III werden dazu berufen. Diese Ärzte müssen hochqualifiziert sein und es wird die höchste Untersuchungsqualifikation gefordert. Diese Ärzte dürfen auch im Bereich Ultraschall ausbilden. Die Geräte, mit denen sie arbeiten, müssen ebenfalls auf dem neuesten und besten Stand sein. Degum III-Ärzte sind eher selten aufzufinden und arbeiten meistens in größeren Zentren oder Unikliniken.
In den ersten Wochen einer Schwangerschaft verhält sich der Kopf zum restlichen Körper immer in einer gewissen Differenz. Deshalb wird in der frühen Schwangerschaft auch kein Verdacht geäußert oder gestellt. Die „Bilder“ der Ultraschalluntersuchungen sind in den ersten Wochen selten aussagekräftig genug, um einen Verdacht zu ergeben.
In der Pränatal-Klinik oder Praxis wird dann von einem Arzt mit DEGUM III oder III geschallt. Sollte dieser eine Besonderheit feststellen oder einen Verdacht aussprechen, so hat die Patientin die Möglichkeit einer Chorionzottenbiopsie oder einer Amniozentese.
Wenn die Ergebnisse der Untersuchungen vorliegen, so hat/haben die Schwangere/das Paar mehrere Möglichkeiten. Die meisten Ärzte raten bei einer schwerwiegenden, lebensbegrenzenden oder nicht-lebensfähigen Diagnose häufig zu einem späten Schwangerschaftsabbruch (Spätabbruch).
§218 StGB (Auszug)
Ein Schwangerschaftsabbruch ist in der Regel grundsätzlich rechtswidrig. Unter bestimmten Bedingungen, wie der sogenannten Beratungsregelung oder der medizinischen und kriminologischen Indikation, bleibt er jedoch straffrei.
§§ 218a Abs. 1StGB und §§ 5 ff. Schwangerschaftskonfliktgesetz: Die Schwangere muss bestimmte Punkte erfüllen, damit sie den Schwangerschaftsabbruch straffrei vollziehen kann:
• Die Schwangere muss nach der Abtreibung verlangen.
• Die Schwangere muss einen Beratungsschein vorweisen können. Diesen erhält sie, wenn sie eine Schwangerenkonfliktberatung, die staatlich anerkannt wurde, besucht.
• Zwischen der Ausstellung des Beratungsscheins und der Abtreibung müssen mindestens drei Tage liegen.
• Die Abtreibung muss von einem Arzt vorgenommen werden, der nicht die Schwangerenkonfliktberatung durchgeführt hat.
• Es dürfen nicht mehr als 12 Wochen nach Befruchtung vorliegen (entspricht der 14. SSW). Es wird ab dem ersten Tag der letzten Monatsblutung gerechnet.
Kriminologische Indikation: Eine kriminologische Indikation liegt vor, wenn die Schwangerschaft durch ein Gewaltverbrechen entstand (Bsp.: Vergewaltigung).
§ 218a Absatz 3 StGB: (…) wenn nach ärztlicher Erkenntnis an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den §§ 176 bis 178 des Strafgesetzbuches begangen worden ist, dringende Gründe für die Annahme sprechen, dass die Schwangerschaft auf der Tat beruht und seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind.
Medizinische Indikation (§ 218a Abs.2 StGB): Wenn ein Arzt oder eine Ärztin zu der Einstellung gelangt, dass die Schwangere durch die Schwangerschaft psychisch oder körperlichen Leidensdruck ertragen muss, darf ein Schwangerschaftsabbruch zu jeder Zeit durchgeführt werden.
Spätabbruch: § 218 StGB Abs. 2: Von einem Spätabbruch spricht man, wenn der Abbruch der Schwangerschaft außerhalb der Regel erfolgt. Dies bedeutet, dass ein Spätabbruch bis kurz vor der Geburt durchgeführt werden darf.
Auch hierfür müssen Schwangere bestimmte Regeln einhalten und/oder es muss eine medizinische/kriminologische Indikation der Fall sein.
Durchführung: Bei einem Spätabbruch wird die Geburt des Kindes in Form von Hormonen in Gang gesetzt. In frühen Wochen, meistens vor der 24. SSW, ist es das Ziel, (wenn das Kind noch lebt) dieses zu Tode zu gebären. In frühen Schwangerschaftswochen benötigt der Körper der Frau mehrere Gaben der Hormone, da der Körper und der Hormonhaushalt noch nicht auf Geburt eingestellt sind.
Auch in späteren Wochen ist es möglich, dass der Körper der Frau noch nicht auf Geburt eingestellt ist. Ab der 22– 24. SSW muss das Kind entweder schon tot im Mutterleib vorzufinden sein, bevor eine Einleitung stattfinden darf, oder es wird der Fetozid vollzogen.
Mögliche Hormongaben sind: Prostaglandine in Form von Tabletten, in Form von Gel oder einem sogenannten Wehentropf.
In der Schwangerschaft ist der Körper der Frau auf das „Halten“, „Behalten“, des Kindes programmiert. Prostaglandine durchbrechen diesen Schutzmechanismus und der Körper beginnt, Wehen zu bilden.
Werden die Wehen zu schnell hervorgerufen und das Kind im Mutterleib noch am Leben ist, so könnte es passieren, dass der Kopf des Kindes bei der Geburt zerquetscht wird, da der Geburtskanal in frühen SSWs sich nicht schnell genug öffnet und der Kopf des Kindes noch nicht „reif“ für eine Geburt ist.
Ab der 22. SSW könnte ein Kind atmen. Sollte das Kind auf die Welt kommen, atmen und nicht unter der Geburt verstorben sein, werden dem Kind schmerzstillende Medikamente verabreicht. Die Eltern sind dafür verantwortlich, ob das Kind nun lebenserhaltende Maßnahmen erhält oder nicht.
Kaiserschnittmethode: Bei der Kaiserschnittmethode wird der Frau das Kind über einen Kaiserschnitt aus dem Bauch geholt. Dies ist jedoch in seltenen Fällen der Fall. Normalerweise wird Schwangeren mit nicht-lebensfähigen Babys in Deutschland geraten, eine Lebendgeburt/Totgeburt zu erleben, da so auch der Abschied vom Kind „einfacher“ ist.
Durchführung bei Kaiserschnitt: Die Geburt erfolgt „chirurgisch“. Dies bedeutet, dass das Kind lebend/nicht-lebend durch die Bauchdecke der Mutter „geboren“ wird. Sollte das Kind leben, werden auch hier (teilweise im Voraus) über lebensbegrenzende oder lebensrettende Maßnahmen mit den Eltern debattiert. Sollten sich die Eltern über lebensbeendende Maßnahmen einig werden, so werden dem Kind lediglich schmerzlindernde Medikamente verabreicht, bis es letztendlich stirbt.
Fetozid: Wie der Paragraf (§218a 2 StGB) besagt, kann die Schwangere, aufgrund von körperlicher oder seelischer Gesundheit, die Schwangerschaft jederzeit beenden.
Sollte das Kind im Mutterleib zu diesem Zeitpunkt leben und/ oder lebensfähig sein, so wäre die Mutter einer Lebendgeburt ausgesetzt und die psychische Gesundheit der Schwangeren wäre bedroht. Aufgrund der Gesundheit der Mutter soll der Fetozid vor Geburt des Kindes vollzogen werden. Ab der 24. SSW gilt ein Baby im Mutterleib als lebensfähig. Dies bedeutet, dass das Kind eventuell selbstständig atmen und überleben könnte.
Der Fetozid muss VOR Beginn der Eröffnungswehen erfolgen, da, sobald die Geburt beginnt, das Lebewesen juristisch als PERSON gilt, und der Schwangerschaftsabbruch ein Tötungsdelikt darstellt. Dieser wird dann auch als solcher strafrechtlich verfolgt.
Die Durchführung des Fetozids bei Mehrlingsschwangerschaften (Drillingen und aufwärts) darf nur durchgeführt werden, wenn ein Risiko für die Mutter oder eines der Kinder besteht. Dies bedeutet: Sollte bei Voruntersuchungen in der Schwangerschaft (nach der 24. SSW) KEINE Auffälligkeit(en) an einem der Kinder gefunden werden, wird das Kind, welches am nächsten zur Bauchwand liegt, dem Fetozid unterzogen.
Genauer erklärt bedeutet dies: Wenn eine Zwillingsschwangerschaft besteht und Gefahr für Mutter oder eines der Kinder besteht, dann wird keine Entscheidung über irgendein Kind getroffen, sondern die Entscheidung fällt urteilsgemäß immer auf das Kind, welches der Bauchwand, somit der Spritze und dem Arzt, am nächsten liegt.
Durchführung: Vor der Durchführung werden dem Kind im Mutterleib schmerzstillende Medikamente verabreicht (kurze Anmerkung meinerseits: Ärzte sagen doch immer, dass diese Kinder noch nichts fühlen können, wieso bekommen sie dann schmerzstillende Medikamente?) Durch eine Spritze wird das schmerzstillende/lindernde Medikament in die Nabelschnur injiziert. Dies geschieht alles unter Einsicht per Ultraschall. Über die gesamte Dauer der Durchführung des Fetozid schallt der Arzt/Ärztin über die Bauchdecke durch die Fruchtblase zum Kind.
Nachdem schmerzstillende Medikamente verabreicht wurden, bekommt das Kind eine Kaliumchlorid-Spritze. Kaliumchlorid (KCI) ist ein Salz, das aus Kalium-Kationen und Chlorid-Anionen besteht. Kalium ist ein essenzieller Nährstoff, der bei „normaler“ Einnahme (oral oder im Krankenhaus als Gabe einer Injektion (Tropf)) nicht giftig ist.
Bei einer Überdosierung des Kaliumchlorids, kommt es potenziell immer zu einem Herzstillstand. Über die Bauchdecke der Mutter wird dem Kind im Mutterleib das Kaliumchlorid direkt in das kindliche Herz injiziert. Innerhalb weniger Minuten verstirbt das Kind nun im Mutterleib und der Arzt/ Ärztin kann danach die Geburt einleiten.
Mehrlingsschwangerschaft: Im Falle einer Mehrlingsschwangerschaft verbleibt das tote Kind bis zur regulären Geburt der verbleibenden Kinder im Bauch der Mutter.
Zusammenfassung:
Liste möglicher Untersuchungen VOR der 12. SSW:
• Nackenfaltenmessung (selbstzahlend)
• Harmony Test (Bei Verdacht übernimmt die Krankenkasse die Kosten, ansonsten selbstzahlend)
• Ultraschalluntersuchung
Mögliche Untersuchungen NACH Verdacht/Feststellung einer Auffälligkeit oder nach der 12. SSW:
• Chorionzottentherapie: Untersuchung einer Plazentaprobe auf Chromosomenanomalien und Besonderheiten im Erbgut
• Amniozentese: Fruchtwasserpunktion, bei der durch das Anlegen der Bakterien weitere Befunde für Besonderheiten und/oder Chromosomenstörung gefunden werden können
Nähere Erklärungen zu Fachbegriffen sind im Fremdwörterverzeichnis zu Anfang des Buches zu finden.
4. Frau Tod
Wo beginnt das Leben?
Beginnt es schon bei der Befruchtung, oder doch erst mit dem ersten Herzschlag? Vielleicht erst, wenn das Kind auf der Welt ist und selbstständig atmet?
Anthroposophen sagen, das Leben beginnt schon weit vor der Befruchtung. Biologen sagen, dass das Leben mit der Zellteilung beginnt. Gottgläubige wiederum meinen, dass Gott das Leben erschaffen hat und dieses mit der „Erschaffung“ begann.





























