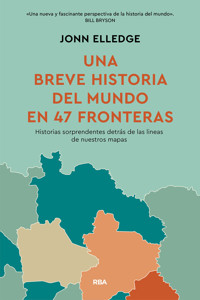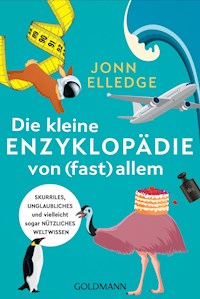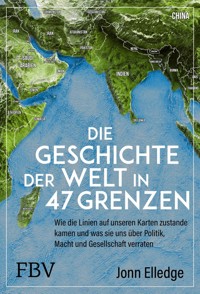
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit es Karten gibt, werden darauf Linien gezogen. Manchmal sind diese Linien in der physischen Geografie verwurzelt, manchmal völlig willkürlich. Sie hätten oft ganz anders aussehen können, wenn ein Krieg, ein Vertrag oder die Entscheidungen einer Handvoll müder Europäer anders verlaufen wären. Indem wir die Geschichten dieser Grenzen erzählen, können wir viel darüber lernen, wie politische Identitäten geformt werden, warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht – und welches Ausmaß menschliche Dummheit annehmen kann. Von den Versuchen der Römer, die Grenzen der Zivilisation zu definieren, über das geheime britisch-französische Abkommen zur Aufteilung des Osmanischen Reichs während des Ersten Weltkriegs bis hin zu dem Grund, warum das Binnenland Bolivien immer noch eine Marine unterhält, ist dies ein faszinierender, witziger und überraschender Blick auf die Geschichte der Welt, erzählt anhand ihrer Grenzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
Jonn Elledge
Die
Geschichte
der Welt in
47Grenzen
Wie die Linien auf unseren Karten zustande kamen und was sie uns über Politik, Macht und Gesellschaft verraten
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de/ abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
1. Auflage 2025
© 2025 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285–0
Die englische Originalausgabe erschien 2024 bei WILDFIRE, einem Imprint der
HEADLINE PUBLISHING GROUP unter dem Titel A History of the World in 47 Borders. © 2024 by Jonn Elledge. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Dr. Ulrich Korn
Redaktion: Rainer Weber
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: Adobe Stock/Corona Borealis
Satz: Achim Münster, Overath
eBook: ePUBoo.com
ISBN druck 978-3-95972-846-1
ISBN ebook (EPUB, Mobi) 978-3-98609-613-7
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
Kritikerstimmen
»Extrem fesselnd und äußerst unterhaltsam. Dieses Buch ist ein wahres Paradies für grenzenlose Nerds – inklusive einer guten Portion Humor. Jonn Elledge versteht es meisterhaft, komplexe Themen zu durchleuchten und sie auf eine Weise zu erklären, die wie ein spannendes und amüsantes Gespräch in einer Bar wirkt.«
Marina Hyde, Autorin von What Just Happened?
»Eine faszinierende und oft sehr lustige Geschichte über eines unserer großen aktuellen Themen: Grenzen.«
Tom Holland, Autor sowie Moderator des Podcasts The Rest Is History
»Gefüllt mit Geschichten, die Sie bereits zu kennen glauben, sowie solchen, die selbst die größten Nerds in Ihrem Umfeld überraschen werden, wird Ihnen diese schlaue und teils unkonventionelle Erzählweise dabei helfen, die Welt aus einer ganz neuen Perspektive zu betrachten – vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt, das Buch aus der Hand zu legen.«
Patrick Maguire, Autor von Left Out
»Manchmal überraschend, manchmal humorvoll, mal düster, mal skurril oder auch alles zugleich – Die Geschichte der Welt in 47 Grenzen entwirrt einige der seltsamen historischen und geografischen Verstrickungen, in die wir uns selbst gebracht haben.«
Gideon Defoe, Autor von Atlas der ausgestorbenen Länder
»Eine geniale Darstellung, wie diese Linien auf einer Karte das Leben, die Schicksale und die Volkswirtschaften beeinflussen. Nach dem Lesen werden Sie eine Landkarte mit ganz anderen Augen betrachten.«
Stephen Bush, Kolumnist der Financial Times
»Es ist äußerst unterhaltsam, die moderne Welt in kurzen, spannenden Kapiteln zu erklären. Genau das Buch, das man sich wünscht.«
Rob Hutton, Autor vonThe Illusionist
»Voller faszinierender Geschichten.«
Greg Jenner, Autor sowie Moderator des Podcasts You’re Dead to Me
»Alle Grenzen sind willkürlich, und jede Nation ist eine Erfindung. Jonn Elledge nimmt uns mit auf eine humorvolle Reise durch die faszinierenden, verstörenden und teils bizarren Entscheidungen, die die Welt zu dem gemacht haben, was sie heute ist.«
Dorian Lynskey, Autor von The Ministry of Truth
»Irgendwie gelingt es Jonn Elledge, geopolitische Geschichte in eine unterhaltsame, faszinierende und aufschlussreiche Erkenntnis zu verwandeln, die uns nicht nur die heutige Welt näherbringt, sondern auch die Zerbrechlichkeit und Entschlossenheit des menschlichen Geistes offenbart. Voller überraschender Informationen, die man sofort jedem erzählen möchte, zeigt uns Die Geschichte der Welt in 47 Grenzen, dass Geschichte sich nicht wiederholt, sondern sich auf ungewöhnliche Weise direkt vor unseren Augen entfaltet. Ein großartiger Autor – ein Lesegenuss von Anfang bis Ende.«
Miranda Sawyer, Autorin von Out of Time
»Einfach großartig. In diesem Buch lernt man mehr als in vielen Schuljahren.«
Charlotte Ivers, Kolumnistin der Sunday Times
»Jonn Elledge ist ein ausgesprochen lebhafter Autor – warmherzig, humorvoll und gleichzeitig politisch scharfsinnig. Genau das macht ihn zum idealen Begleiter für eine Erkundung der Grenzen dieser Welt, die sich unter seinem fragenden Blick als tödlich ernst und zugleich vollkommen absurd entpuppen.«
Phil Tinline, Autor von The Death of Consensus
»Mit dem Witz – und oft auch dem gleichen Tonfall – wie Douglas Adams, der uns von den tragischen Absurditäten der Galaxis erzählt, führt uns Jonn Elledge durch die Grenzen, die uns seit dem Zeitpunkt trennen, als wir beschlossen haben, nicht länger den Karibus zu folgen, um Getreide anzubauen und Steuern zu zahlen. Warum verlaufen manche Grenzen gerade, andere dagegen gebogen? Warum nimmt Israel am Eurovision Song Contest teil? Warum existiert Nordirland? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.«
Matthew Sweet, Autor von Operation Chaos
Inhalt
Einleitung
TEIL 1:GESCHICHTEN
Die Vereinigung von Ober- und Unterägypten
Die Chinesische Mauer und die Grenze als Vereiniger
Warum ist Europa keine Halbinsel in Asien?
Der römische Limes und die Macht der Peripherie
Das Vermächtnis Karls des Großen
Die Grenzen Großbritanniens
Über Feudalismus, Markgrafen, Marquisen und Grenzfürsten
Die Politik der offenen Grenzen des Dschingis Khan
Spanien und Portugal teilen die Welt unter sich auf
Heilig, römisch und ein Reich
Britannien, Irland und die Erfindung des kartografischen Kolonialismus
Die grundlegend missverstandene Mason-Dixon-Linie
Die Reformen der lokalen Verwaltungsstruktur durch Kaiser Napoleon I.
Die amerikanische Invasion in Mexiko
Das Schleswig-Holstein-Geschäft
»… Wo noch nie ein Weißer seinen Fuß hingesetzt hat«
Die Grenzkommission Sudan-Uganda
Europäischer Nationalismus und die Vereinigten Staaten von Großösterreich
Großbritannien und Frankreich teilen den Nahen Osten unter sich auf
Die Teilung von Ulster
Die Teilung Indiens
Der Eiserne Vorhang und die Teilung Berlins
TEIL 2:VERMÄCHTNISSE
Königsberg/Kaliningrad: Ostdeutschland/Westrussland
Der seltsame Fall von Bir Tawil
Die Gefahren der Gartenarbeit in der koreanischen DMZ
Chinas Neun-Striche-Linie und ihre Konflikte
Die unsicheren Grenzen zwischen Israel und Palästina
Die siamesischen Zwillingsstädte Baarle-Hertog und Baarle-Nassau
Die Grenze zwischen den USA und Kanada – und das Problem mit geraden Linien
Ein paar Flecken, die nicht zur Schweiz zählen
Anmerkungen zu Mikrostaaten
Stadtgrenzen
Der Fluch der Vorstädte und die Grenzen von Detroit
Washington, D.C. und das Quadrat zwischen den Staaten
Grenzen vom anderen Ende der Welt
Einige versehentliche Invasionen
Costa Rica, Nicaragua und der »Google-Maps-Krieg«
Das Dilemma des Kartografen
TEIL 3:ANDERE ARTEN VON GRENZEN
Eine kurze Geschichte des Nullmeridians
Einige Hinweise zu Zeitzonen
Eine kurze Geschichte der internationalen Datumsgrenze
Von Seegrenzen und dem Seerecht
Einige Anmerkungen zu Binnenstaaten
Wie die Welt Territorialansprüche in der Antarktis einfror
Das andere, größere, musikalischere Europa
Grenzen in der Luft
Die letzte Grenze
Fazit: Das Ende der Grenze
Quellen und weiterführende Literatur
Danksagung
KARTENVERZEICHNIS
Die Chinesische Mauer
Die grenze zwischen europa und asien
DIE TEILUNG DES REICHES KARLS DES GROSSEN IM VERTRAG VON VERDUN
DAS MONGOLISCHE REICH IM 13. JAHRHUNDERT
DIE VON DEN KATHOLISCHEN MÄCHTEN VEREINBARTEN GRENZEN DER WELT IN DEN 1490ER- UND 1500ER-JAHREN
DIE SICH ÜBERSCHNEIDENDEN ANSPRÜCHE VON PENNSYLVANIA UND MARYLAND
DIE STAATSGRENZEN UM DIE DELMARVA-HALBINSEL
DAS REICH NAPOLEONS IM JAHR 1812
TERRITORIALE VERÄNDERUNGEN IM MEXIKANISCHAMERIKANISCHEN KRIEG (1846–1848) .
SCHLESWIG-HOLSTEIN AUF DER HALBINSEL JÜTLAND
DER AUSGANG DES WETTLAUFS UM AFRIKA
DAS VON DER SUDAN-UGANDA-GRENZKOMMISSION VERMESSENE GEBIET
DER VORSCHLAG FÜR DIE »VEREINIGTEN STAATEN VON GROSSÖSTERREICH
DIE DURCH DAS SYKES-PICOT-ABKOMMEN FESTGELEGTEN EINFLUSSSPHÄREN
DIE HEUTIGEN GEBIETE UM DIE OSTSEE
DIE GEBIETE UM DIE OSTSEE ZWISCHEN DEN WELTKRIEGEN
BIR TAWIL UND DIE FESTLEGUNGEN DER ÄGYPTISCHEN UND SUDANESISCHEN GRENZE
CHINAS »NEUN-STRICHE-LINIE
DER DISTRICT OF COLUMBIA DAMALS UND HEUTE
DIE INTERNATIONALE DATUMSGRENZE
DIE VERSCHIEDENEN KATEGORIEN VON HOHEITSGEWÄSSERN
DIE TERRITORIALEN ANSPRÜCHE AUF DIE ANTARKTIS
DER EUROPÄISCHE RUNDFUNKRAUM
Für Agnes – Gott, ich wünschte, du wärest hier, um das zu sehen
Einleitung
Eine noch kürzere Geschichte
Der Hauptgrund, warum wir von dem ersten dokumentierten Fall einer von Menschen gezogenen internationalen Grenze wissen, ist ihre Abschaffung.
Sie war natürlich nicht die erste, die es gab. Menschen haben Linien auf Landkarten gezogen, seit solche Karten existieren. Und selbst in der Zeit davor werden unsere Vorfahren genau gewusst haben, dass diese Seite des Flusses das Land unseres Stammes ist, während dort drüben, in der Ferne, die anderen wohnen. Das erste Beispiel für eine internationale Grenze, die wir mit ziemlicher Sicherheit bestimmen können, ist jene, die das Land am Nil im 4. Jahrtausend v. Chr. teilte. Nördlich dieser Grenze, gelegen im tief liegenden Flussdelta, lag Unterägypten. Im Süden befand sich Oberägypten, das sich über den schmaleren, höher gelegenen Streifen in Richtung Nassersee erstreckte. Die Trennlinie verlief etwa auf dem 30. Breitengrad, südlich des heutigen Kairo.
Doch dann, um 3100 v. Chr., gab es diese Grenze nicht mehr. Menes, der sich vielleicht mit Narmer gleichsetzen lässt, wurde der erste Pharao, der die beiden Königreiche vereinigte und damit die erste und beständigste nationale Identität der Welt schuf. In den folgenden Jahrhunderten trugen die ägyptischen Herrscher Insignien, die beide Hälften ihres Reiches symbolisierten, und bezeichneten sich selbst als »Herr der beiden Länder«.
An dieser Geschichte sind mehrere Aspekte bemerkenswert. Zum einen, dass Grenzen und Abgrenzungen, die Trennung zwischen Menschen wie uns und den anderen, uns die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch begleitet haben. Zum anderen, dass beide zwar mitunter ihre Wurzeln in der realen physischen Geografie haben, es aber nicht immer klar ist, ob die Grenze durch politische Identitäten gezogen wurde oder ob die politischen Identitäten durch die Grenze geformt wurden. Ein dritter Punkt ist, dass Grenzen noch lange nachwirken können, nachdem sie abgeschafft wurden.
Aber wahrscheinlich ist die wichtigste Erkenntnis aus dieser Geschichte, dass mit ausreichend zeitlichem oder geografischem Abstand fast jede Grenze so rätselhaft werden kann, dass sie letztlich bedeutungslos erscheint.
*
Hier ist ein Spiel, das Sie zu Hause ausprobieren können: Geben Sie »Weltkarte« in die Bildersuche einer Suchmaschine ein. Wahrscheinlich werden Ihnen verschiedene Kartenentwürfe angezeigt – möglicherweise auch eine überwältigende Auswahl an Farbschemata. Dennoch ist es sehr wahrscheinlich, dass alle Karten im Wesentlichen gleich sind, da die Suchmaschine davon ausgeht, dass Sie mit der Suche nach einer Weltkarte eine politische Karte meinen, die nationale Grenzen darstellt und die Länder in unterschiedlichen Farben zeigt.
Diese Annahme ist so tief in unserer Kultur verankert, dass es einen Moment dauern kann, bis man überhaupt erkennt, dass es sich um eine Annahme handelt – aber genau das ist es. Theoretisch könnte unser Interesse eher natürlichen geografischen Merkmalen wie Flüssen und Bergen gelten als den politischen Grenzen zwischen Ländern. Selbst im menschlichen Bereich könnte die Frage, wo Menschen tatsächlich leben – also Karten von Städten und Bevölkerungsdichte – relevanter sein als die oft abstrakte politische Kontrolle über Gebiete, in denen sie nicht ansässig sind. Dennoch geht die Suchmaschine davon aus, dass unser Hauptinteresse den von Menschen geschaffenen Entitäten gilt, die wir als Nationalstaaten bezeichnen. Diese Annahme basiert auf der Vermutung, dass auch unser Gehirn ähnlich funktioniert.
Unsere Vorfahren hätten die Welt nicht unbedingt so wahrgenommen. Hätte es in der Geschichte eine korrekte Kartografie oder gar Internetsuchmaschinen gegeben, hätte eine »Weltkarte« ganz anders ausgesehen. Bevor wir also über bestimmte Grenzen und ihre Bedeutung sprechen, hier sozusagen eine Karte des vor uns liegenden Gebiets, eine kleine Übersicht.
Die ersten politischen Gebilde, die wir als Staaten erkennen können – oder zumindest die ersten, von denen wir Aufzeichnungen haben, was natürlich nicht das Gleiche ist –, entstanden im Lauf des 4. Jahrtausend v. Chr. im sogenannten »Fruchtbaren Halbmond«, einer Region, die sich vom Niltal bis zur Mündung der Flüsse Tigris und Euphrat in den Persischen Golf erstreckt. Später entstanden in anderen Flusstälern weitere Zivilisationen: die Harappakultur im Industal in Pakistan und die ersten chinesischen Dynastien am Gelben Fluss.
Die Herrscher dieser Orte hatten mit ziemlicher Sicherheit eine ungefähre Vorstellung davon, welches Land definitiv ihnen gehörte und welches nicht. Aber die Randgebiete waren eher unbestimmte Bereiche – in denen sie nur begrenzten Einfluss hatten – statt streng gezogene Linien, die den Punkt markierten, an dem es plötzlich endete. Darüber hinaus handelte es sich bei dem, was jenseits der Grenze lag, seltener um einen rivalisierenden Staat als um eine Art Niemandsland, das sich jeglicher politischen Kontrolle entzog und die Heimat von Nomaden war. Zudem existierten dort wahrscheinlich viele aufregende Dinge, die tödlich für einen waren. Es gab einfach nicht genug Menschen auf der Welt, um das gesamte Land für sich zu beanspruchen. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die erste uns bekannte Grenze die bereits erwähnte Trennungslinie zwischen Ober- und Unterägypten ist, da das Niltal eines der wenigen Gebiete war, das fruchtbar und wohlhabend genug war, um rivalisierende Staaten zu ernähren, die aneinandergeraten konnten.
Diese Situation – Inseln mit Staatssystem in einem riesigen Meer aus Land – scheint fast die gesamte Menschheitsgeschichte über angehalten zu haben. Die Herrscher der großen Reiche im Altertum zogen es vor, sich nach Möglichkeit auf natürliche Gegebenheiten – Berge oder Flüsse – als Grenzen zu stützen. Wenn sie ihre eigenen, von Menschenhand geschaffenen Grenzen anlegten, wie den Hadrianswall oder die Chinesische Mauer, ging es weniger darum, die Grenzlinie zwischen Staaten zu markieren als vielmehr zwischen Ordnung und Chaos. Es war eine Möglichkeit, sie mit einer gewissen Kontrollfunktion auszustatten, auch wenn es nur darum ging, ihre Herrschaft über Mensch und Natur gleichermaßen hervorzuheben. Das chinesische Han-Reich verstand seine Mauer, wie der amerikanische Historiker John Mears 2001 schrieb, »weniger als klare, durchgehende Linie, sondern eher als eine Art Cordon sanitaire, als Schutzkordon, als eine Barriere, die den Personen- und Warenverkehr über das hinaus einschränkte, was sie als ungefähre Grenze ihres Staates betrachteten«. Ein halbes Jahrtausend später konnten und taten dies auf der anderen Seite Eurasiens ganze »Nationen«, die dem Römischen Reich beitraten und sich als Foederati – verbündete Stämme, die mit dem Römischen Reich durch einen Vertrag (foedus) verbunden waren – innerhalb seiner Grenzen niederließen. Trotz der Macht, die diese Reiche besaßen, ist dies eine wesentlich schwammigere Vorstellung von nationalen Grenzen als die, an die wir alle gewöhnt sind.
Der Nationalstaat – eine Möglichkeit, die Welt zu gestalten, sodass politische und ethnische/sprachliche Grenzen übereinstimmen – entstand ebenfalls später, als wir manchmal annehmen. Wir leben in einer Welt, die immer noch von zwei westeuropäischen Ländern, England und Frankreich, geprägt ist, die sich früh formierten (beide sind über 1000 Jahre alt). Dieser Umstand, zusammen mit Karten, die Titel wie »Europa im Jahr 1000 n. Chr.« tragen und irreführend modern aussehen, hat uns bisweilen dazu verleitet, uns ein mittelalterliches Europa vorzustellen, das aus einem System rivalisierender Staaten besteht, das dem heutigen nicht unähnlich ist. Bis zur frühen Neuzeit war »Nation« jedoch ein ausgesprochen schwammiger Begriff: Menschen konnten sich frei bewegen, solange sie nicht in Leibeigenschaft oder Sklaverei lebten, doch Städte und Territorien wurden ständig zwischen Adelsfamilien durch Eroberungen, Friedensverträge oder Heiratsbündnisse wie Waren gehandelt. Selbst in England und Frankreich blieben die Grenzen viel länger verschwommen, als wir manchmal vermuten – man denke nur daran, dass Lancashire, aus dem später die großen englischen Städte Manchester und Liverpool hervorgingen, nicht im Domesday Book, einer frühen Volks- und Besitzstandserhebung im mittelalterlichen England, aufgeführt sind, oder dass Giuseppe Garibaldi, einer der berühmtesten Italiener aller Zeiten, in Nice geboren wurde, das heute besser als Nizza (in Frankreich) bekannt ist.
Aber dann, in einigen recht hektischen Jahrhunderten um 1500, ereigneten sich ein paar miteinander zusammenhängende Dinge, die die Vorstellung der Menschen, die sie von der Welt hatten, grundlegend veränderten. Zum einen erhielten Karten dank verfeinerter Werkzeuge und Druckverfahren eine viel bessere Qualität. Das war recht nützlich, um beispielsweise die Kontrolle über das eine Stück Land da drüben zu verkünden, von dem man glaubte, es sei im Besitz der Familie; außerdem bekamen die politischen Führungspersönlichkeiten so eine räumlichere Vorstellung von ihrer Macht.
Eine weitere Veränderung bestand darin, wie zumindest die Europäer über Staaten dachten. Dies mag zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass man zu einer Regierungsform überging, die eher auf einer zentralisierten Verwaltung als auf feudalen Beziehungen basierte; dazu hatte auch die Reformation viel beigetragen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt wurde die Vorstellung, dass ein Großteil ihres Kontinents unter dem Einfluss eines vagen und womöglich nicht existierenden Phänomens namens »Christentum« stand, durch den Gedanken ersetzt, dass die Welt aus unabhängigen souveränen Staaten besteht. Diese Verschiebung wird bisweilen dem Westfälischen Frieden von 1648 zugeschrieben (siehe Seite 105), aber dies erweist sich als eines jener Dinge in der Geschichte, von denen jeder »weiß«, dass sie möglicherweise völlig falsch sind: In den entsprechenden Verträgen ist fast nichts über Souveränität zu finden.
Jedenfalls begann man um das Jahr 1700 damit, Karten anzufertigen, auf denen nationale Grenzen mit dickeren Linien markiert waren als irgendwelche anderen Formen von Grenzlinien: Zum ersten Mal in der Geschichte war das Wichtigste, was man über ein Stück Land wissen musste, zu welchem Staat es gehörte. Gleichzeitig verschlangen die größeren europäischen Mächte nicht eingemeindete Grenzgebiete. Jetzt hatten Staaten die größte Bedeutung, überall war man Teil eines Staates, und sie waren nicht nur politische Einheiten, sondern auch Quellen kultureller Identität.
Dies sollte sich durch die Expansion und den Imperialismus der europäischen Mächte bald – zumindest relativ gesehen – auf die gesamte Welt auswirken. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts legten die USA unter Thomas Jefferson Staatsgrenzen fest und verteilten Land an Siedler, wobei sie sich auf kaum mehr als auf die Kartografie stützten. Am Ende des Jahrhunderts teilten die europäischen Mächte Afrika – einen ganzen Kontinent – auf ähnliche Weise auf. Die Worte des britischen Premierministers Lord Salisbury, die in bester britischer Tradition diese schreckliche Sache auf amüsant ironische Weise zum Ausdruck bringen, zugleich aber auch deutlich machen, dass er nicht die Absicht hatte, dies zu stoppen, fassen die Ergebnisse am besten zusammen: »Wir haben Linien auf Karten gezogen, an Orten, die noch kein weißer Mann je betreten hat; wir haben uns gegenseitig Berge, Flüsse und Seen zugesprochen, nur gehemmt durch das kleine Hindernis, dass wir nie genau wussten, wo sich die Berge, Flüsse und Seen tatsächlich befinden.« Nicht allzu lange Zeit zuvor wäre dieser Gedanke bedeutungslos gewesen – wie kann man die Welt nur anhand einer Karte aufteilen?
Schließlich gingen die Reiche natürlich unter (nun ja, die meisten von ihnen; China, Russland und die Vereinigten Staaten gibt es, glaube ich, immer noch). Aber viele der Linien, die sie auf den Landkarten zogen, blieben bestehen. Und so teilen die heutigen Karten die Landmassen unseres Planeten in etwa 193 einzelne Teile auf, von denen die meisten weniger als zwei Jahrhunderte alt sind. Darüber hinaus legen sie nahe, dass die Grenzen zwischen ihnen nicht nur klar gezogen sind, sondern auch die einzige wirkliche Möglichkeit darstellen, die Erde aufzuteilen.
Es ist unmöglich, ein exaktes und unumstößliches Maß für die Länge einer Küstenlinie zu finden; man kann immer weiter heranzoomen, um eine genauere Messung zu erhalten und Details einzubeziehen, die aus weiterer Entfernung nicht zu erkennen sind. Ebenso könnte man nicht, auch wenn es unendlich viele Wörter gäbe, die Geschichte einer Grenze erfassen, die jedes besondere Vorkommnis, dass sich in ihrer Vergangenheit und in ihrem geografischen Dasein ereignet hat, einschließt. All diese Aspekte und Hintergründe müssen verdichtet und zusammengefasst werden. Was Sie hier vor sich haben, ist daher keine endgültige Darstellung, sondern lediglich meine Interpretation der interessantesten Punkte, in der Annahme, dass, wenn ich sie spannend finde, Ihnen es vielleicht genauso geht. Ebenso musste ich entscheiden, welche Geschichten ich einbeziehe. Dies ist trotz des Titels keine endgültige Geschichte der Welt: Es gibt ganze Jahrhunderte, ganze Zivilisationen, auf die ich nicht eingehen konnte.
Diese Lücken spiegeln teilweise die zeitlichen und räumlichen Beschränkungen wider, die mit dem Schreiben eines Buches einhergehen, und zum Teil den Drang, mich nicht wiederholen zu wollen – aber auch, wenn ich ehrlich bin, meine eigenen Grenzen als Mensch und die Tatsache, dass ich Engländer, Brite, Europäer, Westler und Weißer bin. Ich habe versucht, meine Komfortzone zu verlassen, um zu erkennen, wie viele der Probleme der Welt von Menschen verursacht werden, die mehr oder weniger so aussehen wie ich – aber das ist gleichwohl meine Geschichte mit meiner Voreingenommenheit. Wenn ich Ihre Grenze oder Ihre Zivilisation ausgelassen habe, für die Sie vielleicht ein besonderes Faible haben, kann ich mich nur entschuldigen – und Sie einladen, Exemplare dieses Buches für alle Ihre Freunde und Familienmitglieder zu kaufen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich diesen Fehler in einem Fortsetzungsband korrigieren kann.
Ich sollte auch gleich zu Beginn klarstellen, dass das Folgende keine einfache, lineare Geschichte ist, die sich von der Vergangenheit bis in die Gegenwart erstreckt. Das wäre auch nicht möglich, ohne auf vertrackte und verwirrende Weise von einer Grenze zur anderen zu springen, da sich viele dieser Geschichten über einen sehr langen Zeitraum erstrecken. Tatsächlich enthalten die meisten Essays in diesem Buch sowohl Abschnitte zur Historie als auch Kommentare zum Zustand der heutigen Welt.
Abgesehen davon ist der erste Teil des Buches, Geschichten, grob chronologisch aufgebaut. Darin gehe ich auf einige der interessantesten Grenzziehungen ein, die in der Vergangenheit stattfanden: von der Antike bis zum 20. Jahrhundert – einige, weil sie nach meinem Dafürhalten besonders wichtig sind, um die Geschichte der Grenzen als Umsetzung einer Idee zu erzählen, und einige wegen der Rolle, die sie bei der Gestaltung der Welt, in der wir heute leben, gespielt haben.
In Teil zwei, Vermächtnisse, gehe ich auf die Geschichte jener Grenzen ein, deren interessantester Aspekt darin besteht, auf welche Weise sie die Welt noch heute beeinflussen – indem sie potenzielle militärische Unruheherde schaffen oder weniger beängstigende außenpolitische Zwickmühlen hervorbringen. Oder einfach nur, weil sie für merkwürdige oder verwirrende Linien auf der Landkarte sorgen.
Schließlich betrachte ich in Teil drei, andere Arten von Grenzen, jene Grenzen, bei denen es weniger darum geht, die Herrschaft über den Boden, auf dem wir mit unseren Füßen stehen, aufzuteilen. Dazu gehören die zeitlichen Grenzen zwischen Daten und Zeitzonen; die Grenzen, die auf See oder in der Luft gelten; und schließlich die Grenzen im Weltraum. So wie das Buch in der fernen Vergangenheit beginnt, endet es mit einem Blick in die Zukunft.
Während ich hier erkläre, was Sie in diesem Buch erwartet, möchte ich kurz auf die sprachliche Differenzierung eingehen. Zunächst gibt es technisch gesehen einen feinen Unterschied zwischen den englischen Begriffen boundary und border. Eine boundary im Sinne einer »Begrenzung« oder eines Limits ist, in den Worten von Philip Steinberg, Direktor des IBRU Centre for Borders Research an der University of Durham, eine »dünne Linie, an der sich die Gebiete zweier Staaten treffen«, wohingegen eine border im Sinne einer staatlichen Grenze zu verstehen ist, nämlich die Linie, die man überschreitet, um von einem Staat in einen anderen zu gelangen. Ersteres steht für Trennung, letzteres für Verbindung. Deshalb finden Sie in Gebäuden von Flughäfen, die Hunderte von Kilometern von jeglichen physischen Grenzen entfernt sind, Schilder, die Sie darauf hinweisen, dass Sie eine (staatliche) Grenze überqueren werden. Das ist ein erwähnenswerter Unterschied, auch wenn ich ihn auf den folgenden Seiten weitgehend ignorieren und die beiden Wörter synonym verwenden werde.
Ebenso ist der Begriff »Naher Osten« (engl. Middle East) offensichtlich problematisch, da er eine europäische Perspektive auf die Welt voraussetzt, die in einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Ort und einer bestimmten Einstellung verwurzelt ist. Wenn man einen kurzen Moment darüber nachdenkt, ist dies genauso absurd wie die Tatsache, dass ein großer Teil der östlichen Hälfte der Vereinigten Staaten immer noch allgemein als »Mittlerer Westen« bezeichnet wird. Das Ganze wird noch komplizierter, indem ein Großteil dessen, was wir englischsprachigen Menschen heute als Middle East bezeichnen, den östlichen Mittelmeerraum, früher als »Naher Osten« bezeichnet wurde (wie es in den deutschsprachigen Ländern heute noch der Fall ist, Anm. d. Übers.). Ich habe überlegt, weniger belastete Begriffe wie »Westasien«, »Südwestasien« oder »SWANA« zu verwenden. Aber wenngleich »Asien« ursprünglich der Begriff für die heutige Türkei war, würde eine Bezugnahme auf diese Region als solche heute wahrscheinlich eine breite Leserschaft verwirren, und schließlich wollen wir uns hier klar und verständlich ausdrücken. Daher werde ich, wie bei der Unterscheidung zwischen Grenze und Begrenzung, zugunsten der umgangssprachlichen Verwendung darauf verzichten. Mit diesem Hinweis möchte ich sagen: Hey Leute, ich bin wirklich nicht glücklich damit, okay?
Abschließend sollte ich gleich zu Anfang des Buches zugeben, dass sein Titel irreführend ist. Es enthält 47 Kapitel, aber einige davon befassen sich mit mehreren Grenzen. Die Linien, die die Menschheit auf Karten gezogen hat, sind im Grunde unzählbar. Es ist also angemessen, dass die Zahl der Grenzen, die auf diesen Seiten behandelt werden, die gleiche sein sollte.
*
Wir alle kennen die Weltkarte oder die Landkarte unseres eigenen Fleckchens Erde. Und wir sind uns so im Klaren darüber, wo unser Einfluss endet und etwas anderes beginnt, dass man sich leicht vorstellen kann, dass die Linien, die diese Gebiete durchziehen, eine ebenso natürliche Gegebenheit der Geografie sind wie die Berge, Flüsse oder Küsten. Das sind sie jedoch nicht. Diese Trennungslinien sind eher Konzepte als physische Fakten, und für ein Tier oder einen Außerirdischen wären sie gar nicht erkennbar. Außerdem kann das, was einst geschaffen wurde, auch wieder rückgängig gemacht werden. Es gab eine Zeit, bevor diese Linien existierten; und es wird eine Zeit geben, in der sie nicht mehr da sein werden.
Keine Grenze ist unvermeidlich oder ewig. Grenzen wurden willkürlich und zufällig gezogen und hätten in vielen Fällen ganz anders aussehen können, wenn ein Krieg oder ein Vertrag – oder die Entscheidungen einiger weniger müder Europäer – anders verlaufen wären. Manchmal sind sie nur ein flüchtiges Phänomen, manchmal sind sie Jahrhunderte lang von Dauer. Einige geben Anlass zum Schmunzeln oder Lachen, andere sind absurd, und wieder andere forderten Millionen Todesopfer.
Wenn wir die Geschichten dieser Grenzen erzählen, können wir viel über die Eitelkeit und die Torheit des Menschen erfahren und nachvollziehen, wie das, was in einem Jahrhundert offensichtlich und dauerhaft erscheint, in einem anderen Jahrhundert zufällig oder lächerlich anmutet. Diese Geschichten zeigen uns, wie Entscheidungen, die aus Gründen einer kurzzeitigen Machtpolitik oder der Selbstgewissheit getroffen wurden, langfristige, reale Auswirkungen auf Jahrzehnte oder Jahrhunderte haben können. Und wo könnte man besser beginnen als vor 5000 Jahren südlich von Kairo, um zu betrachten, was die erste Grenze in der Geschichte der Menschheit wirklich bedeutete.
Teil 1
Geschichten
Die Erfindung der GrenzenAufstieg und Fall von ImperienDie Entstehung der NationalstaatenEuropa mischt die Welt auf
Die Vereinigung von Ober- und Unterägypten
Die – möglicherweise – erste Grenze der Welt
Der Übergang von der Urgeschichte zur Geschichte ist nicht der Punkt, ab dem plötzlich besondere Ereignisse stattfanden, sondern markiert lediglich den Zeitpunkt, an dem die Menschen anfingen, etwas aufzuschreiben. Daher lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, wo die ersten Grenzen entstanden, da der dem Menschen innewohnende Trieb, »uns« von »denen« zu trennen, gewiss älter ist als der Drang, dies schriftlich festzuhalten, damit diese Aufzeichnungen bis ins 21. Jahrhundert überdauern und gelesen werden können.
Tatsächlich kamen die ersten Stadtstaaten, Stämme und andere Völker, die eine gewisse Gruppenidentität (je nach persönlicher Ideologie und Vorliebe des Lesers bitte streichen) besaßen, möglicherweise ohne Grenzen im neuzeitlichen Verständnis aus, und zwar aus dem einfachen Grund, weil die Welt nach heutigen Maßstäben im Großen und Ganzen leer war. Sie hatten zweifellos eine Vorstellung davon, wo das Land, das sie kontrollierten, endete. Doch darüber hinaus war es eher unwahrscheinlich, dass es eine gedachte Linie gab, die die Grenze zu einem anderen Stamm markierte, sondern vielmehr ein Niemandsland, das von keiner Menschenseele verwaltet wurde. Hätte damals jemand Landkarten erfunden, was jedoch nicht der Fall war, hätten diese nicht so sehr wie das heutige Flickwerk aus Nationalstaaten ausgesehen, sondern eher wie das Weltall oder das Meer: Inseln der Ordnung in einem chaotischen Meer.
Einer der ersten Orte, an denen das nicht mehr der Fall war, war Nordostafrika. In prähistorischen Zeiten war diese Region die Heimat nomadischer Jäger und Sammler, die auf der Suche nach Nahrung von hier nach dort zogen, möglicherweise mit Viehherden im Schlepptau. Um das 8. Jahrtausend v. Chr. führte ein natürlicher Klimawandel jedoch dazu, dass das Land plötzlich auszutrocknen begann, und über viele Generationen hinweg wurden die Nomaden sesshaft, um die stets fruchtbaren Böden am Fluss zu bewirtschaften. Diese Böden waren aber im Vergleich zu der großen Wüste, die dahinter lag, sehr begrenzt; Sesshaftigkeit bedeutete, dass viele Menschen auf relativ kleinem Raum lebten.
Wenn man also chronologisch vorgeht, ist das erste Beispiel für etwas, was einer heutigen internationalen Grenze ähnelt, etwa im 4. Jahrtausend v. Chr., mit ziemlicher Sicherheit diejenige, die man am Nil findet. Nördlich der Grenze lag Unterägypten, das Land des Flussdeltas, ein relativ weites, fruchtbares Gebiet, das häufig überflutet wurde. Im Süden befand sich das höher gelegene Oberägypten, das Land im Flusstal, wo das fruchtbare Land enger begrenzt war und sich alle Siedlungen dicht am Fluss drängten. Die Trennlinie, wenn es überhaupt so etwas wie eine durchgängige Linie gab, lag um den 30. Breitengrad herum. Diese beiden Königreiche hatten unterschiedliche Bräuche und Dialekte und wahrscheinlich auch unterschiedliche geopolitische Interessen, wobei der Norden auf das Mittelmeer und die Levante blickte und der Süden auf Nubien und Afrika. Es gibt auch keinen Grund anzunehmen, dass sie sich als zwei Hälften eines geteilten Ganzen betrachteten. Die Idee eines Landes namens Ägypten entstand erst später.
Warum also kennen wir diese Grenze zu einem Zeitpunkt in der Geschichte, über den wir fast nichts wissen? Weil sie irgendwann um 3000 v. Chr. von jemandem abgeschafft wurde. Ein König aus Oberägypten namens Menes eroberte den Norden und gründete in Memphis eine neue Hauptstadt, von der aus er sein neu geeintes Königreich regierte. So wurde er zum ersten Pharao und schuf eine Nation, die bis in die heutige Zeit über die gesamte Dauer der Menschheitsgeschichte hinweg besteht. Über Jahrhunderte hinweg stellten sich die ägyptischen Herrscher mit Symbolen dar, die beide Hälften ihres Königreichs repräsentierten, und verwendeten den Titel »vom Binsehalm und der Biene« (den Sinnbildern für Ober- bzw. Unterägypten) und bezeichneten sich selbst als »Vereiniger der beiden Länder« (die genauen Übersetzungen variieren). Sie trugen sogar eine Doppelkrone, die Pschent, die die weiße Krone Oberägyptens und die rote Krone Unterägyptens miteinander verband. Von zentraler Bedeutung für das Selbstverständnis der ältesten Ägypter als Nation war die Tatsache, dass sie einst aus zwei Königreichen bestanden, nun aber dank ihrer wohlwollenden Herrscher eins geworden waren.
Natürlich ist es recht schwierig, herauszufinden, was in einer Welt vor sich ging, die weiter von Sokrates entfernt ist als der griechische Philosoph von uns. Zudem wissen wir auch viel weniger über Unterägypten als über Oberägypten, denn der etwas feuchtere Boden führte dazu, dass bestimmte Dinge einfach schneller verrotteten. Und die ägyptische Geschichte dauert ewig an, so lange, dass die Eroberungen durch die Perser und Alexander den Großen – Ereignisse, die wir selbstsicher als »antike Geschichte« klassifiziert haben – in einer Zeit stattfinden, die allgemein als »Spätzeit« bezeichnet wird. Es wird Sie also nicht überraschen, dass es bei dieser Geschichte einige Fragezeichen gibt.
In seinem Buch Aufstieg und Fall des Alten Ägypten hebt Toby Wilkinson neuere Erkenntnisse hervor, die darauf hindeuten, dass die letzten beiden Königreiche vor der Vereinigung um 3100 v. Chr. in Thinis und Hierakonpolis, beide weit im Inneren Oberägyptens gelegen, zu verorten waren. Als Ägypten in späteren Zeiten politischer Instabilität erneut geteilt wurde, erfolgte diese Teilung, so Wilkinson, weitgehend bei Assiut, einer plötzlichen Verengung des Niltals nördlich dieser beiden Orte, aber gut 320 Kilometer südlich der gedachten Grenze. Die politische Geografie ist bei Weitem nicht so eindeutig, wie es die traditionelle Erzählung vermuten lässt.
Möglicherweise hat Menes – und das ist ein heikles Thema – nie existiert. Sein Name taucht in den archäologischen Aufzeichnungen kaum auf, und so hat sich ein Konsens herausgebildet, ihn mit einem in Thinis ansässigen König namens Narmer gleichzusetzen, dem zugutegehalten werden darf, dass es ihn tatsächlich gab. (Pharaonen hatten, einzig zu dem Zweck, das Leben noch schwieriger zu gestalten, oft mehrere Namen.) Auf der einen Seite der Palette von Narmer, die von einem Ägyptologen als das »erste historische Dokument der Welt« bezeichnet wurde, scheint er die hohe weiße Krone Oberägyptens zu tragen und jemanden zu erschlagen; auf der anderen Seite sieht man ihn als fröhlichen Herrscher mit der roten Krone Unterägyptens auf dem Kopf, die genauso hoch ist wie die weiße. Das deutet sicherlich darauf hin, dass es sich hierbei um eine Darstellung von Eroberung und Vereinigung handelt. Dennoch wird diskutiert, ob die Palette ein realhistorisches Ereignis oder eher die mythologische Geschichte eines Ursprungs veranschaulichen soll, in der Art von »aufgezogen von Wölfen, Brudermörder, dann Gründer von Rom«. Die archäologischen Funde lassen vermuten, dass ein Königreich im Süden Ägyptens seinen Herrschaftsbereich allmählich ausweitete, zunächst über seine unmittelbaren Nachbarn hinaus und dann in den Norden. Es gab jedoch womöglich keinen Zeitpunkt, an dem zwei klar umgrenzte Königreiche zu einem einzigen verschmolzen, oder einen bestimmten König, der eben dies bewirkte.
Warum wird diese Grenze dann überhaupt in den historischen Aufzeichnungen erwähnt? Weil wir zwar nicht viel darüber wissen, wie die Taten und Handlungen der frühesten Pharaonen aussahen und was sie bewirkten, aber die uns vorliegenden Beweise (Gräber, Denkmäler, Königslisten und dergleichen) geben uns zu verstehen, wie sie gesehen werden wollten. Und all diese Insignien – die Doppelkrone, deren beide Hälften tatsächlich aus Oberägypten stammen könnten; die Titel wie »Herr der beiden Länder« – deuten darauf hin, dass es den Pharaonen wichtig war, sich als Personifizierung des vereinten Ägyptens zu positionieren. Mindestens einer von ihnen, Djer, soll eine Art Rundreise unternommen haben, die als »Umschreitung der beiden Länder« bezeichnet wird, und er soll sein riesiges Königreich durch seine bloße Anwesenheit zusammengeführt haben.
5000 Jahre später, nachdem Ägypten die Besatzung durch alle Feinde, von den Persern bis zu den Briten, überstanden hat und immer noch als eine Einheit dasteht, mag die Vorstellung, dass es wieder zerbricht, abwegig erscheinen. Im alten Ägypten war dies jedoch eine sehr reale Befürchtung: Während der »Zwischenperioden«, zwischen dem Alten, Mittleren und Neuen Reich, zerbrach das Land erneut, und zeitweise regierten mehrere Dynastien gleichzeitig von verschiedenen Hauptstädten aus. Titel wie »Vereiniger der beiden Länder« spiegelten die Tatsache wider, dass das Ansehen des Pharaos zum Teil darauf beruhte, dass er stark genug war, das Land zusammenzuhalten.
Ob die Grenze zwischen den beiden ägyptischen Reichen jemals buchstäblich existiert hatte, war weniger wichtig als die Tatsache, dass ihr Herrscher genug Macht hatte, sie zu beseitigen.
Eine letzte Sache noch, bevor wir das alte Ägypten hinter uns lassen und uns den relativ jungen Ereignissen des 1. Jahrtausends v. Chr. zuwenden. Zur Zeit von Djoser, dem Gründer der dritten Dynastie im 27. Jahrhundert v. Chr., war Ägypten in Provinzen unterteilt, die als »Gaue« bekannt waren. Jeder dieser Gaue wurde von einem »Nomarchen« oder Gaufürsten regiert, der offenbar ein Herrscher mit eigener pseudo-feudaler Machtbasis war und dessen Amt erblich geworden war. Auf dem Höhepunkt des Königreichs gab es 42 von ihnen, und sie bestanden bis zu den muslimischen Eroberungen im Jahr 640 n. Chr. fort.
Mit anderen Worten: Die Gaue waren lokale Regierungseinheiten, die in der einen oder anderen Form über 3200 Jahre lang Bestand hatten. Das rückt englische Grafschaften oder amerikanische Bundesstaaten in die richtige Perspektive, nicht wahr?
Die Chinesische Mauer und die Grenze als Vereiniger
Seit 221 v. Chr. markiert sie die Grenzen des Reichs der Mitte
Den bekannten Spruch, der da lautet: »Die eine Sache, die jeder über die Chinesische Mauer weiß, ist falsch«, kann man heute nicht mehr behaupten. Denn das Einzige, was heute jeder darüber weiß, ist: »Es stimmt nicht, dass man sie vom Weltraum aus sehen kann«, und das ist, wie sich herausstellt, richtig. Die Mauer ist zwar sehr lang, aber nur wenige Meter breit und hat auf alle Fälle die gleiche Farbe wie das Terrain, das sie umgibt, sodass man sie selbst aus einer erdnahen Umlaufbahn nicht sehen kann. Wenn Sie die Chinesische Mauer sehen wollen, fahren Sie am besten immer noch nach China.
Tatsache ist jedoch, dass sie fast unvorstellbare Ausmaße hat: eine etwa 50 000 Kilometer lange Mauer – das reicht auf diesem Breitengrad aus, um die Welt eineinhalbmal zu umrunden. Das ist aber mit Blick auf die tatsächliche Mauer definitiv nicht der Fall, und das liegt zum Teil daran, dass sie nicht in einer geraden Linie verläuft. Der Hauptgrund jedoch ist, dass es sich mitnichten um eine einzelne Mauer handelt: Es ist vielmehr ein Netz aus Parallelen und Verzweigungen, das sich wie ein 2500 Kilometer langes Geflecht über Nordchina erstreckt, vom Jadetor im äußersten Westen bis zur Grenze zu Nordkorea. Nicht alle diese Mauern existieren noch: Das verbleibende Netz wird auf eine Länge von etwa 21 000 Kilometern geschätzt, was aber immer noch, um es fairerweise zu sagen, jede Menge Mauer ist.
Um zu erklären, warum diese Mauern notwendig waren – und wie sie zu einem Symbol für die Vereinigung Chinas wurden –, ist es hilfreich, einen Schritt zurückzugehen und eine wichtige Frage zu stellen. Warum haben wir überhaupt damit angefangen, Grenzen zu ziehen?
Während des größten Teils der Steinzeit – die mit etwa 2,5 Millionen Jahren etwa 99,8 Prozent der gesamten Menschheitsgeschichte ausmacht – bestand unsere Spezies überwiegend aus Jägern und Sammlern: kleine Stammesgruppen, die viel umherzogen, nur selten auf Fremde trafen und ihre Kalorien bezogen, indem sie Tiere jagten und Pflanzen sammelten. Aber irgendwann, wahrscheinlich vor etwa 12 000 Jahren, änderte sich das. In einem Ereignis, das verschiedentlich als neolithische Revolution oder Agrarrevolution bekannt ist, erfand jemand – wahrscheinlich waren es viele Jemande – die Landwirtschaft.
Warum sich überhaupt jemand die Mühe machte, ist seltsamerweise ein Rätsel: Man könnte, wenn man ein Verfechter des unaufhaltsamen Fortschritts ist, annehmen, dass dies grundsätzlich alles verbessert hat, doch tatsächlich gibt es jede Menge Hinweise darauf, dass die Landwirtschaft mehr Arbeit für weniger Kalorien bedeutete. Anthropologen haben zahlreiche Theorien aufgestellt, warum unsere Vorfahren diese anscheinend selbstzerstörerische Entscheidung trafen – eine Entscheidung, die nach jeder vernünftigen Definition dennoch das wichtigste Ereignis in der Geschichte unserer Spezies ist: Klimawandel, kurzfristige Vorteile, die langfristige Probleme verschleiern, oder Vorteile für die Oberschicht, die die Nachteile für die breite Masse überwiegen. Eine mögliche Erklärung ist ein einfacher demografischer Grund: Durch Landwirtschaft lassen sich mehr Menschen in einem bestimmten Gebiet ernähren als durch Jagen und Sammeln, was bedeutete, dass diejenigen, die Landwirtschaft betrieben, unweigerlich die Oberhand gewannen. Auf vielerlei Weise – mehr Arbeit, mehr Ungleichheit, der Übergang zur Sesshaftigkeit, der häufigere Schwangerschaften ermöglichte, und damit die Erfindung des Patriarchats – wurde das Leben härter. Aber mit einer wachsenden Bevölkerung gab es zumindest mehr Leben, um das man sich kümmern musste.
Wie dem auch sei: Landwirtschaft bedeutete, sesshaft zu werden, was alle möglichen Auswirkungen auf die Beziehung zwischen den Menschen und der materiellen Welt hatte. Zum einen brachte es mehr Besitz mit sich: Man konnte etwas »besitzen«, ohne es auf dem Rücken tragen zu müssen. Es bedeutete auch, dass die Kontrolle über gutes Ackerland zu einem der wichtigsten Faktoren wurde, um zu bestimmen, welche Gruppen von Menschen Erfolg haben würden und welche nicht. Wo sich früher Grüppchen von Menschen über weite Gebiete bewegten, konzentrierten sich nun wesentlich größere Gruppen in relativ kleinen Gebieten.
Wenn jedoch eine Gruppe von Menschen ein Stück Land kontrollierte, bedeutete dies zwangsläufig, dass andere dies nicht konnten. Das gab der ersten Gruppe einen Ansporn zur Verteidigung und der zweiten einen Anreiz zum Angriff.
Sie können wahrscheinlich erkennen, dass dies der Startschuss für im Grunde die gesamte Menschheitsgeschichte ist.
Die frühesten Zivilisationen – in Ägypten, Mesopotamien, dem Industal in Pakistan und in Nordwestindien – entstanden alle in Flusstälern, wo das Land fruchtbar und die Jahreszeiten vorhersehbar waren. Aus naheliegenden Gründen wissen wir relativ wenig über das Leben und die Politik an solchen Orten. Wie bei der Geschichte von Menes/Narmer sind wir auf Wissenschaften wie Archäologie und Anthropologie angewiesen, weil niemand so gütig war, die Geschichtsschreibung zu erfinden. Soweit wir das heute beurteilen können, ähnelten einige dieser Orte zu bestimmten Zeiten vereinten Reichen, deren wichtigste Grenze die unscharfe Linie zwischen Zivilisation und Barbarei war; zu anderen Zeiten bestanden sie möglicherweise aus mehreren Staaten, die als Rivalen um Territorium und Hegemonie kämpften, wobei die Macht häufig zwischen Reichen, Dynastien und Städten wechselte. Eine Zeit politischer Stabilität und wirtschaftlichen Gedeihens konnte dazu führen, dass sich in dem Gebiet die Zivilisation weiterentwickelte und die Besiedlung ausdehnte. Doch irgendwann gingen die guten Zeiten zwangsläufig zu Ende, und die daraus resultierende Vielfalt an verschiedenen Städten/Staaten/Dingen barg unweigerlich das Potenzial für Konflikte untereinander.
So scheint es auch im alten China gewesen zu sein. Auf ihrem Höhepunkt kontrollierten die frühesten Reiche Gebiete, die zwar nur einen Bruchteil der Größe des heutigen China ausmachten, aber nach damaligen Maßstäben immer noch riesig waren. Wie in Ägypten neigten jedoch auch diese Reiche dazu, sich regelmäßig in kleinere Teile aufzusplittern. So kam es, dass die Zhou, Chinas dritte und langlebigste Dynastie, im 1. Jahrtausend v. Chr. noch einige Jahrhunderte vor sich hatte und theoretisch immer noch an der Spitze eines Reiches stand, über das sie seit Mitte des 11. Jahrhunderts v. Chr. herrschten.1 In der Praxis jedoch begann die eigentliche Macht bereits im 8. Jahrhundert v. Chr., sich vom Zentrum hin zu einer Vielzahl kleinerer lokaler Machthaber zu verlagern.
Im 5. Jahrhundert v. Chr. sah sich der Kaiser gezwungen, die Unabhängigkeit einiger dieser kleineren Staaten anzuerkennen; im 3. Jahrhundert v. Chr. war er kaum mehr als eine Repräsentationsfigur und seine Anerkennung spielte keine Rolle mehr. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, was dies bedeutet haben könnte: Das 5. bis 3. Jahrhundert v. Chr. ist als »Zeit der Streitenden Reiche« bekannt.
Das ist die Welt, in der die Chinesen es erstmals unternahmen, ihre Mauern zu bauen. Bereits im 7. Jahrhundert v. Chr. begann man im Königreich Chu – ein Vasallenstaat der Zhou, der sich auf das Gebiet der heutigen Provinz Hubei konzentrierte – mit dem Bau einer permanenten Verteidigungsbarriere, die als »Quadratische Mauer« bekannt ist, um ihre Hauptstadt zu schützen. Die Qi im Norden nutzten eine Kombination aus Flussdeichen, unpassierbaren Bergen und brandneuen Bauwerken aus Erde und Stein, um ihr Gebiet abzusichern. Das Königreich Zhongshan errichtete Mauern, um sich vor den Zhao und Qin zu schützen; die Wei bauten zwei Mauern – eine zum Schutz ihrer Hauptstadt, eine weitere zur Verteidigung ihrer Reiche gegen Nomadenstämme im Westen und auch gegen die Qin. Die Qin, vermutlich ein wenig verärgert darüber, bauten ihre eigenen Mauern, um sich vor noch mehr Nomaden zu schützen.
Und so ging es weiter. (Es gab noch mehr Königreiche und noch viel mehr Mauern, aber das sollte fürs Erste reichen.) Diese Mauern dienten natürlich der Verteidigung, aber auch zur Markierung des eigenen Territoriums. Man hat den Eindruck, als wollten die lokalen Dynastien dem Land buchstäblich ihren Stempel aufdrücken– um zu zeigen, dass sie genauso mächtig waren wie das benachbarte Königreich.
All dies fand 221 v. Chr. ein gewisses Ende, als Shihuangdi, das Oberhaupt der zu diesem Zeitpunkt äußerst mächtigen Qin-Dynastie, die Annexion von Qi vollendete, China vereinte und der Welt verkündete, dass seine Dynastie »10 000« Generationen andauern würde.2 Dies stellte sich als etwas allzu optimistisch heraus: 207 v. Chr., nur vier Jahre nach seinem Tod, brach sein Reich zusammen, und nach einem kurzen Bürgerkrieg wurde seine Dynastie durch die etwas beständigere Han-Dynastie ersetzt. Dennoch ging Shihuangdi aufgrund seiner vielen Pläne, welche vorsahen, die zuvor verfeindeten Staaten in ein einziges Volk mit einer einzigen Identität zu verwandeln, als erster echter Kaiser Chinas in die Geschichte ein.
Die Chinesische Mauer, übertragen auf die heutige Karte. Nicht alle Abschnitte sind dargestellt
Sein Regime vereinheitlichte die verschiedenen chinesischen Schriftsysteme in einer einzigen Schrift, standardisierte Gewichte und Maße und erließ sogar Regeln für die Breite von Wagenachsen, um das Transportwesen zu verbessern. Es gibt einen Grund, warum die Qin – etwa ausgesprochen wie »Tschin« – dem Staat seinen Namen gaben.
Und doch wird der erste Kaiser auch als eine Art Bösewicht in Erinnerung bleiben, denn zu diesen verschiedenen Vorhaben gehörte ein zermürbendes Programm öffentlicher Arbeiten. Mit einer riesigen Armee unbezahlter Arbeiter, die zur Arbeit gezwungen wurden, um auf diese Weise eine Art Steuer zu entrichten, baute der Staat neue Straßen, Kanäle und Festungen. Außerdem ließ er die verschiedenen historischen Mauern zu einer einzigen Anlage verbinden, die zur Verteidigung gegen Invasionen der Barbaren aus dem Norden, aber auch als Symbol des neu vereinten Staates dienen sollte. In der Literatur dieser Zeit wird gegen die verheerenden Auswirkungen gewettert, die dies auf junge Männer, die zur Arbeit gezwungen wurden, und die von ihnen zurückgelassenen Familien haben würde. Aber China hatte jetzt, ob gut oder schlecht, seine Mauer.
Die ursprünglichen Bauwerke ähnelten eher Erdwällen als Mauern in unserem heutigen Verständnis; sie bestanden aus verdichteter Erde und anderen Materialien, die vor Ort gesammelt werden konnten, oder wie es bei National Geographic heißt: »rote Palmwedel in der Wüste Gobi, wild wachsende Pappelstämme im Tarimbecken, Schilf in Gansu.« Was heute noch steht, ist größtenteils ein viel jüngeres Bauwerk. Das Bild, das Sie beim Lesen vor Augen haben – eine Konstruktion aus Ziegeln, die so breit wie hoch ist und sich wie eine große graue Schlange entlang der Hügel bis zum Horizont windet –, ist höchstwahrscheinlich die Ming-Mauer. Dieser am besten erhaltene Teil der Mauerbauwerke diente bewusst als Schutzanlage. Es war ein Versuch der Dynastie, die China ab 1368 n. Chr. regierte, ein System wiederzubeleben, das so weit von ihnen entfernt war wie das Römische Reich von uns, um so sicherzustellen, dass eine Invasion wie die Eroberungen der Mongolen im vorigen Jahrhundert sich nie wieder wiederholte. Ihre Mauern, die sich über 7200 Kilometer von der Wüste bis zum Meer erstreckten, waren nicht nur einfache Wälle. Sie waren ein kompletter Militärkomplex, einschließlich Toren und Ställen, Türmen und Festungen, mit aufgeblasenen Namen wie »Turm zur Unterdrückung des Nordens« oder (mein persönlicher Favorit) »Turm zur Unterdrückung der ziegenartigen Fremden«.
Das funktionierte zwar, aber im großen Rahmen der chinesischen Geschichte nicht lange. Als die Ming-Dynastie zu schwächeln begann, war der Staat nicht mehr in der Lage, seine Verteidigungsanlagen ordnungsgemäß zu bemannen oder diejenigen, die sie bewachten, ausreichend zu versorgen. Es stellte sich heraus, dass eine Mauer nur so stark war wie der Staat, den sie schützte. Als die Mandschu im 17. Jahrhundert eine Invasion einleiteten, reichte die Mauer nicht aus, um sie aufzuhalten. Das soll jedoch nicht heißen, dass die Mauer keinen Nutzen hatte: Die von den Mandschu gegründete Qing-Dynastie, die letzte Herrscherdynastie des kaiserlichen China, betrachtete sie als nützliches Bollwerk, um einen übermäßigen Einfluss der chinesischen Kultur daran zu hindern, in ihre ursprünglichen nichtchinesischen Gebiete im Nordosten zurückzugelangen.
All dies bringt uns zu einer der wichtigsten Fakten über die Mauern. Ihr Zweck und ihre Bedeutung haben sich im Lauf der Jahrhunderte radikal verändert – was angesichts der geringen Wahrscheinlichkeit, dass über 2000 Jahre hinweg alles beim Alten bleibt, vielleicht keine Überraschung sein sollte. Die Vorläufer des Bollwerks waren ein Ausdruck der Zersplitterung Chinas, während die Mauern der Qin-Dynastie ein Symbol der Einigung waren. In manchen Jahrhunderten zog sich das Reich hinter die Mauern zurück, die so die Grenze zwischen der Zivilisation Chinas und der chaotischen Welt jenseits des Landes symbolisierten. In anderen Jahrhunderten erstreckte sich das Reich weit darüber hinaus, sodass die Mauern weniger eine Verteidigungsanlage als vielmehr eine Kommunikations- und Transportader darstellten – eine Möglichkeit, Reisen und Handel vom Kernland in die Provinzen zu ermöglichen und zu überwachen. In wieder anderen Jahrhunderten wurden sie vergessen und vernachlässigt und dem Verfall preisgegeben.
Dann wäre da noch der unvermeidliche Tourismus. In Zeiten, in denen China sich der Welt verschloss, waren die Mauern etwas, hinter dem sich das Land verstecken konnte. Zeigte es sich jedoch offener gegenüber der Welt, wurden die beeindruckenden historischen Mauern zu einem der wichtigsten Anziehungspunkte für Besucher. Schon seit dem Fall der Ming-Dynastie waren sie ein wichtiger Zwischenstopp auf der Touristenroute, die die Menschen aus dem Westen auf sich nahmen. Heute besuchen ganze Busladungen einheimischer Touristen den Mauerabschnitt in der Nähe von Peking: So wie einst wohlhabende junge Europäer auf ihrer Grand Tour durch Europa reisten, besuchen heute wohlhabende junge chinesische Studenten ihre Mauern.
Auch wenn die Mauern noch immer einen Zweck erfüllen, nämlich als Symbol für das eine, vereinte China, das sie schützen sollten, zu dienen, konnten sie das Land nicht ewig vor der Welt verbergen. Und es waren nicht nur die Mongolen und Mandschu, denen es gelang, sie zu durchbrechen: Als die Europäer im 19. Jahrhundert das Land im fernen Osten erreichten, kamen sie auf dem Seeweg mit Kanonenbooten in chinesische Häfen. Wie die Chu-, die Qi- und die anderen Reiche und Dynastien vor all den Jahrtausenden erkannten, musste auch die Ming-Dynastie im 17. Jahrhundert feststellen: Keine Grenze kann Außenstehende für immer fernhalten.
1 Sie waren vielleicht nicht wirklich die dritte. Die Dynastie, die normalerweise an erster Stelle der Liste steht, die Xia-Dynastie, hinterließ keine Aufzeichnungen und gilt daher im Allgemeinen nur als etwas wenig glaubwürdiger als die legendäre Phase der »Drei Herrscher und fünf Kaiser«, die ihr vorausging. Die nächste in der Reihe, die Shang-Dynastie, die in der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. regiert haben soll, hinterließ tatsächlich einige Beweise in Form von Dokumenten und archäologischen Fundstücken. Das bedeutet, dass zwar immer noch darüber diskutiert wird, wann die Shang-Dynastie begonnen und geendet hat, und man weiterhin über all die Dinge debattiert, die damit zusammenhängen, gleichwohl ist man sich einig, dass sie zumindest existierte. In gewisser Weise jedenfalls.
2 Ich sagte Ihnen ja bereits, dass die Qin sauer waren.
Warum ist Europa keine Halbinsel in Asien?
Wie die Griechen und die Kirche einen Kontinent erfanden
Die verschiedenen städtischen Verkehrssysteme verfolgen unterschiedlich ehrgeizige Ziele. Die New Yorker U-Bahn endet an der nördlichen Stadtgrenze, sodass die Bewohner der Vororte im benachbarten Westchester County gezwungen sind, eine andere Möglichkeit der Personenbeförderung zu finden. Die Pariser Metro erstreckt sich wie ein paar Tentakel über den Boulevard Périphérique hinaus, der in etwa dem Verlauf der letzten Stadtmauer folgt. Die Londoner U-Bahn ist in den nördlichen und westlichen Vororten der Stadt so gut wie kaum zu übersehen, dafür aber im Südosten kurioserweise so gut wie nicht vorhanden.
Aber die U-Bahn in Istanbul stellt sie alle in den Schatten. Sechs ihrer acht Linien befinden sich in Europa; zwei – noch innerhalb der Stadtgrenzen – in Asien. Die beiden Gebiete sind durch die 76,6 Kilometer lange Marmaray-S-Bahnlinie verbunden, deren Name sich aus dem Marmarameer (das etwas südlich liegt) und ray, dem türkischen Wort für »Schiene«, zusammensetzt. Wenn Sie nach Istanbul reisen, können Sie buchstäblich mit einem Nahverkehrszug zwischen den Kontinenten pendeln.
Das ist jedoch nicht so beeindruckend, wie es zunächst klingt. Tatsächlich können Sie den Kontinent wechseln, indem Sie nur 3 Kilometer und eine Haltestelle zurücklegen (von Sirkeci nach Üsküdar, wenn Sie Lust dazu haben), und obwohl die Marmaray-Linie 13,5 Kilometer durch einen Tunnel führt, verlaufen nur etwa 1,4 Kilometer davon durch den Bosporus, die schmale Meerenge, die Europa von Asien trennt. Der größte Teil der Strecke verläuft unterirdisch, und zwar aus dem gleichen Grund, aus dem die New Yorker Subway oder die Pariser Metro unterirdisch verlaufen: weil es verdammt umständlich wäre, Teile Istanbuls abzureißen, um dort Züge hindurchfahren zu lassen. Je länger man den Bosporus betrachtet, desto alberner erscheint es, das Land auf der einen Seite als grundlegend anders anzusehen als das Land auf der gegenüberliegenden Seite.
Es gibt natürlich mehrere Stellen auf der Erde, an denen Kontinente aufeinandertreffen. So ließe sich behaupten, dass beispielsweise die Sinai-Halbinsel oder der Isthmus von Panama ebenfalls recht willkürliche Punkte sind, die man als Übergänge von einem Teil zum anderen bezeichnen könnte. Dabei handelt es sich jedoch eindeutig um schmale Landstreifen, die zwei riesige Landmassen voneinander trennen. Was die Grenze zwischen Europa und Asien so besonders macht, ist, dass sie nicht weniger absurd wird, wenn man sie aus der Ferne betrachtet. Südlich von Istanbul verläuft die Grenze durch das Marmarameer und die Dardanellen, eine weitere Meerenge, die an ihrer schmalsten Stelle nur 1,2 Kilometer breit ist. Im Norden verläuft sie weiter über das Schwarze Meer, den Kamm des Kaukasus, das Kaspische Meer und den Ural. Das alles sind, geografisch gesehen, imposante Merkmale, da bin ich mir sicher, aber:
Wir teilen Kontinente im Allgemeinen nicht durch Gebirgszüge auf – Nordamerika wird weder durch die Rocky Mountains noch durch die Appalachen geteilt;
Es gibt auf jeden Fall eine Lücke zwischen dem Kaspischen Meer und dem Uralgebirge, wo niemand so recht zu wissen scheint, wo die Grenze tatsächlich verläuft – die Flüsse Ural und Emba entspringen beide dort, aber es ist letztlich eine Ermessensfrage, denn:
Wenn man sich eine Weltkarte ansieht, ist es offensichtlich, dass Europa und Asien, im Gegensatz zu Nord- und Südamerika,
eine
Landmasse bilden, zwischen denen eine willkürliche Linie gezogen wurde.
Die seltsame, mäandernde Route der Grenze zwischen Europa und Asien. Unmittelbar nördlich des Kaspischen Meeres ist ihre Route umstritten, wobei einige Quellen behaupten, sie folge dem Ural, andere behaupten, sie folge der Emba
So willkürlich diese Einteilung auch ist, so alt ist sie auch. Die Vorstellung, es gebe einen grundlegenden Unterschied zwischen den Ländern auf beiden Seiten der Ägäis, geht auf die alten Griechen zurück. Eines der frühesten bekannten geografischen Werke, die Periēgēsis (»Beschreibung der Erde«) von Hekataios von Milet, das aus dem frühen 5. Jahrhundert v. Chr. stammt, hatte die Form eines Reiseberichts, der im Uhrzeigersinn um das Mittelmeer herumführte und im ersten Buch »Europa« (von der Straße von Gibraltar bis zum heutigen Griechenland) und im zweiten Buch »Asien« (die moderne Türkei bis Marokko) behandelte. Diese Anordnung zweier Kontinente wurde später zu einem System mit drei Kontinenten, wobei die Grenze zu »Libyen« – Afrika – am Nil verlief.
Die Kerngebiete der antiken griechischen Welt – Attika und der Peloponnes auf der einen Seite der Ägäis und die Westküste Anatoliens auf der anderen Seite – standen im Mittelpunkt dieses Plans. Wenn man ein Grieche des Altertums war, war es wohl am nützlichsten, zu wissen, wo sich ein Ort im Verhältnis zu Griechenland befand.
Das 5. Jahrhundert v. Chr. war auch eine Zeit der Konflikte zwischen Persien, dessen Reich die Länder östlich der Ägäis beherrschte, und den griechischen Stadtstaaten, die größtenteils im Westen lagen und deren Nationalmythos von einem weiteren epochalen Krieg mit einer östlichen Macht namens Troja erzählte. Es ist zumindest möglich, dass auch dies zu der plötzlichen Begeisterung beitrug, Ost und West voneinander zu trennen.
Schon damals gab es jedoch Stimmen, die das für absurd hielten: Noch vor dem Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. beklagte der Historiker und Geograf Herodot schriftlich, dass er keine Ahnung habe, wer die Welt in drei Teile geteilt oder ihnen Namen gegeben habe, aber dass alle sehr unsicher darüber zu sein schienen, wo die Grenzen verliefen. Es war vielleicht kein Zufall, dass er aus Halikarnassos stammte – dem heutigen Bodrum in der Türkei –, einer griechischen Stadt auf der »asiatischen« Seite der Ägäis, deren Anführer auf der persischen Seite des Krieges gekämpft hatten.
Die nächsten 1000 Jahre wurden von Imperien dominiert – makedonischen und römischen –, die Teile Europas, Asiens und Afrikas gleichermaßen eroberten. Im 2. Jahrhundert n. Chr. erstreckte sich ein einziger Staat von Carlisle bis Kuwait, und obwohl es Provinzen mit den Namen Afrika und Asien gab, deckten diese nur winzige Teile der Kontinente ab, denen wir diese Namen zuordnen (ein Abschnitt der Mittelmeerküste bzw. Westanatolien). Es gab keinen besonderen Grund, zu erwarten, dass ein willkürliches geografisches System, das auf der griechischen Weltanschauung um 500 v. Chr. basierte, Bestand haben würde.
Offensichtlich hat es das aber. Vielleicht lag es am griechischen Einfluss auf die römische Vorstellungswelt, ganz zu schweigen von der griechischen Vorherrschaft im östlichen Reich, das fast 1000 Jahre überdauerte, nachdem der westliche Teil zerfallen war. Oder vielleicht lag es an der Religion. Im 2. Jahrhundert n. Chr. unterschied sich Griechenland nicht stärker von Syrien als sich Griechenland von Frankreich unterschied. Einige Jahrhunderte später jedoch kam es zu den Eroberungen seitens des Islams, und die Welt östlich und südlich von Griechenland unterschied sich stark von den christlichen Ländern im Nordwesten. Nur wenige in diesen Ländern mögen sich als Europäer betrachtet haben, aber sie waren sich sehr im Klaren darüber, Teil der Christenheit zu sein.
Im 9. Jahrhundert bezeichnete ein Dichter Kaiser Karl den Großen, einen fränkischen Herrscher, dem wir in einigen Kapiteln noch begegnen werden, als Pater Europae, den Vater Europas, in dem Versuch, eine schmeichelhafte Bezeichnung für einen Mann zu finden, der über ein so riesiges Territorium herrschte. Im Lauf der Jahrhunderte, als das Wissen des klassischen Altertums in aller Munde war, die christlichen Mächte sich bemühten, Spanien zurückzuerobern, und das Osmanische Reich immer näher an das Herz Europas rückte, muss eine Weltanschauung, die eine natürliche Trennung zwischen gesitteten, europäischen, christlichen Menschen und finsteren Asiaten mit ihren seltsamen Göttern nahelegte, recht ansprechend gewesen sein.
Dies war eine ganz andere Herangehensweise als in der Antike. Die Griechen des klassischen Zeitalters hatten möglicherweise politische und geografische Gründe für ihre Dreiteilung der ihnen bekannten Welt. Doch sie wussten auch so wenig über das, was im hohen Norden lag, dass sie vielleicht tatsächlich glaubten, es gäbe eine prinzipielle physische Trennung zwischen Europa und Asien. Die Europäer der Renaissancewussten jedoch, dass Europa und Asien eine einzige Landmasse bildeten. Diese politisch konstruierte und etwas künstliche Teilung ist bei Weitem nicht der einzige Grund dafür, dass Russland, das sich über die Grenze erstreckte, sich in den folgenden Jahrhunderten die Frage stellte, ob seine Bevölkerung nun echte Europäer seien oder nicht, aber hilfreich war sie mit Sicherheit nicht.
Es ist in den Jahrhunderten seither nicht weniger absurd geworden. Im Zeitalter der Imperien änderte sich der Konsens über den Verlauf der Grenze durch Russland mehrfach – zweifellos ein Zeichen dafür, dass es keine fundamentale Wahrheit zu entdecken gab. Mitte des 20. Jahrhunderts setzte sich die Theorie der Plattentektonik durch – die Vorstellung, dass die Erdoberfläche in Platten unterteilt ist, die sich über Millionen von Jahren aneinander stoßen und verschieben. Wissenschaftler entdeckten, dass die meisten Kontinente (Afrika, Antarktis, Australien sowie Nord- und Südamerika) ihre eigene Platte hatten. Europa war jedoch nur ein westlicher Außenposten der eurasischen Platte. Wenn Teile Asiens überhaupt als separate Landmassen betrachtet werden konnten, dann sind es nach diesem Modell die Arabische Halbinsel und der indische Subkontinent.
Diese Orte galten offiziell jedoch nie als Kontinente: In einer Welt, die größtenteils von europäischen Menschen gestaltet wurde, hat sich die Idee von Europa als Kontinent erhalten, obwohl sie offensichtlich erfunden ist. Und die griechischsprachige Nation Zypern wird immer noch als europäisches Land betrachtet, trotz ihres abtrünnigen türkischsprachigen Nordens und der Tatsache, dass sie näher an der asiatischen Landmasse liegt.
Ich habe vorhin gesagt, dass das antike Griechenland sich über beide Seiten der angenommenen Grenze erstreckte. Was ich nicht erwähnt habe, ist, dass das moderne Griechenland dies auch tat. Noch im 20. Jahrhundert gab es in Kleinasien, Ostthrakien und anderen überwiegend islamischen Regionen rund 1,2 Millionen griechisch-orthodoxe Christen sowie 400 000 Muslime im heutigen Griechenland. Im Jahr 1923 wurden beide Gemeinschaften zur Umsiedlung gezwungen: ein Akt der gesetzlich verankerten ethnischen Säuberung, die mehr als 1 Million Flüchtlinge hervorbrachte. Es hatte nie wirklich eine schlichte Trennung zwischen einem christlichen Europa und einer islamischen asiatischen Welt im Osten gegeben – aber die Wirren nach dem Ersten Weltkrieg boten einen Vorwand, um den Versuch zu unternehmen, eine solche zu schaffen.
Istanbul ist übrigens längst nicht die einzige Stadt, die an der Grenze zwischen Europa und Asien liegt. Wenn Sie sich für eine Reise entscheiden, werden Sie unter anderem in Orenburg und Magnitogorsk in Russland sowie in Oral in Kasachstan Halt machen, die alle am Fluss Ural liegen. In jeder dieser Städte können Sie – anders als in Istanbul – einfach von Europa nach Asien gehen und auch wieder zurück. Auch wenn es nicht als Vorwand für ethnische Säuberungen benutzt wird, ist das Ganze einfach albern.
Der römische Limes und die Macht der Peripherie
Das zentrifugale Reich
Severus Alexander muss geahnt haben, dass er sich an hohen Erwartungen messen lassen musste. Einer seiner beiden Namen stammte vom Ehemann seiner Großtante, Septimius Severus, der die Dynastie gegründet hatte, die um die Wende zum 3. Jahrhundert in Rom an der Macht war; der andere war der des größten Eroberers, den die Welt je gekannt hatte, des Mannes, der ein halbes Jahrtausend zuvor Länder von Griechenland bis Indien unter die Kontrolle des winzigen Makedonien gebracht hatte. Schlimmer noch, Severus Alexander bestieg den Kaiserthron im Alter von nur 13 Jahren – ein schwieriges Alter für jeden Jungen, auch ohne ein zerrissenes und schwächelndes Reich verwalten zu müssen – und in dem vollen Bewusstsein dessen, dass sein Cousin ermordet worden war, um ihm den Weg zu ebnen.
Es lief nicht besonders gut. Der junge Alexander wurde weithin als Aushängeschild für die wahren Machthaber in Rom, seine Mutter und Großmutter, angesehen, und die Römer, die nicht gerade für ihren Feminismus bekannt waren, hielten so etwas für ungebührlich.3 Berichten zufolge wurde die Stadt so gesetzlos, dass die Prätorianergarde, die persönliche Leibwache des Kaisers, ihren eigenen Anführer direkt vor seinen Augen ermordete, während einer der Konsuln, der Historiker Cassius Dio, im Jahr 229 n. Chr. einen Großteil seines Amtsjahres außerhalb der Stadt verbrachte, um einem ähnlichen Schicksal zu entgehen.
Alexanders größtes Problem war jedoch die Außenpolitik. Trotz einigem Murren über ihren jungenhaften und unwürdigen Kaiser stoppte die römische Armee eine Invasion der Perser in Mesopotamien, jedenfalls mehr oder weniger. (Die römische Gegenoffensive war eine Katastrophe, insbesondere der Teil, den Alexander persönlich befehligte; dennoch entschieden die Perser, dass es den Aufwand nicht wert war und kehrten nach Hause zurück.) Doch dann, noch bevor jemand wieder richtig Luft holen konnte, begannen Barbarenstämme, die Rhein