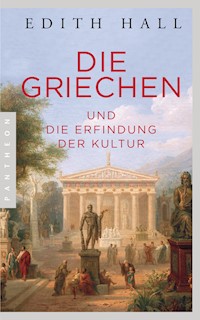
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von der Kraft und Faszination der griechischen Antike
Sie waren die Erfinder der Demokratie, Begründer der Philosophie, Schöpfer unsterblicher Mythen – doch was genau war das Erfolgsgeheimnis der antiken Griechen und was verbindet uns mit ihnen? Edith Hall, Professorin am Londoner King’s College und eine der weltweit profiliertesten Altertumsforscherinnen, untersucht zehn Charaktereigenschaften, die allen griechischen Völkern gemeinsam waren. Über die Jahrtausende hinweg lernen wir so die wissbegierigen, humorvollen wie kompetitiven Menschen kennen, die als Seefahrer in neue Gebiete vorstießen, sich im Wettkampf in Olympia oder im Redegefecht maßen. Wir erfahren, was die Griechen dachten und fühlten, über welche Witze sie lachten – und es entsteht eine ebenso farbige wie kurzweilig-moderne Geschichte, die uns den Mythen und Göttern, Helden und Menschen so nahe bringt wie nie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Sie waren die Erfinder der Demokratie, Begründer der Philosophie, Schöpfer unsterblicher Mythen und Dramen – die alten Griechen haben das Fundament unserer Zivilisation gelegt und somit auch unsere moderne Welt geprägt. Doch was genau war das Erfolgsgeheimnis der griechischen Völker, was hat sie – über alle politischen und kulturellen Grenzen hinweg – angetrieben? Und was verbindet uns mit ihnen? Edith Hall, Professorin am Londoner King’s College und eine der weltweit profiliertesten Altertumsforscherinnen, nähert sich dem Phänomen auf ungewöhnliche Weise: Sie beschreibt zehn Charaktereigenschaften, die den unterschiedlichen griechischen Völkern über alle Grenzen hinweg gemeinsam waren, und widmet jeder dieser Eigenschaften ein eigenes Kapitel. So entsteht eine ebenso farbige wie kurzweilige Geschichte von Mythen, Göttern, Helden und Menschen.
Zur Autorin
Edith Hall, geboren 1959, ist Professorin für Altertumswissenschaften am King’s College in London und zugleich Mitgründerin des Archive of Performances of Greek and Roman Drama an der Universität Oxford. Sie verfasste mehrere Bücher zu Themen der griechischen Geschichte und Literatur, u.a. eine Kulturgeschichte von Homers »Odyssee« sowie eine Geschichte der antiken Sklaverei. 2015 erhielt sie die »Erasmus-Medaille« der Academia Europea für herausragende Verdienste um die europäische Kultur und Wissenschaft.
EDITH HALL
DIE GRIECHEN
UND DIE ERFINDUNGDER KULTUR
Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz
Pantheon
Meiner Familie
INHALT
Vorwort
EinführungZehn Eigenschaften der alten Griechen
1 Seefahrende Mykener
2 Die Gründung Griechenlands
3 Frösche und Delphine um den Teich
4 Wissbegierige Ionier
5 Die offene Gesellschaft Athens
6 Die unergründlichen Spartaner
7 Die wetteifernden Makedonier
8 Gottkönige und Bibliotheken
9 Griechischer Verstand und römische Macht
10 Griechische Heiden und Christen
Dank
ANHANG
Zeittafel
Weiterführende Literatur –Eine Auswahl
Bildnachweise
Register
As some grave Tyrian trader, from the sea,
Descried at sunrise an emerging prow
Lifting the cool-hair’d creepers stealthily,
The fringes of a southward-facing brow
Among the Aegean isles;
And saw the merry Grecian coaster come,
Freighted with amber grapes, and Chian wine,
Green, bursting figs, and tunnies steep’d in brine –
And knew the intruders on his ancient home,
The young light-hearted Masters of the waves.
Ein ernster Händler aus Tyros, vom Meere,
Erspähte schon beim Sonnenaufgang, wie ein Bug sich naht,
Der holte leis den tangbewachs’nen Anker ein,
Die Ränder einer Passerelle, die nach Süden wies,
inmitten all den Inseln der Ägäis;
Und sah das muntre, kleine Küstenboot aus Griechenland sich nah’n,
Beladen voll mit gelben Trauben, Wein aus Chios,
Und grünen, prallen Feigen, Thunfisch, eingelegt in Salz,
Er kannte sie, die Eindringlinge in sein altes Reich,
Die jungen, unbeschwerten Herrn der Wogen.
MATTHEW ARNOLD,The Scholar Gypsy (Der weise Zigeuner), V. 231–240
VORWORT
Zwischen 800 und 300 v. Chr. machten Menschen, die Griechisch sprachen, zahlreiche geistige Entdeckungen und hoben die mediterrane Welt auf eine neue Stufe der Zivilisation. Wie sie sich auf diese Weise kontinuierlich selbst weiterbildeten, wurde von den Griechen und Römern der folgenden Jahrhunderte sehr bewundert. Doch begann, wie dieses Buch zeigt, die Geschichte der alten Griechen schon 800 Jahre vor dieser Phase, und sie dauerte anschließend noch mindestens sieben Jahrhunderte lang an. Und als die Texte und Kunstwerke der griechischen Antike in der europäischen Renaissance wiederentdeckt wurden, veränderten sie die Welt ein zweites Mal.
Dieses Phänomen hat man das Griechische Wunder genannt. Es ist viel vom »Ruhm Griechenlands« geschrieben worden, dem »griechischen Genie«, »griechischen Triumph«, von der »griechischen Aufklärung«, dem »griechischen Experiment«, der »griechischen Idee« oder gar dem »griechischen Ideal«. Doch in den letzten zwanzig Jahren wurde die Ausnahmestellung der Griechen zunehmend in Zweifel gezogen. Die Historiker hoben hervor, dass die Griechen letztlich nur eine von vielen ethnischen Gruppen und Sprachgemeinschaften im antiken Mittelmeerraum waren. Lange bevor die Griechen ihren Auftritt hatten, waren mehrere hoch entwickelte Zivilisationen entstanden: die Mesopotamier und Ägypter, die Hattier und Hethiter. Und es waren andere Völker, die den Griechen entscheidende technologische Fortschritte ermöglichten: Von den Phöniziern lernten sie das phonetische Alphabet, von den Lydiern, wie man Münzen prägt und möglicherweise von den Luwiern, wie man kunstvolle kultische Gesänge komponiert. Als die Griechen nach 600 v. Chr. die rationale Philosophie und Wissenschaft erfanden, war es die Expansion des Persischen Reiches, die ihren geistigen Horizont erweiterte.
Seit dem späten 19. Jahrhundert entwickelte sich unser Wissen über die anderen Kulturen des antiken Nahen Ostens rapide. So verstehen wir inzwischen das Denken der Vorläufer und Nachbarn der Griechen weit besser als noch vor der bahnbrechenden Entdeckung des auf Tontafeln eingeritzten Gilgamesch-Epos im Tigristal 1853. Immer mehr Schriften in den Sprachen der Sumerer, Akkadier, Babylonier und Assyrer, die nacheinander die fruchtbaren Ebenen Mesopotamiens beherrschten, werden erschlossen; hethitische Schriften, die man bei Hattusa in der Zentraltürkei fand, wurden genauso entziffert wie die ebenfalls auf Tontafeln eingravierten Texte in der Nähe des nordsyrischen Ugarit. Bislang unbekannte altägyptische Dokumente und deren Interpretationen machen es nötig, etwa die Bedeutung der Nubier für die nordafrikanische Geschichte neu zu bewerten.
Viele dieser interessanten Entdeckungen haben gezeigt, wie viel die Griechen mit ihren Vorläufern und Nachbarn gemein hatten. Detaillierte komparatistische Studien legen nahe, dass das griechische »Wunder« nur Bestandteil eines andauernden interkulturellen Austauschs war. Die Griechen waren erfinderisch, hätten jedoch ohne die Fertigkeiten, Ideen und Praktiken ihrer Nachbarn niemals so enorme Fortschritte gemacht. Inzwischen herrscht Konsens darüber, dass die Griechen ihren nahöstlichen Nachbarn in Mesopotamien, Ägypten, der Levante, Persien und Kleinasien sehr ähnlich waren. Manche Forscher zweifeln sogar an, dass die Griechen überhaupt etwas Neues geschaffen haben – oder ob sie lediglich das gesamte Wissen aller Zivilisationen des östlichen Mittelmeerraums kanalisierten und in den Gebieten verbreiteten, die Alexander der Große eroberte, ehe es an Rom und die Nachwelt weitergegeben wurde. Andere wollen rassistische Motive erkennen und werfen den Althistorikern vor, »älteste tote weiße europäische Männer« zu schaffen (Bernard Knox); manche behaupten sogar, die Altphilologen hätten systematisch die Fakten verzerrt und jene Quellen unterschlagen, die belegen, dass die alten Griechen den semitischen und afrikanischen Völkern mehr verdanken als den indoeuropäischen Traditionen.
Somit wurde die Frage politisch aufgeladen. Kritiker des Kolonialismus und Rassismus neigen dazu, die Sonderstellung der alten Griechen herunterzuspielen. Für diejenigen jedoch, die daran festhalten, dass die Griechen außergewöhnlich, ja sogar überlegen gewesen seien, dient dies vor allem dazu, die grundsätzliche Überlegenheit westlicher Ideale zu dokumentieren und die Kulturen gegeneinander auszuspielen. Mein Problem ist, dass ich mich weder der einen noch der anderen Seite zugehörig fühle. Ich verurteile Kolonialismus und Rassismus und habe selbst zur reaktionären Vereinnahmung des klassischen Erbes geforscht. Aber je länger ich mich mit den alten Griechen und ihrer Kultur beschäftige, desto überzeugter bin ich, dass sie herausragende Eigenschaften besaßen, die man in dieser Fülle kaum anderswo im Mittelmeerraum oder Nahen Osten findet. Nach einer Skizze dieser Eigenschaften in der Einführung nehmen die zehn Kapitel des Buches den Leser mit auf eine chronologische Reise durch wichtige Phasen der griechischen Geschichte. Damit geht zugleich eine geographische Reise einher, denn im Lauf der Zeit verlagerte sich das Zentrum der griechischen Unternehmungen und ihrer Errungenschaften sukzessive von der Halbinsel und den Inseln, die heute die griechische Nation bilden, hin zu bedeutenden Siedlungen in Italien, Asien, Ägypten, Libyen und im Schwarzmeerraum. Doch so verstreut sie auch zeitlich und räumlich waren, die Mehrheit der alten Griechen teilte die meiste Zeit fast alle diese Eigenschaften. In diesem Buch versuche ich zu erklären, welche Eigenschaften ich damit meine.
Jede einzelne dieser griechischen Errungenschaften findet sich auch in der Kultur mindestens eines ihrer Nachbarn. Die Babylonier kannten den Satz des Pythagoras Jahrhunderte vor dem Namengeber. Die Stämme im Kaukasus hatten den Bergbau und die Verhüttung auf ein noch nie dagewesenes Niveau gehoben. Die Hethiter hatten die Technologie der Streitwagen weiterentwickelt und waren hochgebildet: Sie verschriftlichten die geschliffenen und mitreißenden Reden, die an ihrem königlichen Hof bei offiziellen Anlässen gehalten wurden, ebenso wie die ausgefeilten juristischen Plädoyers. Ein Hethiterkönig wurde zu einem Vorläufer der griechischen Historiographen, als er während der Belagerung einer hurritischen Stadt detailliert beschrieb, wie enttäuscht er von der Unfähigkeit einiger seiner Armeeoffiziere war. Die Phönizier waren ebenso bedeutende Seefahrer wie die Griechen. Die Ägypter erzählten der Odyssee ähnliche Geschichten von Seefahrern, die vermisst wurden und nach Abenteuern jenseits der Meere zurückkehrten. In einem archaischen, aramäischen Dialekt Syriens, den man in jüdischen Kultstätten sprach, wurden pointierte Fabeln verfasst, die denen Äsops vergleichbar sind. Architektonische Gestaltung und technisches Wissen gelangten von den Persern nach Griechenland – und zwar über die unzähligen ionischen Handwerker, die in persischen Texten Yauna genannt werden und beim Bau von Persepolis, Susa und Pasargadai halfen. Aber keiner dieser Volksstämme brachte etwas hervor, das sich mit der athenischen Demokratie, mit der Komödie, mit philosophischer Logik oder Aristoteles’ Nikomachischer Ethik messen könnte.
Ich bestreite nicht, dass die Griechen die Errungenschaften anderer antiker Völker weiterverbreiteten. Aber schon diese Vermittlerfunktion kann man als außergewöhnlich bezeichnen, denn dafür sind zahlreiche Begabungen und Fähigkeiten nötig: Sich fremdes technisches Wissen anzueignen erfordert das Geschick, eine glückliche Begegnung oder Fügung als solche zu erkennen, es erfordert ausgezeichnete kommunikative Fertigkeiten und das Talent sich vorzustellen, wie eine Technik, eine Erzählung oder ein Gegenstand an ein anderes sprachliches und kulturelles Umfeld angepasst werden kann. In diesem Sinn agierten auch die Römer erfolgreich, indem sie wesentliche Errungenschaften ihrer eigenen Zivilisation von den Griechen übernahmen, genau wie die Humanisten der Renaissance. Natürlichwaren die Griechen weder von Natur aus noch von ihrer Leistungsfähigkeit her anderen Menschen überlegen, weder physisch noch geistig. Vielmehr wiesen sie selbst häufig darauf hin, wie schwierig Griechen von Nichtgriechen zu unterscheiden seien (ganz zu schweigen freie Menschen von Sklaven), wenn man Kleidung und Schmuck ignorierte sowie alles, was auf deren Kultur hindeuten könnte. Und dennoch: Sie waren das richtige Volk zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um jahrhundertelang den Staffelstab des geistigen Fortschritts zu tragen.
Das vorliegende Buch versucht, die Geschichte der alten Griechen über einen Zeitraum von 2000 Jahren zu erzählen, von etwa 1600 v. Chr. bis 400 n. Chr. Sie lebten in Tausenden kleinen Dörfern und Städten von Spanien bis Indien, vom eiskalten Don am nordöstlichen Ende des Schwarzen Meeres bis zu abgelegenen Nilzuflüssen im afrikanischen Hochland. Sie waren kulturell anpassungsfähig, denn sie verheirateten sich freizügig mit anderen Volksstämmen; sie kannten keine ethnische, biologistisch begründete Ungleichheit, war doch die »Rassentheorie« noch gar nicht erfunden. Sie duldeten und begrüßten sogar die Einfuhr ausländischer Waren. Es war auch nie die Geopolitik, die sie vereinte. Mit Ausnahme des kurzlebigen Makedonischen Reiches im späten 4. Jahrhundert v. Chr. gab es selbst auf dem Gebiet des heutigen Griechenlands bis zum griechischen Unabhängigkeitskrieg am Anfang des 19. Jahrhunderts keinen unabhängigen Staat, in dem Griechisch gesprochen wurde. Was die alten Griechen miteinander verband, war ihre mehrsilbige und wandelbare Sprache, die in ähnlicher Form bis heute existiert, obwohl griechischsprachige Regionen jahrhundertelang von den Römern, Osmanen, Venezianern und anderen besetzt gehalten wurden. Der Fortbestand dieser Sprache wurde durch die Vertrautheit der Griechen mit prägenden Dichtungen gestärkt, insbesondere mit den Werken Homers und Hesiods (Mitte des 8. Jahrhunderts v. Chr.). Den in diesen Epen verehrten Göttern brachten die alten Griechen Opfer dar, wo auch immer sie sich niederließen. Dieses Buch macht sich auf den Weg, eine einzige Frage zu beantworten: Was genau hatten die alten Griechen, die in Hunderten unterschiedlicher Gemeinschaften entlang unzähliger Küsten und auf zahlreiche Inseln verstreut lebten, über ihre kulturelle Aufnahmefähigkeit, ihre Sprache, die Mythen und den Polytheismus hinaus eigentlich noch miteinander gemein?
EinführungZEHN EIGENSCHAFTEN DER ALTEN GRIECHEN
Die alten Griechen teilten während der meisten Zeit ihrer Geschichte zehn Eigenschaften miteinander. Davon hängen die ersten vier, dass sie nämlich Seefahrer, misstrauisch gegenüber jeder Autorität, individualistisch und wissbegierig waren, eng zusammen und sind zugleich die wichtigsten. Darüber hinaus waren sie stets für neue Ideen offen, humorvoll, liebten Wettkämpfe; sie bewunderten herausragende Fähigkeiten bei talentierten Menschen, waren außergewöhnlich redegewandt und geradezu vergnügungssüchtig. Aber mit diesen zehn übergreifenden Eigenschaften stoßen wir auf ein Problem in der heutigen Haltung gegenüber Darstellungen der Vergangenheit. Manche Forscher tendieren dazu, die herausragende Rolle Einzelner für den Lauf der Geschichte herunterzuspielen, und betonen stattdessen wirtschaftliche, soziale oder politische Strömungen, die sich in der ganzen Bevölkerung oder sozialen Schicht äußerten. Diese Art der Geschichtsschreibung geht davon aus, dass Geschichte so einfach ist, dass man sie ohne die Leistung Einzelner und ohne die allgemeinen Zusammenhänge versteht, und sie fragt auch nicht danach, wie die beiden miteinander zusammenwirken. Ich will an einem Beispiel erklären, inwiefern mein Ansatz davon abweicht. Wenn etwa Aristoteles nicht in eine Arztfamilie, die in der Gunst der makedonischen Monarchen stand, geboren worden wäre, deren Macht sich auf den neuen Reichtum aus Goldminen stützte, dann hätte er womöglich nie die Muße, die finanziellen Mittel, Reisen und Erziehung genossen, die zu seiner intellektuellen Bildung beitrugen. Er wäre sicherlich nicht Männern wie Alexander dem Großen begegnet, der mit seiner militärischen Macht die Welt verändern konnte. Aber das heißt noch lange nicht, dass die intellektuellen Errungenschaften Aristoteles’ deswegen weniger beeindruckend sind.
Ein roter Faden zieht sich durch das ganze Buch: der Zusammenhang zwischen dem Anteil, den die sozialen und historischen Kontexte, in die herausragende Griechen wie Perikles und Leonidas, Ptolemaios I. und Plutarch geboren wurden, an ihrer Entwicklung hatten, und dem Anteil der zehn Eigenschaften der griechischen Mentalität, die sie in vieler Hinsicht als ethnische Gruppe definierten. Der soziale und historische Hintergrund, vor dem die Geschichte der alten Griechen hier geschildert wird, ist in zehn Zeiträume unterteilt: die mykenische Welt von 1600 bis etwa 1200 v. Chr. (Kapitel 1); das Aufkommen der griechischen Identität zwischen dem 10. und dem 8. Jahrhundert (Kapitel 2); die Ära der Kolonisierung und Tyrannen im 7. und 6. Jahrhundert (Kapitel 3); die frühen Wissenschaftler in Ionien und Italien im 6. und 5. Jahrhundert (Kapitel 4); das demokratische Athen im 5. (Kapitel 5), Sparta im frühen 4. und Makedonien im späten 4. Jahrhundert (Kapitel 6 und 7); die hellenistischen Königreiche vom 3. bis 1. Jahrhundert (Kapitel 8); Griechen unter dem Römischen Reich (Kapitel 9) und die Beziehung zwischen griechischen Heiden und frühen Christen, die Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. mit dem Triumph des neuen monotheistischen Glaubens endete (Kapitel 10). Darüber hinaus wird in jedem Kapitel, angefangen bei den Mykenern und ihrem seefahrerischen Geschick, jenem Aspekt der griechischen Eigenart unter den zehn genannten Eigenschaften besonderes Augenmerk gewidmet, den ich jeweils für äußerst auffällig halte. Das heißt keineswegs, dass andere antike Kulturen im Mittelmeerraum nicht ebenfalls einige der Eigenschaften hatten, die zusammengenommen in meinen Augen die Griechen definierten. Beispielsweise wird hier in der Einleitung ausführlich erörtert, wie viel die griechische Kultur den schreibkundigen, phönizischen Händlern verdankte. Aber so gut wie alle zehn »griechischen« Eigenschaften waren, mehr oder weniger ausgeprägt, bei der Mehrheit der Griechen während der meisten Zeit ihrer Geschichte vorhanden.
Die alten Griechen waren begeisterte Seefahrer. 490 v. Chr. wurde die wichtige griechische Stadt Eretria von den eindringenden Persern niedergebrannt und die ganze Bevölkerung in die Gefangenschaft entführt, aus der sie nie zurückkehren sollte. Der persische König ließ die Gefangenen tief im Landesinneren, zwischen Babylon und Susa, eine Kolonie gründen. Ein Gedicht, das dem Philosophen Platon zugeschrieben wird, stellt sich ihre kollektive Grabsteininschrift im kleinasiatischen Exil vor:
Ach, wir verließen dereinst der Ägäis donnernde WogeUnd bei Ekbatana nun liegen wir mitten im Land.Schöne eretrische Heimat, fahr wohl! Fahr wohl auch EuboiasNachbar Athen! Fahr wohl, du unsere Liebe – o Meer!
Die zerstörte Heimat der Eretrier war eine Hafenstadt gewesen. Doch die alten Griechen siedelten fast nie mehr als vierzig Kilometer – einen guten Tagesmarsch – vom Meer entfernt. Die ersten Griechen lebten in Hunderten kleinen Gemeinschaften entlang der Küste, die (politisch) autonom, auf Unabhängigkeit bedacht waren und ein Leben führten, das von der Landschaft bestimmt wurde, die sie umgab. Der größte Teil des fruchtbaren Landes auf der griechischen Halbinsel und den Inseln ist durch Berge oder Meer oder beides isoliert. Das heutige Griechenland ist nur knapp 132 000 Quadratkilometer groß, also ungefähr so groß wie Bayern, Baden-Württemberg und Brandenburg zusammen, und viel kleiner als etwa Italien. Aber Griechenland umfasst sage und schreibe 26 Regionen, die sich auf über tausend Meter Meereshöhe erheben, so dass Überlandreisen beschwerlich sind. Außerdem haben die unzähligen Landzungen, Einbuchtungen und Inseln zur Folge, dass das Verhältnis der Küstenlänge zur Landmasse größer als in jedem anderen Land der Welt ist.
Die Griechen fühlten sich eingesperrt, wenn sie im Landesinneren lebten, und reisten Hunderte Kilometer auf der Suche nach Orten für eine Stadtgründung, die leichten Zugang zum Meer bot. Ihre Gemeinschaften waren deshalb an unzähligen Küsten des Mittelmeers, des Schwarzen Meeres und deren Inseln aufgereiht. Sie zählten zu den Völkern der Erde, die die Nähe der Küste am stärksten suchten. Am liebsten bewegten sie sich per Schiff fort, doch ohne sich allzu weit von der Küste zu entfernen. Wie Platon einmal sagte, lebten sie gerne »wie Ameisen oder Frösche um einen Teich«. Sie waren kulturelle Amphibien. Die Vorstellung eines Geschöpfs, das sowohl auf dem Land als auch im Wasser zu Hause ist, wurde in der griechischen Mythologie auf die tatsächlichen Meeresbewohner übertragen. Die Griechen stellten sich diese für gewöhnlich als halb Mensch, halb Tier vor: Glaukos, einst ein Fischer, aß ein Wunderkraut und wurde zum ersten Meermann, halb Mensch, halb Fisch mit blaugrüner Haut.
Ende des 13. Jahrhunderts v. Chr. ließ der ägyptische König Merenptah am Tempelkomplex von Karnak eine Inschrift anbringen, zur Feier seines Sieges über eine Gruppe »Seevölker«, wie es dort heißt, zu denen so gut wie sicher auch Griechen zählten. Die Seefahrt war zudem sehr eng mit dem eigenen Identitätsgefühl der alten Griechen verknüpft. In der Ilias, dem Epos, das wohl im 8. Jahrhundert v. Chr. entstand, präsentiert Homer die älteste Schilderung der Menschen, die die alten Griechen waren. Es ist eine Liste der Gemeinschaften, die sich Mitte des 8. Jahrhunderts als vereint betrachteten, weil sie Gedichte auf Griechisch lesen konnten und vor langer Zeit gemeinsam in der Schlacht um Troja gekämpft hatten. Dies bildete fortan für mindestens zwölf Jahrhunderte den Kern der griechischen Identität. Aber die Aufzählung ist nicht als Liste geographischer Orte oder Stämme oder Sippen strukturiert. Sie hat die Form eines Schiffskatalogs.
Das Gefühl der Griechen, dass sie die Herren der See seien, äußert sich auch in ihrer Haltung zum Schwimmen. Die Athener hielten es für die Pflicht jeden Vaters, seinen Söhnen das Lesen und Schwimmen beizubringen; die Redensart, mit der man einen völlig ungebildeten Menschen bezeichnete, lautete: »Er kann weder lesen noch schwimmen.« Sowohl die Assyrer als auch die Hebräer beschrieben, wie ihre Feinde ertranken, doch die Überzeugung der Griechen, dass sie die besten Schwimmer der Welt seien, war ein zentraler Bestandteil ihrer kollektiven Identität. Sie waren der Meinung, das sei in den Perserkriegen im 5. Jahrhundert v. Chr. bewiesen worden, als viele Feinde ertrunken waren; die Griechen feierten auch die bemerkenswerte Heldentat zweier griechischer Taucher – Scyllias und seine Tochter Hydne –, die unter Wasser die feindlichen Schiffe sabotiert hatten. Die Griechen hatten die Kunst des Tauchens so weit entwickelt, dass sie relativ lange unter Wasser bleiben konnten, und zwar mithilfe umgedrehter Luftbehälter, die man unter Wasser gedrückt hatte.
Im Juni 1968 wurde die wunderschöne Darstellung eines Tauchers in einem Grab des frühen 5. Jahrhunderts entdeckt, das bei Poseidonia (Paestum) in jenem Teil Süditaliens ausgegraben wurde, den die Griechen besiedelt hatten. Der Taucher war auf die Unterseite des Deckels eines rechteckigen Grabmals gezeichnet. Auf die vier Seiten waren nicht minder schöne Szenen von Männern gemalt, die sich bei einem Gastmahl auf Speiseliegen, sogenannten Klinen, vergnügen. Der Begrabene hatte das Glück, umgeben von seinen Trinkgefährten für alle Zeit auf einen Taucher zu blicken, der in der Luft schwebt zwischen einem Sprungbrett aus Stein und dem einladenden türkisfarbenen Wasser, in das die vorgestreckten Arme jeden Moment eintauchen konnten.
Ist für manche der Kopfsprung erotisch konnotiert, so ist die Szene für andere eine Metapher für den Tod, für den Sprung aus der bekannten in die unbekannte Welt, von einem Element ins andere, eventuell mit okkulten Anspielungen in Verbindung mit dem Orphismus oder Pythagoreismus. Doch der Maler machte sich die Mühe, auf dem Kinn des Tauchers einen leichten Bartansatz in einer speziell verdünnten Farbe anzudeuten. Der Taucher ist berührend jung. Sah er dem Verstorbenen überhaupt ähnlich? War er wirklich einfach nur für seine Tauchkünste berühmt?
Die Helden der griechischen Mythologie, welche die Jungen bewundern sollten, waren hervorragende Taucher und Schwimmer. Theseus, Poseidons Sohn und der Sage nach Begründer der athenischen Demokratie, zeigte auf der Fahrt nach Kreta, was in ihm steckte, noch bevor er dem Minotaurus begegnete. Er nahm die Herausforderung an, in die Tiefe zu tauchen und den Ring des Minos aus dem Palast seines Vaters zu bergen. Aber selbst die Heldentat des Theseus wurde noch von der Strecke übertroffen, die Odysseus nach der Zerstörung seines Floßes schwimmend zurücklegte. Mit reiner Muskelkraft trotzte er der Brandung, die gegen die Küste Scherias rollte, und hielt sich von der Küste fern, bis er einen Landeplatz frei von Felsen und stürmischen Winden entdeckte.
So überrascht es nicht, dass die Griechen für so gut wie jede Tätigkeit Metaphern verwandten, die mit dem Meer, mit Schiffen und Segeln zu tun hatten. In der Ilias heißt es, das griechische Heer ziehe in die Schlacht, »wie sich die Meeresflut am widerhallenden Strande Woge für Woge erhebt, getrieben vom Wehen des Westwinds«. Der Anblick des Odysseus ist für seine einsame Frau Penelope, die ihn jahrzehntelang nicht gesehen hatte, wie das erste Erblicken von Land für einen Schiffbrüchigen. Die Meeresküste war jedoch auch ein Ort, wo griechische Helden gerne nachdachten, weshalb es sich vermutlich nicht vermeiden ließ, dass bei der Beschreibung von Denkprozessen häufig maritime Bilder verwendet wurden. So dachte Nestor, der weise, alte Ratgeber in der Ilias, wenn er mit einem strategischen Problem auf dem Schlachtfeld konfrontiert wurde, eingehend über die Alternativen nach, »so wie das Meer, das große, sich regt in dumpfem Gewoge, wenn es der pfeifenden Winde reißende Bahnen vorausahnt, und sich nicht voranwälzt, weder hierin noch dorthin, ehe nicht ein entschiedener Wind von Zeus herabfährt«. Mit einer internationalen Krise konfrontiert sagt der König in einer Tragödie des Aischylos, er müsse darüber tief nachdenken, »gleich einem Taucher fluthinab versenken sich«. Ein Traktat über Philosophie zu lesen kam einer Reise gleich: Als der kynische Philosoph Diogenes an das Ende eines langen und unverständlichen Buches gelangte, sagte er mit sarkastischer Erleichterung: »Ich sehe Land!«
Schon die früheste griechische Literatur aus dem 8. Jahrhundert v. Chr. behandelt ethische Fragen wie Schuld und Verantwortung auf einem außerordentlich hohen, protophilosophischen und sogar politisierten Niveau. Die zweite herausragende Eigenschaft der alten Griechen, die uns wiederholt begegnen wird, ist ihr Misstrauen gegenüber jeder Autorität, das sich in ihrem hoch entwickelten politischen Gespür äußerte. Im zweiten Kapitel »Die Gründung Griechenlands« wird diese Eigenschaft eingehend erörtert. In der Ilias wird das Recht einer Einzelperson oder einer Elitegruppe, die Handlungen der ganzen Gemeinschaft zu bestimmen, von Mitgliedern des griechischen Heeres vor Troja mehrmals infrage gestellt. Als der griechische Soldat Thersites, der kein König ist, seine Landsleute zur Heimkehr überreden möchte, erfährt der Leser, dass er seine gewohnte Taktik anwendet, stets »mit den Königen grob und ungehörig zu hadern«. Er versucht, ihren Führer vor den anderen lächerlich zu machen. Doch Odysseus überschüttet geschickt Thersites mit Hohn und Spott und bringt so das Heer dazu, über den Lästerer zu lachen statt über Agamemnon, auf den Thersites eigentlich zielte. Auch wenn der Aufstand des Thersites scheitert, schärft schon die Erwähnung dieser Kritik an den Privilegien Agamemnons in der Ilias das politische Bewusstsein des Publikums.
Anführer werden von griechischen Autoren unablässig kritisch geprüft und in der Regel als zu leicht befunden. Beinahe hätte in der Odyssee auf der Insel Kirkes die ganze Mannschaft gegen Odysseus gemeutert. Er hatte einen Spähtrupp aus 22 Mann unter der Führung von Eurylochos ausgesandt, der als einziger zurückkehrte und berichtete, alle anderen seien in Schweine verwandelt worden. Eurylochos rät vernünftigerweise der übrigen Besatzung dringend davon ab, selbst ein so großes Risiko einzugehen, und macht Odysseus schwere Vorwürfe. Selbst die Spartaner, ihrerseits keine Demokraten, waren skeptisch gegenüber Herrschern, die sich allzu sehr aufspielten. Als zwei Spartaner namens Sperthias und Bulis als Gesandte beim persischen König waren, dessen Hof streng hierarchisch war und nach einem raffinierten Protokoll geführt wurde, versuchten die dortigen Hofbeamten, die Griechen zum obligatorischen Kniefall (Proskynese) zu bewegen. Die Spartaner lehnten dies kategorisch ab und erklärten, dass Griechen lediglich Götterbildern eine derartige Ehrerbietung erweisen würden und dass sie im Übrigen nicht deshalb gekommen seien.
Der zweifellos »widerspenstige« Zug im griechischen Charakter wirft die Frage auf, ob diese Haltung auch ihre Frauen teilten. In den klassischen Demokratien, wo die rebellische Tendenz verfassungsmäßig verankert wurde, spricht manches für diese Anschauung. Laut Thukydides stiegen die Frauen demokratisch gesinnter Familien während des Aufstands in Kerkyra (Korfu) auf die Dächer ihrer Häuser, schlossen sich dem Kampf an und schleuderten Ziegel auf die Köpfe ihrer oligarchischen Gegner hinab. Die Reden, die aus antiken Gerichtsverfahren erhalten sind, belegen ebenfalls, dass Frauen, obwohl sie erschreckend wenig Rechte hatten, entschlossen und verschlagen vorgingen, um ihren Einfluss zu vergrößern. Griechische Männer hätten sich vielleicht gewünscht, dass ihre Frauen fügsam und zurückhaltend wären. Doch die Intensität und Häufigkeit, mit der sie dieses Ideal der Weiblichkeit verkündeten, lässt darauf schließen, dass sich ihre Frauen nicht immer daran hielten.
Wie die Griechen allerdings ihr Misstrauen gegen jede Autorität mit der so gut wie allgemeinen Akzeptanz der Sklaverei vereinbarten, lässt sich nicht so einfach erklären. Aber womöglich liegt es an eben dieser paradoxen Verknüpfung zwischen dem griechischen Trachten nach Unabhängigkeit und ihrem Besitz von Sklaven, dass sie die Freiheit des Einzelnen so hoch priesen. Das griechische Wort für Freiheit eleutheria ist das Gegenteil von Sklaverei. Es bedeutete sowohl kollektive Freiheit von der Herrschaft durch andere, etwa die Perser, aber auch individuelle Freiheit. Selbst die ärmsten Bürger der griechischen Gemeinwesen besaßen als freie Männer (eleutheroi) kostbare Rechte, die sie verlieren würden, wenn man sie versklavte. Außerdem war die Angst vor Sklaverei in der Antike allgegenwärtig; der älteste erhaltene Privatbrief eines Griechen ist die verzweifelte Bitte eines Vaters, der in Kürze versklavt und enteignet werden sollte, an seinen Sohn Protagoras. Er wurde von einem Mann, der im frühen 5. Jahrhundert v. Chr. am nördlichen Schwarzen Meer wohnte, auf eine Bleiplatte geschrieben. Unwillkürlich fragt man sich, ob eine Gesellschaft, die nicht auf dem Besitz von Sklaven gründete, jemals eine so genaue Festlegung der individuellen Freiheit hätte hervorbringen können.
Das Konzept der individuellen Freiheit liegt der dritten Eigenschaft der alten Griechen zugrunde, die maßgeblich an ihrem intellektuellen Fortschritt beteiligt war: ein ausgeprägter Sinn für die Unabhängigkeit des Einzelnen, Stolz auf ihre jeweilige Persönlichkeit und Individualität – Eigenschaften, die in Kapitel 3 im Zusammenhang mit dem Zeitalter der Kolonisierung und der Ablösung von Monarchien durch Tyrannen erörtert werden. In einem Traktat mit dem Titel Über Luft, Wasser und Plätze deutete der Heilkundler Hippokrates an, dass die körperlichen Abweichungen unter Individuen innerhalb Europas (insbesondere Griechenlands), im Gegensatz zu Asien, mit den größeren klimatischen und landschaftlichen Extremen zusammenhingen. Laut Hippokrates brächten diese Extreme schroffe Individualisten hervor, mit einer physischen wie psychischen Ausdauer und mit der Bereitschaft, für den eigenen Vorteil Risiken einzugehen, aber nicht im Namen eines anderen, dazu einen unabhängigen Geist und Intoleranz gegenüber Königen.
Hesiods Theogonie, oder Geburt der Götter, die wohl älteste erhaltene griechische Dichtung aus dem 8. oder 7. Jahrhundert, beginnt im Griechischen mit dem Possessivpronomen der ersten Person Plural: »Lasst uns die Feier anstimmen«. Allerdings wird der Leser schon bald mit Hesiod namentlich bekannt gemacht, den die Musen »schön zu singen lehrten, als er seine Schafe unter dem gottvollen Helikon hütete«. Schon einen Vers später wird Hesiod wiederum durch die erste Person Singular ersetzt: »Was diese Göttinnen mir jedoch als Erstes sagten«. Die Lieder der Lyriker des 7. und 6. Jahrhunderts schwelgen vor Namen, Personen und der Subjektivität ihrer Verfasser. Der Krieger Archilochos macht aus seinen persönlichen Präferenzen für einen militärischen Führer ein Gedicht: »Ich mag nicht den großen Feldherrn, wenn er gestelzt daherkommt, affektiert und mit seiner Lockenpracht angibt und glatt rasiert ist. Für mich mag er klein gewachsen sein, krumme Beine haben, wenn er sicher auf den Füßen steht und ein Herz voller Mut hat.« Sappho wiederum teilt uns ihren Namen mit, erzählt, wie sie sich physisch fühlt, wenn sie ihren Geliebten beobachtet, und dass sie eine begehrte Tochter namens Kleïs hat. Das selbstbewusste Theorisieren der persönlichen »Ich«-Stimme wird in den Dialogen Platons sowie durch die griechische Philosophie weiterentwickelt, die zunehmend Einzelpersonen anspornt, ihr eigenes Ich als moralische Kraft zu entfalten. Daraus gingen im Laufe der Zeit die ersten erhaltenen Beispiele für Individuen hervor, die durch ihre Schriften in den Briefen des Paulus und den Selbstbetrachtungen des stoischen Kaisers Mark Aurel (genau genommen: An sich selbst) erschaffen und bewahrt wurden.
Diese beiden Imperative, zum einen Anführer zu kritisieren, aber gleichzeitig mächtige Individuen zu feiern, widersprachen sich zuweilen. Die Spannung zwischen ihnen taucht in einer weiteren, eindrucksvollen Meeresmetahpher auf, das Sokrates, der Begründer der westlichen Philosophie, verwendete, wie er in den Schriften Platons dargestellt wurde. Auch wenn er die Metapher nicht selbst erfand, so legt Platon Sokrates den berühmtesten Fall einer Analogie des Staates als Schiff in den Mund. Soll es nicht zur Meuterei kommen, braucht ein Schiff einen Kapitän, der es steuert (das englische Verb to govern hat den gleichen etymologischen Stamm wie das griechische Wort für das Steuern eines Schiffes kubernan), aber dieser muss auf mehreren Wissensgebieten über große Kompetenz verfügen. Wenn sich die Griechen Zeus als Herrscher der Welt vor Augen riefen, dann stellten sie sich ihn als den »Lenker« des Olymps vor, so wie er bei Homer einmal beschrieben wird, wo er »droben am Steuer sitzt«, als sei der Olymp ein Schiff. Nicht allein die politische Theorie zog Analogien aus der Schifffahrt förmlich an, sondern auch die Kosmologie und Eschatologie. Die Griechen stellten sich das ganze Universum als gewaltigen Dreiruderer vor. Auf dem Höhepunkt der Politeia erzählt Sokrates die Geschichte von Êr, der den Ort besucht hatte, an den die toten Seelen kommen, ehe sie auf wundersame Weise ins Leben zurückkehren. Êr beschrieb die Zusammensetzung des Universums wie folgt: Es werde von einem geraden Lichtband zusammengehalten, das sich über den ganzen Himmel und die Erde erstrecke und sie miteinander verbinde, »denn dieses Licht sei das Band des Himmels, welches wie die Streben an den großen Schiffen den ganzen Umfang zusammenhält«.
Die Wissbegierde der alten Griechen – ihre vierte Eigenschaft, die gemeinsam mit den ersten Wissenschaftlern und Philosophen in Kapitel 4 erörtert wird – war eng mit ihrer seefahrerischen Erfahrung verknüpft. Das Segel auf einem Schiff steht nicht allein für das Verständnis des Verhaltens einer Naturgewalt (»reine« Wissenschaft), sondern für dessen praktische Anwendung (»angewandte« Wissenschaft). Das Segel ist das früheste menschliche Instrument, das eine nichttierische, in der Natur anzutreffende elementare Kraft zügelt, um Energie zu gewinnen. Und das blieb es auch – bis im 3. Jahrhundert v. Chr. die Wassermühle erfunden wurde, so gut wie sicher durch einen Griechen. Die Energie, mit der man ein Schiff antreiben konnte, regte die Griechen zu der Vorstellung an, sie sei lebendig, ein großes Tier, auf dem sie ritten und von dem aus sie einen privilegierten Blick auf die Küstenlinie bekamen, die an ihnen vorübersauste, sowie auf die Städte am Meeresufer. Die Schiffe der alten Griechen bekamen alle ein Auge oder Augen, ein Brauch, der bis in die späte Bronzezeit zurückreichte. Im 6. Jahrhundert zeigen attische schwarzfigurige Vasen häufig ein Kriegsschiff, ausgestattet mit einem Rammsporn in der Gestalt eines wilden Widders. Auf diesen Zeichnungen ist das Auge des Schiffes das Auge eines heranpreschenden wilden Tieres, das die Wellen wie das Unterholz eines Waldes durchpflügt, um den Gegner mit seinen Hörnern zu treffen. Auf anderen Vasenzeichnungen sind jedoch Schiffe zu sehen, die zwei große, in den Bann ziehende Augen haben, eines auf jeder Seite des Bugs, knapp über der Wasserlinie. Das Schiff ist lebendig, beobachtend und wachsam und beschafft sich Informationen sowohl aus der Welt unter wie auch über dem Wasser, während es in Richtung Horizont gleitet.
Doch die Griechen waren weder die ersten Seefahrer im Mittelmeer noch die geschicktesten. Sie haben mit Sicherheit die großen Pferdeköpfe gesehen, welche den Bug der Schiffe schmückten, die ihre östlichen und südlichen Rivalen, die Kanaaniter, fuhren. Das veranlasste die Griechen, ihren eigenen Meeresgott Poseidon mit Pferden in Verbindung zu bringen. Die Phönizier hatten lange vor ihnen die Handelswege des Mittelmeers abgesteckt. Von der Levante aus hatten sie Hafensiedlungen angelegt, um die Routen zu sichern, auf denen große Frachten von Metall mithilfe langsamer, doch stabiler Handelsschiffe mit rundem Rumpf verschifft wurden. So konnten sie in Zypern, Karthago, Sardinien und im Westen sogar bis an der spanischen Atlantikküste anlegen. Sie waren ständig auf der Suche nach neuem Holz, mit dem sie ihre Flotten instand hielten, und wurden zu unerschrockenen Entdeckern und Seefahrern, auch über lange Strecken hinweg. Um 600 v. Chr. haben die Phönizier laut einer Quelle, die der griechische Historiker Herodot zitierte, sogar Afrika umschifft.
Das Rätsel des beschleunigten intellektuellen Fortschritts durch Griechisch sprechende Menschen seit dem 8. Jahrhundert liegt womöglich am Meeresgrund, genauer in phönizischen Schiffswracks, die noch entdeckt werden müssen. Die Phönizier waren erfinderisch und technologisch einfallsreich. Von den semitischen Volksstämmen der Antike entwickelten sie sich als einziger zu guten Seefahrern. Wie die Griechen lebten auch sie in unabhängigen Stadtstaaten und bauten entlang des fruchtbaren Halbmonds Hafenstädte wie Sidon und Tyros, Byblos und Berytos. Wie die Griechen waren auch die Phönizier stets geschickt bei kulturellen Aneignungen; die erhaltenen Artefakte – Elfenbeinschnitzereien, Metallschalen, Rasiermesser, Steinmonumente, Masken aus Terrakotta – sind gerade deshalb charakteristisch, weil ihr Stil so vielseitig ist und Elemente aus griechischen, assyrischen und vor allem ägyptischen Gegenden miteinander verschmilzt.
Neben Baal war Melkart die bekannteste phönizische Gottheit – ein Jäger mit besonderer Macht über das Meer, den die Griechen mit Herakles gleichsetzten. Herodot nennt einen Tempel, den er in Tyros einmal besuchte und der Melkart geweiht war, sogar einen »Tempel des Herakles«. In seinem Innern sah Herodot zwei geweihte Säulen aus Gold und Smaragd, und manche Forscher glauben, dass die Doppelsäule ein typisches Symbol der phönizischen Religion war, das von Salomo im jüdischen Tempel von Jerusalem nachgeahmt worden sei. Der jüdische Monarch rief Hiram von Tyros zu sich, einen phönizischen Baumeister und Maurer, der »zwei Säulen aus Kupfer [goss], jede achtzehn Ellen hoch«, die in der Vorhalle des Tempels aufgestellt werden sollten (1. Könige, 7,15). Die markante Doppelsäule erklärt vielleicht sogar den eigentlichen Ursprung der Vorstellung der Säulen des Herakles bei Gibraltar. Möglicherweise lagen den berühmten griechischen Sagen von den Aufgaben des Herakles, insbesondere den im Westen angesiedelten, unbekannte phönizische Überlieferungen zugrunde, auch wenn sich das nicht beweisen lässt. Die westlichsten Arbeiten des Herakles sind das Pflücken der Äpfel der Hesperiden und der Raub der Herde des Geryones. Die Entlegenheit des zweiten Ortes wird durch das Transportmittel noch unterstrichen: Herakles benutzt ein Gefährt, das aber möglicherweise eher durch die Luft als durch Wasser fuhr, weil es ihm von der Sonne geliehen wird. Als die Griechen anfingen, über die Endpunkte der ihnen bekannten Welt nachzudenken, da verband ihre Fantasie, wie so oft, das Segeln auf See mit einem Flug durch die Luft. Diese Verbindung wurde noch durch die visuelle Ähnlichkeit unterstützt, die sie zwischen einem Schiff, das von den Reihen rasch aufblitzender Ruder vorangetrieben wird, und dem rhythmischen Flügelschlag eines Vogels wahrnahmen – ein beliebter Vergleich in der griechischen Dichtung.
Die Griechen mögen einige Taten des Herakles aus Geschichten übernommen haben, die die Phönizier von ihren eigenen Expeditionen oder jenen ihres Gottes Melkart erzählten. Aber es ist gar nicht so einfach, die Beziehung zwischen der griechischen und phönizischen Kultur zu verstehen. So wird beispielsweise häufig behauptet, die Griechen hätten alles, was sie über Schiffe wussten, von den Phöniziern gelernt. Als Beweis dafür wird etwa eine Lobrede des Griechen Xenophon auf die phönizische Findigkeit angeführt, in der ein Mann die Tugend häuslicher Reinlichkeit erklärt:
Die schönste und sorgfältigste Ordnung von Gerätschaften, Sokrates, glaube ich einmal gesehen zu haben, als ich zur Besichtigung auf das große phönikische Schiff ging. Denn sehr viel Gerät sah ich, auf engstem Raum säuberlich getrennt untergebracht. Mithilfe von vielen hölzernen Geräten und Tauen wird nämlich, sagte er, ein Schiff in den Hafen und aufs offene Meer gebracht, mithilfe einer Takelage segelt es, durch viele Vorrichtungen ist es gegen feindliche Schiffe gewappnet, viele Waffen für die Besatzung führt es mit, alles Gerät, das die Menschen zu Haus benutzen, enthält es für jede Messe …
Doch diese bewundernde Beschreibung des Innenlebens eines Schiffes heißt keineswegs, dass die Griechen die Errungenschaften der phönizischen Schiffbaumeister komplett kopierten. Kein einziges griechisches Wort für ein Schiffsteil ist von einer semitischen Wurzel abgeleitet. In jüngeren Untersuchungen zeichnen Marinehistoriker ein differenzierteres Bild, das die beiden Völker in einem jahrhundertelangen Wettlauf zeigt, in dem sie sich zu übertreffen suchen. Das führte unweigerlich zu beiderseitiger Nachahmung.
Die entscheidende technische Neuerung ereignete sich im 8. Jahrhundert v. Chr. In den Jahrhunderten davor wurden die Schiffe sowohl der Griechen als auch der Phönizier alle von einem einzigen Deck auf der obersten Ebene gerudert. Nachdem man jedoch einen Aufbau hinzugefügt hatte, auf dem bewaffnete Krieger Platz fanden, erkannten die antiken Schiffbaumeister, dass sie überdies eine weitere Ebene von Ruderern mit längeren Rudern hinzufügen konnten, so dass eine Bireme (Zweiruderer) entstand. Das Schiff konnte dadurch viel schneller fahren, ohne dass es länger oder schwieriger zu manövrieren war. Allerdings lässt sich nicht sagen, ob es ein phönizischer oder ein griechischer Geistesblitz war. Es gibt auch widersprüchliche Thesen zur Einführung der Schiffe mit drei Reihen von Ruderern (der Trireme), die eine Voraussetzung für die rasche Entwicklung der griechischen Flotten im 5. Jahrhundert v. Chr. und damit dem Reich Athens waren. Manche Griechen behaupteten damals, die Trireme sei von einem Korinther namens Ameinokles erfunden worden, aber spätere Quellen könnten durchaus recht haben, die andeuten, die Griechen hätten die Idee den Phöniziern aus Sidon abgeschaut.
Ein weiteres Problem ist das Fehlen, die Unhörbarkeit phönizischer Stimmen, sowohl aus der Levante als auch von ihrer punischen Kolonie bei Karthago, wo die Römer 146 v. Chr. eine Bibliothek zerstörten. Das ist enttäuschend, weil die Phönizier und ihre karthagischen Nachkommen schreibkundig waren. Augustinus schrieb im 4. Jahrhundert n. Chr., als die Phönizier noch auf den Straßen Nordafrikas zu hören waren, dass »punisch geschriebene Bücher, wie sehr gelehrte Männer behaupten, gar viele Dinge weise vor Vergessenheit gerettet haben«. Die frühen Kanaaniter aus Ugarit schrieben zwar im späten 2. Jahrtausend v. Chr. Mythen und erzählerische Dichtung, insbesondere einen Textzyklus über Baal, sowie alltäglichere Dinge nieder, aber die Beziehung dieser Texte zu den späteren Phöniziern bleibt dennoch im Dunkeln. Das Versäumnis der Phönizier aus Karthago, substanzielle schriftliche Quellen über sich zu hinterlassen, die spätere Historiker lesen konnten, hat unter Forschern sogar das Gerücht aufkommen lassen, dass sie eine staatliche Politik der Verschwiegenheit gepflegt hätten.
Einige wenige altphönizische Sätze sind erhalten. Ein König namens Kilamuwa hinterließ im 9. Jahrhundert v. Chr. eine Inschrift in der Nähe der Grenze zwischen der heutigen Türkei und Syrien, möglicherweise in Versen, wo er chronologisch aufzählt, wie er sein Volk geschützt habe. Bei Pyrgi, nördlich von Rom, dokumentieren beschriftete goldene Blätter auf Etruskisch und Phönizisch eine Widmung für eine phönizische Göttin um das Jahr 500 n. Chr. Aber es ist schlicht unmöglich, mit den Phöniziern in einen Dialog zu treten so wie mit den meisten antiken Volksstämmen des Nahen Ostens. Der einzige Kandidat für einen aussagekräftigen Text, der ursprünglich auf Phönizisch geschrieben wurde, liegt tatsächlich auf Altgriechisch vor. Nach eigener Aussage handelt es sich um die Übersetzung einer Abhandlung im Zusammenhang mit einer Reise, die im 5. Jahrhundert v. Chr. stattfand: Der Fahrtenbericht des Hanno,des Königs der Karthager, zu Teilen Afrikas jenseits der Straße von Gibraltar, den er dem Tempel des Baal weihte. Die erste Hälfte zählt Orte auf, die noch heute in Marokko bestimmt werden können. Die zweite Hälfte umfasst eine bizarre Ethnographie, die etwa die gegerbte Haut behaarter Frauen beschreibt, und die die Quelle ist, der wir den zoologischen Begriff Gorilla verdanken. Authentizität und Datierung sind heftig umstritten, obwohl es keinen Grund gibt, weshalb der Bericht nicht zumindest einen Nachklang des ursprünglichen Berichts in punischer Sprache von Hanno dem Seefahrer enthalten sollte.
Was das Bild jedoch am stärksten trübt, ist die Ambivalenz der Griechen – und Römer – gegenüber der südlichen Seemacht. Ihrer Meinung nach klang die phönizische Sprache urkomisch, weshalb sie in ihre Komödien auch Figuren aufnahmen, die sich völlig unsinnig, lang und breit ausließen (beispielsweise Hanno in der lateinischen Komödie Der kleine Karthager von Plautus, die einem griechischen Original nachempfunden war). Sie glaubten an magische Kräfte der phönizischen Sprache und schrieben manchmal Zaubersprüche in einem pseudophönizischen Dialekt. In der frühen griechischen Literatur spielen die Phönizier eine widersprüchliche Rolle. Bei Homer sind die Phönizier seefahrende Händler, so realitätsnah bleibt der Autor; allerdings war er vermutlich ungerecht, als er andeutete, dass sie unmoralischer als die Griechen wären. Einige Anklänge an die Phönizier sind auch in Platons fantastischer Erzählung von Atlantis zu hören, dem Land Poseidons, dem Zentrum eines seefahrenden Staatenbunds, der einst das Mittelmeer jenseits der Säulen des Herakles beherrscht hatte. Die griechische Auffassung von der phönizischen Kultur fließt in die halbübernatürlichen Phäaken aus der Odyssee ein, ausgezeichnete Seefahrer, die an einem einzigen Tag von Phaäkien zum griechischen Festland und zurück reisen konnten. In einer faszinierenden Passage erzählt der phäakische König Alkinoos (dessen Name »mächtig im Verstand« bedeutet), der Sohn des Nausithoos (»geschwind in Schiffen«), dem Odysseus, dass ihre Schiffe ein Bewusstsein hätten und sich selbst allein durch ihren Verstand steuern könnten: »Denn nicht Steuerleute haben phäakische Schiffe und nicht Steuerruder, wie andere Schiffe sie haben, sondern sie wissen von selbst die Gedankengänge der Männer, und sie kennen die Städte und üppigen Felder von allen Menschen«. Diese Verse spielen mit der klanglichen Ähnlichkeit der Wörter für »Schiff« und »Verstand«, die beide mit N beginnen und mit S enden und womöglich, in ferner Vergangenheit, von derselben indoeuropäischen Wurzel abgeleitet wurden.
Die Griechen betrachteten die Phönizier mit Sicherheit als Lehrmeister in wichtigen Fertigkeiten. Um die phonetische Übernahme des phönizischen Alphabets zu erklären, behaupteten sie, es sei von Kadmos eingeführt worden, dem Gründer Thebens. Er sei ursprünglich aus Phönizien gekommen – erinnerten sie sich oder einigten sich zumindest darauf. Die Griechen behaupteten selbst oftmals, dass ihre Weisen Verbindungen zu Phönizien gehabt hätten, darunter etwa der allererste Philosoph Thales von Milet. Thales schrieb angeblich auch über die Navigation nach den Sternen, und in der Spätantike wurden zahlreiche Versuche unternommen, anhand des seefahrerischen Geschicks der Phönizier zu belegen, dass der Ursprung der Vernunft beim phönizischen Volk liege. Ein griechischer Geograph namens Strabon bestand darauf, dass das Geschick in der Seefahrt sowie die Entstehung des wissenschaftlichen und rationalen Denkens miteinander zusammenhingen: »Die Sidonier [Phönizier] stehen zu Buch […] als Gelehrte in der Astronomie und der Arithmetik, was sich aus der Rechenkunst und dem Nachtsegeln entwickelt hat (die beide ja zu Handel und Seefahrt gehören)«. Zweifelsohne waren die Griechen eng mit den Sternen und Schiffen verbunden. Sie besaßen Magnetit und Eisen, aber noch keinen Kompass, und deshalb reisten Odysseus und seine Gefährten meist bei Nacht, indem sie sich an den Sternen orientierten. Aber es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob sie von den Phöniziern etwas über Navigation, Astronomie und mathematische Berechnungen gelernt haben.
In Odysseus hatten die Griechen einen glorreichen Helden und hervorragenden Navigator: Selbst auf einem einfachen Floß kann er seine Route nach den Sternkonstellationen steuern. Odysseus ist jedoch ein Held, der die intellektuelle Fähigkeit der Griechen auch auf andere Weise symbolisiert. Er interessiert sich von Natur aus für die Welt und geht faszinierenden Phänomenen auf den Grund, einfach weil er ihnen begegnet. Zwei der berühmtesten Vorfälle in der Odyssee befassen sich mit dem Lohn und den Gefahren des Strebens nach Wissen – um seiner selbst willen. Nur einmal lässt Odysseus zu, dass ihn unbeherrschte Neugier übermannt, und die Folge ist letztlich der Verlust aller seiner Männer. Es gibt nicht den geringsten Grund für ihn, die Insel der Kyklopen zu betreten. Seine Flotte und er hatten auf der benachbarten Ziegeninsel eine große Zahl Tiere gefangen. Die Ziegeninsel ist unbewohnt und unberührt, weil die Kyklopen nicht segeln. Also haben die Griechen schier unbegrenzten Proviant und sind in Sicherheit. Aber sie hören Stimmen über das Meer kommen, und Odysseus kann seinen Wunsch, Näheres zu erfahren, nicht länger zügeln. Er will wissen, »von welcher Art diese Männer sind, ob frevelhafte und wilde und gar nicht gerechte oder ob fremdenfreundliche, gottesfürchtige Leute«. Er nimmt eine Gruppe von zwölf Mann mit sich und plündert nicht nur die Höhle des Kyklopen Polyphem, sondern treibt sich aus Neugier unnötig lange herum, um den Riesen zu sehen. Damit Odysseus zumindest mit einigen Männern aus der Höhle entkommt, muss er Polyphem blenden, was aber den Zorn Poseidons erregt. Der Meeresgott verflucht daraufhin Odysseus, und alle Schiffe samt ihren Besatzungen gehen verloren.
Welch ein Unterschied deshalb, als Odysseus ein zweites Mal seiner großen Neugier erliegt! Er ist entschlossen, den Gesang der Sirenen anzuhören, die »wissen, was immer geschieht auf der vielernährenden Erde«, und dadurch alle normalen Grenzen von Raum und Zeit überwinden – obwohl ihn das in Todesgefahr bringen kann. Also schließt Odysseus einen Kompromiss zwischen Neugier (es besteht überhaupt keine Notwendigkeit für ihn, den allwissenden Gesang der Sirenen zu hören) und angewandter Klugheit oder wissenschaftlichem Erfindergeist. Er fragt sich, was er unternehmen kann, um die Gefahr für ihn und seine Gefährten abzuwenden, und findet eine praktische Lösung: Er weist seine Männer an, sich Wachs in die Ohren zu streichen, damit sie den Gesang überhaupt nicht hören, und befiehlt ihnen, ihn selbst an den Mast zu binden, damit er nicht über Bord springen kann. Hier führt Odysseus ein kontrolliertes Experiment durch, um die Hypothese zu testen, dass die Sirenen sein Wissen steigern können – ohne jedoch das Leben seiner Männer zu gefährden. Das lässt darauf schließen, dass man sich mit ausreichender Vorsorge, Vorbereitung und Vorsicht selbst bei den größten Gefahren einer unbegrenzten Neugier hingeben kann. Aus eben diesem Grund diente für die Griechen die Reise auch dazu, Wissen zu erwerben. Im dritten Vers der Odyssee heißt es, dass ihr Held »vieler Menschen Städte sah und ihr Denken kennenlernte«.
Ehe wir die Neugier der Griechen verlassen, werfen wir einen Blick auf vier Merkmale des analytischen Denkens der Griechen, die es ihnen meiner Meinung nach erleichterten, die »Siedlungen« und das »Wesen« sämtlicher Völker zu verstehen, denen sie begegneten. Das förderte wiederum ihren raschen intellektuellen Fortschritt. Das erste Merkmal ist, dass ihre flexible Sprache ihnen eine breitere Palette an Optionen bot als die meisten modernen Sprachen, um Kausalität, Folgen und nuancierte Grade an Überschneidung zwischen den beiden auszudrücken. Das zweite ist ihre Liebe zur Analogie – die Suche nach Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Sphären der Aktivität oder Erfahrung, die sich gegenseitig erhellen, wie etwa sämtliche Metaphern, die Seefahrt und geistige Bewegung miteinander gleichsetzten. Umgekehrt ist das dritte Merkmal die Liebe zur Polarität: Die Griechen nahmen die Welt wahr, indem sie sie in dualistische Einheiten unterteilten, und verfügten über besondere syntaktische Hinweise, die sie in Sätze einbauten, wenn man sie antithetisch verstehen sollte. Diese syntaktischen Markierungen wurden beispielsweise eingesetzt, um die Wirkung der beiden perfekt ausgewogenen Teilsätze der Redewendung zu steigern, die der lydische König Kroisos (Krösus) äußerte, als er den Krieg gegen Persien bedauerte: »Denn im Frieden bestatten die Söhne ihre Väter, im Krieg aber die Väter ihre Söhne.« Pythagoras, einer der ersten Philosophen, stellte sogar eine »Tafel der Gegensätze« zusammen, um seinen Studenten die Analyse von Phänomenen zu erleichtern: ungerade – gerade, hell – dunkel, männlich – weiblich, etc. Die Liebe der Griechen zu Gegensätzen war so stark, dass sie häufig einfach auf zwei entgegengesetzte Teile eines einzigen Phänomens verwiesen, statt den Kollektivbegriff zu verwenden. Beispielsweise sprachen sie fast nie von »der ganzen menschlichen Rasse«, sondern zogen die Wendung vor: »sowohl die Griechen als auch die Barbaren«.
In ihrer Philosophie ist außerdem die vierte Argumentationsweise stärker als in irgendeiner anderen vertreten: das Prinzip der Einheit der Gegensätze. Zwei Dinge oder Kräfte, die allem Anschein nach im Gegensatz oder Widerspruch zueinander stehen, können auch vereint sein, oder genau genommen bestimmt eben der Widerspruch zwischen ihnen ihre unablässige gegenseitige Beeinflussung. Eine zentripetale Kraft kann nur in Kombination mit der zentrifugalen Kraft verstanden werden, konkav nur in Relation zu konvex. Das Denken der alten Griechen hatte allem Anschein nach weniger Schwierigkeiten mit dem Konzept der Interaktion und Einheit von Gegensätzen als der heutige westliche Verstand, zumindest das moderne angloamerikanische Denken, das stur empirisch ausgerichtet ist. Die Einheit von Gegensätzen kann man leichter über die griechische Mythologie und Religion als über die Philosophie erfassen. Nehmen wir den Seher Teiresias, der physisch blind ist, weil er in Wirklichkeit viel mehr von der Wahrheit »sehen« kann als sehende Menschen. Oder denken wir an die Dichotomie von Verbrechen und Strafe: Das Christentum geht von einem ganz tugendhaften Gottvater aus, der seine Gegner, die Gottlosen, bestraft. Aber in der Antike hatten die Helden und Götter, die für die Bestrafung bestimmter Fehlverhalten zuständig waren, tendenziell selbst vergleichbare Verbrechen begangen. Der inzestuöse Vatermörder Ödipus etwa wurde zu einer Kultfigur für die Verhinderung von Inzest und Vatermord. Die Mutter Medea, die bei Korinth eine Kultstätte gründet, in der Frauen für die Sicherheit ihrer Kinder beten können, ist in Wirklichkeit eine Kindsmörderin: Gute Mutter und schlechte Mutter sind sich gegenseitig definierende und damit vereinte Auffassungen. Sie sind die »beiden Seiten derselben Münze«. Die Ursprünge dieser Denkweise könnten mit Euphemismus in seinem ursprünglichen, nüchternen Sinn zusammenhängen: Weil die namentliche Nennung einer gefürchteten Macht sie anspornen oder ihren Groll erregen könnte, nannten die Griechen die furchterregenden weiblichen Personifizierungen gewaltsamer Rache oder Flüche, also die Erinnyen (Furien), meist die »Wohlgesinnten«. Flüche sind offensichtlich Segenssprüche, solange der Fluch nicht in Kraft gesetzt wird.
Die Einheit von Gegensätzen, die bereits in der Mythologie und im Kult geäußert wurde, erklärt ferner die Neigung zur Dualität in der frühen griechischen Philosophie. Von Heraklit stammt der Spruch, dass das Meer rein und vergiftet sei, zwei absolute Gegensätze. Für die Fische ist es rein und deshalb eine Wohltat, für die Menschen ist es jedoch schädlich. Empedokles argumentierte hingegen, dass sich die physische Welt, die lebt und stirbt, in einem ständigen Wechsel zwischen Trennung und Vereinigung befinde, und zwar unter dem Einfluss der beiden entgegengesetzten, aber dialektisch vereinten Kräfte, die er Liebe und Streit nannte. Aristoteles war es, der erkannte, dass man nicht unbedingt handeln musste, um etwas Unmoralisches zu tun: Indem man etwas zu tun unterlässt, was man tun könnte, kann man ebenso viel Schaden anrichten, wie indem man eine andere Tat selbst begeht. Die Schuldhaftigkeit kann folglich ebenso beim Tun wie beim Nichttun liegen.
Die Wissbegierde der alten Griechen äußerte sich unter anderem auch in ihrer fünften Charaktereigenschaft: einer gewissen geistigen Offenheit. Weil sie gerne auf Reisen gingen und für gewöhnlich in der Nähe des Meeres lebten, brachten sie sich selbst unablässig in Kontakt mit anderen Kulturen und nutzten alsbald die Gelegenheit, von anderen Völkern Fertigkeiten zu lernen und selbst mit völlig neuartigen Techniken und Ideen zu experimentieren. Das altgriechische Wort für »Öffnung«, anoixis,das auf Neugriechisch Frühling bedeutet, der das Jahr »eröffnet«, drückt mehrerlei aus. Es kann den Moment bezeichnen, wenn ein Schiff ablegt und seinen Kurs auf dem offenen Meer findet, und es kann das Ankommen oder erste vollständige Begreifen einer Idee im menschlichen Verstand anzeigen. Erleuchtung und Beherrschung des Meeres waren untrennbare Bestandteile der athenischen Identität. Aber wenn alte jüdische und christliche Autoren auf Griechisch schrieben, was im Mittelmeerraum häufig vorkam, dann gebrauchten sie gelegentlich das Wort anoixis als Äquivalent für das zentrale Konzept der »Gleichheit beim Rederecht«, parrhesia, das ein Kernelement vieler griechischer Verfassungen war und insbesondere mit der athenischen Demokratie identifiziert wurde. Deshalb behandle ich den Aspekt der Offenheit im Zusammenhang mit den klassischen Athenern (Kapitel 5). Eine Gesellschaft, die so offen ist, dass sie sich unverstellte Darlegungen verschiedener Sichtweisen anhört, ist eine Vorstellung, der viele Griechen anhingen. Sie hatte eine lange Zukunft vor sich.
Offenheit für fremde Einflüsse, Neuheiten und ehrliche Äußerungen widersprüchlicher Meinungen werden allesamt mit einer Neigung zu emotionaler Aufrichtigkeit assoziiert. Dass das antike, athenische Drama in den Theatern der heutigen Welt ein so starkes Revival erlebt, liegt unter anderem daran, dass dessen vorchristliche Ethik oft erfrischend ehrlich die Emotionen zu zeigen scheint. Die Generation der Babyboomer und ihre Kinder ziehen es meist vor, sich ihren dunkleren Trieben – Wut, Rache, Begierde, Neid – zu stellen, anstatt sie zu unterdrücken oder zu leugnen. Frühe griechische Denker hatten den Vorteil einer gewissen Klarheit bezüglich der menschlichen Leidenschaften, die erst nach Freud wieder möglich wurde. Beispielsweise hatten die Griechen einen tiefen Respekt vor Sex, über den sie ganz offen sprachen; sie wussten sehr wohl, zu welchen Taten dieser Trieb die Menschen bringen konnte, wie ihre obszön komischen und einige tragische Sagen illustrieren. Viele Sagen schildern Krieger – also gelernte Mörder –, die es nicht schaffen, die eigene Wut zu beherrschen. Als ein Heerführer namens Gylippos zu den Syrakusern spricht, ehe sie in den Kampf gegen die athenischen Eindringlinge ziehen, ermahnt er sie, daran zu denken, »dass es nur gerecht und erlaubt ist, wenn an den Gegnern zur Rache für ihren Einfall das zürnende Herz sich ersättigen darf«. Mit schaurigen Worten, die später bei christlichen Gelehrten moralische Empörung auslösten, fügt er hinzu, dass Rache wohl »die süßeste Freude« verschaffe. In Platons Politeia führt Sokrates seinem Gesprächspartner den mörderischen Hass vor Augen, den Sklaven unweigerlich gegenüber ihren Besitzern hegten, zumindest jene, die in großer Zahl gehalten werden. Doch der griechische Emotionsbegriff, für den ich mir eine deutsche Entsprechung wünschen würde, lautet phthonos oder Neid, vermischt mit Freude am Unglück dessen, den man beneidet: also Neid plus Schadenfreude. Kein Grieche würde bestreiten, dass ein Bettler sich freut, wenn er einen reichen Mann in Schwierigkeiten sieht. Wie Dionysios von Halikarnassos einmal sinngemäß sagte: »Keine großzügigen Gedanken können in einem Mann aufkommen, der die dringendsten Dinge des täglichen Lebens entbehrt.« Wegen der emotionalen Aufrichtigkeit der Griechen mag man sie für herzlos und gemein halten, aber sie dürften kaum jemals heuchlerisch erscheinen.
Es ist einfacher, sich mit dem Schutzschild des Lachens aufrichtig über die dunkle Seite des menschlichen Daseins zu äußern, und der Humor ist die sechste Eigenschaft der Griechen, die ich im Kontext der Spartaner hervorhebe (Kapitel 6). Sie setzten einen pointierten, lakonischen Witz ein, um die Moral ihrer Kriegerkultur zu bewahren. Doch die Spartaner waren nicht die einzigen unterhaltsamen Griechen: Im klassischen Athen gab es eine besondere Trinkgesellschaft, deren Mitglieder allesamt berühmte Anekdotenerzähler waren. Philipp II. von Makedonien, der gerne lachte, bot ihnen einmal ein Talent oder einen Silberbarren und bat sie, ihre Witze niederzuschreiben und ihm zu schicken, vermutlich damit er sie bei einem lärmenden Bankett im Palast vortragen konnte. Die Griechen kamen auf die Idee einer Witzsammlung, und ein Exemplar eines solchen Buches ist aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. erhalten: das Philogelos oder der »Lachfreund«. Pfuscher in ihrem Beruf sind eine beliebte Gruppe, über die Witze erzählt werden: Ein unfähiger Lehrer, der nach dem Namen der Mutter von Priamos, dem König Trojas, gefragt wurde, antwortete: »Ich schlage vor, sie gnädige Frau zu nennen.«
Wenn die Griechen sich die Unsterblichen vorstellten, wie sie glückselig auf dem Olymp lebten, schüttelten sie sich immer vor »unauslöschlichem Lachen«. In einer archaischen Hymne an Demeter, die Homer zugeschrieben wird, ist die Göttin des Ackerbaus untröstlich, weil ihre Tochter Persephone von Hades entführt und in die Unterwelt verschleppt worden ist. Demeter boykottiert daraufhin den Olymp und begibt sich zu ihrem Heiligtum bei Eleusis, aber nichts kann ihren Schmerz lindern. Da hat ihre Gastgeberin, die Königin des umliegenden Gebiets, eine Idee. Sie gewinnt die Hilfe der einzigen weiblichen Komikerin der klassischen Mythologie, deren Name nach den derben jambischen Witzen, die sie vortrug, Jambe lautete. Schließlich bricht Demeter in Gelächter aus. Die Komikerin Jambe lieh ihren Namen dem Versmaß, das die Griechen stets für Gedichte von Beleidigung und satirischer Verzerrung verwendeten; vermutlich hatte es seinen Ursprung in prähistorischen Feierlichkeiten, in ritueller Obszönität und Späßen. Aber die Griechen kannten viele verschiedene Arten von Lustigkeit. Wenn die Inuit zwanzig unterschiedliche Wörter für Schnee haben, so hatten die Griechen ebenso viele, die man mit »verspotten« oder »auslachen« übersetzen kann, um die feinen Nuancen des Unfugs oder der Boshaftigkeit wiederzugeben. Dabei vertrat Aristoteles die Ansicht, dass Lachen in manchen Fällen genau genommen ein Zeichen moralischer Tugend sei. Für Sokrates war es ein zentraler Bestandteil seiner Methode, auf humorvolle Weise die Absurdität in den philosophischen Argumenten anderer aufzuzeigen – die eironeia oder »Ironie«. Von den Kynikern, die ein strenges Leben führten und alle Insignien von Wohlstand und Macht verachteten, ist das Wort zynisch abgeleitet, mit dem wir noch heute eine Haltung zwischen Misstrauen und Spott bezeichnen. Urkomische Anekdoten erzählte man sich in der Antike über den berühmtesten Kyniker Diogenes. Als Platon erklärte, Sokrates habe einmal die Menschen als »federlose Zweibeiner« definiert, machte sich Diogenes über diese Vorstellung lustig, indem er ein gerupftes Huhn in die Akademie brachte und verkündete: »Alle mal hersehen! Ich bringe euch einen Menschen!«
Manchmal ist die Verwendung des Lächerlichen durch die Griechen ermüdend, insbesondere wenn das Ziel des Spotts (wie so oft) eine Frau ist. Leider ist nicht bekannt, welche Witze Jambe damals Demeter erzählte. Aber es sind konventionelle satirische Tiraden gegen Frauen überliefert, welche die alten Griechen in der Regel ganz offen verachteten. Eine Studie des Theophrast der häufig anzutreffenden Persönlichkeitstypen in seinem Werk Charaktere befasst sich mit dem »taktlosen Mann«, dessen Fehler es nicht einfach ist, dass er gerne herkömmlich über das weibliche Geschlecht herzieht, sondern dass er diese Unart taktlos sogar auf Hochzeiten praktiziert. Andererseits werden Witz und Spott gegen die Mächtigen – seien es Götter, Könige oder Feldherren – mit einer verblüffenden Portion Respektlosigkeit und moralischen Rückgrats eingesetzt, die nicht zuletzt erklären, warum ausgerechnet die Griechen sowohl die Demokratie als auch das komische Theater erfanden.
Komödien wurden eigens dafür geschrieben, sie bei Theaterwettbewerben aufzuführen, und jeder komische Autor hatte das Ziel, seine Rivalen zu schlagen und den angesehenen Preis zu gewinnen. Der siebte Charakterzug der griechischen Eigenschaften war ein fast zwanghaftes Konkurrenzdenken, das in Kapitel 7 behandelt wird und vor allem unter den wetteifernden, rivalisierenden Makedoniern zutage trat. Bei Olympia, wo die Olympischen Spiele stattfanden, stand eine Statue der Wettkämpfe, personifiziert als Mann mit Schwunggewichten für den Weitsprung in der Hand. Das griechische Wort für einen öffentlichen Wettkampf war agon,was so viel heißt wie »sich abplagen« und wovon sich das heutige Wort Agonie ableitet. Aber die Griechen fassten alles, nicht nur die Leichtathletik, »agonistisch« auf. Odysseus sagt zu den ernsthaftesten Freiern um Penelope, dass er sie beim Wettpflügen schlagen werde. Junge Mädchen, die in Sparta der Artemis Hymnen vortrugen, stritten darum, wer von ihnen am lieblichsten sang. Platon legt die Dialoge des Sokrates mit den Sophisten feinsinnig als Rededuelle an. Der wettstreitende Ansatz ging von einer elementaren gesellschaftlichen Gleichheit unter den Rivalen aus, die ihre eigenen Fähigkeiten durch gegenseitiges Nacheifern verbesserten. Zu den am schönsten klingenden griechischen Passagen in der alten Dichtung zählt, wie Hesiod in Werke und Tage die beiden Arten von Zwietracht beschreibt, symbolisiert in den beiden Gesichtern der Göttin Eris. In der einen Gestalt führt sie Männer in den Krieg und ist schädlich. Aber ihre andere Seite ist den Menschen viel freundlicher gesinnt, »treibt sie gleichwohl doch auch Untätige selbst an die Arbeit«. Bauern arbeiten hart, wenn sie sehen, wie ihr Nachbar reich wird. Töpfer messen sich mit Töpfern, Handwerker mit Handwerkern und Barden mit Barden. Sogar die Bettler wetteifern untereinander.
Die Griechen sahen eine logische Verbindung zwischen der wohltuenden Form der Zwietracht und ihrem Trachten nach Meisterschaft (arete) in jeder Sphäre der Tätigkeit, und dieses Streben bildet die achte der zehn Charaktereigenschaften. Eben dieser Drang nach Vortrefflichkeit brachte die hellenistischen Könige Ägyptens, die Ptolemäer, auf die Idee, in Alexandria eine Bibliothek anzulegen, welche die besten Bücher und die besten Gelehrten beherbergen sollte, die die Welt jemals hervorgebracht hatte (Kapitel 8). In Smyrna, im heutigen Nordwesten der Türkei, bauten andere hellenistische Herrscher sogar einen Tempel zu Ehren der Göttin der Vortrefflichkeit.
Frauen konnten in den geeigneten Sparten ihrerseits arete





























