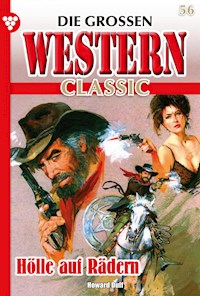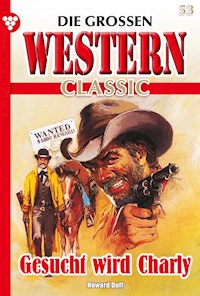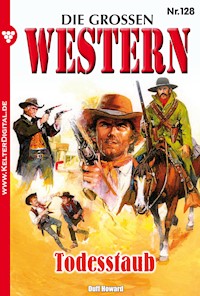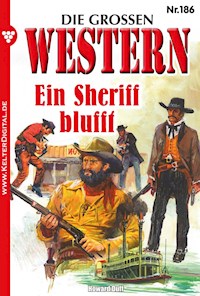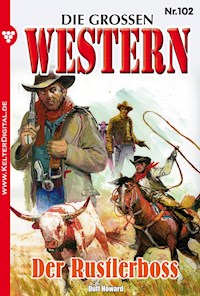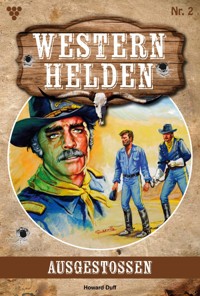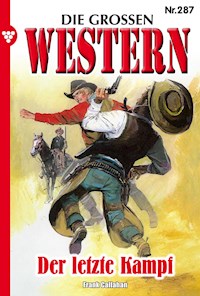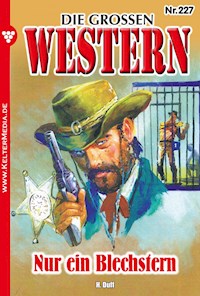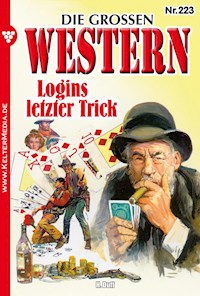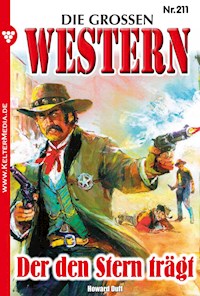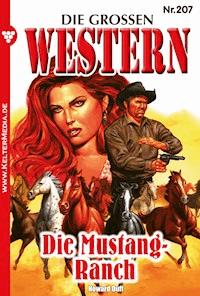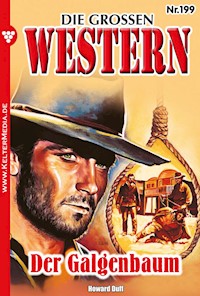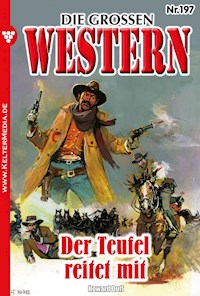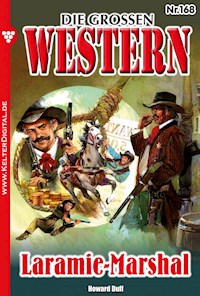
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Der Regen rinnt, Wind säuselt durch die Büsche. In der Gasse, die zum Fluss führt, sind drei Pfützen. Und in einer der Pfützen liegt ein Mann. Er hat die Beine leicht angewinkelt. Ein Arm liegt halb am Rand der Pfütze, und der andere ist unter seiner Brust begraben. Die letzten Regentropfen platschen vom Dach des Schuppens neben ihm in die Gasse. Und der Mann bewegt sich. Es ist der Marshal. Elmar Dwyer. Er stemmt zuerst das linke Bein an. Dann bewegt er müde die linke Hand, und dann tastet die Hand nach seinem Kopf. Er macht es im Unterbewusstsein, denn noch ist er weit entfernt davon, klar zu sein. Die Hand berührt die Platzwunde auf seinem Kopf, und dann stöhnt Elmar einmal. Er stemmt sich langsam auf, denn die Dunkelheit vor seinen Augen lichtet sich. »Verdammt«, sagt Elmar Dwyer heiser. »Verdammt.« Er fühlt jetzt erst, dass er mitten in der Pfütze sitzt. Er steht auf und sieht in die dunkle Nische zwischen Schuppen und Wohnhaus. Er sieht die Dunkelheit rabenschwarz in der Nische liegen. Und dann sagt er schnaufend und mit jenem Unterton von kalter Wut, die ihn erst richtig gefährlich macht: »Da hat der Mister gestanden. Er muss gewartet haben. Und ich weiß auch, warum!« Nach diesem Ausspruch angelt er seinen Hut und schüttelt ihn kräftig aus. Nun gut, er hat mich also zu Bell gehen sehen, der Bursche, denkt Elmar. Ich kam von der Main Street und ging zum Essen. Er hat hier gestanden und gewartet, bis ich zurück musste. Und dann hat er mit einem
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 168 –Laramie-Marshal
Howard Duff
Der Regen rinnt, Wind säuselt durch die Büsche. In der Gasse, die zum Fluss führt, sind drei Pfützen. Und in einer der Pfützen liegt ein Mann. Er hat die Beine leicht angewinkelt. Ein Arm liegt halb am Rand der Pfütze, und der andere ist unter seiner Brust begraben.
Die letzten Regentropfen platschen vom Dach des Schuppens neben ihm in die Gasse.
Und der Mann bewegt sich. Es ist der Marshal. Elmar Dwyer. Er stemmt zuerst das linke Bein an. Dann bewegt er müde die linke Hand, und dann tastet die Hand nach seinem Kopf. Er macht es im Unterbewusstsein, denn noch ist er weit entfernt davon, klar zu sein. Die Hand berührt die Platzwunde auf seinem Kopf, und dann stöhnt Elmar einmal.
Er stemmt sich langsam auf, denn die Dunkelheit vor seinen Augen lichtet sich.
»Verdammt«, sagt Elmar Dwyer heiser. »Verdammt.«
Er fühlt jetzt erst, dass er mitten in der Pfütze sitzt.
Er steht auf und sieht in die dunkle Nische zwischen Schuppen und Wohnhaus. Er sieht die Dunkelheit rabenschwarz in der Nische liegen. Und dann sagt er schnaufend und mit jenem Unterton von kalter Wut, die ihn erst richtig gefährlich macht: »Da hat der Mister gestanden. Er muss gewartet haben. Und ich weiß auch, warum!«
Nach diesem Ausspruch angelt er seinen Hut und schüttelt ihn kräftig aus.
Nun gut, er hat mich also zu Bell gehen sehen, der Bursche, denkt Elmar. Ich kam von der Main Street und ging zum Essen. Er hat hier gestanden und gewartet, bis ich zurück musste. Und dann hat er mit einem Totschläger zugeschlagen.
Niemand ist sicherer als Elmar Dwyer, dass es ein Totschläger war, der ihn in die Pfütze brachte.
Er torkelt leicht. Eine Minute steht er keuchend an der Wand des Schuppens und atmet hastig aus und ein. Dann greift seine Hand nach den beiden Revolvern, die er trägt.
Er sieht zuerst die Revolver nach und blickt in die Gasse. Die Revolver sind voll, und die Gasse ist leer.
Mit seltsamer Gründlichkeit langt er in die Tasche, zieht ein Streichholz aus der Faltschachtel und reißt es am Schuppen an.
Das Streichholz beleuchtet die Nische und den Boden.
Und der Lichtschein, so gering er auch ist, beleuchtet auch den verdreckten Marshalstern an seiner linken Brustseite.
Ich war unvorsichtig, denkt er. Ich war ein Narr, sorglos und wie ein Narr in die dunkle Gasse zu gehen. Dafür habe ich nun eine Platzwunde. Man lernt aus seinen Fehlern. Und dieser wird sich nicht wiederholen.
Das Streichholz erlischt, und er reißt das nächste an. Dann kniet er halb, starrt auf die beiden Stiefeleindrücke und die Feuchtigkeit dieser Abdrücke. Der Boden ist da ziemlich trocken, und der Mann muss also durch eine Pfütze gegangen sein, ehe er in die Nische trat.
Es sind große Stiefel, und einer hat ein Loch in der linken Sohle. Zudem geht der Mann mit den Fußspitzen nach innen.
Er richtet sich wieder auf. Dann legt er sein gelbes Halstuch auf die Wunde und stülpt den Hut darüber.
Langsam dreht er sich um, geht die dunkle Gasse entlang und bleibt vor Bells Speisesaloon stehen. Dort hängt die Laterne an einem Haken, im Saloon ist um diese Zeit nicht mehr viel los. Der Marshal ist meist der letzte Gast.
Ruhig nimmt Elmar Dwyer die Lampe vom Haken und geht sechs Schritte, als hinter ihm die Tür klappt und eine tiefe und rauchige Stimme sagt: »Cowboy, stehle wo du willst, aber lass meine Lampe hängen, verstanden?«
Die Lampe bescheint ihn also nicht gut genug, und die Zwielichtigkeit lässt die Frau, die aus dem hellen Saloon kommt, ihn nicht erkennen.
Dwyer dreht sich langsam um und lächelt knapp. Und dann hebt er die Lampe hoch, und nun ist sein Gesicht im Lichtschein.
»Sicher, Bell«, sagt er.
»Oh, Elmar«, ruft sie überrascht. »Wie siehst du aus? Herr im Himmel, bist du betrunken gewesen, dann musst du es innerhalb der letzten Viertelstunde geworden sein. Was ist mit deinem Gesicht?«
Sie trägt ein rotes Kleid aus Samt, und das Kleid ist eng mit einem tiefen Ausschnitt. Ihr kupferrotes Haar leuchtet auf, als sie hastig vom Vorbau kommt. Sie ist groß und hat eine Figur, dass mancher Mann nicht aufhören kann zu seufzen.
Es bleibt auch immer bei den heimlichen Seufzern, denn Bell Terhune ist nicht für jeden Mann da. Überhaupt für keinen.
Ihre meergrünen Augen liegen mit einem Ausdruck der Verstörtheit auf dem Marshal. In ihren Augen ist nichts als Unruhe. Sie sieht das Blut an seiner linken Gesichtshälfte und erkennt an seinen Augen, dass irgendetwas ihn beschäftigt. Sie liest Ärger und Verdruss.
»Elmar, was ist passiert?«, fragt sie heiser und packt seinen Arm. »Du siehst aus, als wenn du einen Kampf hattest. Und in deinen Augen kann man lesen, wie zornig du bist. Elmar, wer hat es auf dich abgesehen?«
»Das weiß ich selber noch nicht, Bell«, sagt er gleichmütig. Und gerade daran erkennt sie, dass er ziemlich voller Zorn stecken muss. »Ich werde die Person aber finden. Und sicher dauert es nicht lange. Ich säubere mich nachher.«
»Morgen kommen die Herden«, sagt sie herb. »Morgen sieht diese Stadt den Teufel, Elmar. Und du bist ganz allein.«
»Schon gut, fang nicht wieder davon an«, sagt er rauer, als er es beabsichtigt. »Dies ist meine Stadt. Sie haben mich als Marshal angeworben, und ich werde genau das tun, was mein Orden verlangt. Kümmere dich nicht um mich, denn du könntest dadurch selber Ärger bekommen.«
»Nicht, solange Jones bei mir ist«, erwidert sie ruhig. »Du willst dir niemals helfen lassen. Du denkst immer, man scheut vor einem Orden zurück. Hier hast du den ersten Beweis, wie sehr man ihn achtet. Man hat dich niedergeschlagen, ja?«
Sie nimmt seinen Hut ab und blickt auf seinen Kopf. Dann greift sie zu, zieht ihn herunter und betrachtet die Platzwunde.
»Ein Totschläger«, sagt sie. Und auch sie erkennt es sogleich. Schließlich hat sie ihr früherer Beruf in alle rauen Kreise geführt. »Der Mann hätte kräftiger zuschlagen sollen, dann würde er sein Geld verdient haben, Elmar.«
»Vielleicht«, sagt er trocken. »Ich will erst den Burschen haben, und dann will ich mich um den Mann kümmern, der ihn bezahlt. Hat jemand nach oder vor mir deinen Saloon verlassen, Bell?«
»Niemand, der närrisch genug wäre, es zu versuchen«, murmelt sie gepresst. »Damit musst du zum Doc, Marshal, weißt du das?«
»Der Doc ist sicher müde, und ich kann warten«, sagt er knapp. »Noch einmal, Bell, misch dich nicht ein, und halte Harvey Jones an der Leine. Vielleicht hilft er dir nur, weil er eine andere Art von Preis erhofft. Und vielleicht denkt er, wir beide sind Rivalen.«
»Es gibt keine Rivalität in dieser Stadt«, erwidert sie herb. »Nicht für dich, Elmar, und nicht bei mir. Hast du verstanden?«
»Eines Tages werde ich alle meine Vorsätze über Bord werfen und den Orden dazu«, sagt er heiser. »Wenn ich nicht mehr hinter mich blicken muss, habe ich vielleicht Zeit, einmal an das zu denken, was ich seit einigen Jahren möchte. Und bin sicher, dieses Feuer ist dann nicht mehr zu löschen. Weißt du, was das für dich bedeuten kann?«
»Ich würde dir barfuß durch tausend Meilen Schnee nachlaufen, du närrischer Dickschädel«, sagt sie keuchend. »Und jetzt verschwinde, ehe ich mich dazu hinreißen lasse, dich zu küssen. Verschwinde, Marshal!«
Er sieht das Feuer in ihren Augen und denkt, dass er bleiben sollte und warten, ob sie sich wirklich traut, ihn zu überfallen. Vielleicht ist das eine andere Art Spiel als das mit den Revolvern. Sicher ist dieses Spiel bedeutend süßer. Aber genauso sicher wäre auch, dass er dann heute nicht mehr durch die Stadt gehen würde.
»Ach, verdammt!«, sagte er rau. »Verstecke dein Gesicht und deinen Mund, außerdem alles, was noch dazugehört, besser in deinem Zimmer!«
Er dreht sich um und fühlt nichts als den törichten Wunsch, nicht mehr durch den Orden gebunden zu sein. Bell regt jedes Mal seinen Blutdruck zu sehr an, wenn sie ihm begegnet. Und darum rennt er fast weg, denn schließlich ist er auch nur ein Mann.
Sie blickt ihm nach und lacht leise. Dieses Lachen macht ihn wütend, denn es ist lockend und versündigend zugleich. Außerdem aber immer etwas spöttisch.
*
Elmar biegt um die Schuppenecke und kommt wieder auf den Platz, an dem er niedergeschlagen wurde. Weiter hinten klappt die Tür des Speisesaloons, und einen Augenblick muss er noch an Bell und ihre Figur denken. Dann jedoch knirscht er wütend mit den Zähnen, denn er hat als Marshal keine Zeit und kein Recht, auch nur eine Sekunde an eine Frau und was zu ihr gehört, zu denken.
Sein Kopf brummt wieder ein wenig. Die Lampe bescheint den Boden. Ich werde diesen Affen bekommen, denkt der Marshal wild.
Elmar starrt auf den Boden und sieht im Schein der Laterne die Fußabdrücke. Er sieht den linken Abdruck des großen Stiefels, und das Loch zeichnet sich deutlich im feuchten Boden ab.
Elmar Dwyer geht der Spur mit grimmiger Zufriedenheit durch die Gasse nach. Sie geht den steilen Weg zum River hinunter und dann verschwindet sie im Wasser.
Dieser Halunke, denkt Elmar. Mal sehen, wo du diesen freundlichen Fluss verlassen hast und wieder ans Ufer geklettert bist.
Er nimmt die Laterne nun in die linke Hand und den Colt in die Rechte. Sein Daumen spannt den Hammer und hält ihn fest. Ehe er weitergeht, sieht er sich vorsichtig um. Bis an den River führen einige Holzwände herab, die die einzelnen Grundstücke voneinander trennen.
Vor ihm ist der Holzzaun der Frachtwagencompany. Und hinter diesem Zaun kann durchaus ein Mann stehen, der seinen Revolver in der Hand hält.
Vorsichtig blickt Elmar Dwyer auf den Zaun, aber er sieht nichts von einem Revolver und noch weniger von einem Mann. Er hört nur das Klirren von Ketten, als er nahe am Zaun ist.
Langsam richtet er sich auf, geht um das Ende des Zaunes herum und blickt auf den Hof der Company. Er sieht den alten Wesson Smith schwer an einem Haufen Siele schleppen.
»Wesson!«, sagt er scharf. »Wesson, einen Augenblick!«
Der alte Wesson zuckt zusammen, als unmittelbar vom Fluss her eine Stimme spricht. Dann dreht er sich um und starrt auf den Marshal.
»Wie siehst du denn aus?«, fragt er heiser. »Hallo, Elmar, was machst du hier?«
»Wesson, wie lange bist du hier auf dem Hof?«, fragt Dwyer ruhig. »Bist du gerade erst gekommen, oder …«
»Vielleicht zehn Minuten«, antwortet der Alte. »Was ist, warum rennst du hier herum?«
»Dann hast du vielleicht jemanden gesehen«, brummt Dwyer. »Der Bursche muss hier unten am River entlanggekommen sein. Hast du was gesehen?«
»Nichts, du siehst doch, ich war im Stall und habe die Sielen herausgeholt«, antwortet Smith. »Suchst du jemanden?«
»So kann man es auch nennen«, erwidert Dwyer knapp. »Nun gut, du hast also nichts gesehen.«
Er verlässt den Hof und muss mehr als fünfzig Yards gehen bis er wieder die Spur sieht. Der Mann ist aus dem Fluss gekommen, dicht an einem Weidenstrauch vorbeigegangen und hat den Weg zwischen den Schuppen der Korngesellschaft genommen.
Langsam und vorsichtig macht sich der Marshal auf den Weg. An der Ecke zur Main Street brennt eine Laterne, aber die Spur endet dicht vor der Ecke am Bretterzaun.
Rechts ist der Red-Indian-Saloon und hinter dem Zaun beginnt der Hof des Saloons.
Sieh mal einer an, denkt Dwyer. Hat er gedacht, man findet nichts mehr von dieser Spur, wenn er erst einmal durch den River gegangen ist? Bruder, wenn du dich da nur nicht irrst.
Er schiebt das Tor auf, gleitet hindurch und sieht die beiden hellen Fenstervierecke links von der Hintertür des Saloons. Aus den Fenstern fällt Licht in den Hof, und der Schatten von Keith Armstrong zeichnet sich einen Augenblick am Fenster ab.
Er geht der Spur nach und sieht, dass der Mann die Hintertreppe genommen hat. Der Mister ist in den Bau hineingegangen.
Auf der Treppe sind deutlich die nassen Abdrücke seiner Stiefelsohlen zu sehen.
Der Marshal schiebt den Glasbehälter hoch und bläst die Laterne aus. Erst dann geht er mit langen Schritten auf die Regentonne an der Hausecke zu und wäscht sich das Gesicht. Mit dem Taschentuch säubert er sich.
Seine Spannung wächst, als er an der Hauswand entlanggeht und dicht am großen Hoftor stehen bleibt. Dieses Tor ist offen und führt vom Hof aus auf die Straße. Rechts von Dwyer beginnt der Gehsteig. Auf ihm ist niemand. In der Stadt bereitet sich alles auf den morgigen Tag vor.
Morgen werden achtzehntausend Rinder vor der Stadt in den Corrals an der Bahnlinie stehen. Achtzehntausend Rinder und hundertachtzig bis zweihundert Boys der rauen Trailmannschaften werden die Saloons stürmen.
Der Marshal blickt kühl auf den Dancing-Palast auf der anderen Straßenseite. Er sieht das Schild mit der riesigen Schrift. Es kündet die zwanzig Girls an, die sich hier den Männern der Trailmannschaften zur Verfügung stellen. Daneben das nächste Schild mit dem Preis für ein Essen.
Noch vor zwei Tagen waren die Straßen fast leer und keine Schilder zu sehen. Nun hängen überall Plakate. Und wenn noch vor zwei Tagen ein Bett und ein Essen einen Dollar kosteten, so beträgt der Preis für Essen und Übernachtung inzwischen die dreifache Summe.
In der Stadt sind mit dem Einsetzen des Frühjahrsauftriebs die Preise um dreihundert Prozent in die Höhe geschnellt.
Jemand hat achtzig Spieler, zwanzig Girls und ein ganzes Rudel Rauswerfer und Aufpasser den Saloons vermittelt, denkt Dwyer bitter und steht immer noch am Tor. Die Girls sind heute früh mit dem Zug von Cheyenne gekommen, die Spieler lungern schon zwei Tage hier herum, und die Rauswerfer haben ihre Plätze längst bezogen. Ich möchte wissen, wer der Mann ist, der diesmal seine Hand aufhalten wird und seine Prozente kassiert. Vielleicht Cord Harstad aus Rawlins, oder Joel Mature aus Casper im Norden? Nun gut, mit beiden Burschen lässt sich ein Übereinkommen treffen!
Marshal Dwyer kennt dieses Spiel aus einigen wilden und rauen Städten, in denen er Marshal war. Jemand bietet den Saloonbesitzern Spieler, Girls und Schläger an. Er kassiert dafür und praktisch ist er dann für die Dauer des Auftriebs der Boss der Stadt.
Dies war so in Billings, in Miles-City und in Denver. Nur in Sheridan war es etwas anders. Dort brachte Clifton Savery nicht nur die Männer, sondern auch gleich zwei Saloons ins Spiel. Er unterbot die Preise der anderen Saloons, besaß außerdem noch den größten Store der Stadt und bestimmte mit seiner wilden Horde Rauswerfern und Revolverschießern genau so lange, bis es dem Marshal zu viel wurde.
Dieser Clifton Savery ist der haargenaue Typ eines eiskalten Mannes, der über Leichen gehen kann. Und sicher ist Sheridan weit genug entfernt, dass Marshal Elmar Dwyer seinen Todfeind nicht in dieser Stadt trifft.
Elmar Dwyer gibt sich einen leichten Ruck und geht auf den Gehsteig. Er sieht nach links, drüben kommen drei Spieler zusammen aus dem Himmelbett-Saloon. Die drei Spieler sehen ihn und ändern ihre Richtung. Sie gehen über die Straße und gehen vor ihm in den Red-Indian-Saloon hinein.
Sie lieben mich nicht, denkt Elmar grimmig. Sie wissen genau, dass sie auf ehrliche Art kaum jemals reich werden können. Und darum müssen sie die Karten so drehen, dass sie ein bisschen mehr Glück haben. Dies ist etwas, wofür ich sie einsperren kann. Und das gefällt ihnen nicht die Spur. Achtzig Spieler, und keiner sieht meinen Orden! Sie wünschen mich alle in die Hölle. Er hört den schrillen Pfiff der Rangierlokomotive vom Bahnhof her. Dort schiebt seit den Nachmittagsstunden eine Maschine der Union-Pacific die Viehwaggons auf das Abstellgleis an den Corrals.
Elmar kommt sich ganz allein in einer wilden Stadt vor.
Er geht vom Gehsteig auf die Straße, aber er sieht weder rechts noch links des Saloons jene starken Eindrücke der Stiefel im Morast der Straße.
*
Die drei Laternen über dem Dachbalken schaukeln leicht im Wind, und der Lichtschein tanzt, als er auf den Eingang des Saloons zusteuert.
Er streckt gerade die Hand nach dem rechten Flügel der Pendeltür aus, als diese aufgestoßen wird.
Der Mann muss von rechts gekommen sein, hat einen schwarzen Hut auf seinem blonden Haar sitzen und ein sonnenverbranntes Gesicht mit hellen Augen. Er ist nicht sehr groß und sicher auch nicht allzu schwer.
Dieser Mann stößt den Flügel so kräftig zurück, dass er an Elmars Hand prallt. Elmar hält den Flügel fest, sieht kühl auf den Mann, und Harvey Jones’ bartloses Gesicht zuckt einmal.
Harvey Jones, der ständig zwei Revolver trägt, und als sehr schnell verrufen ist, starrt in das kalte Gesicht des Marshals und lächelt dann unmerklich.
»Ein Indianer. Und er sucht jemand, der ihm die Haare schuldig ist. Nun, Indianer! Wen suchst du?«
»Jemand«, erwidert der Marshal knapp. »Nichts, was dich angehen könnte, Harvey. Geh mir aus dem Weg.«
»Natürlich«, beeilt sich Harvey Jones zu versichern. »Ich stehe dir nie absichtlich im Weg, Elmar. In diesem Saloon bist du nicht gern gesehen, weißt du das?«
Elmar Dwyer erinnert sich an den vorherigen Besitzer des Saloons, einen gewissen Nat Burns. Er erinnert sich daran, dass er ihm den Saloon dreimal für eine Woche geschlossen hat. Und nun hat Burns den Saloon verkauft. An wen, das ist ein Geheimnis geblieben. Und der Marshal gehört nicht zu den Leuten, die neugierig veranlagt sind.
»Ich weiß«, erwidert Dwyer ruhig. »Aber dieses Wissen hat mich noch nie gestört.«
Er steht so, dass man ihn vom Saloon aus nicht sehen kann. Und der schlanke und blonde Revolvermann, der lächelt, wenn er wütend wird, sagt träge: »Vielleicht würde es dich interessieren, wer den Saloon gekauft hat, wie? Elmar, ich war immer eine Spur neugierig. Und vielleicht weiß ich es.«
»Tatsächlich?«, fragt Dwyer sanft. »Nun, wer ist es?«
»Ein ziemlich guter Freund von dir«, sagt Harvey Jones und lächelt seltsam. »Geh hinein, du wirst ihn hinter dem Tresen sehen.«
Und damit geht er schleppend los, bleibt aber an der rechten Tragsäule des Vorbaues stehen und lächelt karg.
Dwyer sieht ihn einen Augenblick an und macht dann zwei Schritte. Beim ersten Schritt stößt er die Schwingtür ganz auf und beim zweiten ist er im Saloon.
Es ist seine Eigenart, sofort alles zu sehen, was sich in einem Raum abspielt. Und auch hier ist es nicht anders. Er sieht rechts die drei Spieltische, die acht oder neun Spieler und drei, vier Stadtbewohner und Cowboys an ihnen. Links sitzt Gladys Burns an einem Tisch und zeigt mehr von ihren Beinen, als nötig ist.
Hinter dem Tresen steht breit und wuchtig, sein zernarbtes Gesicht dem Eingang zukehrend, Hammer Leslie.
Hammer hat seine Ärmel aufgekrempelt, und seine tief liegenden Augen unter den beiden Augenbrauenwülsten, von denen eine Augenbraue fehlt, richten sich auf Dwyer.
Hammer Leslie verzieht sein Gesicht und streckt dann seine behaarte Brust heraus. Er trägt wie immer das Hemd drei Knöpfe weit offen, und sein eckiges Kinn schiebt sich vorwärts. Es sieht aus, als wenn er einen Sturm aufhalten will, der ihm entgegenfaucht.
Seine kleinen und bösartigen gelben Augen starren auf Elmar, und seine Hände zucken.
»Oha!«, sagt er grollend. »Wer kommt denn dort?«