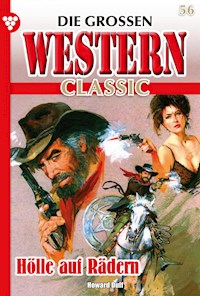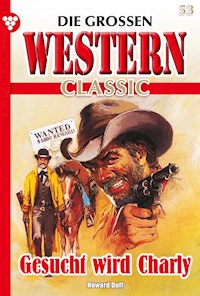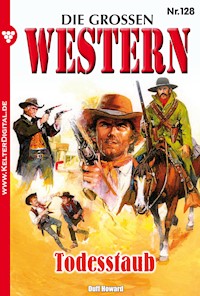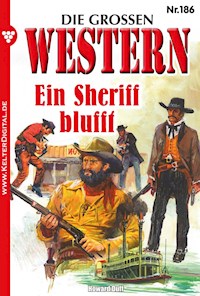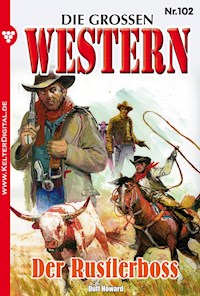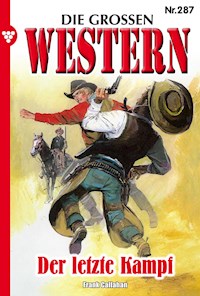Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). »Ben«, sagt der Mann hinter Ben Moore. »Ben, willst du nichts tun?« Ben Moore hört die Stimme und dreht den Kopf etwas herum, gerade soviel, daß er den Sprecher erkennen kann. Es ist Captain Lansing aus Fort Riley, ein großer blonder und meist lustiger Mann, aber er hat jetzt mit dem Zeichen von äußerster Besorgnis gefragt, ob Ben nichts tun will. Lansing blickt an Moore vorbei auf die Lampe über dem Saloon von Crook in Abilene, Kansas. Dann sieht er auf den Zivilisten mit dem einfachen, abgetragenen Rock und der verbeulten Hose, der so eiskalt wie ein Blizzard wirkt. Der Mann in den abgetragenen Sachen steht blond, breitbeinig und reglos mitten auf der Straße, gerade noch am Lichtkreis der Laternen über Crooks Saloon. Die Lampe schwankt ein wenig und schickt ihren Schein von seinen Stiefeln bis zur Hüfte hoch. Der Lichtschein bricht sich am Revolver des Mannes und an der dunklen, kräftigen Hand über dem Kolben des Colts. Dann zuckt Lansings Blick herum auf den Vorbau des Saloons und zu dem zweiten Mann hin der mitten vor der Tür steht und beide Hände flach über den Revolvern hängen hat. Ein hagerer, dürrer und leicht gekrümmt stehender Mann mit einem Texanerhut. »Nein«, erwidert Ben Moore träge und sieht schon wieder nach vorn. »Phil, sollen sie sich schießen, es wird nur einen Überlebenden geben. Und das wird nicht der Mann aus Texas sein.« Ben Moore ist einige Jahre als Scout für die Armee geritten, hat später Herden aus Texas über den Palo Duro nach Kansas gebracht und ist nun seit
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 205 –
Der letzte Moore
Howard Duff
»Ben«, sagt der Mann hinter Ben Moore. »Ben, willst du nichts tun?«
Ben Moore hört die Stimme und dreht den Kopf etwas herum, gerade soviel, daß er den Sprecher erkennen kann. Es ist Captain Lansing aus Fort Riley, ein großer blonder und meist lustiger Mann, aber er hat jetzt mit dem Zeichen von äußerster Besorgnis gefragt, ob Ben nichts tun will.
Lansing blickt an Moore vorbei auf die Lampe über dem Saloon von Crook in Abilene, Kansas.
Dann sieht er auf den Zivilisten mit dem einfachen, abgetragenen Rock und der verbeulten Hose, der so eiskalt wie ein Blizzard wirkt.
Der Mann in den abgetragenen Sachen steht blond, breitbeinig und reglos mitten auf der Straße, gerade noch am Lichtkreis der Laternen über Crooks Saloon. Die Lampe schwankt ein wenig und schickt ihren Schein von seinen Stiefeln bis zur Hüfte hoch. Der Lichtschein bricht sich am Revolver des Mannes und an der
dunklen, kräftigen Hand über dem Kolben des Colts.
Dann zuckt Lansings Blick herum auf den Vorbau des Saloons und zu dem zweiten Mann hin der mitten vor der Tür steht und beide Hände flach über den Revolvern hängen hat. Ein hagerer, dürrer und leicht gekrümmt stehender Mann mit einem Texanerhut.
»Nein«, erwidert Ben Moore träge und sieht schon wieder nach vorn. »Phil, sollen sie sich schießen, es wird nur einen Überlebenden geben. Und das wird nicht der Mann aus Texas sein.«
Ben Moore ist einige Jahre als Scout für die Armee geritten, hat später Herden aus Texas über den Palo Duro nach Kansas gebracht und ist nun seit einem Jahr wieder in Kansas.
Lansing tritt neben Moore, sieht kurz von der Seite in Ben Moores eckiges, von den deutlichen Schatten eines blauschwarzen Bartes verdunkeltes Gesicht und sagt, während sich der Mann in der schäbigen Kleidung und der Texaner auf dem Vorbau immer noch bewegungslos gegenüberstehen: »Kennst du einen?«
»Ja, Phil, den auf der Straße.«
»Diesen Tramp, Ben? Wer ist er?«
»Laßt ihn nicht hören, daß du ihn Tramp nennst, Phil, er würde auch vor deiner Uniform nicht anhalten«, sagt Ben ohne Warnung, aber doch etwas scharf. »Das ist Kaycee Yingells, schon mal von Kaycee gehört?«
Lansing starrt nur den Mann, der die schäbige Kleidung trägt, bestürzt an.
»Das soll Kaycee sein, Ben? Ich denke, Kaycee ist seit zwei Jahren tot?«
Ben Moore hebt leicht die linke Hand und lächelt seltsam.
»Daraus, daß er verwundet bei seiner Frau entkam, haben sie die Legende gemacht, er wäre tot. Dieser Texaner hat nicht die geringste Chance gegen Kaycee. Er kennt ihn sicher nicht. Teufel, da ist ja seine Frau.«
Der Captain sieht auf den Zeigefinger Moores, der nach links neben den Saloon deutet. Dort steht eine Indianerin in verstörter Haltung neben zwei Pferden. Im Licht der Laternen kann Phil Lansing ihr Gesicht ganz deutlich erkennen. Zwar weist auch dieses Gesicht die typischen, hervorstehenden Wangenknochen einer Indianerin auf, aber sie ist ohne Zweifel eine der schönsten Indianerfrauen, die der Captain jemals in den Staaten gesehen hat.
»Was für eine schöne Squaw, Ben, kennst du sie?«
»Ja, sie ist eine Oglalla, die Tochter eines Häuptlings. Kaycee hat mit ihr drei Kinder. Er handelt mit den Oglallas. Was mag es gegeben haben, sieh dir Kaycee, diesen wilden Burschen an, er ist blaß wie die Wand. Phil, der Texaner ist schon tot, obwohl er zwei Revolver trägt.«
»Dann tu’ doch was«, sagt Lansing leise. »Du kannst doch nicht zusehen, wenn Kaycee seinen verdammten Sechsschüsser nimmt und den Mann da erschießt. Warum redet denn keiner von beiden?«
Ben Moore schweigt. Und wie er stehen mindestens achtzig Leute reglos auf der Straße, den Gehsteigen und unter den Haustüren.
»Die Frau ist hingefallen«, sagt da Moore träge. »Kaycee hat schweißnasse Pferde, er muß schnell geritten sein und ist sicher gerade gekommen. Die Bluse der Squaw ist schmutzig. Ich möchte sagen, er hat versucht, mit ihr in den Saloon zu gehen, und dieser Bursche hat seine Frau vom Gehsteig geworfen. Der Mann ist tot und weiß es noch nicht, Phil.«
»Ben, tu was.«
»Nein, Phil.«
»Aber das kann doch vorkommen.«
»Eben. Es soll aber nicht vorkommen dürfen, Phil, so sehe ich das. Ich greife nicht ein, sieh dich nur genau um, rechts und links der Tür.«
Lansing blickt schärfer hin und erkennt drei Männer, die an der Wand stehen und im Rücken des Texaners sind. Er ist auch Texaner, aber schließlich stammt auch Moore aus Texas, dort ist er zu Hause. Daß er seinen Landsleuten nicht hilft, sagt Lansing eine Menge.
»Die Partner des Texasmannes?« fragt Lansing.
»Das denke ich. Und greife ich jetzt ein, dann haben sie keine rechte Vorstellung von dem, was auf sie wartet, mischen sie sich in den Kampf von Kaycee gegen ihren Partner ein. Abwarten, Phil. Geh besser etwas zur Seite, ich muß vielleicht meinen Revolver nehmen.«
»Du willst Kaycee helfen?«
»Ich helfe nur einem guten Mann, Kaycee ist einer.«
Lansing überlegt einen Augenblick und bleibt dann doch stehen.
Vor ihm wird das Schweigen nun von Kaycee unterbrochen, der den Kopf bewegt und den Texaner starr ansieht.
»Ich sage – zieh, Mann!«
»Zieh du doch, Squawmann!«
Der Texaner steht angespannt wie eine Feder da und wartet auf Kaycees erste Bewegung zum Revolver. Kaycee aber, dessen blondes Haar hell wie reifes Stroh ist, schüttelt leicht den Kopf.
»Wir können noch drei Stunden so stehen, ziehst du nicht, Cowpuncher.«
Der Texaner schiebt trotzig den Unterkiefer vor und sagt wild: »Und das alles wegen ’ner Indianerin. Sie hat nichts in ’nem Saloon für Weiße verloren. Mann, ich bin Chap Billham, sei kein Narr.«
Moore sagt leise: »Die Billhams sind aus Houston, eine wilde, rauhe Bande. Chap ist der schlimmste von allen, Phil. Er ist ein berüchtigter Schießer in der Houston-Ecke, aber er kennt Kaycee nicht. Paß auf, was passiert.«
»Ich sagte dir schon einmal, daß sie meine Frau ist. Zieh jetzt, Billham, ich warte immer noch.«
Kaycee blickt ihn nur an. Und in seinen braunen, düsteren Augen, die halb geschlossen sind, taucht ein wilder Funke auf, erlischt aber gleich wieder.
»Du wirst sterben, Tex«, sagt Kaycee dann, und seine Stimme ist kalt wie Eis. »Wenn du jetzt nicht ziehst, dann zwinge ich dich, du Feigling, der sich an einer Frau vergreift. Zieh, oder ich werde dich auslachen und dich einen schmutzigen Feigling nennen, der sich nicht traut, einen Kampf zu…«
Weiter kommt Kaycee nicht, denn Billham klatscht seine linke Hand zuerst hinunter.
Im Schein der Laternen sieht die Bewegung schnell aus, irgendwie verwischt. Zugleich knickt der Mann aus Houston leicht ein. Seine Hand hat den Kolben gerade berührt, als Kaycee sich bewegt.
Und niemand ist da, der nicht voller Schrecken die rasend schnelle Hand des Mannes bewundert.
Kaycee, Waldläufer und Armeescout wie Ben Moore, zieht so schnell, daß man die Hand kaum erkennt, die blitzartig unter die Jacke huscht. Schon kommt der schwere, langläufige Marinecolt unter der Jacke hervor, dann sticht die Mündung hoch, und der Hall des Schusses bricht sich dröhnend an der Wand des Holzhauses.
Kaycee bleibt jetzt ganz ruhig stehen, in seinen Augen sind zwei wilde, sengende Flammen. Einen Augenblick wirkt dieses Gesicht genau wie eine Maske.
Dann dreht sich oben auf dem Vorbau Chap Billham nach rechts, sein linkes Bein knickt ein. Der lange, hagere Körper des Mannes aus Texas neigt sich zur Seite, vollführt eine halbe Drehung und stürzt dann auf die Straße.
Einen Augenblick stehen seine drei Partner vor Schreck starr und gebannt an ihren Plätzen, aber dann zuckt der Mann links außen an der Wand des Saloons zuerst und knickt ein.
»Vorsicht, Phil«, sagt Moore schnappend, aber immer noch ist seine Stimme ruhig. »Jetzt werden sie verrückt. Drei gegen einen.«
Moores kräftige, braungebrannte Hand klatscht auf den Kolben seines Revolvers.
Und seine Stimme läßt die Männer erstarren, die plötzlich jemand schräg in der Seite haben.
»Vorsicht, Freunde, nur vorsichtig. Hier ist Ben Moore, macht keinen Ärger.«
Der Mann links, auf den bereits Kaycees Revolver deutet und der sicher in dieser Minute tot sein müßte, hebt die Hand, als wenn der Kolben des Colts vom Feuer angeglüht worden ist. Die anderen beiden rucken herum und erkennen nun Ben Moore, dessen Name in ganz Texas ein Begriff ist, wenigstens bei allen Männern, die etwas mit Rindern zu tun haben.
Drei Mann stehen urplötzlich so still, als wenn jemand bei einigen Grad Kälte Wasser über sie gegossen hat und sie erstarrt sind zu Eis.
In Bens Hand liegt der schwere mattblaue Stahl eines Dragonerrevolvers. Die Mündung streicht nun langsam über die drei Männer hinweg. Niemand rührt sich.
Vor dem Gehsteig liegt Chap Billham auf dem Gesicht. Kaycee steht angespannt da und weiß in dieser Sekunde, daß er drei Mann niemals schaffen konnte.
»Laßt die Revolver stecken, Freunde«, sagt Moore sanft. »Keinen Ärger mehr, ein Narr ist genug. Kaycee erwischt sicher zwei von euch noch, den dritten müßte ich dann töten. Das ist Kaycee Yingells, Leute, wollt ihr Narren sein?«
Die drei Texaner fahren zusammen und richten ihre Blicke nun auf Kaycee.
»Kaycee?« fragt einer von ihnen tonlos.
Kaycee blickt sie der Reihe nach an, seine Augen sind voller schwelender Düsterkeit. Und Moore, der ihn genau kennt, fragt sich, ob der wilde Kaycee nun einen nach dem anderen fordern wird. Sie haben Kaycee tödlich beleidigt, das ist gewiß. Kaycee liebt diese Indianerin sehr.
»Kaycee, nicht, tue es nicht.«
Zur Überraschung aller sagt es die Indianerin. Sie spricht ein gutes Amerikanisch.
Die dunklen Augen Kaycees wandern zu seiner Frau. Eine Sekunde scheint er zu zaudern, dann lächelt er schnell und kurz, ein Lächeln, das nur seiner Frau gilt.
»Ich sollte euch alle drei umbringen«, sagt Kaycee dann auch schon zischend und so grimmig, daß manchem der Zuschauer eine Gänsehaut über den Rücken läuft. »Sie meint, ich soll es nicht tun, einer ist genug. Nur, weil sie es sagt, habt ihr gehört? Nehmt diesen wilden Affen da und schafft ihn weg. Und faßt noch einmal einer von euch meine Frau an, dann hat er eine Kugel in der Stirn.«
Er wirbelt seinen Revolver herum, der blitzend unter seiner Jacke verschwindet. Dann geht er los, als wenn er keine drei Männer in der Seite hat, die jeden Augenblick ziehen können. Wie immer es aber auch ist, was diese drei Mann aus Texas auch denken, sie tun nichts.
Da ist Kaycees Name, ein Name, bei dem selbst wilde Burschen die Vorsicht packt. Einen nimmt Kaycee auch noch mit, wenn sie von hinten schießen, das wissen sie. Und wirklich keiner möchte der erste sein, der stirbt.
Zudem ist Ben Moore da. Die Blicke der Männer ruhen auf Ben Moore, auf seinem blauschwarzen Revolver und dem kühlen Lächeln auf seinem Gesicht.
»Ben«, sagt einer von ihnen bitter, »hast du uns nicht vorher gesagt, daß es Kaycee ist? Chap könnte noch leben, Mann.«
»Niemand kann Chap halten, das wißt ihr so gut wie ich, Freunde. Seid friedlich, zufällig waren Kaycee und ich einmal Partner.«
»Wie konnten wir das wissen?«
Diese Feststellung klingt mürrisch, dann bewegen sie sich und gehen zu Chap. Von rechts kommt Ward Stevens, der Deputymarshal heran, hat die Hand am Revolver und bleibt dicht neben Kaycee stehen, der ihn reglos erwartet.
»Dein Name?« fragt er grollend. »Warum habt ihr euch geschossen, zum Teufel? Ist denn kein Tag ohne einen Toten in Abilene?«
Kaycees dunkles Gesicht wendet sich ihm zu, er lächelt bitter.
»Er hat meine Frau vom Gehsteig geworfen«, sagt er dann. »Und danach wollte er mich wegjagen. Ich gehe in jeden Saloon dieser Stadt – mit meiner Frau.«
Er blickt zu der Indianerin, die reglos am Pferd steht und ihn so anblickt, daß Moore die Liebe lesen kann, die sie für Kaycee empfindet.
»Das ist deine Frau?« fragt Stevens heiser. »Nun, Mann, du solltest doch wissen, daß man Indianer in Abilene nicht gern in einem Saloon sieht. Die Burschen aus Texas hier kommen aus dem tiefen Süden. Dein Name, Fremder?«
»Kaycee Yingells, Marshal.«
»Wer bist du? Kaycee Yingells? Ich denke, du bist tot? Verdammte Geschichte. Wer zog zuerst?«
»Billham war es, nicht Kaycee«, mischt sich nun Moore ein und geht los. »Hallo, Kaycee, schlimme Sache.«
»Nein, ich denke nicht. Dieser Narr. Es war mein Fehler, ich dachte, man würde sie nicht belästigen, weil ich dabei war. Ben, danke, daß du eingegriffen hast.«
Er sieht Ben an und streckt die Hand aus, die eben noch den Hammer gespannt und den Schuß gelöst hat. Ein fester, harter Männerdruck, dann ein karges Lächeln, halb verwischt.
Stevens steht dabei und beißt sich auf die Lippen.
»Also gut, Kaycee. Sieh aber zu, daß du heute nicht noch ein Dutzendmal ziehen mußt.«
»Schon gut, Marshal, ich werde mich vorsehen und sie gleich auf ihr Zimmer bringen. Vielleicht bleibst du besser in der Nähe, bis sie auf dem Zimmer ist.«
Stevens brummt etwas, das niemand versteht. Dann geht er auf die drei Männer zu, beugt sich über Billham und richtet sich wieder auf.
»Bringt ihn zum Coroner oder holt ihn her«, sagt Stevens und wendet sich schnell ab. »Nun macht schon, es langt mir für heute. Was laßt ihr Narren euch mit diesem halben Indianer ein.«
Er wendet sich um, wartet, bis sie mit Billham, den sie zwischen sich tragen, verschwunden sind und setzt sich dann in Bewegung. Stevens geht in den Saloon, sicher, um sich mit einem Whisky das üble Gefühl aus seinem Magen zu vertreiben.
Ben Moore aber steht neben Kaycee auf der Straße, Lansing kommt nun zu ihnen und begrüßt Kaycee durch Handschlag.
»Du warst lange krank, Kaycee?« fragt Lansing kurz. »Wohin willst du jetzt?«
»Nicht mehr zur Armee, Captain, das ist sicher. Ich habe einige Wagenladungen voll Felle in der Nähe und will sie verkaufen. Diese Narren, hätte ich meine Frau nur draußen vor der Stadt gelassen. Dort stehen die Wagen mit ein paar Indianern. Nun gut, ich hätte es wissen müssen, aber ich dachte nicht, daß sie immer noch so verrückt sind, wenn eine Indianerin auftaucht. Komm her, Minnetoka.«
Die Indianerin setzt sich gehorsam in Bewegung und kommt leichtfüßig heran.
»Willst du mir nicht die Hand geben, Minnetoka?« fragt Moore lächelnd. »Du kennst mich doch noch?«
»Ja, ich kenne dich noch, und ich danke dir, daß du Kaycee geholfen hast«, erwidert sie leise. »Du denkst nicht, du machst dich schmutzig, wenn du einer Indianerin die Hand gibst, ich weiß es.«
Sie reicht ihm die Hand, auch Lansing bekommt einen Händedruck, dann tritt die Indianerin wieder einen halben Schritt hinter Kaycee zurück. Auf ihrem Stirnband ist der springende Büffel, das Zeichen ihrer Sippe, eingestickt.
»Deine Kinder, wo hast du sie?« fragt Moore Kaycee.
»Zu Hause, wir haben uns ein großes Blockhaus gebaut, in dem sie sicher bei Minnetokas Ziehschwester leben, solange wir unterwegs sind. Ben, welcher Wind hat dich hergeweht?«
»Der Wind über einer Herde, aber diesmal ist es meine eigene, Kaycee. Siebenhundert Rinder der Moores. Ich bin mit ein paar angeworbenen Leuten losgezogen und habe die Herde fast ohne Verlust durchgebracht. Morgen geht es zurück, ich wollte gerade mein Geld holen, als ich dich sah und lieber stehen blieb. Was macht der alte Häuptling?«
»Er kommt manchmal mit seinen Vettern und sieht sich seine Enkelkinder an. Ich weiß nie, was der alte Bursche gerade denkt, aber unfreundlich ist er nicht, eher zahm. Und du, noch keine Frau, Ben?«
»Nein, Kaycee, die richtige ist mir noch nicht begegnet. Du hast sicher bei Burns zu tun, wie? Dann sehen wir uns bestimmt noch.«
»Ich werde bei Crooks wohnen und drei Tage bleiben, Ben. Sei vorsichtig, wenn du dein Geld holst, erst vor ein paar Tagen haben einige Bravados einem Trailboß das Fell über die Ohren gezogen, der über zehntausend Dollar bei sich trug. Die Burschen sind von Dodge City aus, wo sie den Überfall ausführten, nach Norden geritten, heißt es, aber wer sagt, daß ihr Beispiel nicht andere Narren ansteckt?«
»Ich passe schon auf. Meine Leute sitzen bei Culvert und warten auf ihr Trailgeld. Also, bis dahin, Kaycee – Minnetoka.«
Er verabschiedet sich und geht weiter, aber Lansing holt ihn nach wenigen Schritten ein und geht neben ihm her.
»Meinst du, daß sie Kaycee in Ruhe lassen werden?« erkundigt sich der Captain besorgt. »Es sind mehr als hundert wilde Texaner in der Stadt, die den Tod von Billham vielleicht zu einer Schießerei benutzen. Und allein ist auch Kaycee ein verlorener Mann, Ben.«
»Es war ein fairer Kampf, Phil. So wild unsere Boys auch sind, was fair ist, wissen sie immer noch. Möglich, daß sich der eine oder andere an Kaycee zu reiben versucht, aber ich glaube kaum an eine Schießerei. Der Trail hier herauf ist zu hart, die Boys sind froh, wenn sie jetzt ein wenig Ruhe haben. Phil, hast du was?«
Er blickt Lansing kurz von der Seite an, und Lansing seufzt melancholisch.
»Hast du eigentlich Zeit, Ben? Ich meine, der Trail ist doch für dich vorbei. Und in diesem Jahr gehst du sicher nicht mehr mit einer Herde auf den Weg nach Norden. Ben, ich könnten einen guten Mann gebrauchen, auf den ich mich verlassen kann. Die Roten im Indianergebiet sind ziemlich unruhig, das wirst du selber gemerkt haben, als du heraufgezogen bist. Ich soll mit ein paar Patrouillen quer durch Indianergebiet, nach Süden und hätte einen guten Mann nötig. Willst du nicht…«
Er bricht ab, er hat das Gefühl, daß Ben Moore bei seinem damaligen Entschluß bleiben wird, nie mehr als Scout für die Armee zu reiten.