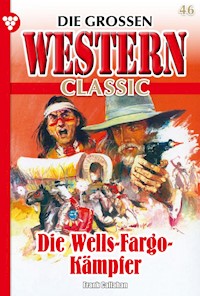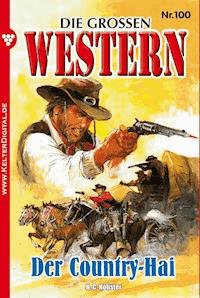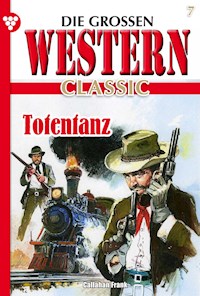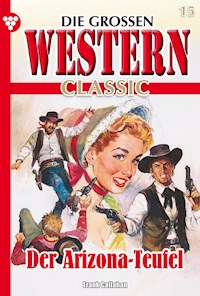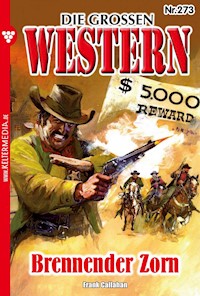
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Ich wollte es einfach nicht glauben! Mein Vater sollte ein Verbrecher sein? Saß er tatsächlich in einem mexikanischen Zuchthaus und wartete auf sein Ende? Nein! Das konnte nicht wahr sein! Nie und nimmer hätte ich meinem Vater ein Verbrechen zugetraut. Ich war davon überzeugt, daß er unschuldig war, und deshalb ritt ich nach Mexiko. Ich wußte selbst, daß ich mir etwas Unmögliches vorgenommen hatte, aber in mir brannte solch ein furchtbarer Zorn, daß es für mich kein Zurück mehr gab. Der Canyonschlund gähnte düster und erinnerte an das klaffende Maul eines vorsintflutlichen Ungeheuers. Bleiches Mondlicht flutete über die unwegsame Bergwildnis. Ich zügelte meinen Rapphengst hinter einigen Felsschroffen und zog mein Gewehr aus dem Scabbard. Außer den vertrauten Lauten der Natur waren keine verdächtigen Geräusche zu vernehmen. Das Heulen eines Wolfes ließ meinen Rapphengst erschreckt auf den Hufen tänzeln. Ein anderer Lobo antwortete. Ich tätschelte meinem treuen Vierbeiner sachte den schweißverklebten Hals und sprang aus dem Sattel. Dann starrte ich auf die Hufspuren, die auf den Canyon zuführten. Es waren mehr als dreißig Pferde, die ihre Abdrücke auf dem harten Boden hinterlassen hatten. In Gedanken verwünschte ich die fünf Pferdediebe, die unserer kleinen Ranch die letzte Herde gestohlen hatten. Seit über sechs Stunden verfolgte ich die Rustlers. Ich hatte alle schmutzigen Tricks der Höllenhunde durchschaut und mich nicht abhängen lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 273 –
Brennender Zorn A
Frank Callahan
Ich wollte es einfach nicht glauben! Mein Vater sollte ein Verbrecher sein? Saß er tatsächlich in einem mexikanischen Zuchthaus und wartete auf sein Ende? Nein! Das konnte nicht wahr sein! Nie und nimmer hätte ich meinem Vater ein Verbrechen zugetraut. Ich war davon überzeugt, daß er unschuldig war, und deshalb ritt ich nach Mexiko. Ich wußte selbst, daß ich mir etwas Unmögliches vorgenommen hatte, aber in mir brannte solch ein furchtbarer Zorn, daß es für mich kein Zurück mehr gab. Ich war bereit, Kopf und Kragen zu riskieren, um meinen Vater rauszuhauen…
Der Canyonschlund gähnte düster und erinnerte an das klaffende Maul eines vorsintflutlichen Ungeheuers. Bleiches Mondlicht flutete über die unwegsame Bergwildnis.
Ich zügelte meinen Rapphengst hinter einigen Felsschroffen und zog mein Gewehr aus dem Scabbard. Außer den vertrauten Lauten der Natur waren keine verdächtigen Geräusche zu vernehmen.
Das Heulen eines Wolfes ließ meinen Rapphengst erschreckt auf den Hufen tänzeln. Ein anderer Lobo antwortete. Ich tätschelte meinem treuen Vierbeiner sachte den schweißverklebten Hals und sprang aus dem Sattel.
Dann starrte ich auf die Hufspuren, die auf den Canyon zuführten. Es waren mehr als dreißig Pferde, die ihre Abdrücke auf dem harten Boden hinterlassen hatten.
In Gedanken verwünschte ich die fünf Pferdediebe, die unserer kleinen Ranch die letzte Herde gestohlen hatten. Seit über sechs Stunden verfolgte ich die Rustlers. Ich hatte alle schmutzigen Tricks der Höllenhunde durchschaut und mich nicht abhängen lassen.
Mir war klar, daß meine Mutter und ich aufgeben mußten, wenn es mir nicht gelang, die kostbaren Zuchtpferde zurückzubringen!
Und wenn ich ehrlich gegen mich selbst war, dann standen meine Chancen verdammt schlecht, dieses rauhe Spielchen zu meinen Gunsten zu entscheiden.
Bestimmt hockten zwei, drei Rustlers drüben im Canyon, um den Trail ihrer Kumpane abzusichern.
Die Grenze nach Mexiko war nicht mehr weit. Mir war längst klar, daß ich es mit mexikanischen Bandoleros zu tun hatte, die unsere letzte Pferdeherde davongetrieben hatten.
Ich spähte zum Canyon hinüber. Das Gefühl einer drohenden Gefahr sprang mich wie der heiße Atem eines Raubtiers an. Ich schluckte schwer und rückte meinen Revolvergurt zurecht.
Nein – es war keine Angst, die mich bewegte. Trotz meiner 20 Jahre stand ich mit beiden Beinen voll im Leben und hatte mich schon mehr als einmal meiner Haut wehren müssen.
Ich dachte an Mutter. Wenn mir etwas zustieß, war sie ganz allein. Mein Vater war vor drei Jahren verschwunden und seitdem nicht wieder aufgetaucht.
Er hatte uns damals nicht gesagt, was er in Mexiko zu erledigen hatte. Es mußte aber ungeheuer wichtig für ihn sein. Mutter stellte keine Fragen, und ich hatte meinem Dad nur alles Glück dieser lausigen Welt gewünscht.
Vater hatte lange Jahre drüben in Sonora gewohnt, war dort auch aufgewachsen. Sein Vater war Mexikaner und seine Mutter eine Texanerin gewesen. Als mein Dad meine Mutter vor über 20 Jahren kennenlernte, hatten sie sich im Arizona Territorium niedergelassen. Und nun lebten wir seit vielen Jahren davon, erstklassige Pferde zu züchten. Viele der Vierbeiner verkauften wir an die Armee.
Seit Dads Verschwinden war es mit der kleinen Pferderanch abwärts gegangen. Eine Seuche und ein endlos langer und heißer Sommer hatten viel dazu beigetragen. Und auch die verdammten Pferdediebe, die immer wieder zuschlugen und die Ranch an den Rand des Ruins brachten.
Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, während ich noch immer zum Canyon hinüberblickte.
Nach wie vor rührte sich dort nichts. Doch ich fühlte noch immer instinktiv, daß mir große Gefahr drohte.
Ich schob meinen Stetson in den Nacken und strich eine Strähne meines schwarzen und gelockten Haares aus der Stirn.
Ich legte meine Hand auf den Griff meines Revolvers. Diese Berührung gab mir neue Kraft und Zuversicht. Ich war ein schneller Mann mit dem Colt, obwohl ich bestimmt kein Revolverschwinger war.
Die Fähigkeit, schnell zu ziehen und genau zu schießen, hatte ich von meinem verschollenen Vater geerbt. Auch er konnte mit seinem Eisen zaubern und es mit den ganz Großen in der Gilde der Revolverkämpfer aufnehmen.
Ich schulterte meine Winchester und zog meinen Colt aus dem Leder. Dann schlich ich vorwärts.
Wenn ich die Pferdeherde nicht verlorengeben wollte, mußte ich durch den Canyon. Eine andere Möglichkeit gab es nicht – außer, ich wollte einen Umweg von mehr als zwanzig Meilen auf mich nehmen.
Dann aber waren die Rustlers längst in der grenzenlosen Weite der Sonorawüste untergetaucht.
Es gab genügend Deckungsmöglichkeiten auf dem Weg zu dem dunkel gähnenden Schlund des Canyons. Nur auf den letzten dreißig Yards änderte sich das abrupt. Da wurde das Gelände eben. Ich würde mich wie auf einem Präsentierteller bewegen müssen.
Das schmeckte mir nicht besonders. Ich gab nicht auf.
Als ich die letzten Felsbrocken vor der Canyonöffnung erreichte, ging ich dort in die Hocke und spähte erneut zu meinem Ziel hinüber. Noch immer konnte ich nichts Verdächtiges entdecken.
Der dumpfe Druck in meinem Magen wurde stärker.
Ich ging zu Boden und kroch auf den Canyon zu.
Sekundenbruchteile später hämmerten drei Winchestergewehre los und brannten ein heißes Feuerwerk ab. Ein Bleihagel fauchte heran. Rechts und links neben mir furchten die Geschosse den Boden.
Und mir war klar, daß ich bis über beide Ohren in einer verteufelten Klemme steckte…
*
Einen Augenblick lang wünschte ich mir, mich in ein Mauseloch verkriechen zu können. Doch dann reagierte ich, sprang auf und jagte im Zickzack auf die schützenden Felsen zu, die ich vor wenigen Sekunden verlassen hatte.
Ich mußte in dieser kurzen Zeitspanne einen Schutzengel gehabt haben. Anders konnte ich es mir nicht erklären, daß keine Kugel mich traf. Nur eine halbe Unze Blei scheuerte über meine rechte Schulter und nahm einen Fetzen aus meiner Lederjacke mit.
Ich warf mich hinter einen Felsbrocken und atmete mehrmals tief durch. Heisa – das war verdammt knapp gewesen.
Die drei Bandoleros schossen noch immer. Die Geschosse klatschten gegen meine Deckung oder sirrten darüber hinweg.
Dann nahmen die Schußdetonationen ab – verstummten. Die drei Strolche sahen ein, daß sie nur Munition vergeudeten. Und mir war klar, daß es kaum eine Möglichkeit gab, in den Canyon einzudringen, um meiner gestohlenen Pferdeherde zu folgen.
Die drei Halunken würden den Canyon einige Stunden besetzt halten, bis ihre beiden Kumpane mit den so kostbaren Zuchtpferden in Mexiko waren.
Und kaum ein Gringo würde es wagen, dort drüben etwas in Gang zu bringen.
Meine Gegner konnten den Canyon gegen eine ganze Armee verteidigen – vorausgesetzt, ihnen ging die Munition nicht aus.
Ich spürte heißen Zorn in mir aufwallen und mahnte mich zur Ruhe. Hitzköpfigkeit brachte mich jetzt auch nicht weiter.
Nachdem ich hinter dem Felsen hervorgespäht hatte, nahm ich meine Winchester von der Schulter und zielte zum Canyonschlund hinüber. Natürlich konnte ich keinen der Bandoleros entdecken.
Die Höllenhunde lagen in sicherer Deckung und warteten nur darauf, daß ich mich nochmals blicken ließ, um es mir dann gründlich zu besorgen. Diesen Gefallen wollte ich den Hundesöhnen nicht tun.
Minuten verrannen träge. Ich merkte plötzlich, daß Schweißperlen über meine Stirn liefen. Zum Henker – das alles war mir doch ganz schön an die Nieren gegangen.
Und ich dachte an die Zuchtpferde, die ich unbedingt zurückhaben mußte, sonst war es mit unserer kleinen Ranch aus und vorbei. In zwei Monaten war eine größere Rate des Kredits fällig, den ich auf der Bank in McDowell erhalten hatte. Und von dieser Rückzahlung hing ein weiterer Kredit ab.
Ich schob diese düsteren Gedanken zur Seite und fühlte wieder diese wilde Wut in mir aufsteigen. Dann krümmte ich den Zeigefinger und jagte einige bleierne Grüße zu den Hombres im Canyon hinüber.
Vergebens wartete ich darauf, daß die Rustler zurückschossen. Es fiel kein Schuß. Nichts. Einfach nichts.
Entweder waren die Halunken längst weitergeritten, oder sie wollten mich in Sicherheit wiegen. Ich sollte glauben, daß sie abgehauen waren, während sie in Wirklichkeit dort drüben lauerten und nur darauf warteten, mich wie einen Hasen abzuknallen, wenn ich mich nochmals anschlich.
Verdammt – was sollte ich tun?
Mit jeder Minute, die verging, wurde der Vorsprung meiner Herde größer.
Und jenseits der Berge der Sierra de San José, in denen ich mich befand, war schon mexikanisches Territorium.
Ich spähte angestrengt zum Canyon hinüber. Dann probierte ich einen uralten Trick aus, stülpte meinen Stetson auf den Lauf meines Gewehres und reckte ihn aus meiner Deckung hervor.
Nichts geschah!
Waren die Kerle wirklich davongeschlichen, um dann davonzureiten?
Ich ließ den Stetson nochmals sehen, obwohl ich nicht mehr daran glaubte, daß die Mistkerle auf diesen Bluff hereinfallen würden.
Ein Schuß krachte, und mein Stetson segelte davon. Gleichzeitig vernahm ich schallendes Gelächter, das zu mir herüberwehte.
Die Burschen nahmen mich nicht für voll und spielten mit mir. Ich holte meinen Hut, der nun ein Loch hatte, und stülpte ihn wütend auf meinen Schädel. Dann kroch ich rückwärts und erreichte mein Pferd.
Hier kam ich nicht durch. Das war klar. Mir blieb keine andere Wahl, als die Bergflanke zu umreiten, auch wenn es mich viele verlorene Stunden kosten würde. Ich wollte aber alles tun, um den Rustlers eins auszuwischen, denn ich war nun einmal ein Mann, der nicht so schnell aufgab.
*
Über einen Tag später sah ich unsere kleine Pferderanch vor mir liegen. Mein Rapphengst stolperte vor Erschöpfung. Und es tat mir sehr leid, ihn in den letzten Tagen so strapaziert zu haben.
Ich kehrte mit leeren Händen zurück, denn es war mir nicht gelungen, die gestohlenen Pferde zurückzuholen. Nachdem ich den Berg umritten hatte, fand ich die Fährten der Pferde nicht mehr.
Es war wie verhext.
Natürlich waren die drei Kerle am Canyon verschwunden gewesen. Und ich konnte mir vorstellen, daß sie sich halb totgelacht hatten.
Ich ritt viele Stunden in Richtung Mexiko und überquerte auch irgendwann die Grenze. Doch es war sinnlos, weiterzusuchen. Ich hatte das Spielchen verloren, obwohl ich mir das selbst nur schwer eingestehen wollte.
Ich zügelte meinen treuen Vierbeiner und stützte beide Hände schwer auf das Sattelhorn. So blickte ich auf die geräumige Blockhütte, auf den Stall und auf die große Scheune. Im Korral graste Mutters Fuchsstute.
Aus und vorbei, dachte ich. In spätestens zwei Monaten würde die Bank den Besitz versteigern lassen, wenn nicht ein Wunder geschah. Und ich glaubte nicht an Wunder.
Ich ritt langsam weiter und sprang auf dem staubigen Ranchhof vom Pferderücken. Mutter trat aus dem Blockhaus, lächelte mir zu und rieb ihre Hände an der Schürze trocken.
Bestimmt sah sie an meinem mürrischen Gesicht, daß mein Ritt erfolglos gewesen war.
Sie lief auf mich zu.
Mary Gomez sah man auch mit ihren fünfundvierzig Jahren noch an, daß sie einmal eine schöne Frau gewesen war. Seit Vaters Verschwinden gab es einen etwas bitteren Zug um ihre Mundwinkel.
Jetzt lächelte sie herzlich.
»Schön, daß du heil und gesund zurück bist, Johnny«, sagte sie herzlich. »Das ist die Hauptsache. Alles weitere wird sich finden. Mach dir nur nicht allzugroße Sorgen. Das Leben ist ein ständiges Auf und Ab. Wir fallen schon wieder auf die Füße, mein Junge. Komm jetzt ins Haus. Das Essen steht auf dem Tisch. Bestimmt bist du hungrig und durstig.«
So sprudelte sie und griff nach meinem Arm.
»Ich konnte die Herde nicht zurückholen«, kam es tonlos von meinen Lippen. »Ich habe versagt, Mam!«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ach was, mein Sohn«, sagte sie. »Wenn es dir nicht gelungen ist, die Pferdediebe zu erwischen, dann wäre es auch sonst niemandem auf der Welt gelungen. So gut kenne ich dich inzwischen. Das mit dem Kredit bekommen wir schon ins rechte Lot. Verlaß dich darauf.«
Sie wollte mich trösten, mir neuen Mut machen.
Ich entzog mich ihrer Hand. Schon wollte ich lautstark protestieren. Da sah ich ihren ernsten Blick und wußte, daß auch ihr klar war, wie es um die Ranch stand.
»Ich komme gleich zum Essen, Mutter«, sagte ich heiser. »Zuerst muß ich mich um mein Pferd kümmern.«
»Schon gut, Johnny.«
Ich versorgte mein Pferd, wusch mir den Staub des langen Rittes ab und setzte mich dann zu Mutter an den Tisch. Ich saß gedankenversunken.
»Wie soll es weitergehen?« fragte ich, nachdem ich meinen leeren Teller zurückgeschoben hatte. »Wir sind am Ende. Ich…«
Sie unterbrach mich auf ihre ruhige und besonnene Art, die ich so sehr an ihr schätzte.
»Du darfst dir keine Vorwürfe machen, mein Junge. Wir hatten viel Pech in den vergangenen Monaten. Ich fahre morgen nach McDowell und spreche mit James Hamilton, dem Bankdirektor. Er und dein Vater sind Freunde gewesen. Er wird uns nicht im Stich lassen. Hamilton weiß, daß du fleißig bist und die Ärmel hochkrempeln kannst. Spätestens in einem Jahr geht es uns wieder besser.«
Sie sah mich lächelnd an.
»Es genügt nicht, wenn wir den Kopf in den Sand stecken, Mutter«, antwortete ich rauher, als ich es eigentlich beabsichtigt hatte. »Gut, vielleicht hilft uns Hamilton sogar, was ich nicht einmal abstreiten möchte. Er verlängert aber höchstens den Kredit. Mit einem neuen können wir nicht rechnen. Und das bringt uns nicht weiter. Wir sind am Nullpunkt angekommen. Bis wir die ersten Pferde verkaufen können, vergehen mehr als zwei Jahre. Diese Durststrecke halten wir niemals durch.«
Ihr Lächeln erlosch. Tiefe Falten furchten ihre Stirn. Mutter sah plötzlich alt und verbraucht aus. Sie tat mir leid. Ich griff nach ihrer Hand, die sich sonderbar kalt anfühlte.
»Ich habe Vaters Erbe schlecht verwaltet«, fuhr ich fort. »Ihm wäre das nicht passiert.«
Mutter hob den Kopf. Und ich wußte, daß ich eine stillschweigende Vereinbarung zwischen uns gebrochen hatte. Schon seit über zwei Jahren sprachen wir nicht mehr über meinen Vater. Zu sehr hatte er meine Mutter enttäuscht.
»Auch er ist nur ein Mensch gewesen, Johnny«, sagte sie herb und konnte ein Zittern in ihrer Stimme nicht unterdrücken.
Sie schluckte mehrmals, ehe sie fortfuhr: »Du bist deinem Vater sehr ähnlich, mein Junge. Auch er wollte immer mit dem Kopf durch die Wand. Er kniff niemals – egal welche Schwierigkeiten sich vor ihm auftürmten. Was hast du vor? Wie ich sehe, hast du schon einen Entschluß gefaßt.«
Wie gut sie mich kannte!
Ich nickte ihr zu.
»Laß uns von hier fortgehen, Mutter. Wir fangen irgendwo nochmals von vorn an. Ich…«
»Und was wird aus Dorothy?« fragte sie ruhig, um mir den Wind aus den Segeln zu nehmen.
*
Es gelang ihr auch für einen kurzen Moment. Ich dachte an Dorothy Jenning, das Girl, das ich von ganzem Herzen liebte. Sie wohnte in McDowell und nähte dort für die Ladies der Stadt. So konnte sie sich einigermaßen über die Runden bringen, was ihr nicht leichtfiel – wie ich wußte.
Sie war neunzehn Jahre alt, blondhaarig und hatte alles, was das Herz bei jedem richtigen Mann höher schlagen ließ. Vor allem aber hatte sie das Herz auf dem richtigen Fleck.
»Sie wird mit uns kommen«, sagte ich ruhig.
»Bist du sicher, mein Junge?«
»Sie liebt mich, Mutter«, antwortete ich, als wäre das die selbstverständlichste Angelegenheit der Welt.
»Dann sprich mit ihr, Johnny. Ich mag Dorothy sehr. Sie ist ein gutes Girl. Ich hoffe nur für dich, daß sie…«
»Ist da etwas, wovon ich nichts weiß?«
Mutter senkte den Kopf.
»Wann hast du Dorothy zum letzten Mal gesehen?« fragte sie ernst.
»Vor über vier Wochen. Ich hatte keine Zeit, denn es gab zuviel Arbeit auf der Ranch«, antwortete ich.
Ihr ernster Blick beunruhigte mich immer mehr.
»Was verschweigst du mir?« stieß ich hart hervor.
Sie stand auf und stellte die Teller aufeinander, um sie abzuräumen. Ich griff nach ihrer Hand.
»Setz dich wieder, Mam. Sag mir die Wahrheit. Was ist mit Dorothy? Du weißt doch etwas. Bitte schone mich nicht.«
Meine Mutter ließ sich schwer auf ihren Stuhl zurückfallen und verschränkte die Hände ineinander. Als sie mich schon wieder so ernst ansah, fühlte ich für einen Herzschlag eine grauenhafte Leere in mir.