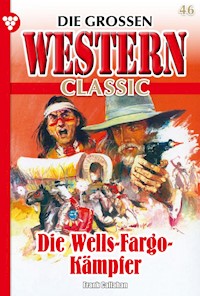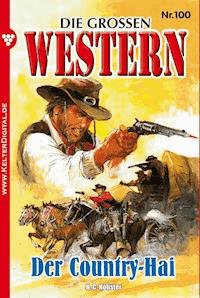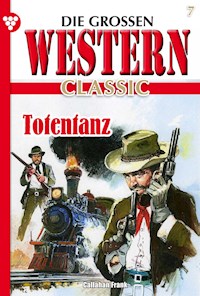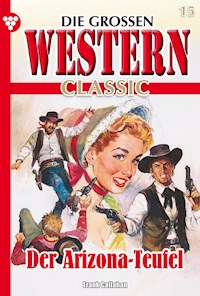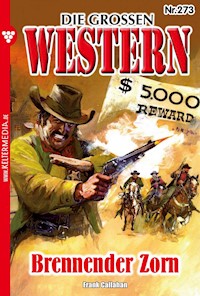Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Der Himmel war sternenklar. Bleiches Mondlicht sickerte zur Erde. Der Geruch von Erde und Gras wurde durch den lauen Wind von den Weiden herübergetragen. Johnny Rivers zügelte seinen grauen Wallach und tätschelte ihm beruhigend den schlanken Hals. »Gleich haben wir es geschafft, alter Junge«, murmelte er. »Dort im Tal liegt Tonson-City. Du bekommst auch eine Extraportion Hafer. Los, Alter, die letzten Meilen werden wir auch noch hinter uns bringen.« Das Pferd setzte sich zögernd in Bewegung. Sein narbiges Fell glänzte an einigen Stellen vor Schweiß. Ein langer Ritt schien hinter Pferd und Reiter zu liegen. Der ungefähr dreißig Jahre alte Mann reckte sich leicht im Sattel. In seinem hageren Gesicht funkelten zwei blaue, sehr bestimmt blickende Augen. Eine blonde Haarsträhne spitzte unter dem staubigen Stetson hervor. Johnny Rivers war ganz in schwarzem Leder gekleidet. Im Revolverhafter steckte ein 45-Colt mit elfenbeinfarbenem Kolben. Langsam kam der einsame Reiter den funkelnden Lichtern der kleinen Rinderstadt näher. Er fühlte feinen Sand zwischen seinen Zähnen. Die Lichter von Tonson-City rückten weiter heran.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 280 –
Regenbogen-Johnny
Frank Callahan
Der Himmel war sternenklar. Bleiches Mondlicht sickerte zur Erde. Der Geruch von Erde und Gras wurde durch den lauen Wind von den Weiden herübergetragen.
Johnny Rivers zügelte seinen grauen Wallach und tätschelte ihm beruhigend den schlanken Hals.
»Gleich haben wir es geschafft, alter Junge«, murmelte er. »Dort im Tal liegt Tonson-City. Du bekommst auch eine Extraportion Hafer. Los, Alter, die letzten Meilen werden wir auch noch hinter uns bringen.«
Das Pferd setzte sich zögernd in Bewegung. Sein narbiges Fell glänzte an einigen Stellen vor Schweiß. Ein langer Ritt schien hinter Pferd und Reiter zu liegen.
Der ungefähr dreißig Jahre alte Mann reckte sich leicht im Sattel. In seinem hageren Gesicht funkelten zwei blaue, sehr bestimmt blickende Augen.
Eine blonde Haarsträhne spitzte unter dem staubigen Stetson hervor. Johnny Rivers war ganz in schwarzem Leder gekleidet. Im Revolverhafter steckte ein 45-Colt mit elfenbeinfarbenem Kolben.
Langsam kam der einsame Reiter den funkelnden Lichtern der kleinen Rinderstadt näher. Er fühlte feinen Sand zwischen seinen Zähnen.
Die Lichter von Tonson-City rückten weiter heran. Sie versprachen dem jungen Mann Wärme, Ruhe und Geborgenheit.
Doch Johnny Rivers wußte zu gut, daß dieser friedliche Anblick täuschen konnte, denn wo es Menschen gab, waren Kampf, Haß und Tod nicht mehr weit.
Johnny erreichte die ersten Häuser der kleinen Town. Aus einigen Häusern fielen goldene Lichtbahnen auf die staubige Main-Street.
Vor dem Saloon waren über ein Dutzend Sattelpferde angebunden. Stimmenlärm erfüllte die Nacht. Wehmütiges Gitarrenspiel erklang, und dazwischen ertönte das schrille Lachen einiger Frauen.
Johnny Rivers leckte sich über die trockenen Lippen. Müde schwang er sich aus dem Sattel. Bevor der hagere Mann den Saloon betrat, rückte er seinen Revolvergürtel zurecht und schob seinen Stetson in den Nacken.
Der Stimmenlärm stockte, als er eintrat. Die Gitarre verstummte nach einem schrillen Akkord. Alle Augen richteten sich auf den hageren Fremden, der kurz nickte und dann mit zielsicheren Schritten zum Tresen trat.
Mißtrauische Blicke trafen ihn von allen Seiten. Es befanden sich vielleicht zwanzig Personen im Saloon. Einige Cowboys standen an der Theke und setzten ihre hartverdienten Dollar in Whisky um. An einigen Tischen wurde gepokert. Zwei Frauen waren auch da, von drei Männern umgeben.
»Ein großes Bier«, sagte Johnny grinsend und fuhr sich über den etwas zu groß geratenen Mund. Er erwiderte den prüfenden Blick des Keepers gelassen.
»Langer Ritt, was?« fragte der dicke Salooner und schob Johnny das gefüllte Glas hinüber. Der hagere Mann trank durstig und wischte sich dann den Schaum von den Lippen. Er nickte.
»Haben Sie eine Matratze frei, an der ich heute nacht horchen könnte?« fragte er den Wirt.
Der Dicke musterte ihn immer noch forschend. Plötzlich verengten sich seine Augen. Ein harter Zug legte sich um seine Mundwinkel.
»He, Mister«, sagte er knurrend. »Kenne ich Sie vielleicht?«
Johnny Rivers zuckte mit den Schultern. Er warf einen Seitenblick zu den anderen Gästen, doch die hatten sich längst wieder ihren Tätigkeiten zugewandt.
»Ich kenne Sie«, ließ der dicke Salooner nicht locker. »Mag vielleicht ein paar Jährchen her sein, aber…«
Er brach plötzlich ab: Eine tiefe Falte kerbte seine Stirn. Dann nickte er langsam.
»Johnny Rivers«, murmelte er dann, »Regenbogen-Johnny ist zurückgekehrt.«
Der hagere Mann schob dem Wirt sein leeres Glas über den Tresen.
»Lassen Sie die Luft raus, Mister«, sagte er lächelnd. »Sie haben ein gutes Gedächtnis. Seit wir uns zum letztenmal gesehen haben, sind immerhin fast zehn Jahre vergangen.«
Der Salooner schluckte mehrmals. Er glich einem Fisch auf dem Trockenen. Sein Gesicht glänzte plötzlich wie mit Öl eingerieben. Mit mechanischen Gesten füllte er das Glas.
»Wollen Sie hier in Tonson-City bleiben?« fragte er dann. Lauernd ruhte sein Blick auf Johnny.
Der junge Mann nickte.
»Sicher, Goulder, sicher. Sie haben doch nichts dagegen einzuwenden, oder?«
Das letzte Wort dehnte Johnny Rivers. Seine Augen hatten sich leicht verengt. Hart ruhte sein Blick auf dem Wirt.
»Reiten Sie weiter, Rivers, ganz schnell. Bringen Sie tausend Meilen zwischen sich und Tonson-City. Seit damals hat sich nicht viel geändert. Mark Harrison ist noch immer der Big Boß in diesem County. Er hat damals geschworen, Sie an den Ohren an eine Scheunentür zu nageln, wenn Sie sich hier nochmals sehen lassen sollten. Und Big Harrison machte bisher jede seiner Drohungen wahr. Reiten Sie weiter. Ich meine es nur gut mit Ihnen.«
Johnny trank von dem kühlen Bier.
Klirrend stellte er das Glas auf die blankpolierte Platte zurück.
Sein harter Blick traf den Salooner.
»Sie meinen es wohl immer nur gut mit mir«, spottete der hagere Mann und lächelte geringschätzig. »Vor zehn Jahren handelten Sie ähnlich. Damals waren Sie noch der Marshal von Tonson-City. Anstatt diesen größenwahnsinnigen Raubrancher Harrison in die Schranken zu weisen, jagten Sie mich aus der Stadt hinaus.«
Raul Goulder machte eine abwehrende Handbewegung. Große Schweißtropfen perlten ihm über die Stirn.
Johnny Rivers grinste jetzt.
»Sie brauchen sich nicht gleich in die Hosen zu machen, Goulder. Ich bin nicht Ihretwegen zurückgekommen.«
Der Salooner beugte sich leicht vor. Erleichterung stand in seinen Augen zu lesen.
»Reiten Sie weiter, Rivers. Big Harrison wird mit aller Härte auf Sie losgehen.«
Rivers nickte ruhig.
»Harrison soll mich nur schön in Ruhe lassen. Ich bin nicht mehr der Junge von vor zehn Jahren. Heute würde er sich die Zähne an mir ausbeißen.«
Raul Goulder schüttelte den Kopf.
»Zwei Revolvermänner begleiten den Rancher auf Schritt und Tritt. Schon einmal etwas von Black Dallas und Dean Savage gehört? Außerdem sind in seiner Mannschaft einige verdammt rauhe Fellows. Reiten Sie weiter, Rivers!«
»Wie sieht es mit dem Zimmer aus?« fragte Johnny Rivers. »Oder haben Sie Angst, daß es Big Harrison erfahren könnte?«
Der Salooner schluckte und fuhr sich mit seiner fleischigen Hand über die glänzende Stirn.
»Okay, Rivers. Sie bekommen Ihr Zimmer. Aber sagen Sie hinterher nicht, daß ich Sie nicht gewarnt hätte.«
Er holte vom Wandbrett einen Schlüssel und schob ihn über den Tresen. Johnny Rivers nahm ihn grinsend entgegen. Dann bezahlte er seine Zeche und verließ den Saloon. Er brachte seinen Wallach in den Mietstall und versorgte ihn gut.
Eine halbe Stunde später lag er in einem weichen Bett. Die gleichmäßigen Atemzüge verrieten, daß er sofort eingeschlafen war.
*
Mary O’Brien stellte die Heugabel zur Seite und verließ den Stall. Goldgelb leuchtete ihr blondes Haar unter den Strahlen der schon schrägstehenden Sonne.
In dem leicht ovalen Gesicht funkelten zwei dunkelblaue Augen. Nervös wischte sie sich beide Hände an der buntkarierten Schürze ab.
Sie starrte auf den Reiter, der nun die Gatterumzäunung des Ranchhofes erreicht hatte und sein Pferd langsamer laufen ließ.
Wenige Yards vor Mary O’Brien zügelte er das rassige Tier und sprang geschmeidig aus dem Sattel.
Der Körper der ungefähr achtundzwanzigjährigen Frau versteifte die Arme vor dem heftig atmenden Busen und starrte dem heranstiefelnden Mann mit unbewegtem Gesicht entgegen.
Mark Harrison zog lächelnd seinen Stetson. Sein markantes Gesicht, das von einer wallenden Haarpracht umrahmt wurde, erinnerte irgendwie an einen prächtigen Löwen.
Sein Alter ließ sich nur schwer schätzen, doch mochte er schon fünfzig Lenze hinter sich gebracht haben. Obwohl er immer noch lächelte, strahlte aus seinen Augen etwas wie kaltes Feuer.
»Hallo, Mrs. O’Brien«, klang seine sanfte Stimme auf. »Nett, Sie zu sehen. Mein Weg führte zufällig hier vorbei. Und ich dachte mir, daß Sie für ein wenig Abwechslung dankbar wären. Ich…«
Mary unterbrach ihn.
»Reiten Sie weiter, Mr. Harrison. Ich habe Ihnen doch wohl schon deutlich genug klargemacht, daß ich Ihre Besuche nicht schätze. Bitte verlassen Sie meine Ranch.«
Das breite Lächeln von Big Harrison verflüchtigte sich. Er schob seine Unterlippe leicht vor und schüttelte sorgenschwer den Kopf. Langsam trat er einige Schritte näher.
Die schöne Frau wich zurück.
»Ich finde es nicht besonders nett, wie Sie mich behandeln, Mrs. O’Brien. Ich hatte bisher sehr viel Geduld mit Ihnen, doch ich fürchte, daß ich bald zu anderen Mitteln greifen muß. Sie wissen, daß ich Sie verehre. Ein Heiratsangebot von mir haben Sie abgelehnt. Ich weiß nicht, was in Ihrem hübschen Kopf vor sich geht, aber ich würde zu gern herausfinden, warum Sie mich wie einen Aussätzigen behandeln? Ich möchte Ihnen mein Rinderreich zu Füßen legen. Sie würden die erste Lady hier in diesem County werden.«
Mary O’Brien winkte ab. In ihre Augen trat ein gefährliches Flackern.
»Verschwinden Sie, Harrison«, fauchte sie wie eine gereizte Tigerkatze. »Sie wissen genau, daß ich Sie am liebsten umbringen würde. Aber ich bin nur eine schwache, hilflose Frau. Glauben Sie vielleicht, daß ich vergessen habe, wer am Tode meines Mannes schuld ist? Glauben Sie das wirklich?«
Big Harrison schüttelte seinen Schädel. Die langen Haare flogen wild durch die Luft.
»Unsinn«, sagte er kehlig, »verdammter Blödsinn. Sie wissen genau, daß ich mit dem Tod Ihres Mannes nicht das Geringste zu tun gehabt habe. Bill wurde von Viehdieben erschossen, als er sie verfolgte und in einen Hinterhalt geriet. Ich hatte nie etwas gegen Ihren Mann, Mrs. O’Brien.«
Mary lächelte herb.
»Lassen wir das, Harrison. Reiten Sie weiter und schlagen Sie sich alles andere aus dem Kopf.«
»Ihr letztes Wort?« fragte er ernst. Sie nickte mehrmals.
»Mein letztes Wort, Harrison. Sie glauben, immer alles bekommen zu können. Und wenn Sie es nicht freiwillig erhalten, dann nehmen Sie es sich mit Gewalt. Auf Ihr verdammtes Rinderreich pfeife ich. Zuviel Blut und Tränen kleben daran. Los, verschwinden Sie, und machen Sie sich nur keine Sorgen um den Kredit. Sie bekommen in vierzehn Tagen die fünftausend Dollar.«
Mary O’Brien atmete schwer. Sie spürte, wie ihr Herz hart schlug. Haß funkelte in ihren Augen.
Mark Harrison setzte den dunklen Stetson auf. Sein Gesicht glich einer starren Maske. Er strich sich über den dunkelblonden Texanerbart und nickte langsam.
»Okay, Mrs. O’Brien, ich habe verstanden. Vielleicht werden Ihnen diese Worte noch einmal bitter aufstoßen. Hoffentlich können Sie auch die fünftausend Dollar in vierzehn Tagen bezahlen, denn sonst kommt Ihre Ranch unter den Hammer.«
Seine letzten Worte waren bitter wie Galle vor Spott. Er nickte nochmals, tippte sich an die Krempe seines Stetsons und trat zu seinem Pferd. Ohne nochmals einen Blick zurückzuwerfen, kletterte er in den Sattel und ritt davon.
Eine Staubwolke hüllte die junge Frau ein. Mit einer hilflos wirkenden Geste fuhr sie sich über das Gesicht. Langsam ging sie zu dem kleinen Ranchgebäude und setzte sich müde auf die davorstehende Bank.
Ihr Körper zuckte. Nervös krampften sich ihre schlanken Finger ineinander. Sie starrte zu den fernen Bergen hinüber, die von den letzten Strahlen der untergehenden Sonne beschienen wurden. Die zackigen Bergkämme leuchteten wie rotglühende Lava.
Ein trockenes Schluchzen brach jetzt aus dem weit geöffneten Mund der Frau. Verzweiflung lag in ihrem Blick.
Sie stand auf, als sich ein Reiter langsam näherte. Ein schon älterer Mann schwang sich mühsam aus dem Sattel. Nachdem er sich den Staub aus den Kleidern geklopft hatte, trat er bedächtig heran. In seinem faltigen Gesicht saßen zwei pfiffige Augen, die sich jedoch leicht verdunkelten, als sie in das ernste Gesicht von Mary blickten.
Old Sam fuhr sich mit einer Hand durch den wallenden Vollbart und murmelte einen Fluch. Dann schob er ein Stück Kautabak in die andere Mundhälfte und spuckte den Saft aus.
»Harrison?« fragte er mit staubtrockener Stimme. »Hat dich dieser Hundesohn wieder belästigt?«
Mary nickte nur. Wie hilfesuchend trat sie zu dem Oldtimer, der sie väterlich in seine Arme nahm.
»Keine Angst, Mary«, knurrte der Alte. »Nur jetzt nicht die Nerven verlieren. Wir sind schon mit ganz anderen Problemen fertig geworden. Mark Harrison wird bald seine Geduld verlieren und uns dann nicht mehr mit Samthandschuhen anpacken. Entweder wir stemmen uns gegen seine brutale Gewalt, oder wir geben auf.«
Mary wich zurück.
»Aufgeben?« stammelte sie. »Ist das dein Ernst, Sam? Wir haben fast zehn Jahre hier gearbeitet und gelebt. Bill liegt dort drüben begraben. Ich gebe nicht auf, niemals.«
Wie ein Schwur hatten ihre letzten Worte geklungen. Der Oldtimer lächelte beschwichtigend.
»Sicher, Mary. Charles und Freddy werden bald zurückkehren. Bestimmt haben sie die Herde in Abilene gut verkauft. Dann sind wir fein heraus. Wir können unsere Schulden bezahlen und haben sogar noch einige Dollars übrig. Big Harrison wird die Ranch nicht für ein Butterbrot bekommen wie bei dem Dutzend Ranches hier in diesem Tal. Außerdem gibt es auch noch einen Sheriff in Tonson-City. Frank Donovan ist ein guter Sheriff. Er hat sich bisher immer gegen Harrison behaupten können.«
Mary O’Brien nickte. Mit einer schnellen Handbewegung wischte sie sich einige Tränen von den Wangen.
»Komm mit ins Haus, Sam«, sagte sie, und es gelang ihr sogar ein Lächeln. »Ich habe dir dein Abendessen warmgestellt. Komm schon, es wird bestimmt alles gut werden!«
Der Oldtimer nickte ernst.
*
Lautlose Schatten huschten durch die Nacht.
Die drei Männer, die jetzt geduckt zwischen einigen Büschen verharrten, waren ganz in Schwarz gekleidet. Dunkle Halstücher bedeckten Mund und Nase.
Hart blickende Augen funkelten unter den tief in die Stirn gezogenen Stetsons. Kaltes Mondlicht brach sich auf den schweren Colts, die sie in den Händen hielten.
Einer der Männer nickte nun. Gedämpft klang seine Stimme unter dem Halstuch hervor.
»Verteilt euch, Jungs. Dort drüben glimmt noch das Lagerfeuer. Ich glaube nicht, daß uns die beiden Burschen große Schwierigkeiten machen werden.«
Ein anderer der Männer lachte glucksend auf. Sein Colt beschrieb einen Halbkreis. Die Banditen schlichen los. Geräuschlos näherten sie sich einem kleinen Camp. Matt schimmerte die Glut eines niedergebrannten Feuers. Irgendwo schnaubten Pferde. Zwei dunkle Bündel lagen in der Nähe des Lagerfeuers.
Die Banditen kamen von drei Seiten. Die Läufe ihrer Revolver zielten auf die beiden schlafenden Männer, die keine Chance hatten.
Als sie erwachten, starrten sie in die drohenden Mündungen der Colts.
»Kommt schon hoch, Jungs«, fuhr eine dumpfe Stimme sie an. »Wenn ihr euch ruhig verhaltet, passiert nichts. Bei der geringsten falschen Bewegung jedoch schicken wir euch über den Jordan.«
Die beiden Männer taumelten hoch. Sie waren noch jung, höchstens zwanzig Jahre alt. Angst stand in ihren Gesichtern. Sie starrten in die Mündungen der Colts, aus denen jeden Augenblick der Tod kommen konnte.
»Was – wollt ihr?« keuchte einer der beiden jungen Männer.
»Bei – uns gibt es – doch nichts zu holen!« stammelte der andere.
Einer der drei Banditen lachte schallend auf. Breitbeinig stand er vor den beiden Überfallenen und wippte leicht auf den Zehenspitzen. Dann spuckte er geringschätzig aus.
»Ich sehe einmal in den Satteltaschen nach«, knurrte er dann. »Schätze, daß wir auf eine Goldader gestoßen sind.«
Die beiden jungen Männer bewegten sich unruhig. Noch immer standen sie mit erhobenen Händen vor den Banditen.
»Sollte es euch vielleicht in den Fingern jucken, Freunde, dann vergeßt es schnell!« Der eine Bandit grinste. »Laßt nur die Finger von den Eisen. Das Geld bekommen wir doch.«
Ein Bandit war zu den Pferden der beiden getreten und machte sich an den Satteltaschen zu schaffen. Einige Augenblicke später klang sein triumphierender Aufschrei zu den anderen Männern hinüber. Gleich darauf kam er selbst. Er schwenkte ein kleines Päckchen, das er jetzt mit gierigen Bewegungen aufriß. Dollarscheine fielen zu Boden.
»Okay«, knurrte der Bandit zufrieden. »Wir haben das Geld. Was machen wir mit den beiden Heldensöhnen?«
Die Ausgeraubten wichen zurück. Noch bleicher wurden ihre angstverzerrten Gesichter.
»Wollen wir sie umlegen?« fragte einer der Banditen und hob seinen Revolver an.
Kalter Schweiß bildete sich auf den Stirnen der beiden jungen Männer. Wieder wichen sie einige Schritte zurück.
»Ach was, Jungs«, knurrte der andere Bandit. »Wir lassen die Fellows laufen.«
Er wandte sich an die beiden.
»Solltet ihr aber nach Tonson-City zurückkehren, dann nehmen wir euch endgültig vor, verstanden?«
Die beiden Cowboys nickten. Erleichterung ließ ihre Augen groß werden.
»Wir verlassen das County«, murmelte einer gepreßt. »Wir haben die Nasen voll.«
Die drei Banditen nickten zufrieden.
»Umdrehen«, kommandierte einer. »Wir werden euch jetzt etwas auf die Nuß geben, Jungs. Aber keine Bange, wir schlagen schon nicht zu fest zu.«
Wieder schlich sich Angst in die bebenden Gesichter der beiden Cowboys. Zögernd drehten sie sich um und zogen die Köpfe zwischen die Schultern.
Blitzschnell waren zwei der Banditen heran. Die Läufe ihrer Colts trafen die Köpfe der Wehrlosen, die mit einem heiseren Stöhnen zu Boden gingen. Bewußtlos blieben sie liegen.
»Das wär’s wohl gewesen«, brummte der eine Bandit. »Los, Jungs, wir verduften jetzt lieber. Das Geld haben wir. Der Boß wird eine Extraprämie springen lassen.«
Lachend verschwanden die drei Banditen zwischen den Büschen. Zurück blieben die beiden wie tot am Boden liegenden Cowboys.
Wenige Minuten später trommelten wirbelnde Hufschläge durch die Nacht. Die Räuber suchten das Weite.
*
Die dunklen Schatten der Nacht wichen. Graues Dämmerlicht fiel durch die verschmutzten Fensterscheiben in Johnny Rivers Zimmer.
Ein dumpfes Pochen an der Tür ließ ihn hochschrecken. Seine Hand tastete nach dem Colt unter dem Kopfkissen.
Es klopfte erneut.