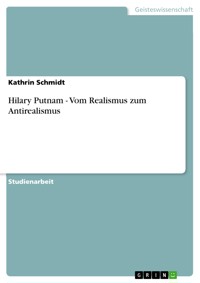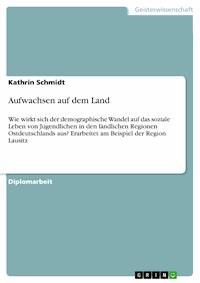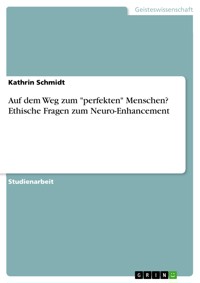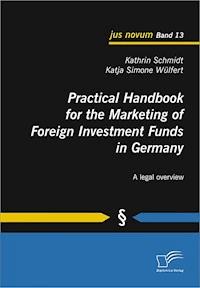18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Josepha Schlupfburg, Druckerin in einer thüringischen Kleinstadt im Jahre 1976, ist schwanger. Das Kind, das sie erwartet, wird unehelich sein. Josepha, durch die körperliche Veränderung in einen träumerischen Zustand versetzt, möchte für ihr Kind eine Geschichte haben. Und so begibt sie sich mit Therese, der Urgroßmutter, mit der sie zusammenlebt, auf die elf Etappen der Gunnar-Lennefsen-Expedition, um sich an ihre Sippe zu erinnern. Auf einer imaginären Leinwand erleben die beiden Frauen Episoden aus der Familiengeschichte der Schlupfburgs, Wilczinskis, Hebenstreits und Globottas, einer Geschichte, die das Jahrhundert umfaßt, von Ostpreußen bis Nürnberg reicht und aus einer endlosen Reihe strotzender Mütter, unehelicher Kinder, erregter und anschließend abwesender Väter besteht. Einen solchen Roman, wie ihn Kathrin Schmidt vorlegt, mit einer reichen, kraftvollen und poetischen Sprache, einer überbordenden Körperlichkeit und Erotik, einer grotesken Komik und unerschöpflichen Phantasie, hat es lange nicht mehr gegeben. Mit ihrer epischen Urkraft erzählt Kathrin Schmidt eine Art weiblicher Körper- und Familiengeschichte deutscher Aufbrüche und Verhängnisse, mit einem plebejischen Humor, dem die Lust nie ganz vergeht.Einen solchen Roman, mit einer reichen, kraftvollen und poetischen Sprache, einer überbordenden Körperlichkeit und Erotik, einer grotesken Komik und unerschöpflichen Phantasie, hat es lange nicht mehr gegeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
TitelPersonenverzeichnisMärz10. März 1976: Erste Etappe der Gunnar-Lennefsen-Expedition11. März 1976: Zweite Etappe der Gunnar-Lennefsen-ExpeditionApril1. April 1976: Dritte Etappe der Gunnar-Lennefsen-Expedition7. April 1976: Vierte Etappe der Gunnar-Lennefsen-Expedition8. April 1976: Fortsetzung der vierten Etappe der Gunnar-Lennefsen-ExpeditionMai26. Mai 1976: Fünfte Etappe der Gunnar-Lennefsen-ExpeditionJuni13. Juni 1976: Sechste Etappe der Gunnar-Lennefsen-ExpeditionJuli11./12. Juli 1976: Siebte Etappe der Gunnar-Lennefsen-ExpeditionAugust13. August 1976: Achte Etappe der Gunnar-Lennefsen-ExpeditionSeptember13. September 1976: Neunte Etappe der Gunnar-Lennefsen-Expedition28. September 1976: Zehnte Etappe der Gunnar-Lennefsen-ExpeditionOktober13. Oktober 1976: Elfte Etappe der Gunnar-Lennefsen-ExpeditionNovember. Und SchlussNachtragBuchAutorImpressumPersonenverzeichnis
Josepha Schlupfburg
Druckerin im VEB Kalender und Büroartikel Max Papp der thüringischen Kleinstadt W. und werdende Mutter des schwarzweißen Kindes
Therese Schlupfburg
Josephas Urgroßmutter
Ottilie Wilczinski
geb. Schlupfburg, spätere Reveslueh, häufig Glasbruch verursachende Tochter der Therese Schlupfburg, Großmutter der Hauptperson, Mutter Rudolph Schlupfburgs und, sensationell spätgebärend, des kleinen Avraham Bodofranz
August Globotta
genannt zärtlicher August, eintopfliebender ostelbischer Junkerspross, Vater der Ottilie
Rudolph Schlupfburg
entfernter Vater der Hauptperson
Marguerite Eaulalia Hebenstreit
erste Ehefrau Rudolph Schlupfburgs und Mutter der Hauptperson
Karl Rappler
wandernder ostpreußischer Scherenschleifer, später als Gennadij Solowjow Mitglied der KPdSU und der Kolchose »Roter Oktober« in einem Dorf nahe Witebsk, Scheinvater des Rudolph Schlupfburg
Birute Szameitat
zweite Ehefrau des Rudolph Schlupfburg, ostpreußische Wanderdüne, zwischenzeitlich polnisch-litauische Papierkirgisin, angeblich russischer Herkunft und deutscher Zunge, Kennerin des Entleerenden Handgriffs
Bodo Wilczinski
Irrenhauspförtner, im bayerischen N., erster Ehemann der Ottilie Wilczinski
Avraham Rautenkrantz
lettischer Jude, Vater des Rudolph Schlupfburg
Franz Reveslueh
bayerischer Fernsehmechanikermeister, zweiter Ehemann der Ottilie Wilczinski, neben Rautenkrantz und Wilczinski einer der drei Väter des kleinen Avraham Bodofranz
Adolf Erbs
einstiges Findelkind von den Stufen der Juditter Kirche, Kürschner und heimlicher Steinschneider in Königsberg/Pr., Vater des Fritz Schlupfburg
Fritz Schlupfburg
Anhänger des Himmels über L.A., Sohn des Adolf Erbs und der Therese Schlupfburg
Senta Gloria Lüdeking
geb. Amelang, Ehefrau des Hans Lüdeking, Adoptivmutter Lenchen Lüdekings, von dieser auch Tegenaria (die Winkelspinne) genannt
Hans Lüdeking
Fischhausener Ortspolizist, Vergewaltiger der Lydia Czechowska und darum Vater Małgorzata Czechowskas, die er später als Magdalene Tschechau unwissentlich adoptiert und wiederum schwängert im Angesicht seiner Ehefrau
Souf Fleur
Zeitgeist
Małgorzata Czechowska; Magdalene Tschechau; Lenchen Lüdeking; Ann Versup
die »vier Mütter«, eigentlich Tochter der Lydia Czechowska und des Hans Lüdeking, lebend in vier Identitäten und noch dazu bekannt als Hasimausi, sich selbst für eine Springspinne haltend und fähig, den Spinnen ins Herze zu schauen
Mirabelle Gunillasara Versup>
engl. Mairebärli, ihres eigenen Großvaters Hans Lüdeking Tochter und damit Kind der vier Mütter und Tochterschwester Ann Versups, womit sie aber keineswegs vollständig beschrieben scheint, denn auch Fritz Schlupfburg alias Amm Versup hält sie lange Zeit für seine und seiner Ehefrau Astrid Radegund leibliche Tochter
Romancarlo Hebenstreit
thüringischer Knopf- und Kurzwarenhändler, Ehemann der Carola Hebenstreit geb. Wilczinski, Zwillingsvater
Carola Hebenstreit
Schwester des Bodo Wilczinski, Sturzgebärende, Mutter der Zwillinge Benedicta Carlotta und Astrid Radegund sowie des Wasserkindes Marguerite Eaulalia
Willi Thalerthal
Vater des Wasserkindes, durch Carola Hebenstreits Zuwendung an Liebe und Frauenmilch vom knöchernen Amtsmenschen zum athletischen Anhänger des Kommunismus reifend
Carmen Salzwedel
Freundin und Kollegin der Hauptperson, vielfache Halbschwester
Annegret Hinterzart
verh. Benderdour, mit ihren Töchtern Magnolia und Kassandra in Burj ʼUmar Idris in der algerischen Wüste verschollene Kindheitsfreundin der Hauptperson
Manfred Hinterzart
Bruder der Annegret Hinterzart und Lehrling im VEB Kalender und Büroartikel »Max Papp«
Richard Rund
spät ertaubter volkssolidarischer Bergsteiger und Obstweintrinker, Liebhaber der Therese Schlupfburg
Mokwambi Solulere
angolanischer Herzblatthäkler, Vater des schwarzweißen Kindes
Ljusja Andrejewna Wandrowskaja
horizontal gespaltene, der dreidimensionalen Existenz schließlich endgültig entsagende drittlebende russische Tortenbäckerin
Adam Rippe
sächsischer Wurstbuchhalter, halbgöttlicher Sohn der L. A. Wandrowskaja
Rosanne Johanne
die Heimliche Hure, hier als Wirtin Annamirl Dornbichler auftretend
März
Josepha Schlupfburgs Faible für Taschenkalender geht weit über jenes Maß hinaus, das sich aus bloßer Erwerbsarbeit ergeben könnte. Du steckst in den Kalender eine Ewigkeit, den du entblätterst bei Kaffee und Bodenfrost, murmelt sie, wenn ihre Nächte unter der Rassel eines vorsintflutlichen (falls der Leser das Wort Sintflut als Synonym für den letzten Krieg gelten zu lassen geneigt ist) Weckers regelmäßig dahinsterben, aller Schlaf einer splittrigen Scheibe Toast zum Opfer fällt und der dicke braune Aufguss der Marke Rondo Melange mindestens dreimal ihre Tasse füllt. In der Küche einer Wohnung übrigens, die Josepha Schlupfburg seit ihrem sechsten Lebensjahr mit ihrer Urgroßmutter Therese teilt, mehr in Freud denn in Leid – und doch durch die Not an Wohnungen gedrungen, seit sie erwachsen ist und gern ein Eigenes hätte, ihren Rhythmus zu finden. Gewohntem ergeben, steht die Druckerin Josepha Schlupfburg auch heute (wie eh und je) mit der fünften Stunde auf, zu der die alte Therese zum ersten Mal zur Toilette zu schlurfen pflegt. Die Außenwand bezeichneter Küche, die den Hintergrund des hier zu schildernden morgendlichen Aufbruchs abgibt, hat Josepha Schlupfburg mit exakt zweiundzwanzig bebilderten Kalendern behängt, deren erster aus dem Jahre ihrer Geburt stammt und wie die der darauffolgenden sechs Jahre von Thereses Hand mit nicht zu vergessenden Terminen, Geburts- und Namenstagen und einer Vielzahl kaum zu entschlüsselnder Zeichen, Kreuzchen und Punkte übersät worden ist. Vom Jahr ihres Schulbeginns an hat dann Josepha die Feder geführt und vermerkt, was zu vermerken ihr wichtig schien. Zu den Weihnachtsfesten brachte sich Therese den Inhabern der Buch- und Schreibwarengeschäfte als treue Kundin in Erinnerung: Sie kaufte Kalender. Die Küchenwand bietet Tier-, Zirkus-, Pferde-, Kunst-, Vogel-, Blumen-, Kirchen- und Frauenkalender, deren monatliche Seiten eine Plastspirale zusammenhält oder Papierleim. Josepha, die sich beim Frühstücken unbeobachtet weiß, hat sich mit den Jahren einen rituellen Spaß daraus gemacht, mittels der ihr innewohnenden magischen und Zeitverschiebungs-Kräfte am jeweils Ersten des Monats durch einen besonderen Klapp-Blick die entsprechende Seite aufzuschlagen. Die Kalender lösen sich von der Wand und blättern sich weiter, um kurz darauf wieder an ihre Nägel zurückzukehren. So zeigen im Januar alle Kalender die Januarseite, im Februar die Februarseite und so fort, ohne dass Josepha auch nur einen Finger dafür krümmen müsste.
Das heutige Frühstück sondert sich ab. Josepha sitzt, trinkt die zweite Tasse Kaffee und klappt nicht, obwohl ihr das Datum, der erste März, keineswegs entgangen ist. Josepha ist nicht allein, ebenso, wie sie in der Nacht nicht allein gewesen ist. Josepha sitzt vor dem ersten März ihres Taschenkalenders mit der Nummer neunzehnhundertsechsundsiebzig und hat keine Angst vorm schwarzen Mann, sondern ihn eben abschiedshalber geküsst, die Wohnung hinter ihm geschlossen und das Laken ihres Bettes in kaltem Wasser geweicht. Josepha sitzt und weiß: Der schwarze Mann ist nicht nur der Vater ihrer momentanen Unentschlossenheit, sich wie bisher fortzuleben, er ist auch der Vater der Veränderung, die sie in ihrer Bauchgrube spürt und die, ahnt sie, zu einem sehr schönen Kind geraten kann. Da aber das Wort Vater seit Langem nur in ihrem passiven Wortschatz seinen Platz hat, veranlasst sie eine sofortige Reaktivierung dieses Begriffes, indem sie sich erinnert:
Eines sonnigen Frühstücks im Jahre ihrer Einschulung entnimmt ihr Vater dem linken oberen Seitenfach seines Kleiderschrankes einen Stapel von an die zehn unterschiedlichen Taschenkalendern und breitet sie vor Josepha auf dem Tisch aus, ehe er sie auffordert, sie möge sich den beiseitenehmen, der ihr am besten gefiele. Ein rotlackiges Exemplar macht das Rennen im Kinde. Der Vater legt das Büchlein vor sich auf die andere Seite des Tisches und beginnt, monatlich einen Sonntag mit einem grünen Kreuzchen zu kennzeichnen. – Hier, Josepha, an diesen Tagen kannst du mich besuchen kommen. Passt es, werde ich dich mit dem Auto abholen. Wir können im Café Lösche ein Eis essen, wir beide. Wenn du willst. Und abends gebe ich dich der Omi wieder ab. – Zum ersten Mal in ihrem sechsjährigen Leben lastet Argwohn auf Josephas Brustbein. – Wo gehst du hin, wenn du mich abgegeben hast bei der Omi? Und wo kommst du her, wenn du mich wieder holst? – Frag die Omi, wenn du Fragen hast. –
Tatsächlich wird die Urgroßmutter niemals von Josepha nach dem Weggang des Vaters befragt werden. Ihr eigenes Leben hatte Josepha am Tag ihrer Geburt wie einen Staffelstab von der Mutter übernommen und an deren Grab einige Tage später, auf dem Arm ihres Vaters, laut gebrüllt. Die Urgroßmutter nährte das kräftige Mädchen mit Zweidrittelmilch und Möhrensaft. Hafermehl und Möhren kamen in großen Paketen, die der Vater im kleinstädtischen Postamt abholen musste. Aufgegeben wurden sie von seiner Cousine, die in Köln am Rhein, jenseits der im Jahre neunzehnhundertneunundvierzig anscheinend endgültig befestigten Grenze, vom Tode der Mutter per Post erfahren hatte und nun, nicht frei von generöser Geste, Woche für Woche dazu beitrug, den Grundstein für Josephas spätere erstaunliche Widerstandskraft gegen physische und psychische Übergriffe zu legen. Als die Pakete nicht mehr Möhren und Mehl, sondern Strumpfhosen, Pullover und Schokolade enthielten, wusste Josepha, ohne dass sie jemanden hätte fragen müssen, dass die Frau im schwarzen Rahmen auf dem Büfett der Urgroßmutter ihre Mutter gewesen war. Und als der Vater die Schokolade nicht mehr nur ihr gab, sondern zu zwei guten Dritteln in seine Manteltaschen stopfte, wusste Josepha, gleichfalls fraglos, dass er sie jener zwei Meter großen Frau zudachte, die ihr zuvorkam, wenn sie den Vater von der Arbeit abholen wollte. An solchen Tagen ging durch Josephas geweitete Augen eine große Freude, die erst am Morgen der Übergabe des Taschenkalenders den Folgen des Argwohns weicht, der auf dem sechsjährigen Brustbein lastet.
Josepha beginnt, von Kreuzchen zu Kreuzchen zu denken, und nivelliert in ihrem Erstklässlerkopf alle Viertelfettwerktage und halbfetten Sonntage zu einem Zeitbrei, den man hinter sich bringen muss, um zum Vater zu gelangen. Wie in einer Nebenrechnung erlernt sie Lesen, Schreiben und Malnehmen, erfüllt bestens, was man an Leistung von ihr erwartet, und setzt ihre Lehrer dadurch in Erstaunen, dass sie zu Unzeiten isst, schläft oder spielt und in ihrem persönlichen Zeitplan durch keinerlei volksbildende oder erzieherische Maßnahme zu stören ist. An den Samstagen vor den grünen Kreuzen kulminiert ihre geradezu autistisch anmutende Unabhängigkeit von äußeren Störreizen in einem fünfstündigen Vormittagsschlaf in der letzten Bankreihe ihres Klassenraumes, wogegen man letztlich nichts mehr unternimmt, zumal Josepha Schlupfburg am darauffolgenden Montag durchaus ernüchtert wiedergeben kann, wovon am Samstag die schulische Rede gewesen war. Davon weiß ihr Vater nicht, denn seine Ohren hören bald nur noch die Sonntagsstimme Josephas, die Bittflöte um einen Nachmittag im Kino mit Prinzessinnen, Zwergen, vergifteten Äpfeln und möglichst niederträchtigen Stiefmüttern, das innige Hersingen des Liedes »Leise zieht durch mein Gemüt« oder den Hundston, wenn er am Café Lösche vorbei-, nicht aber hineingehen will mit ihr. Josepha und ihr Vater lieben die Sonntage, aber während das Kind sie wie große Bäume auf weiter Flur vor sich sieht, lässt der Vater sie bald hinter sich. Er hat zwei Töchter mit der Schokoladenfrau, die sich nie zeigt, und er arbeitet, sagt er, in verantwortungsvoller Position.
Überm Erinnern bittert der Kaffee. Josepha macht sich auf den Weg zu ihrem Arbeitsplatz an den Pressen der Firma VEB Kalender und Büroartikel Max Papp, ohne ausgetrunken zu haben. Zuvor aber schlägt sie mit einem Blick doch noch die Märze ihrer Kalenderwand auf. Was sie nicht sehen kann: Sie schnippen alle zurück in die Februare, als sie die Küchentür hinter sich schließt …
An dieser Stelle erwacht Therese aus herbem Altfrauenschlaf, um unter heftigem Schütteln des Kopfes ein gefäßerweiterndes medizinisches Präparat zu schlucken, das ihr helfen soll, die Schwächen ihres achtzigjährigen Blutkreislaufs auszugleichen. Josepha weiß die Greisin einer großen Erzählerin ähnlich, deren Bücher manchmal ein stilles Schluchzen in ihr ausgelöst hatten. Sie verrät das Therese nicht, die ihrerseits dazu neigt, bei anfallenden Namens- und äußeren Merkmalsverwandtschaften Nachforschungen zur Familiengeschichte anzustellen. Zwar hat sie dadurch siebenundzwanzig weitläufige Verwandte der Schlupfburg-Sippe seit dem Ende des letzten Krieges ausfindig machen können, aber ihre Tochter, die Mutter von Josephas Vater, blieb ihr verloren, seit sich ein Treck flüchtender Menschen aus der Stadt Königsberg auf den Weg nach dem Westen gemacht hatte. An einer Wegbiegung zwischen den Orten Wuschken und Ruschken war es gewesen, als Thereses Tochter der Mutter den elfjährigen Rudolph – sein Glied hockte noch klein und unbenutzt im Winkel zwischen den schlaksigen Beinen, wie hätte er damals ahnen können, Josephas Vater zu werden! – mit einem Strumpfband ans Handgelenk fesselte und für Augenblicke, wie sie sagte, nach hinten lief, den verlorenen Schnürsenkel ihres linken Schuhs zu suchen. Therese wusste sofort, und dies war ein typisches Beispiel fraglosen Begreifens unter den Frauen der Schlupfburggenerationen, dass ihre Tochter auf lange weder Schnürsenkel noch Sohn wiedersehen würde und dass fortan sie selbst, Therese, für dessen Aus- und Weiterkommen in fremder Heimat verantwortlich war. Das rasche Begreifen des Verschwindens ihrer Tochter in gegenläufiger Richtung hinderte Therese daran, sie über den Suchdienst des Roten Kreuzes ausfindig machen oder sie über Radiosendungen und das späterhin übliche Fernsehen suchen zu lassen, aber es verhinderte nicht, dass sich die Hoffnung, man könnte einander eines Tages unverhofft begegnen, unter ihrer Haut nährte und auswuchs. Mit ähnlicher Hoffnung sollte Therese eines Tages einen zum Zwecke grenzüberschreitenden Luftverkehrs genähten Ballon füllen, indem sie ihn aufblies, um dann im Angesicht der nach Süden entfliegenden Josepha friedlich zu sterben.
Vorerst aber spürt sie, wie das Medikament in einem Schwapp kalten Wassers die Speiseröhre hinab in die Fühllosigkeit des Magens entgleitet. Therese, als sie den Schlurfgang zur Toilette und darauf in die Küche hinter sich hat, findet dort Josephas stehen gelassene dritte Tasse Kaffee vor. Unsicher geworden, sucht sie den Raum jenseits der Fernbrille nach Ungewohntem, nach Veränderungen ab. Es müsste bereits März sein, denkt sie, als sie ihre Zahnprothese aus dem Wasserglas neben dem Rundfunkempfänger nimmt und in den Mund schiebt. Gestern hat sie in alten Fotos gekramt und ein braves Porträt ausgewählt, das sie in den Rahmen über dem Kopfende ihres Bettes einpassen will. Sie wechselt die Fotos monatlich: Vielleicht kann sie sich nicht satt sehen an den alten Geschichten, vielleicht, und das wird es wohl eher sein, braucht sie diese Abbildungen zur Vertiefung ihrer Träume, die sie allnächtlich heimsuchen und gegen die sie sich so wenig wehren kann wie gegen die plötzlichen Attacken ihres alt gewordenen Herzens. Jedenfalls weiß sie, dass dem gestrigen neunundzwanzigsten Februar ein erster März folgen muss und dass Josepha es noch nie versäumt hat, die Kalenderwand zu aktualisieren. Therese setzt sich, stellt ihre Füße in eine mit heißem Wasser und Kräuteressenz gefüllte Schüssel und wärmt sich, kopfschüttelnd, auf.
Josepha erreicht auf ihrem blauen sechsundzwanziger Herrenfahrrad der Marke Diamant nach fünfzehn Minuten das Tor zur Fabrik, zeigt Ausweis und verstörte Miene und begibt sich sofort zu ihrer Meisterin, um einen Tag Urlaub zur Klärung dringender Familienangelegenheiten zu erbitten. Nun kommt dieses Ansinnen der Vorgesetzten freilich ungelegen, denn sie hat selbst vor, Josepha ab Mittag um Übernahme ihrer meisterlichen Pflichten zu bitten. Einen Arzt will sie aufsuchen, die linsengroße Warze auf der Nasenspitze auskratzen zu lassen. Josephas Wunsch, dringende Familienangelegenheiten klären zu wollen, lassen überdies der Ausdeutung großen Raum. So überlegt die Meisterin in Überschneidung betrieblicher, privater und kollegialer Motive einen Augenblick, ob Josepha als alleinstehende Frau so etwas wie Familienangelegenheiten überhaupt haben dürfe, doch bewilligt sie schließlich die Beurlaubung. Josepha hat nie zuvor unverhofft einen freien Tag gewünscht und ist zudem so zuverlässig, dass die Meisterin gar nicht anders kann, als den Termin der Operation sausen zu lassen, vor der sie sich ohnehin nicht weniger fürchtet als vor der Warze selbst.
Am Nachmittag dieses Tages, der ein einfacher erster März hätte werden können, wenn er das schmale Vakuum zwischen dem äußeren Gang der Dinge und Josephas innerer Uhr übersprungen hätte, fährt Josepha auf ihrem Fahrrad durch die Stadtstraßen, kauft, was Therese gern isst, also Speck für Speckmus, ein Gläschen Kürbis, ein Fläschchen saure Sahne, verlässt dann die Stadt für eine halbe Stunde, indem sie sie mit dem Fahrrad umrundet, und kommt schließlich erschöpft und verschwitzt nach Hause. Ihre Augen zeigen ein entschlossenes, beinahe wutentbranntes Leuchten, das Therese nicht fremd bleibt. So hatte Josepha ausgesehen, als sie sich entschied, nicht länger ihres Vaters Sonntagskind zu sein. Dieses Gesicht ist Therese sehr lieb, denn es hat sie selten getäuscht. Tatsächlich hat sich Josepha seit ihrem zwölften Lebensjahr mit dem Einsetzen ihrer Periode nie mehr von Sonntag zu Sonntag gehangelt, sondern die Tage gelebt, wie sie kamen. Und obwohl in Thereses Auffassung irdischer Pflicht Dankbarkeit als Gegenleistung nicht vorgesehen ist, freute sie sich doch, als Josepha jenseits des Rituals der Jugendweihe plötzlich mit Zärtlichkeit an ihr hing. Sie küsste und wurde geküsst, sie streichelte und wurde gestreichelt. Daran denkt sie, als Josepha die Stiefel ins Bad stellt, um sie später abzuwaschen vom Schmutz, der sich zwischen den Jahreszeiten sammelt, und dieser hier, zwischen Winter und Frühjahr, ist schlammig und braun. Wenig mehr als ein flüchtiges Blinzeln bringt Josepha für Therese auf, zu sehr steckt sie in sich. Sie meint, die Frage der Fragen entdeckt zu haben, bangt darunter und sucht nach Worten, sie in den Raum zu stellen. Glaubt Josepha, sie aussprechen zu können, zersplittert die Frage augenblicklich in viele Fragen, die einander jagen, einander in die Subjekte fahren, einander mit den Modalbestimmungen fangen. Solche Unruhe hat Therese nur selten an Josepha gesehen, sodass sie ihr eine Tasse Kamillentee zum Munde führen hilft, ihr die kühlen Füße mit einer kleinen Bürste warm reibt, bis ihr nichts anderes mehr bleibt, als sich hinter Josephas Stuhl zu stellen, sie bei den Schultern zu packen und ihr in einem Anfall unausgesetzten Bebens beizustehen. Das dauert die Zeit zwischen Hell und Dunkel. Josepha nimmt währenddessen nichts anderes wahr als die Kalender an der Küchenwand, die still zu höhnen scheinen, weil sie sich außer Kontrolle geraten und endlich frei glauben. Was wisst denn ihr, schreit Josepha schließlich, was denkt ihr denn, was ihr seid? Glaubt ihr, ihr könnt euch lossagen von mir, die ich euch gefüllt habe mit meinen Geburtstagen, Rollerunfällen, Arztbesuchen, mit meinen Pioniernachmittagen, Verliebtheiten und Ohrenschmerzen? Glaubt ihr, ihr könnt euch aus dem Staub machen vor meinen Bleistiften und Wesenszügen? Ihr Heuchler mit eurer Unschuld des ersten Januars und den Sündenregistern der letzten Dezembertage!
Therese greift eine Badestola, mit der sie Josephas rasenden Leib an den Stuhl bindet, während sie schreit und um sich schlägt, um nach drei von den Nachbarn erschrocken zur Kenntnis genommenen Stunden in nervöse Starre zu fallen. Da ist noch nichts gelöst, die Fragen müssen heraus unter schmerzenden Wehen. Therese, die vielen Geburten der Tiere und Menschen beigewohnt hat, besinnt sich ihrer Erfahrungen und streichelt Josephas Rücken, flüstert und legt die Hand auf Josephas Stirn. Als sich die Ermüdete endlich betten lässt, hat Therese ein mehlweißes Laken aufgezogen, das Josepha durch die fiebernde Netzhaut hindurch an etwas erinnert, das sie nicht benennen mag. Einen Augenblick noch glaubt sie, sich wehren zu müssen. Das aber vermag ihr Körper nicht mehr, sondern ergibt sich der in vielen Jahren eingelegenen Wölbung der Matratzen. Josepha schläft. Was man nicht sehen kann: Sie ist außer sich. Therese, durch Lebenswut und Frauenlauf beschlagen, vermutet einen Embryo hinter den merklichen Veränderungen ihrer Urenkeltochter.
Wie wortlos vereinbart, beginnen die beiden Frauen die Gunnar-Lennefsen-Expedition am dritten Tag nach Eintritt der Schwangerschaft zu planen und vorzubereiten. Während Josepha glaubt, sich in Fragen der Psychoanalyse belesen zu müssen, und Schwierigkeiten bekommt, die betreffenden Schriften zu beschaffen, genügt es Therese, sich allmorgendlich in den Ohrensessel an ihrem Fenster zu setzen, die Augen zu schließen und den wie Federwolken vor ihren Augendeckeln ziehenden Träumen nachzujagen. Erwischt sie einen am Zipfel, zieht sie ihn ans Licht der Erinnerung. Dort scheint er ihr dann wie ein blutwarmes Tier, das unter dem Entdecktsein zittert, während Therese mit aller ihr in hohem Alter verbliebenen Kraft darangeht, es für die Dauer der Gunnar-Lennefsen-Expedition zu domestizieren, indem sie es an greifbaren Enden festzuhalten und in den Käfig ihres Gedächtnisses zu sperren versucht. Stichworte, die Therese in ein kleines, schwarz eingebundenes Buch schreibt, dienen als Schlüssel. Josepha, tagsüber arbeitend, hat nach fünf Tagen nahezu ein Dutzend kopfschüttelnder Bibliothekarinnen kennengelernt, die sie nach Schichtschluss aufgesucht und um freudsche Schriften gebeten hatte. Dass es solche geben muss, weiß sie von einem bebrillten, sehr bemühten Studenten des psychologischen Faches, der ihr – es waren Jahre seither vergangen – bedeutet hatte, wie sehr sie sich im Griff höherer Mächte des unteren Leibes befinden musste, solange sie sich ihm nicht lustvoll hinzugeben vermochte. Je länger sie aber seinem Drängen widerstanden hatte, desto lustvoller war ihre Hingabe an die Bücher gewesen, die in seinem Zimmer nicht nur Staub fingen, sondern eben auch die knapp neunzehnjährige Josepha. Ehe sie die ergreifende Schilderung der dreijährigen Analyse einer fresssüchtigen Frau zum guten Ende hatte verfolgen können, war sie dem Jungmann jedoch entwischt, weil sie anstehende Entzauberungen ahnte und ihnen aus dem Wege gehen wollte. Damals war sie unempfindlich gewesen für Klärungen. Damals hatte sie weggedrängt, was sie zwischen den Sätzen wusste beim Sprechen, was in ihren Gelenken knackte, wenn ihr die Hand geschüttelt wurde, und was sie in Übelkeiten trieb beim Lesen der üblichen Zeitung. Damals hatten ihr die Finger nicht gehorcht, wenn sie morgens den aus dem Spind gerissenen Kittel zuknöpfen sollten und stattdessen eine imaginäre Flöte spielten oder nach einem Pass kramten, den sie freilich nicht besaß. Es war die Zeit des Zurückschreckens vor der manchmal schon auftauchenden Sehnsucht nach Biografien, nach Geschichtsbüchern, in denen die auf Thereses Fotografien abgebildeten Personen als Hauptdarsteller agierten.
Daran erinnert sie sich, als sie den fünfzehnten vergeblichen Versuch der Beschaffung Freudscher Schriften hinter sich hat, und sie beschließt in plötzlicher Klarsicht, auf alle wissenschaftlichen Garnknäuel zu verzichten und stattdessen eine Flasche Kognak im um die Ecke gelegenen Lebensmittelladen zu kaufen. Später überrascht sie Therese zu Hause beim Reiben eines ausgetrockneten Stückes Butterkäse, das ebenso als Expeditionsproviant dienen soll wie die gerösteten Brotwürfel, die in einem leeren Gurkenglas luftig lagern.
10. März 1976:
Erste Etappe der Gunnar-Lennefsen-Expedition
(Stichwort im Expeditionstagebuch: HOLZPANTINE)
Der erste Expeditionstag fällt auf den achten Abend nach Eintritt der Schwangerschaft. Josepha packt zum Vorbereiteten eine kleine Ausgabe von Briefen, die eine hinkende, der sozialdemokratischen Bewegung angehörende Frau zu Beginn des Jahrhunderts aus dem Gefängnis geschrieben hatte, und ein Zeitungsfoto, das eine junge, nackte Jüdin zeigt, die von einem anscheinend ebenso jungen, deutschuniformierten Soldaten am Arm geführt wird – zu ihrem späteren Grab, das sich in Kowno, dem litauischen Kaunas, befindet. (Diese Dinge erscheinen Josepha unentbehrlich, und sie sollen auch in ihrem Gepäck stecken, als sie Monate später mit dem Luftschiff mehrere Grenzen überfliegt.)
Mit einem Glas Kognak eröffnen die beiden Frauen die Gunnar-Lennefsen-Expedition, mit der sie in den äußersten Norden ihrer weiblichen Gedächtnisse vorzudringen hoffen, dorthin, wo die Vereisungen am dicksten sind, wo das Packeis treibt und vereinzelt auftauchende Visionen rasch zum Untertauchen zwingen. Dorthin, wo der dickste Pelz nichts nützt, wenn man nicht eingerichtet ist auf einen Überlebenskampf. Den Namen des Unternehmens hatten Josepha und Therese einander von den Augen ablesen können. Er erscheint ihnen als geeignetes Codewort, weil er mit nördlichem Klang daherkommt, weil Männer wie Scott, Amundsen, Barents und Zeppelin zwischen den Vokalen hocken, die immerhin enorme Vorstöße gewagt hatten. Wenn Gunnar Lennefsen auch zu keiner Zeit existiert haben mochte, so ersteht er doch als Legitimation eines weiblichen Aufbruchs, der vorhat, dem in Josephas Bauch wachsenden Kinde eine Geschichte zu schaffen.
Die Expedition kommt zunächst zügig voran. Therese lässt mit dem Schlüsselwort HOLZPANTINE den Tod ihres Bruders Paul ins Wohnzimmer frei. Die alte Geschichte, die mit dem Dunst des Jahres 1914 einherkam, erbricht sich auf die imaginäre Leinwand in der Mitte des Zimmers. Josepha sieht den kleinen Schuppen, in dem Thereses Eltern Holz lagern und der sich fraglos im damaligen Wohnort der Schlupfburgs, im ostpreußischen Lenkelischken, befindet. Paul, Thereses siebzehnjähriger Bruder, stapelt gespaltene Scheite zu einem Meiler, während seine acht jüngeren Geschwister unter der Aufsicht Thereses, der Ältesten, im Hof spielen. In Wirklichkeit ist Therese an diesem Tage aber mit keinem Blick bei den Kleinen, dafür mit offenem Ohr beim holzstapelnden Paul. Die Luft des Frühsommertages riecht nach versengtem Fleisch, nach Frauenrotz und Rübenmus. Dazwischen hängt ein für Therese unkenntlicher Geruch, der ihr den Atem nimmt. Sie hustet. In ihrer Luftnot halluziniert sie den Tod ihres Bruders Paul an inneren Verbrennungen und weiß, dass eine Spur giftigen Gases ihr Denken durchzogen hat. Was sie nicht weiß: Es sollten später die Badischen Anilin- und Sodafabriken sein, die, nachdem sie günstig zu produzierendes Senfgas an ziemlich unschuldigen Kaninchen erprobt hatten, große Mengen dieses Giftes über die Schlachtfelder des Weltkrieges bliesen. Aufgeschreckt durch die Bilder, die den Tod des Bruders in grausigen Farben schildern, zieht Therese plötzlich die linke ihrer schweren Holzpantinen vom Fuß und schleudert sie in einem Zustand wissender Bewusstlosigkeit in Richtung des scheibenlosen Schuppenfensters, hinter dem der geliebte Bruder noch immer Holz spaltet und übereinander schichtet. Minuten nach dem erschrockenen Aufschrei tragen der Vater und ein herbeigerufener Nachbar die lächelnde Leiche Pauls, aus dessen Mund ein dünner Blutfaden herabhängt, durch das Hoftor. Drei Tage später lässt man einen teuren Sarg in die Erde von Lenkelischken hinab. Therese, die stumm eine Handvoll Sand in die offene Wunde des Friedhofs wirft, steht außerhalb jeden Verdachts. In Pauls Haar hat der Arzt unter unverletzt gebliebener Haut Spuren stumpfer Gewalt entdeckt, die vom Heft des Beils auszugehen scheinen, mit dem der Junge arbeitete. Thereses Holzschuh entging der Aufmerksamkeit, er war nach dem Aufschlagen auf Pauls Kopf durchs Schuppenfenster zurückgeprallt und nur wenige Schritte von Therese entfernt zu liegen gekommen.
Therese hat den Vorgang bis zur Gunnar-Lennefsen-Expedition nicht fassen, nicht behalten können. Josepha, die die Ereignisse auf der imaginären Leinwand kommentiert, bittet um eine Pause, sie ist hungrig. Der Hunger schiebt sich vor eine große Übelkeit, die davon herzurühren scheint, dass das Wasser in ihren Lungen zu kondensieren beginnt. Therese nimmt Brotwürfel aus dem Gurkenglas, bestreut sie mit Käse. Als Josepha zulangen will, bemerkt sie jenen Holzschuh in ihrer Hand, mit dem Therese einst ihren Bruder Paul erschlug, um ihn einem qualvollen Gifttod zu entreißen. Da aber weint die Alte ein hemmungsloses Weinen zwischen die Seiten des Expeditionstagebuchs.
Später glaubt Josepha zu bemerken, wie sich Thereses Haut und Muskeln straffen, wie sich die dorrenden Brüste zu jugendlichen Kuppeln erheben, wie sich das graue Haar mit frischem Ton bräunt und die Finger gelenkiger nach Josephas Hand greifen. Es ist jene Therese, die aus dem Foto über dem Kopfende des Bettes, aus den ersten Kriegsjahren in die Zukunft lächelt, die am ersten Tag der Gunnar-Lennefsen-Expedition wiederum Gegenwart ist. Josepha reibt Thereses Schläfen und das im Schluchzen sich hebende und senkende Brustbein mit einem vietnamesischen Fett ein, das man in Drogerien zur Linderung verschiedener Schmerzzustände kaufen kann.
Therese diktiert Josepha in bündigen Sätzen den eben erinnerten Sterbevorgang ihres Bruders Paul. Langsam kehrt ihr Kopf zurück in die begonnene erste Nacht der Expedition. Mit dieser Rückkehr wird auch ihr Leib wieder der einer alten Frau. Josepha legt das Expeditionstagebuch unter Thereses Kopfkissen, ehe sie sie zu Bett bringt, ihr ein Achtelchen Apfel auf die Zunge schiebt und für den nächsten Abend ein Gespräch in Aussicht stellt, weil sie sich nicht mehr sicher ist, der alten Frau eine solch gefahrvolle Reise zumuten zu können.
In jener Stunde, in der Josepha und Therese mit vereinten Kräften längst vergangene Ereignisse heraufbeschwören, nimmt für die alternde Kleinbürgerin Ottilie Wilczinski im bayerischen N. eine ziemliche Aufregung ihren splitternden Anfang: Die Bildröhre ihres für neunhundert D-Mark erstandenen Farbfernsehgerätes implodiert während einer für die Fabel des laufenden amerikanischen Spielfilms wichtigen Kussszene. Ottilie bringt es lediglich zu einem Schrei, der so kurz ausfällt, dass er stumm bleiben muss. Derlei hat sie in ihrem seit dem Jahre neunzehnhundertsechzehn währenden Leben noch nie gesehen, und dabei spielten sich schon enorme Wechselfälle vor ihren markerschütternd blauen Augen ab. Ottilie Wilczinski wagt nicht gleich, den Fernsehmechanikermeister Franz Reveslueh anzurufen, es ist immerhin zwanzig Uhr achtundfünfzig. Sie breitet über den Ort des Unglücks ein altes, weißes Laken, das einst ausreichte, das gemeinsame Bett der Eheleute Wilczinski, Ottilie und Bodo, mit seiner kühlen Frische zu überziehen. Schweiß, Sperma und gelegentlich Tränen hatte es in sich eingesogen, um immer wieder durch Ottilies Hand von den gelblichen Flecken befreit zu werden und dann lustig im Garten zu flattern. Diese alte Flagge der Ergebung bedeckt nun den hölzernen Kasten, der seit Jahren schon Ottilies Fenster zur Welt ist. Sie wagt nicht, ins Bett zu gehen, ist ihr die stille, einsame Wohnung doch plötzlich nicht mehr geheuer. Wüsste sie sich nicht durch den täglichen Vergleich der Lebensmittelpreise in den verschiedenen Gegenden der Stadt, durch die aufklärenden Sendungen des Dritten Fernsehprogramms und durch die wöchentlichen Besuche der Nachbarinnen fest mit dem Irdischen verbunden, so könnte sie sich durchaus auf ihre einstigen magischen Kräfte besinnen. Aber die sind längst einem praktischen Lebenssinn gewichen, der ihren Händen von Zeit zu Zeit eingibt, Pullover für die armen Waisenkinder zu stricken und abgelegte Kleidung in der Städtischen Irrenanstalt abzugeben. Dort allerdings wird ihr oft schummrig zumute. Sie fühlt sich hingezogen zu dem durchscheinend gelben Greis, der sie stets beauftragt, seiner alten Mutter irgendwo jenseits der Anstaltsmauern von seinem Blasenkatheter zu erzählen. Auch dieses Mädchen fasziniert sie, das sie immer schon spürt, ehe sie es sehen oder hören kann. Wenn es dann aus der Tiefe eines der langen Gänge auftaucht, immer im Rücken Ottilies auf diese zuschwebt, sie von hinten bei den Händen fasst und mehrmals um sich selbst dreht, lautlos lacht und nach dem Löffelchen Zeit fragt wie nach einer Arznei, die man ihm seit langem versagt, ist es Ottilie stets, als habe sie all das schon einmal erlebt. Zwar steht sie ratlos vor den geröteten Augen des Mädchens, doch fühlt sie sich an etwas sehr Vertrautes erinnert. Bei Ottilies erstem Anstaltsbesuch Mitte der Fünfzigerjahre war es gewesen, als sich beim Betreten des Pförtnerhäuschens – sie hatte dem Pförtner ihr Kleiderbündel gezeigt und gefragt, wo sie es abgeben könne – plötzlich die Schnürsenkel ihrer neuen schwarzen Lederschuhe aus den Löchern flochten, die Füße sich wie von selbst aus den Schuhen hoben und ihr Blick den Pförtner um ein Tänzchen bat. Auf diese Weise fand sie ihren ersten Ehemann. Der war froh, angesprochen zu werden von einer Frau. Fünfzigjährig, hatte ihn seine lebenslange Scheu stets daran gehindert, sich in eine Frau hineinzuwagen, in ihre Geheimnisse oder was er dafür hielt und sich ausgemalt hatte in seinen einsamen Jahren. Ottilie nahm ihn an jenem Oktobertag des Jahres 1954 mit in ihre Wohnung und drängte ihn, ihren seit Kriegsende unberührt gebliebenen Leib auf männliche Weise wieder zu öffnen. Bodo Wilczinski vergrub sich daraufhin zwischen den Frauenbrüsten und ließ nicht nach, Ottilie beizukommen. Kurz vor der vierunddreißigsten nächtlichen Ejakulation schrillte jedoch der Wecker und trieb den entbrannten, euphorischen Bodo Wilczinski in dessen Pförtnerhäuschen zurück. Kaum war er dort angekommen, hob sich seine dem Schnitt der Zeit entsprechend weite Hose unter dem enormen Schwelldruck seines Gliedes, und Bodo Wilczinski entleerte sich, das Unterbrochene vollendend. (Der dabei entstandene Fleck im Schrittbereich der Hose wurde nie mehr trocken, so sehr sich Ottilie auch in den Wochen nach der stillen kleinen Hochzeit bemühte, ihn mittels der Hitze ihres Bügeleisens verdampfen zu lassen. Zwar zischte es jeweils laut, aber der Fleck erstand immer wieder in gleichbleibend warmer Nässe, und stets roch er so stark nach Mann und Frau, dass auch Ottilie zwischen den Schenkeln feucht wurde. Weil sie sich dadurch aber nicht von den vielen praktischen Verrichtungen ablenken lassen wollte, ließ sie die Hose eines Tages im Mülleimer verschwinden.)
Ottilie bereitet sich im Wohnzimmer, unweit des Unglücksortes und ebenso unweit des Telefons, auf der Couch ein provisorisches Nachtlager und vergisst vor Aufregung, ihre Barbiturate und Herzkräftigungsmittel einzunehmen. Im Dunkeln sieht sie noch einmal, wie Bodo Wilczinski sich mit unstillbarem Eifer müht, ihren fast vierzigjährigen Leib zu schwängern, wie er in den Mittagspausen aus seinem Häuschen in ihren Schoß gehetzt kommt, wie er stöhnt und klagt: ich-muss-mich-einholen-ich-muss-mich-endlich-einholen, wie dennoch ihre Periode niemals ausbleibt und sie nicht mehr Frucht tragen soll bis zum Einsetzen der Menopause, nach deren Beginn im zehnten Ehejahre Bodo Wilczinski eines Morgens im Bett liegen bleibt, ein letztes Mal in völliger Ruhe zwischen ihren Beinen seinen Samen lässt und zugleich sein Leben aushaucht, als sei er von dessen Vergeblichkeit endlich überzeugt. Es ist eine einfache Erinnerung, wie sie Ottilie beinahe täglich unterläuft, und doch beginnt sie, was ihr seit Bodos Tod nie mehr passiert war, erregt zu zittern. Sie beruhigt sich aber schnell, als ihr die Barbiturate im Badezimmerschrank einfallen und sie sich aufmacht, zwei Tabletten zu schlucken. Schnell kommt nun der Schlaf, aus dem sie am nächsten Morgen benommen erwacht und den Mechanikermeister Franz Reveslueh anruft mit der Bitte, ihr aus ihrer misslichen Lage zu helfen. Reveslueh kommt gegen neun Uhr dreißig. Er trinkt eine Tasse Kaffee mit Ottilie Wilczinski, er hat sie in Fernsehangelegenheiten stets gut beraten. Die beiden kosten Ottilies Erdbeerkonfitüre, die sie jahrs zuvor mit einem guten Schuss kubanischen Rums versetzt hat, um sie haltbarer zu machen und vor Moder zu schützen. Immerhin ist diese Erdbeerkonfitüre zwölf Jahre alt. Am Vorabend seines Todes hatte Bodo Wilczinski drei Körbe frischer Erdbeeren vom Markt mitgebracht und ihnen die Stielchen abgezupft, ehe er zu später Stunde mehrfach in Ottilie eingedrungen war. Nach seinem Einschlafen war Ottilie auf leisen Sohlen in die Küche geschlichen und hatte achtzehn Gläser Konfitüre gekocht. Daran also laben sich Ottilie Wilczinski und Franz Reveslueh. Mag es die Gunst der Stunde sein oder aber der kubanische Rum – beide werden lustig und rechnen einander ihre Lebensjahre auf, wobei Ottilie auf sechzig, Reveslueh auf fünf Jahre weniger kommt. Als müsse er ihr seine Jugend beweisen, fährt er ihr plötzlich mit der linken Hand ins Geschlecht. Er muss lediglich Ottilies Morgenrock ein wenig beiseite- und ihr Nachthemd hochschieben. Ihr Körper hat solche Berührung seit Bodos Tod vergessen und sehnt sich nach Belebung, sodass sich der Mechanikermeister Franz Reveslueh in das über Nacht unbenutzt gebliebene Ehebett legt, Ottilie dort geübt die spärliche Kleidung fortnimmt und schließlich noch einmal vorsorglich aufsteht, um die Wohnungstür abzuschließen. Im Unterschied zu Bodo Wilczinski erweist sich Franz Reveslueh als bedächtiger Liebhaber, der eine lange Freude an Ottilie finden kann.
Zur Mittagszeit wird er in seiner Firma zur Pause erwartet. Wohl oder übel muss er ein Ende finden, und er tut es auf Ottilies Bauch, in Höhe des Nabels, getrieben von einem in Jahrzehnten eingeübten Reflex, Schwängerung zu vermeiden. Als Ottilie ihn daraufhin aus ratlosen Augen anschaut, küsst er die alten Spitzen ihrer Brüste und bedankt sich bei ihr mit der Erklärung, er habe neun Kinder mit seiner Frau, obwohl er nicht genau wisse, ob er auch nur eines wirklich gewollt habe. Und so könne er keine reine Freude am Beischlaf mehr finden, wenn er auf dessen Ende sähe, und habe sich entschlossen, es zu gegebener Zeit außerhalb der Frau stattfinden zu lassen. – Mit wenigen Handgriffen passt Franz Reveslueh noch eine neue Bildröhre in Ottilies Fernsehgerät ein. Kein Geld nimmt er von ihr, verabschiedet sich stattdessen ohne Anflug von Sentimentalität, mit aufrichtiger Dankbarkeit, die Ottilie, von seltsamen Ahnungen durchbebt, erwidert. Schließlich kocht sie eine rasche industrielle Suppe, um sie zu den Dreizehnuhrnachrichten unruhig zu verzehren.
Zur selben Zeit, nur liegt eine im Jahre neunzehnhundertneunundvierzig anscheinend endgültig befestigte Grenze zwischen ihren Ländern, geht auch Josepha in die Mittagspause und erbittet von ihrer Vorgesetzten die Erlaubnis, eine Portion Werkessen zu Therese bringen zu können. Sie hat die Urgroßmutter am Morgen nur widerstrebend allein gelassen, glaubt sie sie doch geschwächt von den Ereignissen der letzten Nacht, dem Aufbruch der Gunnar-Lennefsen-Expedition. Umso erstaunter ist sie, Therese schaukelnd im großen Ohrensessel zu finden, das Gesicht von blassem Frieden geweißt, der sie zwar erschöpft, aber auch leicht gemacht hat. Beim Essen – Josepha lädt Knödel, Gulasch und genelkten Rotkohl aus den verschiedenen Assietten auf die Teller – erzählt Therese, wie sie im Bewusstsein ungeahnter Kraft aufgewacht war und sich beim Löffeln der morgendlichen Haferflockensuppe darüber gefreut hatte, dem Schicksal des Bruders die eigene Stirn geboten zu haben. Ja, sie selbst war es gewesen, die einen der Sippe, einen der Ihren vor entsetzlichen Schmerzen bewahrt und ihm einen einfachen Tod gegeben hatte. Nun besteht sie darauf, die Expedition wie geplant fortzusetzen. Zum Schlafen will sie den Nachmittag nutzen und Kräfte sammeln, um ähnlich aufwühlenden Ereignissen wie denen der Nacht zuvor gewachsen zu sein. Zwar ist Josepha noch immer besorgt, Therese zu viel zugemutet zu haben, aber deren Entschlossenheit macht sie stumm. Sie fährt mit dem Fahrrad zurück in die Fabrik, wo für den Nachmittag eine Versammlung angesetzt wurde, die allerdings wegen Unpässlichkeit der Referentin – es sollte über die Vereinbarkeit von Beruf und Mutterschaft gesprochen werden – abgesagt wird. Josepha stürzt sich mit beinahe blindem Eifer in die Arbeit. Blind, denn sie sieht schon lange nicht mehr, wer zum Beispiel am einundzwanzigsten Juni Geburtstag hat und welches Abkommen etwa am zweiten August neunzehnhundertfünfundvierzig unterzeichnet wurde. Und wenn sie es weiß, bleiben diese Dinge doch weit entfernt im Vergleich zu dem, was sie sich von den nächtlichen Unternehmungen mit Therese erhofft. Die durchmustert im Abendsonnenschein, den Josepha über dem täglichen Einkauf nicht sieht, das Expeditionstagebuch nach einem Schlüssel, der für die nächste Etappe geeignet scheint. Und wirklich notiert sie nur Augenblicke später auf einem Blättchen Papier die Worte BLAUE PHIOLE und stellt das Radio in der Küche an. Sie ist ein wenig erstaunt, Zarah Leander zu hören, die wie vor Jahrzehnten ein irgendwann eintretendes Wunder prophezeiht. Bald aber bemerkt sie, dass nicht Zarah Leander singt, sondern ein Wesen, für dessen Geschlecht sie nicht ihre Hand ins Feuer legen möchte. Dennoch rührt es sie, dass jemand von den jungen Leuten sich auf vergangene Zeiten besinnt und dem Lied einen Tonfall unterlegt, den sie bisher nie herausgehört hat und der sie in gleichem Maße fasziniert wie abstößt. So ruft sie im Zustand einer gewissen Verunsicherung Ambivalentia, die Göttin der Doppelwertigkeit an, von der sie sich gestraft fühlt, und bittet, das alte Weib, das sie nun einmal ist, loszulassen. Ambivalentia jedoch lächelt und kaut am blutigen Brot der Dialektik. Dem suchenden Blick Thereses nicht sichtbar, ist sie an allen Orten zugleich. Nein, sie hält die alte Frau nicht fest, sie hat einfach schon immer in den Dingen beschlossen gelegen.
11. März 1976:
Zweite Etappe der Gunnar-Lennefsen-Expedition
(Stichwort im Expeditionstagebuch: BLAUE PHIOLE)
Bei Einbruch der Dunkelheit ziehen Josepha und Therese die Vorhänge ihrer Wohnzimmerfenster zu, murmeln das Codewort und spannen die imaginäre Leinwand. Scharfer Karbolgeruch zieht durch den Raum und versetzt die Frauen in einen Saal des Krankenhauses der Barmherzigkeit zu Königsberg, das im Jahre neunzehnhundertsechzehn eine Vielzahl an Wundstarrkrampf erkrankter Patienten aufnehmen musste. Therese sieht sich in einem der zwanzig Betten liegen. Sie ist vor zwölf Wochen von einem dicken Mädchen entbunden worden, dessen uneheliche Geburt die Schlupfburgs nicht unerwartet traf. Seit Generationen waren die Kinder der Schlupfburgfrauen unehelich zur Welt gekommen, und sie hatten – freilich nicht immer aus freien Stücken – diese Tradition auch ihren Töchtern und Enkelinnen in die grob gezimmerten Wiegen gelegt. Nun aber liegt Therese mit Tetanus darnieder. Das Stillen des Säuglings hat einstweilen Großmutter Agathe übernommen, deren Brüste aus Milchzeiten nie herauszukommen scheinen. Seit zwanzig Jahren stillt sie ununterbrochen, elf Kinder haben sich an ihrer Milch großgetrunken, und bis auf Paul sind alle am Leben. Therese atmet flach, mit kaum geöffnetem Krampfmund. Ein bebrillter Arzt hatte die junge Mutter nach einem Hausbesuch sogleich ins Hospital gebracht. Untrüglich liegt der Schimmer des Verderbens auf der Gesichtshaut Thereses, und sie sieht, riecht und hört beinahe nichts außer dem eigenen Elend, das sie sich beim Krautschneiden zugezogen haben muss. Agathe zieht in verschiedenen Winkeln des Hauses und auf Fensterbrettern in tönernen Behältnissen Kräuter, mit denen sie kräftige Eintöpfe würzt, die wiederum eine scharfe Berühmtheit unter den ärmeren Leuten des Dorfes erworben haben. Aber auch der junge August Globotta, der mehr als nur ein Auge auf Therese geworfen hat, weiß die Suppen zu schätzen, die ihm heimlich durch eine kleine Luke in der Wand des Treppenflures hindurchgeschoben werden, wenn er Therese zur Mittagszeit mit Klopfzeichen lockt. August Globotta ist der erstaunlich zärtliche Sohn des ostpreußischen Gutsherren Friedrich Wilhelm Globotta, auf dessen Hof Therese seit ihrem fünfzehnten Jahr Silber putzte.
Die Unheil abwendenden Kräuterdüfte der schlupfburgschen Eintöpfe ziehen in kleiner werdenden Abständen auch Lehrer Weller, in dessen Klassenraum sich alle schulpflichtigen Schlupfburgkinder ihre täglichen Sitz- und Prügelblasen holen, ins Haus und zu Tisch. So auch am Tage, da sich Therese beim Krautschneiden infiziert haben muss. Lehrer Weller ist gerade recht gekommen, denn Thereses Eltern überlegten seit Wochen, den sechzehnjährigen Max auf die Höhere Technische Staatslehranstalt für Hoch- und Tiefbau in Königsberg zu geben, aber sie kennen Mittel und Wege dorthin nicht. Studierte hatte es in der Familie zu keiner Zeit gegeben, jedoch lässt Max’ handwerkliches und technisches Geschick eigentlich keinen Zweifel an seiner Berufung. Seine letzte Arbeit ist die Installation eines Be- und Entlüftungssystems im schlupfburgschen Wohnhause gewesen: Durch ein undurchschaubares Gewirr von Röhren, Filtern und Rädern war es möglich geworden, auch die dumpfesten Moderwinkel des Hauses mit so viel Sauerstoff anzureichern, dass Thereses Mutter lichtempfindliche Kräuter ohne Schwierigkeiten heranziehen kann und überdies weiß, was in allen zum Anwesen gehörenden Räumen geschieht. Mit dem Sauerstoff ziehen nämlich nun auch die Aromen des Lebens durchs ganze Haus: Die leibwarme, frisch gemolkene Milch aus den Ställen füllt die Schlafkammern der Kinder mit wohligem Dunst, die Schweine fressen ihr Futter im Duft der herrlichen Eintöpfe, der Geruch der Lauge aus dem Waschhaus reinigt die sich zuweilen verklärenden Sinne der Heranwachsenden, und alle im Haus erwachen des Morgens besonders friedlich, wenn Wolken elterlichen Beischlafs, der auch nach elf gemeinsamen Kindern ohne den Segen von Staat und Kirche erquickend verläuft, unter den Zimmerdecken hängen. Zwei Wochen der Existenz des Systems reichten aus, die olfaktorischen Sinne der Familienangehörigen so weit zu schärfen, dass man nun allezeit jedermann im Haus orten kann, was das Tagwerk natürlich erleichtert. Lehrer Weller lässt sich, während er die gelben Erbsen genüsslich löffelt, von alledem breit erzählen und meint, das Provinzialschulkollegium in Königsberg auf die Begabung des Jungen hinweisen zu wollen. In mütterlicher Erregung beginnt Agathe Schlupfburg bei dieser Mitteilung zu schwitzen, was der in der Küche hantierenden Therese dank Max’ System nicht verborgen bleibt. Vom besänftigendsten aller Kräuter schneidet sie ein Sträußchen, um es in die nächsten Erbsenportionen zu rebbeln. Allerdings wird Thereses Herz durch die untrüglich werbenden Klopfzeichen des zärtlichen August Globotta erschüttert, sodass sie sich in den Finger fährt. Durch diese Liebeswunde haben die Tetanusbakterien leichten Zutritt zu ihrem stillenden Körper. Sie gibt das Kraut noch an die dicken Erbsen und trägt auf, dann aber windet sie sich aus der Schürze und verlässt springend das Haus, denn des zärtlichen Globottas Auftritt könnte von jedermann bemerkt werden: Er schwitzt einen sehr ostelbischen, junkerlichen Schweiß, obwohl er Therese durchaus ehrlich anhängt. Er ist der Vater ihrer Tochter Ottilie, deren Zeugung im väterlichen Schlafzimmer er in Abwesenheit der herrschaftlichen Eltern keineswegs hatte erzwingen müssen. Therese war ihm freundlich entgegengekommen, und August Globotta hatte sie entschlossen defloriert. Nach den verschiedensten Freuden schwollen Thereses Brüste und Hüften, zeigten sich Risse in der Unterhaut ihres Bauches, erwiderte sie das Verlangen des Freundes mit häufigen Launen. Ohne Aufregung fühlte sich Agathe zur Großmutter altern und fragte nach dem Vater des Enkelkindes nicht, während die Herrschaften auf dem globottaschen Hofe über das dick werdende Mädchen lächelten, ehe sie es bei Einsetzen der Wehen aus ihren Diensten entließen. Therese presste mithilfe einer entfernten Verwandten, der Jewrutzke, das gutsherrliche Enkelchen unter Gottes Sonnenlicht und war im Kreise ihrer Sippe gut aufgehoben. Auch im Dorfe regten sich weder Klatsch noch Tratsch, denn man kennt das Schicksal der Schlupfburgfrauen seit Generationen. Am besten war immer noch gewesen, es anzunehmen, was den Betroffenen einen anstandshalber begangenen Selbstmord und dem Dorf den Verlust tatkräftig arbeitender junger Frauen ersparte. So oft sie kann – und das ist selten genug – trägt Therese die kleine Ottilie in deren Vaters Augenschein. Nichts könnte August Globotta auf den Gedanken bringen, Therese zu ehelichen. Er ist ganz froh mit ihr in der Gegenwart, während das Wort Ehe eine vorherbestimmte Zukunft bezeichnet. Es stört ihn keineswegs, dass zehn Wochen nach Ottilies Geburt Friedrich Wilhelm Globotta des zärtlichen Augusts Verheiratung gebietend in Aussicht stellt und ihn zu diesem Zwecke auf das Gut seines alten Militärfreundes sendet, dessen Tochter auf die Erfüllung ihrer herangereiften fraulichen Pflichten besteht und überdies als einziges Kind ihrer Eltern reichen Gewinn mitgiftend in die Ehe zu bringen verspricht. Vor seiner Abfahrt nun kommt der zärtliche August, Therese den Abschied zu geben. Freilich denkt er nur an den bis zu seiner Wiederkehr. Die beim Krautschneiden verletzte Therese liegt über kurz erschöpft im herrschaftlichen Hafer und spürt, wie sie wiederum Frucht zu tragen beginnt. Die wächst aber in eine große Trauer hinein, denn einem verheirateten August, mag er noch so zärtlich sein, will sie nicht als Nebenfrau anhängen, und so benutzt ihr zum zweiten Male befruchteter Leib den Wundstarrkrampf, eine Menge Leides in furchtbarem Fieber auszuschwitzen.
Als die imaginäre Leinwand den Hergang der Tetanusinfektion im Jahre neunzehnhundertsechzehn erschöpfend wiedergegeben hat, taucht die alte Jewrutzke an Thereses Krankenbett auf und zieht unter ihrem Rock eine winzige bläuliche Phiole mit angetrübter, gerade noch durchscheinender Flüssigkeit hervor. Sie, die Schwangerschaften bereits mit einem Händedruck diagnostizieren kann, weiß seit ihrem ersten Besuch vor zwei Tagen vom Zustand ihrer jungen Verwandten. Der Zufall wollte es, dass sie nur Stunden nach jenem Besuch ins Haus des sozialdemokratischen Arbeiters Wilhelm Otto Amelang, der in der Gas-Anstalt am Bahnhof Holländerbaum arbeitet, gerufen wurde, um dessen Frau von einer Tochter, später Senta Gloria genannt, zu entbinden. Viel Fruchtwasser floss herab vom Küchentisch, auf dem die Frau Amelang sich wand, sodass es der Jewrutzke nicht schwerfiel, ein weniges davon in ihrer blauen Phiole zu fruchtabtreibendem Zwecke aufzufangen. Das tut sie, so oft sie kann, weiß sie doch eine große Zahl Frauen, die ihren Schwangerschaften nicht mehr beizukommen vermögen und Beistand erbitten. Jewrutzkes blaue Phiole treibt Frucht ab und verpackt den Vorgang in ein wenig Fieber und influenzaähnlichen Symptomen, sodass niemand eine Straftat vermuten und mit der Polizei drohen kann. Und nun ist der Tag gekommen, an dem auch Therese Schlupfburg ihrer Hilfe bedarf. Das Glück mit dem zärtlichen August ist ausgelaufen in den Hafen einer fremden Ehe. Die Jewrutzke hatte sogleich gesehen, dass der Ausbruch des Wundstarrkrampfes einem Abort nur entgegenkommen konnte, und so gibt sie unter Kopfschütteln und leisem Reden Therese vom Fruchtwasser zu trinken, in dem Senta Gloria Amelang dem Leben entgegengeschwommen war. Die üblichen Zeichen solcher Abtreibung bleiben im Dickicht der Krankheit stecken, Jewrutzke wirft das Klümpchen möglichen Lebens in einen Gully der städtischen Kanalisation, und Therese gesundet. (Nicht wissen können die Beteiligten, dass das Fruchtwasser Senta Gloria Amelangs das Schicksal mehrerer Familien unentrinnbar verbinden wird, aber das ist ein noch unbestelltes Feld: Die imaginäre Leinwand zeigt riesige Äcker, ehe sie in einem Loch in der Mitte des Raumes zusammenfällt.)
Auch nach dem zweiten Ausflug der Gunnar-Lennefsen-Expedition sieht Josepha ihre alte Therese gleichsam erschöpft und verjüngt, nur weint diese nicht, sondern greift nach Brotwürfeln, um sie zwischen den Zähnen knirschend zu zermahlen. Sie trägt des zärtlichen Augusts Male der Liebe am Hals, als Josepha ihr das verwitterte Haar hinter die Ohren streicht, um ihr in die Augen sehen zu können. Als auch Josepha Brot kaut, verblassen die Flecke. Das Gesicht beginnt in die Gegenwart zurückzualtern und gibt Josepha zu lesen auf zwischen den Falten. Das hat sie ohnehin gelernt in den Jahren ihres Lebens zwischen Thereses mütterlichen Röcken und Blicken. Josepha liest Augusts Lust aus Thereses Augenwasser, sie riecht den Duft des besänftigenden Krautes hinter Thereses Ohren und unter dem Kinn, sie sieht den Fieberschweiß perlen über den Rücken der Nase und die Trauer der Unwiederbringlichkeit um Thereses Mund. Noch ehe Josepha Fragen stellen kann, entschläft ihr die Alte in die Nacht hinein. Josepha trägt Therese ins Bett und geht mit sich schlafen: Der nächste Tag des Kalenders ist rot mit einem Zahnarztbesuch, blau mit einer Dienstbesprechung und schwarz mit einem abendlichen Besuch bei der Freundin Carmen Salzwedel vorsorglich und nahezu völlig ausgefüllt worden, denn zwischen den drei notierten Ereignissen haben noch neun Stunden Arbeit stattzufinden, ein Einkauf und das Vervollständigen des Expeditionstagebuches.
Für die alternde Kleinbürgerin Ottilie Wilczinski jenseits der Grenze bringt der zweite Ausflug der Gunnar-Lennefsen-Expedition diesseits der Grenze wiederum den Verlust der Bildröhre mit sich. Um den Zusammenhang beider Ereignisse kann Ottilie vorerst freilich nicht wissen, sodass sie in einem Anfall erschrockenen Zitterns jenen Satz wiederholt, den der Kommentator ihres Fernsehprogramms vor dem Zusammenbruch des Bildes in ihr Wohnzimmer hineingesprochen hatte: Und so lassen Sie uns, liebe Zuschauer, protestieren gegen die Unfreiheit des totalitären Systems im Osten unseres Vaterlandes. Diesen Satz ruft sie auch aufgeregt dem Fernsehmechanikermeister Franz Reveslueh durchs Telefon zu, sie wagt ihn nun doch zu später Stunde anzurufen. Franz Reveslueh aber hält diesen Satz für die codierte Aufforderung zu neuerlichem Beisammensein, und da seine Ehefrau sich auf den Abend zu einem der Söhne aufgemacht hat, um dessen Frau im Häkeln zu unterweisen, setzt er seine dunkle Schirmmütze auf, der man landläufig den Namen des amtierenden sozialdemokratischen Bundeskanzlers beigegeben hat, wirft sich den legeren Trenchcoat über und machte sich zu Fuß auf den Weg, Ottilie Wilczinskis vermeintlicher Einladung zu folgen. In der unverschlossenen Wohnungstür meint er einen Wink zu sehen und findet die zitternde Ottilie auf der Couch des Wohnzimmers. Sie begrüßt ihn, indem sie ihm bebenden Auges ihr Undsolassensieunsliebezuschauer … entgegenhaucht. Natürlich erkennt Franz Reveslueh den erbärmlichen Seelenzustand Ottilies, als er die Reste der neuerlich implodierten Bildröhre erblickt und sich jenes vor Wochen gelaufenen Horrorfilmes erinnert, in dem eine alte Frau alles zerbrach, was sie mit ihrer linken Hand berührte. Gleichzeitig empfindet er Scham darüber, Ottilies Anruf auf seine Weise missdeutet zu haben, und er küsst, Entschuldigung heischend, ihre beperlte Stirn. Einige Überlegung veranlasst ihn dann, jenes Krankenhaus anzurufen, in dem sie nach wie vor ihre Kleiderbündel abgibt, und das ihrem Gatten Bodo langjährige Wirkungsstätte gewesen war. Nach zwanzig Minuten trifft ein Wagen des Rettungsdienstes ein und nimmt Ottilie mit. Franz Reveslueh hat sich aus Gründen der Diskretion vorerst nach Hause begeben. Dort holt er eine passende Bildröhre aus dem Materiallager seiner Firma und kehrt in Ottilies leere Wohnung zurück. Er repariert das Fernsehgerät und bringt aus dem Keller ein Gläschen Erdbeerkonfitüre mit, das er auf einem Umweg im Krankenhaus abgibt. All das dauert nicht so lange wie die Häkelstunde seiner Frau, sodass er zehn Minuten früher als sie nach Hause kommt, den Geruch der anderen Wohnung von seinem Leib duscht und in jenem Augenblick das Licht löscht, in dem seine Frau die Straßenschuhe abstreift, um in ihre Pantoffeln umzusteigen.
Ottilie Wilczinski aber hat sich dem Druck der Psychopharmaka gebeugt und liegt ruhig in ihrem Krankenhausbett. Zuvor hatte eine junge Ärztin vergeblich versucht, ihr anamnestische Angaben für das Krankenblatt zu entlocken. Jener Satz des Kommentators ist es, den sie unausgesetzt wiederholt. Weil man befürchtet, Ottilie könne andere Patienten zu hysterischem Aufbegehren gegen totalitäre Systeme aufstacheln, gibt man ihr ein Zimmer für sich allein. Die Sorge des Personals um Ottilie Wilczinskis aufrührerisches Potenzial erweist sich aber als unbegründet.
In den kommenden Tagen soll sie psychotherapeutischen Versuchen, ihren Schockzustand aufzulösen, mit großer Kraft standhalten, sodass der der Klinik seit geraumer Zeit vorstehende Professor den Versuch ins Auge fasst, ihn mit Hypnose zu durchbrechen. Er bereitet sich darauf vor, indem er den Fernsehmechanikermeister Franz Reveslueh in seine Sprechstunde einlädt, erhofft er sich doch von dem Manne Auskünfte über den Hergang des Geschehens. (Franz Revesluehs Name fand sich in den Aufnahmepapieren, er war beim telefonischen Notruf vermerkt worden.) Reveslueh schleicht sich während einer vorgeblichen Dienstfahrt in die psychiatrische Klinik. Bevor er allerdings das Zimmer des Professors erreicht, treibt ihn ein gewisser Drang in die Nähe der geschlossenen Frauenstation, wo er Ottilie Wilczinski zu sehen hofft! Die störrische Schwester verweist ihn nach seinem Klingeln auf die fünf Stunden später angesetzte Besuchszeit. Geknickten Geschlechts steht er schließlich dem Professor gegenüber, der, wie ihm plötzlich einfällt, jener Gilde angehört, die von seiner Ehefrau als die der Klapsgreifer und Graupenjäger bezeichnet wird. Zwar sucht man in des Professors Gesicht vergeblich nach den Malen innerer Entzweiung, aber Franz Reveslueh glaubt doch, von Zeit zu Zeit über dem Kopf des Arztes eine Gloriole zu erblicken, in der ein leuchtendrosa Vöglein seine lustigen Runden fliegt. Das lenkt ihn von den Fragen ab, die ihm gestellt werden und die alle jenen Abend betreffen, an dem die Gunnar-Lennefsen-Expedition zum zweiten Male aufbrach, was der Professor und Franz Reveslueh natürlich nicht wissen können. Letzterer setzt sein fragendes Gegenüber davon in Kenntnis, dass er bereits in der Frühe bezeichneten Tages eine am Vorabend zweifelsfrei implodierte Bildröhre in Ottilie Wilczinskis Fernsehgerät durch eine neue ersetzt hatte. (Dabei erwähnt er nicht, wie nahe er seiner Kundin im Vorfeld der Reparatur gekommen war.) Auch dem Professor fällt, wie am Unglücksabend Franz Reveslueh, jener Horrorfilm ein, der für alte Damen durchaus seelische Drangsal mit sich bringen mag. Er schließt, dass auch seine Patientin den Film gesehen und in aufeinanderfolgenden Implosionen Winke eines bevorstehenden furchtbaren Schicksals erahnt haben könnte. Ein alterndes Herz ist nach seiner Auffassung kein schlechter Ort für bedrohliche Gedanken, wobei auch der Vorgang der Implosion selbst beeindruckend genug gewesen sein könnte, einen Schock auszulösen. Das bringt den Professor dazu, Franz Reveslueh um eine ausgediente Farbbildröhre zu bitten, mit der er Ottilies Heilung einzuleiten gedenkt. Am nächsten Morgen versammelt er das Klinikpersonal und hypnotisiert Ottilie Wilczinski mit solcher Leichtigkeit, dass ihm über Minuten hinweg nicht klar ist, ob er seine Patientin erreicht hat oder nicht. Als er sich seiner Sache sicher ist, spricht er Datum und Situation des Unglücksabends in Ottilies Gesicht. Dem eingeweihten Krankenhausgärtner genügt ein kurzer Wink, und er fordert mit pastöser Stimme seine Zuschauer auf, gegen die Unfreiheit des totalitären Regimes im Osten des Vaterlandes zu protestieren. Mit einer Harke zertrümmert er die aufgebahrte Bildröhre und löst damit einen vielstimmigen Aufschrei des Personals aus. Viel bedeutungsvoller hingegen: Ottilie Wilczinskis Schreckstarre bricht. Splitter der Röhre verletzen sie im Gesicht, und sie starrt auf die Pfützchen Blutes, die sich zu ihren Füßen sammeln und ihrem eigenen Leibe entlaufen sein müssen. Sie spürt, wie ein tiefes Erinnern an jenen Stellen ihrer Seele einsetzt, die sie nach dem Ende des letzten Krieges gewöhnlich mit Häkeldeckchen und Wohlfahrtspäckchen bedeckt hat. Ihr ist, als liefe ihr altes Blut aus, um einem neuen Platz zu machen. Die Ärzte, Schwestern und Wischfrauen haben indes mit Wundverband und Desinfektion des Fußbodens reichlich zu tun und bemerken nicht, wie sich Ottilies geweitete, eher erstaunte denn wissende Augen auf einen Punkt in der Ferne konzentrieren, der immer näher zu kommen scheint und sich, als er etwa zwei Meter vor ihrer Nasenwurzel steht, als Abbild eines männlichen Neugeborenen entpuppt. Ottilie Wilczinski beginnt zu schielen, bis das Bild des Kindes durch die Pupillen hindurch ihren Körper erreicht, das Chiasma opticum passiert und sich als Gewissheit in ihrem Hirn einnistet: Sie ist schwanger. Sie spürt, wie sich der Keim in ihrem Bauch zur Morula teilt, und sie weiß, es wird noch viel, viel dicker kommen.