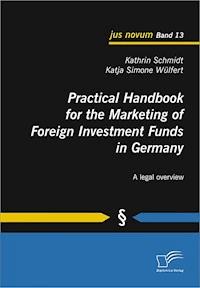18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kleine Verhältnisse, große Geschichte: Zwei Nachbarsfamilien in Weitwinkelaufnahme Kathrin Schmidt greift weit aus: Entlang der spannungsreichen Beziehungen der Familien Kapok und Schaechter erzählt sie von Krieg, Flucht, Teilung, Bespitzelung und neuer Freiheit – und von Liebe, Freundschaft, Schuld und Glück. Die Siedlung Eintracht, einst direkt an der Berliner Mauer gelegen, hat ihre Abgeschiedenheit bewahrt. Jahrzehntelang hat Werner Kapok sein Elternhaus, in das seine Schwester Renate gezogen ist, gemieden. Stattdessen gründete er eine eigene Familie und verließ sie schnell wieder. Später gab er seine Professur auf und verschwand. Nun kehrt er zurück, und die Familiengeschichte holt ihn ein. Denn im Haus gegenüber wohnen immer noch die Schaechter-Schwestern Barbara und Claudia, mit denen er groß geworden ist und seine Sehnsüchte teilte. Dass sie ihn, jede für sich, in die Liebe einführten, haben sie einander bis heute verschwiegen. Als dann auch noch Werners verlorener Sohn auftaucht, kann nichts bleiben, wie es war. Alte Geheimnisse, vergessene Leidenschaften, noch immer schwelende Konflikte müssen ans Licht. Kathrin Schmidt erzählt eine große Geschichte aus kleinen Verhältnissen, führt ihre Leser in abgelegene Gegenden, vergangene Zeiten und in die deutsche und europäische Gegenwart. Kunstvoll, mit Gespür fürs Detail, große Gefühle und niedere Instinkte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Kathrin Schmidt
Kapoks Schwestern
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Kathrin Schmidt
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Kathrin Schmidt
Kathrin Schmidt, geboren 1958 in Gotha, arbeitete als Diplompsychologin, Redakteurin und Sozialwissenschaftlerin. Sie erhielt für ihre literarischen Arbeiten zahlreiche Preise, darunter den Leonce-und-Lena-Preis 1993. Ihr 1998 erschienener Roman »Die Gunnar-Lennefsen-Expedition« wurde mit dem Förderpreis des Heimito-von-Doderer-Preises und dem Preis des Landes Kärnten beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 1998 ausgezeichnet. Für ihren Roman »Du stirbst nicht« erhielt sie 2009 den Preis der SWR-Bestenliste und den Deutschen Buchpreis. 2010 erschien »Blinde Bienen. Gedichte«, 2011 der Erzählungsband »Finito. Schwamm drüber«.
Sie lebt in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Zwei Nachbarsfamilien in Weitwinkelaufnahme: Entlang der spannungsreichen Beziehungen der Familien Kapok und Schaechter erzählt Kathrin Schmidt von der Suche nach eigener Identität während der großen gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen der letzten hundert Jahre.
Die Siedlung Eintracht, einst direkt an der Berliner Mauer gelegen, hat ihre Abgeschiedenheit bewahrt. Jahrzehntelang hat Werner Kapok sein Elternhaus, in das seine Schwester Renate gezogen ist, gemieden. Stattdessen gründete er eine eigene Familie und verließ sie schnell wieder. Später gab er seine Professur auf und verschwand.
Nun kehrt er zurück, und die Familiengeschichte holt ihn ein. Denn im Haus gegenüber wohnen immer noch die Schaechter-Schwestern Barbara und Claudia, mit denen er groß geworden ist und seine Sehnsüchte teilte. Dass sie ihn, jede für sich, in die Liebe einführten, haben sie einander bis heute verschwiegen. Als dann auch noch Werners verlorener Sohn auftaucht, kann nichts bleiben, wie es war. Alte Geheimnisse, vergessene Leidenschaften, noch immer schwelende Konflikte müssen ans Licht.
Kathrin Schmidt erzählt von den spannungsreichen Beziehungen der Familien Kapok und Schaechter zwischen Krieg, Flucht, deutscher Teilung, Bespitzelung, vermeintlicher Freiheit - und von Liebe, Freundschaft, Schuld und Glück. Eine große Geschichte aus kleinen Verhältnissen, die ihre Leser in abgelegene Gegenden, vergangene Zeiten und in die deutsche und europäische Gegenwart führt. Kunstvoll, mit Gespür fürs Detail, große Gefühle und niedere Instinkte.
Inhaltsverzeichnis
Unterstützung durch den Deutschen Literaturfond
Dank
Textbeginn »Kapoks Schwestern«
Die Autorin dankt dem Deutschen Literaturfonds e.V. herzlich für die Unterstützung der Arbeit.
Ich habe zu danken. Natürlich den Erfundenen, aber auch den Lebenden und den Toten. Stellvertretend seien genannt: Katja und Heinz Stern, Stefan Doernberg, Henny und Norbert Jacob, Angela und Gerd Schäfer, Dieter Segert, Adisa Bašić, Adnan Smajić, Willi Wilhelm, Ronald Schwandtke und Juliane Rösch, ohne die das Buch um einige Farben ärmer geraten wäre.
Werner Kapok springt vom Stuhl am Schreibtisch seiner Schwester auf, als er durchs offene Fenster das Trippeln hört. Er hat keineswegs darauf gewartet, aber in diesem Moment wird ihm klar, wie sehr es gefehlt hat an diesem Tag. Die Schaechters, beide auf Ende fünfzig zugehend und ausgestellt lebenslustig, laufen mit kleinen Schritten vorbei, wobei die münzgroßen Absätze ihrer schwarzen Schuhe in schnellem Wechsel den Takt schlagen. Sie wohnen im Nachbarhaus, das sie von ihren Eltern übernommen haben. Die Schwestern gehen noch immer elegant gekleidet und ein wenig extravagant, einen Tick überm Horizont der alteingesessenen Siedlungsbewohner. Sie wissen natürlich, dass sie beobachtet werden auf Schritt und Tritt. Er fragt sich, ob sie der alltäglichen Gafferei der Nachbarn während der letzten Jahre womöglich weniger gewachsen waren als der einst angeordneten Ausforschung, und er erinnert sich erstaunt ihrer Mädchenhaftigkeit, die sie längst eingebüßt haben. Die Ältere, Claudia, hatte das Haar damals lang und meist offen getragen, und Barbara den Gegenentwurf dazu abgegeben mit ihrer blond gefärbten Kurzhaarfrisur.
Er steht im Dachgeschoss, sieht sie also von oben und verzieht das Gesicht: Breiter Ansatz von Grau unterwandert die mahagonigefärbten Scheitel, die beide in der Mitte des Oberkopfes tragen. Die Haare fallen in gleicher Länge links und rechts der Gesichter exakt bis auf Ohrläppchenhöhe. Barbara trägt ein grün schillerndes Kleid mit tief angesetztem Rock. Charlestonstil, denkt er, lächelt und wendet den Blick Claudia zu und deren schwarzem Kostüm mit breitem, leuchtend orangefarbenem Ledergürtel. Beide zeigen einen Ansatz zum Buckel, sodass sie die Köpfe vorgeschoben und aufgereckt halten.
Gestern Abend ist er nach einer Ewigkeit, die er mit beinahe zweieinhalb Dekaden beziffert, hierher zurückgekehrt, und Renate hat, nachdem sie einander nicht gerade herzlich, aber doch vorsorglich tastend begrüßt hatten, auch von den Schaechtermädchen erzählt. Dass sie wieder in ihrem Elternhaus wohnten wie sie selbst. Dass man Anfang der Neunzigerjahre den infarktüberwältigten Vater, Tage vor seinem Krankenhaustod, und zwei Jahre später die demenzkranke Mutter aus dem Haus getragen habe.
Kapok merkt, dass da, wo die Schaechtereltern offenbar in seinem Herzen gehaust haben, ohne dass er sie bemerkt hätte in all den Jahren, ein deutliches Loch bleibt, nun, nachdem er sich bewusst gemacht hat, dass sie endgültig davongegangen sind. Das Loch aber ist keineswegs leer: Die Schwestern, langsam in die Realität alternd, hocken noch drin und lachen, dass es ihn schmerzt.
Inzwischen haben sie das Vorgartentor geöffnet.
Nun, da es zweifellos zu spät ist, fragt sich Kapok, warum er keiner von beiden je einen Antrag gemacht hat.
Claudia Schaechter zieht die Sandalen aus und stellt sie im Erdgeschoss in den Winkel zwischen Küchenwand und Kellertür. Ihre Schwester behält ihre Schuhe bis zur oberen Etage an den Füßen, zieht sie erst dort aus und wirft sie in den Schuhkipper. Mit dem Tod der Mutter haben sie das Haus aufgeteilt. Die Küche in der unteren Etage und den Garten benutzen sie gemeinsam. Von Grund auf muss saniert werden. Sie sind übereingekommen, das Dach erneuern und die Fassade dämmen, die Elektrik komplett auswechseln und den Keller trockenlegen zu lassen. Nächtelanges Rechnen ist dem Bestellen der Handwerker vorausgegangen.
Barbara arbeitet als Sachbearbeiterin für dezentrale Kulturarbeit im öffentlichen Dienst des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf, Claudia ist Kostümbildnerin, hatte bis Anfang der Neunziger am Theater gearbeitet. Seit sie nach einer der Entlassungswellen auf der Straße stand, hat sie nie wieder einen Fuß in die Tür kriegen wollen, sondern näht jene extravaganten Kleider, die in einigen Boutiquen der Stadt für gutes Ein- und damit Auskommen sorgen und der Schwestern Sonderstellung in der Siedlung Eintracht befestigen. Der verschlafene Winkel Berlins zwischen der Kleingartenanlage Formosa und der Siedlung Heimatscholle war früher grenznah gewesen und deshalb abgelegen. Die Grenze gibt es längst nicht mehr. Dennoch haben die weiten Baumschulgebiete in der Umgebung dafür gesorgt, dass sich an ihrer Abgelegenheit nicht viel änderte. Endlich ist es, wie es überall ist auf der Welt: Die in die Jahre gekommenen Bewohner der Häuser sind ans Sterben gegangen und haben sie ihren Kindern vererbt, die ihrerseits auch schon zu alt sind, um ihr Glück noch anderswo suchen zu wollen. Aber es ist ein Schwebezustand des verabredeten Besitzens, denn die nun in den Häusern Lebenden wissen ihre Kinder oft weit im Land oder gar über den Erdball verstreut, wo sie auf eine Weise existieren, die ihren Eltern nicht mehr nahe und nicht mehr verständlich ist. Sie würden die Häuser weder übernehmen wollen noch können, und so versuchen die einen gar nicht erst, sie noch auszubauen oder besonders gut zu erhalten, sondern leben auf Rente und Ende zu, während die anderen sie verscheuern und das Geld, je nach innerfamiliärem Zusammenhalt, entweder für die Kinder anlegen oder auf ihre älter werdenden Tage verjubeln. So hat das eine oder andere Grundstück über die Jahre neue Besitzer bekommen, die aber meist nach dem Kauf nicht mehr genug Geld haben, abreißen und neu bauen zu lassen. Die Siedlung hat ihr Gesicht bis heute behalten.
Barbara und Claudia Schaechter haben keine Kinder, und auch ihr Haus sondert sie ab. In den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts von einem Gropiusschüler errichtet, krönt das Pultdach zwei Volletagen mit der Klarheit seines Entwurfes. In den Nachbar- und Abernachbargärten hingegen waren den winzigen Zimmerchen unter niedrigen Spitzdächern im Laufe der Jahre immer neue Zimmerchen angepflastert, waren Dächer übereck mit, je nach Verfügbarkeit, unterschiedlichen Ziegeln gedeckt worden und bestenfalls in den letzten Jahren unterm Schlingknöterich verschwunden. Diesen Häusern glauben Barbara und Claudia Schaechter übrigens schon von Weitem anzumerken, dass ihre Bewohner nicht nur vor der Wildheit des erst nach der Wende aufgekommenen Gewächses resigniert haben.
Claudia weiß um die Härte von Depressionen. Deshalb hat sie ihre Schwester überredet, an den Sonntagen zu einer Runde über den Spinat- in den Alpenrosen- und Ligusterweg aufzubrechen und an den Zäunen der Knöterichhäuser nach deren Bewohnern Ausschau zu halten. Sind sie bei ihren Verrichtungen zu entdecken, im Garten oder hinter den Gardinen, gehen die beiden weiter. Sehen sie aber niemanden, so klingeln sie. Klopfen, wenn eine Reaktion ausbleibt, an die Türen und versuchen, sich Einlass zu verschaffen. Den alten Achernkötter haben sie so halb tot in seinem Bad gefunden, er war gestürzt und konnte sich alleine nicht mehr helfen. Hatte sich und die Welt aufgegeben, die nun aber in Gestalt zweier elegant gekleideter Frauen in seinen Nahraum zurückkehrte und ihn aufforderte, sich ihr noch nicht zu entziehen.
Das ist gut ausgegangen, die Schaechterschwestern haben den Notarzt geholt, und nach zwei Wochen Krankenhaus und einer anschließenden vierwöchigen Rehabilitation ist Achernkötter zurückgekehrt. Mit Kraftaufwand hat er den Knöterich gekappt. Seitdem schlurft er am Stock hin und wieder zum Gropiusbau, spielt mit den beiden Skat oder erörtert das Ausbleiben des Anschlusses an die Kanalisation, um den sich die Schwestern schon zu alten Zeiten starkgemacht und mithilfe ihrer Eltern über Eingaben an das Zentralkomitee der damals herrschenden Partei zu befördern geglaubt hatten.
Je länger der Anschluss verschoben wird, desto gleichmütiger wird man in der Siedlung darum. Achernkötter und die beiden Schwestern scheinen die Einzigen zu sein, denen es etwas ausmacht, regelmäßig die Scheißeabfuhr bestellen zu müssen. Sie haben Flyer gedruckt und in die Briefkästen gesteckt, auf denen sie die Mitbürger auffordern, wieder und wieder an die Berliner Wasserbetriebe heranzutreten in der Angelegenheit, sich in Erinnerung zu bringen, aber selbst wenn sie die Nachbarn darauf ansprechen, ernten sie nur ein müdes Schulterzucken. Achernkötter zieht jedes Mal nach solcher Erörterung wutschnaubend ab und hat wieder genügend Energie geladen für ein paar Tage Weiterlebens.
Eigentlich geraten alle Anwohner der näheren Umgebung, auch die längst verstorbenen oder verzogenen, für die Dauer eines Knopfannähens etwa oder einer Tasse Kaffee aus dem im vergangenen Jahr angeschafften Vollautomaten in die flatternden Gedanken der Schwestern. Nur Werner Kapok wollen sie lieber hinauswerfen. Kapok, den Barbara stets Kapo nennen möchte, nachdem sie irgendwo gelesen hat, dass dieses Wort in der albanischen Umgangssprache einen Spitzel bezeichnet. Denkt sie länger an ihn, als sie will, nimmt sie aber doch Zuflucht zur Deutung, der von italienischen Wanderarbeitern in die süddeutsche Handwerkersprache eingebrachte Begriff Kapo für Vorarbeiter sei nach der Eröffnung des Konzentrationslagers Dachau in die Lagersprache eingegangen, weil bayerische Angehörige der Arbeiterbewegung dessen erste Häftlinge gewesen waren.
Seine Schwester wohnt nach wie vor im Nachbarhaus, das einmal das Elternhaus der Kapokkinder gewesen ist. Ganz aus dem Sinn gerät Kapok den Schaechters nie, Renate scheint sie zudem aus seinen Augen anzublicken, wenn sie beim Wäscheaufhängen einen Schwatz übern Gartenzaun riskieren oder man sich beim Einkaufen trifft. Claudia versucht wie Barbara, ihm den Zutritt zu ihren Gedanken zu verwehren, hat dafür jedoch andere Gründe als ihre Schwester.
Heute hat sie Mozzarella gekauft, aufgeschnitten und zwischen Tomatenscheiben gepackt, mit Olivenöl und Balsamico beträufelt und Basilikumblätter aufgestreut. Sie ruft Barbara mit ihrem Handy an, um sich einen Treppenaufstieg zu ersparen, und bittet sie zu einem gemeinsamen Abendessen in die Küche. Morgen werden die ersten Handwerker anrücken. Ihr graut davor.
Die Nacht fließt über die Siedlung, schwarzgrundiger Mousselin, dem hier und da ein Goldpunkt eingewebt scheint vom Licht einer Straßenlaterne. Nichts ist zu hören, niemand kehrt spät heim. Es ist der 24. August, Kapoks Schwester wird morgen wieder den Schuldienst antreten, die Ferien gehen zu Ende. Sie hat sich früh schlafen gelegt.
Werner Kapok sitzt auf der Terrasse, der Seite der Schaechters abgewandt, hat das Windlicht zwei Meter von sich weggeschoben, weil er sich vor Insekten fürchtet. Die Stille lässt jeden Anflug eines solchen Tierchens vernehmen, sodass Kapok gebannt auf die Kerze starrt, um beim Auftauchen einer Hornisse etwa im Inneren des Hauses zu verschwinden. Der Garten, knappe achthundert Quadratmeter groß, hält sicher das Jahr über Aufgaben bereit, die er längst vergessen hat. Die Eltern hatten hier, hinter dem Haus, einst Gemüse, Erdbeeren, sogar Kartoffeln angepflanzt, die Scheiben um die Obstbäume mit Tagetes und Astern versehen, den Zaun mit Stachel- und Johannisbeeren gesäumt. Seine Schwester hat zwar mit den Jahren jedes Beet in Rasenland verwandelt, das sie nur noch mähen muss, aber das tut sie offenbar gründlich und genau. Wenigstens die Beerenbüsche gibt es noch, sie werfen sogar in der Nacht lange Schatten, denn insbesondere die Johannisbeersträucher haben es auf eine bewundernswerte Größe gebracht. Ende Juni bis Anfang Juli, rechnet Kapok nach, konnte seine Schwester ernten. Sie hat einen Stachelbeerkuchen gebacken zu seiner Ankunft, mit Baiserhaube. Kapok sah seine alten Eltern mit am Tisch sitzen, als er davon aß. Selbst Johannisbeerlikör wie in früheren Zeiten hat sie angesetzt.
Er öffnet ein Bier und schielt hinauf zum Mansardenfenster. Offen steht es, bewegt sich kaum sichtbar, das Glas spiegelt im Mondschein, wenn die Scheiben einen bestimmten Winkel erreichen. Kapok scheint es, als riskiere die Dunkelheit nach jeweils längerem Zögern ein schnelles Eintauchen ins Zimmer, um sich im nächsten Moment ängstlich zurückzuziehen. Renate hat ihm erzählt, dass Henry dort gelebt habe, bis vor einem Jahr etwa. Sie weiß nicht, wo der Junge jetzt ist, aber er kommt ein bis zwei Mal im Monat vorbei, um sang- und klanglos wieder zu verschwinden, wenn seine Wäsche sauber ist. Er habe gespielt, sobald er zu ein bisschen Geld gekommen sei. Sie vermutet, sexuelle Dienstleistungen haben ihm dazu verholfen.
Die Mutter seines Sohnes hat er jetzt geschlagene sechsundzwanzig Jahre nicht mehr gesehen, er zweifelt, ob er sie überhaupt wiedererkennen würde, liefe sie an ihm vorbei. Die Abstände, in denen er seinen Sohn früher bei ihr abgeholt hatte für ein gemeinsames Wochenende oder ein paar Urlaubstage, waren groß genug gewesen, ihm ihr fortschreitendes Aufschwemmen deutlich werden zu lassen. Als er sie das letzte Mal getroffen hatte, zur Einschulung des Jungen, hatte er sich des gemeinsamen Auftretens halbwegs geschämt. Jetzt, da er daran denkt, riecht er sie: abgestandene Fleischbrühe im Zustand des Umkippens in die Fäulnis. Es schüttelt ihn in genau dem Moment, da er die Flasche an die Lippen setzt. Das Bier rinnt durch den Bart, tropft auf die kurze Hose. Kapok flucht. Während er mit der linken Hand das Kinn trocken zu wischen versucht, hört er von der Seite der Schaechterschwestern leise Musik, Klassik, wie er sie auch zuweilen zu Hause in Trebesee anstellt mit seinem alten, wunderbar volltönenden Radiogerät Rema andante, das er aus zwei defekten Apparaten zusammengebaut hat und das sein ganzer Stolz ist. Er stellt die Bierflasche auf den Tisch und streicht im Schutz der Beerensträucher zum Zaun, begierig, einen Blick auf die Damen zu erhaschen, die ihm heute wieder ins Bewusstsein getrippelt sind, jenseits dessen er auf sie gewartet zu haben scheint. Auch sie sitzen hinter dem Haus, Claudia hält eine entkorkte Weißweinflasche in der Hand und füllt zwei Gläser, während Barbara, wie in einer Ohnmacht, fast aus dem Korbsessel rutscht, so sehr hat sie alle viere von sich gestreckt. Claudia klopft ans Glas, um die Schwester zurückzuholen von ihrem Ausflug in die schläfrige Gelenklosigkeit, Kapok erahnt ihren Gesichtsausdruck mehr, als dass er ihn sieht, sie steht ungünstig hinter dem Pfosten des Holzdaches, das die Garage verlängert. Dafür kann er Barbara genau beobachten, wie sie die Augen öffnet und sich des Mittelpunktes ihres Körpers zu erinnern scheint, sie zieht das Gesäß zurück auf die Sitzfläche, wobei der Rumpf nach vorn wandert, die Arme auf den Sessellehnen Platz finden und die Beine in einer Art sittsamer Grazie eng nebeneinander, leicht schräg zur Körperachse und in den Knien streng abgewinkelt, aufgestellt werden. Ihre im Licht der Terrassenbeleuchtung blaustichige Gesichtsfarbe irritiert ihn, er muss sich zwingen, sie anzuschauen. Das Alter hat die Augen tief in violett schimmernde Höhlen gedrückt, aus denen aufzutauchen sie Mühe haben. Die Nase ist noch spitzer geworden. Was ihn aber bestürzt, ist der Mund, der wie der einer Greisin in Zahnlosigkeit zugezogen scheint. Werner Kapok fühlt die Härchen seiner Unterarme, wie sie sich aufstellen und stehen bleiben im Zustand der Schreckstarre. Die Zeit ist eine Dampframme, der nichts widersteht. Mit der Zunge fährt er sein Zahnrund ab: Links oben sondiert er drei überkronte Zähne, aber rechts unten hat ihn die zu erwartende Rechnung sozusagen abspringen lassen von der Brücke, die nötig gewesen wäre, die Lücke zu schließen. Er redet sich ein, dass ihm das lieber sei als die Kronenlösung, denn die Spalten zwischen den Zähnen links oben lassen Fleisch- und Gemüsefasern erst unter heftigem Zusetzen mit einem Zahnstocher wieder frei nach den Mahlzeiten, während er ein Bröckchen aus der Lücke rechts unten einfach mit der Zunge herausschieben kann. Sitzt es sehr fest, benutzt er in unbeobachteten Momenten, und um solche handelt es sich beinahe ausnahmslos, wenn er zu Hause in Trebesee isst, den Zeigefinger der linken Hand, um es auszulösen. Im Angesicht der alternden Barbara Schaechter muss er sich vorstellen, wie er eine grobe Bratwurst zigarrengleich in den Mund schiebt und versucht, sie mit dem Gaumen zu zerquetschen. Eine grobe Schweinswurst kann ihn noch immer an früher denken lassen, da er im thüringischen Wölfis die größeren und kleineren Ferien verbracht und als Kind so manches Schlachtfest erlebt hat. Wurstsuppe, Blut-, Leber- und Knackwurst sind unerreicht geblieben im Geschmack, nur irgendeine Discounter-Bratwurst enthält etwas, was ihm von damals bekannt vorkommt. Oft hat er gerätselt. Majoran? Thymian? Sein Blick fällt auf die sich im Terrassenlicht windende Kräuterschnecke der Schaechterschwestern, wo Melisse, Minze, Borretsch, Bohnenkraut üppig wuchern, aber vom Liebstöckel übertrumpft werden. Nein, es will ihm einfach nicht einfallen, welche Ingredienz für das Wohlgefühl verantwortlich sein soll.
Auf morgen!, prostet Claudia der Schwester zu.
Barbara Schaechter lacht plötzlich und greift zu der auf dem Tisch stehenden Porzellandose. Sie schiebt sich etwas in den Mund, was ihr Gesicht aus der Jenseitigkeit des Alters in die gegenwärtige Sommernacht rettet.
Sie trinken, genussvoll, mit kleinen Schlucken, stellen die Gläser auf den Tisch.
Den ihm zufliegenden Gesprächsfetzen entnimmt er, dass morgen in aller Herrgottsfrühe Handwerker anrücken, das Haus mit einem Gerüst umgeben und beginnen werden, die Teerpappe vom Dach zu nehmen, um es neu einzudecken. Barbara erhebt sich und geht ins Haus, kommt zurück. Die Musik wechselt zu langsamem Jazz. Claudia steht auf und erwartet ihre Schwester mit ausgestreckten Armen und nach hinten gedehntem Oberkörper.
Das Letzte, was er jetzt sehen will, ist ein tanzendes Schwesternpaar.
Das Schwesternpaar tanzte am Faschingsdienstag des Jahres 1962 im Kindergarten zu Radiomusik. Barbara und Claudia, drei und sechs Jahre alt, sahen gut aus als Hänsel und Gretel. Joachim Schaechter trug seine alte Reflex-Korelle am Mann, die er kurz nach dem Krieg auf dem Schwarzmarkt erstanden hatte. Er war froh darüber gewesen, sie ergattert zu haben, kannte er ihren Vorläufer doch gut aus den Dreißgerjahren.
Seine Töchter hatten heute das Glück gehabt, dass er sie hinbringen konnte. So mussten sie nicht schon kurz vor der Öffnungszeit um sechs Uhr mit der Mutter in der Kälte vor dem Haus stehen. Und er blieb noch zur Feier und fotografierte, musste niemanden zum Grinsen auffordern: Die Kinder sprangen laut gackernd umeinander. Vor fünf Wochen hatte er anderswo zu knipsen gehabt, die Reflex-Korelle hatte er zu Hause gelassen und stattdessen die Ercona II benutzt, die er vor vier Jahren angeschafft hatte. Mit ihr fühlte er sich bei solchen Gelegenheiten sicherer, obwohl er nicht sagen konnte, warum. Am S-Bahnhof Wollankstraße war Ende Januar ein Fluchttunnel entdeckt worden, der am ersten Februar der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Der Bahnhof lag über der Straße auf hochgelegten Gleisen Ostberliner Territoriums, war aber nur von der Westseite Berlins aus zu erreichen. Ein fremdes Ei im eigenen Schoß, sagte Kurt Kapok dazu, der in den Betriebsräumen der Tribüne genannten Zeitung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes auf seinen proletarischen Schweiß auch nach seinem erfolgreichen Aufstieg vom Arbeiterkorrespondenten zum hauptamtlichen Redakteur großen Wert legte. Joachim Schaechter hingegen hatte studiert und niemals in seinem Leben einen proletarischen Schweiß geschwitzt. Da er hervorragend fotografierte, geriet manchmal beinahe ins Abseits, dass er vor allem hervorragend schrieb, aber das war ihm nicht ganz unrecht in diesen Zeiten. Hätte er zum Beispiel schreiben müssen, dass der Tunnel gebaut worden sei, um Westagenten in den Osten zu schleusen, hätte sich ihm vermutlich die Hand über der Schreibmaschine spontan versteift. Also überließ er das Kurt Kapok, bemühte sich später, den Artikel nicht zu lesen, und hatte ein Foto beigesteuert, das den Verkehrsminister Kramer vor der versammelten Journalistenschar zur Pressekonferenz zeigte.
Kurt Kapok spürte, dass Schaechter nicht proletarisch schwitzte. Das brachte ihn zuweilen in Rage, verführte ihn aber auch dazu, Schaechter oft sehr nahe auf die Pelle zu rücken, um ihn riechen zu können. Er wusste einfach nicht, was er da roch, wenn seine Nase sich neben dem Ohr des vor ihm sitzenden Schaechter blähte und begierig die ihn umgebende Luft einsog. Schaechter wurde von einem Anflug Widerwillens erfasst, wenn er bei solchen Gelegenheiten Kapoks Hang zum Rasierwasser Perlonta feststellen musste, drehte aber, ehe das bemerkt werden konnte, rasch den Kopf und fragte die Nase neben seinem Ohr nach deren Begehr.
Kurt Kapoks Sohn Werner besuchte mit Schaechters Töchtern den Kindergarten, er trug eine sehr kleine Budjonowka zum Fasching, die ihm seine Mutter genäht haben musste. Schaechter lächelte, als er das Kerlchen sah, wie es sich zwischen Barbara und Claudia drängte, die Kinder waren eng miteinander, jetzt tanzten sie zu dritt. Schaechter drückte mehrmals auf den Auslöser der Kamera. Der rote Stern auf der Kopfbedeckung von Werner Kapok funkelte, er war nicht, wie beim Original, aus rotem Stoff, sondern Lenin als Kind war in der weißen Mitte des rotzackigen, glänzenden Metallsterns zu sehen, der als große Brosche auf dem Mützchen thronte. Schaechter fühlte sich plötzlich klein werden beim Anblick dieses Jungen, ja, er merkte, wie er der Erinnerung entgegenschrumpfte, die ihn gleich einholen wollte. Er riss am Rollkragen seines Pullovers, wollte Luft und lief ins Freie. Dort aber klebte ihm der Kaltleim des Winters die Arme über die Brust zusammen, er atmete noch einige Mal tief ein und aus und schlüpfte wieder hinein.
Barbara, ein bisschen blass nach einer eben überstandenen Lungenentzündung, war erst seit dem Vortag wieder im Kindergarten. Sie hatte den Vater sofort vermisst und war unruhig geworden. Schaechter hatte Mühe, die Arme von der Brust zu lösen, um Frau Theuerkauf das leise weinende Mädchen abzunehmen.
Wissen Sie was?, sagte er, ich nehme sie wieder mit nach Hause, es ist zu früh. Hals über Kopf hatte er dem Kind das dicke schwarze Mäntelchen angezogen, das Kapoks Frau aus den noch guten Partien eines ausrangierten Wintermantels gearbeitet hatte. Die beiden vorderen Taschen hatte sie mit weißen, wollenen Heftstichen verziert und dem Kragen ein großes Stück Minchen aufgesetzt. Minchen, die schwarze Schaechterkatze, war vor Kapoks Augen von einem der nur selten durch die Straßen der Siedlung kurvenden Autos erfasst worden. Im Kaninchenschlachten erfahren, hatte Kapok kurz entschlossen das tote Tier hinters Haus gebracht, abgezogen und das Fell seiner Frau für den Mantel gegeben. Barbara war zu klein, Claudia zu arglos Erwachsenen gegenüber. Als sie sich zum ersten Mal tief und voller Entzücken in den Kragen hineingewühlt hatte, war Schaechter einen Moment lang versucht gewesen, dessen Herkunft zu offenbaren. Er hatte sich einst geschworen, seinen Kindern nie ein X für ein U vormachen zu wollen …
Er schüttelte sich laut schnaufend, gab Claudia und Werner ein Küsschen, reichte Frau Theuerkauf die Hand und verließ das Haus.
Kapok hatte dafür gesorgt, dass Schaechter mit seiner Familie einen Hauswürfel beziehen konnte in der Eintracht-Siedlung, die Bewohner hatten sich nach dem Westen abgesetzt im letzten Sommer. Er wohnte mit seiner Familie im Nachbarhaus, hatte also den Auszug brühwarm mitbekommen. Schaechter und seine Frau hatten als Korrespondenten des Zentralorgans in den Fünfzigern in Moskau gelebt, waren erst vor zwei Jahren zurückgekommen und in ein Köpe-nicker Mietloch jenseits der Karrieretreppe gezogen, die ihnen erst einmal verstellt worden war. Nicht nur Kapok war der bürgerliche Habitus der Schaechters ein Dorn im Auge. Joachim Schaechter war bei der Tribüne gelandet, seine Frau in der Kaderleitung des an der Spree gelegenen Transformatorenwerks. Das Angebot, in ein Haus zu ziehen, war ihnen mehr als recht gewesen, ungläubig hatten sie die Wohnraumzuweisung zunächst in den Händen gehalten, dann aber beschlossen, die Insel zu entern.
Kapoks Frau Henny arbeitete als Näherin im VEB Herrenbekleidung Fortschritt und ließ es sich nicht nehmen, der Schaechterfamilie hin und wieder gute Taten zukommen zu lassen, die sie nicht vergolten haben wollte. Schaechter fand es erstaunlich, wie sie aus dem Augenmaß Kleidung entwerfen konnte, die den Kindern tatsächlich passte. Einige Wochen nach dem Verschwinden der Katze hatte Kapoks Frau den Mantel vorbeigebracht. Cilly Schaechter hatte ein wenig bänglich dreingeschaut, als Barbara ihn anprobierte, aber nichts war geschehen.
Schaechter merkte, dass er den Mantel schlecht ertrug.
Ihm war, als hätte er ihn selbst jahrelang getragen.
In der Dumpfheit dieses Eindrucks lag ein Erschrecken, aber Schaechter ließ es, wo es war, und schichtete Pläne darüber, was er mit diesem Tage anzufangen gedachte.
Zu Hause brühte er erst einmal einen Kamillentee für Barbara und überlegte, was er zum Mittag kochen konnte. Nudeln und Suppengrün fanden sich in der Speisekammer, er löste Brühpaste auf und bereitete eine Nudelsuppe zu, während Barbara sehr ruhig an ihrem Tischchen saß, hin und wieder einen Strich aufs Papier brachte und ansonsten durch die Terrassentür ins Freie sah. Dort hatten sie ein Vogelhaus aufgestellt und es mit Futter befüllt, mit Haferflocken und Sonnenblumenkernen. Seine Tochter beobachtete die Vögel in großer Stille, die ihn erstaunte.
Er setzte sich neben sie auf den Fußboden und sah sie lange von der Seite an. Ihre kurzen Haare waren so dunkel, dass die zarte Haut des Gesichtchens fast durchsichtig schien und Adern erkennen ließ, er glaubte sogar ein Pulsieren in der Schläfengegend wahrzunehmen, das ihm Tränen in die Augen trieb. Mit dreiundvierzig Jahren gehörte er nicht mehr zur jungen Vätergeneration, allenfalls zur mittleren. Cilly hatte er vermutlich schon vor sechzehn Jahren zum ersten Mal gesehen. Damals hatten andere Frauen nach ihm Schlange gestanden, er hatte Cilly in ihrer ihm gegenüber zurückhaltenden Art zunächst gar nicht wahrnehmen können. Barbara hatte ihre hohe, gewölbte Stirn und den kleinen, zurückgezogenen Mund, dafür trug sie seine gebogene Spitznase dazwischen. Schaechter wunderte sich, als er sie ansah, warum sie nicht zehn Jahre älter war. Immerhin wäre das möglich gewesen. Aber vielleicht hatten Cilly und er die zehn Jahre gebraucht, um im Vertrauen aufeinander existieren zu lernen.
Die breiten Nagelspuren, die seinen Rücken narbig verändert hatten, stammten von ihr. Nie hatte sie sich geschämt, ihm in höchster Erregung das Blut aus der Haut zu kratzen, er war überrascht, ja, erstarrt gewesen, als sie das erste Mal mit solcher Heftigkeit vergaß, was sie tat. Aber kaum hatte er es einmal ausgehalten, verlangte es ihn wieder und wieder nach den Wunden, die sie ihm beibrachte. Ihre Art, mit ihm zu schlafen, unterschied sich von der ihrer Vorgängerinnen. Sie war weder gurrend noch seufzend, sie war inständig fordernd und dabei von großer Ernsthaftigkeit, die ihn anfangs verwirrt hatte. Bis zu Cilly hatte es ihm Spaß gemacht, Frauen systematisch aufzulesen. Bittersüßes Karamell. Aber Cilly war ihm sofort mit offen vorgebrachter Unvollständigkeit entgegengetreten, die verlangte, dass er sie aufhob, gegenstandslos machte für eine Weile. Der Spaß war harte, erschöpfende Arbeit geworden über der ersten Nacht mit ihr, und seitdem wusste er auch, wie geheilt er sich nach einer Frau fühlen konnte.
Er genoss es als ein Geheimnis, das zu hüten er sich nicht bemühen musste. Während er auf die Schläfe seiner Tochter starrte, überkam ihn das Verlangen, das Kind festzuhalten, er musste sich anstrengen, es nicht zu sehr zu drücken.
Noch hatten sie kein Telefon bekommen, obwohl das seiner Arbeit nicht zuträglich war. Um in der Redaktion Bescheid zu geben, dass er zu Hause blieb, musste er eine öffentliche Zelle aufsuchen. Er bedauerte, nicht früher daran gedacht zu haben. Kurt Kapok hatte ein Telefon, aber natürlich war er längst aus dem Haus. Die schwächelnde Barbara konnte er kaum noch einmal anziehen und mitnehmen, die nächste Zelle befand sich am S-Bahnhof, und er brachte es auch nicht übers Herz, sie allein zu lassen, selbst wenn er nur zwanzig Minuten unterwegs sein würde. Nicht einmal schlafend würde er sie hier zurücklassen wollen, die Vorstellung, sie schrecke auf und sei allein, ängstigte ihn. Zwar wusste auch Cilly nicht, dass er Barbara mit nach Hause genommen hatte, aber sie würde es erfahren, wenn sie die Kinder am Nachmittag abholen wollte und nur Claudia vorfand. Während er noch überlegte und den Blick dabei gedankenverloren über die Straße schickte, sah er Henny Kapok, wie sie die Tür des Hauses abschloss, um sich auf den Weg zu machen. Schnell öffnete er das Fenster und pfiff hinüber, sie entdeckte ihn sofort und kam auf sein Winken vorbei. Er bat sie, doch in der Redaktion anzurufen, wenn sie die Zeit noch habe, und erklärte ihr die Situation. Sie lachte und meinte, sie müsse erst zur Mittelschicht im Betrieb sein und habe früher losgehen wollen, um bei einer Freundin Mittag zu essen und dann gemeinsam mit ihr zur Arbeit zu gehen. Er wunderte sich über ihre Abschiedsgeste, sie hob zwei Finger in Stirnhöhe neben den Kopf. So etwas hatte er nur von Männern gesehen bislang. Sie schloss die Haustür wieder auf, um mit Kapok oder jemand anderem in der Tribüne zu telefonieren.
Barbara war noch vor der Mittagssuppe eingeschlafen, hatte sich aufs Sofa gelegt. Er holte das Federbett aus ihrem Zimmer und deckte sie zu, legte noch zwei, drei Kohlen nach. Dann streckte auch er alle viere von sich, er saß im Sessel, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, und hielt für Zufriedenheit, was er fühlte.
Kurt Kapok erreichte der Anruf seiner Frau kurz vor der Mittagspause. Schaechter konnte also nicht schon heute abkommandiert werden, um in verschiedenen Städten des Landes die Vorbereitungen zur Wehrerfassung der 40er- bis 43er-Jahrgänge zu dokumentieren, wozu er ihn ausersehen hatte. Hoffentlich würde er wenigstens ab morgen wieder zur Verfügung stehen. Er hatte Schaechter und seiner Frau, die ja auch voll berufstätig war, schon mehrmals empfohlen, die Kinder ins Wochenheim des Transformatorenwerkes zu geben, sicher wären sie da gut aufgehoben. Aber nicht einmal innerhalb seiner eigenen Ehe hatte er sich mit solch einer Idee durchsetzen können. Werner nur am Wochenende zu sehen, war Henny unvorstellbar. Stattdessen hatte sie mit Cilly Schaechter, die Normalschicht arbeitete, verabredet, dass sie Werner gelegentlich mit in den Kindergarten nahm oder mit den eigenen Töchtern von dort abholte, wenn ihre Schichtpläne mit den Arbeitszeiten ihres Mannes kollidierten. Eigentlich war es Henny Kapoks aus dem Rheinland zugezogene Mutter, die Werner oft abholte und mit zu sich nach Hause nahm, gelegentlich schlief er auch bei ihr. Aber zuweilen hatte sie anderes vor, und Schaechters waren gefragt.
Ärgerlich zuckte Kurt Kapok mit den Schultern, er wollte sich dem Gedanken an sein mangelndes Durchsetzungsvermögen lieber nicht hingeben. Die Wehrerfassungsgeschichte würde er erst einmal auf morgen schieben.
Auf dem Tisch lag Schaechters Schal, er hatte ihn offenbar gestern vergessen. In einem unbeobachteten Moment steckte Kurt Kapok seinen Kopf tief in das handgestrickte Ding.
Er konnte den Geruch nicht benennen.
Werner Kapok steht am 25. August des Jahres 2014 früh genug auf, um die Sonne aufgehen zu sehen. Dafür hat er sich den Wecker nicht stellen müssen, denn um 5.30 Uhr rücken auf dem Nachbargrundstück Handwerker an und beginnen tatsächlich, das Haus einzurüsten. Seine Schwester erhebt sich eine Viertelstunde später aus ihrem Bett. Die Rückkehr zur Routine ist ihr zunächst nicht mehr wert als ein kurzes, resigniertes Aufseufzen. Erst als sie beim Kaffee sitzt und sich einige ihrer Schüler vorzustellen beginnt, die gleich braun gebrannt und in einigen Fällen sonnenblondiert vor ihr sitzen würden, legt sich ein Wärmefädchen ums Herz. Dass ihr Bruder tatsächlich nach vierundundzwanzig Jahren Kontaktabbruch neben ihr am Tisch sitzt, kann sie nach wie vor kaum fassen. Immer wieder sieht sie ihn prüfend an. Gesucht hatte sie ihn nie während seiner Abwesenheit, zu deutlich hatte er sich von allem verabschiedet und war gegangen. Dass ihr Mann Klaus vor nun schon sechs Jahren verstorben war, hat sie ihm erst letzte Woche mitgeteilt, nach seinem ersten Brief seit seinem Fortgang.
Werner Kapok ist einen Augenblick unsicher geworden, ob er sie überhaupt aufstören darf aus ihren Gewohnheiten. Solche Störungen verträgt er selbst nämlich kaum. Wenn man allein lebt, so hat es sich sein Verständnis zurechtgelegt, ist man auf rituelle Vollzüge nahezu angewiesen, um in den Tag zu finden. Kaffeewasser aufsetzen, heizen, rasieren, zwei Scheiben Brot abschneiden, Marmelade, Wurst und Käse hinstellen, ein Müsli anrühren, mit Joghurt oder Buttermilch. Fremde Augen sind lästig dabei. Als er das zum ersten Mal gespürt hatte, hatte er sich noch zur Ordnung gerufen, aber die Stimmung hinter der auferlegten Freundlichkeit war wie verhohlener Harndrang gewesen, man war froh, wenn sich endlich eine Gelegenheit zur Erleichterung bot. Frauen sagte er, noch bevor er sie in seine Wohnung treten ließ, ohne Umstände, dass sie ihn spätestens am nächsten Morgen stören würden, und wenn sie das nicht aushielten, sollten sie lieber nicht mitkommen. Natürlich glaubten das die meisten ihrer Art nicht und kokettierten mit dem eigenen Zauber, aber tatsächlich war es keiner gelungen, sich vor seine Rituale zu schieben. Er hält es für möglich, dass er seine Schwester ähnlich stört, und überlegt. Hat sie Rituale? Gestern bevorzugte sie schwarzen Tee zum Frühstück, heute starken Kaffee mit Milch. Gestern hat sie ein Stück Kuchen gegessen, heute Porridge. Gestern hatte sie das Haar lang und offen getragen, es heute aber streng in einen Knoten gebändigt. Er ist bereit, es auf den Wechsel vom Urlaub zum Arbeitsalltag zu schieben, es ärgert ihn, dass er darauf überhaupt achten muss. Ihr Mund ist schwer zu schließen. Sie redet viel. Ihm gefällt das, es passt zu seiner über die Jahre gewachsenen Schweigsamkeit, ergänzt sie unmerklich, sodass keine Verlegenheit aufkommt, auch er müsse zur Unterhaltung beitragen.
Sie erzählt von alten Nachbarn, die neuen gewichen sind, von Kindern, die in den letzten zwanzig Jahren in der Siedlung gezeugt wurden und in zwei Fällen sogar ihrerseits schon wieder Mutter beziehungsweise Vater sind, oder von Bäcker und Gemüsehändler, die es schon lange nicht mehr gibt hier. So viele Worte fallen aus ihrem Mund, dass er versucht ist, sie zu zählen. Er schafft es immer nur bis zu irgendeinem, das eine Erinnerung freisetzt. Der hängt er eine Weile nach, ehe er von Neuem zu zählen anfängt, aber wiederum nicht weit kommt.
Gerade beginnt seine Schwester von Claudia und Barbara zu sprechen, die es schwer haben würden in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten, denn Handwerker im Haus seien ja immer eine Herausforderung.
Claudia und Barbara …
Werner Kapok sieht aus dem Küchenfenster aufs Nachbarhaus, als die Tür geöffnet wird. Barbara und Claudia treten heraus, den Blick zu den Dachdeckern erhoben, die noch längst nicht auf dem Dach angekommen sind. Barbara ist gut gekleidet, bürofein, hätte Henny gesagt. Sie geht zur Arbeit? Renate beantwortet Kapoks fragenden Blick mit einem Kopfnicken, ja, sie geht immer um diese Zeit, setzt sich in ihren Mini und düst los, sie muss ja bis nach Hellersdorf fahren, wo sie ein Büro im Rathaus hat.
Claudia hat den Handwerkern zwei Thermoskannen mit Kaffee auf einem Tablett auf den gemauerten Zaunpfosten gestellt, Zucker und Milch, nun bringt sie Tassen und eine große Platte mit belegten Brötchen. Er merkt, wie seine Rituale ins Hintertreffen geraten: Belegte Brötchen kann er sich auch gut vorstellen zu diesem Frühstück. Er lächelt. Seine Schwester hält inne, als sie das Lächeln über sein Gesicht ziehen sieht.
Nein, das nicht.
Sie hat es so schneidend hineingesprochen in diesen Morgen, dass Werner Kapok meint, der Luftraum sei geteilt worden zwischen ihm und ihr. Beim nächsten Atemzug merkt er, dass er den Kopf zurückziehen muss aus ihrem Bereich, um genug Sauerstoff zu bekommen.
Keine Angst, Schwesterchen. Ist vorbei. So und so.
Renate bezähmt sich und steht auf, zeigt ihm Fleisch und Gemüse im Kühlschrank. Wenn er will? Aber natürlich kann er auch alles so machen, wie er denkt. Rausfahren, spazieren gehen, über den Wannsee schippern.
Ja, denkt er still und sagt’s dann laut.
Als die Schwester gegangen ist, setzt er sich ans Fenster und sieht durch die Gardine zu, wie die Männer essen. Sie reißen Zoten, die er verstehen kann, denn das Fenster ist angekippt. Auf dem Bau hat er manchmal auch gearbeitet nach seinem Fortgang von hier. Hilfstätigkeiten, meist schwarz, der Rücken hatte sich bald quergestellt. Undenkbar wäre das gewesen früher. Ihm, den im Herbst 1989 eine Professur an der Humboldt-Universität ereilt hatte. Sein Vater war stolz gewesen, Werner sieht ihn, als er sich vom Fenster wegdreht, plötzlich die Küche betreten: ein großer, schlanker Mann mit schütterem Haar, das er über die beginnende Glatze nach hinten gekämmt trägt, die großen blauen Augen zur Sonne, zur Freiheit erhoben, immer mit einem Ausdruck trotzigen Staunens in den Winkeln. Er hat ein kariertes Baumwollhemd an, nach Arbeiterart, die er auch Werner nahelegte für die Wahl seiner Kleidung. Die olivfarbene Manchesterhose zeigt schon Auflösung am rechten Knie, der Flor des Cordsamts verflüchtigt sich, und unterm Arm trägt er die schwarze Wattejacke, während er ein Stück Brot in den Mund stopft und sich mit der anderen Hand Muckefuck einschenkt. Aber er ist schon verschwunden, als Werner Kapok auch noch seine Mutter hervorzaubert aus dem imaginären Zylinder in seiner Hand. Klein und schmal steht Henny am Herd, rührt mit der linken Hand schnell noch im Suppentopf, während die rechte schon darauf wartet, den Koffer mit der schweren Nähmaschine auf den Tisch zu wuchten, auf dem ein Stoffstapel liegt und eine Schachtel mit Stecknadeln steht. Ihr Haar hat die Tönung honigfarbenen Kiefernholzes, kein Grau ist darin auszumachen, obwohl es Zeit dafür wäre. Sie würde es niemals färben. Es wellt sich natürlich über die Ohren bis in den Nacken, das Stirnhaar gefangen in einer breiten Spange auf dem Oberkopf. Damals hatte er diese Frisur altmodisch genannt, während sie heute, im Fünfzigerjahre-Stil, womöglich noch einmal zu großen Ehren käme. Henny trägt ein schmales, wadenlanges Kleid in Gelb- und Brauntönen und an den Füßen hellbraune Sandaletten mit kleinem Absatz. Die Strumpfhose lässt eine repassierte Stelle erkennen unterhalb des Knies. Werner hatte auf dem Weg zur Schule oft einen Beutel mit Mutterstrumpfhosen mitnehmen müssen, um sie zur Reparatur bei Frau Hiller im Ligusterweg abzugeben, die ihr Geschäft zu Hause betrieb.
Je länger Werner seine Mutter so anschauen will, desto weniger von ihr kann er genau ausmachen, sie verwischt im klaren Sommerlicht des beginnenden Tages, und er wendet sich mit einem Ruck wieder dem Ausblick auf die Männer zu. Die haben ihr Frühstück beinahe schon beendet, der jüngste von ihnen nimmt sich noch einen Kaffee, stolpert aber beim Abstellen der Kanne und kippt die Tasse um. Mit einer wütenden Wischbewegung fegt er sie vom Tablett und wagt resigniert einen Tritt gegen das Trinkgefäß, es kullert ein Stück über den kurz geschnittenen Rasen. Der Längste der Runde fasst nach dem Bein des Jüngsten, bringt ihn zu Fall, hilft ihm lachend wieder auf und reicht ihm eine Flasche Wasser statt des Kaffees. Irgendwie scheint die Luft raus, keine Zote springt über und gibt Zunder.
Barbara Schaechter geht zum Zaun, wo die Männer sich eben erheben. Sie holt eine Schachtel aus der Hosentasche, lässt den Autoschlüssel noch einmal zurückrutschen und zündet sich eine Zigarette an. Die Männer tun es ihr nach, bis auf den Jüngsten diesmal. Ja, sie hatten auch früher schon geraucht. Barbara hatte Werner mit auf ihr Zimmer genommen, Claudia hatte angeschleppt, was an Westzigaretten im Haus war. Die hatten ihm besser geschmeckt als jene, die er damals kannte. Seit vielen Jahren raucht er nun schon nicht mehr, hat es einfach aufgegeben, als er glaubte, kein Geld mehr dafür zu haben. Nun aber verspürt er den Drang, sich eine anbieten zu lassen. Sogar von Barbara.
Heutzutage, da sie ihm offen jede beliebige Westzigarette offerieren könnte, raucht sie Club.
Willkommen im Klub!
Kurt Kapok rief es während der Montagssitzung vom 12. März 1962 auf eine Weise in die Runde, die man als spöttisch bezeichnen konnte, kannte man ihn nicht. Joachim Schaechter jedoch hörte das Schroffe der Abweisung, das aus Kapoks Stimmlage sprach, deutlich. Kapok selbst bemerkte das Unpassende seines Ausrufs nicht, während die Kollegen irritiert dreinschauten. Schaechter fingerte das dicke Tuch vom Hals, das ihm seine Frau am Morgen als Ersatz für den von ihr gestrickten Schal aus dem Schrank gekramt hatte, als er selbigen bei einem Streifblick über den großen Sitzungstisch vor Kapok liegen sah. Der grinste augenblicks, strich sich mit einer zwischen Verlegenheit und Triumph schwankenden Geste das Hemd überm Bauch glatt und versuchte, den Redefaden wiederaufzunehmen, den er mit Schaechters Eintreten verloren hatte. Erfolglos. Er stockte, stotterte.
Schaechter setzte sich schnell auf einen freien Platz neben Bruckner, den Volontär, dessen Hände tief in den Taschen steckten. Er schien schräg auf dem Stuhl fixiert, nahezu gestreckt, nur Füße und Kopf wichen in stumpfem Winkel von der Geraden ab. Schaechter suchte unwillkürlich nach dem dicken Kissen zwischen Sitzfläche und Lehne, das Bruckner diese Stellung ermöglichte. Plötzlich aber lachte er belustigt auf, als ihm Doris Schwing, einen Stuhl weiter, heimlich die Hand reichte durch das Dreieck unter Bruckners Rücken. Er ergriff sie. Nun lachten alle, als Bruckner aus der Starre erwachte, den Arsch von der Stuhlkante nach hinten verschob und erschrocken um sich sah, ohne Entscheidendes wahrzunehmen. Kapok hatte auch das nicht bemerkt, und es war beileibe nicht seine verzweifelte Sinnsuche, die dafür verantwortlich war. Da ihm die Köpfe der Kollegen jedoch im Einvernehmen mit Joachim Schaechter hin und her zu gehen schienen im Lachen, steigerte sich schroffe Ablehnung in Zorn. Selbst für Entrüstung vermochte er gerade keine Worte zu finden, sodass er wutentbrannt aus dem Raum stürzte, die Tür krachte ins Schloss.
Bruckner, ehrgeizig, hob sofort Kapoks Faden aus dem Staub, dass die anderen ungläubig dreinschauten, einige in Erinnerung an ihre eigenen, schüchtern-devoten Volontariatszeiten. Vor ihren Augen und Ohren begann Bruckner, die Wehrerfassung der 40er- bis 43er-Jahrgänge als Erfordernis der Staatsräson auseinanderzusetzen, gebrauchte Worte wie voluntas, necessitas und utilitas, die niemals den Weg über Kapoks Lippen hätten finden können, und machte so dessen kümmerndes Fädchen zur schimmernden Schnur, die sich durch den Raum wand und um den Fensterknauf zu wickeln begann, zu dem Bruckner, während er sprach, unverwandt hinschaute. Ohne das Wort Mauer zu gebrauchen, setzte er Satz um Satz dieses letztjährige Staatsbauwerk in Szene, dass die Anwesenden schließlich glaubten, in dessen Schatten Schutz suchen zu müssen vor dem Glanz der brucknerschen Rede. Sie rückten die Stühle näher zum Tisch und damit auch dichter zusammen, die Staatsräson wog schwerer und schwerer, bis Schaechter, als wolle er sie abschütteln, aufsprang und seine Bereitschaft bekundete, die Sache, also die Wehrerfassung, fotografisch zu begleiten. Wer denn das Schriftliche übernehmen wolle?
Erleichtert kehrten die Kollegen zurück, ergriffen ihr jeweiliges Ruder. Graupner wagte einen Einwurf, der die Bedeutung der Wehrerfassung für eine Gewerkschaftszeitung zwar nicht ausschließen, zwar nicht anzweifeln, mindestens aber ins rechte Maß setzen wollte. Friedrich verwies auf sein mit der Schauspielerin Annekathrin B. vereinbartes Interview, das keinen Aufschub dulde, denn in einigen Tagen sollte ihr der Kunstpreis des Landes verliehen werden. Doris Schwing, zuständig für Sozialpolitik, verkroch sich hinter drei Kindern, derentwegen sie natürlich nicht auf Abruf für mehr als einen Tag ausrücken konnte, es hätte verschiedener Absprachen bedurft zuvor. Jedoch hätte sie das gar nicht mehr in die Runde zu werfen brauchen, denn großmännisch gab Bruckner zu verstehen, dass er in diesem ersten großen Auftrag seiner Zeitung, nach reiflicher Überlegung, selbst loslegen wolle. Schaechters rechte Augenbraue zuckte. Von Auftrag konnte keine Rede sein. Aufträge vergab Kapok, und Kapok hatte den Salon verlassen, der so wenig Salon war wie er je ein Klub hätte sein können. Obwohl alle, selbst Doris Schwing, heftig rauchten. Obwohl gelegentlich Russenwodka kursierte. Obwohl vornehmlich Männer den Raum bevölkerten. Es fehlte an distinguiertem Habitus. Schaechter war bislang der Einzige gewesen, der diesem Gedanken hin und wieder aufgesessen war, aber er hatte sich selbst heftig gerügt, später verspottet für diese Rückfälle ins Bourgeoise. Nunmehr vermutete er jedoch, auch Bruckner könne die Abwesenheit des Distinguierten bemerkt haben.
Depressio oeconomica usque gravescens voluntatem separationis auget[1], zischte Schaechter ihm durch die Zähne zu. Bruckner grinste und setzte pantomimisch Stein auf Stein, baute eine Mauer.
Klar. Genau deshalb.
Seine Bewegungen erloschen mit dem Wiedereintritt Kapoks in die verräucherte Redaktion. Doris Schwing blickte einer Birne hinterher, die sich aus einem Rauchkringel geformt hatte und auf dem Weg zur Zimmerdecke langsam auflöste. Sie versuchte gerade, Birnenaroma zu halluzinieren, als Kapok mit fuchtelndem Arm zur Ruhe aufforderte, schließlich mit einem Brüller nachhalf, der aber, da er bereits in vollkommenes Schweigen hineinplatzte, dazu führte, dass Bruckner zu lachen begann und die anderen ansteckte. Kapoks hochroter Kopf drohte zu platzen. Schaechter konnte nicht anders, als ihm den Arm um die Schulter zu legen, eine Geste, die zunächst tatsächlich für das Verebben des Gelächters sorgte. Genossen, wir müssen doch. Äh, wollen doch. Wir arbeiten im Auftrag. Der Partei der Arbeiterklasse. Doris Schwing, die der Partei nicht angehörte, wagte in keineswegs gespielter Naivität den Einwurf, dass ein solcher Auftrag eher von der Gewerkschaft erteilt worden sei. Ein Unterschied, der Kapok offenbar nicht einleuchtete, denn er fuhr der Schwing halbwegs radebrechend über den Mund, dass er es doch wohl sei, der hier am besten Bescheid wisse, die Klasse gehöre der Masse, da die Masse der Klasse angehöre, und wem die Partei als Vorhaut gehöre, sei damit wohl klar beantwortet: der Klassenmasse nämlich, das sei in diesem Staate zum Glück alles eins, weshalb er mit Fug und Recht von sich sagen könne, im Auftrag der Klasse in Gestalt der Partei zu arbeiten und eine klassenmäßige Zeitung machen zu wollen, nicht wahr.
Das Wort Vorhaut hatte den Sturm des Gelächters nun endgültig über den Anwesenden losbrechen lassen, er war nicht mehr unterzukriegen. Bruckner versuchte mehrmals, wie übrigens auch Schaechter und Schwing, Kapok eine Erklärung zu geben, nahm jedoch die Einsicht hin, dass es sinnlos war, dem Sturm entgegenschreien zu wollen. Er ebbte nicht ab, sondern riss jedes Mundloch immer wieder auf, Lachsalven von sich zu geben. Anzeichen von Verzweiflung paarten sich in Kapoks unruhig nach einem Verbündeten heischenden Augen mit tiefem Unverständnis der entstandenen Situation. Schaechter griff ein, verwies darauf, dass am 1. März zum sechsjährigen Bestehen der Nationalen Volksarmee eine neue Briefmarkenserie editiert worden war. Das wusste er, weil er seinen Freund Gerhard Stauf daran hatte arbeiten sehen bei einem seiner letzten Besuche in Leipzig. Er dachte gern an seinen lieben Freund und Kupferstecher. Die Marken wären vielleicht was für die Kulturseite? Und wenn das am gleichen Tage erschiene wie die Reportage über die Wehrerfassung, wäre das doch eine schöne Korrespondenz.
Dankbar konnten die anderen sich langsam beruhigen, und Kapok fragte, wer seinen Schreibblock aufgeklappt habe. Er hatte ihn auf dem Tisch liegen gelassen, die Wehrerfassung auf Blatt drei notiert, das wie vor seinem Verlassen des Zimmers sicher unter zwei papierenen Seiten und einem Deckblatt aus dünner Pappe verborgen lag. Grund genug, jemanden zum Schuldigen zu erklären für das zwischenzeitliche Lüpfen eines Redaktionsgeheimnisses, wie er es nannte. Wenn die Wehrerfassung schon durch war, hier, in der Redaktionskonferenz, ohne dass er sie aufs Tapet gebracht hatte, musste jemand in seine Unterlagen gelunzt haben.
Wer?
Bruckner wollte ansetzen, Schaechter gebot mit erhobener Hand Innehalten. Sagte dann, dass sie ihm, Kurt Kapok, Zeit lassen und ihm Arbeit hatten abnehmen wollen, einfach nach Themen gesucht hätten, und was hätte nähergelegen als die Wehrerfassung, die ja, siehe Zentralorgan, schon seit dem 12. Februar im Gange sei. Höchste Zeit also, sich darum zu kümmern, bald würden die Ersten einrücken. Müssen, schob er nach. Sie hätten sich für Güstrow entschieden, Bruckner würde Kontakt mit dem Wehrkreiskommando aufnehmen, den Besuch der Musterungsbaracke Hafenstraße in den nächsten Tagen vorklären. Er, Schaechter, wolle fotografieren, Bruckner habe sich anerboten, das Schriftliche zu übernehmen.
Kapok gefror. Dass diese verdammten Kerle das so schnell während seiner kurzen Abwesenheit ausbaldowert haben wollten, nahm ihm das, was er seinen Verstand nennen würde, hätte er das Wort im unkontrollierbaren Wutschwelen hinter der Eisfassade ausmachen können. Steif drehte er ab, setzte sich auf seinen Stuhl. Klappte den Block auf.
Was er schrieb, erinnerte Schaechter an die dunkle Spur schmutziger Hühnerfüße auf frisch gefallenem Schnee. Er bedauerte gerade, dass seine Sehkraft zum Entziffern nicht ausreichte, als Kapok die Sitzung für geschlossen erklärte, für Auskünfte stünde er freilich zur Verfügung.
Als Bruckner und Schaechter wenig später tatsächlich darangingen, das Güstrower Wehrkreiskommando anzurufen und sich über die Modalitäten der gemeinsamen Fahrt dorthin zu verständigen, trug Schaechter seinen Schal wieder. Er hatte ihn vom Tisch genommen, als sich Kapok längst nicht mehr im Triumph darüber sonnte, das vermeintliche Fundstück eingesackt zu haben. Bruckner fragte Schaechter, wie ihm auf die Schnelle Güstrow eingefallen sei. Die Erklärung, seine Freunde wohnten dort, ein Sohn sei letzte Woche gemustert worden und hätte den Dienst verweigern wollen, er sei bei Weitem nicht der Einzige gewesen, irritierte ihn. Schaechter empfand offenbar Respekt für diese Haltung, was Bruckner von einem altgedienten Parteimitglied nicht unbedingt erwartet hätte.
Er schlug vor, den IFA F8 seines Großonkels zu nehmen, der in Köpenick eine Autowerkstatt betrieb. Zehn Jahre alt, das Ding, aber natürlich werkstattgepflegt, es würde sie sicher hin und zurück befördern. Schaechter freute sich. Er hatte ein Faible für Autos dieser Linie, seit er Ende August 1945 im anhaltinischen Ammendorf mit einem DKW Front Luxus Cabriolet F8, beige, hochglänzend, zu einer Rundfahrt aufgebrochen war. Dass der Wagen einem Arzt namens Dr. med. Franz Wolff gehört hatte und, mit Schlüssel und allen Papieren, vor dem Haus eines Patienten vorübergehend abgestellt worden war, hatte ihn veranlasst, das Automobil nach etwa einer Stunde eigenhändig zurückzubringen und dem Arzt eine Speckseite zu geben, damit er von einer Anzeige absah. Davon erzählte er Bruckner nichts, aber sein Lächeln zeigte sich noch, als er am späten Nachmittag die Redaktion verließ, um nach Hause zu fahren. Am S-Bahnhof Treptower Park roch er eindeutig Bockwurst, drehte er sich einmal um die eigene Achse, weil er den Ursprung des Duftes nicht gleich auszumachen vermochte. Ein neuer Imbisswagen stand an der Ecke Puschkinallee, Halberstädter Würstchen. Er konnte nicht anders, als gleich zwei zu nehmen. Dass er Hunger hatte, merkte er meist erst nach der Arbeit, konnte viele Stunden ohne einen Bissen auskommen. Der Verkäufer zeigte ihm einen Vogel, als er um drei weitere, kalte Würste bat, die er mit nach Hause nehmen wollte. Sie schmeckten hervorragend.
Der späte Sommer legt sich ins Zeug. An der Südseite des Gropiusbaus haben die Schaechterschwestern in Abgrenzung zur Straßenseite vor einigen Jahren ein Spalier aufstellen lassen und roten Wein gepflanzt. Er trägt inzwischen überreichlich, sodass Barbara dazu übergegangen ist, einen Teil ihres Urlaubs auf den September zu legen. Dann kann sie mit Claudia Traubengelee kochen oder die Früchte dampfentsaften. Das Ergebnis reicht das Jahr über aus, Freunde und Bekannte zu leisen Juchzern des Entzückens über die Mitbringsel der Schwestern zu verleiten. Jetzt geht es erst einmal auf Ende August, sanfte Röte hat das Grün der Beeren zwar beinahe schon besiegen können, aber der Weg zum Blauschwarz liegt noch vor ihnen.
Seit Barbara am Morgen aus dem Haus gegangen ist, säubert Claudia Gläser vor. Solche mit fest haftenden Etiketten stellt sie in heißes Wasser. Wenn sie sie nach Stunden herausnimmt, lassen sich die papierenen Aufkleber meist gut mit Scheuermilch und Kratzschwamm entfernen. Sie sammeln das ganze Jahr über, im Keller erreicht die Zahl der leeren etwa im März die der gefüllten, ehe sich das Verhältnis umzukehren beginnt.
Claudia läuft barfuß im Haus, wie auch ihre Mutter es stets tat. Wenn sie an Cilly denkt, halten sich Erleichterung und Trauer in etwa die Waage. Wie im März leere und gefüllte Glasgefäße. Der Vergleich zieht ihre Mundwinkel nach oben, sie atmet durch. Cillys Demenz hatte sich unmittelbar nach dem Tode ihres Mannes angekündigt, mit plötzlichem Schweigen in Gesprächen über Alltägliches, wer besorgt was, wie wird das nächste Wochenende geplant. Die Schwestern lebten damals jede für sich. Claudia in Karlshorst, Ehrenfelsstraße. Kleine Zweizimmerwohnung, der unmittelbar nach der Wende neuer Standard verpasst worden war und in der sie hatte alt werden wollen. Barbara im Prenzlauer Berg, Chodowieckistraße, unter dem Dach, fünf Stockwerke hoch. Sie raucht seit nun fast vierzig Jahren, es war ihr zunehmend schwerer gefallen, die Treppe in einem Rutsch zu nehmen. Joachim Schaechter hatte auch geraucht und es zum Ende seines Lebens vermieden, seine ältere Tochter unter dem Dach zu besuchen. Während eines Schachspiels gegen seinen guten alten CM diamond aus dem thüringischen Erfurt hatte das Herz ausgesetzt, er war mit schwerem Infarkt in die Klinik eingeliefert worden und lebte noch eine knappe Woche, während der er nicht noch einmal erwachte. Sie hatten sich abgewechselt an seinem Bett, waren aber im Moment des Sterbens zu dritt bei ihm gewesen.
Claudia spürt Kälte in den Füßen, zieht nun doch dicke Socken an.
Die Rede zur Trauerfeier hatte sie selbst entworfen nach dem ersten Schmerz und sie, unterbrochen nur von zwei, drei kehligen Schluchzern, tapfer gehalten. Dabei sah sie die Züge ihres Vaters auf der dunkelbronzenen Urne erscheinen, sie verschwanden mit den letzten Worten. Seit jenem Tage war ihnen die Versorgung der Mutter zur selbst gestellten Aufgabe geworden. Cilly hatte sich wehren, ankämpfen wollen dagegen. Die Sinnlosigkeit dieses Wunsches hatte sie schließlich gar nicht mehr empfinden können, so schnell vergaß sie.
Als die Schwestern zum ersten Mal ihre weinende, völlig verwirrte Mutter an der Straßenbahnhaltestelle Winsstraße fanden, glücklicherweise, nachdem sie nicht zur vereinbarten Zeit zu Barbaras Geburtstag erschienen war, hatte Claudia es übernommen, öfter im Gropiusbau zu übernachten. Cillys alte Freundinnen und ehemalige Kollegen aus dem Transformatorenwerk waren unsicher im Umgang mit ihr. Monate nach Joachims Tod war sie zu einer Historiker-Tagung eingeladen und gebeten worden, über die Verwaltungsstrukturen eines großen volkseigenen Betriebes in den Sechzigerjahren und die Stiche des Apparates in Richtung des einzelnen Arbeiters zu sprechen, was ein Jahr zuvor eine große Freude für sie gewesen wäre. Nun aber brachte sie am Rednerpult kein Wort über die Lippen, weinte, schaute sich Hilfe suchend um. Claudia hatte es geahnt, war froh gewesen, dass Cilly ihr noch hatte mitteilen können, dass sie an dem und dem Tage dort zu sprechen habe. Sie hatte die Mutter begleitet und sie schließlich von der Bühne geholt, auf die sie einfach nicht hatte verzichten können, sosehr ihr die Schwestern auch abgeraten hatten.
Nach einem halben Jahr hatte Claudia ihre Karlshorster Wohnung aufgegeben und war in die Eintracht zurückgekehrt, aber ihre Mutter war nicht mehr zu bändigen gewesen. Zwei, drei Pflegeeinrichtungen hatten sich schnell außerstande gesehen, sie zu versorgen, sie riss aus, wurde im Nachthemd nahe der Autobahn aufgegriffen oder in Unterwäsche in einer Einkaufspassage. Schließlich hatte Barbara eine passable Tagesbetreuung ausfindig gemacht, die Mutter wurde morgens abgeholt und am Abend ins eigene Bett zurückgebracht. So war sie auszuhalten gewesen. Eine Kuh, die nach dem Tag auf der Weide in den vertrauten Stall zurückgetrieben wird. Sie aß immer weniger. Sah sich vorsichtig um, ehe sie in eine Bockwurst biss, trank keine Milch mehr. Barbara bereitete ihr einmal, wie in den letzten Jahren immer am Vorabend ihres Geburtstages, ihr nachwendliches Lieblingsessen zu, Spaghetti alle vongole, das sie während einer Italienreise kennengelernt hatte. Plötzlich verschwand sie unter ängstlich-zornigen trejfe!, trejfe!-Schreien erstaunlich behände unterm Esstisch im Wohnzimmer. Zunächst hatten sie das für eine weitere Verheerung des Geisteszustands ihrer Mutter gehalten und sie unter dem Tisch hervorzuziehen versucht, bis Barbara auf einmal in den Sinn kam, was Cilly Schaechter da schreien mochte. Kosher, kosher, sprach sie beruhigend auf sie ein, es dauerte lange, bis die verblüffende Kraft des Weibleins nachgab. Die Venusmuscheln mussten sie ihr aus dem Gericht herauslesen, sie suhlte sich dann geradezu in der Speise und wischte den Sugo mit den Fingern aus dem Teller.
An jenem Abend, Cilly lag längst im Bett, saßen sie zusammen im Wohnzimmer, dunkle Stimmung, in der Befangenheit mitschwang, Seelenröte, wie Barbara es nannte, und es war, als spürten sie wieder den Stoff, dessen Moleküle womöglich von allem Anfang an ihr Blut grundiert, ihr Haar getönt hatten. Quatsch, sprach Barbara in das Stillewasser zwischen ihnen hinein, das sich kurz kräuselte, aber schnell zurückkehrte in die Unbewegtheit.
Claudia setzt die Brille auf. Vor ihr auf dem Tisch liegt ein Ballen blauen kräftigen Velvetons, sie schneidet gut zwei Meter ab und freihändig einen wadenlangen Bahnenrock zu, Achtzigerjahre-Stil. Renate hat ihn in Auftrag gegeben, trotz Gickerns und Gackerns um andere Modelle, zu denen Claudia sie eigentlich bewegen wollte. Kürzere, gezipfelte, solche mit einem Ausbrennereinsatz oder einem riskanten Schlitz über dem Knie, asymmetrisch in der Länge oder ballonförmig. Renate ist bei ihrem Standardmodell geblieben, das sie seit Jahren schon nähen lässt. Als sei das Altern ein Witz, als habe weder sie die Achtziger noch haben die Achtziger sie verlassen können, läuft sie allmorgendlich mit Haarknoten und langem, dunklem Rock zum Bus. Das Brillenmodell hinkt der Mode allerdings nur etwa fünfzehn Jahre hinterher. Ovales Metallgestell, vermutlich Federbronze, goldfarbene Bügel, die Fassungen altrosa getönt. Kein Sinn für Mode.
Claudia näht die vier Bahnen zusammen, setzt den Reißverschluss ein. Cilly hatte sie Boutiquekleider anpassen können. Groß gewachsen, dabei feingliedrig, war sie ausgesucht elegant durch die Malimo- und Dederonwelt geschwebt, mit einer türkisfarbenen Federboa oder einer schwarzen Kappe mit kleinem Tüllschleier hatte ihr Aufzug im sozialistischen Alltag gar etwas im wahrsten Sinne Jenseitiges bekommen, was aber so zwingend zu ihr passte, dass nur selten irgendeine piefig gekleidete Person daran Anstoß nahm. Im Zustand der inneren Verwesung, wie Barbara die letzten beiden Lebensjahre der Mutter nannte, hatte sie auch vergessen, auszusehen. Alles angezogen, oft verkehrt herum, was Claudia ihr bereitgelegt hatte. Die Schwestern hatten zwei Anzüge aus Samtjersey für sie gekauft, grau und schwarz, die Jacken mit Reißverschluss und Kapuze, die Hosen mit Gummizug und breiten Rippabschlüssen am Bein. Sie knitterten nicht und waren leicht überzuziehen. Claudia hat sie als einzige Kleidungsstücke ihrer Mutter in den eigenen Fundus überführt und trägt sie zu Hause oft, während sie den übrigen Bestand an drei warmen Wochenenden nach Cillys Tod vor dem Haus auf einem Tapeziertisch ausgebreitet und an Vorübergehende abgegeben hatte. Manchmal gegen einen kleinen Geldbetrag, das meiste aber hatte im Gespräch einfach den Besitzer gewechselt. Wort für Wort waren so Cilly Schaechters Kleider verschwunden.
Claudia hat dem Rock ein blaues, elastisches Gurtband in Bundhöhe eingenäht, säumen will sie ihn lieber von Hand. Sie heftet, bügelt vor. Fragt sich, warum Renate so gar nichts von alledem versteht, wo doch ihre Mutter eine Näherin vor dem Herrn gewesen war. Sie selbst hatte sich das Nähen als junges Mädchen von ihr abgeguckt, war abends oder am Wochenende bei Kapoks gewesen. Henny hatte ihr gezeigt, wie der Faden in die Maschine gefädelt wurde, wie man Knopflöcher hinkriegte, wie man beim Zuschneiden einen ordentlichen Schlag ins Hosenbein bekam.
Je länger sie jung wird, desto schärfer will sie das Gedächtnis bestrafen, dem sie nicht einfach so glaubt. Das ja ebenso alt geworden ist wie sie selbst. Sie hatte Henny schließlich immer dann aufgesucht, wenn die Offerten der staatlichen Läden ihre Verzweiflung angestachelt hatten. Ja, ganz elend war sie gewesen, als Henny sie zum ersten Mal mit hinübergenommen hatte an ihre Maschine. Das Elend gehört zur Erinnerung, die bis eben doch nur angenehm gewesen war. Zum Tanzstundenabschlussball in der zehnten Klasse hatte ein graues Kleid gedroht, schmucklos, runder Halsausschnitt, knielang.
Ein Brotsack, hatte Barbara gesagt, in dem die Hauptsache versteckt bleibt.
Aber immerhin geschützt ist, hatte Cilly, leicht verlegen, geunkt. Sie hatte dann Tage später, weiß Gott, woher, einen großen Abschnitt Silastik angeschleppt, gelb, mit großen Blüten in Grau und Lila. Claudia entwarf ein unfassbar längendezimiertes Futteral, Henny musste ran. Wie sie das tat, sicher, ohne Umstände, nach der ersten Erklärung ohne jegliches Nachfragen, hatte Claudia erstaunt merken lassen, dass es ihr gefiel. Bislang ohne Fixstern am Berufshimmel, hatte sie sich bald vorstellen können, zu entwerfen und zu schneidern, war häufiger bei Henny erschienen und hatte gelernt. Renate war damals in der Siedlung als Rüpel durchgegangen, der mit den Jungencliquen um die Häuser zog, Äpfel klaute und an der Bushaltestelle schon mal ein Bier zog. Ein Lehrerschreck zudem.
Was die Zeit macht, scheint sie planvoll zu tun, als liege auf ihren Knien ein schnittmustergleicher Lebensplan, nach dem sie einen jeden hierhin oder dorthin schiebt und Weichen stellt, die offenbar im Verborgenen bleiben. Dass Renate Lehrerschreck ausgerechnet Lehrerin geworden war, hatte sie alle verwundert, aber die Zeit hat ihr recht gegeben: Im ersten Lehrerleben hat sie Russisch und Geografie unterrichtet, im zweiten ist das Russische nach erneutem Studium durch das Französische ersetzt worden. Arbeitslosigkeit braucht sie nicht zu befürchten, und in den letzten Jahren ist man sogar auf Russisch zurückgekommen. Nicht in großem Umfang, aber eine Gruppe von Schülern bekommt sie jedes Jahr zusammen.
Claudia hatte das Russische in Moskau gelernt. Die ersten Lebensjahre hatte sie dort verbracht. Ihre Eltern, Korrespondenten des Zentralorgans,