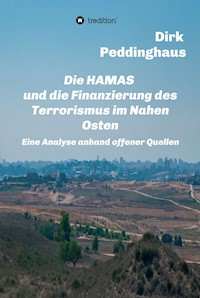
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wirtschaftlich katastrophale Zustände und eine bedenkliche humanitär Situation prägen die Situation im Gasa-Streifen im Nahen Osten. Trotz dieser Daten gelingt es der dort ansässigen Hamas ihren Kampf gegen den Staat Israel unvermindert fortzusetzen. Woher stammt das hierfür notwendige Geld? Wer sind die Finanziers der Hamas? Dieses Buch versucht Zusammenhänge zu verdeutlichen und anhand offener Quellen die Frage der finanziellen Unterstützung der Hamas als ein Beispiel der internationalen Terrorfinanzierung zu verdeutlichen. Damit richtet der Autor seinen Fokus aber auch auf den bis heute nicht gelösten israelisch-arabischen Konflikt. Zu Beginn wird mit einer eine Begriffsdefinition, der Darstellung der Gesamtsituation in der Region und der Hintergründe der religiösen Ausrichtungen der unterschiedlichen Akteure die Basis für die anschließende Diskussion gelegt. Als ein Fazit des Buches wird deutlich, dass die Frage des Aufeinandertreffens unterschiedlicher Religionen nicht als alleiniger Grund für die anhaltenden Auseinandersetzungen angeführt werden kann. Zu vielfältig sind die Verbindungen, Bündnisse, Verwerfungen und Eigeninteressen der Anrainerstaaten Israels. Am Beispiel der Finanzierung der HAMAS wird deutlich, wie die Unterstützung dieser Organisation von den jeweiligen Machtfragen der "Hauptakteure" beeinflusst wird. Machtpolitik, die sich auf die Vormachtstellung einer bestimmten Religion beruft, ist für den Autor die bestimmende Kraft - nicht nur für diesen Konflikt. Der Autor untersucht die wesentlichen Einflussgrößen mit dem Ziel einer Unterbindung von illegalen und terroristischen Aktivitäten. Aus diesen Untersuchungen abgeleitet werden dann Handlungsempfehlungen erarbeitet, die als Kern die Forderung aufstellen, dass sich Deutschland in seiner politischen Ausrichtung deutlich mehr bei der "Austrocknung" der Finanzquellen der HAMAS beteiligen muss, als es derzeit der Fall ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dirk Peddinghaus
Die HAMAS und die Finanzierung des Terrorismus im Nahen Osten
Eine Analyse anhand offener Quellen
© 2021 Dirk Peddinghaus
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-28096-0
Hardcover:
978-3-347-28097-7
e-Book:
978-3-347-28098-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglich-machung.
1. Vorwort
2. Einleitung
3. Begriffsbestimmungen
3.1 Terrorismus
3.2 Terrororganisation
3.3 Islam
3.3.1 Die unterschiedlichen Strömungen des Islams
3.4 Islamismus
3.5 Islamistischer Terrorismus
4. Ursprung und Ausgangspunkt des Konfliktes
5. Die heutige Ausgangslage im Nahen Osten
5.1 Israel und seine Nachbarn
5.2 Die Rolle anderer Mächte
5.2.1 Die Vereinigten Staaten von Amerika
5.2.2 Russland
5.2.3 China
5.2.4 Die Europäische Union
5.3 Außerstaatliche Akteure in der Region
6. Entwicklung der HAMAS
7. Grundsätzliches zur Finanzierung des weltweiten Terrorismus
7.1 Bedeutung und ökonomische Kosten des Terrors
8. Finanzquellen der HAMAS
8.1 Eigenfinanzierung
8.1.1 Steuern und Abgaben im Gaza-Streifen
8.1.2 Sammlungen und Aktivitäten im Ausland: Wohltätigkeitsvereine – Deutschlands Rolle bei der Finanzierung
8.1.3 Drogenhandel
8.2 Finanzierung der HAMAS durch Dritt-Staaten
8.2.1 Iran
8.2.2 Katar
8.2.3 Saudi-Arabien
8.2.4 Syrien
8.2.5 Türkei
8.3 Finanzierung durch Einzelpersonen
8.4 Finanzierung durch internationale Organisationen
8.4.1 Finanzierung aus Geldern der Vereinten Nationen
8.4.1.2 Grundsätzliches zum Verhältnis VN – Israel
8.4.2.2 Finanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten
8.4.2.2.1 Vorbemerkung zum UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)
8.4.2.2.2 Finanzierung des UNRWA
8.4.2.2.3 Kritik an der UNRWA
8.4.2 Finanzierung aus Geldern der EU
8.5 Finanztransfers – Wie gelangt die Hamas an die Finanzmittel
8.5.1 Legale Finanzierung
8.5.2 Illegale Finanzierung
8.5.2.1 Geldwäsche
8.5.2.1.1 Der Begriff der Geldwäsche
8.5.2.1.2 Diskussion der Begriffsbestimmung
8.5.2.1.3 Möglichkeiten der Geldwäsche
8.5.2.2 Das Darknet und die Kryptowährungen
8.5.2.3 Kauf und Verkauf von Wertgegenständen
8.6 Zusammenfassung der Finanzierungs-formen der Hamas
9. Wie kann es weitergehen im Nahen Osten?
9.1 Veränderte Ausgangslage nach den erfolgreichen Normalisierungsverträgen zwischen einigen arabischen Staaten und Israel
9.2 Das Szenario „Weiter so“
9.3 Die Zerschlagung der HAMAS
9.4 Von „Land für Frieden“ zu „Wohlstand für Frieden“ – das Ende eines (deutschen) Mantras
9.5 Die zukünftigen Player für einen nachhaltigen Frieden
10. Handlungsempfehlungen
11. Fazit
Abbildungsverzeichnis
Quellenverzeichnis:
Anlage 1: Verbotene islamische Organisationen
Anlage 2: EU-Liste terroristischer Organisationen
Anlage 3: Glaubensrichtungen des Islam
Anlage 4: Versuch einer Analyse mit Hilfe der Szenario-Technik
1. Vorwort
11.05.2021: 1000 Raketen aus dem Gaza-Streifen auf Israel! Die Gewalt im Nahen Osten eskaliert – wieder einmal! Israel verteidigt seine Bürgerinnen und Bürger mit massiven Vergeltungsschlägen.
Wie finanziert die HAMAS diesen Terror? Drastischer kann die Aktualität für ein Buch kaum sein, das sich gerade mit dieser Frage beschäftigt, doch der Reihe nach.
„Man muss Israel nicht mögen. Man kann diesen Staat kritisieren, sich zur Brust nehmen und ihm viele Fragen stellen. Man muss aber, wenn man Journalist ist, die Wahrheit berichten. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit“1
Diese Reaktion der Fernsehmoderatorin Andrea Kiewel auf einen Beitrag der ARD-Tageschau im Jahr 2019 möchte ich an den Anfang dieses Buches stellen, weil er mir als ein wichtiger Hinweis auf die Israelsichtweise der deutschen Medien gilt. Durch eigene Besuche und Gespräche in Israel und in Ramallah habe ich nämlich eine eklatante Differenz zwischen dem selber Erlebten und dem medial in Deutschland dargestellten Israelbild feststellt. Ein Beispiel soll diese Sichtweise untermauern, ohne diesem Aspekt bereits jetzt einen zu großen Stellenwert einzuräumen. Am 14.11.2019 titelt „tageschau.de“ „Tote und Verletzte durch Israels Luftangriffe“.2 Allein die Schlagzeile verkennt, dass zuvor Hunderte von Raketen vom Gaza-Streifen aus auf das Territorium Israels abgefeuert wurden. Der Artikel beschreibt die Situation wie folgt: „… [haben] israelische Kampfflugzeuge ihre Angriffe auf die militante Palästinenserorganisation intensiviert, und auch die Extremisten beschossen Israel mit Dutzenden Raketen. Bis zum Abend wurden laut Armee 360 Raketen auf Israel abgefeuert.“ Richtig ist, dass diese Angriffe nicht zeitgleich stattfanden, sondern der Beschuss Israels der Auslöser für die Luftangriffe war. Ungefiltert gibt das Nachrichtenmagazin auch die palästinensischen Angaben über die Zahl der Toten weiter. Besonders emotionale Meldungen wie: „Mindestens fünf Zivilisten, darunter eine Frau und Jungen im Alter von 17, 16 und 7 Jahren, …“ scheinen der Nachrichtenredaktion wichtiger als eine nach journalistischen Grundsätzen nachrecherchierte Meldung. Um es klar zu machen: Jeder Tote in diesem Konflikt ist ein Toter zu viel! Doch muss man bei aller Ablehnung von Gewalt trotzdem Ursache und Wirkung unterscheiden. Dies wird in vielen Bereich der öffentlichen Darstellung durch deutsche Medien vernachlässigt. Darum ist der einleitende Satz meines Buches für mich von entscheidender Bedeutung.
Das Erlebte und die Beschäftigung mit dem Thema der Finanzierung der HAMAS kann daher nicht ausschließlich ökonomisch betrachtet werden, sondern muss im Gesamtzusammenhang des Nahost-Konfliktes verdeutlicht werden. Aus diesem Grund kann das vorliegende Buch sich nicht nur mit Zahlen und Quellen beschäftigen, sondern muss den Bogen weiter schlagen, damit die Zahlen und Akteure in einen Kontext gebracht werden können.
Aber warum die HAMAS?
Schaut man sich den Nahen Osten an, dann steht - von der Anzahl der Kämpfer - sicher die im Norden Israels agierende Hisbollah in einem größeren Fokus. Auch die vom Bundesamt für den Verfassungsschutz für 20183 angegebenen Zahlen für Mitglieder/Sympathisanten der HAMAS in Deutschland von 320 ist gegenüber der Hisbollah mit annähernd der zehnfachen Mitgliedschaft eher weniger bedeutend.
Doch die Relevanz der HAMAS ergibt sich aus zwei Fakten: Erstens ist die HAMAS ein Schlüssel – oder wie sich im weiteren Verlauf herausstellen wird, der Verhinderer – für die Lösung der Palästinenserfrage im Gaza-Streifen und einer Annäherung zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde, zum anderen sind die Finanzströme der HAMAS bislang noch nicht zusammenhängend untersucht worden.
„Wir wissen viel über die Finanzquellen der Hisbollah, aber nur wenig Zusammenhängendes über die HAMAS,“ so beschrieb es mir Mirjam Rosenstein vom Nahost Friedensforum NAFFO e.V. bei unserem Gespräch in Berlin. Daher ist diese Arbeit der Versuch, die Finanzierung dieser Organisation zu entflechten.
Das Buch erhebt keinen Anspruch auf eine abschließende und umfassende Sichtweise der aufgezeigten Fragestellung. Zu vielschichtig zeigte sich das Problem bei der Recherche, zu verwunden sind die unterschiedlichen Aspekte und zu vielfältig sind die einzelnen Quellen, die zur Verfügung standen. Es entstand aber ein Bild, welches eine – aus meiner Sicht – hinreichende Genauigkeit hat, um die Grundprinzipien des Konfliktes und der Finanzierung der HAMAS verdeutlichen zu können und aus dem sich Schlüsse für eine zukünftige Herangehensweise ableiten lassen.
Ich werde nicht auf die Frage des Existenzrechtes Israels eingehen. Auch wenn diese Sichtweise möglicherweise von einer einseitigen Interpretation des Ursprungs des Konfliktes in der Region zeugt, so stelle ich die Staatlichkeit Israels als einen Grundpfeiler meines Selbstverständnisses an den Anfang der Ausführungen. Dies bedeutet nicht, dass ich die geschichtliche Dimension und die Frage „Wem gehört das Heilige Land?“ außer Acht lasse. Ich empfehle in diesem Zusammenhang das Buch von Michael Wolffsohn mit dem gleichen Titel, bei dem ich die vorherige Frage „entliehen“ habe. Seine Aussage „Sowohl Juden als auch Araber sind zu verschiedenen Zeiten Besitzer des Heiligen Landes gewesen, nicht Eigentümer. Rechtsnachfolger oder direkte Nachkommen der ursprünglichen Eigentümer sind heute nicht mehr zu ermitteln … „4 zeigt die ganze Komplexität des Themas und die schwierige und oftmals verwirrende geschichtliche Entwicklung des heutigen Konfliktes. Aber ohne die Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Staatsgründung ist eine Diskussion über die Zukunft der Region nicht vorstellbar. Die Alternative wäre ein nicht kalkulierbarer Krieg, ein Krieg, der Auswirkungen weit über die Region hinaus hätte. Daher ist es erforderlich, dass alle Beteiligten vor Beginn von Verhandlungen das Existenzrecht Israels anerkennen. Das ist auch der Grund, warum ich dies als feste Größe annehme, anderenfalls wäre das Buch nämlich jetzt zu Ende!
Mich hat das nachfolgende Bild bei einem Besuch in einem Kibutz nahe der Grenze zum Gaza-Streifen stark beeindruckt.
Foto: eigen
Die Frage, warum Kinder in einem mit Betonwänden umgebenen Kindergarten großwerden müssen, die Frage, warum sie schon als Kleinkinder lernen müssen, dass ein Betonbunker ihr Leben retten kann, macht die Beschäftigung mit dem Thema emotional. Trotzdem ist es erforderlich, den Konflikt nüchtern zu betrachten, die Möglichkeiten abzuwägen, um am Ende vielleicht eine Zukunft ohne Betonschutzwälle für die Kinder dieser Kinder zu ermöglichen. Eine Perspektive, für die es sich lohnt, viele Mühen in diesem Prozess auf sich zu nehmen.
1 Fernsehmoderatorin Andrea Kiewel als Reaktion auf einen Beitrag der ARD-Tageschau“ – wiedergegeben am 04.04.2019 in einem Artikel des online-Magazins marx21 … https://www.marx21.de/gaza-protest-gewalt-hamas-krieg/)
2 Tagesschau.de (2019a)
3 Bundesamt für den Verfassungsschutz – HAMAS (c)
4 Michael Wolffsohn (2002), Seite 284
2. Einleitung
„Terrorismus ist eine Bedrohung für unsere Sicherheit, für die Werte unserer demokratischen Gesellschaften und für die Rechte und Freiheiten der europäischen Bürgerinnen und Bürger.“5
Wenn man sich der Finanzierung einer als terroristisch eingestuften Organisation nähert, dann sollte man sich die Tatsache vor Augen führen, dass die meisten auf terroristischen Aktivitäten beruhenden Konflikte nicht regional isoliert gesehen werden können, sondern eine Bedeutung auch für die Länder haben, die scheinbar nur „Zuschauer“ sind.
Die diversen Terroranschläge außerhalb der eigentlichen Konfliktregionen sind ein Beweis dafür, dass diese Form der Gewalt nicht regional begrenzt wird, wenn die terroristische Interessenlage dies erfordert. Die europäischen Staaten Frankreich und Österreich haben in den letzten Wochen der Entstehung dieses Buches eine leidvolle Erfahrung gemacht. Gerade für Frankreich war dies leider kein Einzelfall, wie eine erschreckende Chronologie der Deutschen Welle über islamische Angriffe deutlich macht.6
Insofern dient der einleitende Satz dieses Kapitels der Fokussierung auf die Bedeutung des Themas für eine freiheitlich demokratische Welt, deren Bewahrung wir uns verpflichtet fühlen. Denn wir können nicht nur gebannt zuschauen, wie in vielen Ländern dieser Welt Terroristen versuchen, unsere Lebensweise zu beeinflussen oder zu zerstören. Dabei sind die „vorgegebenen“ Gründe für die oft menschenverachtenden Aktionen vielfältig und reichen von religiöser Ideologie, Machtkämpfen in einem Land bis zur Frage der Vormachtstellung in einer Region oder wirtschaftlichen Interessen.
Dieses Buch wird sich mit einem Teilaspekt des Terrorismus und der Frage der Finanzierung der HAMAS befassen. Es richtet seinen Fokus damit auf den bis heute nicht gelösten israelisch-arabischen Konflikt.
Mir ist klar, dass die HAMAS sich mit ihren Aktivitäten derzeit auf den Gaza-Streifen und das Kernland Israels konzentriert und damit vordergründig keine Bedeutung für die Sicherheit in den westlichen Ländern hat. Bedeutung erlangt die Untersuchung der Fragestellung aber bei den Verflechtungen der unterschiedlichen Geldquellen, der Bedeutung der Geldwäsche oder durch die Frage der Folgenabschätzung, wenn aktive Maßnahmen gegen die HAMAS eingeleitet werden. Hierzu werde ich ebenfalls Stellung beziehen.
Um den Gesamtkontext zu verstehen, ist es notwendig, bestimmte Aspekte besonders anzusprechen. Hierzu zählen eine klare Begriffsdefinition, die Darstellung der Gesamtsituation in der Region und die Hintergründe der religiösen Ausrichtungen der unterschiedlichen Akteure. Nur so entsteht ein Gesamtbild, das notwendig ist, um die unterschiedlichen Geldquellen der Hamas zu verstehen.
Das Buch basiert ausschließlich aus offenen Quellen. Da es, anders als bei der geschichtlichen Betrachtung oder einer grundsätzlichen Fragestellung zu den einzelnen Akteuren keine dem wissenschaftlich Arbeiten angemessene Literatur gibt, sind die Quellen Veröffentlichungen verschiedener Organisationen, Zeitungsartikeln oder persönliche Gespräche. Diese sind oft widersprüchlich, einseitig oder manipulativ, wie ich im Verlauf der Recherchen feststellen musste.
Aus diesem Grund, wurden folgende Auswahlkriterien bei der Faktensuche angewandt:
• Qualifikation der Autoren
• Ansicht des Werkes / der Quelle
• Aktualität
Durch diese selbst auferlegten Vorgaben beschränkte sich die Nutzung der gefundenen Quellen deutlich, verspricht aber eine höhere Authentizität für die dargestellten Fakten. Auch wurden die Quellen immer wieder einem „Realitätscheck“ unterzogen, das bedeutet, die Informationen wurden durch einen reflektorischen Diskurs an anderen Quellen und eigenen Erfahrungen gemessen, um sie auch im Kontext glaubhafter zu machen.
Foto: eigen
5 Europäischer Rat (2019)
6 Deutsche Welle (2020)
3. Begriffsbestimmungen
3.1 Terrorismus
„Terrorismus gehört zu den umstrittensten Begriffen der Politikwissenschaft, für den bis heute keine international anerkannte Definition vorliegt.“7
Kristina Eichhorst nennt in ihrem Jahrbuch „Terrorismus 2006“ als Begründung für diese Schwierigkeit: „Die Gründe für die Schwierigkeit, auf politischer Ebene eine international anerkannte Definition zu formulieren, lassen sich mit der Redewendung „Des einen Terroristen ist des anderen Freiheitskämpfer“ zusammenfassen.“8
Dass wir im Alltag diesen Begriff wie selbstverständlich benutzen, ohne aber eine genaue Vorstellung davon zu haben, beschreibt auch Professor Hoffmann von der Georgetown University in seinem Buch „Inside Terrorism“,
“… most people have a vague idea or interpretation of what terrorism is but lack a more precise, concrete and truly explanatory definition of the word“.9 Er stellt weiter fest, dass: „This imprecision has been abetted partly by the modern media, whose efforts to communicate an often complex and convoluted message in the briefest amount of airtime or print space possible have let to the promiscuous labeling of a range of violent acts as ´Terrorism´.”10
Wilhelm Knelangen sieht als Wendepunkt für die intensive Beschäftigung mit einer einheitlichen Definition des Begriffes Terrorismus die Ereignisse um den 11. September 2001. Er sieht den 11. September 2001 als eine Zäsur für die sozialwissenschaftliche Terrorismusforschung.
Dies hätte, so Knelangen, nicht nur mit den wechselhaften Konjunkturen des Untersuchungsgegenstandes zu tun, sondern sei auch darauf zurückzuführen, dass ein Forschungsschwerpunkt im Bereich Terrorismus die Karrierechancen in den Fächern Politikwissenschaften, Soziologie und Psychologie oder Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt nicht eben verbessert hätte.11
Bruce Hoffman bietet im Verlauf seines Buches die Definition des Wortes „Terrorist“ aus dem Oxford English Dictionary an. Er sieht den Grundansatz in der Definition als ein „politisches Konzept“. Dies ist, wie er schreibt, das Schlüsselmerkmal des Terrorismus und für das Verständnis seiner Ziele, Motivation und Zwecke elementar und unterscheide den Terrorismus entscheidend von anderen Arten der Gewalt.12 Wobei diese Gewalt besonders auch unbeteiligte Zivilisten zu Opfern macht oder gerade diese im Fokus der Aktionen steht, um eine höhere Verunsicherung und/oder Medienwirksamkeit in der Zivilbevölkerung zu erreichen.
Dieser Sichtweise habe ich mich im angeschlossen, insbesondere um den Terrorismus klar vom Begriff der „organisierten Kriminalität“ abzugrenzen. Zwar wird deutlich werden, dass sich Organisationen in diesem Kontext oftmals der gleichen Finanzierungswege bedienen, doch die grundsätzliche Ausrichtung bleibt entscheidend unterschiedlich!
Man findet diesen Ansatz auch im „Zweiten Periodischen Sicherheitsberichts der Bundesregierung“ vom 27. November 2006. Hiernach ist Terrorismus
„nicht Ausdruck einer spezifischen Kultur, er ist zunächst ein extremes politisches Kampfmittel. Terrorismus ist eine Strategie des Kampfes, die Staatsgewalt bzw. Besatzungsmacht herauszufordern und dadurch Solidarisierungswellen in den Bevölkerungsgruppen zu provozieren, als deren Avantgarde sich die Akteure verstehen. Unmittelbares Ziel ist nicht der Sieg, sondern die Verbreitung von Schrecken und Furcht…“13
Den Umstand der fehlenden Definition sehe ich in der politischen und wissenschaftlichen Diskussion in Deutschland als ein verheerendes Manko an, weil dadurch eine klare Ansprache des Problems verhindert wird. Besonders, da auch nach der Änderung des Grundgesetzes vom 07. März 200614 der Begriff weiter ohne einheitliche Definition bleibt.
Zwar liefert der Verfassungsschutzbericht einen Hinweis auf die in der Bundesregierung vorherrschende Interpretation des Begriffes Terrorismus, wenn es heißt:
„Terrorismus ist nach der Definition der Verfassungsschutzbehörden der nachhaltig geführte Kampf für politische Ziele, die mit Hilfe von Anschlägen auf Leib, Leben und Eigentum anderer Menschen durchgesetzt werden sollen, insbesondere durch schwere Straftaten, wie sie in § 129a Abs. 1 StGB genannt sind, oder durch andere Straftaten, die zur Vorbereitung solcher Straftaten dienen.“15
Wir finden somit auch hier die Ansätze der Definition von Bruce Hoffman wieder. Warum die Bundesregierung sich allerdings bei der Begriffsdefinition so schwertut, bleibt ein Rätsel.
Eine allgemein gültige Definition – abgeleitet aus den Überlegungen von Bruce Hoffman – findet man auch beim US-Außenministerium:
"Terrorismus ist vorsätzliche, politisch motivierte Gewalt, verübt gegen zivile Ziele durch sub-staatliche Gruppen oder im Verborgenen arbeitende Täter, gewöhnlich mit der Absicht ein Publikum zu beeinflussen“16
Ich empfehle diese Definition auch für die weitere Diskussion in Deutschland!
Noch ein Blick in die internationale Gemeinschaft. Die Vereinten Nationen haben in ihrer Generalversammlung am 5. Oktober 2001 – ebenfalls unter dem Eindruck der Anschläge vom 11. September 2001 – die Ächtung terroristischer Aktivitäten einvernehmlich diskutiert, und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen stellte in seiner Resolution 1566 vom 08.10.2004 fest
“, dass Straftaten, …, unter keinen Umständen gerechtfertigt werden können, indem politische, philosophische, weltanschauliche, rassische, ethnische, religiöse oder sonstige Erwägungen ähnlicher Art angeführt werden, und fordert alle Staaten auf, solche Straftaten zu verhindern und, wenn sie nicht verhindert werden können, sicherzustellen, dass für solche Straftaten Strafen verhängt werden, die der Schwere der Tat entsprechen;“17
Auch die Europäische Union hat in einem Rahmenbeschluss eine Definition des Begriffes versucht. Mit dem im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft wiedergegebenem Wortlaut18 überlässt es die Europäische Union den Einzelstaaten, diesen Ratsbeschluss umzusetzen und vergibt damit die Möglichkeit einer einheitlichen europäischen Sichtweise.
3.2 Terrororganisation
Wie schon im vorherigen Absatz, so ist auch im Fall des Begriffes Terrororganisation keine einheitliche – und vor allem keine international einheitliche – Definition erkennbar.
Auch in der Rechtsprechung der Bundesrepublik wird der Begriff im Strafgesetzbuch erst seit dem 18. August 1976 – im Zuge der Bekämpfung des damaligen Terrorismus der Roten Armee Fraktion (RAF) – definiert. Allerdings wird im § 129a Absatz 1 des Strafgesetzbuches (StGB) die Strafbarkeit von Handlungen beschrieben, die landläufig als Terrorakte bezeichnet werden, aber der Begriff nicht exakt definiert. Wörtlich heißt es:
„ Wer eine Vereinigung (§ 129 Absatz 2) gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, 1. Mord (§ 211) oder Totschlag (§ 212) oder Völkermord (§ 6 des Völkerstrafgesetzbuches) oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 7 des Völkerstrafgesetzbuches) oder Kriegsverbrechen (§§ 8, 9, 10, 11 oder § 12 des Völkerstrafgesetzbuches) oder 2. Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 239a oder des § 239b zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.“19
Die Europäische Union hat in Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. November 2001 eine Liste von Personen, Vereinigungen und Organisationen aufgestellt, die an Terrorhandlungen beteiligt waren und restriktiven Maßnahmen unterliegen sollen. Damit macht die Europäische Union die von ihr verdächtigten Organisationen zwar namhaft, vermeidet aber auch hier die genaue Definition des Begriffes Terrorismus. In dieser am 08. Januar 2019 aktualisierten Liste findet sich unter dem Punkt II „Vereinigungen und Körperschaften“ unter 8. auch die „HAMAS“ einschließlich „HAMAS-Izz al-Din al-Qassam“20 wieder21.
Anders als die Europäische Union haben die Vereinten Nationen bislang auf die Erstellung und Veröffentlichung einer Terrorliste verzichtet. Die o.a. Resolution ermächtigt die Mitgliedstaaten der VN vielmehr nur, grundsätzlich alle Finanzmittel von Personen und Institutionen zu sperren, die terroristische Straftaten begehen, es versuchen, sie erleichtern oder anderweitig unterstützen. Die Auswahl der zu sanktionierenden Personen wird den Mitgliedstaaten überlassen, die eigene Terrorlisten führen. Innerhalb dieser Regelung wurde in Deutschland auf die Erstellung einer eigenen Liste verzichtet, da dies durch die Europäische Union umgesetzt wurde.22
In der Vorgehensweise der Vereinten Nationen sehe ich den anfangs von Kristina Eichhorst zitierten Ausspruch: „Die Gründe für die Schwierigkeit, auf politischer Ebene eine international anerkannte Definition zu formulieren, lassen sich mit der Redewendung ´Des einen Terroristen ist des anderen Freiheitskämpfer´“23 zusammenfassen. Bei einem Blick auf die heutigen Strukturen der Vereinten Nationen sieht man den Hintergrund dieser Aussage schnell bestätigt. Vorurteilsfrei können wir feststellen, dass die Demokratie und Rechtstaatlichkeit unserer westlichen Prägung bei der Mehrzahl der vertretenen Staaten nicht greift.
3.3 Islam
Der Islam ist eine monotheistische Religion, deren Ursprung auf den als Propheten verehrten Mohammed (570 – 632 n.Chr.) – vollständiger Name Abū l-Qāsim Muhammad ibn 'Abdallāh ibn 'Abd al-Muttalib ibn Hāschim ibn 'Abd Manāf al-Quraschī - zurückgeht. Er stammte aus der Stadt Mekka, die in der damaligen Zeit durch ihre Lage an einer der wichtigen Handelsrouten ein bedeutsames Handelszentrum war. Durch seine Arbeit als eine Art Handlungsreisender war Mohammed ein für seine Zeit weitgereister Mann.24 Durch diese Tätigkeit lernte er auch seine erste Frau Chadidscha kennen, nachdem sie ihn für eine Handelsmission nach Syrien angestellt hatte.25
Der Überlieferung nach hatte er mehrere Offenbarungserlebnisse. Seine erste Offenbarung wird auf sein 40zigstes Lebensjahr datiert. In der Erklärung des Islamischen Zentrum München können wir lesen:
„Schon Jahre vor der ersten Offenbarung pflegte Muhammad sich zur Meditation auf einen Berg in der Nähe von Mekka zurückzuziehen. Er spürte, dass die Glaubensüberzeugungen, Riten und Traditionen seines Stammes, die auf Vielgötterei gründeten, die Menschen in die Irre führten und von ihrer Bestimmung als Geschöpfe Gottes entfernten. In einer Höhle dachte er über all dieses nach, ohne aber eine Lösung und Perspektive zu finden. Im Jahre 610 n.Chr., als er sich wieder einmal alleine in der Höhle zum Nachsinnen und Gottgedenken zurückgezogen hatte, erschien ihm der Engel Gabriel und verkündete ihm, dass er von dem einen einzigen Gott zum Propheten auserwählt worden sei und übermittelte ihm die ersten Offenbarungen des Korans.“26
Seine erste Anhängerin sollte seine Frau Chadidscha werden. Mohammed hat am Anfang seine Offenbarungserlebnisse und die daraus resultierende Lehre zunächst in einem engeren Umfeld verkündete. Die damals vorherrschende Stammes- und Clanvorherrschaft brachte es mit sich, dass er bald in Konflikt mit politisch und wirtschaftlich führenden Familien in Mekka geriet, da seine Ideen nicht „einfach“ eine neue Religion beinhalteten, sondern wie der Sozialanthropologe Ernest Gellner es formulierte den „Entwurf einer Gesellschaftsordnung“27 beinhaltete, die sich zum Teil gegen die etablierten Machtstrukturen in einer Stammes- und Clanhierarchie richtete.
Als radikale Wende im Leben Mohammeds und damit auch für die Ausbreitung des Islam, kann das Jahr 622 n. Chr. angesehen werden, als er mit seinen Anhängern Mekka verließ und nach Medina übersiedelte. Dies markiert das Jahr eins der Islamischen Zeitrechnung.28 Für die Islamkritikerin Ayaan Hirsi Ali bedeutet diese Auswanderung („Hidschra“) den zentralen Wendepunkt in der islamischen Geschichte, da von diesem Zeitpunkt die Islamisierung durch Mohammed nicht mehr nur durch das Wort, sondern insbesondere auch durch Eroberung vorangetrieben wurde. Sie sieht die Phase in Mekka als die Zeit des friedlichen Islam und die darauffolgende Phase als den Ausgangspunkt der gewaltsamen Ausbreitung, die aus ihrer Sicht bis heute anhält.29
So lässt sich auch erklären, warum es in der Diskussion über den Islam oftmals an „Trennschärfe“ fehlt. Die vielen friedlichen Menschen, die – ähnlich wie bei anderen Religionen – fest in ihrem Glauben verankert sind, aber einen toleranten Umgang mit „Andersgläubigen“ pflegen, werden zu Unrecht in einen Topf mit denen geworfen, die Gewalt als Mittel der Verbreitung ihres Glaubens ansehen. Vielleicht kann der Begriff des „Politischen Islam“, wie in Susanne Schröder in ihrem gleichnamigen Buch beschrieben hat, diese „Trennschärfe“ wiederherstellen.
„Der politische Islam stellt eine Sonderform des Islam dar und sollte nicht als charakteristisch für die gesamte Weltreligion gesehen werden, die auch in Deutschland eine Vielzahl von Facetten besitzt. Durch machtbewusstes und strategisch geschicktes Agieren seiner Funktionäre übt der politische Islam allerdings großen gesellschaftlichen Einfluss aus und dominiert zunehmend die Bühne staatlicher Islampolitik und zivilgesellschaftlicher Dialogveranstaltungen.“30
3.3.1 Die unterschiedlichen Strömungen des Islams
Da in der westlichen Welt die religiöse Aufspaltung innerhalb des Islams in der politischen Diskussion kaum nachvollzogen wird und auch das Wissen um diese Unterschiede kaum verbreitet ist, soll ein kurzer Einschub diese Wesensmerkmale beleuchten, da dies eine eigene Arbeit wert wäre. Für das vorliegende Buch wichtig ist die Kenntnis der unterschiedlichen Glaubensrichtung des Islams, die in den aufgezeigten Ländern und Organisationen zu erheblichen politischen Unterschieden und Allianzen führt.
Wie das Christentum und das Judentum gehört auch der Islam zu den monotheistischen Religionen. Grundlage des Glaubens im Islam ist die Lehre des Korans und das Vorbild Muhammads. Hierin finden alle Strömungen ihren Ursprung und ihre Gemeinsamkeit. Auch die Traditionen – genannt die fünf Grundpfeiler des Islam – das fünfmalige Gebet31, das Fasten im Monat Ramadan, die Almosen und die Pilgerfahrt nach Mekka gehören zu den Gemeinsamkeiten innerhalb des Islam.
Abbildung 1: Die fünf Säulen des Islam; Quelle: Bundesamt für den Verfassungsschutz, „Islamismus: Entstehung und Erscheinungsformen, Seite 7, Köln, September 2013
Erst mit dem Tod des Propheten Mohammed beginnt eine Entwicklung, die zur Spaltung in zwei grundsätzliche Glaubensrichtungen führt. Der Autor York Pijahn beschreibt den Fortgang in einem Artikel wie folgt:
„Einen Nachfolger hat Mohammed nicht bestimmt. Und so fällt die muslimische Gemeinde bald nach seinem Tod auseinander: Eine Gruppe, die sogenannten Sunniten, folgt Abu Bakr, der ihr oberster Politiker und Richter, ihr Kalif, wird. Eine andere Gruppe, die Schiiten, will Mohammeds Vetter Ali zum Kalifen wählen. Als Ali im Jahr 661 ermordet wird, trennen sich Sunniten und Schiiten - eine Spaltung, die bis heute andauert.“32
Zudem haben sich in vielen Ländern Untergruppen, Sekten und Strömungen entwickelt. In Saudi-Arabien bestimmen z.B. Wahhabiten als Untergruppe der Sunniten den Alltag. Eine genaue Beschreibung der unterschiedlichen Strömungen ist in der Anlage 3 wiedergegeben.





























