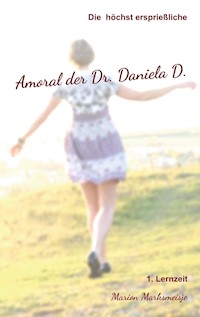
Die höchst ersprießliche Amoral der Dr. Daniela D. Eine autobiographische Satire. E-Book
Marion Marksmeisje
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dr. Daniela D
- Sprache: Deutsch
Durch einen Zufall verschlägt es Dr. Daniela D., eigentlich Absolventin eines Lehramtsstudiums und Bibliothekarin an einem Universitätsinstitut, in eine verschwiegene kleine Grazer Pension, wo sie das erste Mal mit dem Gunstgewerbe in Berührung kommt. Daniela ist kein Kind von Traurigkeit, aus "auch einmal probieren" wird rasch mehr, das schnelle Geld lockt jedenfalls deutlich mehr als eine Bewerbung für den Schuldienst am Gymnasium. Als sie den Job an der Uni auch noch verliert, steht ihr Entschluss fest. Die Geschichte der Daniela D ist eine Satire. Das wirkliche Leben würde sie doch wohl wegen Vergehens gegen die Moral und Kollaboration mit dem Geschlechterfeind schwer strafen, oder?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
Durch einen Zufall verschlägt es Dr. Daniela D., eigentlich Absolventin eines Lehramtsstudiums und Bibliothekarin an einem Universitätsinstitut, in eine verschwiegene kleine Grazer Pension, wo sie das erste Mal mit dem Gunstgewerbe in Berührung kommt. Daniela ist kein Kind von Traurigkeit, aus „auch einmal probieren“ wird rasch mehr, das schnelle Geld lockt jedenfalls deutlich mehr als eine Bewerbung für den Schuldienst am Gymnasium. Als sie den Job an der Uni auch noch verliert, steht ihr Entschluss fest.
Die Geschichte der Daniela D ist eine Satire. Das wirkliche Leben würde sie doch wohl wegen Vergehens gegen die Moral und Kollaboration mit dem Geschlechterfeind schwer strafen, oder?
Marion Marksmeisje hat sich als Autorin einen Namen gemacht, die ungewöhnlichen Lebensentwürfen selbstbestimmter Frauen eine erzählerische Stimme verleiht.
Ein frischer, unverblümter Schreibstil und die stets weibliche Erzählperspektive zeichnen ihre Geschichten aus, deren Moralität sich ausschließlich an den Bedürfnissen ihrer Protagonistinnen orientiert.
Marion Marksmeisje
Die höchst ersprießliche
Amoral der Dr. Daniela D
Eine autobiographische Satire
1. Lernzeit
Inhalt
Saat
Früh am Morgen
Bevor ich weiter erzähle ...
Ein Entschluss
Nach Wien
Claudias Geschichte
Versuchung
Der erste Sündenfall
Latenz
Ein Angebot
Eine Möglichkeit
Auszug
Ankommen
Amandas Geschichte
Routine
Rausschmiss
Keimung
Der Fotograf
Karins Geschichte
Schwächen
Nur für den Fall …
Die Kabine
Besuch von Mama
Der zweite Sündenfall
Austrieb
Dazugehören
Tod des Vaters
Kabine machen
Lucys Geschichte
Begräbnis des Vaters
Im Arbeiterquartier
Petras Geschichte
Reife
Nein, so nicht
Heinz
Die Gesellschaft
Franziskas Geschichte
Rausschmiss und Heimkehr
An der Neuen Donau
Peter und Paul
Epilog
Zeitgeschichtliche Einordnung
Impressum
Saat
Wohl bei keiner menschlichen Begegnung ist deren moralische Bewertung so stark von der rechtlichen Beziehung der Partner abhängig wie beim Geschlechtsverkehr.
Aus dem Tagebuch der Daniela D
Früh am Morgen
Als ich erwachte, war es rund um mich noch dunkel. Ich blickte um mich, versuchte mich im fahlen Licht einer Straßenlaterne zu orientieren, das durch ein französisches Fenster in den Raum fiel. Wo war ich? Die Scheiben des Fensters waren von Regentropfen benetzt, die auf dem verblechten Fenstersims monoton trommelnd aufschlugen. Das Bett quietschte, als ich mich auf den Rücken drehte, fröstelnd die dünne Decke über meinen nackten Körper hochzog. Bruchstückhaft kamen die Erinnerungen an den Abend, an die Nacht wieder, während ich meinen Blick über die Decke des kleinen Zimmers schweifen ließ, den verstaubten Deckenventilator mit einer einzelnen Glühbirne, die fadenscheinigen Vorhänge, die halb zugezogen an einer Metallstange über dem Fenster hingen.Weiter zu einem kleinen Tisch und zwei Sesseln, einem schäbigen Kleiderkasten, der im fahlen Licht einen langen Schatten auf die vergilbte Tapete warf.
Die leisen, gleichmäßigen Atemzüge neben mir halfen meiner Erinnerung nach. Gemeinsam mit der offenen Weinflasche auf dem Tisch, dem Geruch nach Zigaretten und anderen Rauchwaren, den beiden Gläsern, eines davon noch halb voll, den Resten klebriger Feuchtigkeit zwischen meinen Beinen. Das Puzzle der Erinnerung an die vergangene Nacht setzte sich langsam wieder zusammen, zauberte mir kurz ein Lächeln auf die Lippen. Nach Monaten wieder einmal ausgehen, erst überredet von einer Freundin, dann mitreißen lassen von der Stimmung in der Studentenkneipe in der Grazer Altstadt, am Freitag vor den Herbstferien. Von zwei passablen Männern anquatschen und abschleppen lassen, nach Monaten wieder einmal ficken, und ja, gut ficken.
Doch das gehörte zu gestern Nacht. Jetzt drängten sich viel praktischere Fragen in den Vordergrund. Zum Beispiel die, dass es in diesem heruntergekommenen Zimmer weder Bad noch WC zu geben schien. Ich setzte mich vorsichtig auf. Meine getragene Kleidung vom Vortag lag auf einen der Sessel und den Boden verteilt, hingebungsvoll vermischt mit Teilen seines Gewandes. Unter mir hatte sich ein feuchter Fleck auf dem Laken gebildet. Hatten wir ohne Gummi? Ich hatte wohl nicht darauf geachtet. Ich rechnete kurz,es würde schon nichts passiert sein, ich machte mir keine übertriebenen Sorgen. Meine Blase meldete sich zu Wort, sie reagierte nicht allzu freundlich auf die Lageänderung.
Also raus aus dem Bett. Ein wenig linkisch begann ich mein Unterzeug einzusammeln und mich im Dunkeln anzuziehen. In Strümpfen machte ich mich auf den Weg aus dem Zimmer, zum Glück lag die Toilette gleich gegenüber. Ein paar Minuten später war ich erleichtert und notdürftig gesäubert wieder zurück. Der junge Mann hatte sich im Bett umgedreht, schnarchte jetzt ein wenig lauter, schlief aber tief und fest weiter. Ich schlüpfte in meinen Rock, meine Schuhe und meinen Mantel, griff nach meiner Handtasche, betrachtete ihn noch eine Weile. Nein, ich würde ihn nicht wecken, er war ein Schwanz, nicht mehr als das, ich würde ihn so und so kaum wiedersehen. Ich schloss also behutsam die Zimmertüre von außen, rauchte mir eine Zigarette an und stieg die enge Treppe hinab ins Parterre. Es war wohl eine heruntergekommene Pension, in die er mich abgeschleppt hatte, ich glaubte nicht, hier schon einmal gewesen zu sein. Ich dachte noch kurz über das „er“ nach, ich konnte mich beim besten Willen nicht an seinen Namen erinnern.
Eine Frau undefinierbaren Alters in einem altmodisch geblümten Kleid und mit straff zu einem Dutt gebundenen schwarzen Haar blickte in der Rezeption auf. „Guten Morgen, die Dame, recht haben’s, dass’ gehen, bevor er aufwacht, aufg’wärmt schmeckt nur ein Gulasch. Wolln’s noch einen Kaffee? Frühstück inklusive, gleich da hinten.“ „Guten Morgen“, antwortete ich, von dem Redeschwall leicht überfordert. Der Frühstücksraum schien leer, eine olfaktorische Mischung aus angebranntem Kaffee, angebranntem Toast und kaltem Zigarettenrauch schlug mir entgegen. „Danke, sehr nett, aber ich muss meinen Zug erreichen. Bin ich noch etwas schuldig?“ Die Frau blickte wieder auf, sah mich lange und durchdringend an, ein Schimmer eines Lächelns huschte über ihr Gesicht. „Selten, dass ein Mädl das fragt. Aber nein, ich mach mir das schon mit dem jungen Herrn aus, der ist hier kein unbekannter. Kommens gut heim, haben’s weit?“ „Ein paar Stationen Richtung Leibnitz“, sagte ich, obwohl ich eigentlich nicht wusste, was die Frau das anging. Die blickte auf die altertümliche Pendeluhr, die in dem winzigen Vorzimmer der Pension an der Wand hing und laut tickte. „Zwanzig Minuten, geht sich bequem aus. Raus, rechts und dann immer geradeaus. Nur für den Fall, dass’ nicht wissen, wo’s gelandet sind.“
„Danke“, sagte ich unverbindlich, dämpfte die Zigarette in dem Aschenbecher aus, der auf einem der winzigen Tischchen stand, knöpfte meinen Mantel zu und trat durch die quietschende Glastüre hinaus auf die Straße. „Kein Unbekannter“, klang die dunkle Stimme der Frau in meinen Ohren nach. So so. Ich blickte nach rechts und wusste augenblicklich wieder, wo ich war. Der Regen hatte etwas nachgelassen, doch innerhalb kurzer Zeit waren mein Mantel und mein Haar feucht. Der Bahnhof kam in Sichtweite, der sonst so betriebsame Vorplatz war nahezu verlassen, die Stadt war um diese Zeit noch ruhig, nur das Quietschen einer Straßenbahn zerriss die morgendliche Stille. Die große Uhr auf dem Bahnhofsgebäude zeigte dreiviertel sieben. Ich betrat die große Halle, kaufte in der Trafik noch eine Morgenzeitung und Zigaretten und schlenderte dann quer über die Gleise zu dem etwas abgelegenen Bahnsteig, an dem der einzelne Triebwagen schon wartete. Der Dieselmotor tuckerte bereits, aus dem Auspuff aus dem Dach kam schwarzer Qualm, der frische Ostwind verteilte den Gestank wohl über die halbe Stadt. Der Fahrdienstleiter rief mir etwas nach, was nach „Passage“ klang, ich beachtete ihn nicht. Ich kletterte die zwei Stufen auf den Bahnwaggon, suchte mir einen Fensterplatz, zündete mir eine weitere Zigarette an und schlug die Zeitung auf.
Bevor ich weiter erzähle ...
Aber halt, bevor ich da so munter weiter plaudere: Ich habe mich ja noch gar nicht bei Ihnen vorgestellt. Mein Name ist Daniela D., Dr. Daniela D. genau genommen, mein vollständiger Nachname tut hier nichts zur Sache. Zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Geschichten niederschreibe, bin ich in meinen Sechzigern und erfolgreiche Unternehmerin. Was ich mache, ist kein Geheimnis, wird aber erst in einem späteren Band meiner Memoiren bekannt werden. Marion, die sich mit sowas auskennt, nennt das einen „Cliff Hanger“ und hat mich auch aufgeklärt, dass das kein alkoholisches Mischgetränk ist. Sie meinte auch, dass es heutzutage gescheit ist, das Vorwort als zweites Kapitel zu schreiben, es hat etwas mit diesem Internet zu tun, ich erinnere mich nicht genau.
Doch zu der Zeit, wo meine Erzählung beginnt, war ich fünfundzwanzig Jahre alt, eine zarte, fast dürre junge Frau von einsfünfundsechzig, mein langes blondes Haar fast immer streng zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ich lebte damals noch im Haus meiner Eltern in einem kleinen Ort unweit Graz. Ich bin daseinzige Kind des Franz D, eines gelernten Maurers und Poliers, der es durch Glück und Beziehungen zu einer Anstellung bei der örtlichen Gemeinde gebracht hatte. Meine Mutter ist Herta D, die nach meiner Geburt lang zu Hause geblieben war und als gelernte Friseurin in einem abgewirtschafteten Frisiersalon im Nachbarort arbeitete, um noch auf die erforderlichen Mindestjahre für eine eigene Pension zu kommen.
Die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts waren die Zeit, in der das proletarische Kleinbürgertum daran glaubte, dass mit Bildung, Fleiß und Ausdauer ein immer weiterer sozialer Aufstieg möglich sei. Also schickten mich meine Eltern nach der Volksschule an das Gymnasium der nahen Kleinstadt Leibnitz, wo ich die Pflichtschuljahre mit ausreichend Begabung und gerade noch ausreichendem Fleiß absolvierte, sodass beschlossen wurde, mich „studieren zu lassen“. Das hieß, dass ich zunächst die Schule bis zur Matura (der österreichischen Form des Abitur) weiter besuchen sollte. Mir war das mit vierzehn nur recht. Ich hatte zwar keine Vorstellung, was ich aus meinem Leben machen sollte, aber gleichzeitig die ganz klare Vorstellung, dass es sich nicht in einem Frisiersalon, an einer Nähmaschine oder gar in einer Fabrik abspielen würde.Meine Eltern bestärkten mich darin auch sehr, und bis zur Studienwahl war ja noch Zeit.
Weniger Einigkeit bestand vor allem mit meinem Vater, was den Umgang mit jungen Männern betraf. Für ihn gehörte es zum bürgerlichen Aufstieg, dass seine einzige Tochter einen ehrbaren Lebenswandel führte, bis sie aus seiner Hand jungfräulich an einen standesgemäßen Ehemann übergeben wurde. Den standesgemäßen Ehemann hatte er in Gestalt von Karl, dem Sohn des örtlichen Gastwirtes und Hoteliers, bereits ausersehen.
Es gab damit allerdings, was mich anbelangte, einige Schwierigkeiten: Karl war drei Jahre älter als ich und hatte sich zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater begann, mir seine Pläne auseinanderzusetzen, hauptsächlich durch exzessiven Alkoholkonsum und einen schweren Autounfall hervorgetan, was mein Vater als „Kindereien“ abtat. Dafür bewährte er sich beim österreichischen Bundesheer, wo er sich nach dem Grundwehrdienst zu einer Ausbildung zum Unteroffizier weiter verpflichtet hatte. In der Freizeit fuhr er mit seinen Freunden im Tarnanzug in einem offenen Geländewagen über die gesperrten Forststraßen der Umgebung und veranstaltete Pistolenschießen in einem aufgegebenen Steinbruch. Kurz: Er war nicht so ganz, was ich damals für den Mann meiner Träume hielt.
Doch das schwerwiegendere Problem war das mit der Jungfräulichkeit. Ich interessierte mich zwar nicht sonderlich für die jungen Männer, aber ich interessierte mich sehr für Schwänze, und die hingen nun mal an den jungen Männern. Zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater mir seine Pläne ernsthaft auseinandersetzte, ich mochte vielleicht siebzehn gewesen sein, hatte ich schon regelmäßig Geschlechtsverkehr und keinerlei Absicht, das zu ändern. Ich musste ihm das wohl etwas zu deutlich gesagt haben, es war das einzige Mal, dass er seine Hand gegen mich erhob und mir links und rechts eine klebte. Was ihm aber bei meiner Mutter nicht gut bekam: Wie sie mir viel später erzählte, hatte sie ihm den ehelichen Verkehr so lange entzogen, bis er sich bei mir entschuldigte. Seitdem war unser Verhältnis kühl, aber gewaltfrei, und letztlich bekam ich meistens meinen Willen.
Nach der Matura war es dann klar, dass ich ein Studium in Graz aufnehmen würde. Ich hatte nach wie vor keine Ahnung, was ich machen wollte, aber Sprachen und Literatur gefielen mir, also begann ich ein Lehramtsstudium für Deutsch und Englisch, was meinen Vater ein wenig besänftigte. Eine Gymnasiallehrerin war wohl „standesgemäß“ genug und ließ ihm meist darüber hinwegsehen, dass mein Lebenswandel nach wie vor nicht „ehrbar“ war. Ich dachte allerdings nicht daran, den Lehrberuf tatsächlich zu ergreifen. Nach dem Studienabschluss ging ich daher auf ein nur schlecht verhohlenes Angebot eines nicht unfeschen Professors ein, gegen ein Verhältnis mit ihm eine bezahlte Stelle als Bibliothekarin an der Institutsbibliothek und die Gelegenheit zu einem Doktoratsstudium zu bekommen.
Den Doktor hatte ich jetzt schon über ein Jahr in der Tasche, das Verhältnis mit dem Herrn Professor war ich auch los, aber Bibliothekarin war ich immer noch. Das war zwar als Teilzeitstelle nicht sonderlich einträglich, hielt mich aber einigermaßen aus dem Schussfeld meines Vaters, weil ich daheim Kostgeld bezahlte. Darüber hinaus ermöglichte mir die Stelle, auf einfachste Weise weiter am freizügigen Leben im Umfeld der Grazer Universität teilzuhaben. Was ich weiter mit meinem Leben anfangen wollte, wusste ich immer noch nicht, aber es beschäftigte mich zu diesem Zeitpunkt auch nicht sonderlich.
Ein Entschluss
Eine halbe Stunde später hielt der Triebwagen mit quietschenden Bremsen an der kleinen Haltestelle, die unseren gottverlassenen Ort mit der großen weiten Welt verband. Sah man von der Durchzugssstraße ab, die Graz mit Leibnitz verband, den Ort von der Aulandschaft der nahen Mur abschnitt und verhinderte, dass es ein Ortszentrum gab. Eigentlich war die Haltestelle nicht viel mehr als ein Schild mit dem Stationsnamen, eine Bushaltestelle und eine Telefonzelle. Es gab hier keinen Fahrdienstleiter, auch keine Passage, also konnte niemand daran Anstoß nehmen, dass ich einfach das Gleis überquerte und mich auch den kurzen Weg zu meinem Elternhaus machte.
Es hatte auch zu regnen aufgehört, die Sonne kämpfte sich schwach durch die tief hängende Wolkendecke, in den Schlaglöchern der schmalen Straße, die zu meinem Elternhaus führte, standen noch die Pfützen. Der Drill meiner Mutter und jahrelange Übung hatten es mir zur zweiten Natur gemacht, den Weg ohne besondere Aufmerksamkeit so zurückzulegen, dass Kleidung und Schuhe danach nicht bis zu den Knien mit Wasser und Schlamm bespritzt waren. Die architektonischen Scheußlichkeiten aus den fünfziger und sechziger Jahren, die links und rechts die Straße säumten, nahm ich nicht mehr bewusst wahr. Die zu den Häusern passenden Nachbarn zu grüßen, wenn ich ihnen auf der Straße oder über die Zäune ihrer Vorgärten begegnete, war jedoch ebenso zur zweiten Natur geworden wie der Slalom um die Schlaglöcher.
Schließlich erreichte ich die architektonische Scheußlichkeit aus den sechziger Jahren, die ich mein Elternhaus nannte. Graue Eternitplatten, ein ehemals rotes Wellblechdach ohne Dachüberstand, ein Schornstein, von dem die weiße Farbe abblätterte, ein Garagentor, auf dem der Rost blühte. Um diese Jahreszeit milderten nicht einmal die Blumen die Wucht der Hässlichkeit, die meine Mutter ihr jedes Frühjahr in eigensinnigem Trotz entgegensetzte. Zu meiner Überraschung war allerdings das Tor der Garage offen. Die dunkelbraune Limousine meines Vaters, den er fuhr, seit ich mich erinnern konnte, stand mit offener Motorhaube in der Einfahrt, seine untersetzte Gestalt war über deren Inneres gebeugt. „Guten Morgen“, sagte ich beiläufig in seine Richtung und hoffte, dass er mich wie gewöhnlich nicht beachten würde. Leider vergeblich, er richtete sich mit hochrotem Kopf auf und drehte sich zu mir um: „Genau die Zeit, wo anständige Leute von der Arbeit heimkommen. Warst wieder ficken, du Luder?“
Die Situation war nichts Neues. Normalerweise reichte es, ihn nicht weiter zu beachten. Doch wie bei so vielen Dingen, die einen jahrelang stören, gab es auch hier das eine Mal zu viel. Etwas machte „Klick“ in mir. So konnte und wollte ich nicht mehr weiter leben. „Ich find mir wenigstens wen zum Ficken“, gab ich ihm daher zur Antwort. „Aber keine Sorge, das ist das letzte Mal, dass ich danach hierher nach Hause komme.“ Damit drehte ich mich am Absatz um und ging die Straße weiter entlang in Richtung Hauptstraße. Seine Rufe „Dani, Dani, kumm z’ruck, woa do net so g’moant“ ignorierte ich für den Augenblick. Ich brauchte Zeit, zu überlegen.
Ohne groß nachzudenken, führten mich meine Schritte wie von selbst zu Mannis Café, das ein paar hundert Meter weiter an der Hauptstraße lag. Ich stieg die drei Stufen zum Eingang hinauf und stieß die Glastüre auf. Manni erschrak ziemlich, als er die Türe hörte, er war allein im Lokal und gerade damit beschäftigt, die Stühle wieder von den Tischen herunterzustellen, die offenbar zum Aufwaschen hochgestellt worden waren. „Servus Dani, was ist denn mit dir los?“, fragte er empathisch, als er mich in der Tür stehen sah. „Komm erst mal rein und setz dich. Cognac vielleicht?“
Manni, der Besitzer des Cafés, mochte vielleicht Anfang dreißig sein. Er sah genau wie sein Café immer aus, als wäre er in den Siebzigern stecken geblieben. Sein langes gewelltes Haar hing ihm gerade wirr in die Stirn, er trug weit ausgestellte Jeans und dazu einen braunen Pullover mit V-Ausschnitt, unter seiner Nase wucherte ein Oberlippenbart. Doch Manni war ein lieber Kerl, der keiner Fliege etwas zuleide tun konnte, und vor allem hatte Manni etwas, was unter den jungen Leuten der Umgebung weithin geschätzt war: Ein Telefon, von dem aus man sprechen konnte, ohne dass das nächste private Umfeld zuhörte oder man sich in der Kälte einer Telefonzelle abfrieren musste.
„Ja bitte, und das Telefon“, sagte ich zu ihm und steuerte eine der Nischen an, in denen man im Lokal einigermaßen abgeschirmt sprechen konnte – schon deswegen, weil es nachmittags und abends so laut war, dass man das eigene Wort kaum verstand. „Alles klar“, sagte Manni und war ein paar Minuten später mit einem riesigen Schwenker voller billigem Weinbrand und einem Telefon samt Einheitenzähler wieder zurück. Letzteres war mit einem endlos langen Kabel verbunden, das über eine einzigartige Konstruktion aus Schienen und Ösen in Schlaufen von der Decke hing und irgendwie immer von oben kam, damit niemand darüber stolpern konnte. Böse Zungen munkelten, dass Manni mit diesem Telefon sein Hauptgeschäft machte, er verlangte zwei Schilling pro angezeigter Einheit, um die man in der Umgegend vielleicht eine Minute sprechen konnte. Für Ferngespräche natürlich entsprechend kürzer. Aber niemand beschwerte sich, die Vorteile überwogen deutlich. Mannis Café hatte sich überhaupt als Nachrichtenzentrale für die jungen Leute der Umgebung etabliert, man konnte auch Rückrufe oder geschriebene Nachrichten hinterlassen, es wurde alles diskret und stets richtig ausgerichtet.
Ich leerte das Glas in einem Zug und kramte in meiner Handtasche um meinen Kalender, in dem es auch ein Telefonregister gab. „Ist was passiert? Willst du reden?“, fragte er anteilnehmend. „Später vielleicht, jetzt muss ich mal telefonieren“, sagte ich zu ihm, er verstand und wandte sich wieder seinen Stühlen zu, diskreter Weise am anderen Ende des Lokals. Ich hatte mittlerweile Claudias Telefonnummer in Wien gefunden und wählte. Ein verschlafenes „Ja“ am anderen Ende zeigte mir an, dass es für meine beste Freundin wohl noch zu früh am Tag war. „Dani“, sagte ich nur, „entschuldige, ein Notfall.“ Claudia war sofort hellwach. Ich schilderte ihr in kurzen Worten die Situation. „Kann ich zu dir nach Wien kommen? Die Uni hat nächste Woche zu, und ich brauch ein bisschen Abstand, um mir darüber klar zu werden, wie ich weitermachen will.“ „Na sicher“, sagte sie nur. „Kommst du heute noch?“ „Das wäre super, wenn das ginge.“ „Klar, für dich immer, Dani. Unverbrüchlich.“ „Unverbrüchlich. Bis heute Abend.“ Ich legte auf.
Claudia war meine älteste und beste Freundin. Wir hatten einander am Gymnasium kennengelernt und waren miteinander durch dick und dünn gegangen, hatten mit dreizehngemeinsam unsere ersten Zigaretten geraucht, waren mit fünfzehngemeinsam zum Gyn um die Pille gegangen. Wir hatten uns im selben Bett entjungfern lassen und die Nacht darauf in ihrem Zimmer durchgesoffen, Schwänze geteilt, nebeneinander gehabt und aneinander weitergegeben, Nächte durchgetanzt, durchgeheult und auch ganz ohne Schwänze miteinander verbracht. Kurz: Es gab nichts, was wir noch nicht miteinander geteilt hatten. „Unverbrüchlich“, das war das Zauberwort zwischen uns, und es hielt auch, nachdem sie nach der Matura nach Wien gegangen war, um „zu studieren“, was auch nach sieben Jahren noch zu keinen besonders herzeigbaren Ergebnissen geführt hatte. Claudias Eltern waren geschieden, sie bekam Alimente von ihrem Vater, der sich zwar nicht sonderlich für sie interessierte, aber bis jetzt keine Anstalten machte, die Zahlungen einzustellen – er war Facharzt, sie taten ihm wohl nicht besonders weh.
Als Manni merkte, dass ich aufgelegt hatte, kam er mit zwei weiteren Gläsern des billigen Fusels zu mir an den Tisch. „Also, was ist los mit dir?“, fragte er. Manni kannte mich auch schon über zehn Jahre, sein Café war schließlich der Teenager-Treff des Ortes. „Magst auch?“, fragte ich ihn und bot ihm eine meiner Zigaretten an. Er nahm eine, gab uns beiden dann Feuer. Er wartete, bis ich so weit war. „Mein Alter“, sagte ich schließlich. „Ich halt das nicht mehr aus, ich muss raus aus diesem Haus.“ „Hat eh lang gedauert, bis du da draufkommst“, sagte er nur. „Der Arsch hat bei mir schon lang Lokalverbot.“ Hmm, dachte ich, das hatte ich nicht gewusst. „Und was machst jetzt?“, fragte er nach. „Weiß noch nicht, heut fahr ich mal zur Claudia nach Wien. Eine Woche Zeit, bis ich wieder in der Arbeit sein muss.“ Manni nickte und hob eines der Gläser. „Auf einen guten Neubeginn“, sagte er. Ich trank mit ihm, der Fusel brannte zwar höllisch, tat mir aber trotzdem gut. „Und dann?“, fragte er. „Weiß nicht. Von dem Halbtagsgehalt an der Uni kann ich mir nicht viel leisten in Graz. Ein Pensionszimmer vielleicht für den Anfang, und schauen, dass ich mehr verdien.“ Manni wiegte den Kopf, schien aber auch keine bessere Lösung zu wissen. „Schau, daheim hab ich auch nur ein kleines Zimmer, so viel anders wäre das auch wieder nicht.“ „Ich hab noch nie allein gelebt“, antwortete er, „aber wenn du dir das vorstellen kannst, wird es schon passen.“ Manni war mit Leni zusammen, seit ich denken konnte. Sie servierte hier im Lokal, trug dabei Glockenjeans oder erdfarbene Röcke, stets ein breites Haarband, das ihre hüftlange Mähne nur unzureichend im Zaum hielt und Pullover, an denen man sich schon beim Hinschauen elektrisierte.Gemeinsam hatten sie eine winzige Wohnung im Oberstock. Die beiden passten irgendwie gut zusammen. „Alles besser als mit dem alten Arsch“, sagte ich. Manni nickte nur.
„Wie kommst nach Wien?“, fragte er weiter. „Na wie schon, mit der Bahn.“ Manni stand auf und konsultierte die Fahrplanauszüge, die er beim Eingang hängen hatte. „Wenn du den Pendler um halb drei nimmst, erwischt du den Kurswagen im halb vier, da bist um viertel sieben am Südbahnhof.“ Ich schaute auf meine Armbanduhr, es war mittlerweile schon halb elf. „Ja das sollte sich ausgehen, aber dann muss ich los, ich muss noch packen und mit Mama reden.“ Ich kramte in meiner Handtasche nach meiner Geldbörse, die jedoch peinlicher weise leer war. „Kann ich dir schuldig bleiben?“, fragte ich Manni. Er schaute mich eine Weile an. „Lass, Mädl, komm erst mal klar, das heut ist aufs Haus, ich hab ja eigentlich noch gar nicht offen.“ Ich lächelte ihn dankbar an. „Bist ein Schatz, Manni.“ Ich küsste ihn zum Abschied noch links und rechts auf die Wange und machte dann, dass ich nach Hause kam.
Das Garagentor stand immer noch offen, aber Vaters Wagen war nicht da, und von ihm war auch nichts zu sehen. Ich ging also ins Haus. „Hallo Mama“, rief ich in die Küche, wo meine Mutter schon am Herd zu Gange war. Sie war wie ich eine kleine und magere Frau, sie wirkte in diesem Augenblick sehr fragil, ihr straff zurückgebundenes, schon ein wenig angegrautes Haar ließ ihr Gesicht noch verhärmter aussehen, als es ohnehin war. Sie trocknete ihre Hände in der geblümten Schürze ab, die sie im Haus stets trug. „Dani“, sagte sie nur. „Komm bitte kurz rein, was war denn schon wieder los?“
Ich seufzte innerlich. Auch wenn es sein musste, ich hatte eigentlich keine Lust, die Geschichte jetzt ein zweites Mal zu erzählen. Doch setzte ich mich trotzdem brav an den Küchentisch und erzählte ihr in knappen Worten. „Er meinte, du gehst jetzt und kommst nie wieder?“, sagte sie, und Tränen standen in ihren Augen. „Setz dich doch auch, Mama“, antwortete ich mit weicher Stimme. Sie nahm sich den wackeligen Küchenstuhl und setzte sich zu mir. „Es ist nichts entschieden, aber ich hab nächste Woche frei und fahr jetzt mal zu Claudia nach Wien. Abstand gewinnen.“ Ich spürte, wie Mama ihre Hand sachte auf die Meine legte. „Und dann?“, fragte sie. „Keine Ahnung“, sagte ich wahrheitsgemäß darauf. „Aber du weißt, dass ich früher oder später gehen muss. Und es ist eigentlich ohnehin schon sehr spät in meinem Leben.“ Mama schwieg eine Weile und blickte einfach nur auf den Küchenboden. „Ja, ich weiß“, sagte sie schließlich. „Aber es wird hier noch kälter werden ohne dich.“
Ich fühlte, wie jetzt mir die Tränen aufstiegen. Ich konnte ihr Frösteln förmlich spüren, das sich trotz der Hitze in der Küche von ihr zu mir übertrug. „Warum bleibst du eigentlich bei ihm?“, fragte ich sie sanft. Es war nicht das erste Mal, dass ich ihr diese Frage stellte, und in dem Augenblick, wo ich gefragt hatte, wusste ich, dass es die falsche Frage gewesen war. „Du kennst die Antwort, Kind“, sagte sie nur. „Isst du noch mit mir?“, wechselte sie ansatzlos das Thema. „Er ist wohl saufen gefahren, den sehe ich vor Abend nicht mehr, wäre schade drum.“ Ich hatte zwar eigentlich keine Lust darauf, meine Mama kochte schrecklich, aber ich brachte es nicht übers Herz, abzulehnen. „Ja, aber ich muss packen. Rufst du, wenn du so weit bist?“
Ich ging also die Treppen hoch in mein Zimmer. Erst einmal ausgiebig duschen, ich konnte den Mann immer noch an und in mir kleben spüren. Dann zog ich mich frisch an, nahm den kleinen Koffer zur Hand, der oben auf meinem Kleiderkasten lag und begann ohne viel Nachdenken für die Woche zu packen. Ich schloss den Koffer, setzte mich auf das frisch bezogene Bett und blickte mich in dem Zimmer um, in dem ich bis jetzt mein ganzes Leben lang gewohnt hatte. Die schäbig gewordenen Tapeten an den Wänden, das dunkle Bett, selbstverständlich nur für eine Person, der Messingluster an der Decke, das trübe Glas der Nachtlampe an der Wand. Mein Schreibtisch, auf dem ich meine Hausübungen gemacht und meine Liebesbriefchen geschrieben hatte. Ein Poster an der Wand, ein paar Volksschulzeichnungen, die Mama hier aufgehängt und niemand mehr abgenommen hatte. Es wurde mir schmerzlich bewusst, dass der Großteil meiner persönlichen Habe in diesen kleinen Koffer passte: Mit Ausnahme von ein paar verstaubten Jugendbüchern und ein paar Unterlagen aus der Uni-Zeit würde ich selbst für die Woche kaum etwas hier zurücklassen. Ich musste kurz lachen, als ich hinten in der Schreibtischlade meinen schon ziemlich mitgenommenen orangen Dildo wiederfand. Erinnerungen stiegen auf, ich verscheuchte sie und schloss die Lade wieder.
Mamas Ruf zum Essen riss mich aus meinen Gedanken. Halb eins, noch Zeit genug.
Nach Wien
Es war bereits nach zwei, als mich Mama daran erinnerte, dass ich abreisen wollte. Irgendwann während des Mittagessens hatte sich die Stimmung merklich aufgehellt – ob das an der Flasche Wein lag, die wir beide dazu aufgemacht hatten? Ich hatte zu meiner Mutter immer schon ein sehr offenes Verhältnis, sie kannte viele meiner kleinen Jugendsünden, und bei manchen Erinnerungen mussten wir herzlich lachen. Auch sie war offen wie selten, sie ließ mich auch einiges aus ihrer gar nicht so braven Jugend wissen, die dann recht abrupt damit geendet hatte, dass sie mit neunzehn einmal zu unvorsichtig gewesen war und sich damit mich samt meinem Vater eingehandelt hatte.
Ich holte also rasch meinen Koffer und meine Handtasche von oben und machte, dass ich zur Haltestelle kam. Auf dem Weg hinaus drückte mir Mama noch ein Sackerl mit Reiseproviant in die Hand. Ich brachte es nicht übers Herz, es nicht anzunehmen, obwohl ich von dem schweren und opulenten Mittagessen noch so satt war, dass ich dachte, nie wieder auch nur einen Bissen hinunterzubringen. Als ich den Vorplatz der Haltestelle erreichte, stand der Pendlerzug nach Graz schon abfahrbereit auf dem Gleis. Ihn noch zu erreichen, war aber dank jahrelanger Routine kein Problem, Blickkontakt und ein Lächeln für den Zugführer gestatteten mir, noch ohne Hast einzusteigen.
Am Grazer Hauptbahnhof wurde die Zeit dann fast zu knapp, weil mir schmerzlich bewusst wurde, dass meine Geldbörse immer noch leer war und ich vor dem Fahrkartenschalter noch zum Geldautomaten musste. So blieben auf dem Bahnsteig nur mehr ein paar Minuten, bis der Zug mit dem Kurswagen nach Wien einfuhr, der in Bruck an der Mur an den Schnellzug von Klagenfurt nach Wien angehängt werden sollte. Ich kämpfte mich also mit dem Koffer in der Hand bis zum richtigen Waggon durch, richtete mich in einem gut geheizten Abteil der zweiten Klasse häuslich ein und verschlief den besseren Teil der Fahrt, bis in Neunkirchen ein sehr charmanter junger Mann zustieg, der mir die restliche Zeit bis Wien wie im Fluge vergehen ließ. Sein Angebot, doch den Abend mit ihm in der Stadt zu verbringen, musste ich allerdings ablehnen, ich wollte zu Claudia. Er ließ es sich nicht nehmen, mir seine Visitenkarte in die Hand zu drücken, ich bedankte mich artig und steckte sie in meine Handtasche, hatte aber keine Absicht, von ihr Gebrauch zu machen.
Am Wiener Südbahnhof dachte ich noch daran, im Reiseproviantgeschäft eine Flasche Rotwein und eine Schachtel Pralinen zu kaufen, bevor ich mich auf die lange Reise mit der Straßenbahn zu Claudias Wohnung machte, die im 9. Bezirk und damit am anderen Ende Wiens lag. Immerhin führte die Fahrt über die prachtvolle Ringstraße vorbei an der Staatsoper, der Hofburg, Parlament und Rathaus und zuletzt an der Wiener Universität, in deren Nähe Claudia sich ihre Wohnung gesucht hatte. Noch ein paar Schritte, vorbei an einem typischen Wiener Kaffeehaus, und dann durch das mächtige Haustor in eines Wiener Gründerzeithauses. Ich erinnerte mich, ich war vor Jahren schon einmal hier gewesen, ihre Wohnung lag im ersten Stock, der sich aber nach der seltsamen Wiener Zählweise als dritter Stock herausstellte, man musste zuerst durch Hochparterre und Mezzanin. Mein Herz klopfte ein wenig, als ich endlich vor ihrer Türe stand und die altmodische Drehglocke betätigte – nicht nur von den drei Stockwerken, sondern auch vor Aufregung, schließlich hatte ich meine Beste sicher drei Jahre nicht mehr gesehen.
Claudia öffnete, stand in der Tür, strahlte mich an … und es war, als hätten wir einander gestern das letzte Mal gesehen. „Komm rein, Schatz“, sagte sie und nahm meinen Koffer. Drinnen im Vorzimmer umarmte sie mich erst einmal minutenlang. „So cool, dass du da bist, ich freu mich irrsinnig.“ Ich machte mich von ihr schließlich los. „Ich mich doch auch, auch wenn der Auslöser ein bisserl blöd war. Aber vorgenommen hatte ich es mir schon lang, dich wieder einmal zu besuchen.“ Claudia, die praktische, nahm mir als Erstes einmal den Wein und den Proviant ab, den mir Mama mitgegeben hatte. „Also ich hatte ja an Pizza gedacht, aber mit all dem können wir uns die nächsten drei Tage in der Wohnung verschanzen.“ „Du gönnst mir bloß keinen feschen Pizzamann“, gab ich angriffslustig zurück und boxte sie ein wenig. „Einer für uns zwei tät eh nicht mehr reichen, Schätzchen“, gab sie kichernd zurück. „Apropos einer: Das meinst du aber jetzt auch nicht ernst, dass wir heute Nacht mit einer Flasche Wein auskommen?“
Sie sah mich an, plötzlich schien sie zu bemerken, dass ich immer noch in Mantel und Schuhen in ihrem Vorzimmer stand. „Aber jetzt komm erst mal an.“ Sie stellte den Sack mit den Vorräten rasch in die Küche, während ich meinen Mantel ablegte. „Hausschuhe habe ich im Koffer“, sagte ich. „Na dann komm mit.“ Sie führte mich in ihr geräumiges Wohnzimmer. Die Einrichtung war ein wilder Mix aus Möbeln, die noch von Claudias Großmutter in der Wohnung verblieben waren, darunter zwei Rundbaukästen und eine Biedermeierkommode, billigen Möbeln aus den fünfziger Jahren, einigen Stücken aus dem Selbstbau-Möbelhaus und jeder Menge plüschiger Deko. Mittendrin stand ein Gasofen, der die ganze Wohnung beheizte, mit einem langen, fragil wirkenden Ofenrohr, das knapp unter der Decke in der Wand verschwand. Insgesamt machte es mittlerweile einen unglaublich gemütlichen Eindruck.
„Ich nehme an, du wirst lieber bei mir im Doppelbett schlafen als hier auf dem Sofa.“ „Wenn es dich nicht stört?“ „Warum sollte es auf einmal, Süße?“ Sie sah mich auf diese spezielle Weise an, die mich ahnen ließ, dass auch dieses Feuer noch nicht ganz erloschen war. „Bei mir daheim haben wir das auf neunzig Zentimeter geschafft, Jetzt hab ich immerhin zwei Meter in jede Richtung.“ „Na dann“, sagte ich und dachte daran, dass wir ja am Abend sicher die ein oder andere rauchen würden. Ich folgte ihr also ins Schlafzimmer, stellte meinen Koffer auf eine niedrige Kommode. „Magst noch schnell duschen und dir was Bequemes anziehen?“, fragte sie noch. Claudia war bereits in Sweater und weiten Jogginghosen, nach noch einmal Ausgehen sah das jedenfalls nicht aus. „Gern“, antwortete ich also. „Lass dir Zeit, ich richte einstweilen die Köstlichkeiten deiner Mama für uns an.“
Zwanzig Minuten später saßen wir bereits in Claudias gemütlicher Sitzecke. Sie hatte es tatsächlich geschafft, aus Mamas belegten Broten eine ansehnliche kalte Platte zu zaubern, das ganze noch ein wenig mit Tomaten, harten Eiern und Paprika verfeinert und den mitgebrachten Rotwein schon geöffnet. Aus einem Ghettoblaster leierte eine Tonbandcassette Hits unserer Jugend von Boney M bis ABBA, und schon nach dem ersten Glas Wein begann ich mich wieder einmal wirklich wohlzufühlen. Es wurde ein richtiger Versumpfabend zu zweit, wie man ihn nicht planen kann, Claudia fand dann in einer Lade noch eine zweite Flasche Wein, die zwar Anfangs schon ein wenig grenzwertig oxidiert schmeckte, was aber nach den Pralinen und der fünften Zigarette kaum mehr zu spüren war. Nach elf Uhr waren wir dann bei den Tonbändern schon im deutlich peinlichen Bereich angelangt, ein wilder Mix aus Udo Jürgens, Mirelle Matthieu, Neuer Deutscher Welle und anderem, das wir nüchtern nicht ausgehalten hätten, begleitete uns auf dem Übergang zu der halben Flasche Whiskey, die sich noch in ihrem Wohnzimmerschrank fand. Es war schon nach drei Uhr morgens, als wir unszum letzten Schluck noch etwas aus ihrer Blechdose bauten und dann wie auf Wolken ins Bett und in einen traumlosen Schlaf fielen, aus dem wir erst gegen Mittag des Sonntags wieder erwachten.
Claudias Geschichte
„Heute Abend muss ich dich allein lassen. Ich hab ein schon länger ausgemachtes Date, ich wusste ja nicht, dass du mir ins Haus schneien wirst.“ Es war mittlerweile fünf Uhr Nachmittag, wir hatten den Tag mit einem langen Besuch in dem altmodischen Kaffeehaus begonnen, an dem ich gestern vorbeigekommen war, und waren gerade erst wieder auf dem Weg hinauf in Claudias Wohnung. „Ja klar, kein Problem“, sagte ich. Claudia kramte in einer Lade herum. „Hier Haus- und Wohnungsschlüssel, falls du auch ausgehen willst.“ „Danke, ist lieb, aber mein Bedarf ist grad noch gedeckt. Aber wenn du mir noch erklärst, wie die Glotze funktioniert.“ „Fernbedienung liegt auf dem Tisch, den Rest schaffst sogar du. Aber es gibt nur österreichisches Fernsehen“, rief sie aus dem Badezimmer, sie war wohl schon mit Vorbereitungen für ihr Date beschäftigt. Danke für die Blumen, dachte ich, aber ein kurzer Test zeigte mir: Sie hatte recht, das schaffte sogar ich. „Kannst dich aber auch in die Badewanne legen, und einmal kiffen ist auch noch da“, ergänzte sie, als sie im Morgenmantel ins Schlafzimmer vorbeihuschte. Eine Viertelstunde später stand sie fertig aufgebrezelt vor mir, und ich staunte wieder einmal aufs Neue, wie fesch Claudia sein konnte, wenn sie darauf Wert legte. Ich hatte sie schon in der Schulzeit um diese Begabung beneidet, ihre Stilsicherheit, ihr schlafwandlerisches Geschick, ihre Vorzüge zu betonen und sich in Szene zu setzen. Wie immer sie das so schnell hingekriegt hatte, ihr volles dunkles Haar war nach der Mode der Zeit auftoupiert, Blazer und ausgestellter kurzer Rock unterstrichen ihre Taille, Stöckelschuhe, mit denen ihr nicht viel auf 1.80 fehlte, betonten ihre langen schlanken Beine. Wäre sie nicht meine Beste gewesen, hätte ich ihr wohl vor Neid die Augen ausgekratzt.
„Na, du hast ja einiges vor“, sagte ich stattdessen. „Viel Spaß und viel Glück.“ „Danke“, lächelte sie, gab mir einen flüchtigen Kuss, hinterließ mich in einer Wolke ihres Parfums und war auch schon bei der Türe draußen. Ich nahm mir also die Fernbedienung, fläzte mich auf das bequeme Sofa und hatte die Auswahl zwischen Fußball und einer damals sehr populären Sendung namens Seniorenclub, die zu der Zeit wohl zum überwiegenden Teil jüngere Leute ihren Eltern oder Großeltern zuliebe sahen. Oder mangels Alternativen, so wie ich gerade. So ließ ich also die mediokre Mischung aus belanglosem Geplauder und auf die Zielgruppe zugeschnittenen musikalischen Darbietungen an mir vorüberrieseln, während ich an die Decke starrte, das Alleinsein genoss und an genau gar nichts dachte. Ich musste wohl eine Weile eingedöst sein, erst die harsche Signation der Hauptnachrichtensendung riss mich wieder aus meiner Gedankenlosigkeit. Ich schaltete den Fernseher ab, ich hatte keine Lust, mich mit politischen Aufregern zudröhnen zu lassen, die ich weder beeinflussen konnte noch mein Leben sonderlich berührten.





























