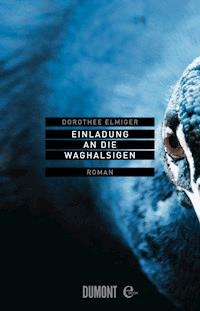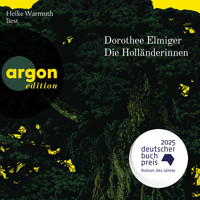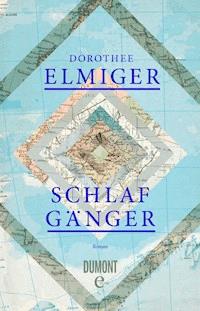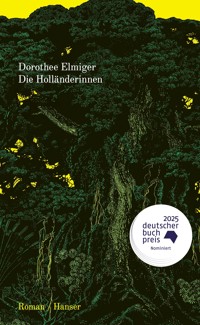
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dorothee Elmigers neuer, bildgewaltiger Roman – eine mitreißende Erfahrung. Wer diesen Text betritt, fällt in den Abgrund unserer Welt und blickt mit aufgerissenen Augen in die Finsternis. Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2025 Mit blinkenden Warnlichtern fährt die Erzählerin, eine namenlose Schriftstellerin, an den Straßenrand, als ein unerwarteter Anruf sie erreicht. Am Apparat ist ein gefeierter Theatermacher, der sie für sein neuestes Vorhaben zu gewinnen versucht – ein in den Tropen angesiedeltes Stück, die Rekonstruktion eines Falls. Wenige Wochen später bricht sie auf, um sich der Theatergruppe auf ihrem Gang ins tiefe Innere des Urwalds anzuschließen. Dorothee Elmiger erzählt eine beunruhigende Geschichte von Menschen und Monstren, von Furcht und Gewalt, von der Verlorenheit im Universum und vom Versagen der Erzählungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über das Buch
Mit blinkenden Warnlichtern fährt die Erzählerin, eine namenlose Schriftstellerin, an den Straßenrand, als ein unerwarteter Anruf sie erreicht. Am Apparat ist ein gefeierter Theatermacher, der sie für sein neuestes Vorhaben zu gewinnen versucht — ein in den Tropen angesiedeltes Stück, die Rekonstruktion eines Falls. Wenige Wochen später bricht sie auf, um sich der Theatergruppe auf ihrem Gang ins tiefe Innere des Urwalds anzuschließen.Dorothee Elmiger erzählt eine beunruhigende Geschichte von Menschen und Monstren, von Furcht und Gewalt, von der Verlorenheit im Universum und vom Versagen der Erzählungen. Wer diesen Text betritt, fällt in den Abgrund unserer Welt und blickt mit aufgerissenen Augen in die Finsternis.
Dorothee Elmiger
Die Holländerinnen
Roman
Hanser
und ich, wie in der stanza eines Gedichts in einer fremden Sprache, die ich nicht verstehe, befinde mich zutiefst erschrocken dabei.
Werner Herzog: Eroberung des Nutzlosen
Aus dem Fenster der Kabine sieht sie bemerkenswerte Formationen, frei flottierende Kuppeln und Türmchen, Stalagmiten, die aus der relativen Dunkelheit des weit unter ihr liegenden Tieflands zu erwachsen scheinen. So wird sie es später beschreiben, als sie im künstlichen Licht des kleinen Auditoriums steht, Wolkensäulen, Streben, Baldachine, und es wird sie in diesem Moment das plötzliche Gefühl befallen, es handle sich bei ihrer Schilderung um eine Indiskretion, eine Zudringlichkeit, es verletze ihre Benennung dieser Dinge, die sie aus der Luft gesehen hat, ein unausgesprochenes Gebot.
I.
Man stellt sie vor als bedeutende Erzählerin, als eine der wichtigen Stimmen dieser Zeit, die mit ihrem frühen Zyklus Die Bestrafung der Mägde erstmals für Aufsehen gesorgt und sich spätestens mit dem Versroman Das ätherische Zelt endgültig etabliert habe, und als man ihr dann ein Zeichen gibt, tritt sie ans Pult, einen Stoß Papier in der Hand, eine kleine Frau, kleiner jedenfalls als erwartet, sie berührt das Mikrofon mit den Fingern ihrer Linken und bedankt sich für die Einladung, sie schätze sich sehr glücklich, sagt sie, heute und in den kommenden Wochen hier sprechen zu dürfen. Ihr ursprünglicher Plan sei es gewesen, einiges über die Prämissen und Methoden ihrer Arbeit zu sagen, über die Texte und Positionen, an denen sie sich orientiere, die ihr Denken im Laufe der Jahre begleitet hätten, ergänzt von einigen wenigen biografischen Anmerkungen und zwei, drei Sätzen zu ihrem Verhältnis zu den richtungsweisenden Schulen und Traditionen, um anschließend dann in ihr Werk einzuführen. Aber obwohl sie genau dies in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt getan habe und obwohl sie glaube, schreibend und sprechend durchaus eine kohärente poetische Theorie entwickelt zu haben, sei ihr nun jede einigermaßen klare Bestimmung ihrer Arbeit, jede sichere Feststellung ihr Schaffen betreffend unmöglich geworden. Tag für Tag, sagt sie, habe sie sich in den letzten Wochen vor ihren Laptop gesetzt und an diesem Vortrag gearbeitet, aber über Nacht sei ihr stets bedeutungslos geworden, was sie tags zuvor aufgeschrieben habe, und einer gespensterhaften Penelope gleich habe sie das am Vortag Gewobene immer wieder aufgetrennt. Stattdessen hätten sich ihr Bilder aufgedrängt, Hieroglyphen, unvermittelt wie Blitzlichter: Frauen mit Aschekreuzen auf der Stirn, ein Toter in der U-Bahn-Station, die Arme und Beine wie zufällig von sich geworfen, die Erinnerung an vier Reiterinnen mit verhüllten Gesichtern, die ihr im Februar vor zwei Jahren in einer abgesperrten Querstraße in New Orleans entgegengekommen seien. Auf ganz ähnliche Weise habe sich zuvor bereits ihr eigentliches Schreiben aufgelöst, eigenhändig habe sie es, wenn man so wolle, in immer kleinere Teile zerlegt: Der Text, jeder Versuch eines Textes habe sich fragmentiert, sei zunehmend formlos geworden.
Selbstverständlich, sagt sie, könne man dies nun im Licht der gegenwärtigen Verhältnisse betrachten, Verhältnisse, die fraglos und im vielfachen Sinne schlecht, ja tödlich seien, man könnte sagen, der Text selbst verweigere sich unter dem Eindruck des rapiden Sterbens, und wenn alles so rasant auf sein unwiderrufliches Ende zuschlittere, erübrige sich der sinnhafte Text, erübrige sich der Hinweis auf das Schöne, das Mögliche und so fort, aber dies sei in ihren Augen eine allzu simple Auffassung, die auch von einer gewissen Hybris zeuge. Sie selbst zumindest habe sich den Text in den Jahren, die sie schreibend verbracht habe, nie als Rettung, sondern vielmehr als Ausdruck einer irren, gellenden Lebendigkeit gedacht, einer Gegenwart, von der sie selbst ja ganz durchschossen sei. Der Text als Notiz aus dem Chaos, dem Mahlstrom des Lebens — jahrelang habe Bruegels Kampf zwischen Karneval und Fasten über ihrem Schreibtisch gehangen, und wie er, Bruegel der Ältere, habe sie sich für das Enzyklopädische, das Karnevaleske, die Gleichzeitigkeit der Dinge interessiert: hier die Kostümierten, die Spieler und Trinker, der Faschingsprinz mit dem gebratenen Ferkel am Spieß und dort die Leprösen mit ihren Glöckchen, ihren Krücken, ein Blinder mit ausgestochenen Augen, Nonnen im schwarzen Habit, am Boden zerbrochene Eier.
Wie dem auch sei, sagt sie, nun, da sich ihr Schaffen in einem Prozess der Auflösung befinde — ein Prozess, der unter Umständen doch folgerichtig sei und den sie vielleicht nur deshalb nicht hinnehmen könne, weil er für sie ein berufliches, ein finanzielles Problem bedeute —, nun, da sie also diese Auflösung erfahre, könne sie, das liege auf der Hand, auch keine Theorie ihres Schaffens mehr vorlegen, sondern höchstens, so habe sie zunächst geglaubt, eine Theorie der Auflösung, des Abbrechens, des Auseinanderfallens, aber dieser Vorgang folge in Wahrheit keinen Regeln, er habe kein System, es handle sich um ein geradezu bartlebyisches Nicht und widersetze sich folglich, dies habe sie in den vergangenen Wochen vor ihrem Laptop feststellen müssen, auch der Theorie.
Trotzdem, sagt sie, wäre es ihr falsch erschienen, ihre Zusage im letzten Augenblick doch noch zu widerrufen, den Kopf, wie es heiße, aus der Schlinge zu ziehen und sich ausgerechnet jetzt, in diesem Moment ihrer Krise, auszuschweigen, auch wenn sie immer wieder versucht gewesen sei, genau dies zu tun. Stattdessen habe sie sich schließlich vor wenigen Tagen, und ganz gegen ihre eigenen Grundsätze, dazu entschlossen, über ihren letzten, nie zu Ende gebrachten Text zu sprechen — ein Wust an Notizen, Fragmenten, die Relikte einer Reise, die sie nun zum ersten Mal in die Hände nehmen und ins Licht halten wolle.
Im Januar vor drei Jahren, sagt sie, habe sie der Anruf eines Theatermachers erreicht, dessen Name ihr zwar ein Begriff gewesen, dem sie aber bis dahin selbst nie begegnet sei. In Interviews und Gesprächen habe er sich oft auf Arendt bezogen, auf Arendt, auf Adorno und einige französische Soziologen, deren Werk sie selbst stets nur gestreift habe. Er baue an einer großen Theatermaschine, habe er oft erklärt, es gehe ihm um nichts weniger als einen neuen, einen hypnotischen Realismus, wie ihn eben nur das Theater, dieser Ort der ständigen Doppelung, schaffen könne, wo Wirklichkeit und Fiktion, wie es ein bekannter deutscher Dramatiker so treffend beschrieben habe, aufeinanderträfen und in einer »heiligen Kollision« ihre Fassung verlören. Er sitze gerade an den Vorbereitungen zu einem neuen Stück, habe der Theatermacher damals im Januar am Telefon gesagt, es handle sich um die Rekonstruktion eines Falls, ein schwieriger, tragischer Stoff, den er sich zurzeit als eine Art tropische Passion vorstelle, als Referenz auch auf Herzog, auf Coppola, und sie selbst sei in diesem Moment mit eingeschalteten Warnblinklichtern an den Straßenrand gefahren, um ihn besser hören zu können. Was ihm vorschwebe, sei eine groß angelegte Recherche, so sei er fortgefahren, eine Recherche, die nur in der Wiederholung, der Nachbildung der Ereignisse geschehen könne, ja, es gehe, wie stets am Theater, darum, die Dinge am eigenen Leib zu erfahren. Er habe ihre Bestrafung der Mägde, ja ihr ganzes Mythen-Projekt über die Jahre hinweg mit Interesse verfolgt, habe er erklärt, und wolle sie deshalb als Autorin für sein Vorhaben gewinnen, vorausgesetzt, sie könne reisen und sei bereit, zehn oder vierzehn Tage vor Ort zu verbringen, zwischen den Wendekreisen, wo man das benötigte Material im Kollektiv erarbeiten wolle. Sie verstehe, habe sie gesagt, obwohl sie ihm aufgrund der schlechten Verbindung nur mit Mühe habe folgen können, sie habe sich Bedenkzeit ausbedungen und auf der Rückseite eines Tankstellenbons einige Namen und Stichwörter notiert, die ihr nun, drei Jahre später, ganz und gar chiffrenhaft erschienen. Als sie kurze Zeit später wieder losgefahren sei, habe es heftig geschneit, und weit vor ihr, zu ihrer Linken, habe sich dann ganz plötzlich die gewaltige weiße Salzhalde des Kalireviers Werra erhoben.
Als sie an jenem Abend in das Haus am Frankfurter Stadtrand, das sie zu jener Zeit bewohnt habe, zurückgekehrt sei und ihr dunkles Arbeitszimmer betreten habe, sei es ihr für einen Moment so vorgekommen, als gehörten die vom orangen Licht der Straßenlaterne beleuchteten Bücher, die Zeitschriftenstapel und leeren Wassergläser auf einmal einer weit zurückliegenden Vergangenheit an — als würde sie die Requisiten, das Schreibgerät einer anderen, einer irgendwie Verschwundenen betrachten. Sie habe damals, sagt sie, an einer Geschichte des Auges gesessen, die lange Zeit den Arbeitstitel Adele Brises rechtes Auge getragen habe. Nachts, über den Arbeitstisch im Frankfurter Häuschen gebeugt, habe sie Texte zu den halluzinatorischen Bildern und Visionen der Seherinnen, den Schauungen der Muttergottes, den Marpinger Marienerscheinungen studiert: Es sei von Gestalten mit hellen Mänteln, mit quasi fluoreszierenden Umhängen die Rede gewesen, der Erlöser sei auf einer weißen Stute vorübergeritten, a white mare, die Jungfrau habe sich im April 1970 in einem Wohnzimmer in Queens gezeigt, sie habe zwischen einem Ahorn und einer Schierlingstanne gestanden, über allen Dingen seien Flämmchen geschwebt, die Welt sei vollständig entzündet gewesen. Die Opulenz der Erscheinungen, der Hokuspokus, die seltsame Schönheit der Auren und Gesichte hätten sie interessiert, sagt sie, auch das Flimmern am äußersten Rand des binokularen Felds, die drehenden Lichter, Blendungen, aber sie habe den Text, so habe sie damals zumindest geglaubt, gegen die Wand gefahren und sei deshalb froh gewesen, sich einer anderen Sache zuwenden zu können. Am nächsten Tag schon habe sie jedenfalls die Nummer des Theatermachers gewählt und zugesagt; wenig später habe man ihr eine E-Mail mit ihren Reiseunterlagen geschickt.
In der Abflughalle habe sie neben einer Nonne gesessen, einer Benediktinerin, die mit einem kleinen Messer einen Apfel zerteilt habe. Im Flugzeug dann sei der Platz neben ihr frei geblieben und sie habe den Flug über den Atlantik lesend und schlafend verbracht. Erst kurz vor der Landung ihr Blick aus dem ovalen Fenster auf die hellen Gebilde, Riffe, die vielstöckigen Wolkengebäude weit unter ihr; bald darauf sei die Sonne schon weg gewesen.
Im Taxi habe sie sich durchs menschenleere Zentrum der Hauptstadt zum Hotel fahren lassen. Der Fahrer, ein schmächtiger, ausgesprochen höflicher Exil-Nicaraguaner, habe die verlassenen Kreuzungen der Innenstadt bei Rot überquert und ihr von seinem ebenfalls exilierten Bruder erzählt, der seinerseits nach Nebraska gegangen sei und dort, in Omaha, nun auf einer Geflügelfarm arbeite. Die Amerikaner, so berichte dieser Bruder, seien gordo, es sei alles ausgesprochen billig dort, in Nebraska, muy barato, insbesondere das Hühnerfleisch. Im Hotel, das regelrecht befestigt gewesen sei — der Eingang zur Lobby und die Garageneinfahrt mit einem eisernen Gitter verschlossen, das der Rezeptionist, der nach langer Zeit erschienen sei, eilig auf- und wieder zugesperrt habe —, sei sie auf ihr Zimmer gegangen und habe dort den Fernseher angemacht. TV5MONDE Amérique Latine habe ein Interview mit einem Schriftsteller gezeigt, dem sie in den vergangenen Jahrzehnten einige Male, zuletzt bei einer Tagung in der Wachau, begegnet sei. Sie habe zugehört, schläfrig schon, wie er erklärt habe, sein Roman handle von einem Mann, der in der Hauptsache sich selbst zu entkommen versuche, und irgendwann habe sie den Kanal gewechselt und Luftaufnahmen gesehen, statische Bilder eines kargen, steppengleichen Geländes, das sie nicht habe verorten können.
Am nächsten Tag die Überlandfahrt: vor dem Busfenster magere, weiße Kühe im gewittrigen Licht, gelbe Felder, Reklametafeln. Tengo fútbol. Se venden lotes. Die Route habe durch ein hohes Gebirge geführt, ein Massiv, das die Einheimischen den Berg oder Hügel des Todes genannt hätten. Das Fahrzeug habe sich unter verhangenem Himmel auf über dreitausend Meter hochgeschraubt; aus den Schluchten, den tief eingeschnittenen Tälern sei Nebel emporgestiegen. Jesús te ama. Pollolandia. Später die schirmhaften Kronen weit entfernter Bäume, endlose Palmplantagen in der Ebene. Augenblicklich habe sie die Landschaftsmaler vor Augen gehabt, die Holländer, die Spanier vor ihren Staffeleien. Humboldtianer in den Anden. Das Vulkanfeld von Michoacán. Brasilianische Landschaften: großes Blau, tief liegende Horizonte. Am späten Nachmittag sei das Wetter dann zunehmend düster geworden, als führen sie einem Sturm entgegen, und als sie um 19 Uhr zusammen mit zwei oder drei anderen in einer südlichen Kleinstadt aus dem Bus gestiegen sei, habe dort eine unruhige Dunkelheit geherrscht. Am Rand der Straße hätten einige Männer gestanden, darunter ein kahlköpfiger in einem verwaschenen Nike-T-Shirt, der sofort auf sie zugetreten sei und sich ihr, der Touristin, als Taxifahrer angeboten habe, und sie sei also in sein Auto gestiegen und habe sich auf den Rücksitz gesetzt. Der Fußraum des lädierten Hyundais sei mit auseinandergerissenen Pappschachteln ausgelegt gewesen, womöglich in Erwartung der Regenzeit, als Schutz vor dem Schlamm. Sie hätten den Ort in südlicher Richtung verlassen, einen breiten Fluss auf einer Bogenbrücke überquert. Zu ihrer Rechten dann die Umrisse einer Kirche, ausrangierte Eisenbahnwagen, das schmale, von einem einzigen Scheinwerfer beleuchtete Rollfeld eines Flugplatzes. United Fruit Company, habe der Fahrer gesagt und mit dem Daumen aus dem Fenster gewiesen. Mamita Yunai.
Sie hätten in diesem Moment ein Gebiet passiert, das sie später auf alten Plänen als zona blanca oder zona americana ausgewiesen gesehen habe. Dort hätten einst die Manager der United-Fruit-Plantagen gelebt, gringos in geräumigen, weißgestrichenen Häusern mit großzügigen, gepflegten Gärten, campos de golf, piscinas, pistas de tenis. Der Mann am Steuer habe sich mit den Fingern über den Hals gestrichen, als schlitzte er sich die Kehle auf: In den Achtzigerjahren hätten die Amerikaner die Plantagen aufgegeben, die Fincas, ihre Häuser und überhaupt das ganze Gebiet verlassen.
Irgendwann, sagt sie, habe das Taxi an jenem Abend eine Art Allee, eine palmengesäumte Straße erreicht, der sie dann lange Zeit gefolgt seien. Im bläulichen Licht des Armaturenbretts habe sie den Schweiß an der Schläfe und am Nacken des Fahrers sehen können. Ihre Frage, ob man hier gut lebe, habe er ohne zu zögern verneint: Die Hitze sei unerträglich, kaum auszuhalten. Eine unglückliche Fügung habe ihn, der eigentlich aus der Hauptstadt stamme, in diese gottverlassene Gegend geführt, und er könne nicht zurück, er habe nichts, nicht einmal dieses Auto gehöre ihm. Ihr Spanisch, sagt sie, sei dürftig, sie könne sich gerade so durchschlagen damit — der Litanei des Fahrers habe sie nur mit Mühe folgen können. Wiederholt habe er über die Hitze geklagt, qué calor, und sein Leben und das große Missgeschick verwünscht, das ihn hierhergeführt habe und wie ein Fluch auf ihm laste. Eine Weile lang hätten sie geschwiegen. Zwei Radfahrer mit Gummistiefeln seien wie aus dem Nichts vor ihnen auf der dunklen Landstraße aufgetaucht. Kurz bevor sie ihr Ziel erreicht hätten, die letzte Siedlung, die dort auf dem Landweg erreicht werden könne, sagt sie, habe der Mann mit einem Blick in den Rückspiegel gefragt, ob sie, wenn sie Schriftstellerin sei, an Gott glaube, an Karma, crees en Dios, en el karma, und erst später habe sie die Tragweite dieses Moments verstanden, habe sie verstanden, wie dramatisch seine Frage gewesen sei, die er, wie sie heute denke, damals vielleicht zum ersten Mal und dann nie wieder ausgesprochen habe.
Noch am selben Abend habe sie ihre Unterkunft verlassen und sei in Richtung des Landungsplatzes gegangen. Eine seltsame Verlassenheit habe die Siedlung beherrscht, die von Fremden nur aufgesucht werde, weil sie das Portal zu jenem immensen Feuchtgebiet bilde, das sich von dort aus in westlicher Richtung ausdehne. Unterwegs habe sie einen einzigen Menschen erblickt, einen barbäuchigen Weißen, der mit einer Bierflasche in der Hand vor einer Hütte am Flussufer gestanden habe. Scheppernde Musik, eine Art Schlager. Zwei Hunde hätten im Licht der Außenbeleuchtung im trockenen Gras gelegen. Beim Landungsplatz habe sie in einem zu allen Seiten offenen und beinahe leeren Lokal ein Gericht gegessen, dessen Name ihr die Kellnerin als verheirateter Mann übersetzt habe. Glänzende, tintenschwarze Bohnen, Reis, Kochbananen und Hühnchen. Vor ihr der Fluss, der sich als graues Band durch die Dunkelheit gewunden habe. Die Kellnerin, eine sehr junge Frau, habe lange am Geländer gestanden und hinausgeschaut, als wäre dort, weit draußen, etwas zu sehen. Irgendwann dann sei der Regen gekommen, brachialer Regen, der ohne jede Vorankündigung auf das Wellblechdach gestürzt sei, und eine plötzliche Furcht vor dem Rückweg habe sie ergriffen. Zu Fuß sei sie der Landstraße gefolgt, die Nachtschwärze nur durchbrochen vom blassen Neonlicht, das aus den wenigen Häusern am Straßenrand gequollen sei. Das Plärren der Fernseher. Palmen. Gespensterhafte Kühe hätten reglos auf den Feldern gestanden.
Sie hebt den Kopf und blickt in die Ränge des Auditoriums. Insgesamt, sagt sie, sei sie während dieser Reise zwischen den Wendekreisen immer wieder zu einer Feststellung zurückgekehrt, die sich bei Merleau-Ponty finde: Es sei »dem Sichtbaren eigentümlich«, schreibe dieser, »im strengsten Sinne des Wortes durch ein Unsichtbares gedoppelt zu sein, das es als ein gewissermaßen Abwesendes gegenwärtig macht«.
Am nächsten Tag, sagt sie, sei sie in eines der Motorboote gestiegen, die an der Anlegestelle gewartet hätten. Sie habe den Kapitän, der eine blaue Sturmhaube mit kleinen Öffnungen für die Augen getragen habe, mit amerikanischen Dollar bezahlt, und kurz nach zehn Uhr sei das Boot in das weitverzweigte Delta aufgebrochen, beladen mit Kanistern und Vorräten für die abgelegenen Siedlungen, die vereinzelten Häuser, die auf dem Landweg schwer zu erreichen seien. Es hätten sich nur wenige Leute an Bord befunden, eine Handvoll Urlaubsgäste — amerikanische Ehepaare mit Sonnenhüten, Feldstechern und großen Objektiven, ein Deutscher aus Meckenbeuren am Bodensee, Sohn eines Apfelbauers, der 1985, wie er den beiden Französinnen neben ihm erklärt habe, nach Venezuela ausgewandert sei — und einige Einheimische mit Kindern und leichtem Gepäck, Plastiktüten gefüllt mit Empanadas und Fantaflaschen. Denke sie nun an die Fahrt zurück, sagt sie, dann erinnere sie sich an Sumpfwälder, Mangroven, die den grauen, schlammigen Fluss gesäumt hätten. Belaubte Äste, ja ganze Bäume seien auf dem Wasser getrieben, und vom offenen Meer her seien ihnen schwarze, großgeflügelte Vögel entgegengekommen. Unterwegs sei ihr, sagt sie, ganz aus dem Nichts ein Satz aus Bernhards Zimmerer zugefallen, ein Satz den der eben aus der Strafanstalt entlassene Zimmerer Winkler, der ohne Obdach sei und deshalb nächtelang durch die Wälder gehe, zu seinem Anwalt sage: In manchen Wäldern sei Wärme, in anderen nicht. Und später, Tage später, sei ein zweiter Satz dazugekommen, angestoßen vielleicht von diesem ersten, ein Satz, der den Zimmerer aus der Sicht seiner Schwester beschreibe, die von ihm, Winkler, ihr Leben lang bedroht und misshandelt worden sei: »Oft wäre er tagelang zu Hause in der gutmütigsten Stimmung gewesen, dann aber blitzartig zu dem Tier geworden, als das er ihr oft in der Nacht erscheine.«
Seit dem Beginn ihrer Reise, sagt sie, habe sie damals eine Art Gefahr wahrzunehmen gemeint, ein Unbehagen, das sie in Wogen überspült habe, aber es sei ihr zu jener Zeit nicht möglich gewesen zu sagen, ob dieses Gefühl von der sie umgebenden Landschaft und ihrem Klima ausgegangen sei, eine Art meteorologische Störung oder Spannung, ob es die bevorstehende Arbeit, das Vorhaben des Theatermachers gewesen sei, das sie beunruhigt habe, oder ob ihre Unruhe die der Dislozierten, der irgendwie Desorientierten gewesen sei, die sich plötzlich in veränderter Umgebung wiedergefunden habe. Erst im Nachhinein, Wochen später, habe sie zu verstehen gemeint, dass ihre Beunruhigung womöglich mit den aufgelassenen Plantagen, den verfallenen Fincas zu tun gehabt habe, den ellenlangen, nun verwaisten Straßen, die die United Fruit Company beinahe hundert Jahre zuvor wie ein Gitter durch das ehemalige Waldgebiet gezogen habe. Sie sei jedenfalls schweigend mitgefahren, schweigend und schauend, alles registrierend, schließlich habe der Theatermacher dies, die Mitschrift, das Protokoll aller Dinge, als ihre Aufgabe beschrieben — vorausgesetzt, sie habe ihn im Januar, als sie mit blinkenden Lichtern am Straßenrand gestanden habe, richtig verstanden —, und irgendwann habe sich der Fluss, den die Einheimischen die Schlange genannt hätten, weit und weiter geöffnet, und das Motorboot sei in einem weiten Bogen in den lichtblauen Ozean hinausgeschnellt.
Erst als das Gefährt sich über die zerklüftete Oberfläche des Pazifiks bewegt habe, stets aufs Neue aus den Wellentälern emporgeschossen und kurze Zeit später jäh wieder abgestürzt, aus großer Höhe in die Tiefe gefallen sei, sodass sich die Leute an den schmalen, harten Bänken hätten festklammern müssen — erst dann, sagt sie, sei sie ins Gespräch mit der sehr jungen, offensichtlich allein reisenden Frau neben ihr gekommen, die, wie sich bald herausgestellt habe, aus einer nordöstlichen Talschaft im Schweizer Voralpengebiet gekommen sei.
Auch diese Frau, sagt sie, habe der Theatermacher für sein Stück engagiert. Ihre Aufgabe, so habe sie in der Folge erklärt, sei es, eine der Holländerinnen darzustellen, um die sich das Vorhaben, das auf allen Dokumenten mit dem Arbeitstitel Die Holländerinnen ausgewiesen gewesen sei, in seinem Kern ja gedreht habe, aber als sie die Schweizerin über den Lärm des Motors hinweg gefragt habe, ob sie also Schauspielerin sei, habe die Schweizerin verneint und gelacht, sie sei, wenn man so wolle, das Gegenteil einer Schauspielerin, zumindest liege ihr nichts ferner, als sich auf eine Bühne zu stellen, davor graue ihr in höchstem Maße, und ehrlich gesagt graue ihr auch vor den Leuten, die das Bedürfnis verspürten, sich auf diese Weise hin- und auszustellen, sich für alle sichtbar beleuchten zu lassen. Dies habe sie auch dem Theatermacher gesagt, als er mit seiner Anfrage an sie herangetreten sei, aber er habe sich nicht beirren lassen; er selbst, so habe er erklärt, sei nicht interessiert an dieser Form des Schauspiels, es gehe ihm, wenn überhaupt, um eine ganz andere Art der Verkörperung, und er brauche sie so gesehen nicht als Darstellerin einer anderen, sondern als diejenige, die sie sei, mit ihrem ganz spezifischen Wissen, ihrer spezifischen Herkunft, ihrer ganz eigenen Erfahrung als Frau, als Europäerin, als angehender Agronomin und so weiter. Er selbst verstehe sich als Materialist, seine Herangehensweise, so habe er es zumindest immer sehen wollen, sei geprägt von der Überzeugung, dass es das Ich nicht gebe, sondern nur Beziehungen, in denen so etwas wie ein Ich auftrete. Sie werde sich, habe er zu ihr gesagt, im Laufe der Arbeit also verdoppeln, ja vervielfachen, es würden, im besten Falle, andere, verschüttete Teile ihrer selbst zum Vorschein kommen, aber sie müsse nicht befürchten, dass man sie auffordern werde, zu spielen.
Die junge Frau, sagt sie, sei verstummt, als das Boot erneut hinabgeschossen und so hart aufgeprallt sei, dass ein gedrungener Mann auf der Bank hinter ihnen mit hoher Stimme aufgeschrien habe. Es seien unterdessen alle anderen Passagiere und Passagierinnen an Land gegangen, und nebst dem Kapitän und seinem Gehilfen hätten nur noch sie drei sich an Bord befunden; auch der größte Teil der Ladung sei von den jungen Männern, die das Boot an den Stränden unterwegs erwartet hätten, abgeholt und davongetragen worden. Nach einer Weile habe die Schweizerin wieder zu sprechen begonnen und gesagt, der eigentliche Grund dafür, dass der Theatermacher sich ausgerechnet für sie interessiere, sei aber, zumindest vermute sie dies, die sogenannte Ziegengeschichte, die ihm auf irgendwelchen Wegen zu Ohren gekommen sein müsse. Auch wenn es ihr bisher nicht gelungen sei, den genauen Zusammenhang dieser Geschichte mit dem Projekt des Theatermachers herzustellen, so sei sie doch sehr sicher, dass es diese Anekdote sei, die ihn auf sie aufmerksam gemacht habe, und tatsächlich sei er bei ihrem letzten Telefonat darauf zu sprechen gekommen und habe gefragt, ob sie unter Umständen bereit wäre, die Geschichte von den Ziegen, die ihm sein Dramaturg kürzlich geschildert habe, vor Ort noch einmal zu erzählen und sie so in das Stück einzufügen. Bevor sie die Schweizerin nach den Einzelheiten dieser Geschichte habe befragen können, sagt sie, habe der Kapitän das Boot gewendet und es auf einen dicht bewaldeten, rauen Abschnitt der Küste zutreiben lassen, der abgesehen von den Bäumen und Sträuchern, den alles überragenden Palmen, absolut leer gewesen sei. Mit einer Kopfbewegung habe er sie aufgefordert, das Boot zu verlassen, und also seien sie nacheinander ins hüfthohe Wasser gestiegen, erst die Schweizerin und dann sie selbst. Man habe ihnen ihr Gepäck gereicht, das sie vor der Brust getragen hätten. Betrunkenen gleich seien sie durch die Brandung dem Ufer entgegengetaumelt. Über ihnen habe sich der Himmel plötzlich zugezogen.
Lange seien sie dann einem Weg gefolgt, den ihnen die Assistentin des Theatermachers in ihren Reiseunterlagen beschrieben habe, eine Art Trampelpfad, der an manchen Stellen fast ganz zugewachsen, von Rinnsalen, von dunklem Morast unterbrochen gewesen sei. Über ihnen habe eine Zeit lang ein Vogel geschrien, es müsse ein großes Tier gewesen sein, das ihr aber verborgen geblieben sei. Die junge Schweizerin sei vorausgegangen, habe sich ab und zu umgedreht, ihr freundlich zugelächelt, und noch bevor sie das Gespräch wieder in Richtung der Ziegengeschichte habe lenken können, habe sich die junge Frau ihrerseits erkundigt, wer sie sei und was sie hierherführe, und sie habe daraufhin gesagt, was sie immer sage, wenn man sie nach ihrem Beruf frage, sie habe ihr dieselbe ganz und gar nichtssagende Beschreibung ihres Schaffens gegeben, die sie immer gebe, um nach Möglichkeit keine weiteren Fragen zu provozieren. Die Schweizerin habe aber dennoch gleich wissen wollen, wie die Titel ihrer Bücher lauteten, wie lange sie an diesen Büchern Handgelenk mal Pi gearbeitet habe und ob sie auch vertraut sei mit der Schweizer Literatur, was sie bejaht habe: Sie schätze vor allem Walser und Jaeggy, auch Johansens Trocadero, das sie für ein großartiges Werk halte. Um das Thema zu wechseln, sei sie dann wieder zum Theatermacher zurückgekehrt und habe gesagt, dass sie diesen zwar kenne, dass ihr sein Name durchaus ein Begriff gewesen sei, als er sie damals im Januar so überraschend angerufen habe, dass sie ihm aber bis heute nicht persönlich begegnet sei. Wenn sie ihn richtig verstehe, so habe sie der Schweizerin erklärt, dann sei es ihre Aufgabe, als Protokollantin eine Mitschrift der kommenden Tage anzufertigen, eine Mitschrift, die im Grunde alles enthalte, ALLES, in Großbuchstaben, und aus dieser Mitschrift dann einen Text, eine Art Drehbuch zu schaffen, worauf die Schweizerin gefragt habe, ob es ihr denn nicht unangenehm sei, sich als Autorin, als Künstlerin, auf diese Weise in den Dienst eines anderen zu stellen und ihre Sprache als Material oder Hilfsmittel für das Werk des Theatermachers herzugeben. Ganz im Gegenteil, habe sie erwidert und erzählt, dass sie im Jahr zuvor die Arbeit vieler Jahre, eine Geschichte des Auges oder der Blindheit,