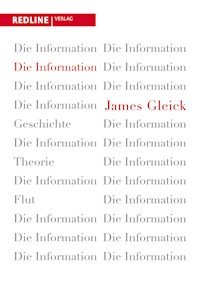
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Blut, Treibstoff, Lebensprinzip - in seinem furiosen Buch erzählt Bestsellerautor James Gleick, wie die Information zum Kernstück unserer heutigen Zivilisation wurde. Beginnend bei den Wörtern, den "sprechenden" Trommeln in Afrika, über das Morsealphabet und bis hin zur Internetrevolution beleuchtet er, wie die Übermittlung von Informationen die Gesellschaften prägten und veränderten. Gleick erläutert die Theorien, die sich mit dem Codieren und Decodieren, der Übermittlung von Inhalten und dem Verbreiten der Myriaden von Botschaften beschäftigen. Er stellt die bekannten und unbekannten Pioniere der Informationsgesellschaft vor: Claude Shannon, Norbert Wiener, Ada Byron, Alan Turing und andere. Er bietet dem Leser neue Einblicke in die Mechanismen des Informationsaustausches. So lernt dieser etwa die sich selbst replizierende Meme kennen, die "DNA" der Informationen. Sein Buch ermöglicht ein neues Verständnis von Musik, Quantenmechanik - und eine gänzlich neue Sicht auf die faszinierende Welt der Informationen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 893
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
James Gleick
Die Information
Geschichte, Theorie, Flut
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Almuth Braun
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:[email protected]
© 2011 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH Nymphenburger Straße 86 D-80636 München Tel.: 089 651285-0 Fax: 089 652096
© der Originalausgabe 2011 by James Gleick.
Die englische Originalausgabe erschien 2011 bei Pantheon unter dem Titel The Information.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Almuth Braun Redaktion: Matthias Michel, Wiesbaden Satz: Grafikstudio Foerster, Belgern eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-86414-225-3
Weitere Infos zum Thema
www.redline-verlag.de
Für Cynthia
»Jedenfalls gaben diese Fahrscheine, die alten, keinen Aufschluss darüber, wohin man fuhr, geschweige, woher man kam. Er konnte sich auch nicht daran erinnern, auf irgendeinem davon ein Datum entdeckt zu haben, und ganz gewiss war keine Uhrzeit vermerkt. Heute war natürlich alles anders. All diese Information. Archie fragte sich, warum das so war.«
Zadie Smith
»Was wir als Vergangenheit bezeichnen, ist auf Bits aufgebaut.«
John Archibald Wheeler
Vorwort
»Das grundlegende Problem der Kommunikation besteht darin, eine Nachricht, die an einem Punkt ausgewählt wurde, an einem anderen Punkt exakt oder annähernd exakt wiederzugeben. Häufig besitzen die Nachrichten eine Bedeutung.«
Claude Shannon (1948)
Nach 1948, dem entscheidenden Jahr, war allgemein die Auffassung verbreitet, man könne den klaren Zweck erkennen, der Claude Shannons Arbeit inspiriert hatte, doch dabei handelte es sich um eine nachträgliche Sichtweise. Er betrachtete es anders: Meine Gedanken wandern umher, und ich denke Tag und Nacht an völlig verschiedene Dinge. Wie ein Science-Fiction-Autor denke ich: »Was wäre, wenn es so und so wäre?«1› Hinweis
Wie es das Schicksal wollte, verkündete Bell Telephone Laboratories im Jahr 1948 die Erfindung eines kleinen elektronischen Halbleiters, »eines erstaunlich simplen Gerätes», das all das konnte, was eine Vakuumröhre konnte, aber effizienter. Es war ein kristalliner Splitter – so klein, dass hundert von ihnen in einer Handfläche Platz fanden. Im Mai bildeten Wissenschaftler ein Komitee, um dieser Erfindung einen Namen zu geben, und gaben Papierstimmzettel aus an erfahrene Ingenieure in Murray Hill, New Jersey, auf denen sie einige mögliche Namen notiert hatten: Halbleitertriode … Iotatron … Transistor (ein Hybrid aus varistor und transconductance). Transistor setzte sich schließlich durch. »Er wird möglicherweise weitreichende Bedeutung in der Elektronik und der elektrischen Kommunikation haben«, erklärte Bell Labs in einer Pressemitteilung, und in diesem Fall übertraf die Realität die aufgeregten, erwartungsvollen Ankündigungen bei Weitem. Der Transistor löste eine Revolution in der Elektronik aus, indem er die Technologie auf den Kurs der Miniaturisierung und Allgegenwärtigkeit setzte, und brachte seinen drei hauptverantwortlichen Erfindern bald darauf den Nobelpreis ein. Für Bell Labs war der Transistor ein Kronjuwel. Dennoch war er nur die zweitwichtigste Erfindung des Jahres; der Transistor war nur die Hardware.
Eine noch tiefgreifendere und grundlegendere Innovation wurde in Form einer 79-seitigen Einzeldarstellung in der Zeitschrift The Bell System Technical Journal im Juli und Oktober bekannt gemacht. Niemand machte sich die Mühe, eine Pressemitteilung zu verfassen. Diese Abhandlung trug einen einfachen und zugleich hochtrabenden Titel: »A Mathematical Theory of Communication« (»Eine mathematische Theorie der Kommunikation«), deren Botschaft sich nur schwer zusammenfassen ließ. Aber sie war ein Angelpunkt, um den sich die Welt zu drehen begann. Wie der Transistor beinhaltete auch diese Entwicklung eine neue Wortschöpfung: das Wort Bit (aus binary und digit), das in diesem Fall nicht von einem Komitee, sondern alleine vom Autor – einem 32-jährigen Mann namens Claude Shannon – gewählt wurde.2› Hinweis Das Bit wurde zu einer grundlegenden neuen Maßeinheit, wie der Inch oder der Zentimeter, das Pfund, das Quart und die Minute. Aber um was zu messen? »Eine Einheit zur Messung der Kommunikation«, schrieb Shannon, als ob es so etwas wie mess- und quantifizierbare Information gäbe.
Dem Vernehmen nach gehörte Shannon zum mathematischen Forschungsteam von Bell Labs, aber blieb meistens für sich.3› Hinweis Als die Gruppe aus der Konzernzentrale in New York auszog, um in ein elegantes, neues Gebäude in einem Vorort von New Jersey zu wechseln, ging er nicht mit, sondern verschanzte sich in einem Kabuff in dem alten Gebäude, einem zwölfstöckigen Sandsteinkasten in der West Street, dessen Rückseite dem Hudson River zugewandt war und dessen Frontseite an Greenwich Village stieß. Shannon hasste es zu pendeln; ihm gefiel das Stadtzentrum, in dem er in den Nachtbars Jazzklarinettisten lauschen konnte. Er flirtete schüchtern mit einer jungen Frau, die in Bell Labs’ Mikrowellenforschungsteam in der ehemaligen zweistöckigen Nabisco-Fabrik auf der anderen Straßenseite arbeitete. Shannon galt als intelligenter junger Mann. Als frischgebackener Absolvent des Massachusetts Institute of Technology (MIT), hatte er sich in die Kriegsarbeit des Labors gestürzt, wo er zunächst ein automatisches Feuerkontrollgerät für Flakgeschütze entwickelte und sich anschließend auf die theoretischen Untermauerungen der geheimen Kommunikation – der Kryptographie – konzentrierte und eine mathematischenn Sicherheitsbeweis für das sogenannte X-System austüftelte, den heißen Draht zwischen Winston Churchill und US-Präsident Roosevelt. Seine Vorgesetzten waren nun bereit, ihn in Ruhe zu lassen, auch wenn sie nicht genau verstanden, woran er eigentlich arbeitete.
Zur Jahrhundertmitte erwartete AT&T noch keine sofortige Erfüllung von seiner Forschungsabteilung. Der Konzern erlaubte Ausflüge in die Mathematik oder Astrophysik, die keinen erkennbaren kommerziellen Zweck zu haben schienen. In jedem Fall hatte ein großer Teil der modernen Wissenschaft direkt oder indirekt mit der Unternehmensmission zu tun, die gewaltig, monopolistisch und beinahe allumfassend war. Dennoch blieb die Kernkompetenz des Telefonunternehmens verschwommen. Im Jahr 1948 rauschten mehr als 125 Millionen Gespräche täglich durch die 138 Millionen Kabel und 31 Millionen Telefongeräte von Bell. Das US-Bureau of the Census berichtete diese Fakten unter der Überschrift »Kommunikation in den Vereinigten Staaten«, aber dabei handelte es sich um sehr grobe Maßstäbe der Kommunikation. Zudem zählte die Behörde mehrere Tausend Radiosendestationen und einige Dutzend Fernsehstationen, zusammen mit Zeitungen, Büchern, Broschüren und der Post.4› Hinweis Die Post zählte ihre Briefe und Pakete, aber was genau transportierte Bell System, und in welchen Einheiten wurde das erfasst? Gewiss keine Gespräche, Wörter oder Zeichen. Vielleicht einfach nur Elektrizität. Die Ingenieure des Unternehmens waren Elektroingenieure. Jeder wusste, dass Elektrizität als Ersatz für Geräusche diente – das Geräusch der menschlichen Stimme, indem Wellen in der Luft in die Sprechmuschel des Telefonhörers eindringen und in elektrische Wellen verwandelt werden. Diese Umwandlung war die Quintessenz des Vorteils des Telefons gegenüber dem Telegrafen – der Vorgängertechnologie, die bereits so wunderlich und kurios erschien. Die Telegrafie stützte sich auf eine andere Form der Umwandlung: einen Code aus Punkten und Strichen, der nicht auf Tönen und Klängen basierte, sondern auf dem geschriebenen Alphabet, das schließlich selbst ein Chiffresystem darstellte. Bei näherer Betrachtung ließ sich eine Kette an Abstraktionen und Umwandlungen erkennen: Die Punkte und Striche standen für Buchstaben des Alphabets; die Buchstaben stellten Klänge dar und bildeten in Kombination Wörter; und Wörter repräsentierten ein ultimatives Trägermaterial für Bedeutung, die vielleicht am besten den Philosophen überlassen wird.
Bell System hatte zwar keine Philosophen, aber seit 1897 seinen ersten Mathematiker: George Campbell aus Minnesota, der in Göttingen und Wien studiert hatte. Er machte sich sofort an die Lösung eines Problems der frühen Telefonübertragung: Die Signale wurden während der Übertragung über die Stromkreise verzerrt, und je größer die Entfernung, desto größer die Verzerrung. Campbells Lösung war zum Teil mathematisch und zum Teil elektrotechnisch.5› Hinweis Seine Vorgesetzten gewöhnten sich an, sich keine Gedanken über den Unterschied zu machen. Als Student konnte sich Shannon selbst nie wirklich entscheiden, ob er Ingenieur oder Mathematiker werden sollte. Für Bell Labs war er mehr oder weniger freiwillig beides – praktisch, was Schaltkreise und Relais anging, aber überglücklich, wenn er sich mit symbolischen Abstraktionen beschäftigen konnte. Die meisten Kommunikationsingenieure konzentrierten ihr Fachwissen auf physische Probleme, Verstärkung und Regulierung, Phasenverzerrung und das Signal-Rausch-Verhältnis. Shannon liebte Spiele und Rätsel. Geheimcodes faszinierten ihn seit er als Junge Edgar Allan Poe gelesen hatte. Er führte die Fäden zusammen wie ein fanatischer Sammler. In seinem ersten Jahr als Forschungsassistent am MIT arbeitete er an einem hundert Tonnen schweren Computer-Prototypen, dem Vannevar Bush Differential Analyzer, der mit großen rotierenden Getrieben, Wellen und Räderwerken Gleichungen lösen konnte. Mit 22 Jahren verfasste er eine Dissertation, die eine Idee des 19. Jahrhunderts – George Booles Algebra der Logik – auf das Design von elektrischen Schaltkreisen anwendete. (Logik und Elektrizität – eine merkwürdige Kombination.) Später arbeitete er mit dem Mathematiker und Logiker Hermann Weyl zusammen, der ihm beibrachte, was eine Theorie ausmachte: »Theorien erlauben dem Bewusstsein, ›über seinen eigenen Schatten zu springen‹ und die gegebenen Fakten hinter sich zu lassen, um das Transzendente zu repräsentieren, wenn auch nur, wie sich von alleine versteht, in Symbolen.«6› Hinweis
Im Jahr 1943 besuchte der Mathematiker und Krypotanalytiker Alan Turing die Bell Labs im Rahmen einer kryptographischen Mission, und traf sich mit Shannon zum Mittagessen, bei dem sie Spekulationen über die Zukunft von künstlichen Denkmaschinen austauschten. (»Shannon will ein künstliches Gehirn nicht nur mit Daten füttern, sondern mit kulturellen Dingen!«, rief Turing. »Er will ihm Musik vorspielen!«7› Hinweis ) Außerdem lief Shannon Norbert Wiener über den Weg, der ihn am MIT unterrichtet hatte und 1948 dabei war, eine neue Disziplin namens »Kybernetik« vorzuschlagen, die sich mit dem Studium der Kommunikation und Kontrolle befassen sollte. Währenddessen begann sich Shannon aus einem ganz bestimmten Blickwinkel mit Fernsehsignalen zu beschäftigen: Er fragte sich, ob sich ihr Inhalt auf irgendeine Weise komprimieren ließ, um die Signalübertragung zu beschleunigen. Logik und Schaltkreise vermischten sich, um etwas Neues, Hybrides hervorzubringen. Das Gleiche taten Codes und Gene. Auf der Suche nach einem System zur Verbindung der zahlreichen Fäden, mit denen er jonglierte, fing Shannon in seiner eigenbrötlerischen Art an, eine Informationstheorie zu entwickeln.
Das Rohmaterial war im frühen 20. Jahrhundert überall und reichlich vorhanden: Buchstaben und Botschaften, Bilder und Klänge, Nachrichten und Anleitungen, Zahlen und Fakten, Signale und Zeichen – ein Sammelsurium an verwandten Spezies. Per Post oder elektromagnetischen Wellen bewegten sie sich von einem Ort zum anderen. Allerdings existierte kein Sammelbegriff, unter dem sich all das hätte zusammenfassen lassen. »Immer wieder«, so schrieb Shannon im Jahr 1939 an Vannevar Bush, »arbeite ich an einer Analyse einiger der grundlegenden Eigenschaften allgemeiner Systeme für die Übertragung von Informationen (»intelligence«8› Hinweis ). Intelligence: ein flexibler und sehr alter Begriff. »Heute als elegantes Wort verwendet«, notierte Sir Thomas Elyot im 16. Jahrhundert, »für gegenseitige Übereinkommen und Verabredungen in Form von Briefen oder Botschaften.«9› Hinweis Dieser Begriff hatte aber noch andere Bedeutungen angenommen, etwa »Intelligenz« als Bezeichnung für die kognitive Leistungsfähigkeit. Einige Ingenieure, vor allem in den Labors der Telefonunternehmen, hatten begonnen, von Informationen zu sprechen. Sie verwendeten diesen Begriff auf eine Weise, der etwas Technisches an sich hatte: die Menge an Information oder Messeinheit der Information. Shannon übernahm diesen Sprachgebrauch.
Für wissenschaftliche Zwecke musste der Begriff Information eine spezielle Bedeutung annehmen. Drei Jahrhunderte zuvor konnte die neue Disziplin der Physik nicht fortschreiten, bis Isaac Newton alte Begriffe mit einer vagen, unbestimmten Bedeutung – Kraft, Masse, Bewegung und Zeit – verwendete und ihnen eine neue Bedeutung verlieh. Newton verwandelte sie in quantitative Maßeinheiten, die sich in mathematischen Formeln verwenden ließen. Bis dahin war zum Beispiel das Wort Bewegung ein ebenso weicher und undeutlicher Begriff wie Information gewesen. Für Aristoteliker umfasste das Wort Bewegung eine weitreichende Familie an Phänomenen: ein reifender Pfirsich, ein fallender Stein, ein heranwachsendes Kind, ein Körper im Verfall. Dieses Bedeutungsspektrum war zu breit gefasst. Die meisten Bedeutungsspielarten des Wortes Bewegung mussten eliminiert werden, bevor sich Newtons Gesetze anwenden ließen und sich die wissenschaftliche Revolution durchsetzen konnte. Im 19. Jahrhundert begann das Wort Energie die gleiche Transformation zu durchlaufen: Die Naturphilosophen passten ein Wort an, das Kraft beziehungsweise Intensität bedeutete. Sie mathematisierten den Begriff Energie und gaben der Energie ihren grundlegenden Platz in der Sichtweise der Physiker über die Natur.
Das Gleiche geschah mit dem Begriff Information. Der Begriff musste bereinigt werden. Nachdem der Begriff vereinfacht, auf das Wesentliche reduziert und in Bits gezählt wurde, stellten die Menschen fest, dass Information überall zu finden war. Shannons Theorie bildete die Brücke zwischen Information und Chaos. Sie führte zu CDs und Faxgeräten, Computern und dem Cyberspace, Moores Gesetz und allen Silicon Valleys dieser Welt. Datenverarbeitung, Datenspeicherung und Datenwiedergewinnung waren geboren. Die Menschen begannen nach einem Begriff für das Zeitalter zu suchen, das auf die Eisenzeit und das Zeitalter der Dampfmaschine folgte. »Der Mensch als Nahrungssammler wird auf inkongruente Weise zum Informationssammler«, bemerkte Marshall McLuhan im Jahr 1967.1› Hinweis Das schrieb er einen Augenblick zu früh, nämlich in der ersten Dämmerung der Computertechnik und des Cyberspace.10› Hinweis
Heute können wir erkennen, dass Informationen unsere Welt antreiben: Sie sind das Blut und der Treibstoff, das Vitalprinzip des Lebens. Sie durchdringen die Wissenschaften von der untersten bis zur höchsten Ebene und transformieren jeden Wissenszweig. Die Informationstheorie begann als Brücke zwischen der Mathematik und der Elektrotechnik und erstreckte sich von dort bis zur Computertechnik. Was englischsprachige Menschen als computer science, »Computerwissenschaften«, bezeichnen, kennt man im sonstigen Europa unter dem Begriff Informatique, Informatica und Informatik. Selbst die Biologie ist inzwischen eine Informationswissenschaft, ein Fach der Botschaften, Anleitungen und Schlüssel. Gene enthalten eingeschlossene Informationen und ermöglichen Verfahren, diese einzulesen und auszulesen. Das Leben breitet sich über Netzwerke aus. Der Körper selbst ist ein Organismus der Informationsverarbeitung. Nicht nur das Gehirn, sondern jede einzelne Körperzelle stellt einen Informationsspeicher dar. Kein Wunder, dass die Genetik neben der Informationstheorie floriert. Die DNS ist das grundlegende Informationsmolekül, der am höchsten entwickelte Verarbeitungsmechanismus auf Zellebene – ein Alphabet und ein Code, 6 Milliarden Bits, die den Menschen ausmachen. »Im Kern eines jedes Lebewesens befindet sich nicht das Feuer, nicht der warme Atem und kein ›Lebensfunke‹«, führt der Evolutionstheoretiker Richard Dawkins aus, »sondern Informationen, Wörter, Anleitungen … Wenn Sie das Leben verstehen wollen, betrachten Sie Informationen nicht als vibrierende, pulsierende Gele und Schlämme, sondern als Informationstechnologie.«11› Hinweis Die Zellen eines Organismus sind Knoten in einem üppigen, ineinander verflochtenen Kommunikationsnetzwerk, das ständig Signale überträgt und empfängt, verschlüsselt und entschlüsselt. Die Evolution selbst ist ein ständiger Informationsaustausch zwischen dem Organismus und seiner Umgebung.
»Der Informationskreislauf wird zur Einheit des Lebens«, erklärt Werner Loewenstein, nachdem er 30 Jahre mit dem Studium von interzellulärer Kommunikation verbracht hat.12› Hinweis Er erinnert uns daran, dass der Begriff Information heute eine tiefere Bedeutung besitzt: »Er hat die Konnotation eines kosmischen Organisations- und Ordnungsprinzips und bietet dafür eine exakte Messgröße.« Das Gen hat auch eine kulturelle Analogie: das Mem. In der kulturellen Evolution ist ein Mem ein Replikator und ein Propagator – eine Idee, eine Mode, ein Kettenbrief oder eine konspirative Theorie. Um es negativ auszudrücken, könnte man sagen, dass ein Mem ein Virus ist.
Die Wirtschaft selbst betrachtet sich inzwischen als Informationswissenschaft, da das Geld einen Entwicklungsbogen von einem greifbaren, sächlichen Ding zu Bits vollzieht, die in einem Computerspeicher und auf Magnetstreifen abgespeichert sind, und die Weltfinanzen durch ein globales Nervensystem strömen. Wenngleich Geld stets ein materieller Schatz zu sein schien, der schwer in den Taschen, Schiffsbäuchen und Banktresoren wog, war es immer auch Information. Münzen und Banknoten, Schekel und Muschelgeld waren allesamt lediglich kurzlebige Technologien zur Verwandlung der Information über Besitzverhältnisse in Wertmarken.
Und Atome? Materie hat ihre eigene Prägung, und die härteste aller Wissenschaften, die Physik, schien ihren Reifegrad erreicht zu haben. Doch auch die Physik wird nun von einem neuen intellektuellen Modell verdrängt. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, der großen Zeit der Physiker, schien die überragende Nachricht in der Physik die Kernspaltung und die Beherrschung der Nuklearenergie zu sein. Die Theoretiker fokussierten ihr Prestige und ihre Ressourcen auf die Suche nach Elementarteilchen und die Gesetze, die ihre Interaktion bestimmen, die Konstruktion gigantischer Beschleuniger und die Entdeckung von Quarks und Gluonen. Von diesen exaltierten Vorhaben hätte die Kommunikationsforschung nicht weiter entfernt erscheinen können. Bei Bell Labs dachte Claude Shannon nicht an die Physik; Teilchenphysiker brauchten keine Bits.
Und dann brauchten sie sie auf einmal doch; die Verschmelzung von Physik und Informationstheorie schreitet voran. Ein Bit ist ein Elementarteilchen einer anderen Art: nicht nur winzig klein, sondern abstrakt, eine binäre Zahl, eine Kippschaltung, ein Ja-oder-Nein. Es ist unwirklich, substanzlos; aber als Wissenschaftler Informationen schließlich begreifen, fragen sie sich, ob sie vielleicht etwas Primäres sein könnte: elementarer als die Materie selbst. Sie vertreten die These, ein Bit sei der nicht weiter reduzierbare Kern, und die Information bilde den Kern der eigentlichen Existenz. In einem Brückenschlag zwischen der Physik des 20. und des 21. Jahrhunderts fasste John Archibald Wheeler, der letzte Physiker, der mit Einstein und Bohr zusammengearbeitet hatte, dieses Programm in orakelhafte Einsilbler: »It from Bit« – »Materie aus Bits«. Informationen lassen »jedes Es – jedes Elementarteilchen, jedes Kraftfeld und selbst das Raum-Zeit-Kontinuum selbst entstehen«.13› Hinweis Das ist eine andere Weise, das Beobachterparadox zu ergründen, welches besagt, dass das Ergebnis eines Experiments dadurch beeinflusst oder sogar bestimmt wird, wenn es beobachtet wird. Der Beobachter beobachtet nicht nur, er stellt Fragen und trifft Feststellungen, die letztlich in einzelnen Bits ausgedrückt werden müssen. »Was wir als Realität bezeichnen«, schrieb Wheeler scheu, »ist das Ergebnis der letzten Analyse von Ja-Nein-Fragen.« Und fügte hinzu: »Alle physischen Dinge sind in ihrem Ursprung informationstheoretisch, und dies ist ein partizipatorisches Universum.« Das gesamte Universum lässt sich daher als Computer beziehungsweise als eine Art kosmische Informationsverarbeitungsmaschine betrachten.
Ein Schlüssel zu diesem Rätsel ist eine Form der Beziehung, die in der klassischen Physik keinen Platz hatte: das Phänomen der Verschränkung. Wenn Elementarteilchen oder Quantensysteme miteinander verschränkt sind, bleiben ihre Eigenschaften über große räumliche und zeitliche Entfernungen korreliert. Selbst wenn sie Lichtjahre voneinander entfernt sind, teilen sie etwas, das physisch und doch nicht ausschließlich physisch ist. Es entstehen unheimliche Paradoxe, die so lange unlösbar bleiben, bis der Mensch versteht, wie Verschränkungen Informationen verschlüsseln, die in Bits oder ihrem drollig benannten Quanten-Gegenstück, dem Quantenbit oder auch QuBit, gemessen werden. Was tun Photonen und Elektronen und andere Partikel eigentlich genau, wenn sie interagieren? Sie tauschen Bits aus, übertragen Quantenzustände und verarbeiten Informationen. Die Algorithmen sind die Gesetze der Physik. Jeder leuchtende Stern, jeder stille Nebelfleck und jedes Elementarteilchen, das seine geisterhafte Spur in einer Wolkenkammer hinterlässt, ist ein Informationsprozessor. Das Universum berechnet sein eigenes Schicksal.
Welche Mengen berechnet es? Wie schnell? Wie groß ist seine gesamte Informationskapazität, der Speicherplatz auf seiner »Festplatte«? Welches ist die Verknüpfung zwischen Energie und Information; wie viel Energie kostet es, ein Bit zu schnipsen? Das sind schwer zu beantwortende Fragen, aber sie sind nicht so mystisch oder metaphorisch, wie sie klingen. Physiker und die neuen Quanteninformationstheoretiker ringen gemeinsam mit diesen Fragen. Sie stellen Berechnungen an und geben vorsichtige Antworten. (»Die Zahl der Bits des Kosmos beträgt, egal wie man es betrachtet, zehn, potenziert zu einer gewaltigen Macht«, so Wheeler.14› Hinweis Laut Seth Lloyd gab es seit Anbeginn nicht mehr als 10120 OPS, das heißt Operationen pro Sekunde, auf 1090 Bit Information.15› Hinweis) Quanteninformationstheoretiker betrachten die Mysterien der thermodynamischen Entropie und die berüchtigten Informationsschlucker – die schwarzen Löcher – mit neuem Blick. »In der Zukunft«, so Wheeler, »werden wir die gesamte Physik in der Sprache der Information verstehen und ausdrücken können.«16› Hinweis
Die Rolle der Information, die weit über jede Erwartung hinausreicht, wächst ins Unermessliche. »TMI«, sagt man heutzutage kurz, »too much information«. Wir leiden unter Informationsmüdigkeit, Informationsängsten und Informationsflut. Wir haben den Teufel der Informationsüberlastung und seine spitzbübischen Untergebenen – den Computervirus, das Besetztzeichen, tote Links und die Power-Point-Präsentation – kennengelernt. Auch all das geht indirekt auf Shannon zurück. Alles hat sich so schnell verändert. John Robinson Pierce (der Ingenieur von Bell Labs, der den Begriff Transistor erfunden hat) sinnierte anschließend: »Man kann sich eine Welt vor Shannon, wie sie denen erschien, die in ihr lebten, kaum vorstellen. Es ist schwer, die Unschuld, das Unwissen und das mangelnde Verständnis der Zeit vor Shannon wiederzuerlangen.«17› Hinweis
Dennoch rückt die Vergangenheit wieder in den Fokus. Am Anfang war das Wort, so der Evangelist Johannes. Wir sind die Spezies, die sich selbst als Homo sapiens bezeichnet – der »wissende Mensch«. Und nach einigem Nachdenken änderten wir diese Bezeichnung in Homo sapiens sapiens. Nicht das Feuer war das größte Geschenk, das Prometheus der Menschheit machte: »Auch Zahlen, die höchsten aller Wissenschaften, erfand ich für sie, sowie die Kombination von Buchstaben – kreative Mutter der Musenkünste, mittels derer alle Dinge in der Erinnerung bewahrt werden.«18› Hinweis Das Alphabet stellte eine Gründungstechnologie der Information dar. Das Telefon, das Faxgerät, der Taschenrechner und letztlich der Computer sind lediglich die neuesten Innovationen zum Erhalt, zur Be- und Verarbeitung sowie zur Weitergabe von Wissen. Unsere Kultur hat ein Arbeitsvokabular für diese nützlichen Erfindungen geschaffen. Wir sprechen von Datenkomprimierung, in dem Bewusstsein, dass es sich dabei um etwas ganz anderes handelt als die Gaskompression. Wir kennen uns mit der kontinuierlichen Datenübertragung – dem sogenannten Streaming –, mit Syntaxanalyse, der Sortierung, Kombination und dem Filtern von Informationen aus. Zu unserer alltäglichen Ausstattung gehören iPods und Plasmabildschirme, zu unseren Fähigkeiten gehören das Verfassen von elektronischen Textbotschaften – auf Neudeutsch »Simsen« genannt – und die elektronische Informationssuche, das »Googeln«. Wir sind gut ausgestattet, wir sind Experten, und folglich sehen wir vor allem Informationen. Diese sind jedoch schon immer da gewesen. Sie bestimmten bereits die Welt unserer Vorfahren, nahmen solide bis ätherische Formen an – von Grabsteinen aus Granit bis zum Tuscheln von Höflingen. Die Lochkarte, die Registrierkasse, der Differentialmotor des 19. Jahrhunderts und die Telegrafenkabel spielten ihre jeweilige Rolle in der Entstehung des Informationsnetzes, an dem wir kleben. Jede neue Informationstechnologie führte zu ihrer Zeit zu Neuerungen in der Speicherung und Übertragung. Aus der Druckerpresse entstanden neue Formen der Informationsorganisation: Wörterbücher, Enzyklopädien, Almanache – Wörterkompendien, Faktenklassifizierer, Wissensbäume. Kaum irgendeine Informationstechnologie wird obsolet. Jede neue Technologie hebt ihre Vorgängerin hervor. Im 17. Jahrhundert widerstand Thomas Hobbes daher dem Neue-Medien-Hype seiner Ära: »Im Vergleich mit der Erfindung der Buchstaben ist die Erfindung des Drucks, wenngleich einfallsreich, jedoch keine große Sache.«19› Hinweis Bis zu einem gewissen Grad hatte er Recht. Jedes neue Medium transformiert die Natur des menschlichen Gedankens. Auf lange Sicht betrachtet ist Geschichte die Erzählung der Information, die sich ihrer selbst bewusst wird.
Einige Informationstechnologien wurden zu ihrer Zeit anerkannt, andere nicht. Eine, die zutiefst missverstanden wurde, war die afrikanische Sprechtrommel.
Sprechende Trommeln
Wenn ein Code kein Code ist
Ȇber den gesamten dunklen Kontinent erklingen die Trommeln, die nie schweigen:
die Grundlage aller Musik, das Zentrum aller Tänze;
die Sprechtrommeln, die drahtlosen Telefone des nicht kartographierten Urwalds.«
Irma Wassall (1943)20› Hinweis
Niemand sprach auf der Trommel in kurzen, knappen Worten. Trommler sagten nicht: »Komm nach Hause«, sondern
Lass dich von deinen Füßen dahin zurücktragen, wo du herkommst, lass dich von deinen Beinen dahin zurücktragen, wo du herkommst, setz deine Füße und Beine auf dem Boden des Dorfes auf, das zu uns gehört.21› Hinweis
Sie würden nicht einfach »Toter« sagen, sondern weiter ausholen: »der auf Erdklumpen auf seinem Rücken liegt«. Anstatt »Hab keine Angst« würden sie mitteilen: »Trag dein Herz von deinem Mund wieder zurück hinunter, dein Herz von deinem Mund, trag es von dort wieder zurück hinunter.« Die Trommeln erzeugten Fontänen der Redekunst. Das erschien ineffizient. War es bombastisch oder hochtrabend? Oder etwas anderes?
Für lange Zeit wussten es die Europäer, die sich in Subsahara-Afrika aufhielten, nicht. Tatsächlich hatten sie nicht die leiseste Ahnung, dass die Trommeln Informationen übermittelten. In ihren eigenen Kulturen konnten eine Trommel, ein Waldhorn und die Glocke ein Signalinstrument für besondere Fälle sein, das zur Übermittlung bestimmter Botschaften verwendet wurde: Angriff, Rückzug, Aufruf zur heiligen Messe. Aber sie konnten sich keine Sprechtrommeln vorstellen. Im Jahr 1730 segelte Francis Moore ostwärts den Gambia hinauf und stellte fest, dass er über 900 Kilometer schiffbar war. Während der gesamten Reise bewunderte er die Schönheit des Landes und so eigenartige Wunder wie »Austern, die auf Bäumen wuchsen« (Mangroven). Er war kein Naturforscher, sondern kundschaftete als Agent für englische Sklavenhändler Königreiche aus, die – wie er es sah – von unterschiedlichen Menschenrassen von schwarzer oder goldbrauner Haut bewohnt wurden, wie zum Beispiel »von den Völkern der Mandinka, der Wolof, der Fulbe, außerdem von Portugiesen«. Als er auf Männer und Frauen stieß, die Trommeln schleppten, die aus einem konisch zulaufenden, bis zu einem Meter langen Holzstück geschnitzt waren, fiel ihm auf, dass die Frauen lebhaft zum Klang der Trommeln tanzten, dass die Trommeln gelegentlich »beim Herannahen von Feinden« und schließlich »zu ganz besonderen Gelegenheiten« geschlagen wurden, nämlich um mit den Trommeln Hilfe aus benachbarten Dörfern herbeizurufen. Aber das war alles, was ihm auffiel.22› Hinweis
Ein Jahrhundert später, machte Kapitän William Allen während einer Expedition auf dem Niger2› Hinweis eine weitere Entdeckung, als er seinem Steuermann aus dem Kamerun, den er Glasgow nannte, lauschte. Sie befanden sich in der Kabine des eisernen Raddampfers, als laut Allen Folgendes geschah:
Plötzlich war er völlig abgelenkt und schien eine Weile aufmerksam auf etwas zu lauschen. Als ich ihn wegen seiner Abgelenktheit rügte, sagte er: »Ihr nicht hören meinen Sohn sprechen?« Da wir keine Stimme hören konnten, fragten wir ihn, woher er das wusste. Er antwortete: »Trommeln zu mir sprechen, sagen mir an Deck gehen.« Das erschien sehr eigentümlich.23› Hinweis
Die Skepsis des Kapitäns wich dem Erstaunen, als Glasgow ihn davon überzeugte, dass jedes Dorf seine »eigene Weise der musikalischen Korrespondenz« besaß. Obwohl es ihm schwerfiel, das zu glauben, akzeptierte der Kapitän schließlich, dass sich ausführliche Botschaften aus vielen Sätzen über viele Meilen Entfernung übermitteln ließen. »Wir sind oft überrascht«, so schrieb er, »dass der Klang der Trompeten in unseren militärischen Entwicklungen so gut verstanden wird. Aber wie weit bleibt dies hinter dem Ergebnis zurück, das diese ungebildeten Wilden erzielen.« Dieses Ergebnis war eine Technologie, die in Europa sehr begehrt war: eine Fernkommunikation, die schneller war als jeder Bote zu Fuß oder zu Pferd. Die stille Nachtluft trug das Dröhnen der Trommel neun oder zehn Kilometer weit über den Fluss. Von Dorf zu Dorf weitergetragen, konnten Botschaften in einer knappen Stunde 150 Kilometer oder mehr überwinden.
Die Nachricht einer Geburt in Bolenge, einem Dorf in Belgisch-Kongo, klang folgendermaßen:
Batoko fala fala, tokema bolo bolo, boseka woliana imaki tonkilingonda, ale nda bobila wa fole fole, asokoka l’isika koke koke.
Die Matten sind aufgerollt, wir fühlen uns stark, eine Frau kam aus dem Wald, sie ist im offenen Dorf, das ist einstweilen alles.
Der Missionar Roger T. Clarke transkribierte den folgenden Aufruf zum Begräbnis eines Fischers:24› Hinweis
La nkesa laa mpombolo, tofolange benteke biesala, tolanga bonteke bolokolo bole nda elinga l’enjale baenga, basaki l’okala bopele pele. Bojende bosalaki lifeta Bolenge wa kala kala, tekendake tonkilingonda, tekendake beningo la nkaka elinga l’enjale. Tolanga bonteke bolokolo bole nda elinga l’enjale, la nkesa la mpombolo.
Am Morgen im Morgengrauen wollen wir nicht zur Arbeit zusammenkommen, wir wollen zum Spiel am Fluss zusammenkommen. Männer, die in Bolenge leben, geht nicht in den Wald, geht nicht fischen. Wir wollen zum Spiel am Fluss zusammenkommen, morgen im frühen Morgengrauen.
Clarke fielen mehrere Dinge auf. Zwar lernten nur einige Menschen mit der Trommel zu kommunizieren, aber fast alle verstanden die Botschaften der Trommeln. Einige Trommler schlugen die Trommeln schnell, andere langsam. Feststehende Sätze wurden praktisch unverändert ständig wiederholt; die verschiedenen Trommler übermittelten dieselbe Botschaft, aber mit unterschiedlichen Worten. Clarke erschien die Sprache der Trommeln formelhaft und fließend zugleich. »Die Signale repräsentieren die Töne der Silben konventioneller Sätze von traditionellem und äußerst poetischem Charakter«, schloss er. Und das war korrekt. Clarke vermochte nur nicht den letzten Schritt zu vollziehen und die Gründe dafür zu verstehen.
Diese Europäer sprachen von »Eingeborenen« und beschrieben die Afrikaner als »primitiv« und »animistisch« und erkannten dennoch, dass sie einen alten Traum jeder menschlichen Kultur verwirklicht hatten. Sie besaßen ein Kommunikationssystem, das die besten Kuriere, die schnellsten Pferde auf guten Straßen mit Raststationen und Übergabestellen übertraf. Kuriersysteme auf Basis des Fußtransports enttäuschten immer; die Armeen waren stets schneller. Julius Cäsar zum Beispiel »traf oft vor den Kurieren ein, die seine Ankunft ankündigen sollten«, wie Sueton im ersten Jahrhundert schrieb.25› Hinweis Trotzdem fehlte es den Menschen der Antike nicht an Hilfsmitteln. Die Griechen benutzten zur Zeit des Trojanischen Krieges, im 12. vorchristlichen Jahrhundert, Leuchtfeuer, so berichten es die Darstellungen von Homer, Vergil und Aischylos. Ein großes Feuer auf einem Berggipfel war von den Wachtürmen in 30 Kilometer Entfernung zu sehen, und in besonderen Fällen sogar aus größerer Entfernung. In der Beschreibung des Aischylos erhält Klytaimnestra die Nachricht vom Fall Trojas in derselben Nacht, 600 Kilometer von der Stadt entfernt in Mykene. »Wer konnte so rasch die Botschaft überbringen?«, fragt der skeptische Chor.26› Hinweis
Klytaimnestra schreibt dies dem Gott des Feuers, Hephaistos, zu: »Er sandte sein Signal aus; weiter und immer weiter, Leuchtfeuer um Leuchtfeuer eilte die Flamme der Botschaft dahin.« Das ist keine geringe Leistung, und der Zuschauer muss überzeugt werden, und so lässt Aischylos Klytaimnestra für mehrere Minuten mit jedem Detail der Route fortfahren: Das flammende Signal stieg vom Ida-Gebirge auf, überquerte die Ägäis bis zur Insel Lemnos, setzte sich von dort aus zum Berg Athos in Makedonien fort; anschließend Richtung Süden über die Ebenen und Seen nach Makistos; von dort nach Messapios, wo der Wächter die entfernte Flamme auf den Flutwellen der Meerenge Euripos leuchten sah und den hoch aufgeschichteten Haufen aus verdorrtem Ginster entzündete, um die Botschaft weiter nach Kithairon, den Berg Aigiplanktos bis zu ihrem eigenen Wachtposten auf dem Arachnaion zu tragen. »So eilig von Punkt zu Punkt, Flamme um Flamme lodernd«, verkündete Klytaimnestra stolz, »entlang dem vorbestimmten Verlauf.« Der deutsche Historiker Richard Hennig verfolgte und maß die Route im Jahr 1908 und bestätigte die Machbarkeit dieser Kette an Signalfeuern.27› Hinweis Die Bedeutung der Botschaft musste natürlich im Vorhinein festgelegt und effektiv zu einem einzigen »Bit« komprimiert werden – eine binäre Wahl, etwas oder nichts: Das Feuersignal bedeutete etwas, und in diesem Fall lautete die Botschaft: »Troja ist gefallen.« Die Übertragung dieses einen Bits erforderte eine ungeheure Planung, immens viel Arbeit, Sorgfalt und Feuerholz. Viele Jahre später sandten Laternen in der Old North Church dem amerikanischen Freiheitskämpfer Paul Revere auf ähnliche Weise ein einziges, kostbares Bit, das er weitertrug; eine binäre Botschaft: zu Wasser oder zu Lande.
Für weniger außerordentliche Anlässe waren mehr Kapazitäten erforderlich. Die Menschen probierten Flaggen und Hörner, Rauchzeichen und reflektierende Spiegel. Sie riefen zum Zwecke der Kommunikation Geister und Engel herbei – Engel, die per definitionem himmlische Botschafter waren. Die Entdeckung des Magnetismus war besonders vielversprechend. In einer Welt, die bereits vor Magie barst, verkörperten Magnete okkulte Mächte. Der Magnet zieht das Eisen an. Diese Macht der Anziehungskraft setzt sich auf unsichtbare Weise durch die Luft fort. Die magnetische Wirkung wird nicht von Wasser oder einem festen Körper unterbrochen. Ein Magnet, der auf der einen Seite einer Wand an diese gehalten wird, kann ein Eisenobjekt auf der anderen Seite der Wand bewegen. Am Faszinierendsten ist jedoch, dass die magnetische Kraft in der Lage zu sein scheint, Objekte zu koordinieren, die sich in sehr großen Entfernungen voneinander befinden, und zwar über die ganze Erde: die Kompassnadeln. Und wenn eine Nadel eine andere kontrollieren könnte? Diese Vorstellung verbreitete sich – eine »Einbildung«, schrieb Thomas Browne in den 1640er-Jahren,
flüsterte durch die Welt mit einiger Aufmerksamkeit. Leichtgläubige und gewöhnliche Empfänger schenkten ihr gerne Glauben, und klügere, besonnenere Köpfe schlossen sie nicht gänzlich aus. Diese Verblendung ist exzellent, und würde sich ihr Effekt einstellen, auf gewisse Weise göttlich. Wir könnten wie Geister kommunizieren und auf der Erde mit Menippus auf dem Mond sprechen.28› Hinweis
Die Idee sympathetischer, das heißt aufeinander ausgerichteter Nadeln tauchte auf, wo immer es Naturphilosophen und Schwindler gab. In Italien versuchte ein Mann, Galileo; »eine geheime Methode zur Kommunikation mit einer Person in zwei- oder dreitausend Meilen Entfernung zu verkaufen, und zwar mit Hilfe bestimmter sympathetischer Magnetnadeln«.
Ich sagte ihm, dass ich sie gerne kaufen würde, das Experiment zuvor aber sehen wolle, und dass es mir genügen würde, wenn er sich in einen Raum und ich mich in einen anderen Raum begeben würde. Er antwortete, die Funktion dieser Methode ließe sich über eine so kurze Entfernung nicht beobachten. Ich schickte ihn mit der Bemerkung fort, ich sei derzeit nicht in der Laune, für dieses Experiment nach Kairo oder Moskau zu reisen, aber wenn er dorthin reisen wolle, würde ich in Venedig bleiben und das Experiment von hier aus überprüfen.29› Hinweis
Die Idee bestand darin: Wenn zwei Nadeln gemeinsam magnetisiert wurden – »von demselben Magnet berührt wurden«, wie Browne es ausdrückte –, würden sie von da an aufeinander ausgerichtet bleiben, selbst wenn sie räumlich voneinander getrennt würden. Man könnte das als »Verschränkung« bezeichnen. Ein Sender und ein Empfänger würden die Nadeln nehmen und sich auf eine Kommunikationszeit einigen. Sie würden ihre jeweilige Nadel auf Scheiben platzieren, auf deren Rand die Buchstaben des Alphabets stehen. Der Sender würde seine Botschaft übermitteln, indem er die Nadel dreht. »Und dann, so will es die Tradition«, erklärte Browne, »würde eine Nadel, die auf irgendeinen Buchstaben gerichtet wird, unabhängig von der räumlichen Entfernung, durch einen wundersamen Gleichklang bewirken, dass die Nadel des Empfängers die gleiche Bewegung vollzieht.« Anders als die meisten Menschen, die an die Idee der sympathetischen Nadeln glaubten, probierte Browne dieses Experiment aus. Es funktionierte nicht. Als er die eine Nadel bewegte, blieb die zweite Nadel still.
Browne ging nicht so weit, die Möglichkeit auszuschließen, dass diese geheimnisvolle Kraft eines Tages für Kommunikationszwecke eingesetzt werden könnte, aber er fügte dem einen Vorbehalt hinzu. Selbst wenn die magnetische Fernkommunikation eines Tages möglich sei, könnte ein Problem auftreten, wenn Sender und Empfänger versuchten, ihre Handlungen aufeinander abzustimmen. Woher wüssten sie die vereinbarte Uhrzeit der Botschaftsübermittlung, da es sich bei der Feststellung des Zeitunterschieds zwischen zwei Orten um kein gewöhnliches oder kalendarisches Vorhaben, sondern um ein mathematisches Problem handele; nicht einmal den Weisesten würde dies genau gelingen. Denn die Uhrzeiten unterschiedlicher Orte antizipieren einander, je nach ihrem Längengrad, der bisher nicht an jedem Ort exakt bestimmt werden kann.
Das war ein vorauswissender und gänzlich theoretischer Gedanke, ein Produkt des neuen Wissens über Astronomie und Geografie des 17. Jahrhunderts. Es war der erste Riss in der bis dahin festgefügten Theorie der Gleichzeitigkeit. Auf jeden Fall ging die Meinung der Experten auseinander, wie Browne anmerkte. Zwei weitere Jahrhunderte sollten vergehen, bis die Menschen schnell genug reisen und kommunizieren konnten, um die lokalen Zeitunterschiede zu spüren. Bisher konnte jedenfalls niemand so schnell und so viel kommunizieren wie die des Lesens und Schreibens unkundigen Afrikaner mit ihren Trommeln.
Als Kapitän Allen im Jahr 1841 die Sprechtrommeln entdeckte, kämpfte Samuel F. B. Morse mit seinem eigenen rhythmischen Code, dem elektromagnetischen »Hämmern«, das durch das Telegrafenkabel gejagt wurde. Die Erfindung eines Codes war ein komplexes und heikles Problem. Zunächst dachte Morse nicht einmal an so etwas wie einen Code, sondern vielmehr an »ein System der Zeichen anstelle von Buchstaben, die von einer schnellen Abfolge an Strichen oder Schlägen des galvanischen Stroms markiert werden sollten«.30› Hinweis Die Geschichte der Erfindungen bot kaum einen Präzedenzfall, an dem er sich hätte orientieren können. Die Frage, wie sich Informationen von einer Ausdrucksform – der Alltagssprache – in eine andere Ausdrucksform übertragen ließen, die per Kabel übermittelt werden konnte, beanspruchte seinen Einfallsreichtum mehr als jedes mechanische Problem im Zusammenhang mit dem Telegrafen selbst. Daher ist es nur angemessen, dass dieser Kommunikationscode und weniger das Kommunikationsgerät nach seinem Erfinder Morse benannt ist.
Morse arbeitete mit einer Technologie, die nur grobe Impulse, plötzliche Stromschläge und einen Stromkreis zu erlauben schien, der sich öffnete oder schloss. Wie ließen sich durch das Klicken eines Elektromagneten Sprachbotschaften übermitteln? Seine erste Idee war, Zahlen zu versenden, und zwar immer jeweils eine Ziffer, bestehend aus Punkten und Pausen. Die Abfolge ••• •• ••••• bedeutete 325. Jedem englischen Wort würde eine Ziffer zugewiesen, und die Telegrafen an beiden Enden des Telegrafenkabels würden die übermittelte Abfolge in einem besonderen Wörterbuch nachsehen. Morse machte sich daran, dieses Nachschlagewerk selbst zu verfassen und verschwendete viele Stunden damit, große Blätter zu beschreiben.3› Hinweis Im Jahr 1840 meldete er sein erstes telegrafisches Patent an:
Das Wörterbuch oder Vokabular besteht aus Wörtern, die in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und mit Zahlen versehen sind. Es beginnt mit den Buchstaben des Alphabets, sodass jedes Wort seine telegrafische Zahlenentsprechung hat, und nach Belieben durch ein Zahlensymbol bezeichnet ist.31› Hinweis
In seinem Bemühen um Effizienz wog er die Kosten und Möglichkeiten über verschiedene sich überschneidende Ebenen ab. Da waren die Kosten der Übertragung selbst: Die Kabel waren teuer und erlaubten nur eine bestimmte Zahl von Impulsen pro Minute. Die Zahlen würden relativ einfach zu übertragen sein. Aber dann waren da noch die zusätzlichen Kosten der Zeit und Bedienungsschwierigkeit für die Telegrafisten. Die Idee von Codebüchern bot weitere Möglichkeiten und fand ihren Widerhall in der Zukunft, in der weitere Technologien entstehen sollten. Schließlich funktionierte diese Methode für die chinesische Telegrafie. Aber Morse erkannte, dass es viel zu aufwendig war, wenn Telegrafisten jedes einzelne Wort in einem speziellen Wörterbuch nachschlagen mussten.32› Hinweis
Sein Protegé Alfred Vail entwickelte in der Zwischenzeit einen einfachen Tastenhebel, mit dem ein Telegrafist den elektrischen Schaltkreis schnell öffnen und schließen konnte. Vail und Morse verlegten sich auf die Idee eines kodierten Alphabets, bei dem Symbolzeichen als Ersatz für Buchstaben dienen sollten; somit wurde jedes Wort buchstabiert. Irgendwie mussten die nackten Zeichen alle Wörter der gesprochenen und geschriebenen Sprache wiedergeben. Sie mussten die gesamte Sprache in eine eindimensionale Abfolge von Impulsen verwandeln. Zunächst entwickelten sie ein System, das auf zwei Elementen basierte: den Klicks (heute »Punkte« genannt) und den Zwischenräumen (»Pausen«) zwischen jedem Punkt. Als sie an dem Prototyp für eine Tastatur bastelten, kamen sie auf ein drittes Zeichen: den Strich, das heißt »wenn der Schaltkreis länger geschlossen blieb, als für einen Punkt nötig war«. (Dieser Code wurde als Morsealphabet bekannt, aber der unerwähnte Zwischenraum – die Pause – blieb genauso wichtig. Das Morsealphabet war damit keine binäre Sprache mehr.4› Hinweis) Dass Menschen die Beherrschung dieses Codesystems erlernen konnten, erschien zunächst wie ein Wunder. Sie würden das Codesystem beherrschen müssen und dann paarweise einen kontinuierlichen Akt der doppelten Übersetzung vollziehen müssen: Sprache in Zeichen; Wahrnehmung in Fingerbewegung. Ein Zeuge war verblüfft, wie sehr Telegrafisten diese Fähigkeit verinnerlicht hatten:
Die Telegrafisten, die das Gerät bedienen, sind derartige Experten in ihren merkwürdigen Hieroglyphen, dass sie nicht auf den Ausdruck blicken müssen, um die Botschaft, die sie empfangen, entziffern zu können. Für sie drückt sich das Morsegerät verständlich aus. Sie verstehen seine Sprache. Sie können ihre Augen schließen und dem eigenartigen Klicken lauschen, das neben ihrem Ohr stattfindet, während die Botschaft auf Papier gedruckt wird. Und sie wissen sofort, was der Sender ihnen mitteilt.33› Hinweis
Im Namen der Geschwindigkeit hatten Morse und Vail erkannt, dass sie Schläge einsparen konnten, indem sie kürzere Sequenzen an Punkten und Strichen für die am häufigsten verwendeten Buchstaben reservierten. Doch welche Buchstaben würden am häufigsten verwendet werden? Über die Statistiken des Alphabets wusste man kaum etwas. Bei der Suche nach der relativen Verwendungshäufigkeit der einzelnen Buchstaben kam Vail die Idee, die lokale Zeitungsredaktion in Morristown, New Jersey aufzusuchen und einen Blick auf die Schriftkästen der Setzer zu werfen.34› Hinweis Dabei zählte er einen Bestand von 12.000 Es, 9.000 Ts und nur 200 Zs. Daraufhin ordneten Morse und er das Alphabet entsprechend neu. Ursprünglich hatten sie Strich-Strich-Punkt für das T verwendet, den am zweithäufigsten verwendeten Buchstaben des Alphabets. Nun änderten sie das T in einen einzigen Strich und ersparten den Telegrafisten in der Zukunft damit unzählige Milliarden Tastenbewegungen. Sehr viel später berechneten Informationstheoretiker, dass sich die beiden Erfinder damit innerhalb 15 Prozent einer optimalen Anordnung zur Telegrafie englischer Texte befanden.35› Hinweis
Die Sprache der Trommeln wurde von keiner derartigen Wissenschaft und keinem solchen Pragmatismus bestimmt. Dennoch musste auch hier ein Problem gelöst werden, das sich auch bei der Entwicklung eines Telegrafencodes stellte: Wie ließ sich eine ganze Sprache in einen eindimensionalen Fluss an simpelsten Klängen übersetzen? Dieses Problem wurde kollektiv von Generationen an Trommlern in einem Jahrhunderte währenden Prozess der sozialen Evolution gelöst. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde den Europäern, die Afrika studierten, die Analogie zur Telegrafie klar. »Vor nur wenigen Tagen las ich in der Times, wie ein Resident in einem Teil Afrikas vom Tod eines europäischen Babys auf einem anderen, weit entfernten Teil des Kontinents hörte und wie diese Nachricht mithilfe der Trommeln übermittelt wurde, die, wie es hieß, ›nach dem Morse-Prinzip‹ verwendet werden – es ist immer das ›Morse-Prinzip‹«, schrieb Captain Robert Sutherland Rattray an die Royal African Society in London.36› Hinweis
Die offensichtliche Analogie führte die Menschen jedoch in die Irre. Es gelang ihnen nicht, den Code der Trommeln zu entschlüsseln, weil es nämlich gar keinen Code gab. Morse hatte sein System von einer zwischengeschalteten symbolischen Ebene befreit, dem geschriebenen Alphabet, das zwischen der Sprache und dem abschließenden Code steht. Seine Punkte und Striche hatten keinen direkten Bezug zum Klang. Sie standen für Buchstaben, die geschriebene Wörter bildeten, die ihrerseits das gesprochene Wort repräsentierten. Die Trommler konnten sich auf keinen zwischengeschalteten Code stützen; sie konnten nicht über eine Symbolebene hinaus abstrahieren, weil die afrikanischen Sprachen – wie alle außer einigen Dutzend der 6.000 Sprachen, die in der modernen Welt gesprochen werden – kein Alphabet besitzen. Die Trommeln waren eine direkte Übersetzung der gesprochenen Sprache.
Es fiel John F. Carrington zu, dies zu erklären. Als englischer Missionar, der 1914 in Northamptonshire geboren wurde, machte sich Carrington im Alter von 24 Jahren nach Afrika auf und verbrachte dort sein gesamtes Leben. Die Trommeln erregten schon früh seine Aufmerksamkeit, als er von der Station der Baptist Missionary Society in Yakusu auf dem oberen Teil des Kongoflusses durch die Dörfer des Bambole-Waldes reiste. Eines Tages unternahm er einen spontanen Ausflug in die Kleinstadt Yaongama und stellte zu seiner Überraschung fest, dass ein Lehrer, der medizinische Helfer und die Mitglieder der Kirche sich bereits zu seiner Ankunft versammelt hatten. Die Trommeln hätten ihn angekündigt, erklärten sie. Schließlich erkannte Carrington, dass die Trommeln nicht nur Warnungen und Ankündigungen, sondern auch Gebete, Gedichte und sogar Witze übermittelten. Die Trommler waren keine Signalgeber, sondern Erzähler; sie sprachen eine besondere, an die Übermittlungsform angepasste Sprache.
Schließlich lernte auch Carrington selbst, die Trommeln zu schlagen. Er trommelte hauptsächlich in Kele, einer Sprache des Bantu-Stammes in dem Landesteil, der heute den Osten Zaires bildet. »Er ist eigentlich kein richtiger Europäer, trotz seiner Hautfarbe«, sagte ein Dorfbewohner von Lokele über Carrington.37› Hinweis »Er stammte aus unserem Dorf, war einer von uns. Nach seinem Tod machten die Geister einen Fehler und sandten ihn weit weg in ein Dorf von Weißen, wo er in den Körper eines kleinen Babys einer weißen Frau schlüpfte, anstatt einer unserer Frauen. Aber weil er zu uns gehört, konnte er seine Herkunft nicht vergessen und kam zurück.« Der Dorfbewohner fügte großzügig hinzu: »Wenn er ein wenig ungeschickt trommelt, liegt das daran, dass er von den Weißen eine schlechte Ausbildung erhalten hat.« Carrington verbrachte vier Jahrzehnte in Afrika. Er wurde zu einem hervorragenden Botaniker, Anthropologen und vor allem Linguisten, der sehr gut über die Struktur der afrikanischen Sprachfamilien Bescheid wusste, die aus Tausenden von Dialekten und mehreren hundert unterschiedlichen Sprachen bestehen. Ihm fiel auf, wie sprachgewandt ein guter Trommler sein musste. Schließlich veröffentlichte er seine Entdeckungen im Jahr 1949 in einem schmalen Band mit dem Titel The Talking Drums of Africa.
Bei der Lösung des Rätsels der Trommeln fand Carrington den Schlüssel in einer zentralen Tatsache über die relevanten afrikanischen Sprachen. Sie sind tonale Sprachen, deren Bedeutung gleichermaßen von einer ansteigenden oder abfallenden Sprachmelodie wie der Unterscheidung zwischen Vokalen und Konsonanten bestimmt wird. Dieses Merkmal fehlt den meisten indo-europäischen Sprachen, einschließlich Englisch, die nur auf begrenzte und syntaktische Weise intonieren: zum Beispiel, um Fragen (»Du bist glücklich«) von Feststellungen (»Du bist glücklich«) zu unterscheiden. In anderen Sprachen, vornehmlich dem Mandarin-Chinesisch und Kantonesisch, hat die Tonlage eine maßgebliche Bedeutung für die Bestimmung der Wortbedeutung. Und das gilt auch für die meisten afrikanischen Sprachen. Selbst wenn Europäer diese Sprachen erlernten, verstanden sie in den seltensten Fällen die Bedeutung der Tonalität, weil sie keine Erfahrung damit hatten. Wenn sie die Wörter, die sie hörten, in das lateinische Alphabet übertrugen, ignorierten sie die Tonlage völlig. Tatsächlich waren sie im sprachlichen Sinne »farbenblind«.
Drei unterschiedliche Wörter aus der Kele-Sprache wurden von Europäern buchstabengetreu als lisaka übertragen. Diese Wörter unterscheiden sich voneinander ausschließlich durch die Tonlage. Daher bedeutet lisaka mit drei tief ausgesprochenen Silben Pfütze; lisaka mit einer ansteigenden letzten Silbe (auf der aber nicht unbedingt die Betonung liegen muss) bedeutet ein Versprechen; und lisaka ist Gift. Liala bedeutet Verlobte und liala Abfallgrube. In der Transliteration wirken sie wie Homonyme, sind es aber nicht. Carrington erinnerte sich, nachdem ihm ein Licht aufgegangen war, an einen häufigen Fehler: »Ich muss viele Male den Fehler begangen haben, einen Jungen zu bitten ›nach einem Buch zu paddeln‹ oder ›zu fischen, dass sein Freund kommt‹.«38› Hinweis Europäer hatten einfach kein Ohr für diese Unterscheidungen. Carrington erkannte, zu welch komischen Verwirrungen das führen konnte:
Seit Ende des 19. Jahrhunderts haben Linguisten Phoneme als kleinste akustische Einheit identifiziert, die einen Bedeutungsunterschied ausmacht. Das Wort Haus umfasst sechs Phoneme: Wenn man H in M, H in L, u in l, n oder s in d oder s in t verändert, lassen sich unterschiedliche Bedeutungen erzeugen. Das ist ein nützliches, aber unvollkommenes Konzept. Linguisten haben festgestellt, dass es überraschend schwierig ist, sich auf ein exaktes Inventar an Phonemen für Englisch oder irgendeine andere Sprache zu einigen (für Englisch bewegen sich die meisten Schätzungen um 45 Phoneme). Das Problem ist, dass der Sprachfluss ein Kontinuum ist. Ein Linguist kann ihn auf abstrakte oder willkürliche Weise in beliebige Einheiten aufbrechen, aber die Bedeutungsfülle dieser Einheiten variiert von Sprecher zu Sprecher und hängt vom Kontext ab. Die Instinkte der meisten Sprecher in Hinsicht auf Phoneme sind zudem von ihrem Wissen über das schriftliche Alphabet gefärbt, das die Sprache gelegentlich auf seine eigene willkürliche Weise kodifiziert. Auf jeden Fall enthalten tonale Sprachen mit ihrer zusätzlichen Variablen wesentlich mehr Phenome, als unerfahrene Linguisten auf einen Blick erkannten.
Nachdem die gesprochenen afrikanischen Sprachen der Tonalität eine maßgebliche Rolle beimaßen, machte die Sprache der Trommeln einen weiteren diffizilen Schritt. Sie verwendete ausschließlich den Ton. Es war eine Sprache, die aus einem einzigen Paar an Phonemen bestand; eine Sprache, die sich ausschließlich aus den Konturen der Tonlage zusammensetzte. Die Trommeln unterschieden sich in Material und Machart. Einige waren geschlitzte Röhren aus Padouk-Holz, das so geschnitzt war, dass die Trommel zwei lange, schmale Öffnungen hatte, um hohe und tiefe Töne erzeugen zu können. Andere waren mit Häuten überzogen, die paarweise verwendet wurden. Es kam einzig und allein darauf an, dass die Trommeln zwei unterschiedliche Töne erzeugen konnten, und zwar mit einem Intervall von ungefähr einer großen Terz.
Bei der Übertragung der gesprochenen Sprache in die Sprache der Trommel gingen Informationen verloren. Die Sprache der Trommel war eine defizitäre Sprache. In jedem Dorf und jedem Stamm begann die Sprache der Trommel mit einem gesprochenen Wort und entledigte sich dabei der Konsonanten und Vokale. Dabei ging bereits viel verloren. Der verbleibende Informationsfluss wurde auf uneindeutige Weise gereimt. Ein doppelter Schlag auf der Trommelseite, die hohe Töne erzeugte [––] entsprach dem tonalen Muster des Kele-Wortes für Vater, sango, aber es konnte genauso gut songe, Mond; koko, Huhn oder fele, eine bestimmte Fischart, oder irgendein anderes Wort aus zwei hohen Tönen bedeuten. Selbst das begrenzte Wörterbuch der Missionare in Yakusu enthielt 130 solcher Wörter.39› Hinweis Wie konnten die Trommeln diese Wörter unterscheiden, nachdem sie die gesprochenen Worte in all ihrer klanglichen Fülle zu einem derart minimalen Code reduziert hatten? Die Antwort lag zum Teil in der Betonung und dem Zeitpunkt, aber diese beiden Faktoren konnten die fehlenden Konsonanten und Vokale nicht wettmachen. Carrington entdeckte, dass ein Trommler unweigerlich jedem kurzen Wort »einen kurzen Satz« hinzufügte. Songe, der Mond, wird als songe li tange la manga – »der Monde blickt auf die Erde hinab« – bezeichnet. Koko, das Huhn, wird als koko olongo la bokiokio – »das kleine Huhn, das kiokio macht« – bezeichnet. Die zusätzlichen Trommelschläge sind keineswegs unerheblich, sondern bilden den Kontext, in dem das Wort steht. Jedes uneindeutige Wort beginnt in einer Wolke an möglichen alternativen Interpretationen. Mit dem anschließend folgenden Kontext scheiden dann alle nicht zutreffenden Interpretationen aus. Das findet auf einer Ebene unterhalb des Bewusstseins statt. Die Zuhörer hören nur das Stakkato der hohen und tiefen Trommelschläge, und ihr Unterbewusstsein ergänzt die fehlenden Vokale und Konsonanten. Tatsächlich hören sie ganze Sätze und keine einzelnen Worte. »Für die Menschen, die weder schreiben können noch die Grammatik kennen, hört das Wort an sich, das aus seiner Klanggruppe herausgelöst ist, beinahe auf, eine verständliche Äußerung zu sein«, berichtete Captain Rattray.40› Hinweis
Die stereotypen langen Wortketten schlenkern dahin, ihre Redundanz beseitigt die Uneindeutigkeit. Die Sprache der Trommeln ist kreativ und erzeugt frei Neologismen für Innovationen aus dem Norden: Dampfschiffe, Zigaretten und christlicher Gott waren die drei, die Carrington besonders auffielen. Trommler beginnen jedoch, indem sie traditionelle, festgelegte Formeln erlernen. Die Formeln der afrikanischen Trommer enthalten manchmal sogar archaische Wörter, die in der Alltagssprache in Vergessenheit geraten sind. Für die Yaoundé ist der Elefant stets »der große Behäbige«.41› Hinweis Die Ähnlichkeit mit homerischen Formeln – statt Zeus: Zeus, der Wolkensammler; statt einfach das Meer: das flaschengrüne Meer – sind keine Zufälle. In einer oralen Kultur muss die Inspiration zuallererst der Klarheit und dem Erinnerungsvermögen dienen. Die Musen sind die Töchter der Mnemosyne – des Gedächtnisses.
Weder Kele noch Englisch besaßen damals Wörter, um zu sagen, man möge zusätzliche Bits für Fehlerkorrektur und die Beseitigung von Uneindeutigkeit einkalkulieren. Dennoch tat die Sprache der Trommeln genau das. Redundanz, die per definitionem ineffizient ist, dient als Gegenmittel für Verwirrung und Missverständnisse. Sie bietet eine zweite Chance zur richtigen Interpretation einer Nachricht. Jede natürliche Sprache enthält eingebaute Redundanzen. Das ist der Grund, aus dem Menschen Texte entziffern können, die vor Fehlern strotzen, und Gespräche in einem lärmerfüllten Raum verstehen können. Die natürliche Redundanz der englischen Sprache motiviert das berühmte Metroplakat aus den 1970er-Jahren in New York City (sowie das Gedicht von James Merrill):
If u cn rd ths
U cn gt a gd job w hi pa!
(»Dieser Gegenzauber möge deine Seele retten«, fügt Merrill hinzu.42› Hinweis ) Meistens ist Redundanz in der Sprache nur ein Teil des Hintergrunds. Für einen Telegrafisten ist sie eine teure Verschwendung. Für einen afrikanischen Trommler ist sie von grundlegender Bedeutung. Eine andere Spezialsprache liefert eine perfekte Analogie: die Sprache des Luftverkehrs. Ein Großteil der Information, die zwischen Piloten und Fluglotsen ausgetauscht wird, besteht aus Zahlen und Buchstaben: Höhenmeter, Vektoren, die Maschinenkennung am Flugzeugheck, Start- und Rollbahnbezeichnungen, Radiofrequenzen. Das sind kritische Nachrichten, die über einen ständig geräuscherfüllten Kanal übermittelt werden, daher wird ein besonderes Alphabet verwendet, um Uneindeutigkeiten zu vermeiden. Die gesprochenen Buchstaben B und V sind leicht zu verwechseln; Bravo und Victor sind sicherere Alternativen. Aus den Buchstaben M und N wird Mike und November. Die Zahlen three und nine werden zum Beispiel tri und niner (»nei-ner«) ausgesprochen. Die zusätzliche Silbe hat dieselbe Funktion wie die zusätzlichen Wörter in der Sprache der Trommeln – sie soll eine Verwechslung ausschließen.
Hartley gab sich große Mühe, um seine Verwendung des Begriffs Information zu rechtfertigen. »Im allgemeinen Sprachgebrauch ist Information ein sehr dehnbarer Begriff«, schrieb er. »Zunächst wird seine Bedeutung näher eingegrenzt werden müssen.« Er schlug vor, Information eher »physisch« – wie er es nannte – zu betrachten, und nicht psychologisch. Er stellte fest, dass sich die Komplikationen vervielfachten. In gewisser Weise paradox, entstand diese Komplexität aus den Zwischenebenen der Symbole: Buchstaben des Alphabets, Punkte und Striche, die separat und daher leicht zählbar waren. Schwieriger zu messen waren die Verbindungen zwischen diesen Platzhaltern und der untersten Ebene: der menschlichen Stimme. Dieser Fluss an bedeutungsvollen Klängen schien einem Telefoningenieur genauso wie einem afrikanischen Trommler der wahre Kern der Kommunikation zu sein, selbst wenn die Töne oder Klänge an sich als Code für die darunter liegende Bedeutung oder das Wissen dienten. Auf jeden Fall fand Harley, ein Ingenieur solle in der Lage sein, alle Fälle der Kommunikation zu beherrschen: schriftliche und Telegrafencodes genauso wie die physische Übermittlung von Tönen mithilfe elektromagnetischer Wellen über Telefondrähte oder durch den Äther.
Natürlich wusste er nichts über Trommeln. Und auch John Carrington begann sie erst zu verstehen, als sie von der afrikanischen Szene zu verschwinden begannen. Er sah, dass die Jugend von Lokele immer seltener das Trommeln übte. Schuljungen lernten oft nicht einmal mehr, ihren eigenen Namen zu trommeln.44› Hinweis Das bedauerte er sehr. Carrington machte die Sprechtrommeln zu einem Teil seines Lebens. Im Jahr 1954 fand ihn ein Besucher aus den USA als Leiter einer Missionsschule im kongolesischen Außenposten Yalemba. Carrington ging nach wie vor jeden Tag in den Urwald, und wenn es Zeit für das Mittagessen war, rief ihn seine Frau mit einem schnellen Trommelwirbel: »Geist des weißen Mannes im Wald, komm, komm ins Haus der Schindeln des Geist des weißen Mannes hoch oben im Wald. Frau wartet mit Yams. Komm, komm.«45› Hinweis
Es dauerte nicht lange, und es gab Menschen (zum Beispiel in Afrika), für die der Pfad der Kommunikationstechnologie einen direkten Sprung von den Sprechtrommeln zur Mobiltelefonie vollzogen und alle dazwischenliegenden Stufen übersprungen hatte.
Die Dauerhaftigkeit des Wortes
Der Kopf besitzt kein Lexikon
»Odysseus weinte, als er den Dichter von seinen großen Taten in der Ferne singen hörte, denn sobald besungen, gehörten sie nicht mehr ihm allein. Sie gehörten jedem, der dem Lied lauschte





























