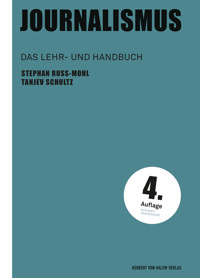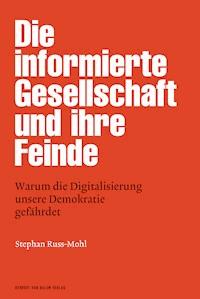
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herbert von Halem Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fake News, Halbwahrheiten, Konspirationstheorien – die Ausbreitung von Desinformation in der digitalisierten Welt, insbesondere in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter, wird immer mehr zur Bedrohung und zur Herausforderung für unsere Demokratie. Das Buch analysiert, welche Trends die Aufmerksamkeitsökonomie in eine Desinformationsökonomie verwandeln. Stichworte sind der langfristige Glaubwürdigkeitsverlust der traditionellen Medien, das rapide Wachstum und die Professionalisierung der Public Relations, die ungeplanten Folgen der rasanten Digitalisierung, darunter das Fehlen eines Geschäftsmodells für den Journalismus, Echokammern im Netz sowie die Algorithmen als neue Schleusenwärter in der öffentlichen Kommunikation. Eine strategische Rolle spielen die allmächtigen IT-Giganten, die sich nicht in ihre Karten gucken lassen möchten. Unter diesen Bedingungen gibt es vermehrt Akteure, die aus machtpolitischen Motiven an medialer Desinformation und an der Destabilisierung unserer Demokratie interessiert sind, oder die aus kommerziellen Motiven eine solche Destabilisierung in Kauf nehmen. Der Tradition der Aufklärung verpflichtet, ist die zentrale Frage des Buches, wie sich der wachsende Einfluss der "Feinde der informierten Gesellschaft" eindämmen lässt, darunter Populisten, Autokraten und deren Propagandatrupps. Könnte zum Beispiel eine "Allianz für die Aufklärung" etwas bewirken, der sich seriöse Journalisten und Wissenschaftler gemeinsam anschliessen? Dazu bedarf es nicht zuletzt realistischer Selbsteinschätzung auf seiten der Akteure. Dazu verhelfen Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie und der Verhaltensökonomie, die im Buch auf die Handelnden und den Prozess der öffentlichen Kommunikation bezogen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Stephan Russ-Mohl
Die informierte Gesellschaft und ihre Feinde Warum die Digitalisierung unsere Demokratie gefährdet
Köln: Halem, 2017
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme (inkl. Online-Netzwerken) gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2017 by Herbert von Halem Verlag, Köln
ISBN (Print)978-3-86962-274-3
ISBN (PDF)978-3-86962-276-7
ISBN (ePub)978-3-86962-275-0
Den Herbert von Halem Verlag erreichen Sie auch im Internet unter http://www.halem-verlag.de
E-Mail: [email protected]
SATZ: Herbert von Halem Verlag
GESTALTUNG: Claudia Ott Grafischer Entwurf, Düsseldorf
Copyright Lexicon ©1992 by The Enschedé Font Foundry.
Lexicon® is a Registered Trademark of The Enschedé Font Foundry.
Stephan Russ-Mohl
Die informierte Gesellschaftund ihre Feinde
Warum die Digitalisierung unsereDemokratie gefährdet
HERBERT VON HALEM VERLAG
INHALT
VORWORT
I.DIE PEST DER DESINFORMATION
1.FAKE NEWS ALS MEDIENHYPE – EINE ERSTE TOUR D’HORIZON
1.1Varianten von Fake News und Desinformation
1.2Kein neues Problem? Journalisten als Scharlatane und Schelme
1.3Journalisten als Opfer von Manipulation
1.4Die neue Dimension: Regierungsoffizielle Lügengeschichten in Serie
1.5Fake News über Fake News
1.6Von der Aufklärung zurück in die Unwissenheit?
2.VON DER AUFMERKSAMKEITSÖKONOMIE ZUR DESINFORMIERTEN GESELLSCHAFT?
2.1Die Karriere zweiter Zitate: Niklas Luhmann und Stewart Brand
2.2Auf den Schultern anderer Riesen: Georg Franck und die Verhaltensökonomen
2.3Die Vorder- und die Hinterbühne in der Aufmerksamkeitsökonomie
2.4Wie der Journalismus im Bermuda-Dreieck verschwindet
2.5Auf dem Weg in die desinformierte Gesellschaft
II.TRENDS
3.TREND EINS: JAHRZEHNTELANG IGNORIERTE VERTRAUENSVERLUSTE IM JOURNALISMUS
3.1Die Datenlage: Glaubwürdigkeit und Ansehen des Journalismus schwinden
3.2Rückblende: Selbstvertrauen bei den Medienmachern – Skepsis beim Publikum
3.3Übermacht der PR-Branche – Entmachtung des Journalismus?
3.4Schwindende Grenzen zwischen PR und Journalismus
3.5Kontrollillusion der Journalisten gegenüber PR-Experten
3.6PR verdrängt obendrein Werbung
3.7Bedeutungsverlust von Journalismus für die Öffentlichkeitsarbeit
4.TREND ZWEI: BESCHLEUNIGUNG DURCH DIGITALISIERUNG
4.1Die neuen Möglichkeiten der Vernetzung
4.2Neuerlicher Relevanz-Verlust des Journalismus
4.3Echokammern: Algorithmen als Verstärker
4.4Social Bots im Vormarsch
4.5Einbettung in den grösseren gesellschaftlichen Kontext
III.BEFUNDE: DIE VERLORENE UNSCHULD DES MAINSTREAM-JOURNALISMUS
5.ELITENARROGANZ UND ELITENKONSENS
6.SYSTEMVERSAGEN, GRAUZONEN, ENTSCHULDBARE FEHLER
6.1Panoptikum krasser Fehlleistungen
6.2Grauzonen des Journalismusversagens
6.3Entschuldbare Fehler
7.EIGENTORE
7.1Perzipierte und ›tatsächliche‹ Probleme: Medienhypes
7.2Tabus und mediale Unterbelichtung von Themen: Zum Beispiel die Mafia
7.3Sprache und Framing
7.4Un-Statistiken und Datensalat
7.5Content Marketing und Native Advertising
7.6Die vernachlässigten ›drei C‹
7.7Verspielter öffentlich-rechtlicher Kredit
8.DIE RÜCKKEHR AUTORITÄRER UND FEUDALER HERRSCHAFT
8.1Das Auftrumpfen der Autokraten: Putin und Erdogan
8.2Der Durchmarsch der Populisten: Trump, Le Pen, Grillo und die AfD
8.3Die Wiederkehr der Medienbarone: Viele kleine Murdochs und Berlusconis
8.4Die überwölbende Struktur: Das neue globale Feudalsystem der IT-Giganten
IV.WAS TUN? MÖGLICHKEITEN DES GEGENSTEUERNS
9.ÖKONOMISCHE ANREIZE, POLITISCHE REGULIERUNG, MEDIENERZIEHUNG
9.1Ökonomische Hebel: »Money makes the world go around«
9.2Die stumpfe Waffe: Staatliche Regulierung und Finanzierung
9.3Die Langfrist-Strategie: Medienerziehung
10.DIE MEDIENINDUSTRIE IN DER PFLICHT? CO- UND SELBSTREGULIERUNG
10.1Die Vielfalt der Faktencheck-Initiativen
10.2Ko-Regulierung: Die Schlüsselrolle und die Verantwortung der Plattformen
10.3Besinnung auf alte professionelle Tugenden
10.4Konturen des neuen Journalismus
10.5Fortschritte im Umgang mit den ›drei C‹?
11.ALLIANZ FÜR DIE AUFKLÄRUNG: EIN BÜNDNIS VON JOURNALISMUS UND WISSENSCHAFT?
11.1Die Win-win-Strategie in der Bedrängnis: Kräfte bündeln
11.2Gegenläufige Trends: Professionalisierung versus Prekarisierung
11.3Die Sondersituation: Medienforschung und Journalismus
11.4Das Kooperationspotenzial – realistisch eingeschätzt
11.5Netzwerke und Selbstorganisation als Chance
12.SCHLUSSAKKORD: WIR ALLE ALS TÄTER UND OPFER?
12.1Die Grenzen ›rationaler Ignoranz‹
12.2Wer zahlt für den ›neuen‹ Journalismus? Ein Hoffnungsschimmer
12.3Der ›Schizo‹ in uns und die gestufte Verantwortung
ANHANG
PERSONENREGISTER
LITERATUR
Zum Geleit: Francisco Goyas Kunstwerk Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer ist kurz nach der Französischen Revolution entstanden, also lange bevor George Orwell 1984, Aldous Huxley seine Schöne Neue Welt und Dave Eggers The Circle schreiben konnten.
VORWORT
Zwei Anspielungen sind mit dem Titel dieses Buches verbunden: Im Jahr 1945 hat der Philosoph Karl Popper seine Schrift Die offene Gesellschaft und ihre Feinde publiziert, und damit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gedanklich jenen Demokratien und Marktwirtschaften im westlichen Europa den Weg bereitet, die – für die damaligen Zeitgenossen kaum vorstellbar – in erstaunlich kurzer Zeit sich wie Phönix aus Schutt und Asche erhoben haben, die der Nazi-Größenwahn in Europa hinterlassen hatte (POPPER 1980).
So, wie sich die ›Dinge‹, soll heißen: Politik, Journalismus und die öffentliche Kommunikation in unserem Gemeinwesen derzeit entwickeln, ist diese offene Gesellschaft gefährdet. Zu ihren Feinden zählen explizit Populisten und Propagandisten, welche die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung und der sozialen Netzwerke zu nutzen versuchen, um im öffentlichen Raum mit Fake News, mit Konspirationstheorien, mit Halb- und Viertelwahrheiten zu ›punkten‹ oder Verwirrung zu stiften.
Diejenigen, die mit Desinformation entweder kommerziell oder machtpolitisch Gewinne erzielen, sind nicht nur Feinde der offenen, sondern auch der informierten Gesellschaft. Womit wir zur zweiten Anspielung kommen: Der Informatik-Professor Karl Steinbuch hat 1966 ein Buch zur Zukunft der Nachrichtentechnik veröffentlicht, und zwar noch im Frühstadium der Informationstechnologie. Es zeichnete sich seinerzeit bereits ab, wie revolutionär Computer und Kybernetik die Gesellschaft verändern würden. Der Titel lautete Die informierte Gesellschaft. Steinbuchs nachfolgender Bestseller Falsch programmiert war dann der Frage gewidmet, wie miserabel die bundesdeutsche Politik und Wirtschaft auf die seinerzeitige technologische Revolution vorbereitet waren (STEINBUCH 1966 und 1968).
Beides sind Aspekte, die uns rund 50 Jahre später als Folge des nächsten Schubs in der Informationstechnologie neuerlich auf den Nägeln brennen. Und sie sind Gegenstand dieses Buchs, das sich freilich weniger mit der Informationstechnologie selbst als mit deren Folgen auseinandersetzt – mit dem Internet, der Digitalisierung, den Suchmaschinen und den sozialen Netzwerken sowie deren Auswirkungen auf den Journalismus und die öffentliche Kommunikation.
ÜBERBLICK ZUM BUCH
Die vorliegende Schrift Die informierte Gesellschaft und ihre Feinde thematisiert, wie wir im Begriff sind, die Glaubwürdigkeit unserer Medien und damit die Essenz unserer Demokratie zu verspielen – als ungeplante Nebeneffekte der Digitalisierung, aber auch als Folge langfristiger Machtverschiebungen zwischen Journalismus und Public Relations sowie von pubertärer Hybris der weltumspannenden Internet-Konzerne.
Ob wir gerade eine Zeitenwende durchleben, mögen in ein paar Jahrzehnten die Historiker entscheiden. Unstrittig dürfte sein, dass wir es mit einer Zeitverschiebung zu tun haben: Es ist nicht mehr fünf vor, sondern fünf nach zwölf Uhr – im Blick auf die Vertrauensverluste der Mainstream-Medien1 und der europaweiten, anti-europäischen populistischen Erfolge, wie sie sich im britischen Brexit-Votum und der brachialen Exit-Strategie von Theresa May, in der Abwahl des linken wie des rechten Parteienestablishments in Frankreich, im Stimmenzuwachs für die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, im derzeit etwas gebremsten Aufstieg der AfD in Deutschland sowie – nicht zuletzt – in der Wahl von Donald Trump widerspiegeln. Es besteht akuter Handlungsbedarf im Kampf gegen Desinformation. Auch was sich auf ganz verschiedenen Ebenen von ganz unterschiedlichen Akteuren tun ließe, thematisiert dieses Buch.
Es ist in den letzten Monaten andererseits viel, vielleicht ja bereits zu viel und wahrscheinlich auch fast alles gesagt worden, was es über Falschnachrichten und Desinformation zu sagen gibt. Braucht es also dieses Kompendium überhaupt noch?
Es gibt mehrere triftige Gründe, die das Projekt rechtfertigen:
•Forscher haben zwar Themen wie die digitale Disruption, Echokammern und Social Bots in sozialen Netzwerken oder Nachrichtenauswahl durch Algorithmen inzwischen entdeckt, aber in der breiten Öffentlichkeit sind deren Facetten und Folgen noch kaum angekommen.
•Laura H. Owen vom Nieman Journalism Lab trifft den Nagel auf den Kopf: »Wenn man nur mal für ein verlängertes Wochenende offline geht, entgeht einem in den USA schon eine ganze Flut von neuen Umfragen, Studien und Artikeln über The Way We Media Now (OWEN 2017). Wer die Medienwelt und die Medienforschung in Europa beobachtet, hat sich mit weiteren solchen Flutwellen auseinanderzusetzen, die dann freilich in den USA so gut wie niemand zur Kenntnis nimmt. Es galt, eine geradezu überbordende Materialfülle zu sichten, zu ordnen, sich einen Überblick zu verschaffen – und das eigentlich täglich von Neuem.
•Medienforscher und Journalisten leben zunehmend in Parallelwelten. Was die eine Seite zur Diskussion beiträgt, bleibt auf der anderen Seite meist ungehört. Da sind die Features und Leitartikel, die Online-Kommentare oder Communities, in denen Medienpraktiker die Diskussion befeuern. Und da sind die Ergebnisse und Erkenntnisse der Medienforschung, die inzwischen meist in hochwissenschaftlichen Journal-Artikeln auf Englisch publiziert werden – fernab der medialen Windmaschinen. Dieses Buch versucht, in der Tradition Frank Schirrmachers Erkenntnisse von Medienforschern und Beobachtern aus der Medienpraxis zusammenzuführen, zu verdichten, aber auch in ihrer bunten Vielfalt zu veranschaulichen. (SCHIRRMACHER 2009) Damit das gelingt, sind immer mal wieder Rückblenden nötig, und vermutlich wird es einige Medienpraktiker schmerzen, wenn ihnen der Spiegel vorgehalten wird und sie daran erinnert werden, was sie hätten wissen können, wenn sie Medienforschern aufgeschlossen zugehört hätten (vgl. Kap. 4, 6 und 7).2
•Viele Einzelbefunde alarmieren bereits für sich genommen. Aber wohl erst in der Zusammenschau werden die Risiken und Nebenwirkungen moderner Kommunikationstechnologien und die Neuverteilung ökonomischer, politischer und publizistischer Macht für unser Gemeinwesen erkennbar. Dieser Überblick kann allerdings angesichts der Materialfülle bei weitem keine ›Gesamtschau‹ sein. Sichtbar wird, was die Forschungsleistungen anlangt, nur die Spitze des Eisbergs: Bisher kümmern sich eine Handvoll von Forschungsinstituten und Fachzeitschriften kontinuierlich um Visibilität außerhalb des Wissenschaftsbetriebs, vor allem im angelsächsischen Raum, zum Beispiel das Pew Research Center, das Nieman Lab der Harvard University, das Tow Center for Digital Journalism oder das Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford. Was all die anderen weltweit betrifft, bedürfte es schon eines ganzen Teams von journalistisch versierten Doktoranden, um jenen Teil des Eisbergs für die Medienpraxis zu erschließen, der bisher unterhalb der Wasseroberfläche verblieben ist (vgl. Kap. 11).
•Weiterhin baut diese Studie Brücken über Disziplingrenzen hinweg und bereichert die Diskussion um ökonomische und sozialpsychologische Einsichten, insbesondere um Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie (z. B. KAHNEMAN/TVERSKY 2000; ARIELY 2008; THALER 2015). Denn es gilt ja weiterhin, was Isaac Newton bereits bewusst war und der Soziologe Robert K. Merton uns dankenswerterweise in Erinnerung gerufen hat: Als Forscher sitzen wir stets auf den Schultern von Riesen (MERTON 1983). Meist sind das die Vordenker des eigenen Fachs. Über Jahrzehnte hinweg waren in der deutschen Kommunikationswissenschaft die drei prägenden Säulenheiligen Jürgen Habermas, Niklas Luhmann und Elisabeth Noelle-Neumann.3 Zu befürchten ist indes, dass die Sicht auch in lichter Höhe begrenzt ist und durch den Aktionsradius der jeweiligen Riesen eingeschränkt bleibt, wenn man es sich stets auf den Schultern derselben Vordenker bequem macht. Deshalb haben wir uns für einen ›anderen‹ Ausguck entschieden (vgl. Kap. 2).
•Interdisziplinäre Forschung ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil sich neue Horizonte erschließen, wenn man gelegentlich die Position wechselt.4 Wer in der Tradition von Ökonomen und Sozialpsychologen gesellschaftliche Entwicklungen primär als kumulatives Ergebnis mehr oder weniger rationaler und auch mehr oder weniger eigeninteressierter individueller Entscheidungen und Verhaltensmuster zu begreifen versucht, dem eröffnen sich andere Einsichten als beispielsweise Systemtheoretikern. Solches ›Fremdgehen‹ wird von Mainstream-Wissenschaftlern allerdings nicht gern gesehen. Wer interdisziplinär arbeiten möchte, geht das Risiko ein, in keiner Disziplin mehr ›richtig‹ zu Hause zu sein und spätestens beim nächsten Antrag auf Forschungsmittel abgestraft zu werden, weil ein Gutachter querschießt – und das reicht ja meistens schon aus, um ein Projekt zu liquidieren.
•Außerdem hat sich der Verfasser über Jahrzehnte hinweg mit dem amerikanischen Journalismus, mit vergleichender Journalismusforschung, mit Wissenschaftskommunikation sowie mit der unabdingbaren Kehrseite der Pressefreiheit befasst, mit journalistischer Qualitätssicherung und mit Media accountability, also der Rechenschaftspflichtigkeit und Verantwortungsbereitschaft von Medien. Seit 2004 hat er schließlich das European Journalism Observatory (EJO) mitaufgebaut – ein Netzwerk von Forschungsinstituten in Europa, die Journalismus beobachten, Medientrends erfassen und Medienforschung für Praktiker zugänglich machen wollen. Das Netzwerk bietet inzwischen Information über Journalismus und Medien in 13 Sprachen. Auch vom Fundus an Geschichten, die die EJO-Partner gemeinsam erarbeitet und publiziert haben, zehrt diese Publikation (vgl. Kap. 4, 6, 7, 9 und 10). Sie ist somit nicht zuletzt ein sehr persönliches Buch.
Inzwischen haben sich die Ereignisse überstürzt, und die Arbeit an diesem Projekt bot auch Gelegenheit, frühere Erkenntnisse und Einsichten noch einmal neu aufzubereiten. Um das Thema einem grösseren Publikum zu erschließen, folgen Schreibe und Präsentation eher journalistischen als wissenschaftlichen Standards. Das Buch soll aber auch die Fachdiskussion mit erfassen und es Forschern und Studierenden ermöglichen, die jeweiligen wissenschaftlichen Quellen zu identifizieren und zu nutzen.5
Das zweite Kapitel im ersten Teil skizziert die ökonomischen Grundlagen der Aufmerksamkeitsökonomie. Es wird gezeigt, weshalb der Journalismus in Bedrängnis geraten ist. Besonders fokussiert werden jene Verschiebungen im Machtgefüge zwischen Journalismus, PR und Werbung, die dazu führen, dass sich die Aufmerksamkeitsökonomie zur Desinformationsökonomie weiterentwickelt.
Die beiden folgenden Kapitel im zweiten Teil gehen stärker ins Detail. Kapitel 3 spürt einem ersten Trend nach, dem langfristigen Vertrauensverlust in den Journalismus. Kapitel 4 zeigt, wie das Internet, insbesondere seine Suchmaschinen und sozialen Netzwerke, innerhalb kürzester Zeit einen zweiten Trend generiert haben, der den Journalismus bedrängt und die rapide Ausbreitung von Desinformation begünstigt: die digitale Disruption.
Teil III vertieft, auf den Journalismus bezogen, die Befunde. In Kapitel 5 wird der Frage nachgespürt, weshalb viele Menschen den Journalismus als ›elitär‹ wahrnehmen und vermuten, dass die Redaktionen mit den herrschenden Politikern, Wirtschaftsführern und Kulturschaffenden unter einer Decke stecken. Kapitel 6 und 7 widmen sich der journalistischen Praxis in den Mainstream-Medien: Wo haben sie versagt? Was sind krasse und was entschuldbare Fehlleistungen? Warum tut sich der Journalismus mit Selbstreflexion und einer Fehlerberichtigungskultur so schwer? Und wie gross sind die Unterschiede innerhalb Europas im Umgang mit Desinformation und bei der Selbstbehauptung des seriösen Journalismus?
Das achte Kapitel skizziert sehr reale Bedrohungsszenarien: Inwieweit gefährden Autokraten und Populisten unabhängigen Journalismus und Pressefreiheit? Was haben wir von einer neuen Generation von Medieneignern zu erwarten, die Redaktionen für politisch-ideologische Zwecke einsetzen, sei es als Spielzeug, sei es als Folterinstrument und Pranger für ihre Gegner? Welche Rolle spielen die IT-Giganten?
Teil 4 und somit die letzten Kapitel sind der Frage gewidmet, was realistischerweise getan werden kann, um Desinformation zu bekämpfen. Im neunten Kapitel wird geklärt, was wir von mächtigen Marktakteuren, von der Politik, dem Bildungssystem und der Medienerziehung erwarten können. Das zehnte Kapitel lotet aus, was die IT-Konzerne selbst, aber auch herkömmliche Medienunternehmen und journalistische Start-ups zur Bekämpfung von Desinformation zu leisten hätten. Kapitel 11 vertieft diesen Aspekt: es wird geprüft, ob der seriöse Teil des Journalismus und die Wissenschaft mit Erfolgsaussicht eine Allianz für die Aufklärung eingehen können, um Fake News und Konspirationstheorien einzudämmen.
Das abschließende Kapitel 12 ist dem ›eigentlichen‹ Souverän gewidmet – uns allen, den Usern und Medienkonsumenten. »Here comes everybody«, avisierte bereits vor Jahren der Internet-Guru Clay Shirky, und sein Kollege James Surowiecki prognostizierte seinerzeit noch einen Siegeszug der Schwarmintelligenz. Wenn beide sich von ihrem Optimismus ein Fünkchen bewahrt haben sollten, dann sind weiterhin auch Herr und Frau Jedermann gefragt und gefordert, der Schwarmdummheit ihre aufklärerische Intelligenz entgegenzusetzen.
Die Entwicklungen und Trends, die in diesem Buch skizziert werden verleiten trotzdem eher zur Spekulation über einen bevorstehenden Desinformations-GAU als zu Optimismus: Ob Nachrichten ›wahr‹ oder ›falsch‹ sind, spielt kaum noch eine Rolle, weil sich mit Desinformation, die gezielt in sozialen Netzwerken viral verbreitet wird, die ›Wahrheit‹ wegspülen lässt. Wir sitzen in der Falle – und haben es nur noch nicht so richtig gemerkt. Andererseits wurde dieses Buch auch in der Hoffnung geschrieben, dass das Ende der Aufklärung noch nicht besiegelt ist. Noch kann es gelingen, in der freiheitlichen Gesellschaft Gegenkräfte zu mobilisieren, noch lässt sich hoffentlich der Uhrzeiger zurückstellen von ›fünf nach‹ auf ›fünf vor 12‹.
DANK
Dank gebührt zuallererst meiner Frau Jutta. Ihr widme ich dieses Buch. Sie hat mich nicht nur über Monate des Auf und Ab in der ›Schreibklausur‹ hinweg ertragen, sondern mit vielerlei Anregungen zu diesem Buch beigetragen. Sodann meinen Mitstreitern an der Università della Svizzera italiana in Lugano, Georgia Ertz, Marcello Foa, Philip di Salvo und Bartosz Wilczek sowie allen Kolleginnen und Kollegen aus Journalismus und Wissenschaft, die zu meinem Netzwerk gehören und dieses Buchprojekt mit wertvollen Literaturtipps und Hinweisen unterstützt haben, namentlich James T. Hamilton, Hans Mathias Kepplinger, Andrea Nordbrink, Bernd Pitz, Tanjev Schultz, Ignaz Staub und Gerhard Vowe. Weiter möchte ich den Kooperationspartnern des European Journalism Observatory danken, die Recherchen zum europaweiten Überblick über Fake News in Kapitel 4 und zu den neuen Medienbaronen in Kapitel 8 beisteuerten. Viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus und der Medienforschung haben dieses Buchprojekt geduldig mit ihren Einzelauskünften unterstützt und es um wertvolle Informationen angereichert. Sie lassen sich hier nicht allesamt auflisten, sind aber jeweils in entsprechenden Fußnoten vermerkt.
Ein besonderes Dankeschön geht an die Fondazione Corriere del Ticino, die Stiftung Pressehaus NRZ und die Robert Bosch Stiftung, namentlich an Fabio Soldati, an Heinrich Meyer, an Uta-Micaela Dürig und Joachim Rogall, ohne deren nachhaltige, langjährige Förderung des European Journalism Observatory dieses Buch nicht hätte entstehen können. Ganz spezieller Dank gilt Herbert von Halem, dessen munterentschlossener Zuspruch mich erst in Zugzwang brachte, den Text in vergleichsweise kurzer Zeit tatsächlich zu schreiben, sowie meinem Lektor Julian Pitten. Last but not least möchte ich Romi Arm und dem Museum Oskar Reinhart in Winterthur für die Druckvorlage von Goyas Capricho Nr. 43 danken.
Berlin und Lugano, im Juni 2017
Stephan Russ-Mohl
1Im Folgenden werden die Begriffe ›Mainstream-Medien‹ und ›traditionelle Medien‹ abwechselnd und ›wertfrei‹ verwendet, wohl wissend, dass umgangssprachlich und in der derzeitigen politischen Auseinandersetzung beide Begriffe eine negative Konnotation haben – der eine Terminus im Sinne von ›eng und einseitig‹, der andere, weil er insinuiert, diese Medien seien ›altbacken und hinterwäldlerisch‹ im digitalen Neuland.
2In das Buch fließen verschiedentlich Erkenntnisse aus eigenen früheren Publikationen mit ein, die aktualisiert und – je nach Bedarf – kondensiert oder auch stark erweitert wurden. Insbesondere basieren die Kapitel 3, 4 und 11 auf drei neueren Publikationen: RUSS-MOHL 2017, 2017a. Punktuell wird auch auf eigene Buchveröffentlichungen rekurriert, insbesondere RUSS-MOHL 1994 und 2009 sowie FENGLER/RUSS-MOHL 2005.
3Vgl. WEISCHENBERG 2012; 2014, der allerdings Noelle-Neumann ausblendet; dazu: RUSS-MOHL 2014.
4Dies haben wir im Blick auf die Ökonomik (FENGLER/RUSS-MOHL 2005; RUSS-MOHL 1994) und die Verhaltensökonomie (FENGLER/RUSS-MOHL 2014; RUSS-MOHL 2010a und 2010b) wiederholt getan (selbstreflexiv dazu: RUSS-MOHL 2012). Die verhaltensökonomische Perspektive ergänzt dabei sinnvoll jene der traditionellen neoklassischen Ökonomik, welche als Ausgangspunkt für realistischere Modellentwicklung weiterhin ihren Stellenwert behält (THALER 2015: 7). Und in ähnlicher Weise sollte unser Versuch, Ökonomik und Verhaltensökonomie in den Theorienfundus der Kommunikationswissenschaft einzubringen, nicht als ›Kriegserklärung‹ an die Systemtheoretiker verstanden werden, sondern als eine horizonterweiternde Zusatzperspektive (FENGLER/RUSS-MOHL 2005: 200; RUSS-MOHL 2012).
5Das Literaturverzeichnis steht unter http://www.halem-verlag.de/die-informierte-gesellschaft-und-ihre-feinde/ zum Download zur Verfügung.
I.DIE PEST DER DESINFORMATION
1.FAKE NEWS ALS MEDIENHYPE – EINE ERSTE TOUR D’HORIZON
Fake News haben Karriere gemacht, sie sind zum Medienhype geworden. Leider geht es indes nicht nur um einen Hype. Desinformation ist die Pest der digitalisierten Gesellschaft. Sie breitet sich nicht nur epidemisch aus, sie verändert auch unsere Wahrnehmung dessen, was wir für wahr halten. Diese Pest zu bekämpfen, wird mehr und mehr zur zentralen Herausforderung für seriöse Medien, ja für die Demokratie und für freiheitliche Gesellschaften. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie sich Info-Müll und mentale Umweltverschmutzung eindämmen lassen.
Ein paar Beispiele zur Veranschaulichung, allesamt ziemlich heftig:
•Um einmal mehr die Glaubwürdigkeit eines Leitmediums zu unterminieren, unterstellten rechte Blogger und AfD-Mitglieder nach dem Londoner Terroranschlag vom Juni 2017 CNN, der Sender habe den Anti-Terror-Protest von Muslimen erfunden und inszeniert. Der Vorwurf war frei erfunden – auch andere Sender hatten die muslimischen Demonstranten gefilmt. Es ist immer wieder besonders erschreckend, wie hemmungslos nach solchen Anschlägen Falschmeldungen in die Welt gesetzt werden und wie die Gerüchteküche brodelt. Auf den Bombenterror folgt berechenbar medialer Terror voreiliger Schuldzuweisungen, Verdächtigungen und Kurzschlussreaktionen.
•BuzzFeed hat dokumentiert, wie nach dem Londoner Terroranschlag auf das Parlament in Westminster im März 2017 der britische CHANNEL 4 zunächst einen Araber verdächtigte, der zum Zeitpunkt des Anschlags im Gefängnis saß. Russische Medien brachten dagegen ein Fake-Foto des angeblich afghanischen oder pakistanischen Täters in Umlauf, das drei Jahre alt war. AL JAZEERA verbreitete auf seiner Facebook-Seite, die muslimische Welt würde ›erheitert‹ auf den Anschlag reagieren. Ein Interview mit dem Londoner Bürgermeister Sadiq Khan wurde so aus dem Kontext gerissen und entstellt, dass der Eindruck von Gleichgültigkeit entstehen musste – solche Anschläge seien einfach »Großstadt-Alltag« (vgl. LYTVYNENKO/DARMANIN 2017).
•Anfang 2017 kursierte nicht nur in russischen Medien, Bundeswehrsoldaten hätten in Litauen ein Mädchen vergewaltigt. Ein Jahr zuvor hatten vor allem vom Kreml kontrollierte Medien die Geschichte der 13-jährigen Russlanddeutschen Lisa verbreitet, die vorgab, von ›Südländern‹ entführt und vergewaltigt worden zu sein – eine Fake-Geschichte, die auf einer Falschaussage des Mädchens basierte, aber gleichwohl eine Welle von Empörung generierte.
•Nach dem Mord an einer Studentin in Freiburg dichtete der rechtspopulistische Schweizer Nachwuchspolitiker Ignaz Bearth, der offenbar sein Fälschertalent erproben wollte, der Grünen-Politikerin Renate Künast das Statement an, der »traumatisierte Flüchtling« habe »zwar getötet«, man müsse »ihm aber jetzt trotzdem helfen« (Tages-Anzeiger 2016, PLÖCHINGER 2017). Bearth hatte mit seiner Diskreditierung nur mäßigen Erfolg, handelte sich aber eine Strafanzeige ein.
•Die Hoaxmap, eine Website, deren Betreiber es sich zur Aufgabe gemacht haben, Falschmeldungen über Asylanten und Flüchtlinge im deutschsprachigen Raum zu dokumentieren, verzeichnete ein Jahr nach dem Start insgesamt 457 Einträge.6 Natürlich waren Vergewaltigungen und Diebstähle unter den frei erfundenen Delikten, aber auch um Wilderei, die Schlachtung von Schwänen und geschändete Grabmäler ging es.
Im angelsächsischen Sprachraum wurde die Falschmeldung, Papst Franziskus habe Donald Trump zur Wahl empfohlen, in kurzer Zeit 960.000 Mal geteilt (LOBE 2016a). Sie war damit der Spitzenreiter im Fake-News-Ranking zur US-Wahlschlacht. Auch folgende Statements der beiden US-Präsidentschaftskandidaten wurden Renner im Netz. Donald Trump wurde untergejubelt, er habe 1998 gesagt: »Wenn ich antreten würde, würde ich das als Republikaner tun. Die haben die dümmsten Wähler, die alles glauben, was FOX NEWS berichtet. Ich könnte lügen, und sie würden das schlucken.« Hillary Clinton wiederum soll sich 2013 für »Leute wie Trump als Kandidaten« ausgesprochen haben, der »ehrlich und nicht käuflich« sei. Beide Zitate sind frei erfunden – ebenso wie Donald Trumps gestreute Desinformationen, Millionen von Immigranten hätten ohne Wahlberechtigung ihre Stimme abgegeben, oder sein Vorgänger Obama habe ihn abhören lassen. Der bereits gewählte Präsident durfte das ungestraft behaupten, auch wenn noch nicht einmal sein eigenes republikanisches Lager dafür die leisesten Anzeichen zu erkennen vermochte (GEISEL 2017). Je abstruser die Lügen, desto mehr Anklang scheinen sie oftmals in den virtuellen Resonanzräumen zu finden: So kursierte im Netz auch die Verschwörungstheorie, Präsident Barack Obama und Hillary Clinton hätten den Islamischen Staat (IS) gegründet oder – wahlweise – der IS habe für Clinton eine Wahlempfehlung ausgesprochen (SCHWARTZ 2017.). Ein weiteres, besonders groteskes Beispiel war ›PizzaGate‹: die Anschuldigung, Clinton habe zusammen mit ihrem Wahlkampfmanager John Podesta in einer Washingtoner Pizzeria einen Ring für Kinderpornografie betrieben, geistert weiterhin durch den Cyberspace – auch nachdem ein irregeleiteter 28-Jähriger mit einer Waffe das Lokal stürmte, um die Kinder zu befreien.
Ob es um Chemtrails oder die Flat Earth Theory, um Impfungen oder die Klimakatastrophe geht, ob der US-Wahlkampf, die Krim-Besetzung, Faschisten in der Ukraine, der IS-Terror oder der Tabak-, Zucker- oder Drogenkonsum angesagt sind – zu all diesen Themen zirkulieren im Netz zunehmend zählebige Falschinformationen, die keiner seriösen Überprüfung standhalten. Weil wir ja alle zahlengläubig sind, ist es in Zeiten von Big Data außerdem ganz besonders infam, wenn gefälschte Statistiken in Umlauf gebracht werden – en vogue ist das »beliebige Herumschleudern von Zahlen, nicht etwa, weil sie wahr oder falsch sind, sondern weil sich mit ihnen eine Botschaft verkaufen lässt«, so Tim Harford, Kolumnist der Financial Times (HARFORD 2016).
1.1VARIANTEN VON FAKE NEWS UND DESINFORMATION
Fake News und Desinformation haben viele Grauschattierungen. Beim Versuch, etwas Ordnung in die Diskussion zu bringen, unterscheiden wir in Anlehnung an Claire Wardle (2017), die bei der kürzlich gegründeten Allianz FirstDraft für die Strategieentwicklung im Kampf gegen Desinformation zuständig ist und zuvor am Tow Center for Digital Journalism der Columbia University Forschungsdirektorin war, sieben Varianten von Fake News:
•Satire oder Parodie: In diesem Fall gibt es keine Intention, Schaden zu verursachen, wohl aber das Potenzial, Missverständnisse auszulösen, weil zum Beispiel Ironie nicht verstanden wird;
•irreführende Inhalte, um ein Thema oder eine Person in Misskredit zu bringen;
•betrügerische Quellenangaben;
•frei erfundene Inhalte: Sie sind falsch und in der Absicht generiert, zu betrügen und Schaden anzurichten;
•falsche Verknüpfungen: Überschriften, Visualisierungen oder Bildlegenden sind irreführend und durch den Inhalt eines Texts nicht gedeckt;
•falscher Kontext: Zutreffende Information wird verfälscht, indem sie in einen falschen Kontext gestellt wird;
•manipulierter Inhalt: Zutreffende Text- oder Bild-Information wird verändert und verfälscht.
Außerdem trennt Wardle zumindest analytisch die ›acht P‹, die als denkbare Motivationen und Treiber zur Kreation von Fake News führen können (WARDLE 2017):
•Poor Journalism – also armseliger, schlecht recherchierter Journalismus,
•Parody – sprich Komik, Parodie, Satire,
•Provoke or ›Punk‹ – Provokationsabsicht,
•Passion – Leidenschaft,
•Partisanship – Parteilichkeit,
•Profit – Gewinnstreben, Profitgier,
•Political Influence or Power – politischer Einfluss oder Macht sowie
•Propaganda.
Georg Mascolo, der Leiter des Rechercheverbunds von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, betrachtet Desinformation und Fake News »als enge Verwandte« und unterstreicht ebenfalls die Absicht des jeweiligen Absenders: »Desinformation wie Fake News meint die gezielte Verbreitung unzutreffender Informationen, sie muss nicht nur objektiv falsch sein, der Urheber muss dies auch wissen. Eine bewusste Lüge also. Sie kann völlig erfunden sein oder durch Auslassungen und Verkürzungen einen bewusst falschen Eindruck erwecken« (MASCOLO 2017).
Ferner sind Auflistungen beeindruckend, welche Verschwörungstheorien uns über die Zeitläufte hinweg begleiteten.7 Auch sie wurden keineswegs erst ›erfunden‹, seitdem in den sozialen Netzwerken vor Impfschäden gewarnt wird, oder dort Wirrköpfe die Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon von 2001 der CIA zur Last legen.
Eine Konspirationstheorie bedeutet, ein komplexes Ereignis oder Geschehen in Form eines Gerüchts möglichst einfach, eben durch Verschwörung irgendwelcher mächtiger und geheimnisvoller Strippenzieher, zu erklären. Weil gerade autokratische Regierungen, zumal in Phasen wirtschaftlicher Schwäche, Feindbilder brauchen, nutzen sie und die von ihnen kontrollierten Medien vielfach Verschwörungstheorien zur Welterklärung: Für die Nazis war es das Weltjudentum; Recep Tayyip Erdoğan und Wladimir Putin stempeln politische Gegner und nationale Minderheiten als Terroristen ab.
Im Folgenden werden wir ›Desinformation‹ als Oberbegriff für alle denkbaren Formen von Fake News, Verschwörungstheorien und Manipulationen im Nachrichtengeschäft verwenden.
1.2KEIN NEUES PROBLEM? JOURNALISTEN ALS SCHARLATANE UND SCHELME
Alles schon mal da gewesen? Ja und nein.
Der Journalist Burkhard Müller-Ullrich publizierte 1996 ein Buch mit dem Titel Medien-Märchen, und sein erster Satz lautete damals: »Neueste Untersuchungen haben gezeigt, dass in den Medien gegenwärtig bis zu 46 Prozent mehr gelogen wird als vor zehn Jahren.« Noch im ersten Absatz beklagte er »sprudelnden Nachrichtenmüll« – wir würden »bespien mit Behauptungen, die keiner überprüft hat« und die sich, »wenn man mit dem Fingernagel des Durchschnittsverstandes daran kratzt, in Schall und Rauch auflösen« (MÜLLER-ULLRICH 1996: 9). Einmal abgesehen von der Tatsache, dass hier offenbar kein Lektor amtierte und die Zahl der Metaphern auf ein erträgliches Maß reduziert hat: Das Problem Fake News war offenbar bereits Ende des vorigen Jahrhunderts so virulent, dass sich Bücher damit füllen ließen. Leider fehlt bei MüllerUllrich die Quellenangabe, um im Blick auf die zitierten Studien eine Überprüfungsrecherche vornehmen zu können.
Diesseits wie jenseits des Atlantiks waren und sind in jüngster Zeit namhafte Journalisten und Karikaturisten dem Medienhype um Falschnachrichten auf der Spur. Um zu zeigen, dass Trump nicht alleine auf der Welt ist, haben zahlreiche Medienexperten den skurrilsten Fake-News-Geschichten und somit zugleich der Geschichte von Falschnachrichten nachgespürt.8
Fraglos hat es im Medienbetrieb schon immer Scharlatane und Schelme gegeben, die mit Fakes spielten und ihre eigenen ›Wahrheiten‹ erfanden. Kurt W. Zimmermann, heute Chefredakteur des Branchenblatts Schweizer Journalist, war über vier Jahre hinweg Redaktionsleiter der Schweizer Sonntagszeitung und anschließend Herausgeber des Nachrichtenmagazins Facts. Er erinnert sich: »Nun, ich habe während meiner Chefredaktoren-Zeit so viele Journalisten erlebt, die das Blaue vom Himmel herunterschwindelten, nur um ihre steile These zu stützen.«9
Auf der Suche nach Journalisten und Medienmachern, die ihr Publikum an der Nase herumführten, fallen einem beispielsweise Tom Kummer oder Jayson Blair ein. Der eine hat im deutschsprachigen Raum als Serientäter so renommierte Medien wie die Magazine der Süddeutschen Zeitung und des Tages-Anzeigers und später neuerlich die Berliner Zeitung und die Weltwoche genarrt, der andere über Monate hinweg der New York Times seine Bären aufgebunden (vgl. Kap. 6, S. 132ff.).
Doch es gibt Beispiele mit weitaus prominenteren Akteuren. Dem rasenden Reporter Egon Erwin Kisch und seinem polnischen Kollegen Ryszard Kapuściński, beide Journalisten-Ikonen des 20. Jahrhunderts, haben Biografen nachgewiesen, dass sie die ein oder andere Geschichte frei erfunden haben, ohne dass dies ihrem Ruhm und ihrer Reputation nennenswert geschadet hätte. Bei Kapuściński ging ging es um seine Reportagen aus Äthiopien, bei Kisch um die eigene Biografie. Sein Beispiel für den kreativen Umgang mit Fake News ist einfach zu schön, um wahr zu sein: Kisch hatte nämlich mehrfach »gebeichtet«, er habe »seine Karriere mit einer Lüge begonnen«. Als er als Berichterstatter zu einem Mühlenbrand geschickt worden war, habe er, um die Geschichte spannender zu machen, »selbstlos löschende Obdachlose« hinzuerfunden. Für seine sensationelle Rührgeschichte habe er »höchstes Lob« eingeheimst, während die getreulich berichtenden Kollegen gescholten worden seien. Da habe er aus Scham beschlossen, zukünftig strikt bei den Tatsachen zu bleiben.
Seine Freunde, so berichtet weiter der Berliner Literaturwissenschaftler Erhard Schütz (1993), der die Geschichte wieder ausgegraben hat, glaubten es gern und seien »nicht müde geworden, die Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit Kischs zu rühmen«. Kisch habe indes »keineswegs die Obdachlosen erfunden, sondern einen ganz braven und biederen Bericht geliefert. Kischs erfundene Reportage war also die Erfindung des Reporters«, sie diente einzig und allein der Selbstinszenierung. Der rasende Reporter habe bei seiner Beichte »wohl nicht geahnt, dass sein Werk später einmal zum Gegenstand für Philologen – den neben Reportern und Detektiven hartnäckigsten Rechercheuren – werden würde«, so Schütz (1993).
Ein weiteres Beispiel für Fake News, die es zu Weltruhm gebracht haben, ist eine Radio-Sendung von Orson Welles aus dem Jahr 1938 über eine Invasion der Marsmenschen in New York. Sie soll eine Panik ausgelöst haben und musste über Jahrzehnte hinweg dazu herhalten, um die Forschungshypothese von den starken Wirkungen der Massenmedien zu unterfüttern. Besonders hübsch daran ist, dass die Massenpanik offenbar selbst eine Fake News war, wie der Kultur-Chef des Daily Telegraph, Martin Chilton, kürzlich herausgefunden hat (2016).
FÄLSCHUNGEN IN MEDIENPÄDAGOGISCHER ABSICHT
Es gab indes auch Schlitzohren, die in bester medienpädagogischer Absicht zeigen wollten, wie leicht es ist, Journalisten ebenso wie das Publikum zu überlisten: Besonders erheiternde Beispiele steuerte der Wiener Ingenieur und Wissenschaftsjournalist Artur Schütz bei – seine legendären »Grubenhunde«, die später der Münchner Kommunikationswissenschaftler Walter Hömberg wieder ausgebuddelt hat (SCHÜTZ 1996 [Neuaufl.]: 43f.). Was Kummer, Born, Blair & Co. aus eher zwielichtigen Motiven getan haben, das betrieb in den zwanziger Jahren Schütz in aufklärerischer Passion: Er drehte den Redaktionen immer wieder Storys an, die dank der Unaufmerksamkeit und Schlamperei der Redakteure als Zeitungsenten das Licht der Öffentlichkeit erblickten, und seine Geschichten wurden immer grotesker: feuerfeste Kohle, einen rechteckigen Kreis und einen ›neuen‹ Eisenbahnwaggon, der mit »stoßdämpfenden ovalen Radsätzen versehen« war und in dem unter anderem »eine Dame mit ihrem fünf Monate alten Töchterchen« auf der Reise in die Schweiz »von plötzlichen Geburtswehen überrascht wurde«. Ein »Grubenhund«, so geriet Schütz ins Schwärmen, »ist kein Aprilscherz, kein Faschingsulk, kein Jux«. Er wirke als »Korrektiv gegen die Denkfaulheit«, die es »den Zeitungen gestattet, gehaltlose Phrasen statt wirklichen Inhalt zu bringen« – und schließlich zerstöre ein Grubenhund »den blinden Glauben an das gedruckte Wort« (ebd.).
1.3JOURNALISTEN ALS OPFER VON MANIPULATION
Historiker können mit einer langen Liste von Fallbeispielen aufwarten, wo und wie Machthaber und ihre Spindoktoren Medien manipulierten und Journalisten belogen haben. Otto von Bismarcks Emser Depesche wäre zu nennen, oder der Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels, der den Reichstagsbrand instrumentalisierte, und sein Führer Adolf Hitler, der später zu Beginn des Zweiten Weltkriegs mit seinem Statement »Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen« Polen zum Aggressor abstempelte; oder Josef Stalin, der mit Bild-Retuschen seine engsten Gefolgsleute – einen nach dem anderen – aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden ließ, nachdem er sie zuvor hatte ermorden lassen; und nicht zuletzt George Bush jr. und Tony Blair, die für ihren Irak-Feldzug Zustimmung mobilisieren wollten und deshalb behaupteten, Saddam Hussein verfüge über Massenvernichtungswaffen und kooperiere mit den Taliban (vgl. als Überblick auch: REISIN 2017).
Georg Mascolo (2017) erinnert anekdotisch an die Zeiten, als »die Herstellung und Verbreitung von Lügen und Halbwahrheiten noch eine mühsame Angelegenheit war« und als Fake News aus dem Osten per Post an westliche Adressaten verschickt wurden. Die Offiziere der DDR-Staatssicherheit hätten sich Gummihandschuhe übergezogen – »eine Vorsichtsmaßnahme, an den Briefumschlägen durften keine Fingerabdrücke zurückbleiben. Die Briefmarken wurden mit Wasser aus dem Blumentopf angefeuchtet. Denn das Bundeskriminalamt in Deutschland-West war dazu übergegangen, in Verdachtsfällen die Spucke zu analysieren«.
Solche Analysen von Spin und Propaganda haben in jüngster Zeit Forscher vertieft, die sich speziell mit politischer Kommunikation auseinandersetzen und zeigen, wie in den westlichen Demokratien die PR-Maschinerie und das Kampagnenmanagement sukzessive ausgebaut und perfektioniert wurden – beispielsweise von Matthias Machnig und Gerhard Schröder sowie von Alistair Campbell unter Tony Blair im Kampf um Downing Street Nr. 10, in Italien von Silvio Berlusconi mit tatkräftiger Unterstützung der zahlreichen Vasallen in seinem TV- und Print-Imperium, sowie – bereits unter Einbezug der neuen Möglichkeiten der sozialen Netzwerke in den USA – von Barack Obama und schließlich von Donald Trump mithilfe der geheimnisvoll-ominösen Beratungsfirma Cambridge Analytica. Dabei wurden nicht nur geografische Grenzen überschritten.10
1.4DIE NEUE DIMENSION: REGIERUNGSOFFIZIELLE LÜGENGESCHICHTEN IN SERIE
Von Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder ist sein Credo überliefert, zum Regieren benötige er nur Bild, BAMS und die Glotze. Bei Trump hat sich dies bereits drastisch verschoben: Er braucht erkennbar, so sehen das jedenfalls zahlreiche amerikanische Medienbeobachter, vor allem Twitter sowie die anderen sozialen Netzwerke als Link-Schleudern. Till Wäscher, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medien- und Kommunikationspolitik in Köln, weist darauf hin, dass vor allem Google, Twitter und Facebook »als nahezu komplett unregulierte Ökosysteme« Trump und ihresgleichen die Verbreitung »alternativer Fakten« ermöglichten. Nur durch die sozialen Netzwerke konnten »Krawalljournalismus-Seiten wie Breitbart und The Gateway Pundit eine größere Leserschaft erreichen – und deren Vertreter schließlich im Pressekorps des Weißen Haus landen« (WÄSCHER 2017). Diese Fokussierung allein auf die Online-Medien greift allerdings auch zu kurz: Ohne die tatkräftige Unterstützung von FOX NEWS, Rupert Murdochs rechtslastigem TV-Netzwerk, hätte Trump keine Chance gehabt, Clinton zu schlagen. Denn er errang ja nicht in den Internet-Hochburgen an der Ost- und Westküste, sondern im weniger netzaffinen Landesinneren der USA seinen Wahlsieg.
Der chilling effect, der Schock sitzt noch immer tief – mit Trumps Inauguration wurde die bisherige Ausnahme von der Regel zum Tagesgeschäft: die regierungsoffizielle Desinformation, einhergehend mit nahezu täglich neuen Kriegserklärungen an die Mainstream-Medien. Als illustratives Beispiel taugt ein Interview mit Präsident Trump, in dem die Faktenchecker alle Text-Teile geschwärzt haben, die nicht der Wahrheit entsprechen. Es kann hier nur auszugsweise wiedergegeben werden, das Original erstreckt sich über neun Seiten (s. Abb. 1).
ABBILDUNG 1
Faktenchecker im Einsatz:Geschwärzte Falschaussagen von Präsident Trump
Screenshot einer geschwärtzen Seite von http://theslot.jezebel.com/we-redacted-everything-thats-not-a-verifiably-true-stat-1793571837
Der Medienexperte der New York Times, Jim Rutenberg, konstatierte, bis dato sei in seiner Wahrnehmung Desinformation das Kennzeichen von »Diktaturen, Bananenrepubliken und gescheiterten Staaten« gewesen, während es in den USA selbst eine geradezu »sentimentale Ehrfurcht vor der Wahrheit und eifersüchtig gehütete Pressefreiheit« gegeben habe. Diese seien zwar »niemals perfekt« gewesen, aber doch für die globale Rolle Amerikas »genauso wichtig wie seine militärische Stärke und die Verlässlichkeit seiner Währung«. Es sei der »felsige Grund für den Exzeptionalismus Amerikas« gewesen, geriet Rutenberg (2017) ins Schwärmen.
Zynisch angehauchte Medienprofis wie Kurt W. Zimmermann meinen dagegen, den klassischen Medien sei lediglich ihr Monopol zur Verbreitung von Fake News abhandengekommen.11 Auch daran ist ein Körnchen Wahrheit, und doch verfehlt dieses Argument den eigentlich Punkt. Auf ihn kommt Paul Krugman, Wirtschafts-Nobelpreisträger und Kolumnist der New York Times, zu sprechen: Statt herkömmlichem Spin, der der ›Wahrheit‹ jeweils einen Dreh gegeben hat, lügen die neuen Rechten und auch die neuen Machthaber in der amerikanischen Regierung als Serientäter wie gedruckt. Sie kommen damit erstaunlich oft und auch seit erstaunlich langer Zeit durch, wenn man den Wahlkampf und die Phase des unaufhaltbaren Aufstiegs von Trump mitrechnet. Das Getting away with it funktioniert bislang wie geschmiert – trotz bewundernswerter Aufklärungs-Anstrengungen und -Erfolge der Mainstream-Medien (KRUGMAN 2017). Wenn es ums routinierte Lügen aus Gewohnheit geht, verdient Trump fraglos die Pinocchio-Nase, die ihm der Karikaturist der Huffington Post verpasst hat, als die Newssite seine ersten hundert Lügen dokumentierte.
Die Sprach- und Kognitionswissenschaftlerin Elisabeth Wehling (University of California, Berkeley) hat recht, wenn sie vermutet, die Medien würden Leuten wie Trump »immer noch auf den Leim« gehen. Eine der Nebelkerzen, die sein Team gezündet habe, seien zum Beispiel die »alternativen Fakten« gewesen: »Alles schreit auf und diskutiert das Thema tagelang, während Trump im Hintergrund Politik macht, die der Schlagzeilen würdiger wäre« (Wehling, zit. n. ECKERT/HUBER 2017). Nicht nur Wehling erstaunt es, wie sich die Medien immer wieder von Populisten ködern lassen (vgl. Kap. 6 und 9).
Während die westliche Welt auf Donald Trump starrt wie das Kaninchen auf die Schlange, schalten und walten andere Autokraten und Despoten in ihren Einflusszonen umso ungehemmter und weiten diese aus – auch indem sie Fake News so lange wiederholen lassen, bis sie als ›Wahrheit‹ Eingang in die Geschichtsbücher finden (KLIMENIOUK 2017).
WAS SOZIALFORSCHER ZU LÜGENGESPINSTEN HERAUSFANDEN
Natürlich setzen sich Sozialforscher, Psychologen und Ökonomen fortlaufend und intensiv damit auseinander, wann, weshalb und wie Menschen lügen. Für Psychologen und Psychiater sind Psychopathen von besonderem Interesse, da sie deshalb besonders überzeugend lügen, weil sie ihre eigenen Lügengespinste glauben. In diese Richtung gingen ja auch jüngste, wohl nicht nur küchenpsychologische Analysen, welche die Zurechnungsfähigkeit von Donald Trump infrage stellten.
Ökonomen betrachten Täuschung vielfach als eine Form von Marktversagen (GERSCHLAGER 2005: 1). Sie fragen aber auch danach, unter welchen Bedingungen sich Lügen und anderes unethisches Verhalten, zum Beispiel Bestechung, rechnen und ausbreiten (ENTORF/SPENGLER 1998). Verhaltensökonomen bauen Brücken zwischen diesen beiden Herangehensweisen: So weisen die beiden Nobelpreisträger George A. Akerlof und Robert J. Shiller darauf hin, dass in der Wirtschaft »Trickserei allgegenwärtig« sei, und »die Menschen [das] wissen [müssen]« (AKERLOF/SHILLER 2016). Und Dan Ariely (2013) macht darauf aufmerksam, dass wir uns selbst zwar meist für »ehrlich« halten, aber trotzdem allesamt lügen und betrügen. Dabei erwischt zu werden, mache uns oftmals weniger aus, als wir zunächst gedacht hätten. Diese Diskussion variiert eine langanhaltende Debatte unter PR-Experten, ob und unter welchen Umständen Öffentlichkeitsarbeiter die Öffentlichkeit hinters Licht führen dürfen.12
Obendrein beeinflussen kulturelle Gegebenheiten und Erwartungen, eingespielte Geschäftspraktiken und Verhaltensmuster, die wir in unserer Umgebung wahrnehmen, unser eigenes Verhalten und Tricksen.
Erklärungsrelevant ist durchaus auch das umgangssprachliche Konzept der ›Notlüge‹: Es konzediert, dass es im Alltagsleben wie in außeralltäglichen Lebenslagen Situationen gibt, in denen es hilft zu schwindeln. Indem das zum Notfall deklariert wird, wird allerdings zugleich die Norm ›Du sollst nicht lügen‹ aufrechterhalten und verstärkt, während die neue Spielregel ja dieses ›achte Gebot‹ der Christenheit außer Kraft zu setzen scheint und darauf baut, dass gerade enthemmtes Lügen Erfolg verheißen kann.
1.5FAKE NEWS ÜBER FAKE NEWS
Mark Twain soll einmal gesagt haben: »Eine Lüge kann um die halbe Welt reisen, während sich die Wahrheit die Schuhe anzieht«.13 Das Witzige an diesem Statement ist, dass es heute mehr denn je zutrifft, aber vermutlich dennoch eine weitere Fake News über Fake News ist – denn es bestehen ernste Zweifel, ob Twain das je geäußert hat. Allemal gut erfunden ist das Zitat ohne jeden Zweifel.
Gewiss gibt es auch heute solche Falschmeldungen auf der Meta-Ebene. David Uberti vom Columbia Journalism Review verkündete beispielsweise schon im Januar 2017 voreilig den Tod der Fake News (UBERTI 2017) – nachdem zuvor der Chefredakteur des Wall Street Journal in einer Redaktionskonferenz sich Kritik an der Berichterstattung seines Blattes über Trump verbeten und diese als »Fake news« abgekanzelt hatte (POMPEO/GOLD 2017). Und es gibt Wissenschaftler, die sich empirischquantitativ mit dem Phänomen beschäftigen und das Problem der Desinformation kleinreden, indem sie kommunizieren, die Medien würden Fake News über Fake News verbreiten, was dann wiederum die Medien gierig aufgreifen (vgl. Kap. 4, S. 92ff.).
Mit einer geradezu kühnen Metapher soll indes Papst Franziskus die »Menschheitsgeißel Fake News« beschrieben haben. Er ermahnte Journalisten und Medien, sie sollten nicht in Koprophilie verfallen und abnormes Interesse an Exkrementen zeigen. All diejenigen, die solche Geschichten läsen oder ansähen, riskierten, sich wie Koprophagen zu verhalten – Leute, die Fäkalien verspeisen. Wäre da nicht der Guardian als halbwegs glaubwürdige Quelle, würde man vermuten, der Pontifex maximus sei neuerlich Opfer von Desinformation geworden (SHERWOOD 2016).
1.6VON DER AUFKLÄRUNG ZURÜCK IN DIE UNWISSENHEIT?
Viele Menschen, zumal Journalisten und Forscher, sind inzwischen eher unsanft von einem womöglich weniger erregenden, aber gleichwohl verheißungsvollen Traum erwacht. Sie hatten in den letzten Jahrzehnten daran geglaubt, der Siegeszug der Aufklärung sei nicht mehr zu bremsen. Die Digitalisierung hatte diesem Traum dann noch zusätzlich ›befreiende‹ Schubkraft verliehen – ähnlich wie Jahrzehnte zuvor die Erfindung der Antibabypille unbeschwerte sexuelle Freiheiten verhieß.
Den Traum vom Internet als Plattform für globale Diskurse aller mit allen hat Time besonders anschaulich mit einer Titelillustration visualisiert. Im Jahr 2006 kürte das Nachrichtenmagazin »You«, sprich: uns alle, also jedermann und jedefrau zur »Person of the year« und hieß uns willkommen im Informationszeitalter, in »unserer Welt«, die wir alle kontrollieren würden. Damit knüpfte das Magazin an Utopien an, die bis heute stark das (Wunsch-)Denken nicht nur im Wissenschaftsbetrieb prägen.
Vielleicht ist es ja auch an der Zeit, diese Utopien auf den Prüfstand zu stellen, statt ihnen nachzuweinen: Der Zürcher Medienforscher Mark Eisenegger hat – sicher auch im Gedenken an seinen viel zu früh verstorbenen Vorgänger Kurt Imhof – kürzlich an die griechische Agora erinnert: Dieser ›Marktplatz der Ideen‹ war im antiken Athen als gemeinsamer Ort der öffentlichen Debatte gedacht.
»Die Kommunikation auf der Agora sollte so gestaltet sein, dass sich die ›sanfte Gewalt des besseren Arguments‹ bestmöglich zur Geltung bringen kann. Nicht Status oder Macht sollten den Diskurs beherrschen, sondern die Überzeugungskraft der Argumente. Argumente sollten gegen Argumente getauscht werden und nicht gegen Personen gerichtet sein. Menschen sollten aus unterschiedlichen Kontexten zusammenkommen und die Bereitschaft mitbringen, die eigene Position gegebenenfalls zu revidieren« (EISENEGGER 2017).
Wie wir wissen, blieb das bereits im griechischen Stadtstaat eine Utopie – denn partizipationsberechtigt waren nur die Eliten, sprich: die privilegierten, gebildeten Stände. Wirkungsmacht hat das Agora-Modell indes bis heute entfaltet. Es hat nicht zuletzt Jürgen Habermas zu seiner vielzitierten Wunschvorstellung eines ›herrschaftsfreien Diskurses‹ inspiriert (HABERMAS 1981) – als könnte es je eine Welt ohne ›Herrschaft‹ geben, erhaben über jeden Zweifel an der vielleicht ja doch unabänderlichen conditio humana, die der Historiker Yuval Noah Harari (Hebrew Univerity, Jerusalem) kürzlich in seiner Menschheitsgeschichte so überzeugend und so unerbittlich wie kaum ein anderer beschrieben hat: Der ›Homo sapiens‹ sei nun einmal »weit näher nach dem Modellbaukasten von Adam Smiths kurzfristig vorteilsmaximierenden, letztlich egoistischen Homo oeconomicus gebaut«, meint Harari, »als nach allen marxistischen Träumen vom ›neuen‹, zu ›gerechtem Teilen‹ und zur Selbstbeschränkung gegenüber der Natur befähigten Supermenschen« (HARARI 2011: 233ff.).
Die jeweils ›Herrschenden‹ haben ihre Herrschaft wohl immer auch mit Legenden und Mythen stabilisiert – und sich bei deren Verbreitung der jeweils zeitgemäßen ›neuesten‹ Medien bedient. Der Agnostiker Harari hat vermutlich recht, wenn er als Wissenschaftler das Allerheiligste der Menschen, ihre Religion, auf den Status von ›Ideologie‹ reduziert, auf ein Glaubensbekenntnis, das eben nicht auf Wissen basiert und doch gerade deshalb meist stärker ist als alle auf Wissenschaft und Forschung beruhende Erkenntnis (ebd.). Wer sich seine Einsichten zu eigen macht, dem muss auch unser Thema in einem anderen Licht erscheinen.
Wie wir inzwischen wissen, entwickelte sich das Internet in wenigen Jahren zu einem Ort, dessen Entwicklungsdynamik eine Handvoll Konzerne bestimmen, die ohne hinreichende demokratische Kontrolle mächtiger sind als viele Staaten. Und in diesem Netz wüten und wirken gesellschaftliche Spaltpilze, die den Erwartungshorizont binnen nur eines Jahrzehnts dramatisch verändert haben. Bereits 2010 titelte der Spiegel in einer Titelgeschichte (11.1.2010) über Google: »Der Konzern, der mehr über Sie weiß als Sie selbst«. Und kürzlich sorgte sich Time (29. 8. 2016) dann in einer weiteren Titelgeschichte darum, »weshalb wir das Internet an eine Kultur des Hasses verlieren«.
Einige Intellektuelle haben immerhin dieses vorzeitige Ende des Aufklärungszeitalters schon lange kommen sehen: Eingeprägt haben sich, wie bereits im Vorwort erwähnt, George Orwells düstere Vorahnungen aus der Nachkriegszeit. Sein Buch 1984, im Jahr 1948 geschrieben und ein Jahr später erstmals publiziert, ist seit Donald Trumps Wahlerfolg neuerlich zum Bestseller avanciert. Aber auch Neil Postmans Wir amüsieren uns zu Tode und Paul Virilios Warnungen vor »rasendem Stillstand«, den fatalen Folgen der Beschleunigung und der geistigen Umweltverschmutzung, kommen in den Sinn (POSTMAN 1985; VIRILIO 1997). Diese Prognosen stammen allerdings aus Vorinternetzeiten.
Mit dem Internet und der Digitalisierung breitete sich zunächst Euphorie aus. So erbringt eine Google-Recherche zum Stichwort ›Ende der Aufklärung‹ zwar zahlreiche Treffer mit Bezug auf die letzten fünf Jahre, aber kaum welche für den Zehnjahreszeitraum zuvor.14 Der Kommunikationswissenschaftler Dieter Roß (1997) erinnerte dagegen bereits daran, wie sich noch an jedes neue Medium ähnliche sozialutopische Hoffnungen knüpften wie an die Internet-Revolution. Sie zerstoben jeweils nach kurzer Zeit an der Realität, seien das Bert Brechts Radiotheorie oder Hans-Magnus Enzensbergers Visionen von einem demokratisierten Fernsehen (vgl. BRECHT 1932; 129ff. und ENZENSBERGER 1970).
Vermutlich sind wir auch nur temporär der naiven Fehleinschätzung aufgesessen, »aufgeklärte« Gesellschaften könnten die Lügengespinste, welche die Menschheit durch die Jahrhunderte begleiteten, hinter sich lassen, wenn sie ihren Kindern und Jugendlichen zu einer soliden Schulbildung verhelfen (vgl. Kap. 9.3, S. 251ff.).
DIE NEUE QUALITÄT DES PROBLEMS: WIRD WAHRHEITSSUCHE IRRELEVANT?
Um eine neue Qualität des Problems, und damit einhergehend wohl auch um eine nie gekannte Dimension des Kontrollverlusts geht es aber eben doch: Zum einen für den Journalismus, der nicht mehr alleiniger Schleusenwärter über die öffentliche Kommunikation ist und sich seine Gatekeeper-Funktion ja inzwischen mit den Algorithmen teilen muss, die eine Handvoll weltumspannender IT-Großkonzerne einsetzen. Auch diese ›entscheiden‹ nicht allein, sondern im Zusammenspiel mit Tausenden von Redaktionen und Aber-Millionen von Nutzern über die Kommunikationsströme und somit über das, was jeder einzelne von uns online zu sehen, zu hören oder zu lesen bekommt.
Für die Verbreitung von Desinformation und Fake News, so Mascolo (2017), »braucht es heute keine Gummihandschuhe und Blumentöpfe mehr, der Zugang über das Internet ist ohne jede Barriere«. Die Lüge treffe auf ein Publikum, »für das der Klick auf ›Gefällt mir‹ eine größere Bedeutung hat als Faktentreue und Plausibilität.« Manchmal seien erfundene Fake News einfach spannender und unterhaltsamer als die Wahrheit.
Neu ist »die blitzartige Verbreitung, wenn eine Meldung viral geht«, so NZZ-Autorin Sieglinde Geisel (2017), und »die Unverfrorenheit, mit der die Realität heute geleugnet wird«. Es ist oftmals der Sieg der (vormals schweigenden) Mehrheit über die Wahrheit – und mithin der Triumph der (jetzt hör- und sichtbaren) Schwarmdummheit: Wenn viele sagen, etwas sei wahr, dann gilt es zumindest für einen erheblichen Teil der Mediennutzer als (alternative) Wahrheit, auch wenn es nicht stimmt, und das vergiftet den gesellschaftlichen Diskurs. Die neuen Populisten stechen mit ihren Fake News durch, denn Argumente interessieren viele ihrer Wähler nicht.
Und damit einher geht eben offensichtlich ein Kontrollverlust der Gesellschaft und ihrer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über das vermeintlich Faktische, das bisher die Grundlage des gesellschaftlichen Diskurses und auch der zu erringenden Konsense oder Kompromisse war, während jetzt ja viele von uns nicht mehr so recht wissen, was Sache ist und was nicht.
Wir leben in Zeiten der Disruption, des Umbruchs. Es geschehen »Dinge, die wir nie für möglich gehalten hätten«, und wir halten »Dinge für möglich, die nie geschehen sind«, meint Geisel (2017). Aus der technologischen Disruption, die unser Mediensystem revolutioniert und den Journalismus in Bedrängnis gebracht hat, ist längst eine politische Disruption geworden. Geistig rege Zeitgenossen und -genossinnen sind zutiefst beunruhigt: Der Brexit, der Trumpismus, die Kehrtwendung der Türkei auf dem Weg nach Europa, die dirty tricks von Mario Draghi, um die Pleite der bis an die Halskrause verschuldeten Länder Südeuropas weiter und weiter abzuwenden, das Wegschlittern Polens und Ungarns und einiger anderer EU-Wackelkandidaten in Osteuropa – all das hat nicht nur mit Markt- und Staats-, sondern eben auch mit Medienversagen zu tun.
»Womöglich driften wir«, so befürchtet auch Katharine Viner, die Chefredakteurin des Guardian, »in eine Gesellschaft hinein, in der die Suche nach Wahrheit und das Aufdecken von Lügen irrelevant werden (VINER 2016). Unfug und frei Erfundenes verbreiten sich wie ein Lauffeuer. »Was unzählige Male wiederholt wird, verfestigt sich irgendwann zu einer Form der Wahrheit«, sekundiert der Schweizer Publizist und vormalige Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, Markus Spillmann (2016). Auf Fake News, so nochmals Geisel, »reagieren die meisten Menschen ähnlich wie auf einen Verkehrsunfall: Man schaut hin, auch wenn man es nicht möchte. Gerade weil man es nicht glauben kann, klickt man auf die Meldung.« Und Magdalena Taube fragt, ob es uns genauso gehe wie ihr: »Seit der US-Wahl gibt es bei mir diesen seltsamen Impuls, Nachrichtenseiten wie Spiegel Online aufzurufen, nur um zu schauen, was Trump wieder angestellt hat.« Alternativ gehe sie auf YouTube, um sich die letzte Folge von Stephen Colberts Late Night Show anzuschauen. Irgendwie fühle »es sich falsch an, so, als würde man zu viele ungesunde Süßigkeiten in sich hineinstopfen« (TAUBE 2017).
Was sie als »Süßigkeit« deklariert, eben die tägliche Überdosis Zucker oder Reality Show-Trumpismus, ist indes der Tanz auf dem Vulkan. Nachdenkliche Menschen in prosperierenden Gesellschaften haben dazu seit Jahrzehnten ein ambivalentes, ja schizophrenes Verhältnis. Einesteils delektieren sie sich, sprich: wir uns daran.
Andernteils ahnen wir ja alle zumindest, dass es so, wie Homo sapiens den Planeten plündert und sich gegenseitig ausbeutet, nicht weitergehen kann und weitergehen wird. Wir spüren, wie Trump, Le Pen, aber auch Putin, Erdoğan, Orbán & Co. mit unser aller Leben spielen, wie sie die Demokratie und das friedliche Zusammenleben in der Zivilgesellschaft gefährden. Wir spüren aber auch, dass die Erfolge der Populisten Ausdruck von Gefährdungen sind, die nicht diese selbst allein zu verantworten haben, sondern eher die alten politischen und wirtschaftlichen Eliten und mit ihnen viele Mainstream-Medien: Jahrzehntelang haben sie gegenüber fatalen Entwicklungen wie der Überschuldung, absurden Renditevorgaben und Steuerflucht, dem Klimawandel oder der Umverteilung vom Mittelstand nach ganz oben den Kopf in den Sand gesteckt, und manche haben ja auch den Rachen nicht voll kriegen können – nach dem Motto ›If you can’t beat them, join them.‹ Nicht nur die Ikonen und Kapitalvernichter der ›alten‹ Industrie wie Jürgen Schrempp oder Martin Winterkorn und des Banken-Establishments wie Josef Ackermann lassen hier grüßen, sondern eben auch SPD-Granden wie Gerhard Schröder, Peer Steinbrück oder Katrin Dennhardt – und auf internationaler Ebene Medien-Tycoone wie Silvio Berlusconi oder Rupert Murdoch.
Der Publizist und Verleger des Freitag, Jakob Augstein, hat vorgeschlagen, man möge doch den Begriff ›Wahrheit‹ erst gar nicht mehr verwenden (AUGSTEIN 2017; DELLIAN 2017). Das ist provokativ und – zumindest auf den ersten Blick – durchaus sympathisch, denn im »Gewissheitslieferantengeschäft«, in dem sich Augstein zufolge Journalisten tummeln, wäre fraglos etwas mehr Demut wünschenswert. Soll heißen: etwas weniger Selbstgewissheit, jeweils im alleinigen Besitz der ›Wahrheit‹ zu sein, die man gerade verkündet.
Augsteins Vorschlag knüpft an eine lange wissenschaftliche Diskussion an, die den Wahrheitsbegriff dekonstruiert und relativiert hat – als Impulsgeber lassen sich hier die Österreicher Paul Watzlawick und, stärker auf den Wissenschaftsbetrieb bezogen, Paul Feyerabend nennen (WATZLAWIK 1977; FEYERABEND 1975). Trotz aller klugen Einwände ist aber davor zu warnen, den Wahrheitsbegriff vorschnell preiszugeben, weil damit einer Beliebigkeit Tür und Tor geöffnet wird, die ihrerseits gefährlich ist.
Doch dies ist nicht der Platz für philosophische Diskurse. Belassen wir es beim Anspruch der Wahrheitssuche, auf den wir uns auch mit Jakob Augstein einigen können. Und bekennen wir uns zusätzlich gemeinsam mit Roger Cohen, einem weltläufigen Kolumnisten der New York Times, zur Faktizität: »Fakten-basierter Journalismus ist ein lächerlicher, ein tautologischer Satz. Es ist so, wie wenn man über Sauerstoff-basiertes menschliches Leben redet. Es gibt nichts anderes. Fakten sind das Fundament des Journalismus – sie herauszufinden, ist sein Hauptziel, und zwar ohne fear or favor.«15
Dass Falschmeldungen Wirkungen zeitigen, ist kaum abzustreiten. Pizzagate ist bei Weitem nicht der einzige ›Beweis‹ dafür, dass Desinformation in der virtuellen Welt höchst reale ›Kollateralschäden‹ auslösen kann. Nur exakt messen lassen sich solche Schäden in den meisten Fällen nicht.
Eine neuere Studie des Pew-Research Center befasst sich mit der Frage, wie die Wirkungen von Fake News wahrgenommen werden. Interessant daran ist: Die Befragten geben zu, bereits selbst Opfer von Fake News-Attacken geworden zu sein, und sie räumen freimütig ein, oftmals nicht unterscheiden zu können, ob Nachrichten ›echt‹ oder ›falsch‹ sind (BARTHEL 2016). Forscher, die mit dem Third-Person-Effekt vertraut sind, hätten an dieser Stelle erwartet, dass die Befragten sich selbst für schlauer halten und lediglich annehmen, dass unbedarfte Dritte nicht in der Lage sind, Fakes zu erkennen.
Angesichts der Schlagzeilen in den Medien ist es nicht verwunderlich, dass in einer Umfrage 50 Prozent der Clinton-Wähler glaubten, Russland habe die US-Präsidentschaftswahl zugunsten von Trump beeinflusst. Aber auch Desinformation wirkt lager-spezifisch: In derselben Umfrage gaben 62 Prozent der Trump-Wähler zu Protokoll, sie glaubten, dass Millionen von Immigranten ohne Wahlberechtigung mit abgestimmt hätten (SCHWARTZ 2017; RAMPELL 2016; FRANKOVIC 2016). Angesichts solcher Zahlen ist es schon ziemlich abenteuerlich anzunehmen, Desinformation sei auf das tatsächliche Wahlverhalten ohne Einfluss geblieben. Und auch die Hoffnung, dass sich die Desinformations-Effekte in beiden Lagern in etwa ausgleichen würden, scheint ziemlich aus der Luft gegriffen.
6http://hoaxmap.org/index.html [13.2.1017]
7https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Verschwörungstheorien
8Vgl. z. B. NEUHAUS 2017; UBERTI 2016 fokussiert auf die USA, sowie DARNTON 2017 mit lesenswerten Beispielen aus England und Frankreich zur Zeit der französischen Revolution.
9E-Mail von Kurt W. Zimmermann an den Verfasser v. 22.1.2017.
10Vgl. als Überblick FOA 2006; mit besonderem Blick auf Italien: MAZZOLENI/SFARDINI 2009; auf Downing Street Nr. 10: PRICE 2005; aufs Weiße Haus: GREENBERG 2017.
11E-Mail an den Verfasser vom Januar 2017.
12Kontrahenten waren u. a. Richard Gaul und Horst Avenarius versus Klaus Merten und Klaus Kocks; als journalistische Zusammenfassung: KLAWITTER 2008.
13https://www.facebook.com/TEDEducation/videos/1494434027236465/
14Durchgeführt vom Verfasser in Lugano am 14.2.2017.
15COHEN 2017. »Without fear of favor« wurde bewusst nicht mit übersetzt, weil Cohen hier auf ein Leitmotto der New York Times anspielt – den legendären und programmatischen Satz von Adolph S. Ochs, Aufgabe seiner Zeitung sei es, »to give the news impartially, without fear or favor, regardless of party, sect, or interests involved« (http://www.nytimes.com/1996/08/19/opinion/without-fear-or-favor.html).
2.VON DER AUFMERKSAMKEITSÖKONOMIE ZUR DESINFORMIERTEN GESELLSCHAFT?
Wie heikel und komplex das Problem proliferierender Desinformation ist, und wie anfällig nicht nur Medien und Journalismus, sondern auch der Forschungsbetrieb sind, selbst Opfer zu werden, lässt sich exemplarisch an der Karriere zweier berühmter wissenschaftlicher Zitate zeigen. Beide haben mit unserem Thema, dem Übergang von der Aufmerksamkeits- zur Desinformationsökonomie, zu tun, und in beiden Fällen entsteht Desinformation nicht durch das Erfinden, sondern durch das Weglassen relevanter Information.
2.1DIE KARRIERE ZWEITER ZITATE: NIKLAS LUHMANN UND STEWART BRAND
Die erste Textstelle stammt von Niklas Luhmann aus dem Jahr 1996. Sie ist der vermutlich von Medienforschern meistzitierte Aphorismus ihres Großmeisters: »Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien« (LUHMANN 1996: 5).
Das zweite Zitat ist noch älter. Stewart Brand erklärte zwölf Jahre zuvor auf der ersten Hacker-Konferenz: »Information wants to be free, because the cost of getting it out is getting lower and lower all the time« (zit. n. MECKEL 2010). Über Jahre hinweg hat sich dieser Satz zum geflügelten Branchen-Credo verselbstständigt und als Rechtfertigung dafür herhalten müssen, die Menschheit online gratis mit demselben hochwertigen Journalismus zu beglücken, den die Medienunternehmen mit ihren Printprodukten weiterhin verkaufen wollten.
Beide Zitate sind aus dem Zusammenhang gerissen und unvollständig. Sie erhalten einen ganz anderen Sinn, wenn man den jeweils fehlenden Teil der Originalaussage ergänzt. Der relativierende zweite Satz bei Luhmann lautet: »Andererseits wissen wir so viel über die Massenmedien, daß wir diesen Quellen nicht trauen können« (LUHMANN 1996: 9). Die andere Hälfte von Brands Statement hat Miriam Meckel ausgegraben: »Information wants to be expensive, because it’s so valuable. The right information in the right place just changes your life« (zit. n. MECKEL 2010).
Journalisten wie Medienforscher haben diese beiden ergänzenden Sätze vielfach unterschlagen. Sie sind indes hochaktuell und in unserem Kontext sogar von wegweisender Bedeutung, wenn wir verstehen wollen, warum sich die uns vertraute Aufmerksamkeitsökonomie zur Desinformationsökonomie weiterentwickelt. Fehlendes Vertrauen in Journalismus und Mainstream-Medien ist wohl so etwas wie die conditio sine qua non einer Desinformationsökonomie – nur wenn ihnen ihre Autorität und Glaubwürdigkeit abhandengekommen ist, können sich Fake News ungehindert ausbreiten. Luhmanns Bemerkung nimmt zum anderen aber auch vorweg und fasst zusammen, was wir zum Glaubwürdigkeitsverlust des Journalismus an empirischen Erkenntnissen zusammengetragen haben (vgl. Kap. 3, S. 66ff.).
Brands Intention war es wiederum, das ökonomische Spannungsfeld auf Nachrichtenmärkten zu beschreiben. Es entsteht dadurch, dass einerseits News, wenn sie einmal bereitgestellt sind, dadurch entwertet werden, dass sie sich ohne weitere Kosten beliebig weiterverbreiten lassen. Das öffnet Trittbrettfahrern Tür und Tor, kostbare Information hemmungslos zweitzuverwerten, und lässt die Chancen auf nahezu null schrumpfen, aus aufwändigen journalistischen Recherchen einen angemessenen Erlös zu erzielen. Andererseits werden aber auf Nachrichtenmärkten weiterhin auch Informationen gehandelt, die für den einzelnen sehr wertvoll, ja mitunter sogar lebensrettend sein können. Soll heißen, für bestimmte Nachrichten, insbesondere ›Insider‹-Informationen, gibt es fraglos weiterhin hohe Zahlungsbereitschaft.
Vermutlich ist es noch nicht einmal ein Zufall, dass Journalisten und Medienforscher den zweiten Teil des Brand-Zitats in Vergessenheit geraten ließen, denn an ökonomischen Fragen wie Produktionskosten und Knappheit waren sie mit Ausnahme von Wirtschaftsjournalisten und einer Handvoll Medienökonomen kaum je interessiert. In ihrem Schlaraffenland sollten Nachrichten und Informationen fließen wie Milch und Honig, und diejenigen, die sie bereitstellen oder analysieren, seien das nun Journalisten oder Wissenschaftler, sollten selbst ebenfalls in Milch und Honig schwimmen. Woher das Geld kommt, das sie nährt, wurde nicht gefragt – es konnte den Journalisten auch egal sein, solange ein florierendes Anzeigengeschäft dafür sorgte, dass ihre Redaktionen üppig ausgestattet waren. Zumindest viele Chefredakteure lebten ja in Saus und Braus, und einige von ihnen konnten sogar ihren Champagner-Konsum auf die Spesenabrechnung setzen.
2.2AUF DEN SCHULTERN ANDERER RIESEN: GEORG FRANCK UND DIE VERHALTENSÖKONOMEN
Trotz des Desinteresses der Kommunikationswissenschaften an elementaren ökonomischen Fragen haben ein paar Außenseiter unter den Sozialforschern frühzeitig das theoretische Rüstzeug für die Analyse der Glaubwürdigkeitskrise geliefert, in die der Journalismus und die Medien hineinschlitterten. Kurz vor der Jahrtausendwende, also noch bevor Internet und Digitalisierung den herkömmlichen Medienbetrieb mit aller Wucht durcheinanderwirbelten, hat der österreichische Raumplaner und Ökonom Georg Franck sein Konzept der »Aufmerksamkeitsökonomie« publiziert. Wenig später folgten die Amerikaner Thomas H. Davenport und John C. Beck mit einer ähnlichen Schrift (FRANCK 1998; DAVENPORT/BECK 2001).
Beide Forschungsarbeiten zeichneten vor, wie Institutionen, aber auch Politiker und Wirtschaftsführer, Künstler, Sportler und Funktionäre immer mehr nach öffentlicher Aufmerksamkeit gierten. »Prominente sind die Einkommensmillionäre in Sachen Aufmerksamkeit. Der Ruhm ist die schönste der irdischen Belohnungen, weil er den Status des Großverdieners an Aufmerksamkeit noch über den Tod hinaus sichert«, gab Franck zu Protokoll. Und: »Je reicher und offener die Gesellschaft, um so offener und aufwendiger wird der Kampf um die Aufmerksamkeit ausgetragen. Nicht der sorglose Genuss, nein, die Sorge, dass die anderen auch schauen, wird zum tragenden Lebensgefühl in der Wohlstandsgesellschaft« (FRANCK 1998: 10f.).
Diese wachsende Konkurrenz um Aufmerksamkeit veränderte den öffentlichen Diskurs. Franck setzte deshalb dem materiellen einen »mentalen« Kapitalismus entgegen, der »närrische Züge« trage. Er skizzierte einen zweiten Wirtschaftskreislauf, der den bisherigen Austausch von Waren und Dienstleistungen gegen Geld zunehmend überlagere, ja an Bedeutung übertreffe: Unter Bedingungen zunehmenden Wohlstands und der Saturierung materieller Bedürfnisse werde in der Aufmerksamkeitsökonomie vermehrt Information gegen öffentliche Aufmerksamkeit getauscht. Es gebe einen Punkt, »von dem an die Aufmerksamkeit dem Geld den Rang des überlegen wichtigsten Rationierungsmittels abläuft« (FRANCK 1998, 143, 157 sowie 50f.; FRANCK 2005).
2.3DIE VORDER- UND DIE HINTERBÜHNE IN DER AUFMERKSAMKEITSÖKONOMIE
Um die Funktionsweise dieser Aufmerksamkeitsökonomie besser zu verstehen, gilt es sich zu vergegenwärtigen, was auf der Vorder- und auf Hinterbühne des Medienbetriebs gespielt wurde, bevor die Digitalisierung die öffentliche Kommunikation umgekrempelt hat.