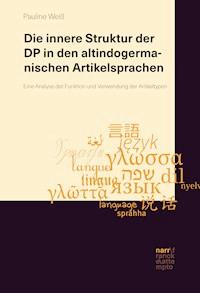
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Studie verbindet Ansätze generativer Linguistik mit den Methoden der Indogermanistik. Untersuchungsgegenstand ist der definite Artikel in vier altindogermanischen Sprachen. Diese Auswahl deckt alle möglichen Wortstellungsvarianten der Kategorie Artikel ab: von präponiert und freistehend im klassischen Griechischen über enklitisch und postponiert im klassischen Armenischen bis hin zu kombinierten Serialisierungen im Altalbanischen und Altnordischen. Fragestellungen waren nicht nur, welche Merkmale die Kategorie Artikel generell konstituieren, sondern auch, ob die fraglichen Morpheme tatsachlich als Definita definiert werden können. Basierend auf der Analyse der Serialisierungsvariationen der Determinansphrasen der vier Sprachen, die das Untersuchungskorpus der Arbeit bildeten, wird in einem zweiten Komplex die innere Struktur der DP nach Maßstäben der generativen Grammatik analysiert. Ausgehend von der DP-Analyse nach Abney werden einfache und komplexe Phrasen untersucht und unter Bezug auf Arbeiten u.a. von Kallulli und Julien wird die DP-Analyse modifiziert und ergänzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pauline Weiß
Die innere Struktur der DP in den altindogermanischen Artikelsprachen
Eine Analyse der Funktion und Verwendung der Artikeltypen
Katrin Schmitz / Joachim Theisen / Carlotta Viti
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2018 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.francke.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
ePub-ISBN 978-3-8233-0071-7
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
Abl.
Ablativ
Adj.
Adjektiv
Adv.
Adverb
AGR
Agreement
AgrM
Agreement-Marker
AgrP
Agreementphrase
AgrGenP
Agreement-Genitiv-Phrase
Akk.
Akkusativ
AkkM.
Akkusativ-Marker
Akt.
Aktiv
alb.
Albanisch
anord.
Altnordisch
Aor.
Aorist
AP
Adjektivphrase
App.
Apposition
arm.
Armenisch
Art.
Artikel
ArtM
artikelartiger Marker
bspw.
beispielsweise
bulgar.
Bulgarisch
BUZ
Buzuku
BW
Bezugswort
CardP
Cardinalphrase
CP
Complementizerphrase
Dat.
Dativ
def
definit
DeikM
(stark) deiktischer Marker
DemP
Demonstrativphrase
DemPron
Demonstrativpronomen
DP
Determinansphrase
DS
Determiner Spreading
dt.
Deutsch
DxP
Deixisphrase
e
empty
E
freier Ausdruck
EN
Eigenname
engl.
Englisch
f.
feminin
fnhd.
Frühneuhochdeutsch
geg.
Gegisch
Gen.
Genitiv
gr.
Griechisch
Hebr.
Hebräisch
i.e.
id est
Imp.
Imperativ
Impf.
Imperfekt
Ind.
Indikativ
IndefPron
Indefinitpronomen
Inf.
Infinitv
Instr.
Instrumental
Interjek.
Interjektion
InterrogPron
Interrogativpronomen
IP
Inflexionphrase
Kard.
Kardinalzahl
Knj.
Konjunktiv
Komp.
Komparativ
Konj.
Konjunktion
Koord2
Koordinator2
Ko2XP
Koordinationsphrase
KorrelativPron
Korrelativpronomen
Lok.
Lokativ
m.
maskulin
MAT
Matrënga
Med.
Medium
MP
Mediopassiv
n.
neutrum
Neg.
Negation
Nom.
Nominativ
NP
Nominalphrase
nP
leichte Nominalphrase
Num.
Numerale
NumP
Numerusphrase
Opt.
Optativ
Ord.
Ordinalzahl
Part.
Partikel
Pass.
Passiv
Perf.
Perfekt
PersPron
Personalpronomen
Pl.
Plural
POSS
possessiv/Possesivität
PossPron
Possessivpronomen
PP
Präpositionalphrase
PQ
Plusquamperfekt
Präd.
Prädikat
Präp.
Präposition
PronAdj.
Pronominaladjektiv
Prs.
Präsens
Prt.
Partizip
QP
Quantifiziererphrase
ReflexivPron
Reflexivpronomen
RelPron
Relativpronomen
russ.
Russisch
RS
Relativsatz
Spez,XP
Spezifiziererposition der XP
Subj.
Subjekt
Subst.
Substantiv
Superlat.
Superlativ
Sg.
Singular
tosk.
Toskisch
Vergleichspart.
Vergleichspartikel
vgl.
vergleiche
VP
Verbalphrase
WFR
Word Formation Rules
I.Einleitung
Der definite Artikel ist eine junge Erscheinung der indogermanischen Sprachen, die noch nicht ausreichend erforscht ist. In den Einzelsprachen entwickelt sich zu unterschiedlichen Zeiten ein Marker, der die Definitheit und Referenz einer Phrase kennzeichnet und somit als bestimmter Artikel beschrieben werden kann. Doch ist fraglich, ob diese neuen Morpheme tatsächlich funktionieren wie ein definiter Artikel der modernen Sprachstufen. Ebenso ist unklar, wann man in den frühen Sprachstufen von einem definiten Artikel sprechen kann. Einerseits teilen die markierenden Elemente gewisse Eigenschaften, andererseits unterscheiden sich die syntaktischen und formalen Merkmale. Daher stellt sich die Frage, welche konkreten Kriterien erfüllt sein müssen, damit ein sprachliches Element der grammatischen Klasse Artikel zugehörig ist.
Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht der definite Artikel in den altindogermanischen Sprachen. Als Untersuchungssprachen werden das klassische Griechische, das Altalbanische, das Altnordische und das Altarmenische herangezogen.1 Diese Sprachen wurden ausgewählt, weil sie verschiedene Artikeltypen aufweisen. Während das Griechische einen freistehenden, präponierten Artikel besitzt, zeigt das Armenische einen enklitischen, postponierten Artikel. Das Albanische und Altnordische verfügen jeweils über einen freistehenden, präponierten sowie einen enklitischen, postponierten Artikel. Diese vier Sprachen decken somit die wichtigsten Möglichkeiten der Artikelsetzung ab. Zudem verwenden sie den Artikel unterschiedlich frequent. Während die Determination im nachhomerischen Griechischen sehr konsequent durchgeführt wird, findet man sie im Armenischen und Altnordischen im Vergleich eher selten.
I.1Stand der Forschung
Zum Stand der Forschung ist zu sagen, dass der Artikel in der deutschen Sprache mehrfach untersucht worden ist. Zu nennen sind hier bspw. das „Lexikon zum Artikelgebrauch“ von Grimm (1987/1992) oder „Artikelwörter im Deutschen: semantische und pragmatische Aspekte ihrer Verwendung“ von Bisle-Müller (1991). Die Entstehung des Artikels im Germanischen hat Hodler (1954) in der Monographie „Grundzüge einer germanischen Artikellehre“ dargestellt. Auch Harbert (2007) widmet dem Artikel in den germanischen Sprachen in seinem Buch „The Germanic Languages“ ein Kapitel. Die skandinavischen Sprachen werden bspw. von Thráinsson (2007), Sigurðsson (2006) oder in den Arbeiten von Julien (2002, 2003, 2005) besprochen. In der Regel beziehen sich diese Werke jedoch auf die modernen Sprachen und verweisen nur ggf. auf das Altnordische. Hinsichtlich des Altnordischen, Griechischen und Albanischen beschränken sich die Informationen über den Artikel vielmehr auf Hinweise aus Grammatiken.
Der armenische Artikel hat im Gegensatz dazu in der Forschung mehr Aufmerksamkeit erfahren. Zeilfelder (2011) kommentiert das syntaktisch auffällige Verhalten des Artikels bei Eznik von Kołb. Müth (2011) analysiert das Vorkommen des Artikels in der armenischen Bibel. Auch in Kleins (1996a) Untersuchung über die Deixis im Armenischen darf der Artikel nicht fehlen. Eine Untersuchung zum Artikel in Relativsätzen hat Lamberterie (1997) vorgelegt. Hier wird das Phänomen der Determination im armenischen Relativsatz beschrieben. Doch trotz dieser verschiedenen Arbeiten sind bisher weder der Status des armenischen Artikels noch die Regeln des Gebrauchs befriedigend geklärt worden. So ist weder klar, ob der armenische Artikel tatsächlich als solcher klassifiziert werden kann, noch was seine Verwendung steuert. Doch auch in den anderen Sprachen ist häufig nicht klar, was die Setzung eines Artikels motiviert. Hendriks (1982) bspw., der das moderne Albanisch untersucht, schreibt, dass die Regeln, wonach sich die Verwendung des Artikels richten, noch nicht explizit formuliert wurden.1 Dies gilt nicht nur für das moderne Albanische, sondern auch für das Altalbanische.
Zur adäquaten Analyse des bestimmten Artikels ist die Kenntnis der syntaktischen Umgebungen, i.e. der Wortstellungsmöglichkeiten, äußerst hilfreich. Dum-Tragut (2002) und Hróarsdóttir (2000) haben maßgebliche Werke zu Serialisierungsvariationen und -veränderungen vorgelegt. Dum-Traguts (2002) Arbeit ist eine diachrone Untersuchung, die das klassische, das kilikische sowie das moderne Armenische erforscht. Sie analysiert die Wortstellungsmuster und -möglichkeiten sämtlicher Konstituenten. Dabei konzentriert sie sich besonders auf die Elemente in Nominalphrasen und auf Relativsätze. Bei Hróarsdóttir (2000) dagegen stehen die Anordnungsveränderungen (und -möglichkeiten) der Konstituenten Objekt und Verb vom Altisländischem zum Isländischen im Zentrum der Untersuchung. Es wird also die Verbalphrase bzw. VP-Syntax diachron behandelt. Dieses Werk wird nur am Rande berücksichtigt, da die Untersuchungsgegenstände von Hróarsdóttir (2005) und der vorliegenden Arbeit nur marginale Berührungspunkte haben. Interessant an Hróarsdóttirs (2005) Arbeit ist, dass die Wortstellungsuntersuchungen mit dem Minimalistischen Programm sowie mit Kaynes (1994) Anti-symmetry proposal verknüpft werden.
Wie in Hróarsdóttirs (2005) Analyse wird in dieser Arbeit mit Theorien der generativen Grammatik gearbeitet. Diese Untersuchung basiert auf der DP-Analyse nach Abney (1987), wobei DP für Determinansphrase steht. Abney (1987) ist einer der ersten Forscher, der von einem funktionalen Kopf der Kategorie Determinans, welcher die lexikalische Kategorie Nomen regiert, ausging. Ein definiter Artikel wird dabei als Determinans definiert und selegiert obligatorisch ein Komplement, in der Regel ein Substantiv.2 Die DP-Analyse kann jedoch nicht ohne Modifikationen angewandt werden. Schon Cinque (1992) hat festgestellt, dass die innere Struktur der DP komplexer sein muss als ursprünglich angenommen.3 Im Zuge dessen wurde die DP Thema vieler Aufsätze und Werke. Thráinsson (2007) bspw. hat das Prinzipien- und Parameter-Framework sowie Ansätze des Government-and-Binding und des Minimalismus auf das moderne Isländische angewandt. Hinsichtlich der Forschung an modernen skandinavischen DPn sind ebenso Delsing (1988, 1993), Julien (2003, 2005) oder Vangsnes (1999) zu nennen. Sie stehen alle in der Tradition der generativen Grammatik und analysieren die Verwendung von Determinantien, schlagen jedoch divergierende Hypothesen vor. Für das moderne Albanische liegt eine äquivalente Untersuchung von Kallulli (1999) vor. Doch Untersuchungen der DP anhand alter Sprachen bzw. Sprachstufen sind in der Forschung rar. Für das klassische Griechische wurde allerdings von Bakker (2009) eine Analyse geliefert und für das Altarmenische von Zeilfelder (2011). Abgesehen davon ist die Anwendung der Theorie der generativen Grammatik auf alte Sprachen unterrepräsentiert. So ist mir kein Werk bekannt, das die Hypothesen und Annahmen auf das Altalbanische, Altarmenische, Altnordische oder Altgriechische überträgt, ihre Haltbarkeit prüft und Strukturbäume nach generativen Aspekten erzeugt.
I.2Forschungsziele und Struktur der Arbeit
Die vier Sprachen Griechisch, Albanisch, Altnordisch, Armenisch weisen unterschiedliche Artikeltypen auf, vom präponierten, freistehenden bis hin zum enklitischen, postponierten Element. In der Forschung werden diese verschiedenen Morpheme bisher alle als Artikel klassifiziert. Hier wird zunächst grundlegend der Frage nachgegangen, ob diese Klassifikation tatsächlich gerechtfertigt ist, d.h. es wird untersucht, ob man wirklich in allen vier Untersuchungssprachen von einem definiten Artikel sprechen kann. Dazu ist es notwendig, die formalen Eigenschaften und Charakteristika der Kategorie Artikel abzustecken, um diese Kriterien anschließend auf die Morpheme der Einzelsprachen anwenden zu können. Daher wird nach Darstellung der Forschungsziele das zugrunde gelegte Material beschrieben (Kap. I.3), die theoretischen und formalen Grundlagen erläutert (Kap. I.4 und I.5) und schließlich der Forschungsgegenstand, i.e. der definite Artikel, sowohl allgemein als auch sprachspezifisch eingeführt (Kap. I.6). In diesem wie in allen weiteren Abschnitten werden die Untersuchungssprachen in der gleichen Reihenfolge besprochen. Die Sprachen werden dabei nicht chronologisch angeordnet, sondern nach dem oder den Artikeltypen: Zuerst das Griechische mit dem präpositiven Artikel, danach folgen das Albanische und Altnordische mit prä- und postponiertem Artikel und anschließend das Armenische, das über Enklitika verfügt. Basierend auf der Arbeitsdefinition des Artikels können das Vorkommen und die Verwendung der verschiedenen Artikeltypen in Kapitel II untersucht werden. Die Leitfragen hierzu sind: Wie verhält sich der Artikel in den genannten Sprachen? Welche Funktionen und Aufgaben übernimmt er? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich der Verwendung liegen vor? Der definite Artikel wird also in formaler und funktioneller Hinsicht skizziert.
Auch die syntaktischen Kriterien sind ein zentraler Untersuchungsgegenstand. Die einzelsprachlichen Belegstellen werden hierfür nach Konstruktionen geordnet, ausgehend von der Anzahl und Art der vorkommenden Konstituenten. Dementsprechend werden die Belege in Gruppen geordnet: einfache Determinansphrasen (Substantiv + Artikel), substantiviertes Element + Artikel, Phrasen mit Pronomen, mit Adjektiv und mit Genitivattribut, Konstruktionen mit Eigennamen oder Apposition, Phrasen mit Präposition und Phrasen mit Numeralia. Diese eingehende Analyse des sprachlichen Materials führt schließlich zu einer Verfeinerung der Klassifikation des Artikels. Dabei werden folgende Fragen untersucht: Ändert der Artikel in den verschiedenen Konstruktionen sein Verhalten oder bleibt es konstant? Gibt es Konstruktionen, in denen der Artikel in einer der Sprachen zu finden ist, die die anderen Sprachen nicht kennen? Dies ist beispielsweise im Armenischen der Fall, da der Artikel dort einen ganzen Relativsatz determinieren kann. Auch das Albanische zeigt eine spezifische Konstruktion: Hier ist die Möglichkeit einer doppelten Determination zu finden. Dabei werden ein prä- und ein postponierter Artikel in einer Phrase verknüpft. Es gilt nun zu erforschen, ob es auch in den anderen Untersuchungssprachen spezielle Möglichkeiten der Artikelverwendung gibt. Hierfür ist es notwendig abzugrenzen, welche Konstruktionen alle drei Sprachen bilden können. Daraus kann auf grundlegende Funktionen des Artikels geschlossen werden, wodurch die Kategorie Artikel am Ende des Kapitels II konkreter bestimmt werden kann. Es werden sprachübergreifende und sprachspezifische Merkmale festgestellt, wodurch der Artikel als sprachübergreifendes Konzept analysiert werden kann, das sich aus Prinzipien und Parametern konstatiert (vgl. Kap. II.10). Somit kann deutlich klassifiziert werden, welche Elemente wirklich als Artikel definiert werden können. Gleichzeitig wird ein Vorschlag unterbreitet, wie die anderen Morpheme, die nicht die notwendigen Kriterien erfüllen, eingeordnet werden können.
Um Regelmäßigkeiten formulieren zu können, muss man allerdings erst einmal wissen, was genau regelmäßig ist. Dafür werden die Wortstellungsmuster der Phrasen mit Artikel untersucht, im Hinblick auf die Frage, was denn einem default mode bzw. einer Grundwortstellung gleichkommt, also welche Serialisierungsmuster die Untersuchungssprachen bevorzugen. Alten Sprachen wird häufig eine sogenannte „freie Wortstellung“ zugesprochen. In dieser Arbeit wird mit Fanselow (1988) angenommen, dass es keine freie Wortstellung gibt, sondern man von einer freien Anordnung der Konstituenten sprechen muss. Zudem tendieren Sprachen stets zu bestimmten Serialisierungsmustern. Mitunter sind diese jedoch nicht konsequent in der gesamten Sprache durchgeführt. Aber man kann je nach Werk oder Autor präferierte Tendenzen feststellen. So bilden die Wortstellungsmuster der Belegstellen einen zentralen Untersuchungsaspekt der Arbeit. Hierbei werden die lineare Anordnung der Konstituenten analysiert und Muster abstrahiert. Die grundlegende Fragestellung lautet: Was kann über das Verhalten des Artikels in den verschiedenen Phrasentypen ausgesagt werden?
Die Wortstellungsmuster dienen des Weiteren als Grundlage für die Strukturanalyse nach der DP-Hypothese der generativen Grammatik in Kapitel III. Dort werden die Sprachen anhand dieser abstrakten Muster untersucht, da man so Gemeinsames und Abweichendes deutlicher sieht. Die Kenntnisse der bevorzugten Serialisierungen erlauben auch eine angemessene Strukturanalyse, da man so weiß, von welchen Wortstellungen grundsätzlich auszugehen ist und welche als markierte Konstruktionen klassifiziert werden können. Ziel in Kapitel III ist es, eine Analyse vorzuschlagen, mit der alle Wortstellungsvarianten der Untersuchungssprachen abbildbar sind und mit der auch die Strukturen moderner Sprachen erklärt werden können.
Die generative Transformationsgrammatik erhebt den Anspruch von Universalität. Wenn theoretisch alle natürlichen Sprachen anhand der generativen Grammatik erzeugt werden können, müssen auch alte Sprachen nach dieser Methode ableitbar bzw. generierbar sein. Die vorliegende Arbeit setzt an dieser Stelle an und untersucht die innere Struktur der Determinansphrase. Dabei wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die DP-Analyse auf die alten Sprachstufen übertragbar ist. Diese Annahme stützt sich auf Muyskens (2008) Untersuchung zu funktionalen Kategorien im Indogermanischen, wobei er Folgendes feststellt: „… We can conclude, on the whole, functional categories in the nominal system have survived intact, but not in the verbal system. …“1 Somit können die funktionalen Kategorien, die für die modernen Sprachen gesetzt werden, auch auf die alten Sprachstufen angewandt werden. Allerdings müssen zur Analyse Modifikationen an der DP-Hypothese vorgenommen werden, da die untersuchten Sprachstufen im Gegensatz zu den modernen Sprachen ein größeres Spektrum an Wortstellungsmöglichkeiten und noch ein ausgebauteres Kasussystem besitzen.
Die Übertragung der DP-Analyse auf die altindogermanischen Sprachen überprüft einerseits den Universalitätsanspruch der generativen Grammatik und erweitert anderseits ihren Anwendungsbereich. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass die DP-Analyse grundsätzlich auf die altindogermanischen Sprachen angewandt werden kann, aber ergänzt werden muss. Dies stellt einen Beitrag zur inneren Struktur der DP generell dar. Gleichzeitig können die Modifikationen, die im Laufe der Untersuchung zur Generierung der vier ausgewählten Sprachen vorgeschlagen werden, auch für die modernen Sprachen in Erwägung gezogen werden.
Eine adäquate syntaktische Analyse beruht also auf einer expliziten Kategorisierung der zu untersuchenden Konstituenten. Demnach muss zuerst untersucht werden, ob alle sprachlichen Elemente über die gleichen Eigenschaften und Funktionen verfügen, die einer bestimmten Kategorie zugeschrieben werden. Schließlich beruhen syntaktische Strukturen auf formalen Eigenschaften. Daher erfolgt in Kapitel II eine ausführliche Untersuchung der grammatischen Kategorie Artikel, um anschließend in Kapitel III eine angemessene Analyse durchführen zu können, die sich sowohl nach der Stellung innerhalb einer syntaktischen Struktur richtet als auch den formalen Merkmalen der jeweiligen Elemente gerecht wird. Die Untersuchung befasst sich einerseits mit der formalen Beschreibung von grammatischen Funktionen sowie der linearen Abfolge von Konstituenten und schlägt andererseits eine komplexe syntaktische Analyse vor.
I.3Zum Material
Zur Analyse der vier zugrunde gelegten Sprachen wurden verschiedene Texte ausgewählt. Ziel war es, für jede Sprache 200 Belegstellen mit definitem Artikel zu erheben. Im Altnordischen war dies im Gegensatz zu den anderen Sprachen allerdings nicht möglich, da der Artikel dort nur äußerst selten Verwendung findet. Zur Untersuchung des Altnordischen wurde die Saga Hrafnkels saga Freysgoða, eine der wichtigsten fiktiven Erzählungen, ausgewählt. Es wurde die Textausgabe von Baetke (1952) Hrafnkels saga freysgoða: Mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar genutzt.
Für das Griechische wurde von Xenophons Anabasis Buch II verwendet, das besonders von Dialogen lebt und daher eine aufschlussreiche Verwendung des Artikels erwarten ließ. Der Text wurde der Website Perseus Digital Library (www.perseus.tufts.edu/hopper/) entnommen. Es handelt sich um ein Geschichtswerk mit autobiographischem Hintergrund.
Auch für das Armenische wurde ein Geschichtswerk herangezogen, i.e. das Werk Patmowtʿiwn Hayocʿ von Agatʿangełos in der Ausgabe von Thomson (1976). Dabei ist zu beachten, dass Thomson einen Teil ausgespart hat. Des Weiteren hat Thomson den Text in 14 Kapitel, zuzüglich Prolog und Epilog, eingeteilt. Die Gliederung in 900 Paragraphen, die auch Thomson (1976) beibehält, stammt aus der kritischen Edition aus Tiflis des Jahres 1909.1 Mittels der Paragraphen gestaltet sich die Bezugnahme auf Textstellen leichter, daher werden sie auch in dieser Arbeit genutzt.
Das Albanische wurde im Vergleich zu den anderen Sprachen spät verschriftlicht. Es besitzt zwei Hauptdialekte, Toskisch und Gegisch.2 Zur Analyse der albanischen DPn wurden die ältesten, zusammenhängenden Texte beider Dialekte herangezogen, i.e. das Missale von Gjon Buzuku (1555) und die Dottrina cristiana von Lekë Matrënga (1592). So konnte überprüft werden, ob sich die Verwendung der Artikeltypen zwischen beiden Dialekten unterscheidet. Es wurde mit den Ausgaben der Texte, die auf der Website der Universität Frankfurt (http://titus.uni-frankfurt.de/indexd.htm) zugänglich sind, gearbeitet. Als zusätzliches Hilfsmittel dienten die Edition Il ‚Messale‘ di Giovanni Buzuku: Riproduzione e Trascrizione von Namik Ressuli (1958) sowie die Bearbeitung der Dottrina cristiana von Matzinger (2006).
In den nachstehenden Abschnitten wird der Inhalt der Untersuchungstexte beschrieben. Sie werden in den historischen Kontext eingebettet und Wissenswertes wird zum Hintergrund, zum Genre oder zur Konzeption der Werke dargelegt. Nicht in allen Fällen erweist sich eine Inhaltsangabe des jeweiligen Textes als sinnvoll. Bei den narrativen Texten, z.B. dem altnordischen, wird die Handlung zusammengefasst wiedergegeben. Aber bei den albanischen Schriften wird darauf verzichtet, weil es sich dort um Gebete und liturgische Texte handelt.
I.3.1Zur Anabasis, Buch II, von Xenophon
Die Anabasis wird insgesamt in sieben Bücher gegliedert. Dies war allerdings nicht die ursprüngliche Einteilung. Hermann (1944) spricht von einer Gliederung in drei Teile und zwar
„… a) den Hinaufmarsch, Buch I, b) den Rückmarsch durch Kleinasien hindurch zu den ersten Griechen, bis ans Meer, bis nach Trapezunt, Buch II-IV, c) die weiteren Unternehmungen bis nach Pergamon, Buch V-VII. …“.1
Xenophon selbst ordnete die Anabasis jedoch in zwei Teile. Der erste Teil reicht bis zum Tod Klearchos und der anderen Führer, i.e. nach der modernen Einteilung Ende von Buch II, und der zweite Teil umfasst den Rest des Werkes, i.e. nach der modernen Gliederung Buch II–VII.
Die vorliegende Untersuchung nutzt, der zeitgenössischen Einteilung folgend, Buch II als Datengrundlage. Um das zweite Buch der Anabasis zu verstehen, ist es wichtig, den Inhalt des ersten Buches zu kennen. Es handelt davon, wie griechische Truppen unter Kyros gegen dessen Bruder, den Perserkönig Artaxerxes, ausziehen. Es gipfelt in einem großen Gefecht, der Schlacht bei Kunaxa, in der Kyros den Tod findet. Erst zu Beginn des zweiten Buches erfahren die Griechen, dass ihr Anführer Kyros in diesem Kampf gefallen ist. Der entscheidende Konflikt besteht darin, dass sich die Griechen als Sieger fühlen, da sie das gegnerische Heer erfolgreich in die Flucht schlugen, und die Perser ebenso der Ansicht sind, sie hätten gewonnen, da sie Kyros getötet haben.
Das zweite Buch der Anabasis besteht großteils aus Gesprächen und Debatten. Zum einen verhandeln die Griechen mit den Persern, ob sie, ihre Waffen abgeben und sich dem Großkönig Artaxerxes unterwerfen sollen. Zum anderen diskutieren die Griechen untereinander über ihre Situation, denn sie befinden sich ohne Anführer, ortsunkundig in einem fremden Land und kennen den Heimweg nicht. Zudem mangelt es ihnen an Nahrungsmitteln, was ihre Lage verschärft. Im Verlauf des Buches tritt Klearchos als der fähigste Stratege hervor, der der Situation gewachsen ist und schließlich die Führung der Griechen übernimmt. Ferner erweist sich Ariaios2, ein Nicht-Grieche, der in der Schlacht von Kunaxa auf der Seite von Kyros kämpfte, als Hilfe, die Griechen in ihre Heimat zu führen. So ziehen Griechen und Nicht-Griechen gemeinsam durch das persische Reich und versuchen dem Heer des Großkönigs auszuweichen. Dies gelingt jedoch nicht und sie treffen auf einen Teil der feindlichen Streitmacht. Zuerst erscheinen Herolde der Perser im griechischen Lager und wollen einen Waffenstillstand aushandeln, schließlich sogar Tissaphernes3 persönlich. Dieser präsentiert sich als Freund der Griechen und bietet an, sie in ihr Land zurückzubringen. Die Verhandlungen bilden einen umfassenden Teil des Textes. Im griechischen Lager werden Stimmen laut, die an der Redlichkeit des Tissaphernes zweifeln. Daher sucht Klearchos diesen auf, um in einem Gespräch mit ihm den herrschenden Argwohn zu beseitigen. Tissaphernes ist ebenfalls an einer Schlichtung interessiert, betont jedoch seine überlegene Position. Die beiden Strategen vereinbaren, dass Klearchos mit allen griechischen Hauptmännern und Feldherren in Tissaphernes Lager kommt, damit sie den Konflikt gemeinsam aus dem Weg räumen können. So begeben sich 20 Hauptmänner und etwa 200 Soldaten in das feindliche Lager. Dort angekommen, werden die Feldherren gefangen genommen, die Hauptmänner erschlagen und die Soldaten von Reitern attackiert. Das Buch endet mit der Hinrichtung der Feldherren und einem Nachruf. Xenophon beschreibt darin die Persönlichkeiten der Feldherren, ihre Qualitäten als Anführer, aber auch ihre Fehler.
Die Anabasis II basiert also auf Dialogen, i.e. Beratschlagungen, Diskussionen sowie Verhandlungen. Sehr detailreich wird, als eine Art Gegengewicht, der Marsch durch das persische Gebiet beschrieben, besonders im Hinblick auf geographische Angaben.
Xenophon, der Autor der Anabasis, geboren um 430, nahm selbst an dem Kriegszug teil, den er beschreibt. Mit seinem Werk begründet er „… die literarische Gattung der Autobiographie […] wie die des Kriegstagebuchs …“.4 Die Teilnahme an dieser militärischen Operation führte zur Verbannung Xenophons aus seiner Heimatstadt Athen, da Kyros ein Feind dieser Stadt war. Xenophon lebte anschließend im Exil in Sparta.
I.3.2 Zu den albanischen Texten
Die Verschriftlichung des Albanischen setzt im Vergleich zu anderen indogermanischen Sprachen verhältnismäßig spät ein. Erst im 15. Jh. beginnen die Albaner in ihrer Sprache Texte zu verfassen. Aus dem Jahre 1462 ist eine Taufformel von Paulus Angelus bewahrt. Hierbei handelt es sich um einen einzigen Satz (alb. Unte paghesont premenit Atit et birit et sperit senit ‚Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes‘), der in einen in lateinischer Sprache geschriebenen Brief eingefügt wurde.
Das Albanische wurde schließlich in lateinischer Schrift aufgeschrieben, erweitert durch Zeichen anderer Schriftsysteme. Allerdings gab es im 15. Jh. noch keine einheitliche Schreibweise der albanischen Sprache.1 Die Wahl ist u.a. aus religiösen Gründen auf das lateinische Alphabet gefallen, denn die ersten albanischen Autoren waren Geistliche der römisch-katholischen Kirche, d.h. sie waren des Lateinischen mächtig.
Auch aus politischen Gründen ist die Entscheidung für das lateinische Alphabet plausibel. Das albanische Territorium befand sich jahrelang unter der Fremdherrschaft von Bulgaren, Byzantinern, Venezianern, Anjou, Türken u. v. m.2 Seit dem Jahr 1479 waren die Osmanen im albanischen Raum an der Macht und mit ihnen hielten die arabische Schrift und Sprache sowie der Islam Einzug. Auch die Islamisierung spielte im Zuge dessen eine Rolle in der Geschichte Albaniens.3 Zuträglich waren Missstände in der albanischen Kirche. Es mangelte an Priestern „... und die vorhandenen waren oft von erschreckender Unbildung. ...“4 Diese „Unbildung“ verdeutlicht die Erfordernisse solcher Bücher wie von Matrënga und Buzuku, wobei beide Werke nicht in Albanien selbst, sondern außerhalb entstanden sind. Das Eindringen der Osmanen löste außerdem eine Flüchtlingswelle nach Italien aus, die erst im 16. Jh. nachließ. Durch die Wahl des lateinischen Alphabets war eine Positionierung gegen die Osmanen möglich. Matzinger (2010) nennt die Wahl der lateinischen Buchstaben im Bezug auf die türkische Fremdherrschaft eine „Signalwirkung“.5
Bei Matrënga kann ein Bestreben, die Inhalte des christlichen Glaubens den albanischen Christen verständlich zu machen und ihnen das Christentum in ihrer eigenen Sprache näherzubringen, an seinem Werk abgelesen werden. Gerade in einer Zeit, in der die Türken die Albaner zwangen zum Islam zu konvertieren und viele Albaner aus ihrer Heimat flüchten. So schreibt Matrënga im italienischen Vorwort, dass sein Werk den Arbëresh6 dienen soll, die des Italienischen nicht mächtig sind. Natürlich steckt dahinter eine Rechtfertigung und Legitimation der Dottrina cristiana, damit die Kirche, die alles kontrollierte, was gedruckt wurde, sein Werk überhaupt zuließ. Im Zuge der Gegenreformation wurden viele Bücher, die in einer Volkssprache verfasst waren, durch die katholische Kirche auf den sogenannten Index librorum prohibitorum gesetzt und verboten. In der Forschung wird hinterfragt, ob auch Buzukus Werk diesem Verfahren zum Opfer gefallen sei.7 Es war nie für die einfachen Gläubigen gedacht, sondern für „... albanische Geistliche der norditalienischen Diaspora ...“.8 Dennoch war es in einer Volkssprache geschrieben und Texten dieser Art stand die Kirche im 16. Jh. kritisch gegenüber. Elsie (2007) umreißt die Einstellung der katholischen Kirche folgendermaßen:
„.... Die Einstellung der Kirche zu religiösen Veröffentlichungen, insbesondere zu Veröffentlichungen in Volkssprachen, d. h. nicht auf Latein, schwankte sehr in und nach den Jahren des Tridentinischen Konzils (1545-1563). Im Geist einer dringend benötigten Reform befürwortete die Kirche anfänglich die Übersetzung von Kirchenschriften in den Volkssprachen. Bald darauf änderte sie ihre Haltung. In Rückbesinnung auf die traditionelle katholische Lehre der Gegenreformation, die der italienischen Renaissance ein Ende machte, und in der allgemeinen Atmosphäre von Einschüchterung, die während der Inquisition herrschte, wurden die gleichen, früher geförderten Bücher auf den Index (Index librorum prohibitorum) gestellt und dadurch verboten. ...“9
Andere Wissenschaftler widersprechen der These, dass Buzukus Buch auf den Index kam. Peters (2007) weist darauf hin, dass Buzukus Buch „... eine Handreichung oder Arbeitsbehelf für Liturgie und Katechese ...“10 war. Dies könnte die katholische Kirche geduldet haben, da sie im 16. Jh. bemüht war, ihren Status zu festigen und sich einerseits in Europa gegen die Protestanten durchsetzen musste und andererseits in Albanien gegen den islamischen Einfluss. Dabei könnte ein Werk, das den albanischen Geistlichen den katholischen Glauben und dessen Dogmen etc. nahebringt und ihren Glauben festigt, hilfreich gewesen sein. Möglicherweise blieb dadurch das Missale von einem Verbot verschont. Zusammenfassend kann nur gesagt werden, dass es in der Forschung nicht abschließend geklärt ist, ob Buzukus Buch dem Verbot durch die Kirche zum Opfer gefallen ist oder nicht.
Das Missale und die Dottrina cristiana haben die Intention gemeinsam, die albanische Identität an westliches Gedankengut anzuknüpfen, um sich vom osmanischen Einfluss abzugrenzen. Dafür spricht auch, dass beide Bücher Übersetzungsarbeiten theologischer Werke sind. Zudem sind beide Werke außerhalb Albaniens durch Geistliche entstanden, „... deren Bestreben es war, das Albanische nach vielen Jh.en der Mündlichkeit angesichts der osmanisch-islamischen Eroberung als Sprache des christlichen Glaubens zu fixieren und so zu etablieren. ...“11 In den nächsten Abschnitten werden das Missale von Buzuku und die Dottrina cristiana von Matrënga kurz vorgestellt. Auf eine Inhaltsangabe wird aufgrund der Textarten verzichtet: Die Dottrina ist ein Katechismus und das Missale eine Komposition aus Gebeten, Psalmen und anderen christlichen Texten.
I.3.2.1Über das Missale von Buzuku
Das Missale von Gjon Buzuku in altgegischem Dialekt stammt aus dem Jahre 1555. Es ist das erste gedruckte Buch in albanischer Sprache. Ursprünglich bestand das Werk aus 110 Folioblättern. Davon sind 16 verloren gegangen, u.a. das Frontispiz, so dass der genaue Titel heute unbekannt ist. Das erhaltene Werk besteht aus 94 Folioblättern, i.e. 188 Seiten.1 Ferner fehlt die Angabe des Druckorts. In der Forschung wird allgemein angenommen, dass das Missale in Venedig2 hergestellt wurde. Zu diesem Schluss ist man u.a. aufgrund der verwendeten Schrift beim Druck, der norditalienisch-gotischen Rotunda, gekommen. Für das vorliegende Projekt wurde nicht das gesamte Missale konsultiert, sondern nur Folio 9, i.e. 9r und 9v nach der Ausgabe von Ressuli (1958).
Lediglich ein Exemplar des Missales ist erhalten. Das Buch war lange Zeit in Vergessenheit geraten und wurde zufällig 1740 in der Bibliothek „… of the College of the Propaganda Fide …“3 durch den Jesuiten Johannes Nicolevich Casasi4 wieder entdeckt. Heute wird das einzige Exemplar in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrt.
Das Werk Buzukus wird nach seinem Inhalt Missale genannt, bzw. auf Albanisch Meshari.5 Daran wird deutlich, dass es sich hierbei nicht um ein Werk handelt, das der Feder Buzukus entsprungen ist, sondern dass eine Übersetzungsarbeit katholischer Literatur aus dem Lateinischen ins Albanische vorliegt. Einen konkreten Vorlagetext besitzt das Missale jedoch nicht.6 Es ist vielmehr eine Kompilation von Gebeten sowie liturgischen und religiösen Texten aus dem Alten und Neuen Testament, die im Kirchenjahr zentrale Bedeutung haben. Peters (2007) fasst den Inhalt des Missales treffend zusammen:
„… Das liturgische Werk Buzukus ist eine Mischung aus Brevier, Messbuch, Lektionar, Rituale und Katechismus und beginnt zunächst mit Teilen des Stundengebets (Laudes, Prim, Terz, Sext, Non, Vesper und Komplet), dann folgen die Sieben Bußpsalmen Davids, Heiligenlitaneien des franziskanischen Ritus einige Teile des Rituale (über das hl. Ehesakrament), die Zehn Gebote sowie einige andere Teile des Katechismus und schließlich fast alle Messen, welche während des Kirchenjahres zu feiern sind, sowohl zu den beweglichen als auch zu den unbeweglichen Festtagen. …“7
Das Werk klingt mit einem „persönlichen“ Kommentar von Buzuku aus. Darin erklärt er seine Beweggründe, das Missale anzufertigen, ermahnt den Leser häufiger in die Kirche zu gehen, beschreibt kurz den Arbeitszeitraum an dem Buch und entschuldigt sich für eventuelle Fehler. Durch dieses Postskriptum sind ein paar Informationen über Buzuku auf uns gekommen. Doch insgesamt ist über den Autor nur sehr wenig überliefert. Man weiß, dass Gjon Buzuku ein katholischer Geistlicher war. Wahrscheinlich hat er nicht in Albanien gelebt, sondern in der Region um Venedig. In dieser Gegend sind albanische Flüchtlinge nach der osmanischen Eroberung sesshaft geworden, darunter auch die Sippe Buzukus. Aufgrund seines Dialektes kann es als sicher gelten, dass Buzukus Wurzeln in Nordalbanien, der Heimat des Gegischen, lagen.8
I.3.2.2Über die Dottrina cristiana von Matrënga
Die Dottrina cristiana, oder auf Albanisch Mbsuame e Krështerë, von Lekë Matrënga aus dem Jahre 1592 ist das erste bekannte Werk im toskischen Dialekt. Gedruckt wurde es in Rom. Es handelt sich hierbei um eine Übersetzung des Katechismus des Jesuiten Jacob Ledesma. Als Vorlage diente eine italienische Version, mit der die Dottrina cristiana verflochten ist. So wechseln sich italienische und albanische Passagen ab. In der vorliegenden Untersuchung wird der italienische Part nicht berücksichtigt, da er gleichen Inhalts wie der albanische Text ist und die vorliegende Untersuchung das Italienische nicht einbezieht. Gemäß der Vorlage ist die Dottrina cristiana als Frage-Antwort-Text gestaltet. Dabei werden Inhalte des christlichen Glaubens dargelegt, verschiedene Gebete vorgetragen und besprochen sowie Dogmen erklärt. Zusätzlich enthält das Buch eine Einleitung in zeitgenössischer italienischer Sprache. Eine Besonderheit der Dottrina cristiana ist, dass sie mit einem kurzen Gedicht, dem Canzone Spirituale, beginnt, der ersten niedergeschriebenen albanischen Lyrik.
Das Werk Matrëngas umfasst 48 Folioblätter. Es sind drei verschiedene Handschriften der Dottrina cristiana erhalten. Man geht sogar davon aus, dass eins dieser Manuskripte die Handschrift Matrëngas selbst ist. Als gedrucktes Buch ist die Dottrina cristiana nur in einem Exemplar erhalten.
Matzinger (2006) informiert über das Buch:
„… Da die gedruckte Ausgabe allerdings sehr fehlerhaft und insgesamt recht mangelhaft war, ist es dieser schlechten Qualität zuzuschreiben, daß der Druck keine große Resonanz gefunden hat. So ist die Dottrina cristiana des Lekë Matrënga in der Folge in Vergessenheit geraten. …“1
Über Matrënga selbst ist ein wenig mehr als über Buzuku bekannt. Matrënga lebte von 1567–1619. Über seinen Geburtsort besteht Ungewissheit. In Frage kommen Piana dei Greci2 oder Monreale, beide Orte liegen in der Provinz Palermo auf Sizilien. Matrënga stammt aus einer toskischen Familie, die vermutlich 1532/33 aus Albanien ausgewandert ist. 1582–1587 studierte Matrënga in Rom am griechischen Kollegium des Heiligen Athanasius und kehrte anschließend nach Sizilien zurück. Die Weihe zum Priester erhielt er vermutlich 1591. Über seine späten Lebensjahre weiß man, dass er in der italoalbanischen Gemeinde in Piana dei Greci als Geistlicher wirkte. Dort starb er auch am 6. Mai 1619 als Erzpriester. Im Unterschied zu Buzuku war Matrënga ein Geistlicher orthodoxen Glaubens.
I.3.3Zur Hrafnkels saga freysgoða
Der altnordische Text Hrafnkels saga freysgoða1 ist eine fiktive Erzählung, die in das Genre Saga einzuordnen ist. Sie lebt besonders von Rachemotiven, die einen Gerichtsprozess führen. Die Geschichte berichtet, wie es zu diesem kam, aber auch auf welche Weise die Figuren streiten und welches Ende der Konflikt nimmt. Der Rechtsstreit wird beinah demokratisch gelöst, was für die Zeit, in der die Geschichte spielt, durchaus bemerkenswert ist.
Die Hauptprotagonisten der Saga Hrafnkels saga freysgoða sind Hrafnkell und Sámr, wobei Sámr erst etwa in der Mitte der Geschichte auftritt. Zu Beginn der Saga werden Hrafnkell und sein Wohnsitz, der Adelhof, beschrieben. Hrafnkell ist ein wohlhabender und mächtiger Mann, der das Godenamt ausübt, d.h. er erfüllt eine gewisse Schutzfunktion und Gerichtsbarkeit. Ein armer Mann, Þorbjǫrn, schickt seinen ältesten Sohn Einar in den Dienst Hrafnkells, wo er eine Anstellung als Schafhirte erhält. Eines Tages jedoch verschwinden die Schafe. Um sie schneller finden und zurücktreiben zu können, fängt Einar von einer Pferdeherde eins der Tiere ein. Er erwischt den Hengst Freyfaxi, der Hrafnkell gehört und dem Gott Freyr geweiht ist. Hrafnkell hat es jedermann untersagt, ihn zu reiten. Natürlich hofft Einar, dass Hrafnkell nichts bemerkt. Doch Hrafnkell erfährt davon und erschlägt Einar. Der Vater Einars verlangt Vergeltung und fordert ein Rechtsurteil. Þorbjǫrn sucht hinsichtlich des Streits Unterstützung bei seinem Bruder Bjarni und dessen Sohn Sámr, der im Laufe der Geschichte als Gegenspieler Hrafnkells hervortritt. Sámr übernimmt die Klage für Einars Vater. Daraufhin wird ein Thing einberufen und der Prozess zu Gunsten Þorbjǫrns und Sámrs entschieden. Hrafnkell wird als friedlos erklärt und von seinem Hof vertrieben. Stattdessen bezieht Sámr diesen mit seinen Leuten, auch den Hengst Freyfaxi nimmt er in Besitz. Allerdings wird das Pferd getötet, da überhaupt erst der Ritt auf ihm den Streit heraufbeschworen hat. Hrafnkell verlegt seine Wirtschaft und erarbeitet sich erneut Reichtum und Ansehen. Zum Ende der Saga kehrt der Bruder Sámrs, der Seemann Eyvindr, nach Island zurück. Als dieser mit seinen Leuten von der Küste in das Landesinnere reitet, treffen sie mit Hrafnkell und einigen von dessen kampftüchtigen Untergebenen zusammen. Es kommt zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, in der Hrafnkell Eyvindr tötet. Anschließend fällt Hrafnkell mit seinen Leuten auch bei Sámr ein, vertreibt ihn vom Adelhof und raubt all seinen Besitz, aber lässt ihn am Leben. Die Geschichte endet damit, wie Hrafnkell seinen Grundbesitz unter sich und seinen Söhnen aufteilt und viel später an einer Krankheit stirbt.
Der Rechtsstreit sowie die anschließende Enteignung und Vertreibung Hrafnkells bilden den längsten Part der Geschichte. Der Totschlag Einars ist die Vorgeschichte, die den Streit heraufbeschwört. Mit dem Tod Eyvindrs kommt es im Verlauf der Erzählung erneut zu einem Konflikt. Das Ende der Saga ist die Rache Hrafnkells. Die Saga kann in die Abschnitte Einleitung, erster Konflikt, erste Rache, beruhigte Phase, erneuter Konflikt, zweite Rache und Ende gegliedert werden. Dies spiegelt das Grundschema wieder, nach dem die Isländersagas aufgebaut sind.
Der Terminus Saga (anord. saga ‚etwas Erzähltes‘) ist von anord. segja ‚sagen, erzählen‘ abgeleitet und bedeutet ‚Mitteilung, Bericht‘. Sagas gehören zur altnordischen Prosaliteratur und sind in schriftlicher Form überliefert. Sie werden in der Forschung in verschiedene Untergruppen eingeteilt, so spricht man beispielsweise von den Königssagas, den Bischofssagas, den Isländersagas, den Vorzeitsagas und anderen.2 Gegenstand der folgenden Darstellung sind ausschließlich die Isländersagas, da die Hrafnkels saga freysgoða zu diesen gehört. Insgesamt sind etwa 40 Geschichten dieser Art überliefert. Die Bezeichnung Isländersaga, bzw. auf Isländisch Íslendinga sögur, leitet sich von der Herkunft der Protagonisten ab, „… die zu den ersten Generationen des isländischen Volkes gehörten, von der Landnahme bis etwa 1030. …“3 Die überlieferten Sagas entstammen der Zeit zwischen der Mitte des 12. Jh. bis ins 14. Jh. Die Autoren sind häufig nicht bekannt. Ebenso ist oft unklar, wann genau und wo die einzelnen Sagas verfasst wurden. Auch hinsichtlich möglicher Quellen können nur Vermutungen angestellt werden. Es ist anzunehmen, dass die Sagas ein Potpourri mündlicher Überlieferungen, älterer Schriften, Genealogien und der Phantasie des jeweiligen Autors darstellen. Eines sind sie jedenfalls nicht: zuverlässige historische Quellen für die Zeit von etwa 930–1030. Die Sagas zeigen vielmehr, welche Vorstellung ihre Verfasser von der Zeit um das 10. Jh. gehabt haben mögen. Thematisch drehen sich die Isländersagas stets um Auseinandersetzungen, Kämpfe, Fehden und Rache. Dabei werden die Charaktere sehr plastisch und lebendig dargestellt. Sie haben sowohl gute wie schlechte Seiten und erleben im Laufe der Erzählung einen Wandel. Baetke (1952) rühmt die Sagaliteratur mit folgenden Worten:
„… Diese Literatur erweckt das Interesse des Literaturhistorikers schon deswegen, weil es die einzige künstlerische Prosaliteratur des abendländischen Mittelalters ist mit einem ebenfalls einzigartigen Sprachstil und einer realistischen Darstellungsform, die erst in der Neuzeit ihresgleichen gefunden hat. …“4
Die Hrafnkels saga freysgoða gilt als „… die bedeutendste Isländersaga. …“5 Sie ist um 1300 entstanden. Man geht in der Forschung davon aus, dass es sich um ein fiktives Werk handelt, auch wenn einige Figuren, wie zum Beispiel Hrafnkell, historisch belegt sind.
Die Saga Hrafnkels saga freysgoða ist in verschiedenen Abschriften erhalten. Baetke (1952) bezeichnet sie als A (AM156, fol.), B (AM158, fol.), C (AM433, 4to), D (AM551 c, 4to) und y. Die Versionen A, B, C und y gehen auf dieselbe Membran zurück, kurz als M bezeichnet. Diese Membran ist ins 15. Jh. zu datieren und „… war bis 1650 vollständig bewahrt. …“6 Heute ist lediglich noch ein Pergamentblatt in AM162 I, fol. erhalten. Auch die Abschrift y ist verloren gegangen. Doch nach ihrem Vorbild sind die Abschriften B und C angefertigt worden. Die Handschrift A dagegen wurde wohl direkt von M abgeschrieben. Die Version D weicht von den anderen stark ab und es wird in der Forschung angenommen, dass sie anhand der ursprünglichen Version der Saga angefertigt wurde. In dieser Untersuchung wurde mit der Ausgabe von Baetke (1952) gearbeitet. Diese stützt sich großteils auf die Abschrift A der Saga.7
I.3.4Zur Geschichte Armeniens von Agantʿangeɫos
Das Werk ist, wie das von Xenophon, ein Denkmal antiker Geschichtsschreibung. Die Geschichte Armeniens von Agantʿangeɫos ist bekannt unter dem Titel Patmowtʿiwn Hayocʿ, doch das Vorwort ist mit Agantʿangeɫeay Patmowtʿean, i.e. ‚Geschichte von Agantʿangeɫos‘, überschrieben. Der Autor zeigt hier ein bemerkenswertes Selbstbewusstsein, indem er sich selbst im Titel nennt. Im Weiteren wird von der Geschichte Armeniens oder von Patmowtʿiwn Hayocʿ gesprochen.
Liest man die Patmowtʿiwn Hayocʿ, erschließen sich die historischen Zusammenhänge nicht augenblicklich. Der Autor setzt viel Weltwissen des Lesers voraus, das ein heutiger Leser nicht mitbringt. Ferner besteht auch in der Forschung nicht immer Einigkeit über die Bestimmung der Jahreszahlen etc. Bspw. ist eine Hauptfigur der Geschichte Armeniens der armenische König Trdat. Über sein Leben ist wenig bekannt.1 Sicher ist, dass König Trdat der erste getaufte armenische König war und im Jahre 330 starb. Im Folgenden wird versucht, zunächst das Werk selbst und anschließend die historischen Hintergründe der Geschichte Armeniens zu erklären, damit der Text von Agantʿangeɫos dem Leser durchsichtiger wird.
I.3.4.1Über das Werk
Die Geschichte Armeniens von Agantʿangeɫos ist ein umfangreiches Werk. Für die Untersuchung wurden lediglich der Prolog und das erste Kapitel verwendet. Daher wird auch nur deren Inhalt umrissen. Einen knappen Überblick über den Inhalt des gesamten Werks gibt Inglisian (1963):
Der Text besteht „… aus 3 Teilen: Nach einer schwulstigen Einführung a) die Darstellung der polit. Umwälzung in Persien (gewaltsame Machtergreifung des Sassaniden Artaschir und Beginn dieser Dynastie) und in Armenien Flucht des Trdats und Gregors und Rückkehr nach Armenien, Bekenntnis Gregors als Christ und seine daranschliessenden Folterqualen, wie die Verfolgung und das Martyrium der christl. Jungfrauen Hrip’simeank’ (15–133); b) die Lehre Gregors (124–372); c) Bekehrung des Hofes und des ganzen Volkes, feierliche Bischofsweihe Gregors in Cäsarea (Kappadozien) und seine pastorale Tätigkeit (373–474). …“1
Die Geschichte Armeniens beginnt mit einer langen Einleitung. Die Sprache des Prologs ist poetisch und die Konstruktionen sind kompliziert. Thomson (1976) nennt sie „äußerst gewunden“ und weist darauf hin, dass es oft schwierig ist, textnah zu übersetzen.2 Agantʿangeɫos beginnt mit einer Meeres-Metaphorik, die sich durch das gesamte Vorwort zieht. Dabei betont er besonders die gefährliche Schönheit des Ozeans. Der Autor vergleicht sich mit einem Kaufmann, der sich den Bedrohungen des Meeres aussetzt, um kostbare Waren zu erlangen. Agantʿangeɫos aber segelt auf dem „Meer der Weisheit“ sowie dem „Meer der Geschichte“ und trotzt den Klippen, die sich einem Schriftsteller in den Weg stellen. Ohne zunächst den Namen zu nennen, schreibt Agantʿangeɫos, dass er dieses Werk auf die Aufforderung eines Königs hin verfasst hat. Anschließend stellt sich Agantʿangeɫos selbst vor.3 So erfährt man, dass er aus Rom kommt und in Latein, Griechisch und literarischer Dichtung geschult ist. Ebenso nennt und rühmt er in diesem Absatz den König Trdat sowie dessen Geschlecht, die Arsakiden. Daraus kann geschlossen werden, dass er auch zuvor von diesem König Trdat sprach. In der armenischen Geschichte gab es jedoch mehrere Könige dieses Namens. In der Forschung geht man davon aus, dass es sich entweder um Trdat III4 oder Trdat IV handelt.5 Ferner skizziert er in groben Zügen das Leben sowie die Verdienste von Gregor dem Erleuchter6, allerdings auch ohne dessen Namen mitzuteilen. Anschließend betont Agantʿangeɫos, dass er keine Quellen benutzte, da er alles mit eigenen Augen gesehen habe. Die letzten Absätze des Vorworts enthalten einen Ausblick über das, was Agantʿangeɫos in seinem Werk berichten wird. Das Vorwort schließt, wie es begonnen hat, mit einer Meeres-Metaphorik.
Das erste Kapitel ist mit „Leben und Geschichte des Heiligen Gregor“7 überschrieben. Zunächst werden die zeitgenössischen Herrschaftsverhältnisse dargelegt, allerdings die des Iran, was für den heutigen Leser im Text nicht gleich deutlich wird. Man muss wissen, dass zwischen dem iranischen und dem armenischen Königshaus enge Bande bestanden, da beide der Dynastie der parthischen Arsakiden8 entstammen.9 Agantʿangeɫos schreibt, dass die Parther durch die Perser abgesetzt wurden. An ihrer Spitze stand Artashir, der Sohn des Sasan. Dies war zur Zeit des armenischen Königs Khosrov, dem Vater Trdats.
Es wird berichtet, wie König Khosrov eine Armee aufstellt, um gegen die Perser zu ziehen. Die Streitmacht besteht aus Völkern verschiedener Nationen, u.a. Albaner und Georgier. Andere Verwandte des armenischen Königshauses unterwerfen sich der Herrschaft des persischen Königs Artashir. Dem armenischen König gelingt es, die persische Streitmacht zu zerschlagen, so dass der persische König vor ihm flieht. Im folgenden Jahr wird erneut eine Armee versammelt, zu der sich auch weitere Völker gesellen. Die Plünderungen und Kriegstreibereien setzen sich die nächsten 11 Jahre10 fort. Der persische König sucht nach einem Ausweg aus dieser Misere und versammelt die Obersten seines Reiches. Unter diesen befindet sich ein Parther, genannt Anak, der dem Perser Rache verspricht. Der Perserkönig stellt Anak eine Krone und den zweiten Rang in seinem Reich als Belohnung in Aussicht. Anak begibt sich zum armenischen Hof und meuchelt König Khosrov. Nur ein Kind überlebt das Attentat auf das armenische Königshaus, der Sohn Khosrovs, Trdat. Diese Tat Anaks bleibt nicht ungesühnt und er wird samt seiner Familie getötet. Das erste Kapitel endet damit, dass der persische König Artashir Armenien einnimmt und die Grenzen befestigt.
Im Allgemeinen ist es unklar, wann genau die Geschichte Armeniens verfasst wurde. In der Forschung wird das Werk auf die zweite Hälfte des 5. Jh. datiert. Die Ereignisse, die geschildert werden, sind aber im 3. und 4. Jh. anzusiedeln. Daher wird bezweifelt, dass Agantʿangeɫos ein Augenzeuge war, wie er selbst schreibt. Ein Grund für die späte Datierung liegt in der Biographie des heiligen Gregor, denn diese ist der Biographie des Mesrop von Koriwn nachempfunden. Da die Lebensbeschreibung des Mesrop in der Mitte des 5. Jh. niedergeschrieben wurde, kann das Werk von Agantʿangeɫos nicht älter sein. Ferner ist bei Thomson (1976) zu lesen, dass der Name Agantʿangeɫos den armenischen Autoren ungefähr bis zum Ende des 5. Jh. nicht bekannt war.11 Vermutlich wurde das Werk zeitlich so angesiedelt, um den armenischen Volk eine Geschichte zu geben, die die Fakten so darlegt, dass das Volk stolz auf seine Herkunft sein kann.
Ein weiterer, entscheidender Grund, warum das Werk des Agantʿangeɫos nicht zu Lebzeiten des Königs entstanden sein kann, ist folgender: In der Forschung bestehen zwar Unsicherheiten hinsichtlich der Lebensdaten Trdats12, aber seine Konversion wird relativ sicher auf 314 datiert, nach armenischer historischer Tradition auf 301. Das armenische Alphabet wurde jedoch erst zu Beginn des 5. Jh.s entwickelt. Des Weiteren gilt die armenische Fassung als Original und man weiß, dass die Armenier vor der Entwicklung ihres eigenen Alphabets ihre Sprache nicht anhand eines anderen verschriftlicht haben. Thomson (1976) schreibt über das Werk des Agantʿangeɫos in der Einleitung, dass es eine Mischung aus erinnerter Tradition und erfundener Legende ist.
Von der Geschichte Armeniens gab es eine ältere und eine jüngere Version.13 Bewahrt ist lediglich die ältere. Die jüngere Fassung ist zwar verloren gegangen, aber durch Übersetzungen ins Griechische, Syrische, Arabische und Georgischebekannt. Der verlorengegangene Text wird Zyklus V genannt, der erhaltene Zyklus A. Kettenhofen (1995) weist zusätzlich daraufhin, dass van Esbroeck eine weitere Version gefunden hat, „… die sowohl die A- als auch die V-Rezension aneinander anglich; auch ihre armenische Vorlage ist verloren. …“14 Schon in der Antike wurde die Geschichte Armeniens von Agantʿangeɫos vielfach übersetzt.
Laut Thomson (1976) gibt es nur eine komplette Übersetzung in eine moderne Sprache. Es ist eine Übersetzung ins Italienische im Jahre 1843 durch die venezianischen Mechitaristen.15 Mit Thomsons Edition (1976) liegt die erste englische Übersetzung vor. Diese wurde grundlegend für die vorliegende Arbeit genutzt.
I.3.4.2Historische Hintergrundinformationen
Die Geschichte Armeniens von Agantʿangeɫos beschreibt die armenische Geschichte des 3. Jh. Zu dieser Zeit gab es zwei Großmächte, die Römer im Westen und die Parther im Osten. Beide unterhielten friedliche Beziehungen und teilten den gleichen Feind, i.e. die erstarkenden Perser. Diese versuchten derzeit die Parther im Osten zu verdrängen. Agantʿangeɫos berichtet zunächst über die Sasanidische Revolution des Jahres 224. Die Parther, die lange Zeit im Iran herrschten, wurden abgesetzt und die Perser nahmen deren Position ein. Dies beschwor einen Konflikt mit den Armeniern herauf, deren amtierender König Khosrov der Linie der Parther entstammte. Der zu den Persern übergelaufene Fürst Anak ermordete König Khosrov. Im Gegenzug wurde Rache an Anak und seiner Familie geübt, lediglich sein Sohn Gregor überlebte. Er wurde in Kappadokien bei einer Christin im christlichen Sinne erzogen. Später wird er als Gregor der Erleuchter, der Apostel der Armenier, bekannt werden. Auch der Sohn Khosrovs, Trdat III. oder Trdat IV.1, wurde außer Landes gebracht. Durch römischen2 Einfluss erhielt Trdat unter der Herrschaft des römischen Kaisers Diocletian den armenischen Thron zurück. Die römische Politik beeinflusste die armenische entscheidend. Kaiser Diocletian verfolgte Christen und ebenso wurden Christen in Armenien verfolgt und umgebracht. Doch als sich in Rom unter Kaiser Konstantin die Haltung gegenüber den Christen änderte, änderte auch König Trdat seinen Kurs. Diese Problematik ist mit einer Legende3 verknüpft, die von der Ermordung 33 nach Armenien geflüchteter Jungfrauen handelt. Angeblich hat es sich folgendermaßen zugetragen: König Trdat verliebte sich in die schöne Nonne Hripʿsimeankʿ. Er begehrte sie zur Frau, doch sie wollte keinen „Heiden“ ehelichen. Daraufhin ließ der König Hripʿsimeankʿ sowie weitere Jungfrauen aus ihrem Orden ermorden. Damit nahm, der Geschichte nach, die Christenverfolgung in Armenien ihren Lauf. Trdat aber wurde sehr krank und verwandelte sich in ein Wildschwein. Seine Schwester Khosroviducht hatte eine Vision, dass nur Gregor, der Sohn des Anak, ihn retten könnte. Gregor befand sich zu dieser Zeit bereits seit einiger Zeit im Kerker, weil er als Christ erkannt worden war. Nun wurde er herausgeholt, bekehrte und heilte den König und das Christentum hielt als anerkannte Religion Einzug in Armenien. Wie viel Wahrheit in dieser Legende steckt, kann man heute nicht mehr genau sagen. Interessant sind aber zwei Dinge: Zunächst wird mit der Bekehrung des armenischen Königs direkt ein christliches Grundprinzip demonstriert, i.e. das Vergeben. Trdat und Gregor sind eigentlich aufgrund ihrer Herkunftsverhältnisse Feinde, doch durch die Heilung und Bekehrung überwinden sie dies. Gregor wird danach geistliches Oberhaupt Armeniens. Somit arbeiten Gregor und Trdat Hand in Hand. Hinsichtlich der Wahrheit ist bei Deschner (1996) zu lesen, dass Gregor um 280 das Christentum verkündete und „… [d]abei gewann er Einfluß auf König Trdats Schwester Chosroviducht und zuletzt auf den König …“.4 Der zweite interessante Punkt ist die neue Religion. Armenien war lange Zeit geteilt, so dass ein Teil des Landes iranisch und der andere griechisch geprägt war. Das Volk besaß also keine einheitliche Religion. Durch die Einführung des Christentums als Staatsreligion wird das Volk auch im Geiste geeint. Zugleich wurde dadurch politisch eine neue Zeit eingeleitet. Eine andere Meinung vertritt Deschner (1996). Er sieht den Übertritt der Armenier zur christlichen Religion in der Feindschaft mit den Persern begründet. Er schreibt: „… Das Motiv für den Übertritt des Königs und damit für die Christianisierung des Volkes war nichts andres als der Argwohn, die Feindschaft gegen Persien. …“5 So hat das armenische Volk die neue Religion nicht aus eigenem Entschluss angenommen. Vielmehr befahl König Trdat dem Volk Christen zu werden, wie er auch. Im Zuge dessen wurde Armenien das erste Land, das das Christentum als Staatsreligion eingeführt hat.
I.4Theoretische Grundlagen
In diesem Kapitel werden die zugrunde gelegten Theorien erläutert, die anschließend in Kapitel II und III angewendet werden, wobei beide Kapitel ineinander greifen sowie aufeinander aufbauen. In Kapitel II erfolgt eine Beschreibung und Untersuchung des Artikels nach grammatiktheoretischen Grundsätzen, die sich besonders in der finalen Analyse auf das Prinzipien- und Parameter-Framework stützen (vgl. Kap. II.10). Dieses Framework bildet auch den Ausgangspunkt der syntaktischen Analyse. Ausgehend von der Erforschung grammatischer Kategorien und Funktionen wurden innerhalb der generativen Grammatik verschiedene Hypothesen zur Erklärung von Serialisierungen und syntaktischer Besonderheiten entwickelt. Dazu gehören u.a. die Rektions- und Bindungstheorie oder die DP-Analyse1, die zur Erforschung des definiten Artikels als maßgebliche Basis dient (vgl. Kap. III). Mittels dieser Analyse können syntaktische Zusammenhänge sichtbar gemacht und somit Serialisierungen sowie unmarkierte Strukturen im Nominalbereich leichter gedeutet werden. Phänomene, wie mehrere Artikel in einer Phrase, können ebenfalls durch diesen syntaktischen Ansatz erklärt werden.
Im Folgenden werden zunächst die für diese Arbeit wichtigen Grundlagen des Prinzipien- und Parameter-Frameworks dargelegt (Kap. I.4.1), anschließend die DP-Hypothese sowie weitere Theorien, Termini und Begriffe der generativen Grammatik, die zum Verständnis der Untersuchung essentiell sind (vgl. Kap. I.4.2).
I.4.1Zum Prinzipien- und Parameter-Framework
Das Prinzipien- und Parameter-Framework ist eine Grammatiktheorie, die auf Chomsky (1981, 1982) zurückgeht und sprachübergreifend den Aufbau von natürlichen Sprachen beschreibt.1 Nach dieser Theorie gibt es Prinzipien und Parameter, die zusammengenommen eine spezifische Sprache konstituieren. Prinzipien sind universelle Regeln, Grundsätze, Merkmale etc., die in jeder Sprache Geltung haben, d.h. es handelt sich um obligatorische Gesetzmäßigkeiten, die eine Sprache determinieren. Die Prinzipien bilden also die Grundlagen der sog. Universalgrammatik. Parameter sind demgegenüber Features, die ein sprachliches Element zusätzlich aufweisen kann und die die speziellen Besonderheiten einer Sprache formen.
Das Prinzipien- und Parameter-Framework geht von funktionalen und lexikalischen Kategorien aus. Lexikalische Kategorien sind uniform, d.h. sie gelten sprachübergreifend und erfassen die deskriptiven Elemente einer Sprache wie Verben, Adjektive etc. Funktionale Kategorien sind sprachspezifisch und konzentrieren sich auf grammatische Merkmale und Aufgaben sprachlicher Elemente. In diese Gruppe gehören alle sprachlichen Elemente ohne beschreibenden Inhalt, also Artikel, Präpositionen usw.2
Im Prinzipien- und Parameter-Framework spielen die sog. Adäquatheitsbestimmungen eine wichtige Rolle. Diese sind Beobachtungs-, Beschreibungs- und Erklärungsadäquatheit. Ein Erklärungsmodell muss beobachtungsadäquat sein, d.h. es muss Regeln formulieren, die zur Erzeugung ausschließlich grammatisch korrekter Strukturen führen und dabei alle Möglichkeiten zur Bildung von Phrasen einer Sprache berücksichtigen. Aus der Beobachtungsadäquatheit resultiert Beschreibungsadäquatheit. Sie ist gegeben, wenn die erste Bestimmung erfüllt ist und wenn die aufgestellten Regeln richtige Strukturbeschreibungen erzielen. Erklärungsadäquatheit schließlich ergibt sich aus der Beschreibungsadäquatheit, d.h. Erklärungsadäquatheit liegt vor, wenn die beschriebenen Regeln mit den Prämissen der universellen Grammatik harmonieren. Ziel ist es also, einfache und anwendungsbezogene Hypothesen folgerichtig für natürliche Sprachen zu erarbeiten, um die Annahme einer Universalgrammatik zu stützen. Prinzipien repräsentieren dabei die allgemeingültigen Regeln und Parameter die einzelsprachlichen Variationen. Somit legt das Prinzipien- und Parameter-Framework eine Sprache nicht auf eine syntaktische Struktur fest, sondern ermöglicht einerseits die Erklärung sowohl markierter als auch unmarkierter Serialisierungen und andererseits die Analyse grammatischer Elemente, die zwar in verschiedenen Sprachen vorkommen, im Vergleich jedoch Funktionsvariationen aufweisen. In Kapitel II wird ebenfalls nach den Adäquatheitsbestimmungen gearbeitet. Zunächst werden die erhobenen sprachlichen Daten ausgewertet und Regelmäßigkeiten sowie Unregelmäßigkeiten abgeleitet. Anhand dieser Beobachtungen und den daraus resultierenden Beschreibungen der Untersuchungssprachen kann im Fazit des Kapitels II die Kategorie Artikel angemessen erklärt werden.
In Kapitel II wird das Prinzipien- und Parameter-Framework zur Erklärung der Kategorie Artikel adaptiert. Nach den Gesichtspunkten dieser Theorie gilt der Artikel eigentlich als funktionale Kategorie und somit als parametrische Größe. Doch in dieser Arbeit wird aufgrund des Sprachvergleichs angenommen, dass eine funktionale Kategorie ebenfalls in Prinzipien und Parameter untergliedert werden kann. Durch dieses Vorgehen wird die Definition der Kategorie Artikel am Ende des Kapitels II deutlich konkretisiert, wobei universelle Merkmale von optionalen unterschieden werden können.
Ferner stellt das Prinzipien- und Parameter-Framework die Grundzüge der syntaktischen Theorie, die in Kapitel III Anwendung findet, dar. Die Theorie nimmt Strukturbeschreibungen an, die „… die phonetischen, semantischen und syntaktischen Eigenschaften eines sprachlichen Ausdrucks spezifizieren. …“3 Diese Strukturbeschreibungen stellen also dar, wie ein sprachlicher Ausdruck insgesamt zustande kommt, d.h. die unterschiedlichen Kategorien eines Lexikons werden durch die genannten Merkmale repräsentiert. Des Weiteren werden die sprachlichen Ausdrücke durch vier Repräsentationsebenen erfasst, i.e. die phonetische Form PF, die logische Form LF, die D-Struktur (von engl. deep-structure) sowie die S-Struktur (von engl. surface-structure). Die phonetische und logische Form betreffen die Lautproduktion und die Lautrezeption. Somit reflektieren die beiden Level die Erzeugung sprachlicher Ausdrücke. Die D-Struktur dagegen steht in direkter Relation zum Lexikon und repräsentiert die „… s-selektionalen Eigenschaften der lexikalischen Elemente …“.4 In der D-Struktur werden die jeweiligen Ausdrücke aus dem Lexikon projiziert. S-selektional bezieht sich dabei auf die Selektionsbedingungen der Oberflächenstruktur, i.e. die Regel zur Generierung wohlgeformter Ausdrücke. Die S-Struktur ist somit das intermediäre Level, das die drei genannten Repräsentationsebenen in Bezug zueinander stellt und auf welchen die Ableitungsprozesse zur Erzeugung sprachlicher Ausdrücke stattfindet. Die S-Struktur ist also die vermittelnde Ebene.
Für die vorliegende Untersuchung sind vorrangig die Repräsentationsebenen D- und S-Struktur relevant, da hier einerseits die strukturellen Bestimmungen reflektiert und andererseits die Anforderungen des Lexikons dargestellt werden. Zudem konzentriert sich die Analyse auf syntaktische Prozesse und Strukturen. Die phonetische und logische Form hingegen beziehen sich auf die Fähigkeit eines Sprechers, sprachliche Ausdrücke erfolgreich hervorzubringen, was im Rahmen dieser Analyse vernachlässigt werden kann. Die syntaktische Analyse findet also auf der D-Struktur statt, wobei nach Transformationsprozessen aus der D- die S-Struktur resultiert.
Die Theorie, nach der die syntaktische Analyse erfolgt, baut letztlich auf den Annahmen des Prinzipien- und Parameter-Frameworks auf und entwickelt dieses weiter. Die entsprechende, grundlegende Darstellung erfolgt im nächsten Kapitel.
I.4.2Erläuterungen der Grundlagen der syntaktischen Analyse
In diesem Abschnitt werden die Grundlagen der syntaktischen Analyse, die in Kapitel III angewandt wird, beschrieben. Maßgeblich stützt sich diese Arbeit auf die DP-Analyse, welche durch Operationen und Grundsätze des minimalistischen Programms erweitert wird. Zusätzlich müssen Hypothesen des Government-and-Binding berücksichtigt und erfüllt werden.
Die DP-Hypothese basiert auf Abneys (1987) Ansatz und modifiziert die ältere NP- oder Standard-Analyse ausgehend von der X-bar-Theorie. In der X-bar-Theorie werden syntaktische Funktionen von sprachlichen Einheiten in Bezug zu einem regierenden Kopf analysiert. Die Bestandteile einer sprachlichen Einheit bzw. Konstruktion werden Konstituenten genannt. Der Terminus Konstituente leitet sich von dem lateinischen Begriff constituens ‚die (miteinander) etwas Aufstellende‘ ab. Eine Konstituente ist also selbst eine sprachliche Einheit, die Teil eines übergeordneten Komplexes ist. Die Größe einer Konstituente kann von einem Morphem bis zu einem Syntagma reichen. Klenk (2003) fasst dies wie folgt zusammen: „… Unter einer Konstituente eines Ausdrucks A versteht man einen Ausdruck B, der Teil von A ist. B kann dabei wiederum aus mehreren Konstituenten bestehen. …“1 Synonym wird für komplexe Konstruktionen auch der Terminus Phrase verwendet. Der Begriff Phrase leitet sich von gr. φράσις ‚Ausdruck‘ ab. Es handelt sich hierbei um eine zusammenhängende Gruppe von Konstituenten, die eine syntaktische Einheit bilden. Aber auch ein einzelnes Element kann als Phrase bezeichnet werden, z.B. ein Nomen als Nominalphrase, kurz NP. Der Ausdruck komplexe Phrase beschreibt eine Phrase, die zusätzliche Modifikatoren enthält, bspw. eine NP mit Numerale und attributiven Adjektiven. Maximale Phrasen sind diejenigen, die durch keine weitere Phrase dominiert werden. Ein wichtiges Charakteristikum ist, dass jede Phrase einen Kopf besitzt. Der Kopf ist das zentrale Element, i.e. der Kern der Phrase. Der Kopf vererbt bzw. projiziert morphosyntaktische und flexionsmorphologische Merkmale.
Ferner wird der Begriff Konfiguration verwendet. Dieser Terminus stammt eigentlich aus der Semantik und bezeichnet „… eine[] geordnete[] Menge von semantischen Merkmalen. …“2 Doch im Folgenden wird mit dem Begriff eine Konstruktion oder Phrase benannt, die beispielhaft auf eine bestimmte Zusammensetzung von Elementen verweist, die nicht nur semantisch, sondern auch syntaktisch eine Einheit bilden. Diese Definition des Terminus ist auf die Herkunft des Begriffes Konfiguration von lat. configuratio ‚gleichförmige Bildungsweise‘ zurückzuführen. Der Begriff impliziert also, „… dass […] Satzglieder im Prinzip gleich aufgebaut sind und daher nach dem gleichen Modell analysiert werden können, z.B. bei stetiger Zweiteilung der Struktur durch eine binäre Verzweigung. …“3 Die binäre Verzweigung ist ein Grundprinzip der in dieser Arbeit angesetzten strukturellen Analyse.
Nach der X-bar-Theorie projiziert nun jeder Kopf X° eine komplexere syntaktische Einheit XP, die maximale Projektion oder Phrase genannt wird. Eine Phrase verfügt nach der X-bar-Theorie grundlegend über folgende Struktur:
Diese Basis-Baumstruktur verfügt über mehrere Projektionsebenen, in denen verschiedene Positionen oder Knoten einer Phrase in einem Abhängigkeitsverhältnis dargestellt werden, wobei jede Phrase ausgehend von der Kopfposition organisiert ist. Dieser Knoten X° regiert die maximale Projektion, XP, und projiziert seine Eigenschaften oder Features an dominierende Knoten. Die Komplementposition ist der Schwesterknoten des Kopfes und ist eine von diesem geforderte Ergänzung, i.e. obligatorische Konstituente. Ein Adjunkt ist demgegenüber eine nicht geforderte Ergänzung, d.h. eine optionale Modifikation des Kopfes. Während es pro Phrase nur eine Komplement-Position gibt, kann die Adjunkt-Position rekursiv angesetzt werden. Schließlich verfügt jeder Strukturbaum über eine Spezifiziererposition Spez,XP, in der weitere Argumente bzw. Modifikatoren des Kopfes generiert werden können.
Entsprechend der grammatischen und syntaktischen Funktionen werden die projizierenden, sprachlichen Einheiten in verschiedene Kategorien gegliedert. In der DP-Analyse werden grundlegend lexikalische und funktionale Kategorien angenommen. Lexikalische Einheiten implizieren deskriptiven Inhalt, d.h. sie generieren bedeutungstragende Morpheme. Funktionale Kategorien hingegen repräsentieren grammatische Eigenschaften und haben keinen beschreibenden Gehalt, sondern binden lexikalische Konstituenten bzw. selegieren diese. Morphologisch sind funktionale Elemente abhängig von lexikalischen und nicht von diesen zu trennen, wobei sie phonologisch nicht ausgedrückt sein müssen. Sie dienen der Strukturierung von Phrasen, d.h. sie transportieren abstrakte Inhalte, wie Direktionalität, Referenz, Definitheit etc., sie koordinieren Konstituenten und betten diese in einen sprachlichen sowie außersprachlichen Kontext ein.4





























