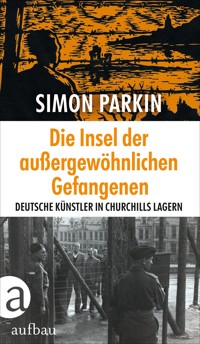
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zum ersten Mal erzählt: das Schicksal deutscher Künstler in Churchills Internierungslagern
Im Mai 1940 ließ Winston Churchill alle männlichen Deutschen und Österreicher zwischen 16 und 60 Jahren als »feindliche Ausländer« internieren. Die Flüchtlinge waren den Nazis gerade entkommen und wurden nun auf die Isle of Man zwischen Irland und England verbannt. Das Hutchinson Camp wurde daraufhin zu einem kreativen Zentrum, in dem einige der begabtesten Denker, Schriftsteller, Musiker und Künstler des 20. Jahrhunderts lebten – unter ihnen Dadaist Kurt Schwitters.
Der preisgekrönte Historiker Simon Parkin beleuchtet zum ersten Mal dieses ungewöhnliche Kapitel des Zweiten Weltkriegs.
»Geschichtsschreibung vom Feinsten.« BOOKLIST
»Akribisch recherchiert und unmöglich aus der Hand zu legen.« DAILY EXPRESS
WINGATE LITERARY PRIZE 2023
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 759
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
»Das Lager offenbarte nicht nur die Unbezwingbarkeit des menschlichen Geists, sondern auch den künstlerischen Ausdrucksdrang unter allen Umständen. Bis Ende 1941 hatten die Internierten aus Hutchinson Kunstwerke produziert, mit denen sich ganze Galerien hätten füllen lassen. Die Internierung wirkte als Gleichmacher. (…) Gemeinsam hatten diese Menschen ein Gefängnis zu einer Universität gemacht, ein Lager zu einem Kulturzentrum, eine Pension zu einer Kunstgalerie, ein Kabelwirrwarr zu einer Sendestation, ein Feld zu einem Fitnessclub, eine Wiese zu einer Freilichtbühne. Das Hutchinson Camp wurde zu einem Mikrokosmos der Zivilisation, und das Außergewöhnliche lag gerade nicht in der Großartigkeit jedes einzelnen Gefangenen, sondern darin, wie sie als Kollektiv die bessere Hälfte der Menschheit verkörperten, obwohl sie von der gemeineren Hälfte belagert waren.« (aus Simon Parkin, Die Insel der außergewöhnlichen Gefangenen)
Über Simon Parkin
Simon Parkin ist ein britischer Autor und Journalist. Er schreibt für den »New Yorker«, ist regelmäßiger Mitarbeiter der »Long Read«-Reihe des »Guardian«, Kritiker der Zeitung »The Observer« und Mitglied der »Royal Historical Society« (RHS). Sein Buch »Die Insel der außergewöhnlichen Gefangenen« hat den Wingate Literary Prize 2023 gewonnen. Parkin lebt in West Sussex, England.
Henning Dedekind, geboren 1968, übersetzt aus dem Englischen. Zu den von ihm übersetzten Autoren gehören Ronan Farrow, Masha Gessen, David Graeber, Evgeny Morozov und Bob Woodward.
Elsbeth Ranke, geboren 1972, Studium der Romanistik und Angewandten Sprachwissenschaft. Übersetzungen aus dem Französischen und Englischen, u. a. Erin Hunter, Frédéric Lenoir, E. O. Wilson, Dave Goulson, Lewis Wolpert, Hélène Beauvoir. André-Gide-Preis 2004.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Simon Parkin
Die Insel der außergewöhnlichen Gefangenen
Deutsche Künstler in Churchills Lagern
Aus dem Englischen von Henning Dedekind und Elsbeth Ranke
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Vorbemerkung des Autors
I.: Matinee hinter Stacheldraht — Die Insel 7. September 1940
Teil eins
II.: Fünf Schüsse — Paris Zwei Jahre früher
III.: Feuer und Kristall
IV.: Die Retter
V.: Zugfahrt bei Sonnenuntergang
VI.: Das Untergeschoss und der Richter
VII.: Spionagefieber
VIII.: Der Alptraum von Warth Mills
Teil zwei
IX.: Die neblige Insel — Die Insel 12. Juli 1940
X.: Universität hinter Stacheldraht
XI.: Die Mahnwache
XII.: Die Suizidberatung
XIII.: Schmelztiegel
XIV.: Erste Abschiede
XV.: Liebe und Paranoia
Teil drei
XVI.: Die Erbin — Berlin, 26. Juni 1940
XVII.: Kunst und Gerechtigkeit
XVIII.: Weihnachten zu Hause?
XIX.: Die Insel der Vergessenen
XX.: Ein Spion in der Mangel
XXI.: Rückkehr nach Warth Mills
XXII.: Der letzte Prozess
Schlussbetrachtung
Bildteil
Nachwort
Namensliste Hutchinson Camp
Literaturverzeichnis
Anmerkung zu den Quellen
Archivquellen
Unveröffentlichte Quellen
Publizierte Quellen
Dank
Abbildungsverzeichnis
Anmerkungen
Impressum
Für Klaus Hinrichsen, einen Kunsthistoriker, der Kunstgeschichte schrieb
In einem Teichlein so klein, dass ich darübersteigen konnte, sah ich gespiegelt den ganzen Himmel. Und ich sagte zu mir selbst: Wie kann ich dieses bisschen Wasser am besten messen? Nach der Erde, die es hält? Oder nach dem Himmel darin?
»Short Hills«, Kurt Schwitters, Hutchinson Camp, 19401
Vorbemerkung des Autors
Die Insel der außergewöhnlichen Gefangenen ist ein erzählendes historisches Sachbuch. Die in diesem Buch geschilderten Ereignisse sind weder erfunden noch geschönt, sondern stammen aus Tagebüchern, Briefen, Memoiren, mündlichen Überlieferungen, Zeitungsberichten und anderen Primärquellen, die sich aus den Erinnerungen der verschiedenen Akteure und Protagonisten speisen. Zitate und Dialoge, an die sich Zeugen viele Jahre nach dem betreffenden Ereignis erinnerten, sind eher als Eindrücke denn als wörtliche Wiedergabe zu verstehen. Bei Diskrepanzen zwischen einzelnen Quellen wurde diejenige Version verwendet, die dem geschilderten Ereignis zeitlich am nächsten lag. Eine vollständige Liste der Fundstellen und Quellen findet sich am Ende des Textes.
I.
Matinee hinter Stacheldraht
Die Insel 7. September 1940
Als sich der Tag allmählich seinem Ende neigte, sah Peter Fleischmann zu, wie der Musiker das Podium in der Mitte des Rasenplatzes bestieg und sich am Flügel niederließ. Bevor Peter aus Berlin geflohen war, hatte der 18‑jährige Waisenjunge Silberbesteck in einem Garten am Rande der Stadt vergraben. Seine Sammlung seltener Briefmarken hatte ihm ein Nazi-Kontrolleur im Zug abgenommen, mit dem er Deutschland fluchtartig verlassen musste. Sein einziger Schatz war eine silberne Libellenbrosche seiner Mutter, die er nie gekannt hatte. Peter war mittellos. Normalerweise hätte er sich keine Eintrittskarte für den Auftritt eines berühmten Pianisten leisten können, der bei Königen und Präsidenten beliebt war.
Klare, warme Luft, ein strahlend blauer Himmel: Der Tag war einer der schönsten des Jahrhunderts gewesen, ein flirrender Samstag, der an die trägen Sommer der Kindheit erinnerte.1 So schön, dass Deutschland an diesem Tag zum ersten Mal seine Flugzeuge zur Bombardierung Londons entsandte – ein Blitzkrieg, der die nächsten acht Monate andauern sollte. Doch hier auf der nebelverhangenen Isle of Man, Hunderte Meilen von Englands Hauptstadt entfernt, wäre das Publikum bei jedem Wetter gekommen. Hier, mitten in der Irischen See, gab es kaum etwas anderes zu tun.
Hinter dem Pianisten sah Peter eine Kulisse aus adretten edwardianischen Gästehäusern. Die Gebäude wirkten unscheinbar: Hotels für Urlauber aus der Mittelschicht, die das Flair des Überseetourismus ohne die damit verbundenen Mühen und Kosten genießen wollten. Bei näherer Betrachtung entdeckte man ungewöhnliche Details. Jedes Fenster war mit einer dunklen Folie bedeckt.2 Das Polymermaterial, das als Notlösung verwendet wurde, nachdem ein deutsches U‑Boot das Schiff versenkt hatte, welches Verdunklungsmaterial zur Insel transportierte,3 löste sich ab, wenn man es mit einer Rasierklinge zerschnitt. Im Lager waren Scherenschnitte in Mode gekommen: Zootiere, Einhörner und Figuren aus der griechischen Mythologie schmückten die Fenster im Erdgeschoss. Nachts, von der Straße aus betrachtet, leuchteten die Bilder im Licht der luftschutzsicheren, bordellroten Glühbirnen im Inneren – eine neuartige Kulisse für den berühmten Pianisten.
Vor dem Klavier, in einem Halbkreis aus hölzernen Stühlen, saßen eine Reihe britischer Armeeoffiziere, lachend und rauchend neben ihren Frauen. Dahinter, unter den umherschwirrenden Mücken, saßen Hunderte von Männern, meist Flüchtlinge, in ungeordneten Reihen auf der Wiese. Aus den offenen Fenstern der umliegenden Häuser, deren Schlafzimmer in der Dämmerung lagen, lehnten andere Männer, deren glimmende Zigarettenenden wie Glühwürmchen im schwindenden Licht wirkten.4 Wenn Peter sich umdrehte, konnte er den Hafen von Douglas hinter sich sehen, wo Boote tuckerten und pufften und auf dem glitzernden Meer ihre Kielwellen zogen. Irgendwo oberhalb der Gesprächsfrequenz war das ferne Wellenrauschen auf dem Kies zu hören, wie ein Besen, der Glasscherben aus einem zerbrochenen Schaufenster zusammenfegt.
Eine Absperrung aus Stacheldraht trennte die Männer vom Hafen und markierte die Grenze dessen, was offiziell »P‑Camp« oder von den Männern schlicht »Hutchinson« genannt wurde. Außerhalb des Stacheldrahtzauns hatte sich eine Gruppe Einheimischer versammelt.5 Sie spähten hinein, in der Hoffnung, einen Blick zu erhaschen und zu verstehen, was dort vor sich ging – der einzige offensichtliche Hinweis darauf, dass es sich heute Abend um ein Publikum aus Kriegsgefangenen handelte.
Acht Wochen zuvor, am Samstag, dem 13. Juli 1940,6 hatte Captain Hubert Daniel, ein freundlicher, trinkfreudiger 48‑jähriger Armeeoffizier,7 das Lager für eröffnet erklärt. Hutchinson war das siebte von zehn Internierungslagern auf der Isle of Man, einer Insel, die so weit von den benachbarten Küsten entfernt lag, dass sie sich ideal dafür eignete.8 Inselbewohner, die ein Boot besaßen, waren angewiesen worden, nachts die Ruder zu verstauen und die Zündkerzen aus den Motoren ihrer Wasserfahrzeuge zu entfernen.9 Selbst wenn ein Flüchtling ein geeignetes Boot besteigen konnte, blieb die Reise zum Festland gefährlich. Wenn man erst einmal hier war, saß man also fest.
In Hutchinson befanden sich derzeit etwa 1200 Gefangene, überwiegend Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland, die zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung friedlich in Großbritannien gelebt hatten. Seit mehreren Monaten kursierten Gerüchte, dass eine Fünfte Kolonne – eine britische Wortneuschöpfung, die heute allgemein als Bezeichnung für im Asylland lebende Verräter verstanden wird – an der Besetzung der Niederlande durch die Nazis beteiligt gewesen sei. Die Zeitungen hatten die nationale Paranoia mit der Behauptung geschürt, dass in Großbritannien ein ähnliches Netz von Spionen lauerte.
Schon vor Ausbruch des Krieges wurde Scotland Yard, das mit dem britischen Inlandsgeheimdienst MI5 zusammenarbeitete, mit Hinweisen auf verdächtige Flüchtlinge und Ausländer überhäuft. Die Polizei nahm einen Mann fest, in dessen Tagebuch man den Eintrag fand: »Tausche britische Königin gegen italienische Königin.« Die Ermittler vermuteten, er hätte ein faschistisches Komplott gegen die Krone aufgedeckt. In Wirklichkeit war der Mann ein Imker, der nur den Sturz der kleinen Monarchin plante, die über seinen Bienenstock herrschte.10
Auf einen der Lagerinsassen von Hutchinson, den jungen Kunsthistoriker Dr. Klaus Hinrichsen,11 und seine Verlobte Greta wurde die Polizei erstmals aufmerksam, als ein Nachbar meldete, er habe das Paar beim Liebesspiel gehört. Der misstrauische Nachbar vermutete, das rhythmische Klopfen auf dem Bett könnte eine verschlüsselte Botschaft beinhalten. Es sei schwierig zu beweisen, meinte Klaus, dass man das Morsealphabet nicht beherrsche.12
Angesichts der kürzlich erfolgten deutschen Besetzung Frankreichs schien ein Invasionsversuch nicht nur plausibel, sondern unmittelbar bevorzustehen. Wenige Tage nach seinem Amtsantritt als Premierminister genehmigte Winston Churchill die Verhaftung von Tausenden sogenannter feindlicher Ausländer. In den chaotischen Razzien, die darauf folgten, wurden Tausende aus Nazi-Deutschland geflohener Juden – darunter auch einige Jugendliche wie Peter, die mit den berühmten Kindertransportzügen gekommen waren –, von eben jenen Menschen verhaftet, denen sie vertraut hatten. Ein Albtraum. Die Flüchtlinge, die an jenem Abend den Großteil des Publikums ausmachten, hatten ein kollektives Trauma erlebt: Von seinen Befreiern inhaftiert zu werden, bedeutet eine verstörende, ungerechte Umkehrung der zeitlichen Abfolge.
Status und Klasse, die ansonsten stets zuverlässigen Waffen des Privilegs, hatten keinen Schutz geboten. Oxbridge-Dons, Chirurgen, Zahnärzte, Anwälte und eine Reihe berühmter Künstler wurden festgenommen. Die Polizei verhaftete Emil Goldmann,13 einen 67‑jährigen Professor der Universität Wien, auf dem Gelände des Eton College, Großbritanniens führender Eliteschule.14 An der Universität Cambridge wurden Dutzende von Mitarbeitern und Studenten in der Guild Hall festgenommen, darunter Friedrich von Hohenzollern, auch bekannt als Prinz Friedrich von Preußen, ein Enkel von Königin Victoria.15 Fast wären in jenem Jahr die juristischen Abschlussprüfungen abgesagt worden, weil einer der internierten Professoren die Prüfungsunterlagen in seinem Schreibtisch eingeschlossen und keine Zeit mehr gehabt hatte, jemandem den Schlüssel zu geben.
Die Polizei holte Peter in den frühen Morgenstunden und ohne Vorwarnung ab, eine Art der Verhaftung, die ihn an die nächtlichen Razzien der Gestapo und an die unsichere Welt der Angst und des Misstrauens erinnerte, der er gerade entkommen war.16
In den Wochen nach seiner Eröffnung strotzte Hutchinson vor kreativer Energie, und seine Bewohner organisierten – ähnlich wie an jenem Abend – Veranstaltungen, die von den besonderen Begabungen der ungewöhnlichen Häftlinge zeugten. Dennoch konnte sich niemand der demoralisierenden Tatsache entziehen, dass die Begriffe »Internierter« und »Internierungslager« – ja sogar »Konzentrationslager«, wie Hutchinson und die anderen Insellager zu jener Zeit manchmal genannt wurden17 – beschönigend waren: Peter und alle anderen Männer hier waren in jeder Hinsicht Gefangene, verhaftet ohne Anklage oder Prozess, ohne Urteil in einem Gefangenenlager eingesperrt, das sie nicht verlassen durften. Ungeachtet ihres Alters oder ihres Standes hatte die geopolitische Entwicklung schonungslos in das Leben eines jeden Einzelnen eingegriffen.
Dennoch war Peter begeistert, Teil dieser Menge zu sein. Da die Männer nicht wegen ihrer Identität oder ihrer Taten, sondern aufgrund ihrer Herkunft inhaftiert worden waren, bot Hutchinson einen schillernden Querschnitt der Gesellschaft. Dass sich so viele herausragende Persönlichkeiten in diesem Lager befanden, war dabei allein dem Zufall geschuldet. Zusammen bildeten sie eine der ungewöhnlichsten und außergewöhnlichsten Gefängnispopulationen der Geschichte. Es gab zwar keine Smokings oder Ballkleider, keine Champagnerflöten oder Kronleuchter für die heutige Veranstaltung, aber Peter saß inmitten einer Schar angesehener Koryphäen aus Kunst, Mode, Medien und Wissenschaft – ein außergewöhnliches Publikum, selbst dann, wenn man die Umstände außer Acht ließ.
Von klein auf hatte Peter den Wunsch gehabt, ein großer Künstler zu werden. Die internationalen und nationalen Ereignisse hatten sich zunächst gegen seine Ambitionen verschworen, und sein Traum vom Künstlerdasein zerplatzte im Exil. Dann trugen ihn die Strömungen der Geschichte in die Umlaufbahn seiner Helden: Er teilte das Lager mit einer Reihe bedeutender Künstler, darunter Kurt Schwitters, der 53‑jährige Pionier des Dadaismus, vor dessen »entarteten« Werken der gescheiterte Maler Adolf Hitler sarkastisch posiert hatte. Die Künstler wiederum nahmen den schmächtigen, bebrillten Außenseiter in ihre Obhut.
Marjan Rawicz, der Interpret des heutigen Abends, litt seit seiner Ankunft in Hutchinson unter Depressionen.18 Die Internierung hatte seinen vollen Terminkalender für den Sommer über den Haufen geworfen. Am 3. Mai 1940 spielten er und sein musikalischer Partner Walter Landauer19 ein Benefizkonzert im Londoner Palladium zugunsten von Varietékünstlern. Ironischerweise wurde der Auftritt des Duos, das bald wegen des Verdachts auf Nazi-Spionage verhaftet werden sollte, von einem Radiosender für die britischen Streitkräfte übertragen. Drei Wochen später, am 23. Mai, bestritten die beiden nachmittags um halb vier eine Live-Vorführung eines Welmar-Flügels im zweiten Stock des britischen Luxuskaufhauses Harrods.20 Einige Wochen später verhaftete die Polizei die Musiker in Blackpool, wo sie gerade eine ausverkaufte Konzertreihe begonnen hatten.
Seine Welt brach zwar zusammen, doch die Gewohnheit blieb. Rawicz war ein Musiker, und Musiker müssen auftreten. Seine einzige Bedingung war, dass der heutige Abend ein Solokonzert wäre, dass er das Programm frei gestalten und einen Flügel spielen könnte – und zwar einen Steinway. Hauptmann Daniel hatte den Musiker darauf hingewiesen, dass im Inventar der Häuser bereits elf Klaviere aufgeführt seien, die sich im Lager befänden.
»Können Sie nicht einen von denen nehmen?«, fragte der Kommandant und fügte hinzu, dass es sich als schwierig erweisen könne, eine offizielle Genehmigung für einen gemieteten Flügel zu erhalten, wenn man, nun ja, die Gesamtumstände bedenke.21
Widerstrebend willigte Rawicz ein. Eine kleine Menschenmenge folgte dem Musiker, als er durch die Häuser zog und jedes Instrument auf seine Tauglichkeit überprüfte. Rawicz, der sein Publikum niemals vernachlässigte, amüsierte es mit sarkastischen Witzen und Kritik.
»Selbst ein Tauber würde bei diesem Instrument Schmerzen empfinden«, scherzte Rawicz, als er ein vernachlässigtes Exemplar ausprobierte. Als sich ein Zuhörer verwundert über die Kürze seiner Finger äußerte, schoss Rawicz zurück: »Mein Freund, ich bin Pianist und kein Gynäkologe.«22
Ein Klavier brach unter der Wucht von Rawicz’ Spiel zusammen.23 Schaulustige bauten das Instrument kurzerhand auseinander und entfernten die Tasten, Bretter und das Drahtgewirr. Ein Holzschnitzer, Ernst Müller-Blensdorf, übernahm die Mahagoni-Seitenteile. Der Tierfänger Johann »Brick« Neunzer24, Löwenbändiger im Burnt Stubb Zoo – dem späteren Chessington Zoo –, holte sich die Elfenbeintasten, um daraus Zahnprothesen zu schnitzen, während die Techniker unter den Internierten den Draht einsammelten, um elektrische Heizungen zu bauen.
Rawicz hatte seinen Standpunkt klar gemacht. Hauptmann Daniel lenkte ein. Die Instandhaltungsabteilung des Lagers rollte einen gemieteten Steinway auf ein stabiles Podium, das eigens für diesen Anlass gebaut worden war. Ein Termin wurde festgelegt, und der Kommandant, der die Überlegenheit seines Lagers demonstrieren wollte, verschickte Einladungen an die anderen Offiziere auf der Insel.25
Als der Applaus des Publikums zu einem gelegentlichen Räuspern und Rascheln verstummte und Rawicz zu spielen begann, gab es keine Partitur, die der Wind hätte davonwehen können. Der Pianist hatte ein breit gefächertes Programm vorbereitet und spielte – von Walzern bis Rhapsodien, vom Radetzky-Marsch bis Bach, von Showmelodien wie »Smoke Gets in Your Eyes« bis zur Eigenkomposition »Spinning Wheel«26 – alles aus dem Gedächtnis. Die Zuhörer bedachten jedes Stück mit stürmischem Applaus, fühlten sie sich doch zurückversetzt in die Berliner, Wiener und Prager Konzertsäle der Vorkriegszeit. Es war eine Ablenkung von der eigenen prekären Situation, dem Risiko der Deportation oder einer drohenden Invasion der Nazis. Der Auftritt jenes Abends war, so brachte es ein Zuhörer auf den Punkt, »unvergesslich«.27
Für das Finale hatte Rawicz zwei Stücke ausgewählt, die einen Schleier ironischer Dissonanz über die Szene legen sollten. Er überging die Klassiker kontinentaleuropäischer Komponisten und entschied sich stattdessen für das Volkslied »Greensleeves« aus dem 16. Jahrhundert – eine durch und durch englische Melodie – dem er eine besondere Version der britischen Nationalhymne folgen ließ. Peter und die anderen Insassen erhoben sich und sangen.
May he defend our laws, And ever give us cause,
To sing with heart and voice, God save the King.
Möge er unsere Gesetze verteidigen und uns stets Anlass geben
Mit Herz und Stimme zu singen: Gott schütze den König.
Der Platz hallte von dem in unterschiedlich starken Akzenten vorgetragenen Chorgesang wider, eine Hochachtungsbekundung für das Land, das den Männern Zuflucht gewährt hatte, um sich dann später gegen sie zu wenden. Rawicz’ bewusst getroffene Wahl unterstrich die qualvolle Absurdität der Situation. Hunderte, die vor der Unterdrückung durch die Nazis geflohen waren, gelobten einem Land und einem König die Treue, unter dessen Regentschaft man sie unter dem bloßen Verdacht der Spionage ohne Anklage oder Gerichtsverfahren verhaftet hatte. Ergriffen von der Stimmung des Abends ließen dennoch nur wenige ihre Blicke wandern, um zu sehen, ob es jemand vorgezogen hatte, zu schweigen.
Teil eins
Quocunque Jeceris Stabit – »Wohin du ihn auch wirfst, er wird stehen.«
Das Motto der Isle of Man
II.
Fünf Schüsse
Paris Zwei Jahre früher
Kurz nachdem die Sonne aufgegangen war, die Schatten kürzer wurden und das Treiben des Tages begann, öffnete Madame Carpe die eisernen Fensterläden ihres Ladens im fünften Arrondissement von Paris. »Ich möchte eine Waffe kaufen«, hörte sie eine Stimme hinter sich rufen. Die Frau wandte sich um und erblickte einen schlaksigen Jungen mit traurigen Augen, der einen Anzug mit breitem Revers, eine Krawatte und einen weiten Mantel trug. Sie rief nach ihrem Mann, Leopold, der in der Tür erschien. Es war 8.35 Uhr am Morgen des 7. November 1938. À la fine lame (Zur feinen Klinge) war zwar noch nicht geöffnet, doch der Ladenbesitzer, der sich auf den Beginn des Tagesgeschäfts freute, winkte seinen ersten Kunden gern herein. »Wozu brauchst du eine Waffe?«, fragte er den Jungen, der die schwer beladenen Regale an den Wänden betrachtete. Der Junge öffnete sein Portemonnaie, in dem ein Bündel Geldscheine steckte, und erklärte, dass er etwas zum Schutz benötige, da sein Vater ihn oft damit beauftrage, große Geldsummen zu überbringen. Die Erklärung war sowohl ausreichend als auch überflüssig. Nach französischem Recht konnte ein Waffenhändler den Verkauf an einen Kunden nur dann verweigern, wenn er die Person für unzurechnungsfähig hielt. Der Junge war mürrisch und erschöpft. Er hatte in der vorangegangenen Nacht kaum geschlafen, da er dreimal von Nachtschwärmern wachgerüttelt worden war und sein Herz so schnell schlug, dass er eine Hand auf seine Brust legen musste, um sich zu beruhigen. Doch wenn sein Kunde Anzeichen von Erschöpfung zeigte, sah sich Carpe nicht veranlasst, weitere Fragen zu stellen. Der Junge wirkte angespannt, aber nicht beunruhigt.
Der Ladenbesitzer legte eine Auswahl an Waffen auf den Tresen. Sein Kunde blickte ausdruckslos von einer zur anderen. Monsieur Carpe erkannte das Zögern des Neulings, widerstand aber vorerst dem Drang, ihn zu belehren. Schließlich fragte der Junge, ob Carpe eine Pistole des Kalibers 45 vorrätig habe, das er aus amerikanischen Filmen kenne.1
Dies sei leider eine schlechte Wahl für die genannte Aufgabe, erklärte der Ladenbesitzer: zu schwer, zu sperrig. Besser wäre ein 6,35‑Millimeter-Revolver, eine Waffe, die klein genug sei, um sie verdeckt zu tragen, leicht genug, um sie schnell zu ziehen, und dennoch bedrohlich genug, um einen Dieb abzuschrecken.
Carpe demonstrierte, wie man die Waffe lud, abfeuerte und entlud. Der Junge beobachtete die geschmeidigen, gut geübten Bewegungen des Verkäufers. Schließlich legte Carpe eine Schachtel mit 25 Patronen auf den Ladentisch und erklärte, dass er vor dem Verkauf der Waffe einen Ausweis sehen müsse. Der junge Mann schob seinen Reisepass über den Tresen. Carpe las einen ausländischen Namen auf dem Dokument: Herschel Grynszpan.
Am Abend zuvor hatte Herschel das Geschäft À la fine lame entdeckt. Der 17‑Jährige war ziellos umhergestreift, erregt von einem vorangegangenen heftigen Streit. Er war aus dem Haus gestürmt, in dem er mit seinem Onkel und seiner Tante lebte. Angeblich war es bei dem Streit um Geld gegangen, aber er hatte sich durch unausgesprochene und unbenannte Vorbehalte und Frustrationen sowie durch Umstände, auf die keiner der Beteiligten Einfluss hatte, noch verschärft.
Herschel war ein Einwanderer ohne Papiere. Zwei Jahre zuvor hatte er seine engste Familie in seiner Heimatstadt Hannover zurückgelassen, war nach Frankreich gekommen und bei seinen Verwandten eingezogen. Herschels Vater hatte erfolgreich 3000 Francs aus Deutschland geschmuggelt, um den Unterhalt seines Sohnes zu finanzieren. Nun wollte der Junge dieses Geld an seine Familie zurückgeben, die er in Lebensgefahr wähnte.
Seine Eltern besaßen eine kleine Schneiderei in Hannover. Seit Adolf Hitler fünf Jahre zuvor an die Macht gekommen war, hatten sie enorme wirtschaftliche Schwierigkeiten erdulden müssen. Die Hoffnung, dass sich der Antisemitismus auf eine Minderheit von verrückten, eingefleischten Parteianhängern beschränkte, wurde zunichte gemacht, als ein örtlicher Polizeibeamter ihnen Auslieferungspapiere überreichte: Zusammen mit etwa 12 000 anderen polnischen Juden, die in Deutschland lebten, sollten sie aus dem Land zwangsausgewiesen werden, das sie ihre Heimat nannten. Auf der trostlosen Fahrt zum Bahnhof, wo sie einen Zug zur polnischen Grenze besteigen sollten, waren die Straßen gesäumt von Menschen, die riefen: »Juden raus!«2
Die Deportation war chaotisch und grausam. Nachdem sie in Zbąszyń an der polnischen Grenze ausgestiegen war, wurde Herschels Familie über die deutsche Grenze gejagt und danach von den polnischen Grenzposten zurückgewiesen. Die Männer und Frauen schleppten sich zurück auf deutsches Gebiet, um auch dort wieder abgewiesen zu werden. Erst als die Nazis Hunde auf die Gruppe hetzten, lenkten die polnischen Grenzer ein und ließen die erschöpften Menschen ins Niemandsland, wo sie in Scheunen und Schweineställen übernachteten. Zu Beginn der Woche hatte Herschel eine Postkarte von seiner älteren Schwester Esther erhalten, die ihm die Situation schilderte und mit einer Erklärung über die Mittellosigkeit der Familie endete: »Wir haben keinen Pfennig.«
Onkel Abraham – wie sein Bruder ein Schneider – wusste, dass sich die Ereignisse bald überschlagen würden. Es wäre unverantwortlich, Geld in ein Chaos zu schicken, erläuterte Abraham seinem Neffen. Klüger wäre es, die weitere Entwicklung abzuwarten. Herschel, der zu Wutausbrüchen neigte, die oft in Selbstmorddrohungen gipfelten, nahm das Zögern seines Onkels als Beweis dafür, dass sich außer ihm niemand für die Lage seiner Eltern interessierte. Die Anschuldigung verletzte Abraham.
»Ich habe schon so ziemlich alles für dich getan, was ich konnte«, sagte er zu seinem Neffen. »Wenn du nicht zufrieden bist, kannst du ja gehen.«3
Herschel riss seinen Mantel aus dem Griff seiner Tante, die ihn schluchzend von der Tür zurückhalten wollte.
«Ich gehe«, sagte Herschel. »Auf Wiedersehen.«
Abraham drückte dem Jungen noch 200 Francs in die Hand, bevor er ging. Herschel verbrachte den Rest des Tages schmollend und widerstand allen Bemühungen seines Freundes Naftali Kaufmann – besser bekannt als Nathan –, ihn aufzumuntern. Nathan hatte den Streit mitbekommen und begleitete seinen Freund von der Haustür an. Er versicherte Herschels Tante und Onkel, dass er ihren Neffen unversehrt zurückbringen werde.
Nachdem sie den Rest des Nachmittags mit Freunden verbummelt hatten, besprachen die beiden jungen Männer am frühen Abend im Licht, das durch die Fenster des Rathauses nach draußen fiel, die Ereignisse des Tages. Nathan drängte seinen Freund sanft, in die Wohnung zurückzukehren. Herschels Wut flammte wieder auf.
»Lieber sterbe ich wie ein Hund, als meine Entscheidung rückgängig zu machen«, sagte er. Herschel erläuterte seinen Plan für die Nacht: Er wollte in seinem Lieblingscafé zu Abend essen4 und dann in einem billigen Hotel unterkommen. Die beiden trennten sich.
Herschel ging die Rue du Faubourg Saint-Denis hinab und erblickte dort das Schaufenster des Waffengeschäfts.
Waffe und Patronen kosteten zusammen 245 Francs. Herschel zahlte mit den 200 Francs seines Onkels und beglich die Differenz mit Kleingeld aus seiner eigenen Tasche. Ohne das Preisschild zu entfernen, das an einem Stück roter Schnur vom Abzugsbügel hing, wickelte der Ladenbesitzer die Waffe und die Munition in braunes Papier und verschnürte das Paket.
Herschel war gesetzlich verpflichtet, seinen Kauf bei den Behörden zu registrieren. Als er den Laden verließ, schlug er daher den Weg zur nächstgelegenen Polizeistation ein. Der Junge ging weiter, bis er sicher war, dass er außer Sichtweite war. Dann bog er von der Hauptstraße ab und ging zurück zum Café Tout va bien, wo er am Abend zuvor seinem Freund gesagt hatte, dass er dort essen wolle.
Um 8:55 Uhr stand Herschel vor dem Spiegel in der Toilette des Cafés. Er schnürte das Paket auf und holte die Waffe aus ihrem Futteral. In seiner Hand spürte er das kalte Gewicht der Entscheidungen, die er am Morgen getroffen hatte, und derer, die noch folgen würden. Er lud fünf Patronen in die Kammer und steckte die Waffe in die linke Innentasche seiner Anzugsjacke. Zehn Minuten später stieg er die Stufen zur Metrostation Strasbourg-Saint-Denis hinab und nahm einen Zug der Linie 8 in Richtung La Madeleine.
Sollten Herschel während der Fahrt doch noch Zweifel oder Bedenken bezüglich seines Plans gekommen sein – eines Plans, der auf den verschlungenen Pfaden der Geschichte das Leben von Millionen von Menschen verändern sollte –, so stand sein Entschluss fest, als er zurück ins Pariser Sonnenlicht trat. Kurz nach halb zehn erreichte Herschel sein Ziel in der Nähe des Seine-Ufers: die deutsche Botschaft in der Rue de Lille 78.
Unsicher und unvorbereitet wandte sich Herschel an einen der diensthabenden Polizeibeamten vor dem Gebäude und fragte, welchen Eingang er nehmen solle.
»Was ist der Zweck Ihres Besuchs?«, wollte der Gendarm François Autret wissen.5
Konzentriert darauf, dass seine Stimme seine Nervosität nicht verriet, teilte Herschel dem Beamten mit, dass er ein deutsches Visum benötige.6 »Dazu müssen Sie aufs Konsulat, nicht zur Botschaft«, erklärte Autret. Der Polizist winkte Herschel in Richtung des öffentlichen Eingangs zur Botschaft, bevor er dem Teenager und der ersten lästigen Anfrage des Tages den Rücken zukehrte.
Zwei Stunden zuvor hatte Herschel in seinem gemieteten Zimmer im Hotel de Suez eine Postkarte geschrieben, um seiner Schwester zu antworten, nachdem er eine Nacht lang mit alptraumhaften Visionen von der Misshandlung seiner Eltern gerungen hatte.
»Gott muss mir verzeihen«, lautete seine Nachricht, die in einer Mischung aus Hebräisch und Deutsch verfasst war. »Mein Herz blutet, wenn ich an unsere Tragödie und die der 12 000 Juden denke. Ich muss auf eine Weise protestieren, die von der ganzen Welt gehört wird, und das habe ich vor. Ich bitte Dich um Verzeihung.«
Herschel hatte die Nachricht auf dem Weg zum Waffenladen aufgeben wollen, hatte dies jedoch versäumt, da er zu sehr mit seiner Mission beschäftigt gewesen war. Was als private Bitte um Verzeihung gedacht gewesen war, wurde nun zu einem Geständnis, das er bei sich trug. Herschel war in die Botschaft gekommen, um einen leitenden Mitarbeiter zu erschießen. Damit wollte er gegen die Behandlung seiner Eltern und des gesamten jüdischen Volkes durch die Nazis protestieren. Als Herschel die Tür öffnete, trat ein vornehmer 60‑jähriger Mann heraus. Ohne dass Herschel es wusste, handelte es sich um Graf Johannes von Welczeck, den deutschen Botschafter in Frankreich, der gerade seinen täglichen Spaziergang durch das Viertel antrat. Kein Ziel war besser geeignet als Welczeck, der damals ranghöchste deutsche Diplomat in Paris, um die Aufmerksamkeit der Weltpresse auf sich zu ziehen. Der Mann und der Attentäter gingen schweigend aneinander vorbei. Dabei überschritten beide eine unsichtbare Schwelle zwischen Ländern und Schicksalen.
Im Inneren des Gebäudes begegnete Herschel Madame Mathis, der Frau des Franzosen, der als Concierge in der Botschaft arbeitete. Ihr Mann hatte gerade den Ofen im Keller repariert und kurz die Rezeption verlassen, um sich umzuziehen.
»Ich muss einen Herrn von der Botschaft sprechen«, sagte Herschel auf Französisch.7 »Ich möchte ihm einige wichtige Papiere vorlegen.«
Die Lüge war gut gewählt. Die deutsche Botschaft war, wie ein Journalist damals schrieb, eine Brutstätte für Spionage-Intrigen: »Man musste sich nur als Geheimagent ausgeben, um problemlos empfangen zu werden.«8 Herschels Behauptung, er sei im Besitz geheimer Dokumente von nationaler Bedeutung, war also der sicherste Weg, um eine Audienz bei einem hochrangigen Botschaftsmitarbeiter zu erhalten. Derartige Angelegenheiten lagen deutlich über Madame Mathis’ Gehaltsklasse. Sie wies Herschel den Weg zum Treppenhaus, wo der Junge, so sagte sie, im ersten Stock den diensthabenden Rezeptionisten antreffen werde.
Durch seine Fortschritte ermutigt, sagte Herschel dem Rezeptionisten Wilhelm Nagorka, dass er im Besitz eines »vertraulichen und sehr wichtigen Dokuments« sei.9 Nagorka bot an, das Dokument weiterzuleiten. Nein, sagte Herschel, die Sache sei zu wichtig, er müsse das Dokument »jemandem mit Geheimwissen« persönlich übergeben. Nagorka lenkte ein. Es war noch früh, und in der Botschaft war wenig los. Außerdem wollte Nagorka nicht derjenige sein, der den Teenager behinderte, wenn dieser tatsächlich wichtige Informationen zu übermitteln hätte. Er bot Herschel an, im Wartesaal Platz zu nehmen.
Wenige Minuten später kehrte Nagorka zurück und begleitete den Jungen in das Büro eines 29‑jährigen Diplomaten, der unter seinen Kollegen dafür bekannt war, dass er sich nicht scheute, derlei Besucher zu empfangen.
Um 9:45 Uhr betrat Herschel das Büro des Diplomaten Ernst Eduard Adolf Max vom Rath. Rath saß hinter seinem Schreibtisch und blickte aus dem Fenster, mit dem Rücken zur Tür. Er drehte seinen Stuhl um eine Vierteldrehung nach links, um Herschel gegenüberzusitzen.
»Nun«, sagte Rath, schmallippig, aber statuenhaft gutaussehend. »Lassen Sie mich das Dokument sehen.«
Herschel zog den Revolver aus der linken Innentasche seiner Anzugjacke und richtete den Lauf auf Rath. Das Preisschild baumelte an seiner roten Schnur.
»Sie sind ein sale boche (ein dreckiger Deutscher)«, sagte er. »Im Namen 12 000 verfolgter Juden, hier ist Ihr Dokument.«10
Herschel gab fünf Schüsse ab. Obwohl sich die beiden Männer sehr nahe waren, verfehlten drei davon ihr Ziel. Einer blieb in der Garderobe stecken. Ein anderer schlug in die Wand ein. Beide hinterließen Löcher, die etwa einen Meter über dem Boden lagen.
Zwei Schüsse aber trafen ihr Ziel und drangen von der linken Seite in Raths Körper ein. Einer durchschlug die Brusthöhle und blieb in der rechten Schulter stecken. Der andere zerriss Raths Milz, durchlöcherte seinen Magen und verletzte die Bauchspeicheldrüse, was die Ärzte und Chirurgen, die sich bald um das Opfer kümmern würden, am meisten besorgte.
»Dreckiges Judenvolk«, schrie Rath, dem es trotz seiner Verletzungen gelang, seinem Angreifer einen Kinnhaken zu verpassen. Daraufhin taumelte der Diplomat nach vorn und riss seine hölzerne Bürotür auf. »Hilfe!«, rief er hinaus in den Flur.
Nagorka sprang von seinem Schreibtisch auf und rannte in Richtung des Tumults, der sich etwa 30 Meter von ihm entfernt abspielte.
»Ich bin verwundet«, sagte Rath unnötigerweise.
Herschel ließ sich in dem Büro auf einem Stuhl nieder. Die Waffe, die der Teenager zornig nach Rath geworfen hatte, nachdem ihm dieser ins Gesicht geschlagen hatte, lag auf dem Fußboden.11 Später behauptete Herschel, er habe seine Taten an jenem Morgen in einer Art Trancezustand begangen. Die nicht aufgegebene, an seine Schwester adressierte Postkarte in seiner Brieftasche ließ jedoch anderes vermuten.
In den frühen Morgenstunden des 8. November trafen Hitlers Leibarzt, Dr. Karl Brandt,12 und der Direktor der Chirurgischen Klinik der Universität München, Dr. Georg Magnus, mit dem Zug in Paris ein. Die Reise der beiden Männer hatte sowohl praktische als auch symbolische Gründe. In erster Linie sollten sie Rath, der sich inzwischen von einer Operation und einer Bluttransfusion erholt hatte, fachmännisch versorgen. Außerdem sollten sie die deutsche Regierung zuverlässig über Raths Zustand auf dem Laufenden halten. Ihre rasche Entsendung sollte der Weltöffentlichkeit zudem zeigen, welche Fürsorge das NS‑Regime seinen Beamten zukommen ließ, und die Bedeutung des Vorfalls unterstreichen, ja, überhöhen.
Gegen 10:30 Uhr untersuchten Brandt und Magnus den jungen Diplomaten. Beim Verlassen des Krankenhauses bezeichneten sie die chirurgische Behandlung, welcher man Rath unterzogen hatte, als »ausgezeichnet«, hielten den Zustand des Patienten aber dennoch für »äußerst ernst«.
In Deutschland blieb Adolf Hitler ungewohnt schweigsam. Er hielt keine Rede und gab keine Erklärung zu den Schüssen in Paris ab. Das Propagandaministerium riet der nationalsozialistischen Presse zwar, das Attentat »in größter Form herauszustellen«, doch war die offizielle Position lediglich eine Richtlinie, nicht verbindlich: Die Tat, so hieß es vom Ministerium, müsse »die schwersten Folgen für die Juden in Deutschland haben«.13
Am nächsten Tag verschlechterte sich Raths Zustand. Kurz nach drei Uhr am Nachmittag des 9. November 1938 fiel er ins Koma. Neunzig Minuten später war der Diplomat tot.
An jenem Abend saß Hitler in einem rauchgeschwängerten Saal in München, umgeben von einer illustren Schar seiner treuesten und ältesten Anhänger, der Sturmabteilung, auch bekannt als Braunhemden. Die Männer drängten sich und jubelten bei der Feier dessen, was als bedeutendstes Datum in der Geschichte der Partei galt: der Jahrestag des sogenannten Bürgerbräu-Putschs von 1923.
Auf den Tag 15 Jahre zuvor hatten Hitler und etwa 600 seiner paramilitärischen Kämpfer versucht, die Regierung zu stürzen. Der Putsch scheiterte. Hitlers Trupp aus Schlägern und verbitterten Veteranen wurde von etwa 100 bewaffneten Polizeibeamten leicht zurückgeschlagen, wenngleich es ein paar Opfer gab. Sechzehn Nazis und drei Polizeibeamte kamen bei dem Zusammenstoß ums Leben. Hitler wurde verhaftet, angeklagt, verurteilt und ins Gefängnis gesteckt, wo er seine berüchtigte Hetzschrift Mein Kampf verfasste.
Hitlers Propagandisten verdrehten die Niederlage bald zu einer Geschichte von Ehre und Triumph. Der Jahrestag wurde zum Mythos der NSDAP, die den 9. November zum nationalen Feiertag, dem »Tag der Bewegung«, erklärt hatte. Jedes Jahr wurde der Marsch nachgestellt, und zum Gedenken an die 16 Gefallenen wurden Kränze niedergelegt. Anschließend verbrachte Hitler den Abend mit etwa 500 der ranghöchsten Parteimitglieder beim traditionellen Abendessen der »Alten Kämpfer« im Alten Rathaus. Dieser Abend, bei dem reichlich Alkohol floss, gipfelte um Mitternacht in einer ausgelassenen Zeremonie, bei der die neuen Rekruten der SS, der militärischen Abteilung der Partei, »Gehorsam bis in den Tod« schworen.
Gegen neun Uhr abends betrat ein Bote den Saal, wo die Feierlichkeiten in vollem Gange waren, und flüsterte etwas in Hitlers Ohr.14 Der Führer wandte sich an Josef Goebbels, seinen Propagandaminister, und man sah, wie sich die beiden Männer eingehend und leise unterhielten.15 Ein Gast berichtete, er habe den Satz gehört: »Die Braunhemden sollen sich austoben dürfen.«16
Daraufhin verließ Hitler die Versammlung. Normalerweise wandte er sich mit einer mitreißenden Rede an seine Anhänger, aber an jenem Abend sprach Goebbels an seiner Stelle.
»Ernst vom Rath war ein guter Deutscher, ein treuer Diener des Reiches, der in unserer Botschaft in Paris für das Wohl unseres Volkes arbeitete«, begann er, während die Menge verstummte. »Soll ich Ihnen sagen, was mit ihm geschehen ist? Er wurde niedergeschossen! In Ausübung seiner Pflicht wollte er unbewaffnet und ahnungslos mit einem Besucher der Botschaft sprechen, und wurde von zwei Kugeln durchbohrt. Jetzt ist er tot.«17 Nachdem die Tatsachen offengelegt waren, wandte sich Goebbels dem Thema Schuld und Vergeltung zu.
«Muss ich Ihnen sagen, welcher Rasse das Dreckschwein angehört, das diese schmutzige Tat begangen hat?«, fragte er und wiederholte damit das von Rath während des Attentats verwendete Epitheton. »Ein Jude!« Der Saal brach in alkoholisierte Beifallsstürme aus.
»Heute Abend sitzt er in Paris im Gefängnis und behauptet, er hätte allein gehandelt, er hätte keine Anstifter zu dieser schrecklichen Tat gehabt. Aber wir wissen es besser, nicht wahr? Kameraden, wir können nicht zulassen, dass dieser Angriff des internationalen Judentums unerwidert bleibt.«
Und so verlagerte Goebbels mit der präzise kalibrierten Rhetorik, für die er bekannt werden sollte, den Schuldvorwurf vom Einzelnen auf die Gemeinschaft. Die Schlussfolgerung war klar: gemeinsame Schuld bedeutete gemeinsame Konsequenzen. Die Vergeltung könnte willkürlich erfolgen. Wenn es zu Vergeltungsmaßnahmen kommen sollte, so stellte Goebbels klar, seien diese »dort, wo sie spontan entstehen, nicht zu verhindern.«18
Das Crescendo der Gewalt, das sich seit der Machtübernahme der NSDAP 1933 gegen die Juden aufgebaut hatte, sollte endlich seinen Höhepunkt erreichen. In Paris wartete Herschel Grynszpan auf seinen Prozess wegen Mordes. Das Urteil würde lange vor der endgültigen Entscheidung der Geschworenen gefällt werden. So viel war klar, als die Zwischenrufe im Saal zu einem Kampfgebrüll anschwollen.
Hitlers Abgang war bezeichnend und folgte einem Verhaltensmuster, das in den letzten Jahren zur Regel geworden war: Privat gab der Parteiführer Befehle für Gewalt gegen jüdische Gemeinden aus oder unterzeichnete sie; in der Öffentlichkeit blieb er stoisch stumm oder, wie im Falle des heutigen Abends, auffällig abwesend, um so sicherzustellen, dass sein Name nicht mit Gewalttaten in Verbindung gebracht werden konnte. In seinem Tagebuch legte Goebbels die Wahrheit über die Situation dar: »[Der Führer] bestimmt: Demonstrationen weiterlaufen lassen. Polizei zurückziehen. Die Juden sollen einmal den Volkszorn zu verspüren bekommen.«19
Ein Jugendlicher hatte den Vorwand für eine staatlich sanktionierte Gewaltorgie geliefert, den Startschuss, auf den ein angespanntes Regime lange gewartet hatte. So begann eine Nacht der Gewalt gegen Geschäfte und Wohnungen, Synagogen und Friedhöfe, Künstler und Waisen, ein Kapitel, das nicht nur mit der Inhaftierung Unschuldiger in ganz Deutschland, sondern auch mit der Inhaftierung Unschuldiger in Großbritannien enden sollte.
III.
Feuer und Kristall
Den anderen Kindern im Auerbach’schen Waisenhaus in Berlin schien es, als gewänne Peter Fleischmann niemals einen Kampf. Auch, als begänne er niemals einen. Im gnadenlosen Universum des Spielplatzes war der kleine Junge mit dem welligen Haar und der ovalen Brille offenbar das typische Opfer. Die Angestellten bahnten sich ihren Weg durch den Halbkreis der Schaulustigen, um die Jungen voneinander zu trennen, und Peter humpelte dabei stets als Besiegter davon. Die Wahrheit war jedoch viel komplizierter. Inmitten allen Gerangels, der zusammengebissenen Zähne und Schwitzkästen, des staubigen Getümmels war Peter immer sicher, dass er mindestens einen harten Schlag landen würde. Er mochte den Kampf verlieren, aber solange er unbemerkt dennoch Schmerz verursachte, würde sich der andere Junge danach sicher fernhalten.1
Jedes Waisenkind ist ein Überlebender. Eines Sommers, Wochen, Monate oder vielleicht auch Jahre nach seiner Geburt – niemand erzählte ihm je die ganze Wahrheit – waren Peters Eltern zusammen mit seiner Tante und seinem Onkel in der Nähe des Wannsees in Berlin unterwegs, als das Auto einen Lenkungsfehler hatte. Der Fahrer verlor die Kontrolle, und der Wagen stürzte ins Wasser. Als Passanten das Fahrzeug entdeckten, waren alle Insassen bereits ertrunken. Es gab keine Augenzeugen.
Wie der neun Monate ältere Herschel Grynszpan machte Peter die Nazis für sein Unglück verantwortlich. Sein Vater, Moritz, war Reporter für Die Freie Meinung! gewesen – eine Wochenzeitung, die im Januar 1919 von Peters Onkel Hugo gegründet worden war. Von ihrem Büro in Breslau aus dokumentierten die Brüder Fleischmann das Stadtleben in all seiner düsteren Fülle. Hugo, der unter dem Pseudonym Hans Hantada-Fleischmann schrieb,2 glaubte mit dem Eifer eines fundamentalistischen Predigers an die moralische Verpflichtung des Journalisten, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen. Außerdem musste er Zeitungen verkaufen, und im Breslau der 1920er Jahre verkaufte sich nichts so gut wie Klatsch und Tratsch. Die Berichterstattung der Freien Meinung! umfasste anzügliche Berichte über schmuddelige, lokale Sünden. (Eine regelmäßig erscheinende Kolumne trug den Titel »Aus den düstersten Winkeln Breslaus«.) Rasch machten sich die Fleischmanns Feinde in einflussreichen Positionen. In einem Artikel, der 1922 in einem Konkurrenzblatt erschien, verleumdete der Stadtrat Max Gruschwitz Hugo als »gemeinen Verleumder« und, mit antisemitischem Unterton, als »Brunnenvergifter«.3
Im Polizeibericht wurde der Tod der Fleischmanns als Folge eines Autounfalls aufgrund technischen Versagens dargestellt. Regelmäßige Leser der Freien Meinung! vermuteten etwas anderes. Der Mord blieb zwar unbewiesen, doch die Geschichte, die man Peter als Erklärung für die abgrundtiefe Leere in seinem Leben anbot, lautete, dass seine Familie ermordet worden sei, wahrscheinlich von Nazi-Sympathisanten. Was auch immer die genauen Umstände des Verschwindens seiner Eltern gewesen sein mochten, Tatsache war, dass Peter Fleischmann im Alter von drei Jahren zur Vollwaise wurde.
Peters Großvater, ein pensionierter Bankier namens Dr. Alfred Deutsch, sorgte fortan für Stabilität und finanzielle Sicherheit. Peter zog in seine palastartige Wohnung mit zwei Bädern und elf Schlafzimmern – viel zu viele für Alfred und seine Haushälterin Elizabeth Altenhain – in der vornehmen Aschaffenburger Straße.4 Alfred kümmerte sich um Peter, als wäre er der Vater des Jungen, und Elizabeth, als wäre sie seine Mutter – ein seltsames, aber wohlmeinendes Paar. Dennoch brauchte der Junge eine Ausbildung, und so schickte Alfred ihn, als Peter fünf Jahre alt war, in das Auerbach’sche Waisenhaus, wo er die Woche über blieb; sonntags kehrte er zu seiner ungewöhnlichen Familie zurück.
Das Schicksal war jedoch noch nicht ganz fertig mit dem überlebenden Fleischmann. Bald türmten sich weitere Probleme auf. Im Oktober 1929 entzog der Börsenkrach in den USA der Weimarer Nachkriegswirtschaft den Boden unter den Füßen. Die Kreditgeber weigerten sich, neue Kredite zu vergeben, und kündigten die bestehenden. Wie Millionen anderer Deutscher verlor Peters Großvater sein Geld. Alfred behielt die Wohnung, aber an den Wochenenden waren er und Peter gezwungen, durch die Straßen Berlins zu ziehen, in Suppenküchen zu essen und Pferdemist zu sammeln, den sie trockneten und anstelle von Kaminholz verwendeten.5 Alfreds Klage war nur eine Stimme unter vielen im Chor des Elends. In den zwölf Monaten zwischen September 1929 und September 1930 hatte sich die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf drei Millionen mehr als verdoppelt. Peter und sein Großvater waren privilegiert: Sie besaßen ein Haus und verfügten über die damit verbundenen Sicherheiten, doch Alfred überlebte seinen jähen Absturz in die Not nicht. Er verstarb innerhalb eines Jahres. Die Haushälterin zog aus und begann ein neues Leben in einem Bauernhaus in Dahlewitz, südlich von Berlin. Im Alter von zwölf Jahren hatte Peter keine Familie mehr, zumindest keine, von der er wusste. Die Illusion menschlicher Stabilität war dahin. Der Junge wurde ganztags im Auerbach’schen Waisenhaus untergebracht, wo er lernte, sich zu prügeln.6
In den Schulferien kehrten die Erinnerungen an Peters früheres, privilegiertes Leben in relativem Wohlstand zurück. Bevor Alfred sein Geld verlor, ging er mit seinem Enkel in das berühmteste Restaurant der Stadt, das Kempinski am Kurfürstendamm 27, das zu einer hochklassigen und profitablen Kette von Geschäften und Restaurants gehörte, die sich seit dem späten 19. Jahrhundert über die Stadt ausgebreitet hatte. Das riesige Restaurant war prächtig ausgestattet: weinrote Teppiche, Mahagonimöbel, blitzblankes Besteck, weiße Servietten. Im Erdgeschoss befand sich ein Delikatessengeschäft, in dem Verkäuferinnen in schwarzen Uniformen mit weiß-gerüschten Schürzen und Haarreifen von silbernen Tabletts mit silbernen Zangen kandierte Ananas servierten.
Bei seinen Besuchen dort erkundete Peter das Gebäude und die Bereiche, die normalerweise für die Öffentlichkeit gesperrt waren. Einmal lernte er den Inhaber des Weinimportgeschäfts kennen, welches das Restaurant belieferte. Der Mann wirkte auf Peter freundlich und gut gelaunt und spielte mit ihm zwischen den Säulen und Regalen Verstecken. Es sollte noch einige Zeit dauern, bis Peter herausfand, dass es sich bei seinem unerwarteten Spielkameraden um Joachim von Ribbentrop gehandelt hatte, den späteren Außenminister der Nazis.7
In dem Restaurant lernte Peter auch Elisabeth Kohsen kennen, die Erbin des Kempinski-Imperiums, eine temperamentvolle Gesellschaftslöwin mit zwei eigenen Kindern, die nur wenig jünger waren als Peter selbst. Echen, wie sie von ihren Freunden genannt wurde, war trotz der außergewöhnlich günstigen Umstände ihrer Geburt empathisch und mitfühlend geblieben. Sie spendete Geld, um die Arbeit des Auerbach’schen Waisenhauses zu unterstützen.8 Nach Alfreds Tod lud Echen Peter ein, die Ferien bei ihrer Familie zu verbringen, und bezahlte in einem Winter auch den gemeinsamen Skiurlaub in der Schweiz. Als Peter einmal krank wurde, finanzierte sie ihm einen Erholungsaufenthalt auf dem Lande, weit weg von den anderen Waisenkindern.
Echen wurde für Peter zu einer Art Ersatzfamilie. Wenn er ihre geräumige und luxuriöse Wohnung im dritten Stock eines Hauses im mondänen Berliner Viertel Charlottenburg besuchte, wollte sie, dass er sie als »Tante« ansprach, und wies ihre beiden Töchter an, ihn »Cousin« zu nennen.9 Seine Besuche waren für Peter bald wie ein Traum. Vor dem Abendessen sah er zu, wie Echen lebende Hummer aus einer niedrigen Spüle nahm und sie scharf zischend in einen Topf mit kochendem Wasser fallen ließ, wo sich ihre schwarzen Panzer leuchtend rot färbten.10 Im Esszimmer hing ein rosafarbener venezianischer Glaslüster über einem riesigen hellgrünen und purpurroten Teppich. Durch das Fenster beobachteten Peter und die Schwestern manchmal den Vorbeimarsch junger Nazi-Braunhemden oder warfen Münzen zu einem örtlichen Leierkastenmann und seinem Affen hinab. Ein paar Wochen lang erlebte Peter hier und da kurze Ausflüge in das entschwundene Leben, das er einst bei seinem Großvater genossen hatte, bevor er zu den Pflichten und der Routine des Waisenhauses zurückkehren musste.
Abgesehen von den Kämpfen auf dem Spielplatz war das Auerbach’sche Waisenhaus ein Ort relativen Friedens und Überflusses. Das Waisenhaus glich nicht den Arbeitshäusern bei Dickens mit ihren Schüsseln dünnen Haferschleims und unbarmherzigen Aufseherinnen. Das Gebäude war alt und solide. Mit ihren weißen Metallbetten und identischen Decken erinnerten die Schlafsäle zwar an Krankenstationen, waren aber gemütlich eingerichtet. Der Spielplatz war von Bäumen umstanden, und das Gelände wurde von einem Hausmeister, Herrn Gross, sorgfältig gepflegt.11 Peter lebte mit etwa 80 anderen jüdischen Kindern zusammen, sowohl Jungen als auch Mädchen, vom Vorschulalter bis zum Schulabgang.
Nicht alle Bewohner waren »Vollwaisen«, wie diejenigen, die beide Elternteile verloren hatten, lapidar genannt wurden. Auch Alleinerziehende schickten ihre Kinder als Wochengäste ins Auerbach’sche Haus. Jede Familie zahlte, was sie sich leisten konnte.12 Eine mit Barren, Sprungpferden und Ringen ausgestattete Turnhalle trennte die Jungen- und Mädchenschlafsäle, und nach den täglichen Hausaufgaben trafen sich die Schüler im Hof, um sich an den Händen zu berühren und heimlich ein Küsschen zu ergattern. Beschäftigungsmöglichkeiten gab es in Hülle und Fülle: Radiogeräte und Schachspiele, Tischtennisplatten, Spielkarten, kleine Holzküchen und einen Sandkasten im Freien, der so breit und tief war wie ein Schwimmbecken, in dem die jüngeren Kinder Burgen und Wehrgräben bauen konnten.13
Es gab tägliche Aufgaben – Schuhe putzen, Stufen schrubben, Geländer polieren – und einige jahreszeitlich bedingte Härten: Im Winter froren die Wasserhähne im Kutschenhaus unten im Garten gelegentlich ein, und die Kinder mussten das Eis aus den Waschbecken hacken, bevor sie sich waschen konnten.14 Im Großen und Ganzen aber war das Leben angenehm für die Kinder, die von den Spenden vermögender Wohltäter wie dem Bankier und Philanthropen Eugen Landau profitierten, von welchem eine Büste über den Speisesaal wachte. Am Samstagmorgen erhielten Peter und die anderen Schüler zur Feier des Schabbat ein Stück Kuchen und einen Löffel Lebertran. Zu Chanukka erhielt jeder Junge einen neuen Anzug.15
Jonas Plaut, ein jovialer, breitschultriger Mann Mitte vierzig, und seine zehn Jahre jüngere Frau Selma leiteten seit 1922 das Waisenhaus. Zur Betreuung der Kinder stellte das Ehepaar fortschrittliche Praktikantinnen ein, junge Leute, denen es vor allem um die Förderung ihrer Schützlinge ging. Eine Erzieherin gab den Schülern häufig Geld aus ihrer eigenen Tasche, damit sie ins Kino gehen oder die Bäckerei nebenan besuchen konnten.16 Selma Plaut neigte zwar dazu, bestimmte Kinder zu bevorzugen, was diejenigen, denen ihre Aufmerksamkeit nicht zuteil wurde, entsprechend verärgerte,17 doch gelang es dem Ehepaar, eine Erlebniswelt zu schaffen, an die die meisten gern zurückdachten.
Gemäß den Wünschen des Gründers des Waisenhauses, Baruch Auerbach, wollten die Plauts, dass ihre Einrichtung nicht nur die körperlichen und seelischen Bedürfnisse der Waisenkinder befriedigte, sondern auch ihren geistigen und kulturellen Wünschen nachkam.18 Daher inszenierten die Waisenkinder klassische Theaterstücke, die sie in voller Kostümierung aufführten.19 Ein Abend in der Woche war für klassische Musik reserviert, während die Betreuer den jüngeren Kindern in ihren Betten vorlasen, bis die Lichter gelöscht wurden.20 Gastlehrer gaben Klavierstunden oder lehrten Holzarbeiten und Buchbinderei.
Der Gründer der Einrichtung hatte betont, wie wichtig es sei, sich um das seelische Wohlbefinden der Kinder ebenso zu kümmern wie um ihre körperlichen Bedürfnisse. »Wenn es seinem wahren Zweck entsprechen soll«, schrieb Auerbach einmal, »muss das Waisenhaus ein Elternhaus für Waisen sein.«21 Es herrschte zwar Disziplin, aber die Kinder wurden nie geschlagen.22 Gewaltlosigkeit wurde auch auf implizite Weise gefördert: Die Schüler benutzten aus dem Ersten Weltkrieg übrig gebliebene Gewehrschäfte als Hockeyschläger, und eine Statue Friedrichs III., Deutschlands ausgesprochen pazifistischem Kaiser, überblickte den Hof in der Mitte des Geländes. Das Auerbach’sche Haus war ein Zufluchtsort, wenngleich es bei 16 Kindern pro Schlafsaal nicht gerade viel Privatsphäre bot.23
Außerhalb der mächtigen Tore des Gebäudes, das seit der Jahrhundertwende in der Schönhauser Allee 162 stand,24 herrschten im Berlin der Weltwirtschaftskrise Obdachlosigkeit und Hunger, Streiks und Straßenkämpfe.25 Der britische Schriftsteller Christopher Isherwood, der damals in Berlin lebte, berichtete von jungen Männern, die an einem »weiteren arbeitslosen, leeren Tag« in einer trostlosen Stadt erwachten und ihre Zeit damit verbrachten, »Schnürsenkel zu verkaufen«, »an Pissoirs herumzuhängen« und aus dem Rinnstein aufgesammelte Zigarettenstummel miteinander zu teilen.26 Als der Würgegriff der nationalsozialistischen Unterdrückung immer enger wurde, erlangte das Waisenhaus, das eine kleine, liberale Synagoge beherbergte, den Ruf, einer der sichersten Orte für junge jüdische Kinder zu sein.27 Es war eine Oase in einer ansteigenden Flut von Schmutz. Wie viele Zufluchtsorte in Zeiten großer Not, wurde auch das Auerbach’sche Waisenhaus zu umkämpftem Terrain.
Um 23 Uhr am Abend des 9. November, wenige Stunden nachdem die Ärzte Rath in Paris für tot erklärt hatten, trat Hugo Moses, ein 44‑jähriger Angestellter der Oppenheimer-Bank, aus einer Besprechung im Zentrum der deutschen Kleinstadt, in der er und seine Familie lebten, hinaus auf eine leere Straße. In den örtlichen Kneipen tummelten sich noch immer die Nazis, aber Hugos Heimweg zu seiner Wohnung, wo seine Frau und seine Kinder bereits im Bett lagen, verlief ruhig. Bald war auch er eingeschlafen, bis ihn das penetrante Klingeln der Türglocke aus dem Schlaf riss. Moses ging zum Fenster, zog den Vorhang zurück und sah, dass die Straßenlaternen gelöscht worden waren. Gegen den fast schwarzen Himmel erkannte er die unheilvolle Silhouette eines Transportfahrzeugs und die Umrisse von Männern, die entweder ausstiegen oder sich bereits vor seiner Haustür versammelten.
»Hab keine Angst«, rief er seiner Frau im Schlafzimmer zu. »Es sind Männer von der Partei; bleib ruhig.«28
Noch im Schlafanzug öffnete Moses die Eingangstür. Er roch seine Angreifer, bevor er sie sah: eine Welle von Alkohol, gefolgt von einem festen Stoß gegen die Brust, als der erste der Männer, aufgeputscht vom Alkohol und der elektrisierenden Aussicht auf Gewalt, sich an ihm vorbeidrängte und das Telefon aus der Wand riss. Der Anführer, ein SS‑Mann, baute sich vor Hugo auf. In der Dunkelheit schimmerte sein Gesicht grün und wirkte bedrohlich. Er spannte demonstrativ seinen Revolver.
»Weißt du, warum wir hierhergekommen sind?«, fragte er und hob die Waffe. Er drückte das Ende des kalten Laufs gegen Moses’ Stirn.29
«Nein«, antwortete Moses.
«Wegen der ungeheuerlichen Tat in Paris, an der auch du schuld bist. Wenn du auch nur versuchst, dich zu bewegen, werde ich dich abknallen wie ein Schwein!«
Moses antwortete nicht. Er stand mit den Händen hinter dem Rücken an die Wand gepresst. Novemberluft wehte durch die offene Tür in den Flur und blies die kalte Gegenwart in die Vergangenheit, das Undenkbare in die Realität. Moses hörte, wie die Männer in schweren Stiefeln durch die Wohnung polterten. Er hörte das Schlagen und Rascheln, als sein Schreibtisch ausgeräumt wurde, das leise Klirren vom Glas gerahmter Fotos, die auf den Boden fielen, die häusliche Manifestation eines Angriffs auf die Identität.
»Was wollen Sie von meinen Kindern?«, hörte er seine Frau aus dem Nebenzimmer schreien. »Sie werden meine Kinder nur über meine Leiche anfassen.« Plötzlich blies der Mann, der Hugo den Revolver an den Kopf hielt, kräftig in eine Pfeife. Die Plünderer trampelten durch den Flur und stürmten auf die Straße hinaus. Als die letzten Männer gingen, nahm ihr Anführer die Mündung von Hugos Stirn, richtete die Waffe an die Decke und gab zwei Schüsse ab. Moses glaubte, seine Trommelfelle wären geplatzt, und blieb regungslos stehen. Dann schlug der Mann Moses mit dem Stock, mit dem er die Bilder zerschlagen hatte, seitlich auf den Kopf.
»Da hast du’s, du jüdische Sau«, schrie er, während der draußen geparkte Lastwagen stotternd zum Leben erwachte. »Viel Spaß noch.«
Ähnliche Szenen ritueller Einschüchterung, Erniedrigung, Demütigung und Übergriffe spielten sich zu diesem Zeitpunkt in vielen deutschen Städten ab. Wenige Stunden nach Goebbels’ Rede, in der er zu gewaltsamen Protesten gegen Juden aufgerufen hatte, verfasste Reinhard Heydrich, Leiter der Gestapo, ein Telegramm an sämtliche Polizeidienststellen und Nachrichtendienste des Landes.
«Auf Grund des Attentats gegen den Leg. Sekr. v. Rath in Paris sind im Laufe der heutigen Nacht … im ganzen Reich Demonstrationen gegen die Juden zu erwarten«, schrieb Heydrich.30
Er gab stichpunktartig eine Reihe von Anweisungen, wie die Staatspolizei die bevorstehende Welle der Gewalt einzudämmen hätte, die darauf abzielten, Kollateralschäden zu minimieren und zu gewährleisten, dass die Gewalt präzise und selektiv war.
»Synagogenbrände« seien nur zu dulden, »wenn keine Brandgefahr für die Umgebung« bestehe, lautete Heydrichs Anweisung. »Geschäfte und Wohnungen von Juden dürfen nur zerstört, nicht geplündert werden. […] Ausländische Staatsangehörige dürfen – auch wenn sie Juden sind – nicht belästigt werden.« Letzteres gab vor, wie man mit den deutschen Juden verfahren sollte. Heydrichs Telegramm deckte sich mit den Anweisungen, welche die in München versammelten Sturmbannführer einige Stunden zuvor an ihre jeweiligen regionalen Abteilungen telefonisch durchgegeben hatten. Offenbar war in Erwartung von Raths Tod ein Plan ausgearbeitet worden.
In Wittlich, einer Kleinstadt im Westen Deutschlands, warfen Nazi-Anhänger Möbel durch das kunstvolle Bleikristallfenster über der Eingangstür der Synagoge, sodass der Bürgersteig mit bunten Glasscherben übersät war. Ein Mann kletterte auf das Dach.
»Wischt euch den Arsch damit ab, ihr Juden«, schrie er, während er Torarollen in die Luft warf, die sich wie Luftschlangen entrollten.31
In der deutschen Hauptstadt wurden die Gewalttaten bis zwei Uhr morgens hinausgeschoben. Dann kappten speziell ausgebildete Einsatzkräfte die Telefonleitungen zu den jüdischen Gebäuden und schalteten Strom und Heizung ab.32 Die Polizei leitete den Verkehr aus den am stärksten betroffenen Gebieten Berlins um – ein Maß an Kalkül, das die Behauptung widerlegt, die nächtlichen Übergriffe seien die Manifestation eines spontanen »Volkszorns« gewesen.
Die großen Gotteshäuser waren die ersten Ziele der Razzia. Goebbels ordnete ausdrücklich die Zerstörung der größten Synagoge in der Fasanenstraße an.33 In der Nähe des Berliner Zoos gelegen, hatte Kaiser Wilhelm II. am 26. August 1912 an der Eröffnungsfeier teilgenommen. Vierundzwanzig Jahre später erzwangen die Nationalsozialisten 1936 ihre Schließung. Das Gebäude wurde jedoch von Magnus Davidsohn, dem Oberkantor, weiter unterhalten. Davidsohn war ein Nachbar der Eltern des ermordeten Rath. Bevor der Diplomat in Paris seinen Verletzungen erlag, hatte Davidsohn das Ehepaar besucht, um das Mitgefühl der jüdischen Gemeinde auszudrücken.
»Mein lieber Herr Kantor«, hatte Raths Vater zu Davidsohn gesagt. »Weder Sie noch sonst ein Jude ist dafür verantwortlich.«34
Als die Flammen in der Synagoge immer höher schlugen, flehte Davidsohn den Feuerwehrhauptmann an, den Brand zu löschen.
«Ich kann nicht helfen«, sagte der Hauptmann. »Wir sind gekommen, um die Nachbargebäude zu schützen.«
Der Pförtner der Synagoge kam in den Innenhof, sein Nachthemd war blutverschmiert. Als er sich geweigert hatte, die Schlüssel für das Heiligtum herauszugeben, hatten die Sturmtruppen die Türen aufgebrochen, die Orgel mit ihren 78 Registern über die Empore geworfen, die heiligen Texte, Gewänder und Gebetsbücher zerrissen und auf den Wittenbergplatz geworfen. Anschließend übergossen die Männer die Holzbänke mit Benzin und beschleunigten so die Geschwindigkeit und Intensität des Brandes.
Davidsohn und der Pförtner sahen zu, wie die Gruppe die Gegenstände und Dokumente der Synagoge zu einem Scheiterhaufen auftürmte, diesen in Brand steckte und dann um die Flammen herumtanzte. Im Auerbach’schen Waisenhaus kletterten einige der älteren Jungen auf das Dach des Gebäudes und sahen von dort aus, wie die Funken des fernen Feuers den Himmel färbten.35 Derweil stiegen die Täter in 30 Taxis, die bereitstanden, um sie zu den jüdischen Krankenhäusern der Stadt, zu den Altersheimen und den Waisenhäusern zu bringen.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Jahre 1933 dauerte es nicht lange, bis die Auerbach-Kinder merkten, dass sich die Welt veränderte. Keine acht Wochen nach der Machtergreifung wurden deutsche staatliche Schulen angewiesen, die Zahl der jüdischen Schüler auf weniger als fünf Prozent der Gesamtschülerzahl zu begrenzen. Die Lehrer begannen, nicht-arische Schüler von ihren Mitschülern wegzusetzen und sie mit rassistischen Beinamen wie »Judenjunge« anzureden.36 Manche Lehrer zogen jüdischen Schülern, die während des Unterrichts redeten oder eine falsche Antwort gaben, wenn sie aufgerufen wurden, die Hosen hoch und schlugen ihnen mit einem Stock auf die Oberschenkel – eine Strafe, die ihre Mitschüler nie zu fürchten hatten.
Im Alter von zehn Jahren wurde jedes Kind des Waisenhauses nach seinen individuellen Begabungen und Neigungen an einer weiterführenden Schule angemeldet. Kinder, die sich in Sprachen, Mathematik oder Naturwissenschaften besonders hervortaten, besuchten die Königstädtische Oberrealschule,37 die für den hohen Turm auf ihrem Gelände bekannt war, der ganz oben ein mächtiges Teleskop beherbergte. Diejenigen, die eine Begabung für geisteswissenschaftliche Fächer an den Tag legten, kamen auf das Heinrich-Schliemann-Gymnasium.
Peter war ein mittelmäßiger Schüler. Er hatte Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung und tat sich schwer mit Sprachen. Er pendelte zwischen den Klassen hin und her, während seine Lehrer versuchten, ein Fach zu finden, in dem er, wenn schon nicht glänzen, so doch aufblühen könnte. Die Kunst war Peters Rettung. Er war ein geborener Zeichner und verbrachte die Unterrichtsstunden damit, endlos zu skizzieren und zu kritzeln, mit Formen, Farben und Typografie zu spielen. Anstatt Peter in Richtung der Hauptfächer zu lenken, förderten die Lehrer am Auerbach’schen Waisenhaus die Leidenschaft ihres Schützlings und besorgten ihm einen Platz an der Königlichen Kunstschule zu Berlin.38 Nachdem er seinen Platz gefunden hatte, entwickelte sich Peter prächtig, lernte Mal-, Radier- und Stichtechniken und zeigte dabei so großes Talent, dass er freiberufliche Aufträge zur Gestaltung von Reise- und Filmplakaten erhielt.39 Die Unterstützung durch die Lehrer hatte tiefgreifende Wirkung.
»Damals beschloss ich, Künstler zu werden«, sagte er.40 Die Auerbach-Mitarbeiter lenkten ihre Schützlinge zwar behutsam in eine Richtung, die ihren Begabungen und Interessen entsprach, konnten sie aber nicht vor den eskalierenden Grausamkeiten der Außenwelt schützen. Ältere Kinder wie Peter verließen das Waisenhaus gemeinsam gegen 7.30 Uhr,41 bevor sie sich je nach Zielort in kleinere Gruppen aufteilten. Für die meisten war der Schulweg ein mindestens 40‑minütiger Fußmarsch, ein Weg, auf dem die Kinder im Laufe der Monate immer häufiger zur Zielscheibe von Schikanen wurden.
Eines Tages erspähte eine Gruppe Auerbach-Schüler eine Bande von Hitlerjungen, die ihnen offenbar am Wegesrand auflauerte. »Bleibt zusammen«, sagte einer, als sich die Gruppe den Uniformierten näherte. »Tut nichts, was sie irritieren könnte.«42
Der Versuch war erfolglos. Die älteren Jungen begannen, Steine auf die Kinder zu werfen. Ein Geschoss traf einen Auerbach-Schüler am Kopf und verursachte eine Platzwunde.
»Seht euch nur das jüdische Blut an!«, rief ein Mitglied der Bande. Bald wurden die Schikanen zum festen Bestandteil des Schulalltags.43 Selbst, als man die jüdischen Kinder schließlich von den staatlichen Schulen verwiesen und das Auerbach-Personal begonnen hatte, sie in der 30 Minuten zu Fuß entfernten Rosenstraße zu unterrichten, wurden die Waisenkinder regelmäßig von Mitgliedern der Hitlerjugend mit Gürteln und Schnallen angegriffen.44
Die Übergriffe wurden von älteren Parteimitgliedern inszeniert, um bei jungen Hitler-Anhängern die Hemmschwelle zu senken, Gewalttaten an Juden zu verüben. Diese jungen Anhänger waren es auch, die in den frühen Morgenstunden des 10. November 1938 auf halber Strecke ihrer lustvollen Zerstörungstour zum Auerbach’schen Waisenhaus kamen, an das Eingangstor klopften und Einlass verlangten.
In den Monaten vor dem Attentat auf den deutschen Diplomaten Rath in Paris hatten sich bereits die Anzeichen dafür verdichtet, dass das Schicksal Peter erneut heimsuchen würde. Am 27. Juli wurden mehrere Berliner Straßen, die Namen von Juden trugen, umbenannt. Am 27. September wurde jüdischen Rechtsanwälten die Berufsausübung untersagt. Am 5. Oktober wurden die Reisepässe aller Juden eingezogen und mit einem rot gestempelten »J« neu ausgestellt. Kurz bevor der Mob am Auerbach’schen Waisenhaus eintraf, klopfte ein Polizeibeamter in Zivil an das Eingangstor.
»Die Gestapo ist auf dem Weg«, sagte er. »Sie kommen, um Peter Fleischmann zu holen.«45
Offenbar hatte die Geheimpolizei endlich die »Überbleibsel« der Familie Fleischmann aufgespürt, die ansonsten ausgelöscht worden war.46
Jonas Plaut fragte Peter: »Wo willst du denn hin?«
Sechs Wochen vor seinem 17. Geburtstag – dem Zeitpunkt, an dem er sich vom Auerbach’schen Waisenhaus, der Institution, die ihm in den Wirren seines jungen Lebens Halt gegeben hatte, würde verabschieden müssen – wusste Peter Fleischmann, wie man überlebte: unauffällig. Es gab zwei Personen, bei denen er Zuflucht suchen konnte: seine »Tante« Echen Kohsen, Erbin des Kempinski-Vermögens, und die Haushälterin seines Großvaters, Elizabeth Altenhain. Obwohl beide Frauen nicht mit ihm verwandt waren, hatte er zu beiden eine enge Bindung. Peter entschied sich für die Haushälterin, deren bescheidenes Bauernhaus in dem Vorort Dahlewitz lag, weit weg von der Stadt.
Peter packte seine Habseligkeiten zusammen – ein paar Kleider, eine Geige und eine Mappe mit seinen Zeichnungen – und sagte Lebewohl. So kam es, dass Peter Fleischmann sich in der Nacht, in der der deutsche Diplomat Rath starb und der Mob der Nazi-Anhänger vor den Toren des Auerbach’schen Waisenhauses aufmarschierte, im Keller eines Bauernhauses versteckte, das der Haushälterin seines verstorbenen Großvaters gehörte, 25 Kilometer südlich von seinem leeren Waisenhausbett.
Der Waisenhausleiter Jonas Plaut öffnete knarrend das Tor und erblickte eine Schar junger Männer, manche in Uniform, andere in Zivil.47
Er hatte gewusst, dass der Mob unterwegs war. Der Polizist in Zivil hatte ihn schon früher am Abend gewarnt, er solle die Kinder woanders hinbringen.48 Aber wo sollte man 80 junge Menschen unbemerkt verstecken?49 Es erschien sicherer, an Ort und Stelle zu bleiben und zu beten, dass die Plünderer vorbeiziehen würden – eine nachvollziehbare Fehleinschätzung.





























