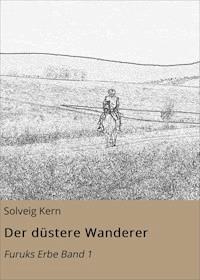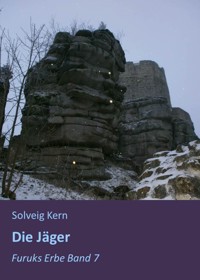
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Furuks Erbe
- Sprache: Deutsch
Der 7. Band begleitet Mauros Jäger Yvo und Feren auf ihrem Entwicklungsweg. Feren begreift, was seine Ernennung zum Jäger bedeutet: er, der sich Zeit seines Lebens unterordnen musste, soll plötzlich den anderen vorangehen. Er sucht Rat bei seinem Großvater in Tolego, doch die Unterstützung des Clans hat ihren Preis. Feren soll in den Machtkampf um Torrens Nachfolge einsteigen. Gesundheitlich beeinträchtigt und obwohl ihm ein Sieg noch mehr Druck und Verantwortung brächte, stellt Feren sich einem Kampf, den er kaum gewinnen kann. Yvo hingegen ist auf der Suche nach seiner verlorenen Identität. Noch wählt er Frauen, die ihn gefühlsmäßig nicht berühren, doch der Eispanzer zeigt Risse. Als sich die Chance zur Rache auftut, stellt er fest, dass der alte Schmerz keine Macht mehr über ihn hat. Befreit vom Ballast der Vergangenheit findet Yvo die verschollene Bibliothek. Endlich erfährt Mauro, was es mit dem Pakt auf sich hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Solveig Kern
Die Jäger
Furuks Erbe Band 7
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1: Das Geschenk der Kojotim
Kapitel 2: Der Kampf mit der Vergangenheit
Kapitel 3: In Barrens Visier
Kapitel 4: Der lange Weg zurück
Kapitel 5: Der Fürst von Tolego
Kapitel 6: Ein Feuerwerk für Nauriell
Kapitel 7: Familienidylle
Impressum neobooks
Kapitel 1: Das Geschenk der Kojotim
Am Tag nach Ferens Auszug aus dem Palast erlebte die Stadt Mandrilar ein Spektakel: das Eintreffen der Delegation aus dem Kojotenland. Der König der Kojotim liebte den Prunk. Die Leidenschaft für schöne, wertvolle Dinge teilte er mit Mauros Statthalter Pado. Kein Wunder, dass die beiden bestens mit einander auskamen. Sie unterstützten sich gegenseitig darin, ihren Reichtum zu mehren.
Nun zogen die Kojotim durch die große Prachtstraße zum Palast. Ganz vorne gingen die Standartenträger. Als Mauros Untertanen trugen sie zu vorderst das Staatswappen der Furukim. Die Frauen wurden in prächtigen Sänften getragen. Der König der Kojotim saß auf einem feurigen Hengst, gehüllt in ein goldbesticktes Gewand, das bis zum Boden reichte. Pado mit seinen Kombat-Zauberern hatte sich in den bunten Zug eingereiht. Es folgten die Trommler und dahinter die Krieger. Sie hatten geschmückte Elefanten mitgebracht, auf deren Rücken Menschen ritten. Gaukler machten den Abschluss. Sie trugen Affen und andere seltsame Tiere.
Die Mandrilanen säumten dicht an dicht den Weg und bestaunten den exotischen Prunk. Von ihren eigenen Königen bekamen sie derlei nicht zu sehen. Schon König Curon neigte nicht dazu, seinen Reichtum öffentlich zur Schau zu stellen. Mauro waren solche Aufzüge verhasst. Er kleidete sich schlicht und zweckmäßig, denn seine Bewegungsfreiheit ging ihm über alles. Seine Fürsten hüteten sich davor, ihn durch übermäßigen Prunk zu übertrumpfen.
Dem Kojotim hatte man das offenbar nicht gesagt. Er repräsentierte sein Land auf die einzige Art und Weise, die er kannte: mit größtmöglichem Prunk.
Im Palast angekommen machten die Kojotim Mauro wertvolle Geschenke. Sie brachten Gold, Schmuckgegenstände, wertvolle Teppiche und edle Früchte aus ihrer Heimat. Mauro nahm die Gaben mit unbewegter Miene entgegen. Es war der Tribut, den sie ihm ohnedies schuldeten. Den Aufwand, den sie damit trieben, hätten sie sich seiner Meinung nach sparen können. Die Getreidelieferungen interessierten ihn viel mehr als der andere Plunder.
Zum Schluss machte der Herrscher der Kojotim Mauro ein ganz spezielles Geschenk. Er öffnete den Vorhang zu einer der Sänften. Eine komplett mit Schleiern verhüllte Frau kam zum Vorschein. Er reichte ihr die Hand und führte sie vor Mauro. Dort nahm er ihr den äußersten Schleier ab. Ein wunderschönes Mädchen kam zum Vorschein. Sie war blutjung, hatte dunkle Haut und riesige, schwarze Rehaugen. Yvo starrte sie mit offenem Munde an. Anmutig verneigte das Mädchen sich vor Mauro.
Der Kojotim-Herrscher ließ seine Worte übersetzen. „Wie ich höre, hat der mächtige König der Furukim zur Zeit nur zwei Frauen“, sagte er. „Man munkelt gar, eine davon wäre sehr krank. Ich bin besorgt um den Bestand Eures edlen Geschlechtes. Gewährt mir die Gnade, Euch meine Tochter als Konkubine anzudienen. Auf diese Weise möchte ich meinen Dank für Euren Großmut ausdrücken, dass Ihr meine Männer verschont habt. Möge das Bündnis zwischen unseren Völkern ebenso gedeihen wie die Kinder aus dieser Verbindung.“
Im kleinen Kreis machte Mauro seinem Unmut Luft. „Die eigene Tochter als Geschenk zu überreichen ist eine Unglaublichkeit“, tobte er. „Warum habt Ihr ihn davon nicht abgehalten? Wie konntet Ihr zulassen, dass er mich in so eine Situation bringt – gerade jetzt? Reicht das bisschen Hirn in Eurem Kopf nicht aus, um drei Schritte weiterzudenken?“
Pado, der Adressat des Wutanfalls, zog den Kopf ein.
Mauro tobte weiter: „Er schenkt mir etwas, das ihm nützt, aber für mich keinen Wert besitzt. Er lädt mir eine Verpflichtung auf, und ich muss ihm auch noch danken. Seine Tochter nistet sich in meiner Familie ein, und ich soll das widerspruchslos hinnehmen? Kennt Ihr mich so schlecht, dass Ihr glaubt, Ihr könnt das mit mir machen?“
„Gefällt Euch das Mädchen denn nicht?“ fragte Pado betroffen.
„Sehe ich aus, als würde ich mich an Kindern vergreifen? Sie ist kaum fünfzehn!“ schrie Mauro Pado an. „Wenn ich das Gegacker halbwüchsiger Mädchen um mich haben will, dann sollten es bitte meine eigenen Töchter sein, nicht die von jemand anderen. Noch eine Frau, die sich wie ein Kind benimmt, brauche ich wahrlich nicht!“
Die anwesenden Höflinge schwiegen betreten. Zum ersten Male hatte Mauro öffentlich auf Sigruns Zustand Bezug genommen. Ihm dieses blutjunge Geschöpf zuzuführen musste dem König der Furukim wie blanker Hohn vorkommen.
Pado interpretierte Mauros Unmutsäußerungen wieder einmal völlig falsch. „Ich habe auch eine seiner Töchter als Konkubine genommen“, sagte er zu seiner Entschuldigung. „Sie ist ein liebreizendes, anschmiegsames Geschöpf…“
„Daher weht der Wind“, knurrte Mauro. Er packte Pado am Kragen und sah ihn an, als würde er ihn gleich fressen. „Ihr habt selbst einen Nutzen von diesem Geschenk. Wenn ich es annehme, werde ich Euer Schwager!“
„Diesen Hintergedanken hatte ich nicht“, versicherte Pado wenig überzeugend. „Ich meinte, die exotische Schönheit würde Euch entzücken…“
Mauro stieß Pado derb von sich: „Nichts da, Ihr bringt das in Ordnung. Findet einen diplomatischen Weg, ihm zu sagen, dass ich seine Tochter nicht haben will.“
Pado wurde blass: „Wenn das Mädchen Euer Missfallen erregt, wird er sie töten!“
Damit musste er Mauro nicht kommen. „Und? Ist das mein Problem? Muss ich diesen Übergriff auf meine Privatsphäre dulden, um ihr Leben zu bewahren? Ich habe die Gesetze der Kojotim nicht gemacht, und ich bin nicht bereit, mich ihnen zu unterwerfen. Ist Euch vielleicht aufgefallen, dass er mein Vasall ist, und nicht ich der seine?“
„Bitte, lasst nicht zu, dass sie stirbt“, flehte nun auch Yvo. „Sie ist so zart, so schön wie eine Blume. Was sage ich da, wie eine kostbare Orchidee… schenkt sie mir, wenn Ihr sie nicht haben wollt!“
„Das ist das letzte, was ich tun werde!“ Mauro war völlig außer sich. „Das passt genau in Dein Denkmuster: Du rettest die Frau vor dem Tode und meinst, sie ist Dir zu ewigem Dank verpflichtet. Du bist Ihr Herr und sie muss tun, was Du sagst. Hast Du aus der Episode mit Iorghe nichts gelernt? Auf Menschen gibt es keinen Besitzanspruch. Du musst sie täglich neu überzeugen.“
„Das mit Iorghe war anders“, rechtfertigte sich Yvo. „Ich hätte ihn als Lehrer betrachten und sein Wissen nutzen müssen, statt zu versuchen, ihm meinen Willen aufzuzwingen. Ich habe seine Sympathie verloren, doch ich habe daraus gelernt. Den gleichen Fehler mache ich gewiss nicht wieder.“
„Nichts hast Du gelernt“, sagte Mauro grob. „Menschen sind kein Spielzeug, das man aus dem Käfig holt, wenn man seinen Spaß haben will. Das man beliebig quälen kann, ohne dass es jemals zurückschlägt. Die einzige Art von Beziehung, die Du kennst, basiert auf der Ausübung von Macht. Barren hat Dir nichts anderes beigebracht.“
Yvo stand wie versteinert. Dass Mauro so über ihn dachte, verletzte ihn zutiefst.
„Es ist nicht Deine Schuld“, lenkte Mauro ein. „Du kannst ja nichts dafür, dass Du nie Freundschaft oder Liebe erfahren hast. Du gibst nur weiter, was er Dir vorgelebt hat.“
„Das ist nicht wahr!“ Yvo war entsetzt.
„Sei nicht gekränkt“, sagte Mauro und ging zu Yvo hinüber. Er wollte ihm die Hand auf die Schulter legen, wie er es bei Feren oder Shui tun würde, doch Yvo wich zur Seite. Mauro erinnerte sich, dass Yvo keine Berührungen ertrug. Er blieb vor ihm stehen und versuchte, ihn mit Worten zu erreichen: „Zu einer Beziehung gehört auch, Konflikte auszuhalten und Widerworte zu akzeptieren. Wenn Du das kannst, darfst Du jede Frau wählen, die Dein Herz begehrt. Doch davon bist Du weit entfernt.“
Yvo stand da, als hätte man ihm ein Brett auf den Kopf geschlagen. „Ich wusste nicht, dass Ihr so über mich denkt“, sagte er. „Wie wollt Ihr da auf meine Loyalität bauen, wenn Ihr mir nicht zutraut, dass ich zu Bindungen – zur Treue gegenüber meinem Bruder – fähig bin?“
„Yvo, ich habe nicht Deine Treue mir gegenüber in Frage gestellt. Ich sagte nur, dass Du noch viel lernen musst, bis Du andere begeistern und zur Loyalität inspirieren kannst.“
Yvo blieb stur: „Gebt mir die Frau. Ich werde Euch beweisen, dass ich eine Beziehung zu ihr aufbauen kann.“ Als Mauro den Kopf schüttelte, wechselte Yvo den Tonfall: „Euch kann es doch egal sein. Ihr habt längst entschieden, dass Ihr sie nicht wollt. Als mein Spielzeug kann sie wenigsten noch ein bisschen leben.“
Mauro blies hörbar die Luft aus. Das war der falsche Weg. Er durfte nicht nachgeben. „Nein, Yvo. Du blockierst Deine künftige Entwicklung. Du nimmst Dir Chancen, wenn Du Dich an dieses Geschöpf bindest. Was würde Dein Lehrer Torren dazu sagen?“
Das war eine Vorlage für Yvo: „Fürst Torren hat bereits vorgefühlt, wie ich zur Verehelichung mit einer Dame aus seinem Hause stehe. Er stellt mir zwei zur Auswahl. Nun wähle ich eben die Dritte.“
Nun gingen Mauro die Argumente aus. „Na schön“, sagte er resigniert. „Regle das mit den Kojotim. Zu Deinem Besten ist es gewiss nicht. Ich hoffe, meine Nachgiebigkeit führt nicht direkt ins Desaster.“
„Das liegt in meiner Verantwortung“, sagte Yvo barsch. „Ihr werdet gewiss keine Klagen hören.“
Bevor Mauro den Raum verließ, packte er Pado unsanft am Kragen und schüttelte ihn: „Ihr habt mir diese Situation eingebrockt. Glaubt nicht, dass ich das jemals vergesse.“
Mit dem König der Kojotim wurden Pado und Yvo rasch einig. Der war zufrieden, seine Tochter mit Mauros Bruder zu verbinden. Er verlangte jedoch, dass sie Yvos Hauptfrau werden solle. Den Status einer Konkubine akzeptierte er unter diesen Umständen nicht.
Yvo willigte ein.
Zum Schluss der Unterredung sprach der Kojotim ein ernstes Wort mit Pado. „Ihr seid ein gescheiter Mann, Pado, doch Ihr seid nicht klug.“
„Was stelle ich mir darunter vor?“ fragte Pado pikiert.
„Euer König ist von seinem Wesen her ein Krieger. Ein Krieger beurteilt die Dinge danach, ob sie ihm zur Erreichung seiner Ziele nützlich sind. Der äußerliche Prunk hat für ihn keinen Nutzen. Er braucht ihn nicht, um seine Untertanen zu beeindrucken. Gerade dass er darauf verzichten kann, zeigt, wie mächtig er ist. Alle anderen Fürsten wissen das, und verhalten sich entsprechend. Bloß Ihr ärgert ihn andauernd damit, dass Ihr ihn zu übertrumpfen versucht. Mich habt Ihr verleitet, es ebenfalls zu tun. Das ist dumm.“
Pado überlegte. „Ich fürchte, Eure Einschätzung trifft zu. Doch er sollte mehr…“
Der Herrscher der Kojotim bedeutete Pado, dass er irrte. „Er ist der König, er setzt die Regeln. Und Ihr tut gut darin, in seinem Kopf zu denken, statt ihn in Eure Richtung verändern zu wollen. Da ist noch etwas, was Ihr überseht.“
„Was?“ wollte Pado wissen.
„Der König ist starrsinnig. Er hasst Veränderungen und hat gerne alles unter Kontrolle. Was er einmal besitzt, gibt er nicht wieder her. Deshalb wählt er sorgfältig aus, was er zu sich lässt. Ihr dürft ihm niemals ein Geschenk anbieten, das er sich nicht gewünscht hat. Wenn er sagt, >Eure Tochter gefällt mir, sie könnte mein Herz erfreuen<, dann dürft Ihr sie ihm geben. Bringt Ihr sie ungebeten in sein Haus, wirft er Euch hinaus, selbst wenn sie ihm gefällt.“
„Wie unsinnig. Er könnte viel mehr Frauen haben….“
Der Kojotim schüttelte den Kopf: „Ihr begreift ihn immer noch nicht. Da steht Euch wohl die eigene Gier im Wege. Während er das Zuviel fürchtet, das seiner Kontrolle entgleiten könnte, ist es für Euch nie genug.“
Einige Tage später fand unter Anteilnahme der ganzen Stadt Yvos Hochzeit mit der Kojotim-Prinzessin statt. Als das festlich geschmückte Brautpaar vom Tempel zum Königspalast zog, war die Straße so voller Menschen, dass das stolze Sechser-Gespann kaum vorankam. Die Mandrilanen verrenkten sich die Hälse, um einen Blick auf die kaffeebraune Schönheit zu werfen, die von jenseits der Meerenge gekommen war. Sie jubelten auch Yvo zu, denn er war der einzige Mandrilane in Mauros Entourage.
Am Abend gab Mauro zu Ehren seines Halbbruders im Palast ein großes Fest. Sigrun sollte ihn begleiten. Er wusste wohl, dass hinter seinem Rücken über ihren Zustand getuschelt wurde. Nun wollte er allen zeigen, dass es ihr gut ging und er nach wie vor zu ihr stand.
Mauro saß bereits auf seinem steinernen Thronsessel, als Zeldis, Ortrud und die beiden Hofdamen Sigrun durch das Spalier der Gäste zu ihm geleiteten. Mauros Augen folgten jedem ihrer Schritte. Sie kam so leichtfüßig auf ihn zu wie in Moringart, als sie seine Tischdame gewesen war. Sigrun wirkte auf ihn nicht weniger schön und begehrenswert wie damals. Die Schwangerschaft hatte gerade erst begonnen, ihre Formen zu runden. Die Übelkeit war vorbei. Ihre Haut war rosig. Aus dem hochgesteckten Haar hatte sich, wie so oft, eine widerspenstige Strähne gelöst und fiel in ihr hübsches Gesicht. Vor Mauro angekommen machte Sigrun einen formvollendeten Knicks. Er ging ihr entgegen und führte sie zu ihrem Sitz. Die anderen Damen gruppierten sich rund um sie.
Einen Augenblick lang gab Mauro sich der Illusion hin, dass alles beim Alten wäre. Dann hörte er, wie Sigrun halblaut zu Ortrud sagte: "Huch ist das aufregend. So viele Menschen habe ich noch nie gesehen. Warum spielt hier keine Musik? Ich möchte tanzen!" Dabei klatschte sie erwartungsfroh in die Hände.
"Ihr müsst Euch noch ein wenig gedulden", sagte Mauro von seinem Thronsessel herab. "Wir erwarten den Einmarsch des Brautpaares."
Sigrun sah ihn mit dem Blick eines schuldbewussten Schulmädchens an, das vom Lehrer gemaßregelt worden war, und schwieg.
Wenig später schritten Yvo und seine Gemahlin durch das Spalier. Yvo und seine junge Gattin absolvierten ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen mit Eleganz und Würde. Streng nach Rangfolge gratulierten erst die Würdenträger. Es dauerte geraume Zeit, bis sie sich durch den ganzen Saal zum Thron vorgearbeitet hatten, wo Mauro und der Brautvater sie erwarteten.
Sigrun saß unbeteiligt daneben und schaute sichtlich gelangweilt zu. Dann machte sie wieder unpassende Bemerkungen, oder kicherte mit Ortrud.
Als der offizielle Teil vorüber war, feierte Sigrun so ausgelassen, als ob es kein Morgen gäbe. Hinter dem Rücken ihrer Hofdamen sprach sie dem Weine zu und warf kokette Blicke nach den Männern in ihrer Nähe. Ihr Vetter Wolfram gab sich redlich Mühe, Sigrun davon abzuhalten, einen Skandal zu verursachen.
Ortrud war so fröhlich wie nie zuvor. Es machte ihr Spaß, Sigrun dabei zu beobachten, wie sie sich über die Konvention hinwegsetzte und die steifen Furukim brüskierte. Noch mehr genoss sie es, Mauro leiden zu sehen.
Mauro musste einsehen, dass es keine gute Idee gewesen war, Sigrun zum Fest mitzunehmen. Statt den Gerüchten entgegenzutreten, hatte sie allen gezeigt, dass sie nicht bei klarem Verstande war. Nicht nur die Furukim, sondern auch die auswärtigen Gäste tuschelten nun hinter Mauros Rücken. Mauro absolvierte ein paar Pflichttänze mit Sigrun. Als ihr das nicht reichte, ging sie zu Shui hin und forderte ihn auf, mit ihr weiterzutanzen.
Irgendwann wurde es Mauro zu bunt. Er ging zu ihr auf die Tanzfläche und schnappte Sigrun beim Arm: „Lass Shui in Ruhe. Willst Du Deine Hofdame Ana unglücklich machen?" schnauzte er sie an und bedeutete dem erleichterten Shui, dass er gehen konnte. "Schluss für heute!"
Sigrun fing an zu zetern: „Ich mag noch nicht heim. Wer seid Ihr, dass Ihr es wagt, mir so gründlich den Spaß zu verderben?"
"Ich bin Euer Gatte und der Vater des Kindes, das Ihr unter dem Herzen tragt. Wenn Ihr schon auf mich keine Rücksicht nehmt, dann wenigstens auf die Kleine!" schimpfte Mauro.
Sigrun wurde ganz kleinlaut: "Entschuldigung. Mir war nicht klar, dass Ihr mein Gatte seid."
Oben in ihrer Kammer warf Sigrun sich auf ihr Bett und fing zu weinen an. Anklagend sagte sie zu Mauro: "Was meint Ihr, wie es mir geht? Wolfram sagt, dass mir etliche Jahre an Erinnerung fehlen. Ich weiß nicht, wo ich hier bin und wer die Menschen sind, die mich umgeben. Ihr behauptet, Ihr seid mein Gatte - und doch seid Ihr ein Fremder für mich. Wahrscheinlich hatte ich auch so eine schöne Hochzeit - bloß weiß ich nichts mehr davon. Könnt Ihr Euch vorstellen, wie orientierungslos und ausgeliefert ich mich fühle?"
Mauro ging zu ihr hin und strich ihr begütigend über die Schulter: "Verzeiht mir, wenn ich grob zu Euch war. In meiner Verzweiflung vergaß ich, wie schwer das alles für Euch ist. Lasst uns versuchen, diese Prüfung gemeinsam durchzustehen. Vielleicht kann ich helfen, Eure Erinnerung wiederzufinden. Was wisst Ihr über mich?"
Sigrun wischte sich die Tränen fort und setzte sich auf: „Ihr seid der Erain Maur, der dunkle Herrscher von Furukiya. Ihr seid nicht mehr jung - und Ihr seht grimmig aus. Kein Wunder, dass die halbe Welt vor Euch zittert. Nun trage ich also Euer Kind - und darf weder reiten noch ausgelassen tanzen", fügte sie trotzig hinzu.
"Wisst Ihr noch, wie Ihr hierher kamt?" fragte Mauro weiter
"Ich wurde an Euch verheiratet, weil Ihr das Rigland erobert habt. Ich nehme an, mein Vater gab mich an Euch, als Preis für den Frieden. Wolfram sagt, es geht unserem Volke gut. Das lohnt die Qual, dass ich nun fern der Heimat leben muss", resümierte Sigrun.
"Ihr habt selbst entschieden, mir zu folgen - als freie, stolze Almanin", korrigierte Mauro sie. "Euer Vater ist längst tot."
"Habt Ihr ihn umgebracht?" wollte Sigrun wissen.
Mauro schluckte. "Nein, Sigrun, das habe ich nicht getan." Er wollte ihr erzählen, unter welchen Umständen sie einander kennen gelernt hatten. Dann entschied er, dass es besser für sie wäre, nicht alles zu wissen. Zu viele schlimme Erlebnisse, zu viele Bedrohungen würden auf sie einstürmen. Mit einem schmerzlichen Blick sagte er: „Wir haben einander geliebt. Es war eine ganz große Liebe. Eine, über die die Barden Lieder sangen. Mögen die Götter uns gnädig sein, dass wir eines Tages wieder zu einander finden!"
Nach dem Gespräch mit Sigrun floh Mauro zu Hamon. Er ließ sich auf den Fellen nieder, die vor dem flackernden Kamin lagen und starrte wortlos in die Flammen. Hamon rückte für sich einen Stuhl zurecht und legte Mauro die Hand auf die Schulter. So saßen sie schweigend eine ganze Weile beisammen.
Schließlich fragte Mauro: „Wie ist es Dir in letzter Zeit ergangen?“ Das war keine ernsthafte Frage, denn die beiden Freunde sahen einander regelmäßig. Erst vor wenigen Wochen hatte Mauro auf der Heimreise von Tolego die Nacht auf Hamons Landgut verbracht und sich persönlich davon überzeugt, dass alles zum Besten stand. Wie es schien, wollte er bloß die beruhigende Stimme des Freundes hören.
Hamon erzählte, dass er das Landgut, das Mauro ihm übereignet hatte, sehr genoss. Der Sommer an der frischen Luft hatte seiner Gesundheit gut getan. Das regelmäßige Hin- und Herreiten machte ihn beweglicher und fitter. Sein Leibesumfang war etwas abgeschmolzen, was seine drei Frauen zu schätzen wussten. Das Amt des Kämmerers, das Hamon für seinen Freund und König versah, machte ihm immer noch Freude. Hamon betonte, dass er sich Mauros Kritik zu Herzen genommen hatte, und seinen üppigen Lebensstil inzwischen ausschließlich aus eigenen Mitteln finanzierte.
Nach einer Weile hielt Hamon im Erzählen inne. Er merkte wohl, dass Mauro mit seinen Gedanken weit weg war. „Willst Du darüber reden?“ fragte er den Freund.
Mauro machte eine resignierte Geste.
„Siehst Du eine Möglichkeit, Barrens Zauber zu durchbrechen?“ fragte Hamon.
„Barren kennt mich ziemlich gut. Er ließ mir keinen sanften Weg, um seinen Zauber auszuhebeln. Wenn ich die Gedächtnisblockade mit Gewalt durchbreche, wird Sigrun nicht überleben. Fast denke ich, ich könnte ihren Tod leichter ertragen als das Zusammenleben mit einem Kind, das aussieht wie meine geliebte Frau!“
„Ich weiß nicht, was ich Dir empfehlen soll“, sagte Hamon betrübt. „Du hast gewiss auch andere Zauberer gefragt…“
Mauro bejahte: „Ich habe mit Schlobart gesprochen, und mit Barad. Selbst Elfenkönigin Galbereth wusste mir keinen Rat.“
Hamon nickte: „Das hatte ich befürchtet. Du bist der mit Abstand mächtigste Zauberer hier. Wer sollte helfen, wenn Du nicht mehr weiter weißt?“
Mauro presste die Lippen zusammen und schwieg. Seine Gedanken gingen zurück zu den guten Zeiten mit Sigrun: „Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir geheiratet. Ich war der glücklichste Mensch auf Erden, und mein Tagwerk ging mir leicht von der Hand. Nun ist es mit einem Mal vorbei.“ Nach einer Weile fügte er empört hinzu: „Ich nahm Barren in die Pflicht, Sigrun nicht anzurühren. Ich stellte sie unter den Schutz des großen Furuk – und dennoch habe ich sie verloren. Das ist unfassbar für mich!“
„Wie es scheint, hat Barren die Abmachung unterlaufen. Ihr das Gedächtnis zu rauben hat ihm sein Herr offenbar nicht verboten. In der Auslegung sind die höheren Wesen mitunter spitzfindig.“
„Erst kürzlich sprach ich mit Hohepriesterin Suza darüber, wie verwundbar wir Menschen doch sind. An wem immer mein Herz hängt, Barren kann ihn mir nehmen. Ich fühle selbst, wie jeder Verlust die Dunkelheit in mir nährt. Schon jetzt wage ich kaum mehr zu zeigen, welcher Mensch mir nahe steht. Irgendwann kommt auch für mich der Punkt, wo ich jede Hoffnung begrabe.“ Mauro grub den Kopf in die Hände und klagte: „Wie soll ich die bevorstehenden Prüfungen bestehen, ohne Sigruns sanfte Kraft an meiner Seite? Schon einmal wähnte ich sie auf immer verloren. Schon einmal war ich mutlos und verzweifelt ohne sie. Nun ist sie zwar da – und mir dennoch entzogen. Ist damit mein Schicksal besiegelt? Wollen die Götter mein Scheitern?“
„Noch ist nicht aller Tage Abend“, versuchte Hamon ihn zu trösten. „Vielleicht findest Du einen Weg, den Zauber zu durchbrechen. Vielleicht sind die Götter Dir gnädig, und sie wird gesund.“
„Vielleicht…“ wiederholte Mauro niedergeschlagen. „Meine Mission steht wieder einmal auf Messers Schneide. Wo vor kurzem noch Licht und Zuversicht war, sehe ich nur noch dunkle Bedrohung. Nachts schlafe ich kaum. Die Alpträume sind schlimm wie lange nicht mehr. Die Geister des Labyrinths bedängen mich wieder. Hohepriesterin Suza hat Recht: ich brauche ein Wunder – einen Akt göttlicher Gnade – sonst laufe ich Gefahr, genau wie mein Vater zu scheitern.“
Kapitel 2: Der Kampf mit der Vergangenheit
Kayla kam regelmäßig ins Gildehaus. Sie spürte, dass ihre Anwesenheit Feren wohl tat, auch wenn er das so deutlich nicht sagen würde. Langsam wuchs das gegenseitige Verständnis.
Kayla machte von Anfang an klar, dass sie als freie Zauberin an Ferens Seite weilte. Sie würde kommen und gehen, wie es ihr beliebte. An erster Stelle kamen ihre Verpflichtungen gegenüber Malfar, dann ihre Aufgaben für die Gilde. Feren würde sich mit dem Rest ihrer Aufmerksamkeit begnügen müssen. Allen darüber hinausgehenden Ansprüchen erteilte sie von vorne herein eine unmissverständliche Absage.
Feren akzeptierte widerspruchslos ihre Bedingungen. Da er nicht die Kraft aufbrachte, sie fortzuschicken, blieb ihm keine andere Wahl. Er wusste selbst, dass er im Rang nicht hoch genug war, um sie zu freien. In seiner Situation konnte er froh sein, dass sie überhaupt an seiner Seite war. So ließ er sie im Wesentlichen gewähren. Wenn er allerdings von etwas überzeugt war, dann stand er wie ein Fels. Kayla lernte, wann sie sein >nein< akzeptieren musste und wann noch Spielraum für Verhandlungen war. In ihm fand sie einen geduldigen Zuhörer, dem sie am Abend nach einem langen, harten Tag ihr Herz ausschütten konnte. Er gab ihr Rat oder nahm sie einfach in die Arme, wo Worte nichts nützten.
So bereitwillig er sich in ihr Leben involvieren ließ, so wenig gewährte er ihr Zutritt zu dem seinen. Kayla spürte, dass Feren ihr nicht rückhaltlos vertraute. Wichtige Bereiche seines Lebens waren ihr verschlossen.
Das stachelte ihren Ehrgeiz an. Wie davor ihr Bruder Beor kämpfte Kayla mit allen Mitteln um Zugang zu Ferens Welt. Es entsprach ihrem inneren Streben, den Mann, den sie gewählt hatte, mit Haut und Haaren zu besitzen. Allerdings wusste sie instinktiv, dass sie sich den Zutritt nicht erzwingen durfte. Vertrauen aufzubauen brauchte Zeit. Bei Feren brauchte es viel Zeit.
Feren kam nicht auf die Beine. Kaylas Nähe und Zärtlichkeit gaben ihm Kraft, die Nacht zu bestehen – Kraft, die ihm der Tag wieder raubte. Obwohl seine Pflegerinnen genau darauf achteten, was er zu sich nahm, erholten sich seine Reserven nicht. Er konnte gar nicht so viel essen, wie er im Kampf gegen Ängste, quälende Erinnerungen und in der mühsamen Aufarbeitung der Vergangenheit verbrauchte. Zwei Wochen nach dem Angriff der Daughûi war er immer noch zu schwach, um sein Lager zu verlassen.
Ida half ihm nach Kräften. Feren leugnete nicht, dass er zu Essen aufhörte, sobald er unter Druck geriet. Meist waren die Phasen kurz und er erholte sich rasch wieder, doch angesichts der Schwere seiner Verletzungen war seine derzeitige Appetitlosigkeit problematisch. Auf der Suche nach der Ursache für seine paradoxen Essgewohnheiten war Ida mit ihm den ganzen Weg zurückgegangen, bis nach Orod Ithryn, wo er sich vor den Augen der Lehrer beinahe zu Tode gehungert hatte. Das war seine Art, gegen die andauernde Überforderung zu protestieren. Ida machte ihm bewusst, welch destruktive Mechanismen er aufgebaut hatte, um dem für ihn unerträglichen Druck auszuweichen, und wie das trügerische Gefühl der Macht über Leben und Tod ihn immer wieder in den gleichen Abgrund trieb.
Allmählich brach Ida seinen Eispanzer auf und brachte ihn mit den ursprünglichen Gefühlen in Kontakt, sodass er Wut wieder als Wut und Trauer als Trauer empfinden konnte. Die Konfrontation mit den eigenen Emotionen und mit dem alten, aufgestauten Schmerz brachte Feren an seine Grenzen. Seine Schutzmechanismen brachen unter dem Ansturm zusammen und es beutelte ihn arg.
Ida versuchte, sorgsam zu dosieren, um Feren nicht zu viel abzuverlangen. Doch an irgendeinem Punkt geriet der Prozess außer Kontrolle. Feren begann, das Tempo selbst zu bestimmen. Was für ihn machbar war, tat er ohne Zögern – und ohne Rücksicht auf Verluste. Die Pausen, die Ida ihm verordnete, nutzte er, um weitere Türen aufzustoßen.
Feren wusste, dass er nicht erst in Orod Ithryn mit der Nahrungsverweigerung begonnen hatte. Der Junge, der dort ankam, beherrschte das Spiel schon perfekt. Die Wurzeln lagen viel weiter zurück. Feren ließ die gewalttätigen Szenen seiner Kindheit an sich vorüberziehen. In dem mit ultimativer Härte ausgetragenen Geschlechterkampf seiner Eltern hatten die zahlreichen Kinder keinen Platz. Feren wurde überhaupt ignoriert, denn er war nicht seines Vaters Sohn. Er war ein Kind der Riten – was immer das bei einer Frau wie Mallen hieß, die sich jedem an den Hals warf, mit dem sie den verhassten Gatten und ihren unnachgiebigen Vater Torren ärgern konnte. Als er zum ersten Mal von daheim ausriss, war er kaum älter als sein Sohn Beor jetzt. Als das Ausreißen zur Gewohnheit wurde, verbannte Torren den widerspenstigen Enkel nach Orod Ithryn. Er war ein gutes Jahr jünger als alle anderen und sehr klein. Orod Ithryn war für ihn eine harte Schule, doch er war dort immer noch lieber als daheim. Als man ihm eines Tages die Nachricht vom gewaltsamen Tod seiner Mutter überbrachte, berührte ihn das kein bisschen.
Mit den Techniken, die Ida ihn gelehrt hatte, ging Feren den Weg bis zum bitteren Anfang, bis zu seiner Geburt. Er fühlte den initialen Schrecken, als er das Licht der Welt erblickte und sich noch nicht zu orientieren wusste, sehnte sich nach dem gewohnten Herzschlag der Mutter. Er wartete darauf, dass sie ihn in die Arme nahm, fühlte die Sehnsucht nach Geborgenheit. Doch nichts dergleichen geschah. Eine Amme trug ihn fort und legte ihn einer fremden Frau in den Arm. Feren hörte nicht, was gesprochen wurde, doch er fühlte deutlich den Wahrnehmungszauber, den die Amme entfaltete: >Das hier ist Dein Sohn, Mallen. Du wirst von jetzt an für ihn sorgen.< Wie in Trance wiederholte Mallen, was ihr die Amme einsuggerierte. Dann bot sie dem Säugling die Brust. Feren wies sie zurück. Der säuerliche Geruch ihrer Haut ekelte ihn an. Er wollte zu seiner Mutter. Er stemmte sich mit beiden Fäusten gegen die Fremde, schrie wie am Spieß und verweigerte die dargebotene Nahrung.
Vor Ferens Augen brachen die Eckpfeiler seiner Existenz in sich zusammen. Lauter Lügen. Alles, was sein Großvater jemals über ihn behauptet hatte, womit er seine Strenge gegenüber dem Enkel zu begründen pflegte, war falsch. Mallen, die Feren Zeit seines Lebens verabscheut hatte und deren Namen er trug, war nicht seine Mutter.
Eine Kette von Erinnerungen spulte sich in Ferens Gedächtnis ab. Was immer er gesagt oder getan hatte, sein Großvater ergriff grundsätzlich gegen ihn Partei. Niemals ließ er zu, dass Feren auf irgendetwas stolz sein durfte. Er verhielt sich hart und ungerecht. Wann immer Feren dagegen aufbegehrte, erinnerte er ihn an seine zweifelhafte Herkunft, und dass Feren sich schämen müsse, überhaupt auf der Welt zu sein. So stellte er sicher, dass Feren niemals ohne Not erwähnte, dass er Torrens Enkel war.
Warum hatte Torren ihm das angetan? Wusste er nicht, dass Mallen ein fremdes Kind aufziehen sollte? Der aufgestaute Hass gegen seinen Großvater brach sich Bahn. Er suchte nach einem Ventil, wollte alles kurz und klein schlagen, doch seine Kraft reichte nicht einmal dazu, aufzustehen. Die Wut drohte ihn zu ersticken. Er versuchte zu schreien, doch er brachte nur gurgelnde Laute hervor.
Als Ida wenig später nach Feren sah, ging sein Atem schwer und er zitterte am ganzen Körper. „Feren, was hast Du gemacht?“ rief sie ihn erschrocken an. „Du hast Dich weiter vorgewagt, obwohl ich Dich bat, es nicht zu tun. Was hast Du gesehen? Was hat Dich so erschreckt?“
„Ich bin bis an den Ursprung zurückgegangen. Jetzt weiß ich, woher das Muster kommt. Es begann gleich nach der Geburt.“ Mehr wollte, mehr konnte er Ida nicht sagen.
„Feren, bitte, Du darfst nicht alle Wunden gleichzeitig aufreißen. Ich komme nicht nach mit dem Verbinden!“
Feren brauchte ziemlich lange, bis er sich wieder unter Kontrolle hatte. Dann sagte er: „Seit meiner Kindheit begleitet mich das vage Gefühl, dass etwas grundlegend falsch ist. Jetzt weiß ich es. Bloß das >warum< kann ich nicht verstehen.“
Ferens Sohn
Kayla hatte Segur Ferens Nachricht überbracht. Sie bat ihn in Ferens Namen um Vergebung und drängte ihn, Feren im Gildehaus aufzusuchen. Segur ließ nicht durchblicken, wie nahe er Feren stand und wie sehr der Streit ihn belastete. Er sagte nur: „Sobald meine Pflichten es zulassen, werde ich nach ihm sehen.“
Das tat er dann auch.
Sie gingen hinaus ins Freie und suchten sich einen ruhigen, sonnenbeschienenen Platz an der Stallwand. Feren berichtete über seine Fortschritte. Seine Wunden waren abgetrocknet und das gesplitterte Schlüsselbein tadellos verheilt. Den Schwertarm konnte er allerdings immer noch nicht heben und seine Finger waren taub. Die Lagerstatt verließ er jetzt immer öfter. Im Freien war er heute zum ersten Mal. Alles in allem erweckte Feren einen optimistischen Eindruck.
Segur erzählte vom Krönungsfest und von der feierlichen Lehensvergabe. Nôrden hatte für Tolego den Schlüssel von Burg Amrun in Empfang genommen und war kurz darauf abgereist. Leor wurde Fürst von Dares und Passar. Sein Schwager Bertram erhielt die reiche Provinz Neylar im Norden der Hauptstadt. Damit herrschte Bertram als erster Almane über eine Kernland-Provinz mit gemischt mandrilanisch-almanischer Bevölkerung. Segur verschwieg Feren, dass Fürst Leor mit Mauros Einverständnis Hanok zum Stadtvogt von Passar bestellt hatte. Eine weitere Überraschung hatte es gegeben: Fürst Val d’Ossar, der nie Forderungen an Mauro gestellt hatte, bekam die ehemalige Alicando-Burg Sevas. Damit waren die alteingesessenen Clans hoch zufrieden.
In Anschluss an die Lehensvergabe war die Verleihung der Herzogswürde an Alagos von Aglar und Segurs Beförderung zum Togwed der königlichen Garde erfolgt. Segur erzählte ausführlich von seiner neuen Aufgabe.
Später kam Segur auf das Leben im Stadthaus der Tolegos zu sprechen. Am Anfang mochten sie das riesige Haus überhaupt nicht und trauerten dem Torwächterhäuschen nach. Inzwischen hatte sich die Familie eingelebt. Die zahlreichen Tolego-Beamten, die in Mauros Verwaltung ihren unauffälligen Dienst versahen, merkten rasch, dass mit Mehan und Segur ein neuer Geist eingezogen war. Das Klima im Haus verbesserte sich. Segur respektierte die Leistung der Männer und Mehan drangsalierte die rangniedrigeren Frauen nicht. Schon nach kurzer Zeit wusste Segur, dass er sich nicht nur auf seine Männer, sondern auch auf die alteingesessenen Tolegos stützen konnte. Er war entschlossen, die ihm zustehende Position innerhalb des Clans auszufüllen.
„Wirst Du zurückkommen?“ fragte er Feren.
Feren schüttelte den Kopf. „Nein, daran denke ich nicht. Doch ich respektiere Deine Entscheidung für den Clan. Es hat mich erstaunt, denn Du warst viel weiter weg als ich. Verzeih mir die harten Worte von neulich. Wenn Du Deine Zukunft im Clan siehst, musst Du den eingeschlagenen Weg zu Ende gehen.“
Segur nickte nur. Nach ihrem Streit hatte er lange mit Greven über Feren geredet. Greven war überzeugt, dass Feren zurückkehren würde und riet Segur, nicht zu drängen. Deshalb wechselte Segur das Thema. Er berichtete detailliert über die Sicherheitsvorkehrungen, die man im Haus der Tolegos für den kleinen Beor getroffen hatte. Zaydhan, eine alte Zauberin aus Torrens Sippe, hatte ein wachsames Auge auf den kostbaren Nachwuchs. Sie galt als mächtig genug, um Barren in seine Schranken zu weisen. „Willst Du Deinen Sohn nicht zu Dir kommen lassen?“ fragte Segur. „Er hat mitbekommen, dass Du verwundet bist und fragt nach Dir.“
„Nein“, rief Feren entsetzt. Dann fügte er leise hinzu: „Je weniger Leute von Beors Existenz wissen, desto besser. Barren hat gedroht, dass er mir jederzeit nehmen kann, was ich am meisten liebe. Er tötete Stork. Meinen Sohn darf er nicht finden!“
„Ich habe von eurer Begegnung gehört“, erwiderte Segur. „Trotzdem kannst Du Deinen Sohn nicht auf alle Zeit vor der Welt verstecken! Er wächst heran und hat ein Anrecht, den ihm gebührenden Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Den Weg dorthin musst Du ihm ebnen. Er braucht seinen Vater. Es wird Zeit, dass Du Dich dieser Verantwortung stellst.“
„Lass uns nicht schon wieder darüber streiten. Beor braucht vor allem einen Platz, wo er in Sicherheit ist. Das Stadthaus der Tolegos ist in Ordnung“, beeilte sich Feren zu sagen. „Hier hingegen gehen zu viele Fremde ein und aus. Ich möchte auch nicht, dass Kayla von ihm weiß. Sie kommt regelmäßig hierher. Wir teilen die Kammer….“
Segur sah Feren fassungslos an: „Soll das heißen, sie ist Deine Gefährtin und Du hast ihr nichts von Deinem Sohn erzählt? Ihr wart in Vedar bei den Feuern und teilt offen das Lager. Das erfüllt alle Voraussetzungen einer einvernehmlichen Verbindung. Ihre Kinder werden Deine legitimen Nachfahren sein. Sie hat ein Recht, etwas über Deine Vergangenheit zu erfahren!“
Feren sah das nicht so klar. Er wollte in Ruhe nachdenken. Doch das änderte nichts an dem beklemmenden Gefühl. „Beor von Malfar war ihr Bruder“, erinnerte er Segur. „Ich weiß, wozu ein Malfarin fähig ist.“
„Du wirst nicht umhin kommen, Gildemeister Goswin die Existenz Deines Sohnes kundzutun. Es ist entschieden, dass alle Zauberer sich im Gildebuch registrieren lassen müssen. Dein Sohn hat unverkennbar Dein Talent geerbt. Du solltest ihn möglichst bald deklarieren. Vergiss nicht, dass er damit Anspruch auf den Schutz der Gilde erwirbt!“
„Nein“, sagte Feren entschieden. „Mir wäre am liebsten, wenn keiner außer uns beiden von seiner Existenz wüsste!“
Allmählich wurde Segur wütend: „Hast Du Dir jemals Gedanken darüber gemacht, was es für uns bedeutet, das Kind eines Freundes zu hüten? Nicht genug, dass Du mächtige Feinde hast. Kinder in diesem Alter sind anfällig für Unfälle oder Krankheiten. Mehan lebt beständig in der Angst, Dir eines Tages eingestehen zu müssen, dass sie als Hüterin versagt hat.“ Nicht dass das wirklich ein Problem war. Mehan hatte die Gabe, die Dinge so zu nehmen, wie sie kamen. Sie machte sich nicht im Voraus Sorgen. Doch Segur fand es an der Zeit, die Augen des Freundes mal auf seine Probleme zu lenken.
Segurs harte Worte schlugen in Ferens Bewusstsein ein wie Meteoriten. Seine Gedanken gingen zurück zu Stork. Und zu Greven, dem er eingestehen musste, dass er Stork nicht zu schützen vermochte. Sein Magen krampfte sich zusammen, wenn er an die bevorstehende Unterredung dachte. Es war ihm nicht bewusst gewesen, dass er seinen Freunden eine ähnlich schwere Last aufgebürdet hatte. Segur musste ihm vielleicht eines Tages beibringen, dass Beor ein Leid geschehen war. Dann fühlte er sich genau so elend wie Feren jetzt. Das durfte nicht sein. Er hatte kein Recht, das von seinen Freunden zu verlangen. Wie konnte er so gedankenlos sein. Alle Farbe war aus seinem Gesicht gewichen. Die Fassade der Selbstdisziplin brach zusammen. Er schwankte.
Segur streckte die Hände aus, um Feren zu stützen. Doch Feren wich aus.
„Das darf nicht wahr sein! Hast Du jetzt auch schon Angst vor mir?“ Segur machte noch einen Schritt in Ferens Richtung und begann, mental Druck auf ihn aufzubauen. Normalerweise müsste jetzt die Gegenreaktion kommen. Segur erhöhte den Druck und wartete auf einen Befreiungsschlag, doch nichts kam. Da begriff er: Feren war nicht nur körperlich schwer angeschlagen, er verfügte auch nicht mehr über die mentalen Kräfte, sich zu schützen. Das war für einen Zauberer fatal.
Feren wich zurück, bis er nicht mehr weiter konnte. Jetzt war der größere Segur direkt über ihm. Er stütze sich mit einem Arm gegen die Stallwand und zwang Feren, ihm in die Augen zu blicken. Ungehindert konnte er in das Innerste der Auster vordringen: schutzloses weißes Fleisch, über das wie ein Gitter die Narben liefen, die das Leben geschlagen hatte. Ein Gitter aus Angst und Verzweiflung, dem kein Entkommen war. Wie immer, wenn er einen kurzen Blick in Ferens Innerstes erhaschte, erschrak Segur. Noch nie hatte er einen Weg gefunden, den Freund in den Momenten seiner höchsten Not zu erreichen. Segur kannte das Gefühl von Hilflosigkeit, das ihn jetzt überkam. Feren, der immer da gewesen war, wenn er ihn brauchte, ließ selbst keine Hilfe zu.
Diesmal war Segur zu wütend, um aufzugeben. Er fühlte sich betrogen. Den ganzen Nachmittag hatten sie über Belanglosigkeiten gesprochen. Feren hatte den Eindruck erweckt, als hätte er seine Situation im Griff. So wie er es immer getan hatte. Die von ihm vermittelte Sicherheit hatte die Truppe über viele schwierige Situationen hinweggebracht. Segur sollte Feren gut genug kennen, um hinter die Fassade zu sehen. Niemand wusste besser als er, welch eiserne Disziplin Feren aufbringen konnte, wenn er nicht wollte, dass die anderen seine Mutlosigkeit und seine Zweifel sahen. Trotzdem war er wieder darauf hereingefallen, hatte wieder geglaubt, was der Freund ihm zeigen wollte. Nun musste er erkennen, dass Feren gar nichts im Griff hatte. Er stand, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Rücken zur Wand.
Segur musste sich sammeln. Er gab den Blick frei und Feren drehte mit einer Geste der Erschöpfung den Kopf zur Seite. Sein Blick ging ins Leere. Segur trat ein wenig zurück und betrachtete die entkräftete Figur, die Halt suchend an der Stallwand lehnte.
Feren suchte nach Worten. „Segur, verzeih mir. Ich hatte nicht darüber nachgedacht, was ich euch mit Beor aufbürde. Ich werde eine Lösung finden. Lass mir bitte ein bisschen Zeit.“
Dieses Ergebnis hatte Segur nicht gewollt. „Feren, Du drehst Dich im Kreis“, sagte er leise. „Viel zu lange hast Du eine große Bürde getragen. Du warst schon erschöpft, bevor das mit den Daughûi passiert ist. Das war nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Jetzt bist Du völlig am Boden. Bitte, lass mich Dir helfen!“
„Es geht mir schon besser...“ Feren fröstelte und zog seinen Mantel enger um sich: „Ich bin einfach müde.“
„Das glaube ich Dir nicht. Dir fehlt die innere Kraft, die Verbindung zu Deiner Mitte. Sobald ich ein wenig Druck auf Dich ausübe, brichst Du zusammen. So kannst Du nicht weitermachen.“
„Ich arbeite daran. Ich mache regelmäßig meine Konzentrations- und Meditationsübungen.“
„Das ist ganz großartig“, spottete Segur. „Und wie fühlst Du Dich dabei?“
Feren machte eine vage Geste. Es kam ihm hart an, die nötige Konsequenz aufzubringen. Meist war er so erschöpft, dass er dabei einschlief.
„Ist Dir vielleicht schon aufgefallen, dass alle diese Techniken Dir eine Menge Härte und Disziplin abverlangen? Damit treibst Du Dich immer weiter in den Kreisel hinein. Je verzweifelter Du nach Halt suchst, desto weniger wirst Du ihn finden.“
„Was soll ich denn tun?“
„Wie wäre es, wenn Du gar nichts tust?“ schlug Segur vor. „Lass einfach los und erlaube Dir, zur Ruhe zu kommen. Denk erst über den nächsten Schritt nach, wenn Du wieder festen Boden unter den Füßen hast.“ Segur war kein Gelehrter, doch er war verbunden mit der Weisheit seiner Seele, die ihm die richtigen Worte gab. Er wusste, dass das Gesagte Sinn machte. Nun schob er seinen Arm unter Ferens gesunde Schulter und geleitete ihn vorsichtig zurück ins Haus. Er spürte, wie Feren sich darauf einließ und sein Gewicht auf ihn stützte. „Das ist schon besser. Freunde hat man, damit sie einen stützen, wenn es nicht mehr weitergeht!“ brummte Segur.
Schon fast beim Haus angekommen sagte Segur: „Mach Dir wegen Beor keine Sorgen. Dein Sohn ist bei uns gut aufgehoben. Mehan und ich sind nicht die einzigen, die auf ihn Acht geben. Aber sei Dir bitte auch bewusst, dass Beor aus dem Alter heraus ist, wo man ihn verstecken konnte. Einen Fünfjährigen bindest Du nicht an. Und verlang nicht von ihm, dass er seine Herkunft leugnen soll, selbst wenn es scheinbar seinem Schutz dient. Er ist sehr stolz darauf, Dein Sohn zu sein!“
Feren blieb stehen und sah Segur erschrocken an. Die Herkunft verleugnen zu seinem Schutz – der Hinweis war bei ihm angekommen. „Das werde ich von Beor niemals verlangen. Es reicht, dass ich es mein Leben lang tun musste!“
Segur sah Feren überrascht an. Da war also eine weitere tiefe Wunde, die Feren stets vor ihm verborgen hatte. Er antwortete mit einem Kopfschütteln: „Im Moment scheint aller Schmerz aufzubrechen, den Du über Jahrzehnte in Dir vergraben hast. Es war zu erwarten. Du weißt, ich war vor kurzen auch mitten drinnen in diesem Prozess. Es braucht Kraft, und es braucht Zeit.“
Feren nickte und versuchte ein Lächeln. „Es geht schon, Segur .... Du musst jetzt reiten. Es ist schon spät.“
Segur antwortete mit einem Kopfschütteln: „Wenn Du nur wieder für andere denken kannst. Schau bitte auf Dich. Wenn ich wiederkomme, möchte ich Dich in einem besseren Zustand vorfinden!“ Bevor er vom Hofe ritt, drehte er sich noch einmal um: „Ich wünsche mir von Dir ein bisschen mehr Vertrauen!“
Daheim gab Segur Mehan einen detaillierten Bericht über alles, was er erfahren hatte. Mehan war erstaunt, dass Kayla Ferens Gefährtin war. Die beiden hätte sie nicht miteinander in Verbindung gebracht. Doch wo die Liebe so hinfällt....
Segur berichtete, dass seine Männer Feren besuchen wollten. Er hielt es für keine gute Idee. „Er wird nicht wollen, dass sie ihn in diesem Zustand sehen. Und ich möchte nicht, dass er wieder einen Kraftakt vollbringt, um ihnen vorzumachen, dass alles in Ordnung ist. Heute war er völlig am Boden. Ich musste ihn nur antippen, und er ist zusammengeklappt.“ Zuletzt erfuhr sie von Ferens Sorgen wegen Beor. Sie schalt Segur, dass er dieses Thema überhaupt aufgebracht hatte. „Er hat so viel für uns getan. Diese kleine Gefälligkeit darf er wohl erwarten!“ Darüber waren sie sich einig. Doch Mehan würde Beor in Zukunft nicht mehr mitnehmen, wenn sie ins Gildehaus ging.
Während sie sich unterhielten, achteten sie nicht darauf, dass ein Dreikäsehoch mithörte, der durchaus der Meinung war, dass ihn diese Dinge etwas angingen.
Schon am nächsten Tag würde sich bewahrheiten, dass man fünfjährige Knaben nicht so leicht verstecken kann.
Kayla hatte beschlossen, dass es an der Zeit war, Mehan einen Besuch abzustatten. Die Verbindung zwischen Segur und Feren machte den Kontakt plötzlich viel interessanter. So wappnete sie sich mit Interesse für den Säugling und rief sich ins Gedächtnis, was jede junge Mutter in dieser Situation zu hören wünscht. Natürlich würde es das schönste Kind auf Erden sein, selbst wenn es wie eine Kaulquappe aussah. Und Ähnlichkeiten mit den Eltern musste man auch herbeireden, selbst wenn man der Meinung war, dass sich manche Leute besser nicht vermehrt hätten. Nun ja, auf Segur und Mehan traf das nicht zu. Kayla hatte durchaus bemerkt, dass Segur ein attraktiver Mann war. „Beeoah“ war ihnen auch ganz gut gelungen. Ihr Vater hatte herzlich gelacht, als sie ihm erzählte, was die Sommerländer aus dem stolzen Namen ihres Bruders machten.
Kayla hatte das Stadthaus der Tolegos noch nie von innen gesehen. Es lag am Ende der großen Prachtstraße, nahe der Arena. Da die Tolegos seit mehreren Generationen zum Königsclan gehörten, war ihr Haus besonders prächtig. Schon die Fassadengestaltung und die Befestigung des Tores zeugten von ihrer Macht. Das Haus hatte drei statt der sonst üblichen zwei Stockwerke und weitläufige Wirtschaftsgebäude im hinteren Bereich.
Kayla hatte ihren Besuch nicht angekündigt. Sie teilte den Wächtern knapp ihr Anliegen mit und ritt dann in den Hof hinein.
Als hätte sie ihn gerufen, stand Beor plötzlich vor ihr. Da seine Kinderfrau nicht dabei war, konnte er sie mit unverhohlenem Interesse anstarren, ohne dass ihn jemand zur Ordnung rief. Sie warf ihm die Zügel ihres Pferdes hin: „Hier, halt das!“ Er fing sie geschickt auf und hielt das Pferd still, während sie abstieg. „Schaust Du nach, ob ich nicht doch eine Elfe bin?“ fragte sie ihn belustigt.
„Du bist hübsch“ konstatierte er.
„Danke für die Blumen, junger Mann. Sind wir einander eigentlich schon vorgestellt worden?“ Sie meinte, dass er nicht mehr klein genug war, um sie zu duzen.
Er nahm Haltung an, wie er es von den Wachsoldaten kannte, und stellte sich förmlich vor: „Ich bin Beor, Sohn des Feren.“
Jetzt musste sich Kayla am Riemen reißen, um nicht erstaunt auszurufen. Jahrelange Übung ermöglichten ihr, nur kurz eine Braue hochzuziehen und ebenso förmlich zu antworten: „Ich bin Kayla, Tochter des Goswin von Malfar.“ Sie machte einen artigen Knicks. Beor verbeugte sich, wie es sich gehörte. Man hatte ihm offenbar Manieren beigebracht.
Kayla erinnerte sich, dass Feren in einem Nebensatz erwähnte, dass er schon einen Sohn gezeugt hatte. Sie hatte das mehr als Hinweis auf seine Fruchtbarkeit gedeutet und nicht weiter nachgefragt. Doch hier handelte es sich offensichtlich um einen offiziellen Sohn, der seinen Namen trug. Hatte er ihr das bewusst verschwiegen? War etwa Mehan früher einmal Ferens Gefährtin gewesen? Kayla spürte sofort die Eifersucht in sich hochsteigen. Mehan war eine attraktive Frau. Was verband die beiden, dass sie es ihr nicht offen sagen konnten? War es das gewesen, worüber Feren und Segur sich gezankt hatten? Zu Beor sagte sie nur: „Ich kenne Deinen Vater gut.“
„Ich weiß“ antwortete Beor, der sie weiterhin prüfend ansah. „Du bist seine Gefährtin.“
Jetzt musste Kayla schlucken. Der Junge wusste mehr über sie als umgekehrt. „Warum habe ich Dich noch nie bei Deinem Vater im Gildehaus gesehen?“
Ein Schatten huschte über Beors Gesicht. Er sagte nichts. Kayla wunderte sich, dass ihr die Ähnlichkeit mit Feren nicht sofort aufgefallen war. Offenbar vererbten sich nicht nur Gesichtszüge, sondern auch Verhaltensweisen. Beor neigte wie Feren dazu, unangenehme Fragen einfach im Raum stehen zu lassen, als gingen sie ihn nichts an. Bei Feren lohnte es sich manchmal, ein wenig zuzuwarten. Sie schwieg und wartete, ob noch etwas kam.
Beor grub mit der Zehenspitze im Sand. „Ich darf nicht zu ihm“, sagte er traurig.
„Das glaube ich nicht. Wie kommst Du darauf?“
„Er ist krank und muss viel schlafen. Ich darf nicht zu ihm, weil er sich sonst anstrengen muss, für mich wach zu bleiben.“ Das waren Beors Schlussfolgerungen aus Segurs Worten von gestern.
Kayla verstand. Feren wollte offenbar nicht, dass sein Sohn ihn schwach und elend sah. Das konnte sie nicht gut heißen: „Ich meine, er könnte ruhig zulassen, dass Du seinen Schlaf bewachst.“
Beor schüttelte betrübt den Kopf: „Es ist meine Schuld. Ich war böse auf ihn, weil er eingeschlafen ist, als ich mit ihm spielen wollte.“ Ferens letzte Versuche, seinem Sohn Aufmerksamkeit zu schenken, waren gründlich schief gegangen. Sobald der Junge begonnen hatte, ihm etwas zu erzählen, war er eingeschlafen. Beor hatte sich bitter beklagt, dass er einen Vater, der immer nur schlief, nicht haben wollte. Feren war geknickt abgezogen und hatte sich vorgenommen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Wenig später war er verunglückt.
„Bitte“, sagte Beor flehentlich zu Kayla, „Sag ihm, dass ich nie mehr böse sein werde! Ich verspreche, dass ich ihn schlafen lasse! Ich will nur sehen, ob es ihm gut geht!“ Beor, dem der Tod schon die Mutter genommen hatte, litt große Angst, dass auch sein Vater ihn alleine zurücklassen könnte. Trotz der kleinen Missverständnisse gab es ein inniges Band zwischen den beiden.
Kayla fühlte die Not des Jungen. Sie überlegte einen Moment. „Weißt Du, Beor, wenn Du von etwas wirklich überzeugt bist, solltest Du darum kämpfen. Du hast ein Recht darauf, Deinen Vater zu sehen. Du bist ein Zauberer, Du brauchst Dich nicht einfach abweisen zu lassen!“
Beor sah sie erstaunt an. Auf diese Idee war er nicht gekommen. „Zeigst Du mir, was ich tun kann?“
„Gut, ich zeige es Dir. Doch ich möchte nicht, dass Dein Vater erfährt, von wem Du das gelernt hast. Sonst ist er wahrscheinlich auf uns beide böse! Verspricht Du mir, ihm nicht zu erzählen, dass wir uns getroffen haben?“ Sie war nicht überzeugt davon, dass das funktioniert, doch sie wollte Feren nicht die Entscheidung abnehmen, sich gegenüber ihr zu seinem Sohn zu bekennen.
„Versprochen“, wiederholte der Junge mit großer Ernsthaftigkeit.
„Ich verlasse mich auf Dich.“ Kayla machte das Zauberzeichen für >Einverständnis des Schweigens<.
Beor kannte das Zeichen nicht, doch als er es wiederholte, begriff er intuitiv seine Bedeutung. Dann zeigte Kayla ihm, wie man den Willen argloser Menschen in die gewünschte Richtung lenken konnte. Beor war mit Feuereifer bei der Sache. Er konnte es kaum erwarten, seine neuen Fertigkeiten auszuprobieren.
Als Khären von Amrun sich mit seinen Leuten bereit machte, Feren zu besuchen, probierte Beor aus, was Kayla ihn gelehrt hatte. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen und stellte sich den Reitern in den Weg. Beor erklärte Khären, dass er seinen Vater zu sehen wünschte. Während er sprach, konzentrierte er sich darauf, Khärens Willen in die gewünschte Richtung zu lenken.
Khären merkte wohl, dass der Junge ihn zu manipulieren versuchte. Doch die Entschlossenheit, die hinter dem Versuch steckte, überzeugte ihn. Man würde Beor nicht auf Dauer von einem Besuch bei seinem Vater abhalten können. Lieber nahm Khären ihn jetzt gleich mit, als dass Beor andere, gefährlichere Wege fand.
Feren saß entspannt in der herbstlichen Sonne, als die Amrunim in den Hof des Gildehauses einritten. Er freute sich über ihren Besuch und winkte ihnen zu. Beor winkte fröhlich zurück. Da erst bemerkte Feren seinen Sohn und erschrak. Aufgebracht machte er Khären Vorwürfe: „Ich habe doch ausdrücklich verboten, Beor hierher zu bringen. Es ist zu riskant…“
Khären bürstete Ferens Unmut ab: „Er wäre auf jeden Fall gekommen. Hätte ich warten sollen, bis er sich zu Fuß auf den Weg macht? Ihr hättet Euch an seiner Stelle gewiss nicht abweisen lassen.“
Feren schluckte. Khärens Hinweis war berechtigt. Er ging auf Beor zu und streckte seine Arme aus, um den Jungen vom Pferd zu heben. Mitten in der Bewegung hielt Feren inne. Ein Stechen im Rücken erinnerte ihn, dass er Beors Gewicht nicht tragen konnte. Er musste sich gedulden, bis Khären den Jungen absetzte. Dann ging er in die Hocke, um seinen Sohn in die Arme zu schließen.
Beor näherte sich ganz vorsichtig. Ihm war bewusst, dass er dem Vater nicht wehtun durfte. Feren drückte ihn mit seinem gesunden Arm an sich. Er konnte nicht verhindern, dass seine Augen feucht wurden. Eine Träne lief über seine Wange. Er versuchte, den verletzten Arm zu nutzen, um sie fortzuwischen, doch die Motorik gehorchte nicht. Der rechte Arm fühlte sich fremd und taub an. Auch wenn er eine leichte Besserung festzustellen glaubte, war er noch weit davon entfernt, seine Finger zu gebrauchen.
So kam ihm Beor zu Hilfe. Mit seinen kleinen Fingern nahm er die Träne fort.
Im Aufstehen erfasste Feren ein leichter Schwindel. Er stützte sich einige Sekunden auf Beors Schulter ab, bis sich sein Körper auf die Lageveränderung eingestellt hatte. Beor fühlte bewusst sein Gewicht und streckte sich ein wenig. In seiner Erinnerung blieb haften, dass er schon stark genug war, seinem Vater Unterstützung zu geben.
Das Bewahren von Geheimnissen lag in Beors Erbanlagen. Er erwähnte Kayla mit keinem Wort, als später alle am prasselnden Kamin zusammen saßen. Eine Magd versorgte die Gäste mit Tee und Honiggebäck. Beor machte es sich wohlig an seines Vaters Seite bequem. Es beruhigte ihn ungemein, Ferens Körpers zu spüren. Endlich konnte er sich persönlich davon überzeugen, dass sein Vater am Leben war. Seine kleine Hand suchte Ferens Herzschlag und fühlte, wie dieser innerlich fror. Beor begann, Feren Energie zu übertragen.
Feren gebot ihm sofort Einhalt: „Lass das, das tut Dir nicht gut!“ Er schickte sich an, Beors Hand wegzuschieben. Dann besann er sich eines Besseren. Er legte Beors Hand an sein Herz zurück und sagte zu ihm: „Nimm nicht Deine eigene Energie, sondern hole sie Dir von den Sternen. Dort ist reichlich Energie vorhanden. Lass sie durch Deinen Körper fließen, bis in Deine Hände. So ist es gut. Achte stets darauf, wie Du Dich fühlst. Der, der gibt, muss seine Grenzen kennen. Wenn es Dich anstrengt, hörst Du auf. In Ordnung?“
Beor nickte. Feren schloss die Augen und fühlte den warmen Strom. Tatsächlich ging es ihm danach besser. Er schaffte es sogar, mit Khärens Männern zu scherzen.
Als sie sich einige Zeit später wieder verabschiedeten, sagte Feren zu Beor: „Schön, dass Du da warst. Danke, dass Du mir Kraft gegeben hast. Ich fühle mich stärker!“
Khären von Amrun konnte nicht an sich halten: „Warum habt Ihr ihn nicht schon viel früher zu Euch geholt?“
Feren sah ihn nachdenklich an. Dann beantwortete er die Frage: „Ich habe mächtige Feinde. Je weniger Leute wissen, wo er lebt und wie er aussieht, desto besser. Leider lässt er sich nicht mehr so einfach verstecken.“ Er sagte das nicht ohne Stolz. Segurs Worte klangen in seinem Ohr. Jetzt sah er ein, dass der Freund Recht gehabt hatte.
„Macht Euren Frieden mit dem Clan“, drängte Khären. „Das Stadthaus ist geräumig und bestens gesichert. Dort könnt Ihr mit Eurem Sohn beisammen sein. Nôrden hat sich nicht mehr blicken lassen, seit Segur das Haus übernommen hat. Dafür lebt Großmeister Greven jetzt bei uns. Wir sind wieder eine starke Gemeinschaft. Es ist höchste Zeit, dass Ihr zurückkehrt.“
Greven. Ferens Blick verlor sich in der Ferne. Er hatte es noch nicht fertig gebracht, mit Greven persönlich über den Tod seines Sohnes Stork zu sprechen. Die Verantwortung lastete schwer auf seinen Schultern. Was sollte er Greven sagen? Dem Vater, der nun auch den dritten hoffnungsvollen Sohn begraben musste? Wieder stellte Feren sich die Frage, ob er Storks Tod hätte verhindern können. Er kannte die Antwort auswendig. Sobald er entschied, ihn mit in den Tunnel zu nehmen, konnte er ihn nicht mehr schützen. Der Fehler lag weiter zurück: Feren hätte Stork niemals in seine Gruppe berufen und damit ihrer beider Schicksal verbinden dürfen. Zu Khären sagte er nur: „Ich werde kommen und mit Großmeister Greven sprechen, sobald ich ein wenig kräftiger bin.“
Beor war sehr zufrieden mit sich. Er hatte etwas Wichtiges gelernt: Es lohnte sich, für das zu kämpfen, was einem richtig erschien. Er hatte keinen Zweifel daran, dass er seinem Vater eine große Unterstützung gewesen war. Die Erwachsenen wussten auch nicht immer, was ihnen gut tat. Er würde in Zukunft genau prüfen, welchen ihrer Anordnungen er nachkommen musste und welchen nicht.
Ein potenzieller Schwiegersohn
Einige Tage später besuchte Gildemeister Malfarin das Gildehaus von Orod Ithryn. Mit Genugtuung stellte er fest, dass das Haus die Erwartungen erfüllte: es war zu einem wichtigen Umschlagplatz für Informationen geworden. Nun galt es, dafür zu sorgen, dass Erfahrungsaustausch und Fortbildung nicht zu kurz kamen. Die jungen Kombat-Zauberer sollten die Begegnung mit den alten Routiniers, die im Gildehaus zu Gast verweilten, zur Weiterentwicklung ihrer Techniken nutzen. Im Moment war jeder so mit Aufgaben eingedeckt, dass die Muße für fachlichen Austausch fehlte.
Natürlich interessierte Malfarin sich nicht ausschließlich für das Haus. Er wollte endlich Feren näher kennen lernen, mit dem seine Tochter zusammen war. Inzwischen hatte er mit vielen Leuten gesprochen, die Feren kannten, doch er hatte noch kein klares Bild von ihm.
Für Feren kam es nicht unerwartet, dass Malfarin ihn um eine Unterredung unter vier Augen bat. Der Fürst hatte ein Recht darauf, dass Feren ihm über die Beziehung zu seiner Tochter Rede und Antwort stand. Feren hatte mehrere Varianten der Argumentation durchgespielt, er war gut vorbereitet. Als erstes würde er das Donnerwetter über sich ergehen lassen, bevor er irgendetwas sagte.
Malfarin bot ihm Platz an. Das war gut. Feren fühlte sich noch nicht so kräftig, die Unterredung im wahrsten Sinne des Wortes durchzustehen.
Der Fürst musterte sein Gegenüber eine Weile schweigend. Er versuchte, die unterschiedlichen Einschätzungen, die er aus verschiedenen Quellen über Feren erhalten hatte, in Einklang zu bringen. „Wer ist Feren?“
Feren nahm sich mit der Antwort Zeit. Wer war er wirklich? Diese Frage würde er mit Malfarin gewiss nicht diskutieren. So entschied er sich für Torrens offizielle Version: „Ich bin ein Kind der Riten. Meinen Vater kenne ich nicht. Meine Mutter Mallen war Fürst Torrens Tochter.“
„Ich kannte Mallen. Eure Mutter hat ihre Riten selbst definiert, und ihr Ehemann hat das Ergebnis ihres lockeren Lebenswandels nicht anerkannt“, sagte Goswin schärfer als nötig. „Gebe ich die Situation treffend wieder?“
Feren nickte: „So hat man es mir gesagt.“
„Dennoch habt Ihr es gewagt, meine Tochter Kayla zu verführen?“ fragte Malfarin.
Feren hatte mit dem Donnerwetter gerechnet und brachte die vorbereitete Antwort: „Es gibt nichts, was ich zur Rechtfertigung vorbringen könnte, nichts, worum ich Euch bitte. Eure Tochter kam zu mir als Geschenk, als Gunst in schwerer Stunde. Was das Schicksal gibt, kann es jederzeit wieder nehmen.“
„Wie soll das weiter gehen?“
Ferens Augen nahmen den typischen verlorenen Ausdruck an, den er benutzte, um keine Angriffsfläche zu bieten: „Ich habe kein Recht, sie zu freien. Nichts was ich bin und besitze, kann in Eurer Welt bestehen. Solange sie bleiben will, ist sie mir willkommen.“
Die Antwort befriedigte Malfarin nicht. Wenn man seine Herkunft so interpretierte, wie Malfarin es in seiner Einleitung bewusst getan hatte, war Ferens Entgegnung korrekt. Doch das war nur eine Lesart der Wahrheit. Feren war mittlerweile einer der mächtigsten Zauberer des Tolego-Clans. Das zählte mehr als Mallens Fehltritt. Unter diesem Blickwinkel war Kayla durchaus eine angemessene Partie für Fürst Torrens Enkel. Doch das schien Feren nicht bewusst zu sein.
„Kayla ist frei in der Wahl ihrer Partner, seit sie zu einem der großen Rituale berufen wurde. Ich nehme an, das ist Euch bekannt. Als Vater interessiert mich allerdings, wer der Mann ist, der vielleicht einmal meinen Enkel zeugen wird“, sagte Malfarin.
„Was wollt Ihr wissen?“ fragte Feren defensiv.
„Ihr wurdet in Orod Ithryn ausgebildet. Für einen Tolego ist das ungewöhnlich. Warum schickte Euer Großvater Euch dorthin?“ wollte Malfarin wissen.
Feren antwortete: „Es war zur Strafe. Ich bin wiederholt von daheim ausgerissen. Auf den Straßen von Tolego gefiel es mir besser als im Haus meines Stiefvaters. Irgendwann hatte mein Großvater es satt, nach mir zu suchen.“
Aha. Es war also Fürst Torrens Entscheidung gewesen. Aber warum nach Orod Ithryn? Zu jener Zeit hatte König Curon gerade mit dem alten Hexenmeister gebrochen und seine eigene Zauberschule gegründet. Torren hatte sich dem Wunsch des Königs gebeugt und seinen Nachwuchs dort hingeschickt. Warum hatte er bei Feren eine Ausnahme gemacht? „Bis vor kurzem wusste hier kaum jemand, dass Ihr Fürst Torrens Enkel seid. In Orod Ithryn habt Ihr das vermutlich auch geheim gehalten“, testete Goswin weiter.
Feren bestätigte: „Ich sprach mit niemandem über meine Herkunft. Es war schon schwierig, aus Furukiya zu stammen. Ein Tolego hätte gar keine Freunde gehabt.“
Malfarin registrierte, dass Feren früh lernen musste, nichts von sich preiszugeben. Aus dem hintersten Winkel seines exzellenten Gedächtnisses tauchte das Bild eines kleinen Jungens auf, der in eigenartiger Haltung mit dem Rücken zur Kaminwand kauerte. Er war sehr klein, sehr schüchtern und sehr verloren. Ängstlich bemüht, keinen Fehler zu machen. Nicht aufzufallen. Tapfer zu sein. „Vor vielen Jahren sah ich Euch in Malfar, wo sich die Schüler aus Furukiya für die gemeinsame Reise nach Orod Ithryn versammelten. Ihr wart jünger als die anderen, erheblich kleiner und etwas langsam. Keine guten Voraussetzungen, um zwischen Jungs wie Sedh und Mischa zu bestehen.“ Malfarin konnte sich vorstellen, was Feren durchgemacht hatte. Er war selbst einer von den Kleinen gewesen.
Feren antwortete nicht. Ein winziges Zucken im Augenwinkel zeigte Malfarin, dass er ins Schwarze getroffen hatte. So fragte er weiter: „Warum brachte man Euch so früh in eine so feindselige Umgebung? Was stellt ein neunjähriger Junge an, damit er eine solche Strafe verdient?“
Feren sah Malfarin prüfend an: „Ich habe einen Mann getötet.“
Malfarin wartete.
Schließlich fuhr Feren fort: „Er hatte mich an Armen und Beinen gefesselt und wollte mich verstümmeln, damit ich für ihn Betteln gehe. Ich rief heißes Wasser vom Herd und schickte es in sein Gesicht. Er konnte mich nicht mehr sehen. Dann befreite ich aus dem Herd das Feuer und hieß es, ihn zu umzingeln. Bald stand die ganze Hütte in Brand. Ich streifte meine Fesseln ab, schritt durch die Flammen und war frei. Den Unhold jedoch hielt ich mit einem Wahrnehmungszauber zurück, bis er elendiglich verbrannte.“