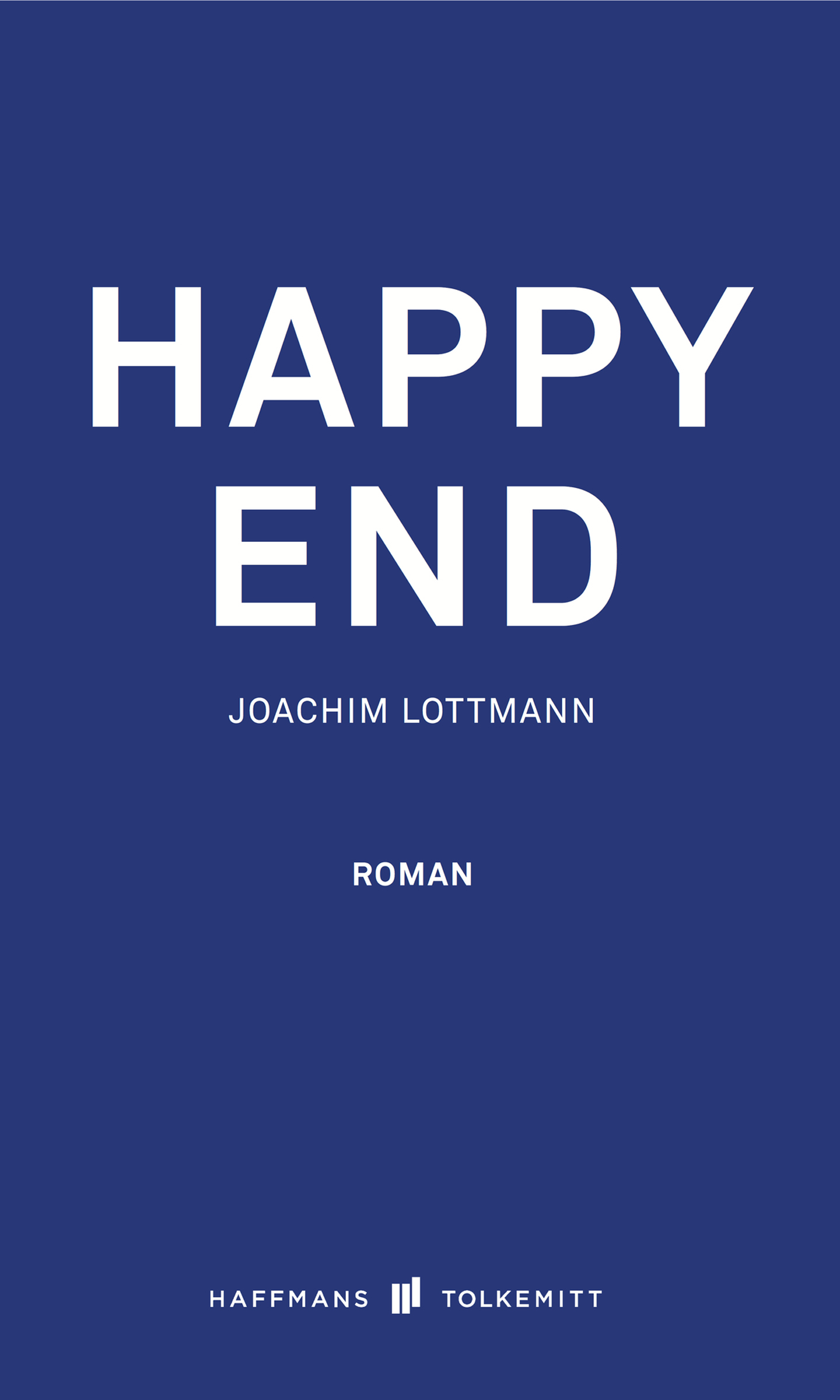8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Lottmanns Meisterstück und scharfsinnige Vision« Welt am Sonntag Schon Sokrates klagte über die Jugend in Athen, sie sei auch nicht mehr das, was sie früher einmal gewesen war. Derlei rentnerhaftes Genörgel ist Onkel Jolos Sache nicht. Joachim Lottmanns Ich-Erzähler feiert das Neue: Gestern ist doof, heute ist klasse, morgen ist Ecstasy. Das gilt auch für die jungen Leute um seinen Neffen Elias, eben die Jugend von heute. Der Ex-Jugendliche nimmt die Herausforderung an und lebt als erster Erwachsener unter ihnen, und damit im Herzen unserer Kultur, die eine Jugendkultur ist. Als unfreiwilliger Feldforscher lernt er die bislang unbekannte Ethnie »Jugend des dritten Jahrtausends« kennen. Onkel Jolo erforscht ihre Rituale, vergleicht diese neueste deutsche Jugend mit ihren Vorgängern, hört ihre Musik, besucht ihre Partys, nimmt ihre Drogen, schwärmt für ihre Frauen und versucht unter Einsatz seines Lebens, diese Herrscher von morgen zu verstehen. Die Jugend von heute ist der Roman des beginnenden 21. Jahrhunderts: ein Dokument der Zeit nach dem Börsen-Boom, der Medienblase, der Spaßgesellschaft und so, dazu eine rasend komische Achterbahnfahrt der Gefühle und das Protokoll eines hemmungslosen Höllentrips. »Wenn es ein Pendant zu Houellebecq in Deutschland gibt, ohne dessen gesamten Weltekel gleich mitzuschultern, dann ist es Lottmann. [...] Ein wundervolles Buch über das Nichts.« Der Spiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Joachim Lottmann
Die Jugend von heute
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Joachim Lottmann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Joachim Lottmann
Joachim Lottmann, geboren 1959 in Hamburg, studierte Theatergeschichte und Literaturwissenschaft in Hamburg. 1987 erschien sein literarisches Debüt »Mai, Juni, Juli«, das als erster Roman der deutschen Popliteratur gilt. Lottmanns zweiter Roman »Deutsche Einheit« kam 1999, seitdem folgten sechs weitere Bücher bei KiWi, am erfolgreichsten »Die Jugend von heute« (2004), »Der Geldkomplex« (2009) und »Endlich Kokain« (2014). 2010 nahm Lottmann den Wolfgang-Koeppen-Preis entgegen. Der Autor schreibt u. a. für taz, FAS und Welt und lebt in Wien.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Lottmanns Meisterstück und scharfsinnige Vision« Welt am Sonntag
Schon Sokrates klagte über die Jugend in Athen, sie sei auch nicht mehr das, was sie früher einmal gewesen war. Derlei rentnerhaftes Genörgel ist Onkel Jolos Sache nicht. Joachim Lottmanns Ich-Erzähler feiert das Neue: Gestern ist doof, heute ist klasse, morgen ist Ecstasy. Das gilt auch für die jungen Leute um seinen Neffen Elias, eben die Jugend von heute. Der Ex-Jugendliche nimmt die Herausforderung an und lebt als erster Erwachsener unter ihnen, und damit im Herzen unserer Kultur, die eine Jugendkultur ist. Als unfreiwilliger Feldforscher lernt er die bislang unbekannte Ethnie »Jugend des dritten Jahrtausends« kennen. Onkel Jolo erforscht ihre Rituale, vergleicht diese neueste deutsche Jugend mit ihren Vorgängern, hört ihre Musik, besucht ihre Partys, nimmt ihre Drogen, schwärmt für ihre Frauen und versucht unter Einsatz seines Lebens, diese Herrscher von morgen zu verstehen.
Die Jugend von heute ist der Roman des beginnenden 21. Jahrhunderts: ein Dokument der Zeit nach dem Börsen-Boom, der Medienblase, der Spaßgesellschaft und so, dazu eine rasend komische Achterbahnfahrt der Gefühle und das Protokoll eines hemmungslosen Höllentrips.
»Wenn es ein Pendant zu Houellebecq in Deutschland gibt, ohne dessen gesamten Weltekel gleich mitzuschultern, dann ist es Lottmann. […] Ein wundervolles Buch über das Nichts.« Der Spiegel
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Meinen Eltern
Wie sie die Straßen langgehen
So unaufhaltsam und schön
Cool in der Gegend rumstehen
Und jeder weiß, sie werden die
Herrscher der Welt sein.
Die meisten sind nur telefonisch erreichbar
Sie haben ihre Lektionen gelernt.
Punkt eins: Mit Geld weint es sich leichter, Baby
Und zweitens …
Aus: Blumfeld »Jugend von heute« (Jenseits von Jedem, WEA/ZickZack)
Ich wollte nie mehr schreiben und nur noch eines: weg! Weg von Berlin. Alles andere war egal.
Ich erzählte das natürlich ein bißchen herum, und so kamen ein paar Getreue, die mir das ausreden wollten. Sie verstanden nicht, daß es mir nicht um die Stadt, sondern um die Jugend ging. Die Jugend mochte mich nicht. Die Jugend war Berlin. Noch nie war ich so permanent so gnadenlos nicht geliebt worden wie da, dreieinhalb Jahre lang. Dreieinhalb Jahre lang keine Geliebte! Was für eine Folter.
Mein Neffe Elias wollte mich trotzdem zum Bleiben bewegen. Er fuhr im Nachtzug von München nach Berlin, um mir ins Gewissen zu reden. Es kostete 49 Euro, ich mußte ihm das Geld wiedergeben.
Er hatte in meinem ersten Berliner Jahr bei mir gewohnt und währenddessen Abitur gemacht, später zog er zu seinem Jugendfreund Lukas, und seine Cousine Hase übernahm sein Zimmer in der Kleinen Präsidentenstraße am Hackeschen Markt. Dann zog auch noch Hase weg, und ich war der Kälte Berlins allein ausgesetzt. Das war objektiv nicht überlebbar.
Ich fuhr zu Lukas, um meinen Neffen zu begrüßen. Er sah aus wie immer, wie ewige 18. Unter einem schwarzen Anzug trug er mehrere offene verschiedenfarbige Hemden.
»Jolo, du darfst hier nicht weggehen«, begann er nach einer Umarmung. Wie alle Berliner Jugendlichen hatte er die Hiphop-Gesten der schwarzen US-Amerikaner adaptiert. Leicht angeekelt erwiderte ich die diversen Bewegungen mit Hand, Faust und Kopf. Ich konnte das ganz gut, weil Elias es mir beigebracht hatte. Auch Hases Freunde waren alle Hiphopper, so daß ich nie aus der Übung kam. Nur hatte Hase vor allem weibliche Freunde, und die benahmen sich weniger affig.
»Eli, die Stadt ist pleite, und zwar schon lange und jetzt wirklich. Im Winter werden hier nicht mehr die U-Bahnen fahren! Rette sich, wer kann!«
Lukas wohnte in einer 30 Quadratmeter kleinen, äußerst gemütlich wirkenden Zweiraumwohnung im Bötzowviertel am Friedrichshain. Das Wort »gemütlich« war mir schon lange nicht mehr in den Sinn gekommen. Tausend winzige Gegenstände ließen eher an eine Mädchenwohnung denken, oder an einen Weihnachtsbasar, wegen der vielen kleinen Lampen. Natürlich lag schwerer Dopegeruch über all dem Zeug.
Vermutlich konnte Lukas den beginnenden Winter noch überleben, zumal er angeblich eine echte Freundin hatte, blond und normal, wie es hieß. Aber das stimmte schon nicht mehr. Elias deutete an, es gäbe da eine Art Freundschaftsverfall. Die Fotos der keineswegs schönen, aber sehr blonden Freundin vergilbten bereits an den Wänden wie alte Honeckerportraits. Sie selbst ward nicht mehr gesehen und rief auch nicht an. Die Mutter rief jetzt immer an. Elias nahm ab und verleugnete seinen Freund.
Lukas machte einen traurigen Eindruck. Er war einst aus München gekommen. Vielleicht war Elias auch angereist, um ihm zu helfen und nicht mir, oder beiden. Lukas war offenbar dem Dope verfallen. Elias hatte im Internet eine neue Droge entdeckt, die unser aller Leben, vor allem Lukas’, aber noch mehr meines, revolutionieren sollte. Denn auch ich hatte ein vergleichbares Problem: Obwohl ansonsten gesund, nahm ich fast täglich große Mengen Schmerztabletten.
Ich war in Berlin Migräniker geworden. Und schlafsüchtig. Vor lauter Lebensangst schlief ich jeden Tag 16 Stunden. Es war einfach anders nicht auszuhalten, dieses Leben ohne Liebe.
Nun erklärte Elias, die perfekte Droge für uns zu haben, die alles schlagartig ändern würde: Samsunit. Chemisch ausgedrückt Deltahydroxybutamol. Zum Beweis ging er mit uns ins Netz, und wir lasen ein paar Stunden lang – im Netz vergeht die Zeit schnell – alles, was es darüber gab. Es war zwar alles auf Englisch (ich kann kein Englisch), aber Elias ließ es per Mausklick ins Deutsche transformieren. Ich wußte damals noch gar nicht, daß das geht. Zwischendurch schlief Lukas ein, da er eine Überdosis Gras inhaliert hatte.
Elias sagte, mit der neuen Droge Samsunit könne ich in Berlin bleiben und die Fahne der Literatur hochhalten. Ich entgegnete mit tiefer Stimme, ich schriebe als nächstes ein sehr ernstes Buch über meine Eltern. Mein Motto sei »Nie wieder 44, nie wieder Pop-Autor«. Jenseits der 40 mache es keinen Spaß mehr, in Clubs abzuhängen.
Elias widersprach. Er glaubte einfach nicht an das Alter. Dafür glaubte er an das Geschlecht, was ich wiederum nicht tat. Geschlechtertrennung war für mich genauso ein Konstrukt wie Rassentrennung. Elis Glaube an den biologischen und gottgegebenen Unterschied zwischen Mann und Frau manifestierte sich in pausenlosen Subtheorien und Diskursen darüber, mit denen er auch früher meine Nerven zersägte. Er las sogar all die reaktionären Frauenzeitschriften von Elle bis Petra und BRAVO GIRL, weil da dieser Bullshit täglich ausgewalzt wurde.
In Deutschland war dieses »Die Frau an sich will ja …«-Geplapper besonders beliebt, da man viel Übung in der Zerteilung der Menschheit in biologisch solche und biologisch andere hatte.
Was wir über Samsunit lasen, war so verblüffend, daß es mich am Ende überzeugte, obwohl ich mein Leben lang geglaubt hatte, jede Droge koste ihren Preis. Künstlicher Hochgenuß und künstliche Leistung ergäben stets mit ihrem Gegenteil (den Erscheinungen des Entzugs) eine Summe von plus/minus null.
Doch nun las ich etwas ganz anderes. Es handele sich bei Samsunit um eine körpereigene Substanz ohne Suchtpotential, die antidepressiv und angstlösend wirke sowie euphorisierend und sozialisierend. Bei höherer Dosierung sei eine verstärkte, sexuell anregende Sensibilität zu verzeichnen. Es hilft zuverlässig gegen Schlafstörungen und gegen Suchtabhängigkeiten. Es wird innerhalb von zwei Stunden in der Leber metabolisiert, das heißt in vom Körper besser ausscheidbare Substanzen umgewandelt, und als Kohlenstoffdioxyd abgeatmet. Es ist dann im Körper nicht mehr nachweisbar. Mit einem Wort: Es mußte sich um einen wahren Zaubertrank handeln!
Wir lasen dann noch die Selbsterfahrungsberichte aus aller Welt dazu im Netz. Irre. Leider konnte man nur die Zutaten, aber nicht die komplett gemixte Substanz per Kreditkarte bestellen. Selber mixen wollten wir nicht. Also beschlossen wir, uns das fertige Medikament von einem Arzt unseres Vertrauens verschreiben zu lassen. Meinem Hausarzt Dr. Hartmann. Gelang dies, war auf der Stelle alles besser. Damit würde ich nicht als gebrochener Mann, sondern als Glücksritter die verhaßte Stadt verlassen. Ich konnte mich in Hochstimmung von allen sogenannten Freunden verabschieden:
»Seht her, ihr depressiven Flaschen, ich wechsle die Seiten, ich bin klüger als ihr, ich bin gut drauf, ich lache!«
Und dann würde ich das ernste Buch über die eigenen Eltern schreiben und damit als Autor gefeiert werden. Ich wußte: Ohne die Heiterkeitsdroge konnte ich keine fünf Seiten über meine langweiligen Eltern schreiben. Na ja, langweilig waren sie nicht, oder wenn doch, konnte ich das nur im Schreiben herauskriegen.
Dennoch bekam ich ein Gefühl von Schläfrigkeit, wenn ich an das Buch dachte. Ich war im Sommer erstmals seit 30 Jahren wieder an den Ort der Kindheit gefahren, nach Grottamare, mit meiner Kölner Freundin April.
Sie ist wunderbar, die April, sehr schlank, sehr aufrecht. Eine gewisse klare Schönheit. Der dunkle Typ, von der Haarfarbe her, mit schönen Konturen im Gesicht, markant. Ich fand schon, als wir uns kurz vor Grottamare wieder ineinander verliebten, daß sie ein äußerst ansprechendes Äußeres hatte. Wenn sie mich ansah, tat sie es intensiv, ohne aufdringlich zu sein. Sie war da, interessierte sich für die Sache, blieb aber auf eine vornehme Weise zurückhaltend. Und sie war wieder meine Freundin! Nach 15 Jahren! Es war kaum zu fassen. Auch andere verstanden es nicht, schon gar nicht, wer mich einmal mit meiner Nichte Hase gesehen hatte, oder eben mit Elias, mit all den quatschenden Teenies, mit denen ich mich auf erschreckende Weise gut verstand und sie so gar nicht.
Diese Kölner Freundin war wirklich eine ganz besonders alte Kölner Freundin, denn wir waren schon in den 80er Jahren, schon vor dem Mauerfall, der Zeitenwende und so weiter, ein Paar gewesen, sozusagen als blutjunge damalige Westdeutsche. Inzwischen waren wir ganz anders, keineswegs weiter, im Gegenteil.
Die Kölner Freundin hatte im Laufe ihres Lebens vieles verloren. Nie hätte ich sie wieder lieben können, wüßte ich nicht, wie sie als Mädchen gewesen war. Nämlich naiv, liebevoll und natürlich. In den Jahren, in denen sie in New York gelebt hatte, war sie zur typischen arroganten Manhattan-Lady verkommen, fast schon wie eine Singlefrau.
Gewiß, ich war auch nur noch eine Fratze meiner selbst, ein Gegenteil des schwerelosen Spaßvogels von einst. Aus Jean-Pierre Léod war Gerhart Polt geworden, und um so erstaunlicher war es, daß sie, die gnadenlos erfolgreiche Fotokünstlerin mit eigener Agentur, eigenem Pferd und eigener Eigentumswohnung, mich immer noch mochte, mich, der ich Destiny’s Child hörte und im »Sexy Stretch« Autogramme gab, um es milde auszudrücken.
Sie mußte in mir etwas sehen, das ich selbst nicht kannte und das dennoch dasein mußte. Pathetisch gesagt: meine wahre Größe. Sie war die einzige, die sie sah. Und was immer man gegen sie vorbringen konnte – sie war immer an meiner Seite, wenn ich sie brauchte. Sie las mir jeden Wunsch von den Augen ab, und natürlich fragte ich mich manchmal: Was soll ich denn mit einer Frau, die perfekt ist?! Und fuhr dann wieder ab, nach ein paar Tagen. Oder fuhr gar nicht erst nach Köln und blieb in der Hauptstadt.
Zu Geschäftsleuten konnte sie schneidend und hart sein, aber das störte mich nicht. Mich schien sie wirklich zu lieben. Sie verzieh mir jeden Fehler, ja, sie übersah die Fehler, lachte über meine Frauengeschichten, blieb verführerisch. So eine Frau mußte man erst einmal finden! Es dauerte, bis ich begriff, welchen Schatz ich da besaß, und wußte, daß ich nur mit ihr nach Grottamare hatte fahren können.
Dieser Ort der Kindheit, an den ich also zurückkehrte mitsamt der bezaubernden April, liegt an der italienischen Adriaküste auf der Höhe von Rom. 14 Jahre lang hintereinander hatten wir die großen Sommerferien dort verbracht, die Eltern und wir Kinder. Warum ich das erzähle? Ach ja, ich wollte sagen, daß ich meinen Roman »Eltern« nur mit Hilfe dieser Internetzauberdroge schreiben konnte.
Am nächsten Tag fuhr ich zu meinem Hausarzt. Die vielen Internetseiten hatte ich ausgedruckt bei mir. Der Mann, eigentlich ein großartiger Mensch und Donald-Judd-Fan, 46 Jahre alt, »blendend« gut aussehend, lachte unnötig laut auf, als er die wenigen eher bösen Stellen in dem Text fand: »Wie bei Ecstasy-Tabletten handelt es sich um eine höchst gefährliche Substanz, die zunächst euphorisiert, dann Übelkeit, Erbrechen und Atemnot bis zu schweren Atembeschwerden, Anfällen und Komazuständen erzeugt. Den Konsumenten, die meist aus der Technoszene stammen, droht ein totaler Horrortrip!«
Er las nicht weiter und gab mir die Seiten zurück. Er holte ein dickes Buch, schlug die Wirksubstanz nach.
»Das dürfen nur Narkoseärzte in speziellen Krankenhäusern bei besonderen Operationen verwenden, zum Beispiel bei der Trennung von siamesischen Zwillingen. Es eignet sich nur zur Vollnarkose in gefährlichen Situationen. Ich kann das als einfacher Arzt gar nicht verschreiben, und ein normaler Apotheker kann es nicht herausgeben. Er muß vorher eine eidesstattliche Erklärung in dreifacher Ausführung unterschreiben!«
Ich sagte:
»Herr Hartmann. Sie sind mein Hausarzt. Sie haben alle meine Bücher gelesen. Sie waren dabei, als die Tochter meines Bruders geboren wurde. Wir sind im selben Sportverein. Sie können mich nicht einfach so wegschicken, jetzt, da ich Berlin verlasse und Sie um Hilfe bitten muß.«
Als er das hörte, erschrak er. Die Nachricht, ich könne Berlin verlassen, löste bei ihm erkennbar Entsetzen aus. Diese Reaktion hatte ich in den Tagen davor schon öfter beobachtet. Diese ganzen anderen zugezogenen Nach-Wende-Berliner dachten dann eine Sekunde lang, und man konnte es auf ihrer Stirn lesen: »Wenn der Lohmer geht, gehen alle.« Sie versuchten sofort, mich zum Bleiben zu bewegen.
Auch Dr. Hartmann fand nun derlei Worte. Und er wurde plötzlich persönlich. Mit seiner Frau und den Kindern sei er gerade in New Mexico gewesen, habe sich das Land- Art-Objekt von Walter de Maria angesehen, das Lightning Field. Er wußte, daß meine Freundin Fotokünstlerin ist, und sparte nicht mit Namen und Hipnesszeichen. Und er wollte sich bis Dienstag umhören, was es mit dem Medikament auf sich habe. Dann maß er meinen Blutdruck. Ich war 20 Punkte besser als beim letzten Mal.
»Wie oft laufen Sie?« fragte er.
»Zweimal die Woche.«
»Laufen Sie dreimal die Woche.« Ich war entlassen.
Wieder bei Elias, schlug mir der Marihuanaqualm noch schwerer als sonst entgegen. Schon als 13jähriger hatte er gedampft. Mit 14 nahm er LSD, und zwar ziemlich viel, vielleicht 20 Trips in dem Jahr. Dann hörte er auf, weil er mit der Nachbarstochter ging, die zugleich seine Halbcousine war. Fünf Jahre ging das erstaunlich gut. Die beiden waren wie Geister, immer still und händchenhaltend und unzertrennlich, wie die Zwillinge in »Shining«. Nach dem Ende wechselte der Junge nach Berlin, ging dort zur Schule und wollte die geisterhafte Geliebte und das Haschisch vergessen, dem er nun wieder verfallen war.
In dem Berliner Jahr war er noch clean. In unserem Club Sexy Stretch, der sich im Erdgeschoß des Hauses in der Kleinen Präsidentenstraße befand, spielte er den Major- domus, jede Nacht bis zum Hellwerden, wobei er niemals trank oder rauchte. Tagsüber drehte er Filme fürs Fernsehen und machte nebenher sein Abitur, das natürlich in Berlin besonders leicht war.
Jetzt aber begegnete mir der alte Drogenfreak von einst, was mich deprimierte. Wir sprachen über Mädchen, Sex, Filme, nicht über Musik, außer über Snoop Dogg, den generationenübergreifenden Helden des Gangsta-Rap.
Es wurden noch drei oder vier Joints gebaut. Elias überredete Lukas, mit seiner blonden Freundin endlich Schluß zu machen. Es gab eine Nicole, mit der Lukas für den Abend verabredet war.
»Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß da dann gebohnert wird?« fragte Elias neutral.
»Na schon 80, 90 Prozent.«
Lukas sagte das gequält, aber nicht, weil ihm die Vorstellung nicht gefiel, sondern weil er sich mit der Entscheidung quälte, welcher Frau er den Vorzug geben sollte. Er war unentschlossen. Wenn er die Blonde abschob, bekam er dadurch nicht automatisch die andere. Es war zu befürchten, daß er dann auf lange Sicht genauso ein verwahrloster Single werden würde wie alle jungen Männer in der verfluchten Hauptstadt. Wir sprachen über die neue Droge. Mein Bericht fiel eher negativ aus. Ich sagte den beiden nicht, daß Dr. Hartmann noch etwas Hoffnung übriggelassen hatte.
»Wir müssen weiter darum kämpfen«, meinte Eli, »denn es ist zwar wohl ein langer Weg, aber wenn wir die Droge haben, ist sie mit Sicherheit besser als alles, was bisher in unserem Leben passiert ist.«
Ich besuchte Elias nun täglich. Das erinnerte mich an unsere gemeinsame Zeit Anfang des Jahrtausends, als Berlin noch boomte und hipper war als New York. Aber jetzt passierte nicht mehr viel. Meistens fand ich einen der Jungen schlafend vor, hingeworfen auf ein Sofa, das Gesicht in ein Kissen vergraben, leicht schwitzend in den Military-Jugendklamotten, während der andere aus dem Computer Stücke von St. Thomas, Blackalicious und Blonde Red downloadete. Sie hatten Hanfpflanzen im Fenster und diese fünfstöckigen Hi-Fi-Türme, von denen ich dachte, es gäbe sie nicht mehr. Aber in der Kifferjugend blieb die Zeit stehen, und Berlin wurde wieder zu jener alldeutschen Drogenhauptstadt, die es vor der Wende gewesen war.
Elias warf gequält den schlafenden Kopf hin und her, ohne die Augen aufzumachen. Lukas las die »Süddeutsche Zeitung«. Das kleine Fenster der unsanierten Altbau-Arbeiterwohnung ließ das ohnehin kaum vorhandene Novemberlicht nicht durch. Ich sagte laut, daß ich dieses finstere Stalingrad nun verlassen würde, noch heute. In meiner Wohnung befände sich nur noch ein gepackter Koffer.
Elias schnellte hoch. Sein Gesicht war rot vom Schlaf und sah etwas blöde aus. Aber er sagte etwas Interessantes.
»Wir fahren jetzt nach Tempelhof, damit du mal checkst, wie es in Deutschland außerhalb Berlins aussieht!«
Er meinte, Tempelhof sei wie Hamburg oder Frankfurt, wie Kiel, wie Hannover. Oder zumindest so, wie diese Städte schon bald sein würden: oll und überaltert, ohne Jugend, wirtschaftlich am Boden.
Wir fuhren wirklich hin.
»Guck sie dir an, die verbockten Gesichter!« rief er aus, als wir den Flughafen schon vor uns sahen. Den Flughafen Tempelhof, der wenige Monate später auch noch geschlossen werden sollte. Ich fuhr das Auto auf den Bürgersteig, stellte den Motor ab. Eine 50jährige wurde dabei unschön abgedrängt. Die Ausdruckslosigkeit wich nicht aus ihrem ausgelöschten Blick. Was hatte sie noch zu erwarten? Sie hatte fertig, wie alle hier. Elias hielt seine kleine Rede, deretwegen er mich besucht hatte:
»Die Deutschen sind das unglücklichste Volk der Welt, total vergreist, kraftlos, visionslos … die Stimmung ist doch exakt so wie unmittelbar vor Hitlers Machtergreifung: völlig im Eimer. Aber es kommt kein Hitler mehr …«
Innerhalb Deutschlands ließe es sich nur noch in Teilen Berlins aushalten, wo noch junge Menschen seien. Ich sah aus dem Autofenster. Die vorbeiziehende Schar verbrannter Existenzen erinnerte mich an die endlosen Trecks sudetendeutscher Flüchtlinge bei Kriegsende. Selbst die deutschen Kriegsgefangenen in alten Wochenschauen wirkten noch lustiger als diese Gestalten hier. Kein einziger trug noch ein anständiges Kleidungsstück, einen Stoffmantel, einen Anzug. Überall diese Jogginghosen-Wendeverlierer aus Frankfurt/Oder, wie Roger Willemsen sie beschrieb. Alle über 30 hatten tiefe Ringe unter den Augen. Was nahmen die bloß für Gifte zu sich?
Ich hatte einmal gelesen, daß über die Hälfte aller Deutschen zwischen 50 und 55 in psychotherapeutischer Behandlung war oder dringend eine solche brauchte. Hunderte Milliarden von Euro flossen jährlich in diese Kanäle. Mit dem Geld hätte man ganz Afrika aufbauen können.
Es fiel mir schwer, die Leute weiter zu beobachten. Aufgeschwemmte, unsportliche Fettsäcke, auf uns zuwankend, schwankend, verblödet im lebenslangen Konsumieren, lange vor der Zeit und ohne Not invalide, lebende Tote, unfit und unvital. Die wenigen verbleibenden Kinder benahmen sich wie Könige, wie Tyrannen. Kein Wunder, sie waren die letzten Menschen in diesem Romero-Film. Die ahnten schon jetzt, daß sie ihr Leben nicht in der Rentnerhölle Deutschland verbringen würden. Sollte jeder von ihnen später 23 Rentner durchfüttern? Sie wären ja verrückt!
Diese Kinder sprachen unnatürlich laut. Wie selbstverständlich ignorierten sie jede Diskretion, jede Höflichkeit. Als schrien sie sich im dunklen Wald Mut zu, plärrten und redeten sie stets weit über Zimmerlautstärke. Sie lebten in dem Bewußtsein, alles an ihnen sei göttlich interessant. Ihre Mütter waren in der Regel im Großmutteralter. Und diesen Großmuttermüttern mußte man noch gratulieren. Glückwunsch, Mädels! Daß ihr es gerade noch gerafft und geschafft habt! Für eure Singlefreundinnen kommt jede Einsicht zu spät. Sie finden sich im ewigen Altersheim wieder. Und verweilen dort länger, als früher eine ganze Lebensspanne währte …
»Guck sie dir an, diese Nazis …« höhnte Elias.
Für ihn waren alle Rentner in Deutschland Nazis. Da übernahm er die Vereinfachungen unserer Nachbarn im Ausland. Die Frauen mit ihren Brillen und superkurzen Haaren sahen auch wirklich zum Fürchten aus. Der eisige Ostwind blies in ihre extrem uneleganten, unfemininen Sportswearklamotten. An der Bushaltestelle, die wir überblickten, hielten die Busse immer mehrere Minuten lang, weil die Alten so lange zum Einsteigen brauchten. Wir sahen 60jährige mit langen grauen Haaren, hinten zum Zopf gebunden, daneben gleichaltrige Tussen mit Piercingringen im Ohr und wahrscheinlich Tattoos am welken Körper. Sie trugen Rucksäcke und verachteten Autos und anderen Fortschritt, wohl weil sie dreimal durch die Führerscheinprüfung gefallen waren. Dann wieder schwiemelige Kapotthütchen-Typen im Janker oder Trenchcoat, wie schlecht gecastet aus dem letzten »Ärzte«-Spot: ein Panoptikum des Horrors.
»Machen wir den Kleid-Test!« rief Elias. »Wenn von den nächsten hundert Frauen, die kommen, eine einzige keine Hose trägt, sondern ein Kleid, kriegst du zehn Euro.«
Er gewann das Geld. Bald konnte ich nicht mehr hineinsehen in die dumpfe Zombieherde, in der Heide Simonis, unsere einzige Ministerpräsidentin, wie ein Teenager gewirkt hätte. Ich sah Großeltern, denen die Enkel fehlten. Auf vier Großelternteile kam gerade noch ein knapper Enkel, um den gestritten und gebuhlt wurde und der sich wie ein Diktator benahm. Und überall traf mich unerwartet dieser verdeckte, messerscharfe, schneidende, vorwurfsvolle Blick der Alten, so abgrundtief hassend und verbittert, von dem ein sensibler Inder, träfe ihn dieser Blick, sofort Kopfschmerzen bekäme! Ich bat Eli, das Experiment abzubrechen. Ich hatte genug gesehen.
Trotzdem verließ ich Berlin kurz darauf für immer, in Richtung Hamburg, meiner alten Heimatstadt.
Elias hatte sich aber ausbedungen, mich zu begleiten. Er hatte so lieb gefragt, daß ich nicht nein sagen konnte. Kinder wissen immer ganz genau, wie sie einen herumkriegen können: Sie erzählen einfach rührende Geschichten. Und so erzählte er mir an dem Abend unvermittelt, wie er seine bisher einzige Freundin kennengelernt hatte, in der Frühpubertät und gänzlich unschuldig, also sexuell gesehen (daß er sich zu dieser Zeit schon Drogen reinhaute wie Snoop Doggs Stiefvater, änderte daran nichts). Dieses Mädchen war Griechin gewesen, sehr schlank, sehr hellhäutig, sehr schwarzhaarig, und hatte den größten und straffesten Busen gehabt, den man sich vorstellen konnte, laut Elias.
»Diese Busen! Du hättest diese Busen sehen sollen …«
Er sah mich an, und seine Augen leuchteten. Man schreibt das so hin: sie leuchteten. Aber sie leuchteten wirklich, als reflektierten sie eine Kerze, oder als stünde er direkt vor dem brennenden Weihnachtsbaum.
Peu à peu hätten sie sich gegenseitig körperlich kennengelernt, hätten sich alles gezeigt, wie in einem privaten Biologie-Unterricht. Dann waren sie von zu Hause ausgerissen.
Er brachte mir einen Kaffee und zündete sich selbst einen Joint an. Das war ein Fehler. Denn durch den Joint bekam er den gefürchteten sogenannten Laber-Flash. Er redete hektisch, unkoordiniert und wirr, und sentimental. Währenddessen versuchte er, den Reisekoffer fertigzupacken, den er nach Hamburg mitnehmen wollte. Er brauchte die halbe Nacht dazu.
Ich legte mich erst mal hin, neben Lukas, der auch gerade mal wieder schlief. Wir wollten eine gemütliche Nachtfahrt mit meinem Wartburg Tourist 353 S unternehmen, da mußte ich ausgeruht sein. Ich fand aber keinen Schlaf, weil Eli begann, höchst lautstark Songs von 50 Cent und Doktor Dre zu brennen. Damit wir auf der langen Fahrt Musik hätten.
Warum Lukas schon wieder schlief, war nicht auszumachen. Er stöhnte herzergreifend in seinen sicherlich traurigen Träumen. Von dem Gestank des illegalen Schwarzbrennens wachte er auf und hatte schlechte Laune. Es ging ihm nicht gut. Seine blonde Freundin hatte ihren Besuch für den nächsten Morgen angesagt; sie kam mit dem Nachtzug aus der unversehrten bayerischen Landeshauptstadt München. Auch deswegen mußte Elias erst mal weg, Stichwort Bohnern.
Eli und Lukas schliefen zwar seit ihrer Kindheit gern im selben Bett, aber nicht, wenn die Frau Freundin kam. Die führte ein strenges Regiment, das Lukas auch dringend brauchte. Er war ziemlich verwahrlost in Berlin, wodurch er allerdings sexier wirkte. Statt des braven Hansi-Hinterseer-Schnitts fielen ihm die schwarzen Locken nun wild vor die Augen, man hätte ihn für Roque Santa Cruz halten können.
Durch den Laber-Flash hatte ich Kopfschmerzen bekommen, mehr noch: Migräne. Ich stand auf, Eli hatte immer noch nicht gepackt. Dafür hatte er acht neue Theorien über die Arier in der Vorzeit, über das integrale Bewußtsein von Ken Wilber, über den Gegensatz von Liebe und Besitz in der Zweierbeziehung, über den Einzug der Pornographie in den Gangsta-Rap, über neue Wege, an die Internet-Superdroge Samsunit ranzukommen. Ich fragte nach.
»Du kennst jemanden, der das Zeug selbst zusammengerührt und ausprobiert hat?!«
So war es. Ein Freund eines Freundes aus München, der vor Jahren nach Berlin gezogen war. Die Zutaten waren alle legal käuflich. Man brauchte so ein Pulver, das mußte man auf dem Herd mit ganz normalem Wasser so lange kochen, bis das Wasser verdampft war und das Pulver als Salz geronnen am Boden klebte. Dieses Salz mischte man wieder mit einer weiteren Substanz, und fertig war Samsunit. Dieser Drogenfreund hatte zwei Jahre lang damit alle anderen Drogen ersetzt, auch Zigaretten und Alkohol. Diese Zeit nannte er im Rückblick seine »pornographische Phase«. Die sexuelle Lust inklusive Potenz sei unbeschreiblich gewesen. Er habe schließlich aufgehört, da es »einfach zu gut« gewesen sei. Schon unheimlich. Er mochte nicht mehr länger glauben, daß es keinerlei Nachteile gebe. Den Standpunkt habe er heute noch, obwohl bei ihm alles gutgegangen sei. Er lebe mit seiner Freundin glücklich, beruflich erfolgreich und völlig drogenfrei in einem häßlichen Loft in Spree-Nähe. Ich fand, daß das richtig gut klang.
Lukas beugte sich sorgenzerfurcht über den Schreibtisch. Der nahende Besuch der dominanten Freundin verursachte ihm Kopfschmerzen. Elias zog einen nagelneuen Joint aus dem Ärmel. Der nächste Laber-Flash konnte kommen. Es war zwei Uhr nachts, als wir endlich loskamen. Meine Migräne war so stark wie ein Orkan geworden.
»Weißt du, wen ich gern bohnern möchte?« fragte Elias in prächtiger Stimmung, als wir die alte DDR-Autobahn nördlich Berlins erreicht hatten.
»Nein, wen denn?«
»Julia Gormann. Die mußt du noch aufstellen, bevor du ganz weggehst.«
»Ich bin schon weggegangen, Junge, gerade eben.«
»Und weißt du, wer auch noch gut wäre?«
»Nein.«
»Rebecca Haase. Ich sag zu ihr, wenn ich sie ’s nächste Mal sehe, ob sie Lust auf was rauchen und Sex hat. Ich sag dir: Sie wird’s machen.«
Er lehnte sich genüßlich im Sessel der großen Limousine zurück und zog vier Sekunden lang ohne Pause am Glimmstengel. Schon seit einer Ewigkeit war dieser Joint an, und er wurde nicht kleiner. Der Rauch und der Grasgeruch ließen mein Migränehirn schier platzen. Und nun setzte der Laber-Flash mit ungeheurer Wucht erneut ein. Elias wurde fickerig, kreischend, unvernünftig, lachte, jodelte, sang falsch und wurde sentimental.
»Ich mag dich!« sagte er und starrte mich unverwandt an, mit lieben leuchtenden Augen, ein Honiggesicht, mit verzücktem Mund und brennender Zigarette daneben, die furchtbar stank. Ich fuhr das Verdeck nach hinten. Sofort wurde es eiskalt, mindestens minus sieben Grad. Mein Hals hatte sich schon von den Lüftungsversuchen davor entzündet. Nein, es war nicht auszuhalten.
Ich hielt an einer Raststätte und joggte um dieselbe. Joggen hatte früher oft meine Migräne vertrieben. Diesmal nicht. Ich hoffte, Elias würde auf der langen Ladefläche hinter der Rückbank schlafen, wenn ich zurückkam. Wie dumm von mir. Er war aufgekratzter als vorher. Vor sich hatte er säuberlich elf Joints aufgereiht, die er für die kleine Fahrt vorbereitet hatte. Es hatte keinen Sinn. Es war vier Uhr morgens, als ich umkehrte. Um fünf Uhr waren wir wieder in Berlin, um halb sechs Uhr in meiner Wohnung. Der Ausbruchsversuch war gescheitert, jedenfalls dieser.
Nach dieser Pleite mied ich Lukas’ Wohnung und die Gesellschaft der beiden. Dafür besuchte mich Elias nun öfter in meiner Wohnung am Hackeschen Markt, die ich mit der schönen Jaina und DJ bewohnte. Jaina war für meine Nichte Hase gekommen und bewohnte das sogenannte Mädchenzimmer. DJ war ebenfalls weiblich, 23 Jahre alt und stammte aus Japan. Sie wohnte in der Wohnung, weil sie sich mit der schönen Jaina gut verstand und kein Mann war. Und weil ich so selten da war.
Ich hatte den Mädchen gesagt, daß ich Berlin verlassen und die Wohnung aufgeben würde, und hatte ihnen zum 31. Dezember gekündigt. Das trübte die Stimmung aber keineswegs, seltsamerweise. Ich hatte das Gefühl, daß die beiden Beautys sich erst jetzt für mich als Mensch zu interessieren begannen. Ich hatte ihnen immer 500 Euro von der Miete erlassen, was in ihnen vielleicht jenes Unbehagen auslöste, das eine junge Frau gegenüber einem älteren Mann hat, der ihr regelmäßig Geld schenkt. Ich weiß es nicht. Womöglich bildeten sie sich ein, ich wollte sexuell etwas von ihnen.
Jaina war 22 Jahre alt und kam aus Persien. Da sie schöner war, als man sich eine Frau aus 1001 Nacht auch nur erträumen konnte, hatte ich sie zu Anfang ganz unverbindlich gefragt, ob sie mit mir schlafen würde (wirklich nur, um das Thema sofort vom Tisch zu haben). Ihre Antwort werde ich nie vergessen. Sie ist nicht wiederzugeben. Nun aber kümmerten sich die beiden endlich um mich, jetzt, da alles zu Ende ging.
DJ war eine hübsche, kleine Asiatin, und es gefiel mir, daß sie endlich ohne Handtuch unter die Dusche sprang und die Tür nicht mehr verriegelte. Von Jaina bekam ich Massagen und durfte, wenn ich Migräne hatte, bei ihr im Bett übernachten. Daß Elias neuerdings Stammgast in unserem Heim war, verstärkte die gute Stimmung. Vielleicht war sogar er es, der die Frauen hinter meinem Rücken anstachelte, nett zu mir zu sein. Damit ich in Berlin blieb. Sicher dachte der Junge, ich sei durch Erotik korrumpierbar. Als wenn mich zwei blutjunge Studentinnen in meinen gewiß reiflich überlegten Entscheidungen beeinflussen könnten!
Jedenfalls sprachen plötzlich alle wieder von Berlin. Das Neue Berlin sei tot, aber das Neue Neue Berlin sei eine historische Weiterentwicklung und noch mal um eine Dimension besser. Die Botschaft hörte ich wohl, allein mir fehlte vollständig der Glaube. Ich widersprach heftig.
»Berlin hat fertig, Leute. Die Stadt ist unübersichtlich und unheimlich geworden. Hier geht der Bestattungsunternehmer um. Und jeder spürt doch …«
Da ich unter Freunden war, verschwieg ich auch mein Hauptmotiv nicht: Ich hatte in dreieinhalb Jahren keine einzige Frau in Berlin erobern können.
»Und Bastienne?« fragte Jaina.
»War die berühmte Ausnahme, die die Regel bestätigt.«
»Aber eine Frau reicht doch?« buchstabierte die Japanerin in ihrer üblichen Naivität.
»Und ob! Ich hätte sie auch gern behalten. Aber Elias hat sie mir ausgeredet. Er redet allen seinen Freunden das Mädchen aus. Bei Lukas macht er es auch gerade …«
Elias erklärte den beiden, Bastienne sei eine unfreundliche Frau gewesen. Ich gab zu bedenken, sie sei eine Hardcore-Ausgabe von Sahra Wagenknecht gewesen, was die Mädchen nicht verstanden und Eli unerheblich fand.
Wenn ich morgens aufwachte, spürte ich sie deutlicher denn je: die Berlin-Endzeit-Depression. Ich erwachte immer sehr langsam und mußte mich erst gewöhnen: an den Tag, die Situation, diese untergehende Stadt. Es schien schon zu dämmern, wenn ich von Elias den ersten Tee gebracht bekam. Ich hatte ihm gesagt, daß er als Kiffer keine Chance im Leben hätte. Er erwiderte lachend, das Gute am Kiffen sei, daß einem das dann herzlich egal sei.
Unten im Haus, im Sexy Stretch, gab es freitags Lesungen. Diesmal kamen wir zu spät, trafen aber Raoul Hundertmark, einen jungen Typ, dem der Club gehörte und das Haus dazu. Er hatte gerade einen zweiten Club gekauft, nämlich das alte und berühmte Café Peking, zu DDR-Zeiten die Nummer-eins-Disco der Republik.
Hier tanzten verknöcherte Unteroffiziere der Volksarmee Foxtrott und Samba mit undefinierbaren freudlosen Damen. Ich war selbst einmal mit Anja Fröhlich dagewesen. Mich wunderte damals, daß sie uns reinließen. Angeblich hatten sie die strengste Tür im Ostblock. Und ich hatte gar keine Uniform an und Anja kein Kostüm. Vielleicht beeindruckte sie die schwarze Ernst-Bloch-Brille, die ich damals trug. Hundertmark hatte den ganzen Komplex gekauft und errichtete eine Kreativhölle darin, oder was das war. Er schrie mir ins Ohr:
»Da kommen meine Leute und ziehen das hoch! Alle kreativen Moves der Stadt bekommen ihr Zentrum! Und wir machen alles selbst! Der Wowereit kann später mal reinflattern und Beifall klatschen …«
Ich erwähnte meine Absicht, Berlin demnächst zu verlassen. Er riß die Augen auf und machte klar:
»Dann muß ich dir auf der Stelle meinen neuen Club zeigen!«
In Schlangenlinien fuhren wir zum Café Peking. Hundertmark schwärmte von dem neuen Superclub, bei dem auch ich mitmachen müsse. Hier könne er mir genau jene Öffentlichkeit herstellen, die ich brauche.
Tatsächlich war diese Location großartig. Der Club WWF, offiziell wie inoffiziell höchst angesagt, war dort untergebracht, füllte aber nur ein Achtel der Fläche. Hundertmark wollte in dem Gebäude einen internationalen Club aufbauen, der sich, wie er meinte, »als Plattform zum Austausch kreativen Potentials« verstehen werde, »unisexy, genreunabhängig, interdisziplinär« und für Leute jeden Alters und »jeder Penunze«, wie er säuselte, »egal ob Golden Spoon oder Dingo, Hauptsache Leidenschaft in seiner Mache«.
Im Keller war Platz für ausufernde Saunalandschaften, kecke Springbrunnen in den beiden Gärten im Erdgeschoß und eine dicke Lobby auf dem Dach, das war es, was er wollte: Eine eigene Lobby, »nur um in Ruhe gelassen zu werden. Die Medien werden sich draufstürzen wie eine Meute total ausgehungerter Wölfe! Aber wir werden ihnen nur einen Knochen hinwerfen und das meiste geheimhalten. Was sie nur noch wilder machen wird …«
Es war ihm zu glauben. Der Mann hatte auch bisher schon seine Pläne umgesetzt. Das Sexy Stretch war der einzige Club, in dem Ost- und Westjugend eine gemeinsame neue Kultur entwickelten, wenn man so wollte: der einzige Ort echter deutscher Wiedervereinigung. Und nun das alles hoch zehn! Das mußte Deutschland erschüttern.
»Im Grunde ist die jetzige Krise wunderbar. Sie wirft das Land auf null zurück. Wir sind am Ende, also am Anfang. Wie hieß doch dieser Rossellini-Film kurz nach dem Krieg … Germania hora zero oder so, Deutschland der Stunde null. Die haben wir jetzt!«
Die Stunde null. Das war es. So lautete das Motto. Ich solle auf keinen Fall gehen. Seine Goldzähne blitzten:
»Ich mag dich nämlich! Ich habe dich in deiner Ungreifbarkeit dann doch gesehen. In all deinen Schattierungen und Varianten habe ich gerade dich als eine PERSON gesehen, anders als die Leute, die ein klares Profil haben und die mir dann für immer abhandengekommen sind, durch alle Gullys gerutscht sind. Gerade DU mußt in Berlin bleiben!«
Und dann tat er etwas für mich völlig Überraschendes – er sprach über sich. Früher hatten die Leute immer eine Reserve gegen mich gehabt, auch Hundertmark, da sie angeblich Angst hatten, ich schriebe über sie. Was natürlich Quatsch war. Ich dachte mir immer alles aus, es klang nur so abgeguckt. Er sprach über seinen vierjährigen Sohn Hugo:
»Mit zwei hatte er das Alphabet drauf, mit vier liest er, und diese frühkindliche Neigung zur Abstraktion hat mir anfänglich ein wenig Sorgen gemacht, aber das ist die Liebe seiner Mutter. Daran scheitern ja die meisten, weil man ihnen als Kind die Seele genommen hat, an der Gutmütigkeit und der Leidensbereitschaft. Wir müssen füreinander dasein, deshalb habe ich meine Schwiegereltern ins Haus geholt. Der Kleine soll alles haben, Ansprache wenn er’s braucht; die meisten wurden doch zu selten aus dem Kinderwagen genommen, daher auch die Verklemmungen und Ängste. Auch ich habe Ängste. Meiner Mutter zu verdanken. Schreiend liegengelassen hat man mich. Das kriegt man nicht mehr raus. Das Verlorenheitsgefühl, man kultiviert es. Eher, weil es einen sowieso beherrscht. Die Brust hat man mir verweigert! Das erste und einzige wirkliche Geborgenheitsgefühl, der mütterliche Herzschlag, die Kopfstütze, die Umarmung verwehrt – was einem bleibt, ist mangelnde Bindungsfähigkeit, unsteter Blick, desolater Kiefer, schlechte Zähne – Selbstzerstörungstrieb. Meine Eltern, diese Victims, sind heute noch total in sich gestülpt und kommen aus ihrer deutsch-trotzigen Rolle nicht raus. Verkappte Faschos.«
So merkte ich, daß er wirklich auf mich baute.
Das WWF war übervoll der schönen neuen Frauen, wie ich zerknirscht zugeben mußte. Die Musik war anders geworden. Irgendeine neue Mischung aus Techno und etwas, für das ich keine Worte hatte. Jedenfalls kein Hiphop. Fast alle Frauen trugen schwarze Herren-Feinripp-Unterhemden, was sie stark und nackt zugleich machte, irgendwie besonders physisch, als müssten sie gleich in die Schicht einfahren, nach dem Abdancen. Die Männer sahen nicht mehr ganz so hanselhaft bescheuert aus wie noch vor Monaten, als die meisten ihre dicken Schul-Wollmützen sogar auf dem Dancefloor aufbehielten und ihnen die Übergröße-Hosen herunterhingen wie bei gewindelten Kleinkindern. Die Frauen sahen wirklich cool aus. Alle so ernst, keine spielte Spielchen, und alle so nackt, so rückenfrei. Sie tanzten auch echt gut, ermüdungsfrei wie Naturfedern.
Elias, der mir hatte versprechen müssen, nicht mehr zu kiffen, bekam von einem unsicheren kleinen Mädchen eine Tüte angeboten. Er zog ein paarmal, und der widerwärtige Laber-Flash setzte wieder ein. Es war vier Uhr morgens. Gerade hatte ich mich so wohl gefühlt. Der Club begann sich noch zu füllen. Und nun das! Eli laberte los. Ich bekam nach zehn Minuten Kopfschmerzen. Ich bat ihn, den Abend abzubrechen. Er hörte mich nicht mehr. Ich schüttelte ihn:
»Elinger! Laß uns gehen!! Wo ist der Autoschlüssel?!«
Er lachte irr und wirr, plapperte weiter. Erst um halb sechs saßen wir im Auto. Hundertmark fuhr uns nach Hause. Auch er hatte gekifft. Auch er redete ziemlich aggressiv.
»Andere Städte sind, was sie sind, Alter. Berlin ist Niemandsland. Niedergang und Aufbau verschmelzen hier …«
Wir fuhren durch verlassene Glas- und Stahlviertel, Investitionsruinen des Neuen Berlin, wahre Ghost-Towns der Postmoderne. Einmal stiegen wir aus, weil Hundertmark, gelernter Architekt, Subventionsmißbrauch am Bau erklären wollte. Die Luft war frisch, die glitzernde Ruinenstadt ungewohnt, aber nicht unangenehm.
»Genau hier wird unser Zugriff noch einzusetzen haben!« deklamierte der New-Age-Kulturimperator streng.
Nachdem wir das alles gesehen hatten, kam mir auch Mitte nicht mehr so trostlos vor. Das lud sich gegenseitig auf. Hundertmark fuhr weiter. Ich sagte zu Eli:
»Komm, laß uns den Nachbarinnen noch gute Nacht sagen.«
»Gut. Betrunken genug dazu sind wir ja.«
Wir meinten die netten Straßennutten, die vor der Kleinen und Großen Präsidentenstraße postiert waren. Wir sprachen mit Claudia, Alizia, Steffi, Jeannie und Angie. Keine hatte einen Freier. Es war minus acht Grad kalt. Angie sah zehn Jahre älter aus als im letzten Jahr, also wie 28. Wartete ich noch ein Jahr, war sie in meinem Alter und paßte zu mir. Sie wirkte äußerst enttäuscht. Vom Leben, vom Beruf, von den Männern, von mir:
»Du hast auf meine SMS nie mehr geantwortet.«
Ich entschuldigte mich wortreich, merkte aber, daß es nicht ging. Ihre Enttäuschung saß zu tief. Das verunsicherte mich. Ich wollte gehen.
»Laß uns lieber morgen treffen. Bist du denn morgen hier?«
»ICH BIN DOCH IMMER HIER, wo soll ich denn sonst sein!« Sie weinte fast. Wir schlichen uns davon.
»Wie kann man ihr helfen?« fragte Eli.
»Wir müssen sie rauskaufen.«
»Genau. Mit der neuen Wunderdroge werden wir so leistungsstark und erfolgreich, daß wir Angie auch noch rauskaufen können …«
So trösteten wir uns. Beim Einschlafen dachte ich intensiv an sie. Es war ein trauriges, aber auch beglückendes Gefühl. Arme kleine Angela …
Wir wollten Angie wieder besuchen. Elias schrieb eine SMS unter meinem Namen: »Es war so schön, dich gestern wiedergesehen zu haben. Auch mein Neffe Elias findet dich sehr nett und interessant. Hoffentlich haben wir in Zukunft wieder mehr Kontakt.«
Elias wollte wissen, was Angela für wieviel Geld wie lange ganz genau machte. Die anderen Nutten, die an der Kleinen Präsidentenstraße standen und denen wir Hallo gesagt hatten, hatten ihm bereits erste und widersprüchliche Antworten gegeben. Für nur sechzig Euro wollten sie ihn angeblich eine ganze Stunde lang »verwöhnen«. Das hieß Massage, Französisch mit Kondom, schön aufs Zimmer gehen und noch irgendwas. Konnte man so eine ganze Stunde füllen? War das Mädchen auch wirklich nackt? Durfte man es streicheln? Ihm die Haare kämmen? Befehle geben und es im Zimmer hin- und herschicken? Und galt das alles auch für die schöne Angie? Und bekam er einen Sondertarif, da Angie mich kannte? Würde sie zu ihm besonders nett sein? Er versicherte mir glaubhaft, mit ihr gar nicht schlafen zu wollen, sondern auf dieses obskure »Verwöhnprogramm« in voller Länge scharf zu sein.
»Eli, das ist doch alles Bluff. Alle Nutten hier reden erst mal vom Verwöhnen, aber dann holen sie dir einen runter, und nach zwei Minuten suchst du das Weite.«
Er protestierte: »Nein, ich lege mich auf den Bauch und lasse mich erst mal total verwöhnen. Sie muß mit der Ganzkörper-Massage beginnen …«
Angela wurde für ihn zur fixen Idee. Ich solle ihr sagen, er sei noch Jungfrau und sie müsse ihm alles beibringen. Sie müsse die ganze Nacht bei ihm bleiben. Ich müsse meinen Einfluß auf sie geltend machen, daß er ihr auch befehlen dürfe, ihn zu küssen und so weiter …
Ich sagte, ich wolle es versuchen. Immerhin habe sie zwei meiner Bücher im Regal stehen, was um so bemerkenswerter sei, da sie nicht lesen könne. Ich hielte sie für ein sehr anständiges Mädchen mit einer hehren Berufsauffassung, fast sozialdemokratisch und gewerkschaftlich geprägt:
»Die glaubt wirklich, einen ordentlichen Arbeitsplatz innezuhaben.«
Am nächsten Abend saßen oder, besser, lagen wir wieder im Cruising Car von Hundertmark und rauschten durch die Berliner Nacht. Fett dampfte Jazzanova durch die smoothige Luxussuite auf Rädern. Hundertmark fuhr selbst, wieder in Schlangenlinien, immer mit anderthalb Händen am Joint. Neben ihm so ein Verbrechergesicht, gutaussehend und verroht, hinten Elias, ich und Elias’ amie du jour, Freundin des Tages, ein 15jähriges Ossi-Girl aus Wandlitz.
Als die zur Welt kam, war Daddy noch ein Gott von Honeckers Gnaden. Sie war der helle Typ, blond, mit viel zu großen, smaragdgrünen Augen, interessierte sich aber weder für Eli noch für Hundertmark, sondern für den so rohen wie unbedeutenden Beifahrer Hundertmarks.
Der Chef war gesprächig, warf abgehackte Sentenzen nach hinten in meine Richtung. Es ging um sein neues Großprojekt im Café Peking, bei dem ich mitmachen sollte.
»Hast du gehört, daß Deutschland als Thema international ziemlich angesagt ist? Modemacherinnen wie Eva Gronbach packen den Reichsadler auf Puma-Pumps und nähen aus der Deutschlandfahne Minikleider, die Szene in London flippt aus, New York kreischt nach Berlin. Hier rein packen sie alle ihre wilden Sehnsüchte und verarbeiten ihre Desillusion über die Tatsache, daß die eigene Metropole verödet. Die Welt schaut auf Berlin, und wir sorgen dafür, daß sie das Richtige zu sehen kriegen. Wir kommen über die internationale Schiene … Café Peking, dieser gewaltige Klotz mitten im Zentrum der alten DDR-Hauptstadt, wird wie ein riesiger Fernseher in die Stadt hineinstrahlen … Aber merken wird man es erst in New York. In New York wird es das Thema sein, und ein halbes Jahr später schwenken die blöden Deutschen dann endlich ein …«
Ich fand das logisch. Eigentlich interessierten sich die Deutschen in ewiger Selbstverleugnung nur für Amerika. Erst wenn Amerika sein Okay gab, konnte ein Trend hier laufen. Ich brüllte in die Graswolke hinein:
»Du hast recht! Im Mai 1945 ist Deutschland bei den Deutschen ausgelöscht worden. Es besteht aber weiter im Bewußtsein der anderen Völker als eine Art virtuelles Deutschland, und dieses Bewußtsein fragt immer wieder diesen Stoff nach, will bedient werden!«
»Und wir bedienen es, um bekannt zu werden!« rief Raoul überglücklich.
Sein Plan war aufzusteigen, um die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, daß unter den »Brandings von offiziellen Botschaften und den Images aktueller Wahrheiten die Luftblase des niemals einzulösenden Versprechens« gährte. Daß Nike in Indonesien Kinder übelst ausbeutete und gleichzeitig deren Erzeugnisse mit der richtigen Kampagne an die Enkel der Sklaven in Amerika verkaufte. Daher durfte Nike einfach nicht mehr cool sein.
»Wir haben die falschen Idole! Hinter den Fassaden des Realen wird oft nur die Orgie der von den Mächtigen gewünschten Realität veranstaltet, und daher gilt es, die anagraphische Toleranz des alten Systems zu hintergehen.«
Der gute Hundertmark. Er sagte solche komplizierten Sätze immer ohne mit der Wimper zu zucken. Er kam voll in Fahrt.
»In unserem neuen Kosmos, dem Peking, errichten wir eine chinesische Mauer und lassen nur den rein, der bereit ist, sein Leben zu investieren in seine Arbeit, in seine selbstgesetzte Aufgabe. Das sind die neuen Mitglieder. Wir bilden eine internationale Elite und senden später von hier aus unsere Botschaften ins Weltnetz, außerparlamentarisch, denn die Demokratie hat ausgedient, solange sich die Volksgewählten in ihren gierigen Interessen nicht unterscheiden und umherlaufen wie Lemminge. Jeder, der zukünftig Macht ausüben will, soll mit seinem Leben in der Verantwortung stehen. Zur Hilfe gibt man ihm Statute, Experten und Computerprogramme.«
Die tausendfachen Umbauarbeiten bei der innenarchitektonischen Gestaltung des Großkunstwerks übernahmen Hundertmarks bewährte Kolonnen, die auch schon das Sexy Stretch zum Nulltarif aufgestellt hatten: Gesinnungsgenossen aus aller Herren Länder, Künstler, Schwule, Abenteurer und Straßenköter. Café Peking konnte das größte gezielt antikapitalistische Projekt seit dem Mauerfall werden. Die Medien würden durchdrehen und so weiter.
So ging es Nacht für Nacht. Wir saßen in der dicken Stretch-Limo, die fetten Bräute schnupfend im Fond, Elias mit der hübschen 15jährigen Viola total verknallt vorne, ich als verklemmter deutscher Schriftsteller stocksteif mittendrin.
Eines Abends war dann auch Lukas wieder mit dabei. Er hatte eine junge Afrikanerin aufgestellt, in die ich mich sofort verguckte. Sie hieß Miranda Magebrachehel. Es war schwer, ihren Namen herauszubekommen, auch, ihn auszusprechen. Eigentlich hatte ich längst genug von »der Jugend«. Ich hatte mich ein letztes Mal in den Clubs umsehen wollen, und dann – tschüß! Auf in ein erwachsenes Leben ohne Hiphop, Night Ladies und all den Blödsinn. Endlich ruhig werden.
Doch dann, an meinem letzten Abend, war diese schwarze Afrikanerin da, Miranda, in die ich mich verliebte. Na, es konnte mir nur guttun, dachte ich und gab Gas. Go on, Berlin, noch eine Runde! Bis ich merkte, daß dieser schöne dunkelhäutige Mensch viel interessanter war als alle anderen im Hummer-Jeep. Oder verwechselte ich etwas? Was ich an ihr interessant fand, war eigentlich nur, daß sie mich interessant fand.
Anscheinend war das für mich höchst ungewöhnlich. Durch ihre übertriebenen Reaktionen auf alles, was ich sagte, merkte ich erst, wie wenig sonst die Menschen auf mich reagierten.
Einmal holte Lukas mich ab und hatte sie, Miranda Magebrachehel, auf dem Beifahrersitz. Ich saß hinten. Bei jedem Satz, den ich sagte, riß das Mädchen den Kopf nach hinten, lachte, wollte mehr wissen. Man sah, daß ihre Wahrnehmung plötzlich mit Informationen durchschlagen wurde, die sie als bemerkenswert ungewöhnlich einstufte, somit »erkannte«. Ich hatte solch ein »Erkennen« normalerweise nur umgekehrt, also daß ich einen bestimmten Abweichungsgrad bei seltenen anderen Menschen erkenne. Zuletzt war es mir vor zehn Jahren bei Alexander Kluge so ergangen, und selbst bei dem würde es mir heute nicht mehr so gehen.
Nun also sie. Erstaunlich war außerdem, daß sie Komplimente machte. Niemand sonst macht in der Jugend noch Komplimente oder sagt etwas Nettes. Nur ich tat das noch und war deshalb leidlich beliebt. Sie aber sagte oft, meine Augen würden leuchten, oder sie sei froh, mich kennengelernt zu haben, das würde vielleicht viel in ihrem Leben in Bewegung bringen. Wann hört ein Mann je solche Worte? Andererseits war es schwer, etwas über sie