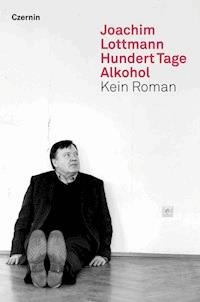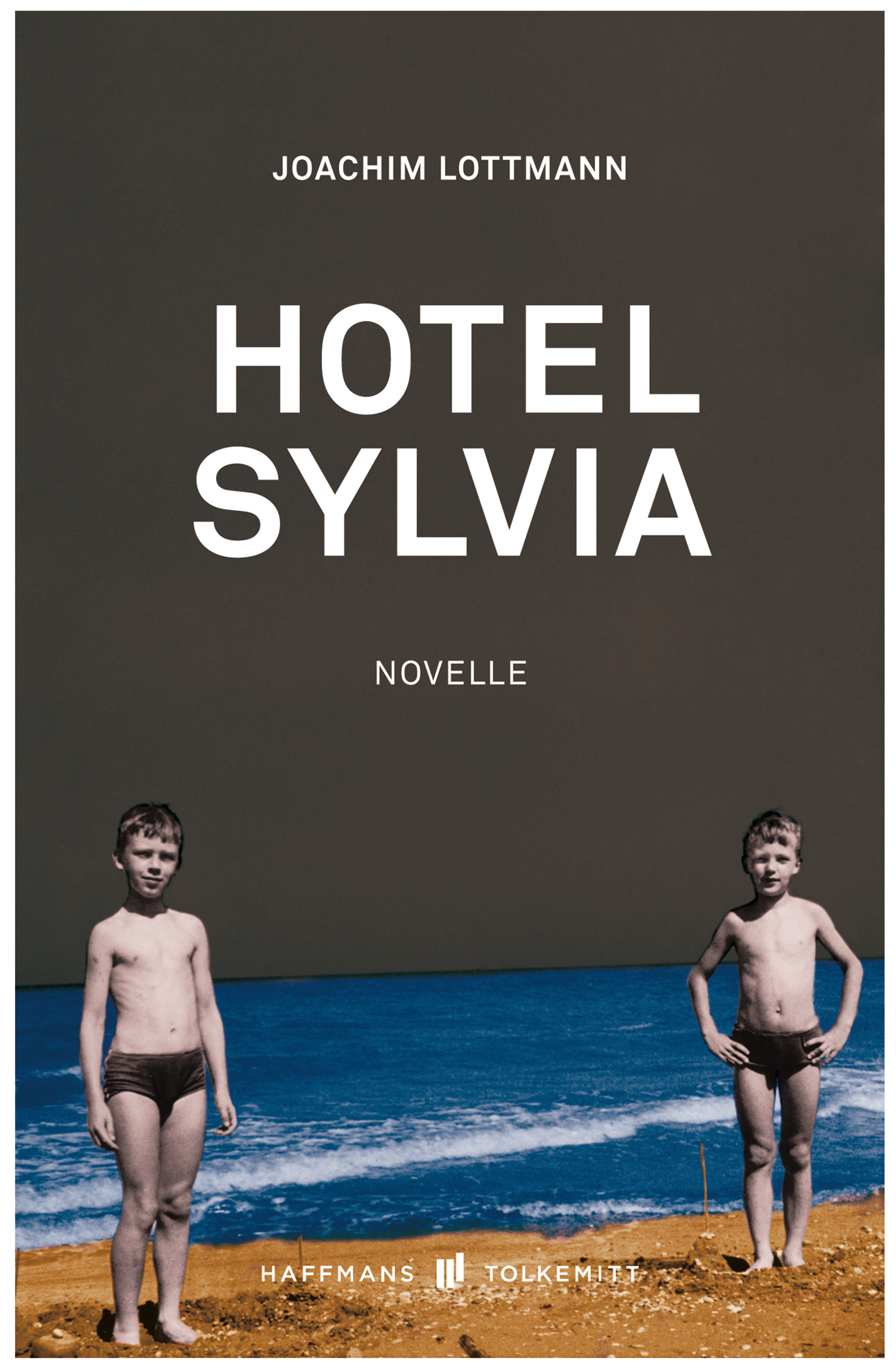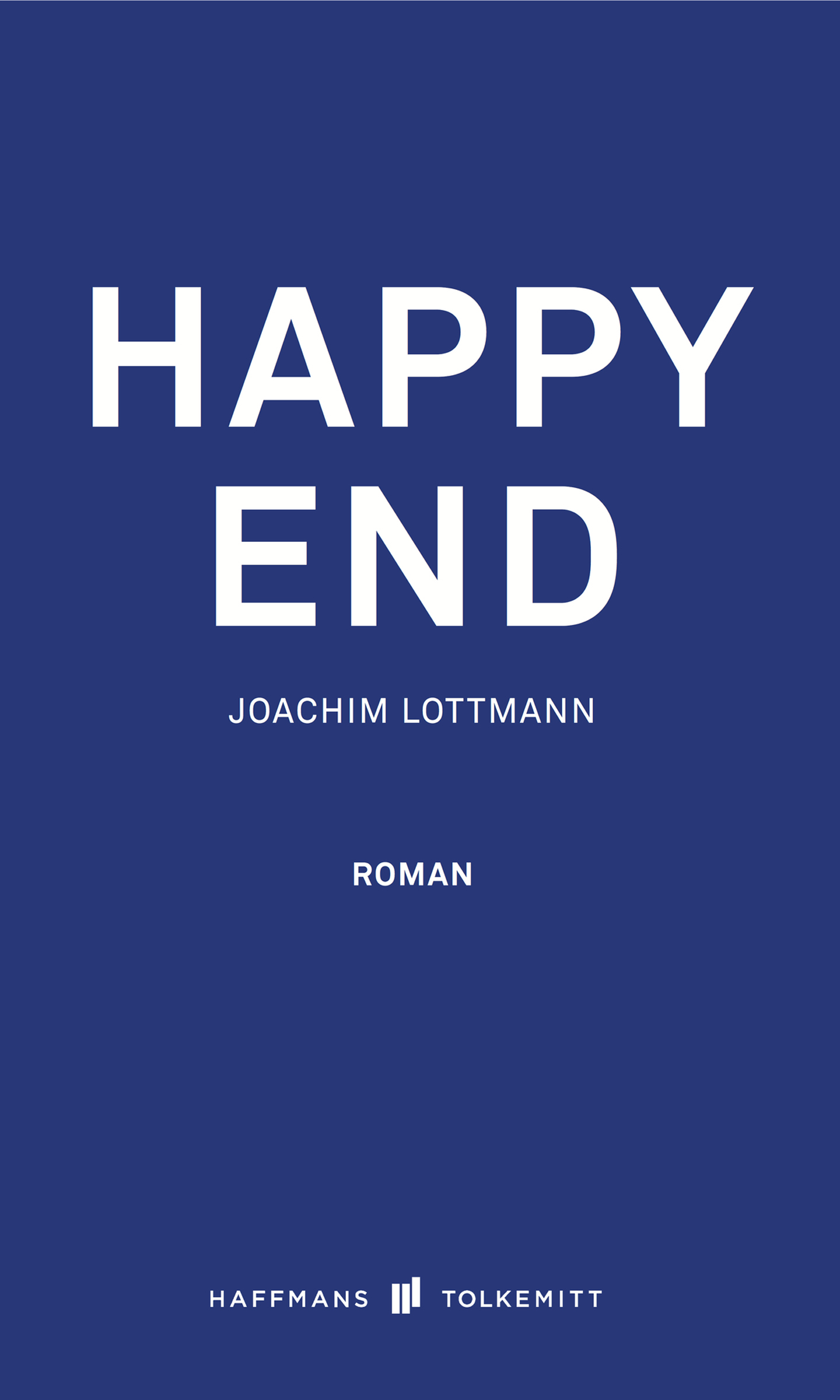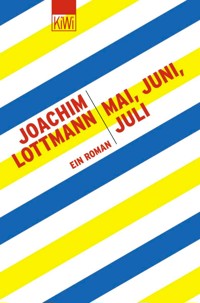8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Furios: ein Stadtneurotiker auf der Suche nach dem Arzt fürs Leben! Ein junger, etwas zwanghafter deutscher Schriftsteller folgt dem Rat seiner Freundin, »mal zum Therapeuten« zu gehen. Doch wie in vielen modernen Paarbeziehungen reicht auch ein einziger Psychiater nicht mehr für die Ewigkeit: Wie wild wechselt der Romanheld fortan Ärzte und Methoden und erprobt die schier unerschöpflichen Möglichkeiten des Psycho- und Erleuchtungsmarktes. Er jagt vom Seelenklempner der kassenärztlichen Vereinigung zum Familienaufsteller, gerät an einen Klaus-Kinski-Nervenarzt, an Quacksalber, Nazi-Hypnotiseure und Transaktionsanalytiker, die ihn über Jahre mit Einzel-, Paar- und Gruppentherapie behandeln. Scheinbar erfolgreich. Genauer: Erfolge und Misserfolge wechseln sich ab, bis eines Tages »der Richtige« (Arzt) kommt. Ein älterer Herr, der leider nach wenigen Jahren stirbt. Die langjährige Freundin verlässt ihn erneut, diesmal nach Indien, und im Ashram, wohin er ihr folgt und sich in eine junge Inderin verliebt, kulminiert der Horror: seine neue Geliebte stirbt, ausgezehrt von den kriminellen Methoden eines leider hochkriminellen Gurus. In der Sinnkrise ist nur eins gewiss: Das Alter kommt, die Freundin geht, die Therapie bleibt! Joachim Lottmanns bislang bester Roman ist eine hochkomische seelische Achterbahnfahrt und ein Schrei nach Liebe, die den Helden und den Leser in den lakonischen Irrwitz treiben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Joachim Lottmann
Unter Ärzten
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Joachim Lottmann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Joachim Lottmann
Joachim Lottmann, geboren in Hamburg-Hochkamp, Kindheit in Belgisch-Kongo. Studium der Theatergeschichte (bei Diedrich Diederichsen) und Literaturwissenschaft (mit Maxim Biller) in Hamburg. 1986 Übersiedlung nach Köln, Romanerstling »Mai, Juni, Juli« (KiWi 767). Freundschaft mit Martin Kippenberger, der nach »Die Frauen, die Kunst und der Staat« mit dem Autor bricht und dafür sorgt, dass er in Ungnade fällt. 13 Jahre schlägt Lottmann sich als Straßenbahnschaffner in Oslo und als Leibwächter von Rainer Langhans durch, bis ihn der Literaturchef der FAS wiederentdeckt. 2004 sensationelles Comeback mit dem Roman »Die Jugend von heute« (KiWi 843, 2004), danach »Zombie Nation« (KiWi 930, 2006) und der Reportageband »Auf der Borderline nachts um halb eins« (KiWi 1002, 2007), 2010 der gefeierte Roman zur Krise: »Der Geldkomplex« (KiWi 1116). Der Autor erhielt 2010 den Wolfgang-Koeppen-Preis und lebt in Wien.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Furios: ein Stadtneurotiker auf der Suche nach dem Arzt fürs Leben!
Ein junger, etwas zwanghafter deutscher Schriftsteller folgt dem Rat seiner Frau, »mal zum Therapeuten« zu gehen. Doch wie in vielen modernen Paarbeziehungen reicht auch ein einziger Psychiater nicht mehr für die Ewigkeit: Wie wild wechselt der Romanheld Ärzte und Methoden, jagt vom Seelenklempner der kassenärztlichen Vereinigung zum Familienaufsteller, gerät an einen Klaus-Kinski-Nervenarzt, an Quacksalber, Nazi-Hypnotiseure und Transaktionsanalytiker, die ihn über Jahre mit Einzel-, Paar- und Gruppentherapie behandeln. Scheinbar erfolgreich. Dann aber stirbt der Arzt seines Vertrauens, seine Frau verlässt ihn, und im Ashram eines leider hochkriminellen Gurus stirbt auch noch seine junge indische Geliebte. In der Sinnkrise ist nur eins gewiss: Das Alter kommt, die Freundin geht, die Therapie bleibt! Joachim Lottmanns bislang bester Roman ist eine hochkomische seelische Achterbahnfahrt und ein Schrei nach Liebe, die den Helden und den Leser in den lakonischen Irrwitz treiben!
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
für Julia Irene Heuse
»Das Fatale an der Psychoanalyse ist nicht, daß sie wirkungslos wäre oder dämlich. Nein, sie ist eine extrem wirkmächtige, aber eben grundfalsche Welterklärung.«
Matthias Matussek
Teil 1
Seltsamerweise weiß jeder genau, was ihn in der Therapeutenszene erwartet. Überrascht ist man nie, immer nur enttäuscht. Das Bild, das jeder von der Sache hat, entspricht haargenau der Sache selbst. Nur halt noch mal viel weniger glamourös, als man im stillen gehofft hatte. Allerdings: Damit wollte ich mich nicht abfinden. Ich suchte den Psychiater mit dem gewissen Extra, mit dem rollenden R und dem nervösen Zucken. Das Klaus-Kinski-Monster vielleicht. Oder den abgedrehten Professor, den Übervater, den alten Mann mit Bart, der 40 Berufsjahre lang die Abgründe der Seele geschaut hatte. Es mußte gar nicht Sigmund Freud persönlich sein. Auch eine Frau war mir recht; auch da gab und gibt es grandiose Klischees. Die verrückte Nymphomanin, die im Kleid der Ärztin ihre Patienten in die Schizophrenie treibt und sich an ihnen vergeht. Zum Beispiel. Aber natürlich war der Anfang meiner Suche von all dem das Gegenteil. Ich ackerte eine Telefonliste der ›Deutschen Psychologischen Gesellschaft‹ durch. Bis auf zwei oder drei Ausnahmen stieß ich nur auf Frauen. Und diese Frauen leierten alles in einer irgendwie vertraut-langweiligen Leidensstimme herunter, als lebten wir noch in den doch recht unerfreulichen WG-Tagen der Siebziger. Vielleicht handelte es sich um eine negative Auslese: Die besseren Kollegen hatten mehr zu tun, die bekam man wohl nicht sofort an den Apparat.
Um trotzdem erst einmal weiterzukommen, ging ich einige Verabredungen zu sogenannten Erst- und Beratungsgesprächen ein. Man muß wissen, daß diese Erstgespräche nicht direkt von der Kasse bezahlt werden, sondern das Geld – und das erinnert ein bißchen an die Bordellsituation – vor Beginn des Gesprächs in bar auf den Tisch der Therapeutin gelegt wird, 150 bis 170 Mark für 40 Minuten. Also, die erste Frau war gleich ein Flop, und wie ich hoffte: der größte Flop, denn von nun an konnte es nur noch bergauf gehen. Es sei mit zwei Sätzen abgetan, denn Hohn und Spott sollen hier nicht ausufern: Eine etwa fünfzigjährige Frau mit schwarzen Lederstiefeln und betont humorlosem Rottweilergesicht attestierte mir rundheraus, daß es für mich keine Heilung gebe. Ich solle ins Universitätskrankenhaus in die Notaufnahme fahren und mir Medikamente gegen meine Angstschübe geben lassen. Wir saßen in einem völlig unaufgeräumten Zimmer, weit voneinander entfernt, ich auf einem Design-Sofa, sie auf einem Stuhl, wobei es finster wurde und sie kein Licht machte. Nun gut: Sie war die einzige gewesen, die mich noch am selben Tag treffen wollte. Sie war wohl keine richtige Ärztin, denn sie durfte nichts verschreiben. Sie war auch nicht auf dieser offiziellen Liste des Psychoanalytiker-Verbandes, sondern ein Geheimtip. Eine Bekannte meines Bruders, die sogenanntes Coaching »machte«, schwärmte von ihr, sie sei »richtig gut«. Mein Bruder hatte seine erste vierjährige Therapie Anfang der 80er gemacht. Er hieß übrigens Ekkehardt, sagte ich es schon?
Ich war bei meiner Therapeutensuche also noch weit entfernt vom Ziel, begann mit den ersten Schritten, verhedderte mich noch bei Dilettanten. Trotzdem: Warum wurde ich abgelehnt? Weil mir meine übergroße Distanz zu dieser Szene, mein Abscheu gegen den Psycho-Jargon, gegen die vorgeschriebenen Kuschelrituale und Unterwerfungsgesten anzumerken war? Nehme ich an.
Ich ging wieder die Telefonliste durch. Ich hatte meine allererste Therapie, nebenbei bemerkt, mit 17 gehabt. Als Schüler interessierte ich mich für Marxismus und für die Psychoanalyse; das waren außer Fußball die einzigen Volksreligionen. Das war aber lange her. Inzwischen war ich nicht mehr aus Neugier bei dem Fach, sondern aus Bedrängnis. Meine Freundin verlangte von mir, »mal zum Therapeuten« zu gehen, da sie selbst eine Therapie machte und zudem meinte, ich hätte es nötig. Ich stand unter Druck. Ohne Therapie keine Freundin mehr. Den Job als Textchef hatte ich fast schon verloren. Ein anderer war nicht in Sicht. Ich war nicht mehr jung und so gut wie arbeitslos.
Was lag näher, als eine Therapie zu machen? Es würde bestimmt hart werden. Obwohl ich Ärzte liebte. Mein Leben lang war ich gern bei Ärzten in Behandlung gewesen. Einmal, bei einem Zahnarzt, ein ganzes Jahr lang, jede Woche, 52 mal. Jedesmal bekam ich zwei bis vier Spritzen. Ich liebte die weißen Gegenstände, die kollektive Routine um mich herum, das Lachen der jungen Helferinnen. Nichts davon war bei der Rottweilertherapeutin übriggeblieben, die immer nur signalisierte: Ich mach dir nichts vor, du kleiner Arsch, also mach mir auch nichts vor. Die Ärzte, mit denen ich nun telefonierte, wirkten kaum besser. Einer hörte sich verschlafen meine Krankengeschichte an, bis er endlich entschied, keine Kapazität frei zu haben.
Ich verabredete schließlich mit folgenden Leuten eine Therapiebeginn- oder Beratungsstunde: Anna-Sophie Blöder, eine Frau mit Doktorengrad, im billigen Studentenviertel lebend, ohne Arztschild, im vierten Stock ohne Aufzug. Lena von Düpperts, im reichen Harvestehude. Hier nahm endlich einmal nicht die Ärztin selbst ab, sondern eine forsche Assistentin, die auch nicht im schleppenden Szenedeutsch daherkam, sondern militärisch knappe Anweisungen gab. Angelika Berghaus, etwas bessere Studentengegend, nicht urban, aber teuer, gleich neben der Universität. Sie wirkte einigermaßen sympathisch. Dierk Schleyden, endlich ein Mann, mehrfache Doktorgrade, aufgeklärt-bürgerliche Wohngegend. Seine Stimme war schon auf dem Band angenehm manisch, von dunkler, vibrierender, unheilvoller Verrücktheit. Aber ich konnte mich auch täuschen. Als ich ihn persönlich am Apparat hatte, wirkte er eher jugendlich und fast heiter. Roman Lesmeister, nur ein Diplom, unscheinbares Winterhude als wenig inspirierende Adresse. Auch sonst hinterließ er keinen Eindruck auf mich. Vom Vornamen ›Roman‹ her zu schließen, war der Mann noch jung. Jünger als ich. Das konnte nichts werden. Ebenso verhielt es sich mit Melanie Bechtolf aus dem Wacholderweg. Wo war der Wacholderweg? Etwa in der Nähe des Flughafens? Stunden von der City entfernt? Die Frau sprach gebrochen Deutsch und wollte auf der Stelle gleich ZWEI Stunden machen, sprich 300 Mark. Widerwillig sagte ich zu. Sie hatte keinen Doktor und wohnte in einer Proll-Gegend. Durfte ich mir das zumuten? Immerhin ging es mir wirklich nicht so gut. Der falsche Arzt konnte da vollends die Lebenslust dämpfen. Doch zunächst brauchte ich so etwas wie Vollzugsmeldungen für meine Freundin. Sie machte ihre Therapie, ich sollte meine machen, na ja, wer machte eigentlich keine? Ganz Deutschland lag damals in Agonie. Mir fiel übrigens auf, daß die feudal-zackige Anita von Arnim als einzige nicht von Bargeld gesprochen hatte, sondern von der Krankenversicherungs-Scheckkarte, die ich mitbringen sollte.
Nach ein paar Tagen, am 4. Juni, entdeckte ich noch einen weiteren männlichen Arzt. Er wirkte nett und gütig, fast mitleidsvoll, sagte auch nicht, er sei bereits besetzt. Aber auch hier: eine junge Stimme. Wohl kein weiser, weißhaariger Professor mit Bart und dicker Hornbrille. Wieder ein dynamischer Fitneßapostel, der einen in den Arbeitsprozeß zurückcoachte. Beim nächsten Mal wollte ich als erstes nach dem Alter fragen. Er sagte, ich müsse erst ein sogenanntes Delegationsgespräch mit einem anderen Arzt führen, ehe er tätig werden dürfe. Er nannte Namen und Telefonnummer. Dort war dann ein Tonband dran und verwies auf eine bestimmte Sprechzeit: Freitags von 7.50 Uhr bis 8.10 Uhr war der Herr angeblich zu sprechen.
Meine zweite Psychiaterin war schon besser als der Anfangsflop. Ich traf Frau Doktor Boehnke zur Mittagszeit, wie gesagt, im billigen Studentenviertel im vierten Stock ohne Aufzug und ohne Arztschild. Die Frau war um die 50, hatte eine schöne, sonnige Wohnung, kleidete sich aber betont studentoid: Der alte Pullover war geflickt, dem Rock fehlten ein paar Knöpfe. Sie war füllig, die kurzen Haare hatte sie rot gefärbt. Ansonsten fehlten kräftige Farben in der Wohnung, alles war beige, weißgetüncht, schwarz oder schwarzbraun, die Möbel waren aus Holz. Mein erster Eindruck: Hier war es leer und karg, aber auch sauber und frisch. Im Behandlungszimmer stand eine klassische, mit persischen Deckchen drapierte Psychiatercouch aus dem letzten Jahrhundert. Eine leichte Hemmung hinderte mich daran, mich daraufzulegen. Leider. Sicher hätte ich lockerer gesprochen, ekstatischer gebeichtet. Aber so: Ich kam mir blöde vor, als ich über mein ›Problem‹ sprach. Was hatte ich eigentlich? Ich hatte es mir zurechtgelegt, aber wieder vergessen. Irgend etwas mit Autodestruktion. Ich zerstörte mich selbst. Mich bedrückte, daß es sich für andere wahrscheinlich ironisch und pseudowitzig anhörte, und für mich selbst auch, wenn ich große Worte darüber machte. Man mußte sein Problem in einem bestimmten Ton vortragen, den ich nicht richtig hinkriegte, was mich traurig machte, denn ich wollte mich ja mitteilen.
Die Frau sagte, sie sei aus Gründen, die mich nichts angingen, nicht mehr in der kassenärztlichen Vereinigung. Deswegen müsse ich die 150 Mark pro Stunde – sie schlug drei Stunden Einführungsgespräche vor – selbst bezahlen. Die kassenärztliche Vereinigung sei so eine Sache für sich, darüber würde sie mir gern ein andermal etwas erzählen, aber nicht jetzt, ich möge das bitte schön akzeptieren. Sie fragte, ob ich meinen Vater gehaßt habe.
»O nein, natürlich nicht. Mein Vater war ein wundervoller Mensch. Ein bißchen schwach vielleicht. Ein bißchen schwach entwickelt im Geistigen, im Intellekt. Wahrscheinlich zu doof für diese Welt, wenn Sie entschuldigen, also wenn ich das so sagen darf …«
Bevor sie fragte, ob ich meine Mutter sexuell begehrt hätte, berichtete ich vom ›Problem‹.
»Wissen Sie, ich bestrafe mich für jeden Erfolg. Wenn ich beruflich reüssiere, vergraule ich mein Mädchen. Wenn ich in der Liebe Glück habe, versage ich beruflich. Erbe ich Geld, mache ich sofort einen schrecklichen Autounfall. Ich sorge dafür, daß es mir summa summarum eher schlecht geht, ja, daß meine Lage verzweifelt bleibt. Geht es mir einmal richtig gut, sterbe ich schier vor Angst. Ich muß dann die Situation wieder zerstören.«
Ich sagte, ich hätte zur Zeit ein wirklich nettes Mädchen und wolle es behalten. Das sei für mich ein riesiger Positivposten in der Lebensbilanz. Um trotzdem ein Gleichgewicht von Plusminusnull zu erhalten, müsse ich nun andauernd die schlimmsten Dinge tun. Kürzlich hätte ich meine mit Geldscheinen und Ausweisen prall gefüllte Brieftasche in den Fluß geworfen, um mich wieder besser zu fühlen.
Sie fragte nach einem weiteren Beispiel. Sie glaubte mir meine Geschichte nicht. Sie glaubte wohl, ich machte mir selbst etwas vor. Ich hätte mir da eine tolle Räuberpistole ausgetüftelt, an die ich selber glaubte. Doch was steckte wirklich dahinter? Haßte ich meinen Vater? Begehrte ich die eigene Mutter? Ich versuchte nun, etwas ratloser zu erscheinen. Ich baute viele »ich, äh« und »es ist so, äh« in den Redefluß ein.
»Wissen Sie … ich, das ist zum Beispiel … also, ich, äh, ich glaube äh, ich habe da ein Beispiel. Hm. Meine Freundin und ich sind in einem Lokal verabredet, äh. Wir lieben uns sehr sozusagen. Alles läuft, äh, so richtig gut eigentlich. Viel zu gut sozusagen. Ich verdränge dann, daß wir in dem LOKAL verabredet sind, so ein Restaurant ist das. Ich bilde mir plötzlich ein, wir wären in der Wohnung verabredet, und ich warte dort auf sie. Sie kommt aber nicht, sondern wartet in dem Lokal. Ich werde immer unruhiger, sie immer wütender. Der Abend vergeht. Ich gerate in Panik. Ich betrinke mich. Ich nehme Tabletten. Ich laufe wie ein Irrlicht durch fremde Straßen und anonyme Städte. Sie macht mit mir Schluß. Erst als alles zu spät ist, fällt mir die Lokalverabredung wieder ein.«
Sie fragte, welches Gefühl ich in den Sekunden hatte, als die Verabredung gemacht wurde.
»Ich fühlte mich schlecht. Ich hatte gar keine Lust zu kommen. Ich war gerade seit ein paar Minuten ein bißchen schlecht gelaunt, deprimiert so ein bißchen. Ich langweilte mich gerade, sah trübe aus dem Fenster, dachte an die endlos anstrengende Sache, die bevorstand … Ich hätte mich nämlich mit einem wildfremden Allerweltsangestellten unterhalten müssen, den meine Freundin bereits seit Stunden abfüllte, irgendein entfernter Bekannter von ihr, von dem ich dachte, er müsse langweilig sein. Das, äh, war er gar nicht, was ich da aber nicht wußte. Nein, ich hätte mich viel lieber mit eigenen Freunden getroffen, mit Künstlern, Berserkern, Außenseitern, mit schwierigen, charismatischen, gebrochenen, kurz: kreativen Menschen. Ich hätte mich gerne anregen, inspirieren lassen an diesem Abend, denn ich hatte gerade meinen Job so gut wie verloren und brauchte irgendwelche neuen Ideen. Ich wollte, äh, als Autor wieder arbeiten, und dazu braucht man das Abseitige und Abweichende, wenn man auf Ideen kommen will …«
Sie schien mich absolut nicht zu verstehen, und so wiederholte ich den letzten Gedanken, der mir jetzt natürlich total hohl vorkam:
»Ich, äh, brauche zwei Dinge im Leben: Inspiration und, äh, Liebe. Die Frauen geben mir die Liebe, alles andere geben mir die Künstler. Irgendwie, äh. Dazwischen gibt es nichts. So ein normaler Angestellter höhlt mich nur aus. Deshalb meine Unlust in dem Moment der Verabredung mit meiner Freundin sowie einem Vertreter der bundesdeutschen Angestelltenkultur.«
Die Alternativanalytikerin fragte mich, ob mir jene ›Unlust‹ denn bewußt gewesen sei.
»Ja. Aber ich hätte mich niemals getraut, das zu sagen …«
Die vierzig Minuten waren erschreckend schnell um, zumal wir noch tatsächlich und sehr ausführlich über die kassenärztliche Vereinigung sprachen. Ich ging mit dem Gefühl, von meinem Problem bereits ein Zipfelchen erkannt zu haben: Ich konnte gegenüber meiner Partnerin meine Interessen und Gelüste nicht äußern. Daran mußte ich nun ›arbeiten‹. Wir verabredeten zwei weitere Termine. Ich war nicht begeistert, aber guter Dinge.
Der erste männliche Arzt war noch um ein Vielfaches besser. Von der billigen Studentengegend kämpfte ich mich nämlich ins halbwegs lebenswerte Winterhude vor, in die Sierichstraße, Ecke Maria-Louisen-Straße, nicht weit weg vom hochbürgerlichen Johanneum. Das Johanneum ist ein 465 Jahre altes Elitegymnasium in der Hansestadt. Wenn es hier keinen guten Arzt gab, wo dann?
Es handelte sich um eine Gemeinschaftspraxis von sieben behandelnden Therapeuten. Einen Empfang gab es nicht. Ich befand mich ziemlich unvermutet in einem Labyrinth von Behandlungszimmern, genauer gesagt: in einem mehrfach gebogenen, verwinkelten Flur einer hohen, dunklen Altbauwohnung. Einige Türen waren geöffnet und die Zimmer leer – überall sah ich erneut die typische Sigmund-Freud-Couch mit den persischen Deckchen drauf, als könne man die Dinger irgendwo im Dutzend bestellen –, andere Türen waren zu, und ich hörte das Sorgengemurmel der Patienten.
Ich war nun, nach zwei Frauen, sehr gespannt, auch auf mich selbst. Würde ich dem Seelendoktor dasselbe erzählen wie seiner weiblichen Kollegin? Und würde er andere Fragen stellen? Würde ich, bereits weitergebracht durch das erste Gespräch, auf einem höheren Niveau beginnen? Kam ich langsam hinein in die Psycho-Szene? Ging es mir vielleicht bereits besser? Ich wußte, daß ich mich ungern wiederhole. Ich würde also etwas anderes erzählen, etwas Neues, aber was? Leider führten wir nur ein sogenanntes ›Delegationsgespräch‹. Dr. Dr. Tönnies war nämlich ein richtiger Arzt, mit richtigem Diplom, und er mußte für jenen anderen Arzt, der kein richtiger Arzt war, wohl aber sein Freund und Kumpel, bescheinigen, daß ich in Behandlung mußte. Dieser Delegationsarzt also, ein knapp Vierzigjähriger in Jeans und Turnschuhen, kam schnell auf den Punkt.
»Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater?« fragte er nicht ohne Neugierde. Ich gab ihm die entsprechende Antwort.
»Und wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter?« wollte er wissen. Ich sprach etwa zehn Minuten und faßte ungefähr wie folgt zusammen:
»Er (der Vater) war Kriegsteilnehmer. Dem Leben war er nicht sonderlich gewachsen. In den Redeschlachten mit meiner Mutter zog er immer den kürzeren. Er war eben nicht eloquent – der Krieg hatte ihn geprägt. Er tat mir leid. Er war Lehrer und wollte außerhalb des Unterrichts nichts mit Kindern zu tun haben, also leider auch nichts mit den eigenen. Es gibt da noch einen zwei Jahre älteren Bruder, der Ekkehardt heißt, wissen Sie.«
»Welches Problem haben Sie denn nun genau?« fragte der Arzt aggressionslos, fast süßlich. Seine Physiognomie hatte übrigens rein gar nichts, was ich mir hätte merken können.
»Ich leide wohl unter einem echten ›Trauma‹ … Ich scheine genauso versagen zu müssen wie mein Vater.«
»Wann trat das zum ersten Mal auf?«
»Das habe ich mich auch oft gefragt. Da gab es nämlich einen Bruch. Bis ich zwölf war, war ich lustig, koboldhaft, ein Clown, sehr lebendig. Und dann: das Grauen. Das Trauma trat nämlich auf, als ich aufgeklärt wurde.«
»Aha!«
»Der Himmel verzog sich, alles wurde grau. Das Leben hatte seine Farbe verloren, seinen Spaß und seinen Sinn. Seitdem vegetiere ich nur noch. Besser wurde es erst mit der ersten Freundin. Bis dahin hatte ich, immerhin dreieinhalb Jahre lang, eine Zwangsphobie zu bekämpfen: Ich hatte Angst, schwul zu sein. So wie ich heute die Zwangsphobie habe, meine Freundin würde mich verlassen. Beides nährt sich irgendwie aus derselben Quelle. Ich möchte herauskriegen, welche.«
»Sie sollten eine Analyse machen. Es muß Ihnen geholfen werden.«
Ich sagte ihm, daß das auch meine Meinung sei. Im vorletzten Monat, das war der April, seien meine Angstzustände schier unerträglich gewesen.
»Es ist wie ein Zug, der abfährt und den ich verpasse. Ich laufe hinterher und schaffe es nicht. Meine Freundin ist einfach stärker, schneller, kompetenter, intelligenter, eloquenter, denkt besser, kennt das Leben besser, macht alles richtig, ermüdet nie … und ich versage, und sie erkennt immer mehr, was für eine Flasche ich bin. Mir bricht der Angstschweiß aus, ich verzögere die Entwicklung, aber es ist unvermeidlich: Sie sieht, was für ein Totalausfall ich bin, und wirft mich weg wie eine faule Tomate, und ich drehe durch, habe alles verloren, habe mich für sie ruiniert, lande in der Gosse, ja: muß mich umbringen. Ich habe so schreckliche Angst, mich schließlich umbringen zu müssen …«
»Sie brauchen Hilfe. Ich werde Ihnen bescheinigen, daß Sie eine Analyse benötigen.«
»Ja. Bei allen Frauen war es so, daß ich mich am Ende heillos unterlegen fühlte und wie paralysiert in den Abgrund starrte. Ich konnte schließlich nicht mehr arbeiten, nicht mehr mit anderen Menschen kommunizieren, war gefangen im Angstzustand …«
»Ich schreibe Ihnen das jetzt auf, daß Sie eine Analyse brauchen. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Ihrer letzten Partnerin gewesen?«
»Wieso gewesen? Ich habe sie ja noch.«
»Sie haben noch immer eine Partnerin?« fragte er erstaunt.
»Ja. Also … wie soll ich es griffig ausdrücken … Mein Verhältnis zu ihr … es gibt da so ungefähr eine Million Küsse pro Tag. So Schmuse-Orgien, wissen Sie. Wir schlafen täglich miteinander und mögen uns sehr. Um so schlimmer ist meine Angst, sie könne entdecken, was für ein Flop ich bin.«
»Haben Sie Ihren Vater gehaßt? Hatten Sie je die Phantasie, ihn womöglich töten zu können? Oder Ihrer Freundin Gewalt anzutun?«
»Nein … wirklich nicht. Ich habe meiner Freundin gegenüber einen Minderwertigkeitskomplex, weil mein Vater ein Versager war. Dabei mochte ich ihn ganz gern und fand, daß man ihn unfair behandelte. Ununterbrochen hat die Frau ihn angegiftet – dabei konnte er doch nichts dafür, nicht so eloquent zu sein. Sie hat ihn zum letzten Deppen gemacht, zur Wurzel allen Übels, den armen Kerl. Ich wiederhole mich. Er tat mir so leid. Das Leben hat ihn zerrissen, er hatte nicht den Hauch einer Chance.«
»Und jetzt ist es mit Ihnen und Ihrer Freundin ganz ähnlich, nicht wahr? Finden Sie nicht? Sie kommen irgendwie nach dem Vater, oder?«
»Jaja, schrecklich.«
»Das ist die Vererbung.«
»Wenn man doch nur etwas dagegen tun könnte. Meine Freundin ist ja auch so eloquent. Sie redet von morgens bis abends. Sie ist eine rheinische Frohnatur, wissen Sie. Anfangs habe ich hundertmal am Tag kontra gegeben. Jetzt habe ich nur noch Angst. Ich frage mich nur noch, ob ich etwas Falsches sagen könnte – und höre lieber bloß zu, angestrengt aufmerksam und mucksmäuschenstill. Bloß keinen Ärger machen! Sonst macht sie mich fertig, wie einst meine Mutter meinen Vater. Ich lebe in permanenter Angst. Sage ich etwas, macht sie mich fertig. Sage ich nichts, entlarve ich mich als Flop. Dabei ist das alles Quatsch. Denn sie liebt mich ja.«
»Was passierte, als Sie 13 wurden?«
»Ich wurde, wie gesagt, ›aufgeklärt‹. Von meiner Mutter. Das hat mir den totalen Schock versetzt. Von da an war das Leben vorbei.«
»Was war so schlimm an der Situation? Begehrten Sie Ihre Mutter sexuell?«
»Tja, LOGISCH ist das nicht herleitbar. Ich weiß noch, wie wir in dem stillen, toten Schlafzimmer waren, wie sie flüsternd und verdruckst davon sprach, von diesen Ungeheuerlichkeiten. Und wie die Vögel aufhörten zu singen, die Blätter von den Bäumen fielen, wie alles kraftlos und traurig wurde auf der Welt.«
»Was hatten Sie denn vorher gedacht, über das Thema?«
»Nichts. Komplett verdrängt. Den Unterschied zwischen Jungen und Mädchen hatte ich in der Phantasie regelrecht wegretuschiert.«
»Wenn Sie solche starken Verlassenheitsphobien haben und möglicherweise schon als Kleinkind hatten, wäre das eine Erklärung: Der Unterschied – als trennendes Element – hätte Ihnen Angst gemacht, und so verdrängten Sie ihn.«
Donnerwetter! Das war die erste Erklärung des Arztes! Er wagte sich erstmals vor ans Netz. Warum? Weil die Stunde zu Ende war. Ganz am Ende wollen die Ärzte den Leuten wenigstens IRGEND ETWAS mit auf den Weg geben. Dr. Dr. Tönnies stand auf und verabschiedete mich. Es war ja nur eine Delegationsstunde gewesen, und wir würden uns niemals wiedersehen. Er lächelte, sah mich aber nicht an und drehte sich rasch weg.
Tags darauf besuchte ich wieder zwei Ärzte hintereinander. Ich merkte, daß ich es nicht mehr schaffte, meine Story ein weiteres Mal dramatisch vorzutragen. Da war ein endvierziger Bartträger im besten Eppendorf, der sein Leben lang Studienräte in seinem Haus in der Toskana behandelt hatte. Sein Bart war weiß durchsetzt und blaßblond. Seine Augen wirkten auf mich wäßrig und müde, also gar nicht. Er hatte die Hagerkeit des Ökos und die Arroganz gegenüber dem Nichtöko, dem lebhaften Menschen. Bäume starben, und ich lachte noch! Aber das Lachen würde auch mir noch vergehen … Er sprach wenig, und wenn, dann schleppend und lahm. Er schien Mühe zu haben, seine wenigen Gedanken in Worte zu fassen. Auch ich hatte wenig Lust, irgend etwas zu sagen. Bei Dr. Tönnies war ich bis zum Ödipuskomplex vorgedrungen – hier quälte ich mich erneut durch den Anfang. Ich hatte das meiste auch schon wieder vergessen und verdrängt, was ich den anderen Ärzten gesagt hatte. Schlimm! Schon Minuten nach der Beichte wußte ich nicht mehr, was geredet worden war. Wie sollte es dann langfristig nutzen? Zeigte das nicht, wie hochgradig belanglos und unnatürlich der Psycho-Talk im Grunde war? Es rüttelte mich auch nicht auf, bewirkte so gut wie nichts in mir.
Dieser Toskana-Fraktion-Arzt war nun wieder einer von der Sorte, die andauernd schwieg. Ich erzählte, daß mein Vater ein Versager gewesen sei und ich deswegen in Zweierbeziehungen ein ebenso großer Versager sei, obwohl ich eigentlich klüger und fähiger sei als er. Der Arzt fragte, was das denn mit mir zu tun habe, diese Bemerkung; er verstünde den Zusammenhang nicht. Ich sagte:
»Nun ja, es ist eben zwanghaft. Ich MUSS lauter Mist bauen, um auch so zu versagen.«
»Ja, und was hat das jetzt mit Ihnen zu tun? Ich weiß nicht, warum Sie mir das erzählen. Sie erwarten von mir eine gewisse Hilfestellung, die ich Ihnen aber nicht geben kann. Sie sagen, daß Sie ›fast am Ende‹ seien. Aber Sie halten mich außen vor. Das schaffen Sie noch.«
Ja, was sollte ich ihm sagen? Um ihn zu beeindrucken, erzählte ich die Geschichte von der weggeworfenen Brieftasche. Es beeindruckte ihn nicht. Dann dachte ich, ich erzähle auch ihm die Ödipusgeschichte:
»In meiner beginnenden Pubertät gab’s wohl ein sogenanntes Trauma. Ich verband das Geschlecht an sich untrennbar mit der Person meines Vaters. Ich dachte, wenn ich Frauen gegenüber ein Mann sein wolle, müsse ich so sein wie mein Vater. Die Alternative wäre Homosexualität oder das Leben als Alleinstehender gewesen. Beides war noch unbeschreiblich schrecklicher als das Versagertum meines Vaters. Ich fürchtete mich vor dem Schwulsein, und ohne Liebe konnte ich auch nicht überleben. So mußte ich wohl wie mein Vater sein, wohl oder übel.«
Ich erinnerte mich, daß es in meiner Urschrei-Therapie vor einigen Jahren genau darum gegangen war: um die Auflösung dieser Vernetzung. Da der damalige Therapeut sehr alt und groß war, in jeder Hinsicht ein Übervater, gelang es ihm recht gut, mir einen Gegenbefehl zu vermitteln, der wenigstens kurzfristig den vor Urzeiten eingebrannten Befehl ›Sei wie dein Vater gegenüber Frauen‹ aufhob. Es war eine schöne Zeit gewesen, damals. Leider hatte ich die Therapie abgebrochen, weil sie so bedrohlich erfolgreich wurde. Nur noch wenige Monate, und ich wäre ein anderer gewesen. Dagegen sträubte sich in mir verständlicherweise das latent wirkende, abgespaltene andere Ich, das ein destruktives Terroristenleben führte und das dann abgestorben wäre.
Der zweite Therapeut, den ich an dem Tag noch aufsuchte, erklärte mir das so. Mit dem Eppendorf-Guru war ich bald fertig. An der ersten interessanten Stelle unterbrach er und sagte, die Stunde sei zu Ende. Ich war auch zu spät gekommen, so daß er wohl recht hatte.
Zwischen den Sitzungen ging ich am Eppendorfer Baum spazieren. Ich trank einen Kaffee und schlenderte über den Klosterstern. Es war Anfang Juni und die Sonne schien. Ich dachte, es müsse schön sein, das Leben genießen zu können, die Bäume zu sehen und die Menschen und den Himmel. Ich konnte das nicht. Ich war ein Angstmensch, sobald ich der Mann einer Frau war. Und sobald ich nach draußen ging, nahm ich außer meiner Angst praktisch nichts wahr. Deshalb blieb ich meistens in der Stube und bereitete mich auf die gemeinsamen Stunden vor. Viel Geld verdiente man damit nicht. Dieses Mal wollte ich meine Angststruktur und mein Zwangsverhalten durchbrechen, denn die Frau, die ich gefunden hatte, war es wert. Und ich selbst war es wert, diese Frau zu besitzen. Weniger pathetisch: Diese Frau schlug alle vorherigen um Längen. Mit ihr hätte ich erstmals das absolut »gute Leben« aufbauen können, im Prinzip.
Der zweite Arzt des Tages war mir auf Anhieb sympathisch. Ein häßlicher, kahlköpfiger, dunkelhäutiger Inder! Wahrscheinlich ein Deutsch-Inder, der hart ums eigene Überleben und Anerkanntwerden hatte kämpfen müssen, einer also, der die Schmerzen der Ausgrenzung und die Abgründe des Leids kannte. So einer verstand mich natürlich sofort besser. Wir schüttelten uns erfreut die zupackend-hektischen Neurotikerhände, und mit leichter Übelkeit mußte ich an die schlaffe Hand des Toskana-Arztes denken, die beim Abschied wie Vanillepudding in der meinen geruht hatte.
Der Inder kam rasch zur entscheidenden Stelle. Die Gefahr sei, daß mein abgespaltenes Ich, das für den Mißerfolg meines Lebens zu sorgen hatte, um mich vor Homosexualität und Lieblosigkeit zu beschützen, auch den entscheidenden Therapieerfolg sabotieren würde. Schließlich wirke dieses abgespaltene Ich außerhalb meines Bewußtseins, sei also durch mein Bewußtsein nicht beeinflußbar. Welches Bewußtsein könnte auch allen Ernstes die absichtliche Selbstschädigung zulassen? Das ging nur durch Abspaltung und den Marsch in den Untergrund. Und dort kann es nun munter bis in alle Ewigkeit weiter Anschläge vorbereiten und durchführen, wie die RAF. Logischerweise müßten die Anschläge sogar noch an Härte zunehmen, sobald die Therapie praktische Alltagserfolge zeitige.
Ich nickte begeistert. Der Mann verstand etwas von der Sache. Ich sagte, mir sei diese Seite in mir manchmal fast wie ein Dämon vorgekommen. Dieses Wort gefiel ihm, und er nahm es fortan öfter auf. Er sprach nun lieber von meinem »Dämon« als von meinem »abgespaltenen Ich«. Er sagte, er könne mir die geschilderten Symptome, wie die Angst und die Selbstwertprobleme gegenüber meiner Frau, sofort wegtherapieren, aber der Dämon sei damit noch nicht geschlagen. Das würde wohl viel Zeit brauchen. Denn dieses Verhaltensmuster habe sich anscheinend schon ziemlich verselbständigt. Meinte er damit, daß dieses andere ›Ich‹ tatsächlich schon so etwas wie ein eigenes Bewußtsein besaß und damit ebenso große Angst vor dem eigenen, individuellen Tod hatte wie das eigentliche, offizielle Ich? Würde mein offizielles Ich jemals qua höherer Einsicht freiwillig in den Tod gehen? Niemals. Wie sollte ich es von dem anderen Ich erwarten können? Dennoch mußte es möglich sein. Es gab ja auch Leute, die qua höherer Einsicht fürs Vaterland starben. Es ging also.
Zwei Dinge fielen mir an dem indischen Arzt noch auf. Er verlangte kein Krankenkassen-Scheckheft, nahm meine Personalien nicht auf und sagte auch nicht, er habe in den nächsten 18 Monaten keinen Therapieplatz frei. Wir machten einen neuen Termin. Es war klar, daß es dem Mann nicht um Formalien, sondern um die Sache selbst ging. Wenn die Sache es erforderte, würden wir beide sicherlich auch die Formalien regeln – aber nicht vorher. Natürlich konnte sein Verhalten auch einen anderen, schrecklichen Grund haben: Womöglich durfte er Kassenpatienten gar nicht behandeln? Dann würde ich, wie schon bei der letzten Therapie, schnell 20000 Mark loswerden. Und vielleicht hatte die letzte Therapie auch nur gewirkt, weil ich dabei nicht nur viel Geld, sondern auch meine Schreibkraft und somit mein einziges Kapital verlor? Vielleicht war es genau dieses untergetauchte, ›subversive‹ Ich, das schreiben konnte, und das nun tatsächlich bereits ziemlich geschwächt war? Dann konnte ich davon ausgehen, es bald vollständig zu besiegen, mir aber freilich einen ganz anderen Job suchen zu müssen. Das alles war doch ziemlich aufregend. Ich freute mich auf die nächsten Begegnungen. Am liebsten wäre ich bei dem Inder geblieben, aber ich war zu faul, alle bereits getroffenen Verabredungen mit weiteren Ärzten schon jetzt abzusagen. Und so traf ich am nächsten Tag den ›Klaus-Kinski-Arzt‹, also den Mann mit der manischen Stimme, auf den ich mich ja anfangs am meisten gefreut hatte.
Er erfüllte die Erwartungen. Doch bevor ich von ihm erzähle, muß ich das unangenehmste Erlebnis meiner Psycho-Tour loswerden: Denn noch vor meinem Besuch bei ›Klaus Kinski‹ ging ich zum niedergelassenen Therapeuten Kohlschläger. Er gehörte zu der Eppendorfer Clique um den ›Delegationsarzt‹ Dr. Tönnies und dem hageren Weißbart Lagestein, Stichwort Toskana-Fraktion. Der niedergelassene Therapeut Kohlschläger wohnte in jenem unattraktiv-spießigen Teil Eppendorfs, der aus Kleingartenkolonien und schwärzlich verkohlten Backsteinbauten aus der Nazi-Zeit besteht: Baumkamp. Hier bekam auch jener Depressionen, der noch nie welche hatte. Wer hier durchmarschierte, begann Hamburg zu hassen: als wohnte in jeder Parzelle ein tausendfach geklonter, 65jähriger Uwe Seeler. Ich war einmal in einem Kino in dieser Gegend gewesen und hatte anschließend graue Haare auf dem Kopf. Ich riß sie aus, und sie wuchsen nicht nach – weil ich nie wieder dorthin ging. Als mir die Adresse nun bewußt wurde, versuchte ich zweimal, den Termin abzusagen, erwischte aber nur den Anrufbeantworter. So fuhr ich nun hin, durch Sonnenbrille, Hut und Handy geschützt. Das Handy sollte die Rettungslinie zu meiner lebenslustigen Freundin darstellen, sie hieß übrigens Daphne Blücher, es war die Nabelschnur zur Welt. Ich sagte ja schon, daß mein Verhältnis zu meiner Freundin das eines Kleinkindes zu seiner Übermutter war, eine angenehme Sache übrigens. Der Therapeut Kohlschläger war so alt wie mein Bruder, hatte tiefe Leidensspalten um den Mund und aufgeplusterte Backen. Mein Bruder war zwei Jahre älter als ich und hieß Ekkehardt, der Name dürfte sich nun eingeprägt haben. Dieser Therapeut starrte mich so empört wie durchdringend an. Sein fahles Plustergesicht schrie in hoher Erregung: ›Wie können Sie es wagen?!‹ Die unmodern halblange und ohrenbedeckende Stufenschnitt-Frisur schien sich zu sträuben. Gut, ich war zehn Minuten zu spät. Ich hatte den Wagen aus Versehen zunächst zum Braamkamp statt zum Baumkamp gesteuert (beide Straßen waren gleich häßlich und leicht zu verwechseln).
»Was soll das?!« fragte er.
Ich erklärte meine Verspätung. Er wollte das nicht hören, sagte Sätze wie »Ich weiß nicht, was Sie noch wollen«, »Warum sind Sie überhaupt hier«, »Ihr Verhalten ist ausgesprochen anstandslos und jenseits jeder Moral und Mitmenschlichkeit« – der Mann war, das sah jedes Kind, zutiefst gekränkt. Was hatte ich ihm getan? Nun, ich hatte auf Band die Nachricht hinterlassen, daß ich wahrscheinlich einen anderen Therapieplatz bekomme. Das war mir schon aufgefallen: Jeder Arzt fragte mit klitzekleinen blitzenden Augen, ob man sich noch anderswo umgesehen habe, oder ob er, der behandelnde Arzt, ›der einzige‹ sei. Kohlschläger wollte mich nicht in die Wohnung lassen, meinte aber, er müsse mir die Stunde dennoch in Rechnung stellen. Daraufhin sagte ich schroff, er müsse die Stunde auch geben, und ging an ihm vorbei in die Praxis. Sie war außerordentlich ärmlich und unfrisch. Der Raum eines ewigen Junggesellen. Das Deckchen auf dem Tisch war jahrelang nicht gewaschen worden. Alles muffte. Kohlschläger trug keinen Ehering – es hätte auch keiner über seine fleischigen Finger gepaßt. Ich stellte ihm Fragen zu seiner Methode und begann, meinen Fall und meine Geschichte zu schildern, aber es wirkte absurd. Ich hörte die üblichen ausweichenden Gemeinplätze: Eine Therapie brauche lange Zeit, auf jeden Fall mehrere Jahre, vorher bewege sich da gar nichts, Methoden wisse man nicht, das sei von Person zu Person verschieden, Heilung könne nie versprochen werden, die Krisen können während der Behandlung auch zunehmen, alles könne durchaus auch viel schlimmer werden, der größte Erfolg stelle sich oftmals ein durch die Androhung einer Therapie, die dann nicht begonnen werde. Die Neigung, die Therapie abzubrechen, sei immer groß. Ich wollte schon fragen, wie viele Patienten seine Therapie denn NICHT abgebrochen hätten, ließ es aber. Die ganze Zeit behielt er dieses beleidigte Gesicht. Mit schweren Depressionen verließ ich den Mann. War es nicht besser, diesen Psycho-Quatsch sofort fahrenzulassen? Ging es mir wirklich so schlecht, daß ich so etwas nötig hatte? Mit letzter Kraft schleppte ich mich, wie angekündigt, zum Klaus-Kinski-Doktor.
Sein Aussehen überraschte mich. Keine irren blauen Augen, keine langen blonden Haare, kein hektisches Gefummel mit den Händen. Gewiß, er war verrückt, trug eine schwarze, topfförmige Rundperücke und einen schwarzen Günter-Grass-Schnauzbart. Das Haus, in dem er wohnte, war angemessen unheimlich: Art déco, frühe zwanziger Jahre, Steinfiguren im dunklen Treppenhaus, ein gußeiserner Lift, der stehenblieb. Auch die Wohnung war dunkel und mit afrikanischen Kunstgegenständen angefüllt. Aber Dr. Kinski war nicht manisch genug. Meine Rede beeindruckte ihn. Er wirkte unsicher.
Ich versuchte, bei dem anzuknüpfen, was der Inder gesagt hatte: Es sei schwer, dieses zerstörerische andere Ich zu bekämpfen; leichter sei es, mein Selbstwertproblem gegenüber Daphne Blücher aus der Welt zu schaffen. Kinski gab zu bedenken, daß es solch ein festgefügtes anderes Ich gar nicht gebe. Die ganze dualistische Konstruktion von zwei verschiedenen Ichs sei Einbildung. In Wirklichkeit gebe es nur eine Gesamtpersönlichkeit, nämlich mich, und ich müsse einfach lernen, alle einzelnen Teile in mir zu akzeptieren.
»Herr Doktor«, sagte ich und wirkte womöglich spöttisch, »wenn ein Triebtäter so vorginge, würde er ja weiter Leute umbringen, nur daß er dann kein schlechtes Gewissen mehr hätte.«
Nein, sagte Kinski, er würde ja einsehen, daß das nicht gehe. Aha, dachte ich, demnach kann eine erfolgreiche Analyse die Kontrolle über sich selbst zurückgeben. Aber irgendwie blieb das alles unklar. Schließlich hatte Old Kohlschläger gerade noch erklärt, ein Erkennen der eigenen Intentionen und Ursächlichkeiten führe keineswegs zur Möglichkeit eines alternativen Handelns. Das käme entweder überhaupt nicht oder erwachse bestenfalls zufällig aus der langen Dauer einer Therapie. Ein neues Verhalten müsse ebensolange heranwachsen, wie das alte Verhalten gebraucht habe zu entstehen. Die Idee vom plötzlichen Trauma, vom Schock, der nur einmal nacherlebt werden mußte, um das traumatische Fehlverhalten auf der Stelle auszulöschen und eine bestimmte Arretierung in der Seele zu lösen, hatte Kohlschläger nicht. Und Kinski wohl auch nicht so recht. Doch genau das war MEINE Idee. Ich war davon überzeugt. Ich mußte einen Arzt finden, der noch an Freud glaubte.
Kinski glaubte eher an mich. Fasziniert, mit offenem Mund, lauschte er meinen Räuberpistolen und Familiengeschichten. Ich erzählte, wie ich schlagartig taubstumm geworden war, als ich merkte, daß ich meine langjährige Freundin plötzlich liebte. Ich erzählte von meinen Lähmungen, die mich immer überfielen, wenn mir etwas zustieß, das »einfach zu schön« war. Sprach von meinen »Es darf nicht sein«-Vorstellungen. Ich erzählte, daß ich ein Medium sei und immer nur etwas Gutes bewirken könne, wenn ich an anderer Stelle etwas Böses verursachte. Mister Kinski fand das ganz spannend, trug aber nichts Neues zu meinem Fall bei. Und so ging ich weg, ohne zu wissen, ob ich noch einmal hingehen sollte.
Die vielen Gespräche hatten bis zu diesem Zeitpunkt nicht viel gebracht, dachte ich. Dennoch war ich meinen eigenen Zwangshandlungen gegenüber etwas bewußter geworden.
Als ich zum Beispiel vor einem wichtigen beruflichen Treffen meine Freundin zu mir bestellte, schloß ich schon im Vorfeld messerscharf, daß es nur darum gehen könne, positive Energie aus der Liebesbeziehung in die Berufsbeziehung zu transformieren. Ich brauchte einen Mißerfolg in der Liebe, um einen Erfolg im Beruf zu plazieren. Tatsächlich verdunkelten sich unsere Gefühle auf entsetzliche Weise, und mein berufliches Gespräch verlief positiv. Gleich darauf, als ginge es mit dem Teufel zu, traf ich zufällig erneut meine Freundin und konnte weiter auf ihr herumhacken. Ich fuhr sie durch die Stadt und sprach von unserer bevorstehenden Trennung. Ich setzte sie irgendwo ab, und als ich sie wieder abholen wollte, verpaßte ich sie. Sie kam zwar zur vereinbarten Stelle, aber ich sah in die entgegengesetzte Richtung, so daß ich sie nicht bemerkte, als sie aus der Tür trat. Ich weiß noch, daß ich mich wunderte, daß ich dauernd und verkrampft in die falsche Richtung starrte. Später versuchte ich ganz bewußt, gegen diesen zerstörerischen Impuls vorzugehen. Ich zwang mich, nette Sachen zu sagen. Ich zwang mich, sie am Abend zu besuchen. Ich zwang mich, sie anzurufen. Ein bißchen schien das zu klappen. Beim Einschlafen merkte ich, daß ich eine Erkältung bekam. Immer, wenn ich mir verbot, mich zu schädigen, wurde ich krank. Ich hatte schon einmal drei Jahre lang fast täglich Migräne gehabt – das war während einer Schlammbad-&-Urschrei-Verhaltenstherapie beim Heilpraktiker gewesen. Von dieser Therapie vielleicht später mehr. Ich SEHNTE mich nach diesen Zeiten zurück. Ich war damals tatsächlich ungemein erfolgreich gewesen. Heute wollte ich gern meine alte Migräne wiederhaben, wenn ich dadurch Daphne Blücher behielt. Aber noch lieber wollte ich natürlich richtig geheilt werden. Dummerweise wollte sich partout kein hundertprozentig passender Analyse-Professor finden lassen! Ich probierte herum bis zum Erbrechen. Daphne Blücher dagegen hatte auf Anhieb einen sonoren, älteren, vertrauenerweckenden, weisen Arzt gefunden, der ihr auf der Stelle half. Irgendwie hatte bei meiner verzweifelten Suche schon wieder ein vermaledeiter Geist seine Hand im Spiel, ich hatte einfach KEIN GLÜCK! Und ich hatte keine Kraft mehr, meine Story ein weiteres Mal einem 45jährigen Midlife-crisis-Mann zu erzählen, der mich an meinen Bruder erinnerte. Wobei mein Bruder richtig nett sein konnte, manchmal. Der Stimme nach hatte ich noch einen guten Arzt in petto, den ich treffen wollte, ein älterer Dr. Sauerbruch alias Dr. Friedrich. Und dann hatte ich noch einen Termin bei einem richtigen Professor. Da ging ich noch hin. Ansonsten ruhten alle Hoffnungen auf dem Inder.
Der richtige Professor hieß Diederichs und war ein junger Mann mit Glatze – eine gute Mischung, fand ich. Er praktizierte in derselben Straße, ja in demselben Haus wie jene rothaarige Rottweiler-Therapeutin mit den Lackstiefeln und der unaufgeräumten Wohnung, die ich gleich zu Anfang kennengelernt hatte. Sie fand sich, wie der Leser sich erinnert, besonders klug in der ›Ich weiß, daß ich nichts weiß‹-Pose und sagte immer nur, niemand könne etwas für mich tun, am wenigsten ich selbst, ich solle mir im Krankenhaus Tabletten geben lassen. Ich erinnerte mich, vor allem an ihre Säuferstimme. Ich klingelte trotzdem in dem Haus, schließlich wollte ich einmal sehen, wie so ein echter Professor vorgeht. Der mußte ja nun wirklich etwas können.
Die Wohnung des Professors war unaufdringlich und geschmackvoll, ohne Designer-Quatsch, sehr weiträumig, mit altem, edlem, still atmendem und daher kerngesundem Mobiliar bevölkert. Die Augen des Mannes waren ernst und aufmerksam, wie die eines Chefarztes, der ein Kind operiert, das gerade unters Auto gekommen war. Ich legte gleich los, da er mich so erwartungsvoll ansah und einen gezückten Füllfederhalter in der Hand hielt – er wollte alles mitschreiben. Ich sagte:
»Ich will eine Psychoanalyse machen, da ich mich zwanghaft selbst zerstöre. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es eignet sich gut, weil es extrem und fast lustig ist und gerade erst passiert ist …«
Ich erzählte die Geschichte von den gefälschten Leserbriefen von Prominenten, die ich als Textchef geschrieben und gedruckt hatte, woraufhin ich meinen Job verlor. Einen Traumjob mit 120000 Mark im Jahr, unbegrenzter Macht und wenig Arbeit. Mein Verhalten, sagte ich, sei irrwitzig gewesen. Ich hatte Helmut Kohl Worte in den Mund gelegt, ohne daß dieser etwas ahnte. Genausogut hätte ich mir ein Interview zwischen Bill Clinton und Madonna ausdenken und abdrucken können. Die Grenze des Wahnsinns war überschritten. Es war eine Art Amoklauf. Den mußte ich stoppen.
Der Arzt wollte wissen, ob das Verhältnis zu meinem Chef gestört gewesen war. Handelte es sich womöglich um eine Rache an dem Chef? Oder um eine Rache an der ganzen Zeitschrift? War ich enttäuscht gewesen? Wollte ich in Wirklichkeit gar nicht mich, sondern andere zerstören? Er stellte mir viele Fragen zu dieser Situation, in der ich damals gehandelt hatte. Schnell zeigte sich, daß ich diese Zeitschrift immer komplett verachtet hatte, daß ich ihr nicht zubilligte, was ich für meine Qualität hielt und was mich auszeichnete: In meinen Augen war ich kritisch, geistreich, anregend und pädagogisch wertvoll. Diese Zeitschrift war affirmativ, geistlos, abstumpfend und ließ die Menschen charakterlich verwahrlosen. Ein reines Konsumblatt mit der Parole: ›Kaufe! Dann bist du geil und gut! Alles andere zählt nicht!‹ Ich sagte das dem Doktor, der das sofort verstand. Denn als ordentlicher Professor unseres Staates stand er außerhalb jener totalen Konsumideologie, die weite Teile von Wirtschaft und Gesellschaft inzwischen beherrschte und die die Menschen blind machte. Er nickte ernst, schrieb alles mit, stellte Fragen. Dennoch kam mir mein damaliges Kamikaze-Verhalten, Leserbriefe zu fälschen und noch andere Sabotage-Akte, jetzt absurd vor. Okay, die Zeitschrift war geistlos, na und? Drehte man deswegen durch, als erwachsener Mensch? Alle behandelten mich supernett. Ich liebte diese Leute. Wieso hätte ich mich an ihnen rächen sollen? Nein, von Anfang an war die Situation die gewesen, daß ich fassungslos vor den absolut geistlosen Texten saß und nicht wußte, was ich damit tun sollte. Manchmal schrieb ich einen Text neu, und dann war der Skandal da: Alle waren bestürzt. Die Blatt-Ideologie war verletzt, nämlich das Gebot: Es darf nichts drinstehen in den Texten. Man darf sich nicht festlesen. Die Leser dürfen nicht in die Texte hineingezogen werden. Sie müssen bei den Bildern bleiben, sie müssen BLÄTTERN.
Und dennoch: Auch das Stapeln von Apfelkisten ist geistlos, wäre aber bei einem Lohn von tausend Mark die Stunde sinnvoll. So war meine Situation. Ich hätte ohne Anstrengung reich, glücklich, gar Familienvater werden können. Mir dies zu verweigern, war pathologisch. Ich kam nicht darüber hinweg. Ich begriff es nicht. Übrigens hatte ich denselben Fall noch extremer in der Werbung erlebt. Dort war ich, ganz ohne Sabotage-Akte, nach vielen genialen Werbe-Ideen, die stets ärgerliches Kopfschütteln, Ekel und Befremden ausgelöst hatten, rausgeworfen worden. Werbung war eben zu 99 Prozent gerade nicht innovativ, sondern ›gezielt kommunikativ‹, das heißt die gezielte Anbindung an das Bestehende. Das nur nebenbei.
Die Lage war vielleicht doppelt kompliziert: Einerseits war ich zwanghaft innovativ, besser gesagt, zwanghaft ›anders‹. Ich konnte eine Sache nie so machen, wie man sie ›normalerweise‹ machte, selbst für eine Million Dollar nicht. Das war schon einmal seltsam, das heißt therapiewürdig. Und wenn ich mit meiner ›anderen‹ Art dann abgelehnt wurde, entstand ein Rachebedürfnis. Andererseits hatten meine Sabotage-Aktionen, die ich dann unternahm, nichts mit der Sache zu tun.
Ich erinnerte mich an andere Fälle der jüngsten Zeit. Es waren eindeutig Selbstzerstörungen. Es war plötzlich zu schön geworden, mein Leben, ich war auf einmal aus Versehen glücklich geworden. Ich weiß noch: Einmal hatte ich eine wunderbare Wohnung und einen tollen Job, und meine Freundin besuchte mich, und wir aßen zusammen. Sie hatte gekocht und das Essen mitgebracht. Beim Essen bekam ich einen autistischen Anfall, eine Lähmung. Ich konnte nicht mehr sprechen. Gerade noch hatte meine Freundin gesagt, eine ihrer Bekannten habe mich angeblich bei der ersten Begegnung für schwul gehalten, als ich ärgerlich wurde und schweigend in die Suppe starrte. Es war überhaupt nicht schlimm gewesen, diese kleine Bemerkung, absolut nicht. Dennoch hatte der autistische Anfall begonnen und war nicht mehr zu stoppen. Ich ärgerte mich, daß meine Freundin und ich keinen gemeinsamen Bekanntenkreis hatten, also daß unsere Verbindung keine öffentliche und soziale Realität besaß, so daß sie nur für uns bestand und somit ›wie ausgedacht‹ war. Stritt einer von uns die Verbindung ab, gab es keinen Beweis und keine Verbindlichkeit mehr – alles hing in der Luft. Es war dann alles umsonst gewesen. Man hatte mich an der Nase herumgeführt, nur ausgenutzt … solche und ähnliche Gedanken stürmten nun auf mich ein. Der Abend stürzte total ab, man kann durchaus sagen: wie ein Computerprogramm, so schnell und unwiederbringlich. Ich hatte eine Flasche Sekt gekauft und geöffnet, aber keiner mochte sie noch trinken. Ich glaube, es war das erste Mal in meinem Leben gewesen, daß ich aus reinem Glück eine Flasche Sekt besorgt hatte, um sie mit meiner Freundin auf unser Wohlergehen zu trinken. Es wäre wirklich zu schön gewesen. Wir trennten uns in vollständiger Entfremdung. Nervlich war ich nun in den nächsten Tagen extrem angeschlagen und im Büro ein glatter Ausfall. So beschloß ich, nach Köln zu fahren und meine Freundin allein zu lassen. In Köln trieb ich irgendeinen Penner auf, dem ich meine über alles geliebte Heimatwohnung übergab, wohlwissend, daß ich die Wohnung dadurch verlieren würde. Die Mitwohnzentrale hatte mir den Mann geschickt. Man hat das ja selten, aber hier war es klar: Der Mensch war verrückt. Mal flüsterte er, mal schrie er, und ständig beschwerte er sich ungefragt über andere. So beschwerte er sich bald beim Hausvermieter über mich, und die Wohnung wurde gekündigt. Er rief sogar bei meinem Arbeitgeber an und beschwerte sich über mich, sprach von Prozessen,