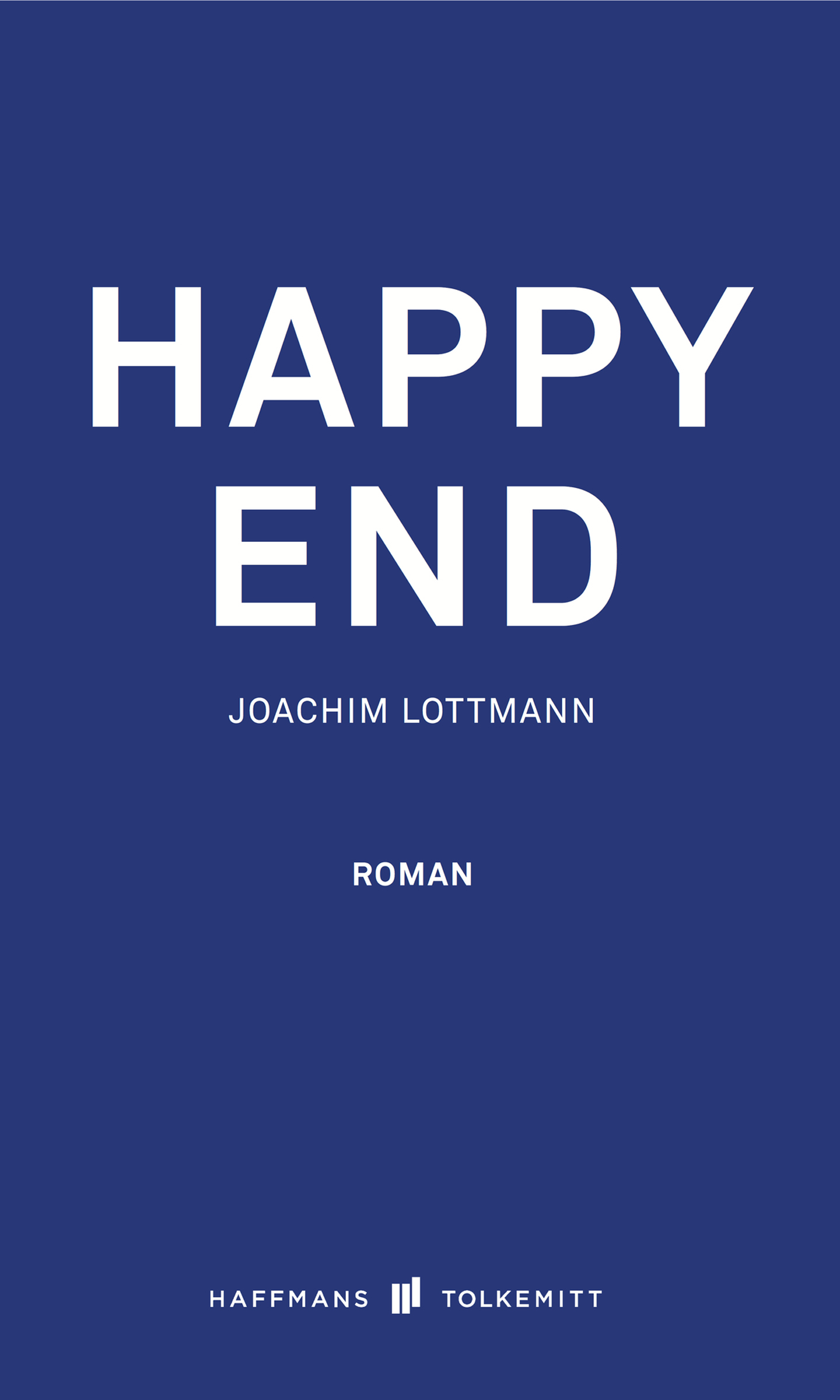9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Mann, der beim Spiegel Joachim Lottmann war Als journalistischer Tarnkappenbomber und mittels seiner speziellen Reportagetechnik, die niemals an schnöden Fakten klebt, hat Joachim Lottmann Deutschland inspiziert. Seine literarischen Reportagen über dieses Land sind allesamt Sternstunden der etwas anderen Wahrheitsfindung. Joachim Lottmann, den manche Germanisten für den Erfinder der deutschen Popliteratur halten, hat als Jugend- und Zombie-Forscher im neuen Jahrtausend schon mehrere Bücher vollgeschrieben. In den letzten Jahren ist der ehemalige Pop-Autor aber vor allem als Reporter durch die Medienrepublik gepilgert. Er war dabei immer getarnt: mal als Faktenjournalist, mal als heißlaufender Wallraff-Epigone und »Graf Lottmann« beim Adelstreffen in Karlsbad (dem größten Heiratsmarkt Europas). Er war der Alfred Kerr im Merkelland, gab den Frauenversteher und höflichen Paparazzo, bei dessen Frontberichten »Dichtung und Wahrheit nicht immer sorgfältig getrennt werden können«, wie ein gewiefter taz-Redakteur korrekt bemerkte. Auf seiner Reise ans Ende des Kulturbetriebs traf er sie alle: Kerstin Grether und Bob Geldof, Tokio Hotel und Kathrin Passig, Maxim Biller, die Strokes und Philipp Boa. Als Ethnologe bereiste er Dortmund, Berlin-Mitte, die hessische Stadt Schlitz und die karibische Insel Kuba. Die sozialen, ästhetischen und politischen Wahrheiten, die Joachim Lottmann dabei der Wirklichkeit abgerungen hat, ergeben nicht weniger als eine subjektive Sittengeschichte der Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
» Buch lesen
» Das Buch
» Der Autor
» Widmung
» Impressum
INHALT
1. Vorwort
+++ DIE VERWANDLUNG +++
2. Vom Pop-Schriftsteller zum Deutschlandreporter oder Mein Leben mit Stuckrad-Barre
+++ FRAUEN IN FREIHEIT +++
3. Mit Kerstin Grether in der Kastanienallee
4. Mit Nina Hagen im BKA-Zelt
5. Mit Ariane Sommer im »90 Grad«
6. Mit Sophie Dannenberg im Tierpark
7. Mit Sahra Wagenknecht im Wahlkampf
8. Mit Kathrin Passig in der Zentralen Intelligenz Agentur
9. Mit Fräulein Schwermut in Bozen
+++ REISE ANS ENDE DES KULTURBETRIEBS +++
10. Cinema for Peace: Charity mit Bob Geldof
11. Ferien in Klagenfurt
12. Echo-Verleihung in Berlin
13. Ovid in Kreuzberg: Thomas Kapielski
14. Berlin Mitte und »Liebe heute«
15. Kunst heute: Berlin, Auguststraße, 2007
16. Kunst gestern: Köln, Hotel Chelsea, 1989
+++ LANDSCHAFTSKUNDE +++
17. Die AVUS: Deutschlands erste Autobahn
18. In Dortmund zu Hause: Phillip Boa
19. Im »Maria« am Ostbahnhof mit den Strokes
20. Out of Magdeburg mit Tokio Hotel
21. Im Palast der Republik mit Einstürzende Neubauten
22. Popstar aus Lüdenscheid
23. Im Regierungsviertel: Berliner Sommerfeste
24. In der hessischen Stadt Schlitz
+++ DER REPORTER PRIVAT…+++
25. Das KaDeWe – Weihnachten mit meinem Bruder
26. Die Reportage als »Gegendarstellung«: Eine Nacht mit Joachim Lottmann
+++…UND JENSEITS DER GRENZE +++
27. »Ganz oben«: Der Mann, der in Karlsbad Graf Lottmann war
28. Die glücklichen Kinder der Revolution
WIDMUNG
[Menü]
1. Vorwort
Dieses Kompendium des Popjournalismus ist mehr als ein Buch. So wie jeder, der »Mai, Juni, Juli«, »Die Jugend von heute« und »ZOMBIE NATION« gelesen hat, alles über Popliteratur weiß (und nie mehr etwas darüber lesen oder sagen muß), kann jeder deutsche Student für wenig Geld dieses »Borderline«-Taschenbuch erwerben und sich diesen historischen Ableger des englischsprachigen NEW JOURNALISM aneignen. Er kann es neben die »20 Jahre TEMPO«-Jubiläumsausgabe stellen, neben die neuen Hefte von Vanity Fair oder den Best-of-Band von Hunter S. Thompson. Er ist dann klüger.
Klüger als die, die heute noch schreiben. Vor allem kann er dann selber Artikel verfassen, wenn das Bafög mal knapp wird. Es ist nämlich ganz einfach, wie ich gesehen habe.
Bekanntlich bin ich selbst erst im hohen Alter Deutschlandreporter geworden. Ich schloß erst mit der Popliteratur ab, nach 32 Romanen für die Schublade, an meinem 45. Geburtstag am 14. April 2003, während einer tumultuarischen Veranstaltung im »Kurvenstar« am Hackeschen Markt in Berlin Mitte. Und danach erst wurde ich Journalist.
Die Veranstaltung hieß »Nie wieder 44, nie wieder Popautor« und zog die Medien an, das muß man wirklich sagen. Zwei Dinge hatte es vorher nicht gegeben: Daß Reporter sich für mich interessierten, und daß ich meine Geschichten »Popliteratur« nannte. Popliteratur war ein Schimpfwort und ist es noch. Aber man zieht damit Leute.
Und ebenso ist es mit dem Wort Borderline-Journalismus. Niemand, nicht einmal Tom Kummer, würde es wagen, dieses Schimpfwort auf seine eigenen Texte zu beziehen. Es ist, als würde eine attraktive Fernsehmoderatorin, zum Beispiel Brigitte Slomka, topless die Ansagen sprechen. Der Ruf wäre ruiniert, aber alle würden die Sendung anschalten. Deshalb weiß ich mit Sicherheit, daß mich dieses Buch reich machen wird, wie auch schon die Romane, seitdem sie unter der falschen Flagge der Popliteratur segeln. Natürlich wird keine Zeitung mehr einen Beitrag von mir drucken. So wie kein seriöses Feuilleton mehr meine Romane bespricht. Aber ich bin auch schon längst im Internet. Ich bin, während Sie diese Zeilen lesen, Blogger geworden.
Die Frage, die dieses Vorwort zu behandeln hat, ist die der Genese. Wie wurde ich Deutschlandreporter und warum?
Nun, es lag ein bißchen an besagter Veranstaltung, und ein bißchen an Stuckrad-Barre. Er war in der letzten langen Nacht der Popliteratur nicht erschienen, und ich hatte ihn von der Bühne im ›Kurvenstar‹ aus herzlich gegrüßt. Die Reaktion des Publikums, fast alles Medienvertreter, war seltsam gewesen. Sie alle lachten! Und zwar häßlich und höhnisch und schadenfroh. Sie verstanden mich also völlig falsch. Ich hörte, wie sie »Ha ha ha, genau! Richtig so, gib’s ihm!« und dergleichen riefen.
Nun überlegte ich. War Benjamin von Stuckrad-Barre nicht der einzige, der immer getan hatte, was ich forderte? Und warum tat ich es dann nicht selbst? Wichtig war zunächst, daß ich den Eindruck geraderückte, der entstanden war. Ich schrieb meinerseits einen Artikel für die Zeitung, den ich ›Mein Leben mit Stuckrad-Barre‹ nannte.
Es war mein erster Artikel als Nicht-»Popautor« für eine Zeitung, und er war gar nicht einmal so schlecht geworden. Ich bemerkte, daß vor allem im ersten Teil ein Ton angeschlagen war, den es in den deutschen Zeitungen bis dahin nicht gab. Über mehrere Seiten beschrieb ich so redundant wie eindringlich die Mode des Stuckrad-Dissens auf Avantgarde-Partys. Erst durch die Wiederholung entstand dieses Gefühl, wie bohrend schmerzhaft und gnadenlos die Ablehnung war, die der junge Mann über Jahre hatte aushalten müssen. Es war also mehr als nur ein nachrichtlicher Text; er enthielt literarische Elemente. Das fehlte bisher, und diese Lücke wollte ich mit weiteren Texten ausfüllen.
Ich heuerte, als Journalist getarnt, beim SPIEGEL an, unterschrieb einen Einjahres-Vertrag und nahm Deutschland ins Visier. Eine meiner ersten Stationen war jedoch ein Adelstreffen in Karlsbad. Ich sollte als Quasi-Günter-Wallraff die Sitten und Gebräuche des europäischen Hochadels für das Hamburger Nachrichtenmagazin auskundschaften. Ich blieb 72 Stunden in dem Kurort und schrieb anschließend in einem kleinen Redaktionszimmer in der Brandstwiete darüber.
Dabei merkte ich, daß diese Geschichte, anders als die davor über Stuckrad, von mir unbewußt vorzensiert wurde. Bei ›Stuckrad‹ hatte ich noch nicht gewußt, für welche Zeitung ich schrieb. Jetzt wußte ich es. Und ich schrieb irgendwie Spiegel-like. Die Sätze wurden kürzer, Nebensätze kamen gar nicht mehr vor, alles ratterte im Subjekt-Prädikat-Objekt-Stil daher. Das war anders, aber war es schlecht? War es vielleicht sogar besser?
Mir war es unheimlich, und ich wollte sehen, ob dieser Stil wieder wegging, indem ich auch für die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche schrieb. Am Ende schrieb ich neben den genannten auch noch für die linke ›taz‹, die linksradikale ›jungle world‹, die rechte ›Welt am Sonntag‹ und viele andere Zeitungen. Nebenher schrieb ich für den ersten Blog, der sich »Wir höflichen Paparazzi« nannte, und heute für einen Blog, der tatsächlich so heißt wie dieses Buch. Ich sagte es schon. Das Internet ist ein pubertäres Medium, und auch meine Texte wurden erst mal unreif, hemmungslos und bis zur Peinlichkeit pubertär. Wenn man alles darf, wenn kein Lektor, kein Ressortleiter, kein Schlußredakteur mehr aufpaßt, schreibt man wie ein mit Alcopops besoffener 15jähriger, dessen Eltern zum ersten Mal weg sind. Ich bitte das zu entschuldigen. Meine SPIEGEL-Texte, etwa als »Graf Lottmann«, verhalten sich zu den Blog-Texten, etwa in »Frauen in Freiheit«, wie eine Bach-Fuge zum Gitarren-Gewichse eines zugedröhnten Jimi Hendrix. Interessant für den Germanisten, bis auf die männlich-chauvinistischen Redundanzen. Die sind selbst mir heute zuwider.
Alles in allem waren es meine Jahre als Deutschlandreporter. Deren Ergebnis ist hier versammelt. Ich werde es vereinzelt, wo es nötig ist, kommentieren.
Joachim Lottmann, im August 2007
[Menü]
+++ DIE VERWANDLUNG +++
[Menü]
2. Vom Pop-Schriftsteller zum Deutschlandreporter oder Mein Leben mit Stuckrad-Barre
Es war wohl noch tief im letzten Jahrhundert, als ich in einem heruntergekommenen Eimsbütteler Lokal – ich glaube, es hieß ›Beach Star‹ – die wohl klügste Frau ihrer Epoche, die Foucault-Expertin Nicola Reidenbach, traf, um ihr meine Verlobte vorzustellen. Das Gespräch raste auf hohem Niveau dahin, man verstand sich ›blendend‹, schließlich war auch die Verlobte, Chefin des Literaturhauses Hamburg, nicht blöd.
Doch dann kam die Rede auf Stuckrad-Barre. Die Ablehnung dieses Autors durch die beiden female intellectuals übertraf alle Brandreden der Menschheitsgeschichte. Selbst ein Ajatollah Khomeini hätte einen Salman Rushdie nicht so hassen können wie diese Ikonen der Frauenkultur den kleinen Popautor. Das Dumme war nur: alle ihre Argumente hatte ich schon gehört. Eitelkeit, Narzißmus, der hat kein Thema, der kann nicht schreiben, der kann nicht lieben, der ist ein kleines Arschloch, der soll erst mal richtig arbeiten, der verhöhnt die kleinen Leute, der schreibt nur ab, der schreibt nur, was alle schreiben, der ist totaler Mainstream, der sieht scheiße aus, und so weiter. Das alles kannte ich schon – von den beiden Damen selbst. Ich rief also aus:
»Wie oft haben wir bereits über Stucki gestritten! Eure Wut muß sich doch allmählich gelegt haben!«
Sie sahen mich zwei Sekunden lang erregt an, der Schaum tropfte von ihren Lippen. Dann machten sie weiter. Sie höhnten, kreischten und berserkerten, daß sich die Tische bogen, und noch von draußen hörte ich ihre sich gegenseitig anfeuernden Injurien gegen den Mann.
Das ist ein halbes Jahrzehnt danach, nicht anders. Wir haben eine Vereinbarung, das Thema zu meiden, aber irgendwann zu später Partystunde kommt es doch immer auf. Und zwar auch auf Partys, wo die beiden Hyänen gar nicht erscheinen. Kurz gesagt: auf ALLEN Partys. Irgendwann kommt immer die Stuckrad-Stunde, meistens in der Küche um halb drei Uhr nachts, wo sich der Rest der Gäste schmatzend und gut gelaunt eingefunden hat. Und alle vertreten dieselbe Meinung. Alle kotzen sich aus, übergangslos, auf Knopfdruck, als hätten sie seit Stunden darauf gewartet. Dieser Mistkerl, dieses Brechmittel, dieser Hochstapler, der kann nichts, der kommt mir schon aus den Ohren raus, das ist keine Literatur, der glaubt wohl, nur weil er gut aussieht, sei er schon wer, der war doch nur mit Anke Engelke zusammen, was die an dem fand, möcht ich mal wissen, dieser Pisser, dieser Idiot, wo ist denn da eigentlich die Lebensleistung, für mich hat der keine Existenzberechtigung, der kennt die normalen Menschen doch gar nicht, der ist doch nur angesagt, weil alle denken, er sei angesagt, der ist nur ein Produkt der Medien, der kriegt NIE den Literaturnobelpreis, der sieht scheiße aus und so weiter. Man hat das Gefühl: Wäre der schmächtige kleine Gescholtene zufällig unter den Gästen, würden sie ihn johlend hochzerren und ohne Umwege am Fensterkreuz aufhängen. Sie würden nicht eine Sekunde zögern.
Ich habe mich immer gefragt, warum das so ist. Warum wird Benjamin von Stuckrad-Barre so gehaßt? Warum erkennt man nicht, daß ›Soloalbum‹ einer der zehn besten Romane der Bundesrepublik ist und ›Deutsches Theater‹ das klügste Buch, das zur Zeit auf den Ramschtischen der Buchläden liegt?
Sein Ritt durch die Medien war gut durchdacht und genau so, wie ich es mir von einem politisch bewußten Menschen, ja einem Marxisten immer gewünscht hatte. Er war nicht ein Opfer der Medien, also der Umstände, des Systems, des Kapitalismus et cetera, sondern ein Benutzer und bewußtseinsstiftender Entlarver desselben. Wo er hinkam, kannte er die ungeschriebenen Gesetze und setzte sie gnadenlos um. Woher er sie kannte? Durchs Hinschauen! Der Mann hat eben mit seinem Fernseher wirklich gearbeitet, anstatt sich berieseln zu lassen. Seine Mittel: Übertreibung, Beschleunigung, Ästhetisierung. Seine Lehrer: Schlingensief, Harald Schmidt, J.D. Salinger. Natürlich auch Kracht und Lottmann. Sein Busenfreund Rainald (»Irre«) hat ihn dagegen ästhetisch eher behindert.
›Soloalbum‹ ist das eine und einzige Buch, das jeder Mensch schreiben kann und meiner Ansicht nach auch sollte (nach Baum und Kind). Jeder trägt eben EIN gutes Buch in sich, das ist sein Stoff. Danach erst beginnen die Second-order-Erfahrungen, das Ausgedachte, die Literatur, also der Krampf. Benjamin wußte das und hielt sich daran. Er wußte: einen weiteren Roman wird es nicht geben, allenfalls Bluff. Also ging er mit ›Soloalbum‹ auf eine deutschlandweite Lesereise und schrieb darüber sein nächstes Buch: ›Live Album‹. Danach hatte er den Status, um in jeder Zeitschrift schreiben zu dürfen. Er testete den Print-Bereich komplett durch und veröffentlichte seine Erfahrungen darin in dem dritten Buch ›Remix‹. Jeder Leser kann seine Erkenntnisreise für wenig Geld nachvollziehen und mit ihm profitieren: Medien, was ist das, wie geht das, tut das weh, was geschieht da? Medien, für oder gegen die Arbeiterklasse? Wer schafft an, wer blutet, wer wird betrogen?
Als nächstes warf er sich auf die Musiksender VIVA und MTV. Nicht, weil er DIESEN Teil der Medien auch noch im Selbstversuch durchleuchten und analysieren wollte. Das auch. Aber vor allem, weil dort und nur dort noch andere Bedürfnisse zu stillen waren. Hätte Nora Tschirner die Tagesthemen moderiert, wäre er dorthin gegangen. Sogar wenn er dann Angela Merkel hätte interviewen müssen. Aber Tschirner war bei MTV. Und so machte er da eine Show, die noch rasanter war als Schlingensiefs 3000er-Sendung an gleicher Stelle.
Schon auf seiner legendären Lesereise hatte er vorgemacht, wie man eine Auftrittsform in die Luft sprengt. Seine eigenen Texte las er valentinesk und total gaga vor, als hätte ihn der Stechapfel gestochen. Er brüllte auf der Bühne, als wolle er Hartmann den Job beim Schauspielhaus abluchsen. Sah er hübsche Mädchen in der ersten Reihe, fegte er die Manuskripte vom Tisch und unterhielt sich nur mit ihnen. Ältliche Buchhändlerinnen ließ er vom Saaldienst abführen, wegen angeblichem Bombenalarm. Und so fort. Nie ließ er es zu, eine Sache zweimal zu machen. Deswegen stellte er Sylvester 2001 alle Lesungen ein und ward nicht mehr gesehen.
Die Frage, warum Stuckrad so gehaßt wird, ist damit noch immer nicht beantwortet. Verzeiht man ihm nicht, die Britpop-Band ›Oasis‹ obsessiv verehrt und zum strukturgebenden Thema von ›Soloalbum‹ gemacht zu haben? Ich verstand das sehr gut, erinnerte es mich doch an meine Bret-Easton-Ellis-Verehrung in ›Deutsche Einheit‹.
Es GIBT Obsessionen dieser Art, und sie kommen in der Literatur viel zu kurz. Zudem mag ich ›Oasis‹. Aber als Intellektueller hatte er damit natürlich ausgespielt, ›SPEX‹ kündigte ihm das Abo und so weiter.
Doch der Stuckrad-Haß hat andere Gründe. Sein Privatleben? Vier Gruppen von Menschen umgeben ihn: Die Leser, die ihn natürlich lieben und kaufen, ungefähr 100 000 Leute. Die sogenannte ›Szene‹, die ihn, wie beschrieben, haßt und lynchen möchte, circa 2 000 000 Leute. Die Pop-Autoren, die ihn durch die Bank innigst mögen und verdammt gut leiden können, das ist eine einstellige Zahl von Leuten. Und schließlich ich, der Autor dieser didaktischen Abhandlung: Natürlich verehre ich ihn.
Er fiel mir 1997 auf, noch vor seinem Romandebüt, als er recht scharfsinnig über Alexa Hennig von Lange schrieb. Ich nahm sofort Kontakt auf, wir trafen uns. Eine Freundschaft entwickelte sich, wir gingen gern spazieren, am liebsten die Biller-Route Hofgarten, Leopoldstraße, Hohenzollernstraße, Habsburgerstraße. Er war knapp über 20 Jahre alt, hätte fast mein Sohn sein können und war entsprechend klüger und schneller als ich. Ich bekam immer schon nach fünfundzwanzig Minuten Kopfschmerzen, weil mich das schnelle Sprechen extrem anstrengte. Die Erfahrung, so schnell denken und reagieren zu müssen, hatte ich nie vorher gemacht. Das war wirklich ein heller Geist, zu hell sogar, ich machte mir Sorgen. So einer, dachte ich, stirbt früh. Damals wußte ich noch nicht, daß er alles richtig machen würde in den folgenden Jahren. Daß er nicht verbrennen würde in den Medien, sondern den Strahl umkehrte.
Auch hatte er damals Pech bei den Mädchen. Ich vermutete damals, das würde so bleiben. Zumal sich das Pech während der Anke-Zeit in lebensbedrohliche Verzweiflung steigerte. Ich machte mir Ende der 90er wirklich große Sorgen. In aufrüttelnden Faxen beschwor ich ihn, sich nicht das Leben zu nehmen. Er zweifelte erstmals fast an sich selbst. Helge Malchow hatte ihm ›Mai, Juni, Juli‹ zugesteckt, und Benjamin bekannte plötzlich, er hätte ›Soloalbum‹ niemals schreiben können, wenn er das Buch zufällig vorher schon gelesen hätte. Dann hätte er sich nach dem Drittstudium vom sagenhaften Reichtum seiner Vorfahren, der von Stuckrads und von Barrés, ernähren müssen und wäre nutzlos gestorben.
Einmal rief ich ihn Mitte 1999 an und hatte Anke am Apparat. Zu meiner freudigen Überraschung plapperte sie in derselben halsbrecherisch schnellen Diktion wie Freund Stuckrad, unzähmbar, glutvoll, über Stock und Stein, von unbeschreiblicher Komik dabei und nicht endend und nicht beeinflußbar: irre! Ich dachte, daß sich da zwei gefunden hatten, die eine Liebe vom anderen Stern zelebrierten, und freute mich für Stucki. Ich habe mir nie wieder Sorgen um ihn gemacht, obwohl ich mitbekam, daß er Anke erst nach Jahren ganz und gar erobern und bezwingen konnte. Er hat es getan, er hat es geschafft, und als ich zuletzt heimlich in der Bild-Zeitung las, ›Deutschlands großer Dichter von Stuckrad-Barre‹ habe Anke Engelke ›aus seinem Leben geworfen‹, konnte ich das so deuten: Das Problem ist bewältigt, und zwar positiv.
Was ist heute mit ihm, lebt er noch in Zürich, was wurde aus der Anke-Nachfolgerin, die ihn verließ, und warum floppte der Film? Zunächst zu letzterem: Natürlich wußte Stuckrad, was deutsche Filmer aus einem Stoff wie ›Soloalbum‹ machen würden, nämlich eine Teenie-Komödie, sozusagen ›Eis am Stiel, Teil 14‹, mit dem Höhepunkt, daß der Held sich den Schwanz im Autofenster einklemmt und eine ganze Nacht nicht freibekommt. Sie würden aus Gold Scheiße machen, das war ihm VORHER klar. Aber er wußte auch: Er konnte in seinem Leben nur diesen einen großen Kinofilm machen, weil er nur diesen einen großen Roman hatte schreiben können. Und so machte er es. Weil er auch dieses Medium testen wollte. Weil sein Erkenntnisinteresse größer war als sein Stolz. Weil Weisheit ihm wichtiger war als Ehre. Und weil er Nora Tschirner bekam (Hauptrolle).
Er will soviel wissen wie möglich. Dafür bleibt er gern der Stachel im Fleisch des deutschen Kulturkörpers. Denn das ist ohnehin die Funktion der Popliteratur gewesen.
PS: Heute schreibt Stuckrad-Barre, höre ich, für Helmut Dietl das Filmdrehbuch zu dessen »Kir Royal«-Nachfolgefilm, der in Berlin Mitte spielt. Wo sonst. Und wer könnte das besser schreiben als Stuckrad?
[Menü]
+++ FRAUEN IN FREIHEIT +++
[Menü]
3. Mit Kerstin Grether in der Kastanienallee
Wir drehen uns nach oben, zum Balkon, wo die Pet Shop Boys dröhnen.
»Da! Unsere Party. Eben waren wir noch drin.«
Unfaßbar, daß man sich eben noch diesem Lärmbrei ausgesetzt hat. Jetzt wölbt sich ein dichter, stiller Romantikhimmel über das sommerliche, nächtliche Berlin, über den Park und die Kastanienallee. Ein Uhr dreißig – Zeit für einen Spaziergang. Neben mir: Kerstin Grether, 27, blond, Knabenfigur, Autorin des neuen Kultbuches über Magersucht und Pop-Lifestyle-Feminismus »Zuckerbabys«.
»Ich muß um halb elf Uhr morgens aufstehen, was sehr früh für mich ist…« Sie macht jetzt nämlich jeden Tag diese MTV-Sendung, deshalb. Aber sie freut sich, mal am frühen Morgen all die anderen Menschen mitzubekommen, die normalen, die zur Arbeit müssen wie sie. Sehr aufregend. Kerstin Grether wohnt in dieser Straße, der Kastanienallee, die sie Castingallee nennt.
»Das ist allgemein der Spitzname hier. Castingallee. Das finde ich gut, weil mein Roman doch auch vom Casting-Unwesen handelt.«
Sie fragt, von was »Deutsche Einheit«, ein alter Roman von mir, handelt, und ich sage, vom Unwesen der Subventionsliteratur. Sie sieht mich durchdringend an.
»Ja, ich habe noch NIE einen Preis bekommen. Andere wie Juli Zeh werden mit Fördermitteln überschüttet.«
Kerstin murkst sich auch keine kunsthandwerklichen Fleißarbeiten ab, sondern beschreibt die Welt, in der wir leben, und das ist die Pop-Welt. Dafür gibts nur Hiebe. Das hat natürlich auch eine schöne Tradition und ist seit 20 Jahren so. Schon erstaunlich, wie es eine doch so wichtige Richtung wie die Popliteratur geschafft hat, bis zum heutigen Tage verfemt zu bleiben.
Wir laufen an fünf neuen Internetcafés vorbei, alle offen. Die Kastanienallee wirkt wie geflutet von Leuten, und alle sehen jung aus, auch wenn sie es nicht sind. In die Stadt strömen jeden Monat zehntausend neue, lebenshungrige Menschen, getrieben einzig von dem Verlangen, sich nicht länger zu langweilen in einem Land, in dem einzig über Rente, Steuersatz und Hartz IV gestritten wird anstatt über große Utopien, Liebe, das Geschehen auf dem Planeten Erde…
»Die Journalisten können noch so oft schreiben, der Berlin-Hype sei vorbei – gegen diese Menschenmassen kommen sie nicht an. Sie sind die wahre Realität.«
Berlins geistiges Potential wächst immer noch, die Provinz stirbt weiter ab. Heißt: Die Popliteratur ist nicht totzukriegen, auch wenn in Klagenfurt ein weltfremder Ossi mit einem Dresdenroman aus dem vorletzten Jahrhundert mit Geld und Preisen überschüttet wird. Der Mann wird weiter in seinem Keller schreiben, 13 Stunden am Tag, und das Essen von seiner Frau hinabgereicht bekommen. Aber Kerstin Grether lebt! Wolfgang Herrndorf lebt! Hier in der Kastanienallee, in der schon Nina Hagen aufwuchs. Wir sind das Volk!
Wir kommen am Café Kani Mani vorbei. Hier hat Grether, einst Wunderkind bei »SPEX«, die Band Wir sind Helden interviewt, besser gesagt, deren Sängerin und Songschreiberin Judith Holofernes.
»Schau, hier hat sie gesessen! Hat ein Eis geschlotzt. Und da habe ich gesessen.«
»Hast du über die Jungs auch geschrieben?«
»Kein Wort. Die Band ist Judith. Die Presse sieht das natürlich immer umgekehrt: die Jungs sind das ernste Fundament, das Girl nur der Blickfang.«
Kerstin schrieb schon mit 13 für Fanzines, mit 15 dann für SPEX. Relativ früh setzte sie sich von dem altehrwürdigen, jungsgesteuerten Avantgardeblatt wieder ab, jedenfalls ein bißchen:
»Diese bebrillten Nerds mit ihren Plattensammlungen. Für die ist Popliteratur, wenn jemand über seine Plattensammlung und seine Jugend aus den 80er Jahren schreibt. So Sätze, daß einer schon mit 17 Throbbing Grizzle gehört hat und seine Freundin das gar nicht verstanden hat.«
Dabei hat sie selbst 4000 Platten gesammelt. Aber sie schreibt nicht darüber, keine Angst.
Ihre These ist folgende: Die männliche Sozialisation zum Pop geht über die Plattensammlung, die weibliche über die Magersucht. Sie kann das wortreich erklären. Jedes Mädchen in der westlichen Welt, das den popkulturellen Zeichensystemen ausgesetzt ist (also alle), muß auf diese Schönheitsgebote irgendwie reagieren. Weder ist »Zuckerbabys« ein Roman gegen den Schönheitswahn, noch gar für ihn, sondern ganz realistisch über ihn. Genauer gesagt: über den fortgeschrittenen Medienkapitalismus, der bei ihr der Einfachheit halber schlicht Jugendkultur heißt…
Natürlich hat Kerstin auch eine Band. Sie muß oft über die Wechselwirkung von Musikmachen und Romanschreiben extemporieren. Das interessiert mich aber nicht. Was soll das sein, eine Band zu haben? Mit 27? Einen Satz kriegt sie dennoch unter:
»In Hamburg ist das Paarbeziehungsmodell ein ganz anderes. Dort stehen die Jungs auf der Bühne, und die Mädchen sind Groupies. Da bin ich lieber nach Berlin gegangen!«
Klar. Die Hamburger Jungs sind ja nun auch schon alle über 40, da wächst nichts mehr nach. Was ist denn nun mit dem Diät-Ding?
»Durch dieses ewige Hungern wird den Frauen systematisch Energie geraubt.«
Ist sie denn selbst magersüchtig?
»Nie gewesen. Nicht, als ich das Buch schrieb. Das habe ich ja immer abgelehnt. Ich war vielleicht eher der fette Typ. Schließlich war ich ja recht politisch, und es machte mir nicht mal viel aus, wenn sie mich im Haus Specki nannten. Nein, erst jetzt bin ich es.«
»Was?«
»Ja, das war eine Reaktion darauf. Ich wollte nicht immer dasselbe sagen und tun.«
»Wie ist es denn so, als Magersüchtige?«
»Lies das Buch.«
Sie strubbelt ihre Debbie-Harry-Haare zurecht. Sie hat sie extra mit Seife gewaschen, weil sie dann besser strubbeln. Auf dem Tisch liegt das neue »I-D« mit einer langen Fotostrecke über die neue Insider-Autorin Kerstin Grether. Man kann sie jetzt perfekt fotografieren. Im Heft davor war Stuckrad-Barre dran.
»Ich mag Stuckrad. Er hat für sich diesen kultur-industriellen Rahmen gewählt, das finde ich gut.«
»Genau. Er forscht für uns in diesen Bereichen, in die nicht jeder reinkann. Sehr verdienstvoll.«
»Ein Michael Moore im Mediensumpf.«
»Deshalb hassen ihn die Medien.«
»Logo. Alles Schweine da.«
»Halt! Journalisten sind eigentlich tolle Menschen. Was die alles machen, ehe sie einen Künstler interviewen. Wie die sich interessieren für einen. Und der Künstler ist dann meistens ignorant und arrogant!«
Oft hat sie unbekannten Bands mit ihren genialischen Berichten den Weg geebnet, zum Beispiel Tocotronic, die sie zur Platte des Monats machte:
»Danach konnten die überall spielen. Ich selbst habe für meinen Artikel 10 Mark bekommen.«
Fünf Euro. Nicht viel, wenn die Leute sich dann auch noch beim Chefredakteur beschweren, weil Kerstin einen Interviewsatz gekürzt hat. Gerade bei Newcomern passiert es oft, daß sie Journalisten von oben herab behandeln. Bei jedem eigenen Satz des Schreibenden wittern sie Manipulation. Denn: Journalisten stehen in der sozialen Rangordnung ganz unten, bei den Politikern.
»Da fragt man sich unwillkürlich, ob nicht auch Politiker ganz nette Menschen sind.«
»Hey! Gestern sah ich Renate Schmidt im Fernsehen, wie sie sagte: ›Was haben Sie immer gegen die Politiker? Die sind doch die einzigen, die sich den ganzen Tag mit den kleinen Leuten beschäftigen.‹«
»Ich verstehe, daß sie alle Alkoholiker werden.«
»Die Politiker?«
»Die Journalisten.«
Wir passieren ein paar Teenie-Boutiquen. Kerstin kauft da gern ein. Sie lebt zwar seit ihrem 13. Lebensjahr in der (wirtschaftlichen) Krise, wie sie gerade im Kursbuch schrieb, shoppt aber trotzdem gern.
»Teenie-Boutiquen sind einfach billiger. Wenn man den Körper dazu hat, wenn man das Gesicht dazu hat – warum nicht.«
Sie sagt aber auch den bedenklichen Satz:
»Nachdem ich den Distinktionsterror 300 Seiten lang gebrandmarkt habe, übe ich einen noch schlimmeren Schönheitsterror aus als andere…«
Alles, was sie im Buch anprangert, macht sie nun selber: das ist die Dialektik der Aufklärung, wie Adorno sie wohl übersehen hat. Pop-Literatur war ihre Art zu leben, zu denken und zu fühlen: »Ich wollte einfach die populäre Kultur beschreiben, die uns alle umgibt.«
Doch auf einmal findet sie sich stundenweise in einem besinnungslosen Konsumismus wieder. Seit wann genau? Als der Verlag nach wenigen Tagen meldete, die erste Auflage sei verkauft. Laut grölend schlägt sie Einkaufsschneisen in die westdeutschen Innenstädte. Dabei besteht sie darauf, daß Pop nicht bunt und schrill sei, sondern ernst und politisch.
Wir kommen an der Teenie-Boutique ›crème fraiche‹ vorbei. Kerstin zeigt auf einen Pucca-Rucksack, den sie gerne hätte. Es folgt das Café Naan, in dem sie mit ihrer Schwester manchmal Kaffee trinkt. Im Pop-Kaufhaus ›Uranus‹ liegt ein hellblauer Blechwecker im Schaufenster, den sie sich holen wird, nach der dritten Auflage von ›Zuckerbabys‹. Am Ende unseres Spazierganges erreichen wir das legendäre John-Lennon-Gymnasium.
»Wie gern wäre ich auf dieses Gymnasium gegangen! All die Graffitis…die Schüler durften selbst bestimmen, wie die Schule heißt!«
»Ist die Jugend von heute denn jetzt wieder politisiert?«
»Ja. Definitiv.«
Sie reicht die Wange zum Kuß. Kerstin Grether wohnt im Gymnasium, in einem leerstehenden Nebentrakt. Sie tänzelt weg, leichtfüßig, mädchenhaft, magersüchtig, wird schnell verschluckt vom Dunkel des Schulhofes. Möge ihr Roman noch viele Auflagen erleben.
[Menü]
4. Mit Nina Hagen imBKA-Zelt
Draußen dieses blaue Zelt, jeder kennt es, man fährt dran vorbei, auf dem Schloßplatz, dieses seltsame Gebilde aus Kinderlampen und blauem Neon: das BKA-Zelt.
»Wir alten Hippies sind immer noch da, neben Gerhard Schröders Schreibtisch«, sagt Nina Hagen dazu. Es ist ihr erster Satz an diesem Abend, beiläufig, fahrig, lustlos. Stimmt: Der Kanzler arbeitet nur einen Pflastersteinwurf entfernt und soll, laut Nina, Kontakte mit ihr pflegen.
Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf: Mißgestimmt und bockig absolviert sie die ersten Nummern, produziert Fehler über Fehler, trifft den Ton nicht, ärgert sich über das Publikum, das sich nicht provozieren läßt. Unbändiger Jähzorn packt sie. Minutenlang bricht sie ab, dann ist sie wieder lieb und säuselt, dann brüllt sie ohne Kontrolle wie ein BSE-verseuchter Nachwuchs-Hitler.
Die armen Leute denken betrübt: Da schüttelt sich des Wahnsinns fette Beute. Andererseits war sie nie anders. Ein Pflegefall. Nina-Hagen-Fans sind es aus einem Helfersyndrom heraus. Sie wissen: Sie müssen ihr helfen, das durchzustehen, da auf der Bühne. Vor allem in dem Alter, da muß man schon ein bißchen aufpassen, denken die. Und spüren gleichzeitig, daß sie diese Furie im Ernstfall niemals stoppen könnten. Daß sie selbst in ihren besten, präsentesten Momenten nur fünf Prozent gibt; 95 Prozent lauern in der Reserve: böse, anarchisch, balla-balla. Was ist der Störfall von Tschernobyl gegen ein cholerisches Liebeslied der Hagen? Nichts! Deswegen die vielen Sicherheitskräfte. Das ganze Zelt ein Krankenhaus. Viele hundert Ärzte und ein Patient. Aber die Lämmer schweigen alle, selten nur regt sich eine Hand zum Beifall, warum? Als externer Gast hat man das leicht peinliche Gefühl, einer doch recht intimen Party her-untergekommener enger Spinnerfreunde beizuwohnen. Wie die Bundeshauptversammlung der Briefmarkensammler, da wird doch auch mehr geklatscht. Aber Nina-Hagen-Fans sind stille, stumme Wesen, altgewordene Ossis, vom Leben Besiegte. Natürlich nicht nur. Es sind auch Leute versteckt im alten Kinder-Zirkus-Zelt, wenige nur, die wissen: hier erleben sie die größte Rocksängerin, die Deutschland nach dem Krieg hatte, vielleicht sogar die einzige. Die größte Zerstörerin, eine echte Künstlerin.
Leichtfüßig explodierend macht sie das gesamte Spektrum alternativer Kultur nieder: subkulturell Versprengte aus drei Dekaden, frauenbewegte Linke, Sexualkämpfer jeglicher Schattierung, Transen, Glatzenfrauen, Esoteriker, Ost-Nostalgiker, Kinderselige, Hippies, Radikalökos, Indienfahrer, Altrocker, Verschwörungstheoretiker, UFO-Gläubige, AIDS-Theoretiker und Zeugen von Sebnitz – nur Nina Hagen selbst ragt aus allem hervor wie Jesus mit der Peitsche im Tempel, der die Geldwechsler vertreibt.
Sie ist der permanente Gegenimpuls zu allem, was sie präsentiert. Sie bedient die Minderheiten – und verbrennt sie genüßlich. Sie säuselt mit verdrehter Piepsstimme irgendwelche Indienkitsch-Weisheiten und schmeichelt damit den im Publikum ausharrenden Esoterikern, aber die wissen bald nicht mehr, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Dann wieder »fetzt« die Band, und die Puhdys- und Peter-Maffay-Fans beginnen mit den grauen Matten zu wippen, doch selbst dieses widerliche Fetzen wird von Nina schon nach sechzig Sekunden durch ausbrechende Zerstörungswut, durch Grimassieren, Übertreiben, anarchisches Grölen zum Einsturz gebracht. Es ist, als schrie sie gegen die Dummheit an, und wenn Nina schreit, schweigt bald der Rest. Und die Band, eben noch »echt tierisch geile Rock ’n’ Roller«, stehen als Mainstream-Schweinerock-Langweiler da, die auch für Udo Jürgens ›fetzige‹ Stimmung machen würden. Zur Strafe müssen sie nun Zarah-Leander-Lieder spielen, erst süßlich (Freude bei der Lesbenfraktion), dann als Stuka-Angriff. Ein Hurrikan tobt hernieder, Graue Panther fallen in Ohnmacht.
»Der Wind hat mir ein Lied erzählt«, wer ahnt schon, daß Stalingrad daraus wird. Anders als der ewige Casdorf bricht sie auch das nach Belieben und schlechter Laune wieder ab; über den deutschen Kulturscharmützeln steht eine, die selbst englisch besser singt als Jennifer Lopez und besser kompiliert als Frank Zappa, weit drüber. Wehe, wenn Nina Hagen rappt, das tat sie nämlich schon, als Sabrina Setlur noch die Brust bekam, da wird dann alles noch mal eine Dimension gewalttätiger, kraftvoller, härter, potenter – anschließend ist der aktuelle deutsche Hiphop als folgenlose Gesinnungssingerei enttarnt.
Man hat in jeder Sekunde das Gefühl, daß sie nicht weiß, was sie im nächsten Moment sagen wird. Was sie sich gleich einfallen läßt. Welche Laune sie gleich reiten wird. Und immer wieder wird Berlin thematisiert, Schröders herrliche Hauptstadt. Und die Hagen ist immer am besten, wenn sie Großdeutsches intoniert. Wenn sie eine Hitlerrede imitiert, kriegte selbst der Führer Angst. Oder wenn sie von Honekker erzählt. Oder von Menschenliebe, Tantra, den Pyramiden, den UFOS, der ewigen Sonne in indischen Tempeln: alles Bullshit, unterm Strich. Subkultureller Brei zum Gehirnverkleben. Die ständigen »Ich liebe Euch alle!«-Appelle ans Publikum haben soviel Gewicht wie dieselben von Yoko Ono dereinst.
Sie hat nicht das geringste Lampenfieber, würde auch ohne Skrupel auf der Bühne zwei Stunden lang den SPIEGEL lesen können, so egal ist ihr das Publikum, und die Presse erst recht. Sie ist nun mal keine Dienstleisterin, sondern hat etwas zu sagen. Aber nicht diesen Idioten hier.
Tja, so paradox kanns zugehen. Das Leben ist es sowieso, und bei großen Künstlern spielen die Paradoxien dann oft ganz verrückt. Warum es nicht zugeben? Warum nicht gleich mit der Stimme einer Dreijährigen plappern? Nina ist so frei. Mitten in der Show wirft sie dann noch ein ambitioniertes Benefizprojekt an: ›Kinder zurück‹. Da soll man spenden, kann Gegenstände ersteigern, es geht um einen ›guten‹ Zweck, und wem dabei nicht schlecht wird, dem ist die ganze Spenden- und Charityverlogenheit der enthirnten Warengesellschaft noch nicht aufgegangen.
Für die ganz Langsamen quakt Nina, nun Daisy Duck im Zeichentrickfilm, die Spendenaufrufe gleich mehrmals: für die von Schändern entführten Kinder, damit sie nicht mehr von Nazis im Freibad ertränkt werden, oder so ähnlich. Das Ganze wäre Comedy, wenn es nicht Nina Hagen wäre. Aber so ist es Schlingensief, der in seinem zweiten Leben als Andreas Baader auf die Welt kommt, oder besser umgekehrt.
Nina, Tochter des Verräters Hagen (Hans Hagen, Brechtassistent, von der Stasi lange Jahre verhaftet, seine Stelle nahm Wolf Biermann ein), ist ein moderner Dekonstruktivist. All die herrschenden Verabredungen, Meinungen, Wahrheiten werden als gemacht entlarvt und hübsch zerlegt in ihre Einzelteile. Vor allem wird das sogenannte Authentische nachhaltig zugrunde gerichtet. Nina benutzt ihren früheren Ruhm als Treibstoff für ihr bitterböses, lichtbringendes Tun in der Gegenwart des vereinigten Deutschlands. Johann Wolfgang von Goethe wird ebenso verbrannt wie Transenkitsch, Opernpathos, Mutter Teresa, Gutböse-Nazischelte, Minderheitenfolklore, ja sogar der Medienkanzler und große Kommunikator: Nina flüstert aufgeregt von heimlichen Treffen, die sie mit Gerhard Schröder habe, von »gigantischen Thesen und Hypothesen«, die sie mit ihm tausche, und daß diese Gespräche so bedeutsam seien, daß sie demnächst die Öffentlichkeit davon unterrichten werde (vom Bundeskanzleramt war dazu keine Stellungnahme zu erhalten). Daß hinter einer restlos abgewirtschafteten ›Kultur‹ nur eine ebenso tote Alternativ- und Subkultur steht und daß dieses Deutschland nach der Vereinigung nur noch eine Pappkulisse mit Kasperlefiguren ist, würde selbst den Kasperlefiguren deutlich – wenn die Nina-Hagen-Show (war nur im Internet live zu verfolgen unter www.kanal.web.tv) einen guten Sendeplatz im Fernsehen bekommen hätte. Aber dann wäre dies Land nicht das, was es ist.
[Menü]
5. Mit Ariane Sommer im »90 Grad«
Natürlich fand ich Ariane Sommer immer schon klasse. Aber als sie dann vor mir stand, im Café des Literaturhauses in der Fasanenstraße…
Doch ich will der Reihe nach berichten. Jede Geschichte hat ihre ganz besondere Vorgeschichte, wußte schon Lukrez, und die von Ariane Sommer ist nicht nur besonders lang, sondern besonders einzigartig, ja verblüffend.
Als Pubertierender sah ich einmal nachts im Fernseher unter dem Bett den Film »Ekel« von Roman Polanski, in dem die blutjunge Cathérine Deneuve eine verhaltensgestörte, autistische Blondine spielt, in Schwarzweiß. Ich komme noch darauf zurück.
Am 19. Januar 1982, ich war nun schon ausgewachsen, erlebte ich den ersten und ganz sicher auch letzten epileptischen Anfall meines Lebens. Ich hatte mit einer jungen Frau, mit der ich einst die Schulbank »gedrückt« hatte, wie es so sinnig heißt (natürlich drückt man etwas ganz anderes), eine Woche lang nichtsexuellen Verkehr gehabt. Ich hatte sie immer schon morgens getroffen, in dieser Woche, dann waren wir spazierengegangen, dann in die Museen (sie war kunstinteressiert, als Tochter eines großen deutschen Nachkriegsmalers), dann in die Cafés, dann wieder die Boulevards entlang (d.h. die Leopoldstraße in München hinauf und hinunter und wieder hinauf), dann nach Hause, wo wir Alkohol tranken. Mein Ziel war es natürlich, mit der jungen Künstlerin zu schlafen. Wir hatten das nämlich schon auf dem Schulhof verabredet. Ich hatte sie damals gefragt: »Wenn ich keine Freundin hätt’, gell, und du amal keinen Freund…dann…« Sie nickte: »Dann gehn wir miteinander.«
Und so war es gekommen. Meine Freundin Kirstin Ruge hatte mit mir Schluß gemacht, und der Maler Jan Philipp v. Bertheaux hatte mit ihr aus Standesgründen die Trennung vollziehen müssen, was ihm gewiß nicht leichtgefallen war. Wir waren beide solo. Ich löste das alte Gelöbnis ein und fuhr von Hamburg, wo ich geboren war, nach München, wo ich zur Schule gegangen war mit besagter Dame. Sie empfing mich mit offenen Armen, wie sich denken läßt. In ihrem kleinen Zimmer in der Maxvorstadt tranken wir immer mehr Alkohol. Sie war wirklich ein schönes Mädchen geworden, fast schon eine richtige kleine Frau und wahrlich gut entwickelt. Sie hatte herrliche Brüste, eine sehr helle Haut und fast weiße, langsträhnige, glatte und dichte Blond-haare, die ihr nervös ins Gesicht hingen und die sie immer wieder ebenso nervös wegpustete. Die Haare waren gefärbt, aber das waren die von Cathérine Deneuve auch.
In der Schule, auf den Innentüren der Knabentoiletten, hatten einst eingekratzte Botschaften auf Eva Maria, so hieß die Schöne, aufmerksam gemacht: »Try Eva fast hand Maria«, »Eva fast hand Maria rides best«, und so weiter. Es gab an der Schule mehrere Mädchen mit diesen in Bayern häufigen Vornamen, aber ich glaubte, es könne nur meine hübsche Banknachbarin sein, mein Deneuve-Lookalike. Ein Fehler?
Ich war jedenfalls nervlich beschädigt ins Bett gegangen, als mich Eva Maria am ersten Abend nicht angefaßt hatte. Auch ich hatte sie natürlich nicht angefaßt, so etwas muß in unserem Kulturkreis stets die Frau machen; das ist ihr kulturhistorisch verbrieftes Recht, alles andere zählt als Vergewaltigung.
Nun, die vielen Stunden des Redens, Lachens und Scherzens hatten mein Nervenkostüm wundgescheuert. Ich bin normalerweise ein nervlich sehr stabiler Mensch. Ich könnte Jahre auf einer einsamen Insel durchhalten, ohne depressiv zu werden. Aber das Soziale strengt mich an. Etwas in mir fordert anschließend eine Kompensation in Form von körperlicher Wärme. Das muß gar nicht Sex sein, da Sex ebenfalls etwas Soziales ist und anstrengt. Nein, ich muß meinen armen, vom Kommunizieren wirr gewordenen und heißgelaufenen Kopf auf eine wohlwollende, üppige, noch stramme, weil junge Brust betten. Am liebsten ist es mir, die Frau schläft schon, und ich höre ihren ruhigen, gleichmäßigen Herzschlag. Das, nur das, zusammen mit der warmen, gutdurchbluteten Haut, dem nachtwarmen Körper unter der gemeinsamen Decke, beruhigt mich und macht das grelle, sinnlose, uferlose Geplapper und Geschnatter des Tages vergessen. Die vielen »Meinungen«, die keine sind, die ganze Verirrung und Fehlsteuerung eines jungen Menschen im Hoch- oder Spät- oder Postkapitalismus, diese ahnungslose Verzweiflung eines Gehirns ohne Bewußtsein. Welch ein Segen, wenn solch ein Geist endlich ruht und alles seinem gewissenhaften, unbeschädigten, ja blühenden Frauenkörper überläßt…
Jedoch, es kam ja nicht dazu. Ich wurde am ersten Abend nach 14½ Stunden der charmantesten Konversation nervlich erschöpft und mental zugrunde gerichtet abgeschoben, und am zweiten Tag wiederholte sich der Ablauf. Auch am dritten. Ich zitterte schon, konnte keine Zigarette mehr halten, hatte brüllende Kopfschmerzen. Und wie das so ist, jeder kennt das ja: Je länger das »reizende Verhältnis« körperloser Zugeneigtheit andauerte, desto unmöglicher wurde es, die aufgebaute physische Sperrmauer zu durchbrechen.
Am Ende des siebenten Tages rief ich verzweifelt, nein, ich konnte es nur noch flüstern, nein, nur röcheln: »Wollen wir jetzt nicht zusammen ins Bett gehen?«
Sie verstand nicht, was ich gesagt hatte. Ich glaube wirklich, sie zwang mich, den Satz zu wiederholen. Sie wich dann ruckartig einen halben Meter zurück und drehte dabei ihr Gesicht weg, stand auf, stand dann da im Raum auf ihren zwei strammen Beinen, irgendwie recht selbstbewußt. Sie sagte noch, obwohl sie gewiß fassungslos war:
»Du…du meinst…ob ich dich als Mann will?!«
Sie sprach das Wort Mann so seltsam aus, wie Martin Luther es getan hätte, wenn er über Mann und Waib gepredigt hätte. Als ich »Ja« sagte, geschah das Schrecklichste, was ich je erlebt habe. Eva Maria bekam einen hysterischen Lachkrampf. Das schreibt sich so einfach dahin, aber in echt ist es furchtbar. Noch heute höre ich manchmal dieses gekreischte Lachen, nachts, wenn ich alleine wachliege…
Damals, in dieser Nacht vom 19. auf den 20. Jänner 1982, vor über 20 Jahren also, bewegte ich mich rückwärts und angstgeschüttelt aus dem Zimmer, der dunklen Treppe entgegen, die ich Etage für Etage nach unten stürzte, ohne Jacke und Mantel. Auf der Plattform der ersten Etage erlitt ich den besagten Ausbruch von Epilepsie, den ich nicht weiter schildern will, um den Leser nicht zu verschrecken.
Hannelore Kohl ist bekanntlich an einer Krankheit namens Lichtallergie gestorben. Sie hat sich nicht gekillt, weil der Alte sie schlecht behandelte, wie der stern behauptete, nein. Sie ertrug das Licht nicht, und eines Tages wurde sie immun gegen das Gegenmittel (Aluminiumhydroxid), mußte immer im Keller bleiben, was auf die Dauer doof war. Die Parallele zu mir liegt auf der Hand: Das Soziale war für mich das Licht, gegen das ich allergisch war, und der ruhende, mir nichts Böses wollende junge Frauenkörper das Gegenmittel. Ein alter Frauenkörper oder auch ein Tier wirkten nicht, da ich mich vor beidem fürchtete. Alte Frauen gemahnten mich an meine Mutter, die den armen Vater so gequält hatte, und Tiere waren geistesgestört und übertrugen Krankheiten. Nur überirdisch blonde, kratzerfreie Engel brachten die optimale Wirkung, Wesen wie die somnambule Cathérine Deneuve von 1964 oder die zugekokste Ariane Sommer ohne Slip auf der Stretchlimo-Rückbank von 2002. Frauen auf Drogen waren sowieso gut. Wenn sie in die tiefen Kissen versanken und in die endlose Ferne des Dämmers…aber greifen wir nicht vor, bleiben wir bei Hannelore Kohl und meiner Lichtallergie.
Diese Eva fast hand Maria hatte also einen Nervenzusammenbruch bei mir herbeigeführt. Was bedeutete das? Ich konnte fortan anderthalb Jahre lang nicht allein sein, nachts nicht schlafen, nicht schreiben, nicht Geld verdienen, und ich befand mich die ganze Zeit in einem Zustand der Angst. Das war wirklich nicht schön. Meine Freunde halfen mir, doch tatsächlich wußte niemand, wie es wieder aufwärtsgehen solle mit mir, am wenigsten ich. Damals war es noch nicht üblich, junge Leute zum Psychiater zu schicken. Man hielt Zustände wie meine für normale Erscheinungen einer Selbstfindungsphase.
Da ich so kaputt war, gelang es mir nicht, Frauen für die Nacht aufzutreiben, schon gar keine blonden und auch keine mit mächtigen, straffen Brüsten. Wenn ich es versuchte, dachten sie, ich wolle bloß mit ihnen ins Bett, und wandten sich angeekelt ab (genau wie die Deneuve in Ekel, daher der Titel). Also, sie dachten, ich wolle sie penetrieren. Sie waren besessen von dem Gedanken. Hätte ich gesagt, ich wolle bloß neben ihnen liegen während sie schlafen