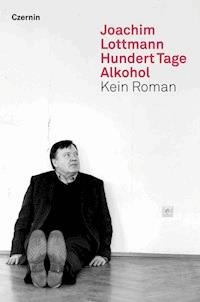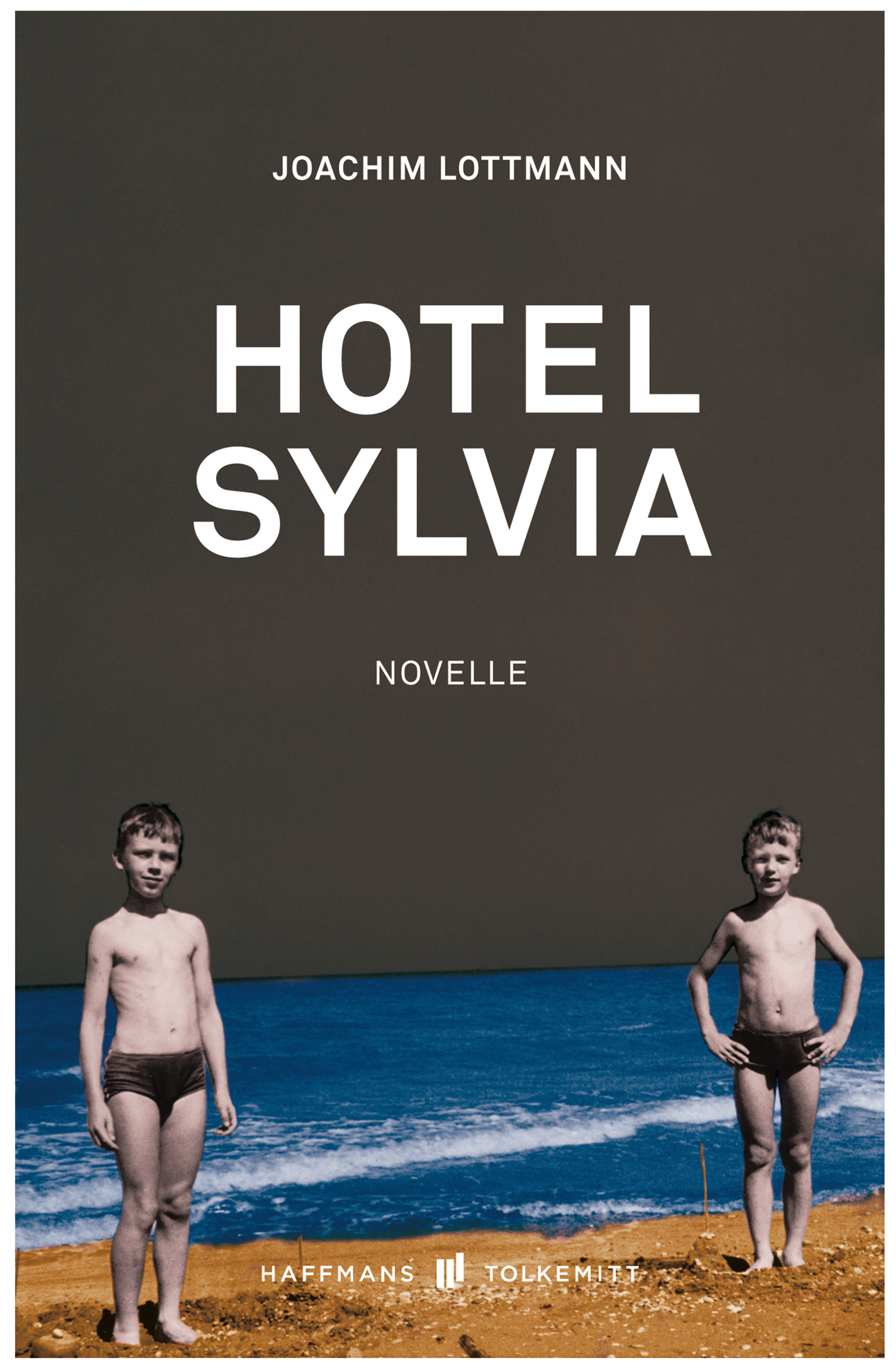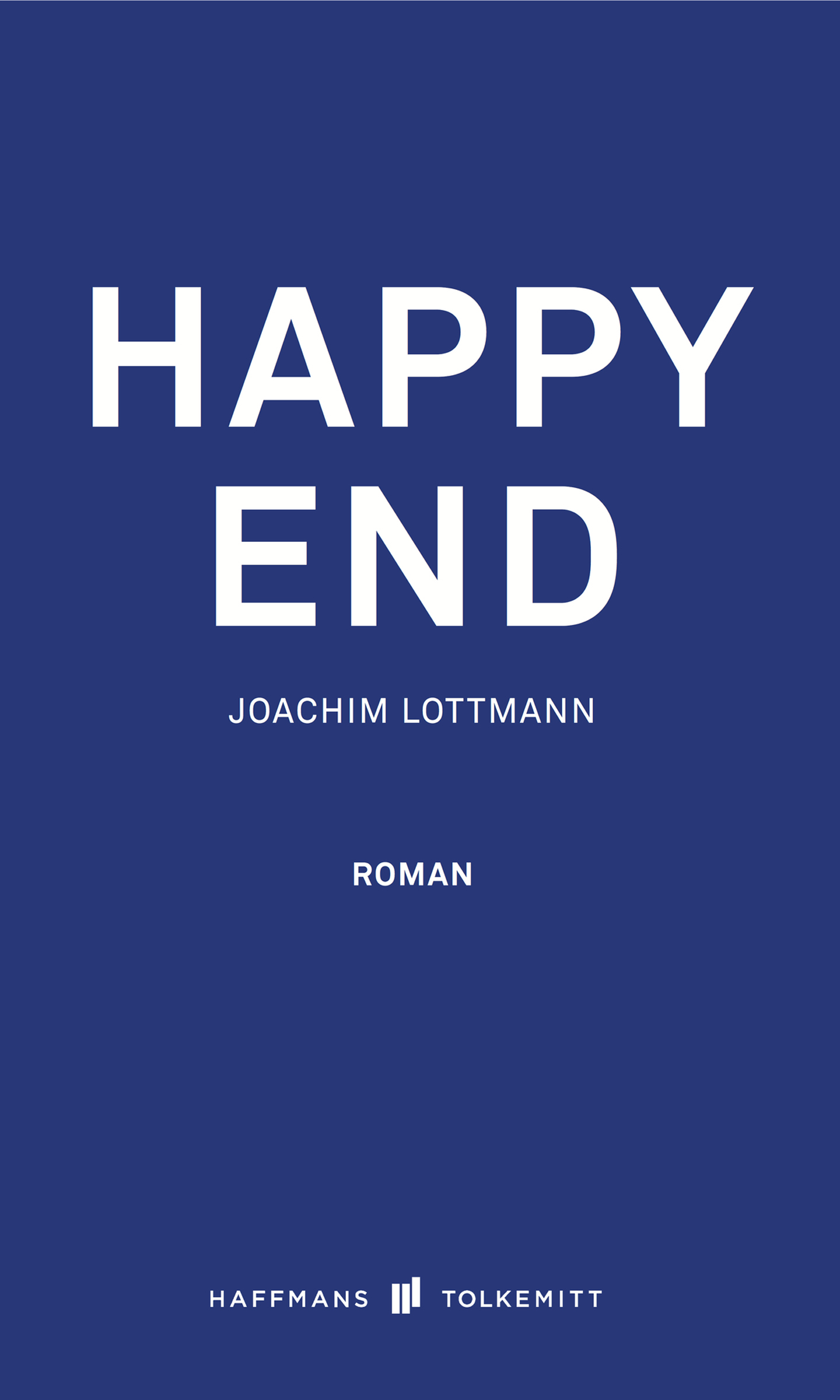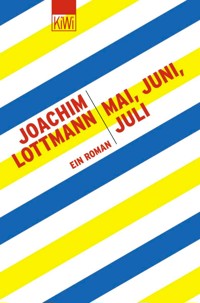9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ganz Wien greift zu Kokain« oder: eine todsichere Methode, sein Leben zu retten Ein rührend normaler, leider zu dicker Gutmensch, der nie wild, aufregend und hemmungslos gelebt hat, erhält die furchtbare Diagnose: noch maximal drei Jahre Lebenserwartung bei weiter zunehmendem Bluthochdruck und Bewegungslosigkeit. Der frühpensionierte TV-Redakteur fasst einen verzweifelten Entschluss, als er erfährt, dass nur harte Drogen gegen seine monströse Fettsucht helfen: Er beginnt eine »Kokain-Diät«. Der geborene Spießer protokolliert penibel Dosis und Wirkung, doch bald schon wird er immer rauschhafter, wilder, offener – und dünner! Sein Charakter löst sich auf. Er lügt, fälscht, betrügt, hat plötzlich Sex im Übermaß und steigt mit jedem verlorenen Pfund auf zur schrulligen Kultfigur der Wiener Kunstboheme. Nur ein Zufall kann ihn vor seinem naiven Optimismus und dem sicheren Drogenende retten. Joachim Lottmanns Roman ist die eindrückliche Seelenstudie eines Mannes, der in einen Strudel dekadenter Abenteuer gerät, und zugleich das Abbild einer berauschten Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Joachim Lottmann
Endlich Kokain
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Joachim Lottmann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Joachim Lottmann
Joachim Lottmann, geboren in Hamburg-Hochkamp, Kindheit in Belgisch-Kongo. Studium der Theatergeschichte (bei Diedrich Diederichsen) und Literaturwissenschaft (mit Maxim Biller) in Hamburg. 1986 Übersiedlung nach Köln, Romanerstling »Mai, Juni, Juli« (KiWi 767). Freundschaft mit Martin Kippenberger, der nach »Die Frauen, die Kunst und der Staat« mit dem Autor bricht und dafür sorgt, daß er in Ungnade fällt. 13 Jahre schlägt Lottmann sich als Straßenbahnschaffner in Oslo und als Leibwächter von Rainer Langhans durch, bis ihn der Literaturchef der FAS wiederentdeckt. 2004 Comeback mit dem Roman »Die Jugend von heute« (KiWi 843), danach »Zombie Nation« (KiWi 930, 2006) und der Reportageband »Auf der Borderline nachts um halb eins« (KiWi 1002, 2007). 2009 der gefeierte Roman zur Krise: »Der Geldkomplex« (KiWi 1116), 2011 »Unter Ärzten« (KiWi 1053). Lottmann erhielt 2010 den Wolfgang-Koeppen-Preis und lebt in Wien.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ein rührend normaler, leider zu dicker Gutmensch, der nie wild, aufregend und hemmungslos gelebt hat, erhält die furchtbare Diagnose: noch maximal drei Jahre Lebenserwartung bei weiter zunehmendem Bluthochdruck und Bewegungslosigkeit. Der frühpensionierte TV-Redakteur Stephan Braum faßt einen verzweifelten Entschluß, als er erfährt, daß nur harte Drogen gegen seine monströse Fettsucht helfen: Er beginnt eine »Kokain-Diät«.
Der geborene Spießer protokolliert penibel Dosis und Wirkung, doch bald schon wird er immer rauschhafter, wilder, offener – und dünner! Sein Charakter löst sich auf. Er lügt, fälscht, betrügt, hat plötzlich Sex im Übermaß und steigt mit jedem verlorenen Pfund auf zur schrulligen Kultfigur der Wiener und schließlich auch der Berliner Kunstboheme. Nur ein Zufall kann ihn vor seinem naiven Optimismus und vor dem sicheren Drogenende retten.
Joachim Lottmanns Roman ist die eindrückliche Seelenstudie eines Mannes, der in einen Strudel dekadenter Abenteuer gerät. Ein furioser Anti-Entwicklungsroman, der zugleich das Porträt einer lebensgierigen Kunst- und Medienszene abseits der »normalen« krisenbesessenen Jammergesellschaft zeichnet.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Für Christa Zöchling
1
Es war der zweite Frühlingstag des Jahres, der 4. März 2013, als Stephan Braum einen jungen Mann traf, der sein Leben – wenn das, was er bis dahin würgend dahingestottert hatte, Leben genannt werden kann – auf den Kopf stellte. Und der dennoch bald keine Rolle mehr spielte in Stephan Braums befremdlicher Biographie.
Dieser junge Mann saß in dem Kaffeehaus Aida in der Praterstraße in Wien, ganz in der Nähe des Riesenrads. Man konnte es durch die Schaufensterscheibe sehen, dieses berühmte Riesenrad. Jetzt, um 17 Uhr 15, in der blauen Stunde, war es bereits beleuchtet und funkelte verheißungsvoll im klaren tiefdunkelblauen Abendhimmel. Braum betrat das Lokal und erkannte den jungen Mann sofort, obwohl er ihn zum erstenmal sah. Es war nämlich der kleine Bruder eines Freundes von ihm, und der sah ihm ähnlich.
Er studierte wohl Geschichte. Auch war er irgendwie Künstler. Vor allem aber galt er als wenig erfolgreich. Eine Freundin hatte ihn Stephan Braum folgendermaßen angekündigt: »Das ist der bekiffte kleine Loser-Bruder.«
Der junge Mann sprang vom Stühlchen auf. Das Kaffeehaus Aida war wie eine Puppenstube möbliert. Die sehr alten Menschen, die dort verkehrten, waren entweder von Geburt an klein oder waren es im Greisenalter geworden. Man stellte einander vor – Stefan hieß auch der andere. Man kam darüber ein, sich zu duzen. Österreichern fällt das schwer, aber es war besser so. Nur in der Politik wurde ständig geduzt, das war in Mode gekommen, seitdem ein gewisser Jörg Haider damit bei allen Journalisten viel Anklang gefunden hatte.
Man duzte sich also und redete sich mit demselben Vornamen an, Stephan und Stefan. Es ging um eine Steuersache. Stefan war Student und mußte keine Steuern zahlen. Stephan Braum konnte ein paar tausend Euro verdienen, indem er ein hohes Honorar über das Konto des Studenten laufen ließ. Man war sich sofort einig. Der völlig mittellose »Loser-Kiffer« bekam selbst tausend Euro für sein Entgegenkommen.
So hatte man alles geregelt, schon in den ersten Minuten, und mußte doch sitzen bleiben, aus Höflichkeit. Braum fand sein Gegenüber sympathisch, wußte aber nichts zu fragen, und da es kein Entkommen gab, wurde er ehrlich:
»Ich weiß leider von dir nur, daß du der Bruder vom Thomas bist … in der Interviewsituation würde man jetzt fragen: ›Was war das bemerkenswerteste Ereignis in deinem Leben?‹ Du weißt, daß ich Journalist war.«
Ja, er hatte von seinem Bruder so etwas Ähnliches gehört. Der hatte ihm einen Artikel genannt, aus der FAZ, den er im Internet aber nicht finden konnte. Das Gespräch stockte, und so griff er die ironische Frage einfach auf:
»Das Bemerkenswerteste in meinem Leben war eine Sache, die du nicht weitererzählen darfst: Du kennst doch Elmex, die Zahnpasta?«
»Äh, ja! Natürlich!«
»Der Gründer und Erfinder war mein Großvater. Dessen Neffe und Erbe ist vor zehn Jahren gestorben, in der Schweiz. Wir sind damals hingefahren und haben in seinem Labor historisches synthetisches Kokain gefunden. Du mußt wissen, daß Kokain seit 1932 verboten ist und seitdem nicht mehr hergestellt wird. Die versiegelten Ampullen, die wir fanden, waren aus dem Jahr 1928 und vollkommen unberührt …«
Kokain wurde nicht mehr hergestellt? Der Stoff von 1928 war immer noch funktionsfähig? Braum glaubte es nicht. Aber der nette junge Typ begann nun, immer überzeugender und beseelter zu erzählen. Die Geschichte mit dem historischen Kokain war nur der gewollt sensationelle Anfang. Bald redete er auch über normalen Stoff, über Erlebnisse in Mexiko, Frankreich, Italien und Ost-Berlin. Braum war froh, daß der andere ein Thema hatte. Und auch, daß er so spektakulär damit eingestiegen war. Denn normalerweise interessierte sich Braum nicht für solche Drogenstorys. Er gehörte ja selbst einer Generation an, die mit genau solchen Erlebnissen aufgewachsen war wie mit der sprichwörtlichen Muttermilch. Schon seine Eltern hatten ihn mit ihren LSD-Angebergeschichten gelangweilt. In Wahrheit und genaugenommen gehörte Stephan Braum dieser seiner Post-Hippie-Generation eben gerade nicht an. Er war immer der einzige gewesen, der nicht mitgemacht hatte beim Kiffen, beim Pilzeessen, beim Tantrasex und beim Komasaufen. Man konnte ihn fast schon dadurch definieren: der Stephan ohne Drogenerfahrung. Braum liebte es zwar, Alkohol zu trinken, betrunken zu sein, aber er schaffte es fast nie. In neun von zehn Fällen blieb er nüchtern. Die Spirituose wirkte einfach nicht. Meist mußte er viele verschiedene an einem Abend ausprobieren, und nur wenn er Glück hatte, wirkte zufällig und nur an dem Tag ein spezielles Getränk. Dabei blieb er dann und trank sich glücklich in einen Rausch. Aber das kam nur ein paarmal im Jahr vor, und selbst im ärgsten Rausch blieb er vollkommen kontrolliert und fuhr sogar im eigenen Auto nach Hause. Polizisten, die ihn manchmal stoppten und wegen der Schlangenlinien zur Rede stellten, hielten ihn sofort für stocknüchtern. Und das war er irgendwie auch.
Irgendwann wollte er sich für die freimütige Offenheit seines Gesprächspartners revanchieren und erzählte seinerseits von Dingen, die ihm nahegingen. Das waren Krankheiten, das Alter, das gefährliche Übergewicht, die dunklen Andeutungen seines Arztes über die geringe verbleibende Lebenszeit. Er verschwieg, daß er schon seit elf Jahren keinen Sex mehr gehabt hatte. Er verschwieg erst recht – da er sich das selbst kaum eingestehen konnte –, daß er eigentlich auch vorher schon skandalös wenig Sex gehabt hatte. Er wollte andererseits den anderen nicht langweilen und konzentrierte sich so auf den ihm prognostizierten baldigen Tod. Das war ja schön dramatisch. Stefan Draschan hörte aufmerksam zu. Er war kein exzentrischer Vielredner und wußte es zu schätzen, wenn jemand beichtete.
»Sicher hast du alles versucht, das Übergewicht wegzukriegen?« fragte er mitfühlend und musterte ihn. Ein massiger, fast furchteinflößender Körper. Es war klar, daß keine Frau mehr auf so etwas stand. Stephan Braum ließ den Kopf hängen und sagte nur seufzend ja.
»Aber du hast doch sicher schon hier und da gehört, daß es nur ein todsicheres Mittel gegen Übergewicht gibt. Nämlich harte Drogen. Kokain, um genau zu sein.«
»Ach, bei mir kommen noch viel schlimmere Sachen hinzu. Es ist nicht nur das viele Fett, das Cholesterin, die ganzen Symptome, die mit Diabetes zu tun haben, sondern …«
Er machte eine Handbewegung, die Fülle ausdrücken sollte. Draschan hakte aber nach:
»Also du bist Diabetiker?«
»Noch nicht, nein. Aber das Herz schlägt so unregelmäßig, daß ich jeden Moment tot umfallen könnte. Das hat mir ein zweiter Arzt gesagt, mit dem ich sogar befreundet bin.«
»Du hast also Herzrhythmusstörungen? Hast du einen Herzschrittmacher?«
»Nein, offiziell ist das alles noch nicht. Ich bin noch zu jung für so was. Der ganze Körper ist im Eimer, trotzdem. Glaub mir, ich weiß oft nicht mehr, wie ich die Treppe hochkommen soll. Ich stehe auf der untersten Stufe und denke: Heute schaffe ich es nicht mehr. Deswegen bin ich ja auch pensioniert worden. Ich bin Invalide.«
»Wie alt bist du denn?«
»Ich … äh …«
»Sechzig?«
»Nein, oh Gott! Doch keine Sechzig! Hm, ich rede nicht gern darüber …«
»Fünfundsechzig!?« scherzte Draschan.
»Ich bin am 6. Dezember 1959 geboren.«
»Aha, also … 53 Jahre alt.«
»Ja. Würde man nicht denken, nicht?«
»Rauchst du viel? Warst du Kettenraucher?«
Braum gab an, nie geraucht und sehr selten getrunken zu haben. Draschan wollte wissen, wie das in der Jugend mit ihm war.
»Genauso! Ich habe gelesen, Briefe geschrieben, das Studium abgeschlossen und so weiter. Dann geheiratet, und während der Ehe ging das dann los mit dem Übergewicht …«
»Was hast du gemacht, während die anderen gekifft haben oder geknutscht?«
»Manchmal mitgekifft, aber es wirkte nicht. Mir wurde jedesmal schlecht.«
»Aha. Sehr gut. Du hast also keine Erfahrungen mit Kokain?«
»Doch, auch, klar. Dreimal habe ich es genommen.«
»Und?«
»Es wirkte nicht.«
»Nie?«
»Na, vielleicht ein halbes Mal. Aber nur recht lau.«
»Wahrscheinlich war es kein reines Kokain. Du mußt reines Kokain nehmen.«
»Aber warum? Ich bin ein Wrack! Weißt du, welche Tabletten ich jetzt schon jeden Tag in mich hineinstopfen muß? Ich habe Schweißausbrüche …«
»Halt! Du hast einfach nur Übergewicht, und das kriegst du nur mit harten Drogen weg. Vergiß alles andere!«
»Stefan, du meinst es gut und ich danke dir. Leider liegen die Dinge nicht so, wie du meinst.«
Sie wechselten das Thema. Als die Höflichkeitsspanne abgelaufen war, verabschiedeten sie sich.
Stephan Braum war ein ehemaliger Beamter. Er war immer ernst und kontrolliert. Das soeben Gehörte konnte ihn unmöglich kaltlassen. Was der junge Mann gesagt hatte, bedurfte unbedingt einer Veri- oder Falsifizierung, also einer genauesten Untersuchung. Immerhin galt es eine Information zu überprüfen, die nicht weniger aussagte als die Behauptung: Er konnte gerettet werden!
Zu Hause wollte er ins Internet gehen, um über Kokain, Opium und Heroin zu recherchieren. Ihm fiel aber als erstes eine Mail einer alten Freundin auf, die ihm ein Buch empfahl. Auch sie wollte offenbar auf seine mißliche Lage Bezug nehmen, denn das Buch hatte den Titel »Was sterbende Menschen am meisten bereuen«. Es gab gleich einen Link zu einem Interview dazu, in dem der Verfasser breit über das letzte Stündlein der Menschen berichtete. Er war nämlich Sterbebegleiter, seit 18 Jahren schon. Demnach bereuten die Leute allesamt und übereinstimmend, zu wenig wirklich gelebt zu haben. Sie hätten zu selten das getan, was sie wollten, und statt dessen das getan, was andere wollten. Um es ins Konkrete zu übersetzen: Sie hätten zu wenig wilden Sex, hemmungslose Partys, ohrenbetäubende Musik, abenteuerliche Szenen und gehirnsprengende Drogen gehabt. Natürlich drückten sie es anders aus, sprachen von der zu kurzen Jugend, den nicht gepflegten Freundschaften, dem verpaßten Rockkonzert der Lieblings-Heavy-Metal-Band und so weiter. Aber Stephan Braum spürte: Diese Leute bereuten, so gelebt zu haben wie er, und genau deswegen mußten sie nun sterben. Der Tod holte sich die Leute, die das Leben ignorierten, und die intensivste Form des Lebens war der durch Drogen induzierte Exzess – so ließe es sich vielleicht verkürzen, das depperte Buch von dem verlogenen Sterbebegleiter. Braum konnte es jedenfalls in seine Recherche einfließen lassen und bestellte es online. Und er faßte nun ganz formell den Beschluß, die Drogenthese zu prüfen und dabei für seine Verhältnisse sehr weit zu gehen. Er wollte alles dafür tun und zulassen – bis auf eines: die exakte, hundertprozentige, verstandesmäßige Kontrolle über sein Verhalten aufgeben. Das würde er niemals tun. Und daran hielt er sich in der Zukunft auch auf meisterliche Weise. Zunächst jedenfalls.
Die ersten belastbaren Informationen über die in Erwägung gezogene neue Medizin bekam er sehr rasch bei Wikipedia. Dieses Unternehmen war eine Art Lexikon der Neuzeit und jeder benutzte es. Es hatte 150 angestellte Mitarbeiter und 450 Millionen User. Somit kamen auf einen Angestellten 30 Millionen Kunden. Stephan Braum, als altmodischer, schrullenhafter Knacker, verließ sich immer noch lieber auf den Großen Brockhaus, also auf sein 25-bändiges tonnenschweres Konversationslexikon. In diesem Fall aber wollte er plötzlich ganz up to date sein. Als erstes las er einen Bericht des blutjungen Sigmund Freud, der 1884 Kokain genommen und dabei ähnlich gewissenhaft die Wirkung bei sich beobachtet hatte, wie Braum das demnächst zu tun gedachte:
»Die psychische Wirkung des Cocainum mur. in Dosen von 0,05 bis 0,10 Gramm besteht in einer Aufheiterung und anhaltenden Euphorie, die sich von der normalen Euphorie des gesunden Menschen in gar nichts unterscheidet. Es fehlt gänzlich das Alterationsgefühl, das die Aufheiterung durch Alkohol begleitet, es fehlt auch der für die Alkoholwirkung charakteristische Drang zur sofortigen Betätigung. Man fühlt eine Zunahme der Selbstbeherrschung, fühlt sich lebenskräftiger und arbeitsfähiger; aber wenn man arbeitet, vermisst man auch die durch Alkohol, Tee oder Kaffee hervorgerufene edle Excitation und Steigerung der geistigen Kräfte. Man ist eben einfach normal und hat bald Mühe, sich zu glauben, dass man unter irgendwelcher Einwirkung steht.«
Aha! Stephan Draschan hatte anscheinend recht gehabt. Doktor Freud nahm sicher reines Kokain, und in dem Fall gab es nur Gutes zu berichten. Herr Braum las gierig weiter, verhedderte sich bald in den nun folgenden chemischen und medizinischen Analysen. Schnell wurde aber klar, daß Kokain das Hungergefühl betäubte:
»Kokain bewirkt eine Stimmungsaufhellung, ein Gefühl gesteigerter Leistungsfähigkeit sowie das Verschwinden von Hunger- und Müdigkeitsgefühlen.«
Schade, daß er die Katze nicht mehr hatte. Seine geschiedene Frau und er hatten keine Kinder gehabt, dafür eine Katze, die sie abgöttisch liebten. Sie waren ihretwegen sogar in die Nähe von Östersund in Nordschweden gezogen, da Kirstin, seine Ex, gemeint hatte, die Katze habe nach fünf Jahren Großstadt und am Ende ihrer Tage endlich die ganze Herrlichkeit der Natur verdient. Tatsächlich lebte Nelly, so hieß sie, noch eine Ewigkeit, bestimmt wegen der herrlichen Natur, und hielt ihn und Kirstin ein volles Jahrzehnt im menschenleeren Schweden fest. Er war Auslandskorrespondent für ganz Skandinavien geworden, für den NDR und die restlichen öffentlich-rechtlichen Sender des deutschen Sprachraums. Erst als Nelly starb, waren sie wieder frei, zogen zurück in die Zivilisation und ließen sich scheiden. Wie gesagt, gäbe es Nelly noch, hätte Braum an ihr die neuen Drogen ausprobieren können. Aber so wie die Dinge lagen, mußte und wollte er dafür seinen eigenen zerstörten Körper einspannen.
Er tat es schon bald. Noch ehe er seine Lektüre richtig aufgenommen und sich die Fachliteratur besorgt hatte, zum Beispiel den Roman von Pitigrilli, aber auch andere, die Stefan Draschan ihm genannt hatte, nahm er zum ersten Mal seit seiner verkorksten, weil freudlosen Jugendzeit tatsächlich wieder Kokain. Draschan hatte ihm ein Lokal genannt und einen Mittelsmann, der mit ihm auf die Toilette gehen sollte. Angeblich war der Mittelsmann zuverlässig und bestens beleumundet.
Ein Mann wie Stephan Braum wollte das natürlich genau wissen und sich absichern. Wer war dieser Vermittler? Hatte der ein Suchtproblem? Handelte es sich um einen wurzellosen, verantwortungsscheuen Jugendlichen, dem bald die Polizei auf der Spur war? Konnte er, Braum, ausgenutzt, betrogen, ausgeraubt werden?
Nein, es war ein durchaus erwachsener, überhaupt nicht mehr junger Mitbürger, den Braum sogar kannte. Und zwar aus der Zeitung. Es handelte sich um den ziemlich erfolgreichen Feuilletonisten Ludwig Fachinger, dessen Kolumne Braum manchmal las. Wenn dieser ihm eine illegale Droge gab, war das nicht für Braum gefährlich, sondern für Fachinger. Der ganze Vorgang war eigentlich verwunderlich, aber Braum wußte, daß in Österreich die Uhren anders tickten als in Deutschland. In Wien hatte der Rausch eine unerhört tiefe und gesunde Tradition und war fast niemals negativ konnotiert. Die Polizei hatte etwas gegen großkriminelle Dealer, aber nichts gegen die Leute, die sich ein paar schöne Stunden machten. Da war es egal, ob sie Bier, Wein oder eben ein bißchen Koks verwendeten.
Nur: Wie sollte er in das Lokal kommen? Wie es dort aushalten? Er bekam ja kaum noch Luft, wenn er in seinem Büro saß und die Fenster geschlossen waren. An zwei von drei Tagen plagte ihn eine mörderische Migräne. Das Laufen fiel ihm derartig schwer, daß er bei jedem Schritt anhalten und sich hinsetzen wollte. Er benutzte auch einen Stock, und das sah bestimmt peinlich aus, in einem Koks-Schuppen. In geschlossenen Räumen, in denen geraucht wurde und in denen sich viele Menschen befanden, wurde ihm schlagartig schlecht, und Minuten später setzten seine gefürchteten Schweißausbrüche ein, die ihn bald aussehen ließen, als habe er gerade in voller Montur geduscht. Jedenfalls kam es ihm so vor. Ging er dann nach draußen, holte er sich garantiert die nächste lebensgefährliche Erkältung. In den zurückliegenden Jahren hatte er nichts so sehr gefürchtet wie eine Erkältung. Sein Körper pfiff ohnehin auf dem letzten Loch, wie sollte er da noch solch einen Angriff abwehren können? Beim letzten und vorletzten Mal war es auch so. Er erholte sich nicht mehr. Einmal hatte er nach vierzehn Tagen die Nerven verloren, das Fenster mitten im Winter weit aufgerissen, das Fieber auf über 42 Grad ansteigen lassen und auf den Tod gewartet. Und jetzt das alles noch mal, die ganze aufgezählte Gefahrenlage, plus Kokain? Das wollte wohlbedacht sein.
Die Treppe runter schaffte er noch. Unten wartete das bestellte Taxi. Der Fahrer erschrak fast, als er die 135 Kilo Lebendgewicht auf sein Auto zukommen sah, sprang heraus, half dem Kerl, dem armen Fettsack. Am Innenspiegel baumelte ein schmuckloses kleines hölzernes Jesuskreuz. Braum registrierte es und hätte es dem Taxler am liebsten abgekauft. Heute konnte ihm nur noch der liebe Gott helfen.
Sollte er das Experiment bestehen, wollte er alles genau aufschreiben und vielleicht sogar einem seiner Ärzte zeigen. Er hatte sich dafür das schönste und teuerste Tagebuch gekauft, lederbezogen, mit Schloß, für 42 Euro. Das war für ihn die eigentliche Lust, auf die er sich freute. Der Rausch selbst war ihm gleichgültig, er erwartete ihn nicht, bestenfalls erhoffte er sich irgendwelche Veränderungen in der Wahrnehmung und im Körpergefühl. Vor allem fieberte er auf das Verschwinden des Hungergefühls hin. Schon beim Gedanken daran überkam Braum ein Anfall von Heißhunger, und er ließ das Taxi vor einem McDonald’s halten. Auf sein Bitten hin holte ihm der Fahrer zwei Big Burger Royal de Luxe aus dem Laden, die Braum sofort aufaß, sozusagen als kräftemäßige Grundlage für das anstrengende Vorhaben.
Das Lokal hieß wie ausgedacht »Alles wird gut« und lag im Ersten Bezirk. Der Taxifahrer bekam vier Euro Trinkgeld und zeigte sich erkenntlich, indem er Braum die schwere Glastür der Drogenhölle aufriß. Zumindest sein Eintreffen war geglückt, dachte sich Braum in dem Moment.
Wie immer in solchen Situationen fiel ihm die Orientierung recht schwer. Er konnte die fremden Menschen nicht erkennen, einordnen, unterscheiden. Er fürchtete sich vor ihnen. Warum hatte er nicht Stefan Draschan mitgenommen? Nun, weil ihn das noch mehr angestrengt hätte. Sein Herz begann zu rasen. Aber er hatte Glück: Fachinger stand gleich neben der Tür an einem kleinen Stehtisch und schien ihn zu erkennen. Braum war zwar kein Prominenter, aber in Wiener Journalistenkreisen auch nicht völlig unbekannt. Immerhin hatte er für den ORF vor einigen Jahren noch eine vielbeachtete 120-minütige Dokumentation über deutsche Überlebende im russisch besetzten Ostpreußen gedreht.
Fachinger duzte ihn, auch er also, und das war schon ungewöhnlich. Anscheinend, merkte sich Braum, ist in festen Drogenkreisen das »Du« die übliche Ansprechform. Man sprach über gemeinsame Bekannte. Als Fachinger merkte, daß Braum einen Schweißausbruch bekam, zog er den verabredeten Deal schnell durch. Er verschwand in Richtung Toilette, Braum sollte bald folgen.
Der tappte unsicher auf die offenen Toilettentüren zu. Am Waschbecken stand ein Fremder, doch das schien Fachinger nicht zu stören. Aus der letzten Toilette heraus rief er mit tiefer Stimme:
»Hierher!«
Braum zögerte. Er war zu dick, um dort mit Fachinger hineinzupassen. Aber der hatte das schon bedacht. Er stellte sich etwas schräge hin, damit Braum zusehen konnte, wie er vom Spülkasten weg das weiße Pulver in die Nase zog. Er benutzte dafür einen simplen Zehneuroschein. Dann verließ er die Zelle und verfolgte, wie Braum es ihm nachtat.
Sie gingen in den Barraum und fühlten sich prächtig. Braum war froh, daß er alles richtig gemacht hatte. Auf der eiskalten Toilette war auch sein Schweißausbruch ein bißchen gestoppt worden. Jetzt legte er sein Jackett ab und zog sogar den Pullover aus, um nicht erneut mit diesem ihm peinlichen Totalschwitzen zu beginnen. Das war die erste unbedingte Voraussetzung dafür, sich nicht vollends unwohl zu fühlen. Normalerweise wäre es ihm unmöglich gewesen, sein Jackett auszuziehen, weil dann jeder seinen Bauch sehen konnte, aber diesmal war es ihm weniger wichtig. Es war erst eine Minute oder zwei vergangen, seit der Einnahme, und schon war eine Veränderung da.
Fachinger stellte ihm nun den Besitzer des Lokals vor. Er tat dies recht großspurig, indem er sagte:
»Darf ich dir Stephan Braum vorstellen: Er ist einer der bekanntesten und angesehensten Journalisten Deutschlands!«
»So? Das war er einmal.«
Das entgegnete der Besitzer des Drogenlokals, so brutal wie unhöflich. Braum, der in seinem bisherigen Leben die Taktik verfolgt hatte, derartiges wegzulächeln und sich dadurch unangreifbar zu machen, fühlte auf einmal eine neue, ganz andersartige Kraft in sich. Er sah dem Luden angriffslustig und selbstsicher ins Gesicht, sagte:
»Dafür wirst du dich entschuldigen. Du kannst schon einmal überlegen, wie.«
Der andere starrte Braum sekundenlang an. Braum hielt dem Blick nicht nur stand, sondern begann dabei, immer mehr zu strahlen. Schließlich stotterte der Besitzer:
»Ich geb’ dir einen Wodka aus.«
»Das reicht nicht.«
»W-was denn dann?«
»Gib mir, was du selbst am liebsten trinkst!«
»Ah, ach so, ja … äh, ich weiß was! Ich gebe dir den Petronsnaja, der … das ist das Beste, was wir haben. Kriegt normalerweise nur der Chef!«
Er gab Order, es wurde eine Flasche von weit her geholt, und Braum stieß mit dem Mann an, mit echtem Petronsnaja. Nun war alles wieder eitel Sonnenschein. Man war befreundet. Ja, Braum gehörte nun dazu, wenn der Schein nicht trog. Was für ein Erfolg, nur zehn Minuten nach der Einnahme des Kokains! Das war sensationell. In Gedanken schrieb es Stephan schon in sein wissenschaftliches Tagebuch.
Kam nun der Rückschlag? Das Herzrasen, der Infarkt, der Schlaganfall? Die Panikattacke? Zunächst nicht. Braum fühlte sich auch weiter wohl. Er stand mit Fachinger an einem der Stehtische und war sehr gesprächig. Sein Gegenüber leider noch mehr. Ja, der hatte jetzt einen Laberflash. Eine Stunde lang ließ er Braum praktisch nicht zu Wort kommen. Es ging um journalistische Heldentaten, die Ludwig Fachinger für sich in Anspruch nahm. Auch er hatte früher für den Staatssender gearbeitet, diesen ORF, den alle in Österreich so wichtig nahmen. Er war sogar zwei Jahre lang Kulturchef gewesen. In seiner Zeit hatte er den Intendanten, einen üblen Frauenfeind, so couragiert bekämpft, ja offen bekriegt, daß der seinen Hut nehmen mußte. So und ähnlich sprach Fachinger, der große Frauenversteher. Der Intendant, den Braum nicht einmal dem Namen nach kannte, mußte demnach eine Art Super-Brüderle gewesen sein, der gutaussehenden Frauen dreist ins Gesicht sagte, ihr Hintern passe vortrefflich in die enge Hose, oder so ähnlich. Ein schönes Thema, aber bei Braum schwanden jetzt doch die Kräfte. Aufmerksam achtete er auf alle Zeichen einer möglichen Überanstrengung. Gerade am Anfang seiner Diät wollte er extrem behutsam vorgehen. Er analysierte die augenblickliche Lage: Vor sich hatte er einen Gesprächspartner, der sich im Laberflash befand und diesen womöglich bis zum nächsten Morgen nicht mehr loswurde. Andere Gesprächspartner waren offenbar nicht vorhanden. Der Körper fühlte sich stark an, was auch an den Petronsnaja liegen konnte, die nun immer nachgeschenkt wurden. Braum konnte mühelos eine weitere Stunde diesen Zustand aushalten, aber die Vergiftung danach war dann doppelt so groß, ohne für die Untersuchung weiteren Erkenntnisgewinn abzuwerfen. Schließlich war zu berücksichtigen, daß zu vorgerückter Stunde womöglich die Toilettensache wiederholt werden würde. Das war doch so üblich bei Junkies. Fachinger hatte sicher noch mehr bei sich, und der Ladenbesitzer erst recht. Nein, es war besser, das wissenschaftlich Erreichte zu sichern und das Experiment für diesen Abend abzubrechen.
Braum nahm seine Sachen. Er hatte sogar noch die Kraft, sich von seinen neuen Freunden vollmundig-leutselig zu verabschieden. Er war nun ganz Mensch. Das beinhaltete, daß Fachinger ihm leid tat. Er stellte sich vor, wie der Typ nachts mitten im Laberflash verröchelte, ohne Zuhörer, weil natürlich alle im Lokal seine journalistischen Heldentaten schon kannten. So überredete er ihn, mit ihm die Gaststätte zu fliehen. Tatsächlich war er einverstanden. Ein Taxi wurde gerufen, und Braum wartete auf den Freund, der noch einmal »kurz aufs Klo« gegangen war.
Erstaunlicherweise machte es Braum nichts mehr aus, allein in dem Lokal zu stehen. Er kam sogar mit einer Frau ins Gespräch, die Literaturwissenschaft studierte. Offenbar hatte er in dieser besonderen Stunde eine Art, so charmant auf andere einzugehen, daß sie sein monströses Aussehen für einige Minuten vergaßen. Aber er wollte dieses Glück nicht überstrapazieren. Als Fachinger nach zehn Minuten nicht zurückgekehrt war, tauschte Braum mit der Studentin die Handynummern aus – und federte zum immer noch wartenden Taxi. Unter Braums Gewicht schien die Erde zu beben, aber es fühlte sich diesmal fast lustig an, so schwer zu sein, auch auf der Treppe, die er problemlos hochstiefelte. In der Nacht dann bekam er natürlich die vorhergesehenen Probleme.
Er fand nicht in den Schlaf. Darauf war er vorbereitet. Er hatte Milch und Honig im Haus, interessantes Lesematerial, einfache Zeitschriften, beruhigende Filme auf DVD, die er extra ausgeliehen hatte. Schokolade. Obst. Fruchtsäfte. Kamillentee. Als letztes Mittel Xanor-Tabletten und Relpax. Er horchte in sich hinein, ob ihm etwas weh tat, zum Beispiel sein schwaches Herz. Doch nur der Kopf selbst fühlte sich mitgenommen an. In Braums Hirn schien eine bleihaltige, säuerliche, zermürbende und gasartige Substanz zu wüten, vergleichbar mit Viren bei Mittelohrentzündung, aber feiner … wie früher, in der Kindheit, bei langen Autofahrten. Mit einem Wort: Er hatte leichtes oder beginnendes Kopfweh. Wenn es nicht schlimmer wurde, konnte er damit leben. Er trank Multivitaminsäfte. Die Schokolade ließ er liegen. Hunger hatte er keinen. Gegen halb sechs Uhr morgens wurde es hell. Da fiel er, etwas überraschend, doch in den Schlaf.
Am nächsten Tag zwang er sich mit äußerster Disziplin dazu, das Tagebuch zu beginnen.
»Liebes geschätztes wissenschaftliches Tagebuch (fortan W.T. geheißen), wie beginnen? Mit dem Datum natürlich. Es war der 10. März 2013. Der Ort: das Lokal ›Alles wird gut‹ in der Rotensterngasse im Ersten Wiener Bezirk. Uhrzeit: kurz nach 23 Uhr. Ich kam nüchtern in das Lokal, und zwar mit dem Taxi. Der Taxifahrer hielt mir die Tür auf, da ich ihm ein unverschämt hohes Trinkgeld gegeben hatte. Ich fühlte mich besser als sonst in vergleichbaren Situationen. Soziale Ansammlungen in geschlossenen Räumen ängstigen mich normalerweise sehr. Diesmal eher nicht.
Hammondorgel-Musik aus den 60er Jahren empfing mich. Ich tippte auf Brian Auger and the Trinity, mit Julie Driscoll. Mein Bruder hatte das gehört, als ich zehn war und er vierzehn. Kein schlechter Beginn. Sonst fällt mir Musik in Lokalen kaum auf, doch diesmal achtete ich aus guten Gründen auf alles. Ich sah auf einen langen, schmalen, schlauchförmigen Gang, an dessen rechter Seite gerade einmal Platz für kleine, viereckige Tischchen war, die eine erstaunliche Höhe aufwiesen, wie auch die Barhocker, sodaß die Leute wie auf Stelzen zu sitzen schienen.
Gleich am ersten Tisch saß mein Mittelsmann, mit Namen Ludwig Fachinger, den ich schon seit Jahren aus der Ferne kenne. Ich lese seine Kolumne im ›Freitag‹ und kann mir ein Bild von ihm machen. Reicher Sohn, lag dem Vater früher auf der Tasche, vielleicht sogar heute noch. Alter schwer zu sagen, 40? 50? Dem Rotlichtmilieu zugetan. Politisch eher links als rechts. Später erzählte er mir, daß er Drogen am liebsten von Hurenbrüsten schnieft. Er erzählte auch viel von Kämpfen, die er in dem Staatssender ›ORF‹ ausgefochten haben will. Da war er einmal, sagte er, Kulturchef gewesen. Ich kann das nicht nachprüfen, will es auch nicht. Meine eigene Zeit beim Fernsehen reicht mir.
An der Bar standen virile, dennoch ausgemergelte 40jährige Männer, gefährlich, potent, böse, vielleicht Werber oder eben sogenannte Kreative. Oberhalb der Flaschenregale hing sehr schlechte Kunst, also wertlose abstrakte Möchtegernkunst, ockerfarbene Farbkleckse. Die Bar war indirekt beleuchtet. Fachinger machte mir frühzeitig ein Zeichen und ging durch den langen Gang nach hinten. Dort geht es eine Treppe hinunter zu den Toiletten. Er verteilte zwei Linien Kokain auf einen Handspiegel und schnupfte eine davon. Sie war etwa zwei Millimeter dünn und drei Zentimeter lang. Ich schnupfte die zweite. Die Toilettentür war dabei offen. Wir gingen zurück. Ich fühlte mich gut. Soweit ich mich erinnere, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch keine körperlichen Reaktionen, auch keinen Schweißausbruch.
Es waren nicht viele Leute in dem Lokal. Eine Frau lachte kehlig, als ich mich an ihr vorbeizwänge. Ich hörte Wortfetzen des amerikanischen Idioms. Eine abgehärmte, im Alter schwer zu schätzende Blondine mit krummem Rücken und schwarzer Weste auf nackter Haut blies den Rauch ihrer Zigarette aus, die sie weit oben hält, etwa in Stirnhöhe. Sie lümmelte auf einem der Barhocker und unterhielt einen jungen Mann, der sehr glatt und rosig rasiert war und eine H.-C.-Strache-Frisur trug. Ich saß wieder mit Fachinger am Eingang des Lokals und hörte mir seine ›ORF‹-Geschichten an. Er redete sehr schnell, schneller als vor der Drogeneinnahme. Ich kam nicht mehr zum Entgegnen.
Er stand auf, holte den Barbesitzer und stellte ihn mir vor. Dabei kam es zu einem feindseligen Wortwechsel. Danach gab mir der Mann teure Getränke aus.
Erst durch diese Getränke begann ich mich wohl zu fühlen. Sie sind wirklich sehr gut, irgendein seltener Wodka aus Rußland. Das Kokain machte mich selbstbewußt, der Wodka erzeugte nun eine Art Glücksgefühl. Vielleicht war es die Mischung aus beidem? Leider traute ich mich nicht, nach der Herkunft und der genauen Zusammensetzung des Kokains zu fragen. Wie rein war es? Mit was genau war es gestreckt worden? Mir war Fachinger zu fremd, als daß ich ihn hätte fragen können. Außerdem überließ er mir nie das Wort. Trotzdem hegte ich in dieser Situation freundschaftliche Gefühle ihm gegenüber. Sehr seltsam. Er erzählte weitere ›ORF‹-Geschichten, weitere Kämpfe, wem er was und wann gesagt hatte, sein ganzer Kampf gegen den schwarzen Muff, sein Eintreten für die Frauen und gegen den Sexismus und den damaligen Intendanten. Er war wohl doch eher ein Art nachgeborener Altlinker und daher so froh, mich kennenzulernen. Er erzählte, daß er sich das Trinken abgewöhnt hätte, jetzt aber wieder angefangen hätte, da er lieber etwas vom Leben haben wollte und von der Erotik. Er sei ein lieber, zärtlicher Mensch und sehr verletzlich. Er redete ununterbrochen.
Später verschwand er wieder auf der Toilette, nun ohne mich. Ich wartete auf ihn, ziemlich lange, wie ich fand. Vielleicht war mein Zeitgefühl auch gestört. Das Lokal kam mir nun ganz normal vor. Also natürlicher, als man es von einer Opiumhöhle erwarten würde. Es kamen nun immer mehr Menschen. Da ich allein war, hätte nun meine Soziophobie ausbrechen müssen, was aber nicht der Fall war. Leider wurde die Musik schlechter. Sie spielten nichtssagende 80er-Jahre-Bluesmusik mit großem Orchester, also richtige Scheiße. Danach steigerte sich das noch durch Gospelsongs in derselben Besetzung. Ich stellte mir vor, wie die Koksnasen sich an diesen quasireligiösen Gospelreimen delektierten, während sie im Klo neue Lines auflegten. Direkt vor mir stand nun so ein Verbrecher fordernd an der Bar, das eine Bein obszön abgespreizt, das andere am Boden. Ein anderer Kerl, ein Mittdreißiger mit Thermojacke, Segeltuchhose und Wolfskin-Bergschuhen, stand sebstsicher-dumpf daneben – vielleicht selbst ein Gastronom oder Bordell-Betreiber. Die Bedienung gefiel mir. Sie trug eine weit offene, gut sitzende, petrolfarbene Bluse, und ich nahm sogar den dünnen, teuren Stoff wahr, aus dem diese Bluse gemacht war. Vor der herrlichen Brust baumelte ein silbernes Amulett und sollte wohl die Blicke von derselben ablenken. In meinem Fall gelang das nicht. Ich spürte nun, daß ich gegen meinen Willen hinsah. Offenbar hatte mich die Einnahme der Droge ein Stück weit hemmungslos gemacht.
Eine Frau mit enganliegendem Leibchen und viel Haut setzte sich irgendwann auf Fachingers Platz. Große Augen, volle rote Lippen, dunkle Haare, gute Figur. Es war mir recht, denn gerade wurde die Musik um einen weiteren Grad scheußlicher. Die Mega-Arschgeige Frank Sinatra sülzte sein ›My way‹, live, am Ende seiner Karriere, mit Big Band, aber ohne Stimme. Die Frau kam mit mir ins Gespräch. Sie war noch Studentin. Ich bekam noch immer keinen Schweißausbruch, merkte aber, daß mein Glück nun überhandnahm. Die vor mir befindlichen Flaschenregale der Bar enthielten wohl alle nur denkbaren Spirituosen der Erde. Aber was hätte ich mit so einer schönen Person anfangen sollen? Es konnte nur peinlich enden, wenn ich mit Hilfe von Alkohol die Stimmung künstlich verlängerte. Und so geriet ich in die Defensive. Obwohl meine Euphorie noch immer anhielt und ich sogar die Handynummer der Studentin eroberte – junge Leute sind heutzutage immer bereit, erfolgreichen Älteren ihre Daten zu überlassen –, trat ich den Rückzug an. Gegen 0.45 Uhr brachte mich ein Taxi nach Hause. Dort begann für mich die Kehrseite des Rausches. Ich war erst aufgeregt und glücklich, dann schlaflos und nervös, dann ungeduldig und unzufrieden. Verzweifelt war ich aber nicht. Und auch kein bißchen depressiv, nicht in der Nacht. Und nach ungefähr fünf Stunden des Hin- und Herwälzens schlief ich sogar ein. Das war vor siebeneinhalb Stunden.«
Stephan Braums erster Bericht im »geschätzten wissenschaftlichen Tagebuch, fortan W. T. geheißen«, war ihm noch etwas schwergefallen, und er ahnte nicht, wieviel Spaß und Lebenslust er gerade aus diesen Aufzeichnungen eines Tages ziehen würde. Nein, es kam ihm holprig vor, was er da verfaßt hatte.
Dafür hielten die nächsten Tage ein paar Besserungen für ihn bereit. Wenn er sich nicht täuschte und wenn das ungewohnte extreme Selbstbeobachten ihn nicht in die Irre führte, fiel ihm das Gehen nun etwas leichter. Die übliche Morgendepression, die er mit einem verschreibungspflichtigen Psychopharmakon sowie einem harmlosen Biomittel bekämpfte, verschwand schneller als sonst, nämlich schon nach einer Dreiviertelstunde. Das notierte er sofort. Die Kopfhaut juckte weniger stark, und er hatte fast Lust, zum Friseur zu gehen – normalerweise eine unangenehme Vorstellung. Er schien sich insgesamt weniger vor der Außenwelt zu fürchten, obwohl, und auch das muß erwähnt werden, der Tag nach dem ersten Kokainschnupfen nicht leicht war. Er fühlte sich schwach und gereizt. Wie nach einer Nacht ohne Schlaf. Er mußte sich zusammennehmen, was jedoch, da er alleine lebte, ohne Folgen blieb. Auf jeden Fall überwand er diese kritische Phase und wurde danach, für seine Verhältnisse, ein bißchen weniger introvertiert, fast könnte man sagen: gesellig. Er traf Freunde von früher, wobei er stets mehr oder weniger geschickt das Thema Drogen ansteuerte. Er merkte, daß – außer ihm selbst – alle Menschen seines Kulturkreises massive Erfahrungen mit Drogen hatten, und zwar nicht nur mit Gras und Shit, wie Marihuana und Haschisch oft genannt wurden. Praktisch jeder hatte einmal eine Drogenphase gehabt, und jeder kannte mindestens einen, der sich gerade mit harten Drogen zugrunde richtete.
Für genau diese Fälle interessierte sich Stephan Braum besonders. Er wollte wissen, was ihm blühte, wenn er das vermeintliche Teufelszeug länger nahm, oder besser gesagt: was ihm genau blühte. Denn daß ein furchtbarer Preis zu zahlen war für die Freuden des Rausches, daß es sozusagen ein Pakt mit dem Teufel war und man dafür in die Hölle kam, wußte doch jedes Kind. Nur wie sah die Hölle ganz konkret aus, und war sie schlimmer und unangenehmer als der Zustand, in dem Braum bislang gelebt hatte? Zudem hatte er gar nicht vor, im Rausch zu leben. Er wollte nur abnehmen. Er wollte nicht in wenigen Jahren sterben. Und wenn doch, dann nicht als ekliger, gemiedener Elefantenmensch. Also noch mal: Was geschah mit den Kokainisten und Morphinisten genau? Die Erzählungen, die er nun hörte, übertrafen leider alle unangenehmen Erwartungen.
Da war zum Beispiel der Hölzl, ein stadtbekannter, sogar landesweit bekannter Künstler, Braum kannte ihn gut, ja alle kannten ihn gut. Man wußte auch, daß er exzessiv viel trank, und das liebten alle sogar an ihm. Er war der originellste, lustigste, liebenswerteste Mensch weit und breit, immer zu schrägen Scherzen aufgelegt. Im Alleingang unterhielt er die ganze Clique, zu der in besseren Zeiten auch Braum einmal ein bißchen gehört hatte. Daß er auch kokste, war bekannt und völlig normal. Nun aber erfuhr Braum, daß Hölzl längst am Ende war, heillos überschuldet, ausgebrannt, kreativ ausgehöhlt, emotional erkaltet, impotent, trotzdem sexsüchtig, körperlich ein Wrack, mit 100000 Euro im Minus bei der Bank, vom Dealer gerade noch geduldet. Selbst der bestochene Apotheker überlegte sich, dem Freund die Überdosen Xanor weiter ins Haus zu liefern. Ein Stop der Lieferung hätte den Absturz ins Nichts bedeutet, in die Hölle eben, die vielbeschworene. Nun liefen seltsamerweise Hölzls Geschäfte in der Kunst immer noch gut, ja blendend. Er stand sogar vor einem weiteren großen Sprung nach oben. Denn in der Kunstwelt wurde es honoriert, wenn jemand sozusagen sein Leben für das Werk aufs Spiel setzte. So sah es nämlich für viele aus, auch wenn der Zusammenhang kaum stimmte. Wenn Hölzl bald das Doppelte verdiente, konnte er auch ein weiteres Jahr Kokain nehmen. Oder? Die alten Freunde winkten ab. Der Körper sei schon zu geschwächt, Hölzl blute ständig aus der Nase. Es ging das Gerücht, er habe bereits eine Leberzirrhose. Er sei zudem Lichtjahre von einer Einsicht in seine Lage entfernt. Er müsse jahrelang in eine Klinik, wäre aber noch nicht einmal bereit, über seinen Zustand auch nur zu reden. Nein, das werde nichts mehr mit dem. Statt dessen lasse er sich fast jede Nacht Nutten aufs Zimmer kommen, die dann Furchtbares zu erleiden hätten …
So so, dachte sich Stephan Braum. So sah also die Hölle aus. Darüber mußte er unbedingt noch einmal gesondert nachdenken, zum Beispiel in seinem wissenschaftlichen Tagebuch. Hölzl führte dieses Leben, das zur Hölle führte, seit einem Vierteljahrhundert. Vielleicht brauchte es so lange, bis man an der Pforte zur Ewigen Verdammtheit anlangte? Dann wäre Braum erst mit 78 soweit. Zudem: War es wirklich nötig, derartig den Kopf zu verlieren wie Hölzl? Er, Stephan Braum, war ein vollkommen anderer Typ Mensch. Immer schon. Von Kindesbeinen an. Kontrolliert, vernünftig, maßvoll. Hölzl dagegen war sicher schon als Schüler ein Rabauke, ein Schläger, ein hemmungsloser Angeber – warum sollten Drogen diese Züge nicht verstärkt haben, bis hin zum Desaster? Wenn man diese Züge aber gar nicht hatte, konnten sie auch nicht hochgeputscht werden. Vielleicht hatte Braum deshalb nie eine Wirkung verspürt, damals, als Jugendlicher, bei den ersten Drogenerlebnissen. Auch jetzt, in dem Lokal »Alles wird gut«, war die Wirkung kaum stärker als die von Sekt gewesen. Wenn ein junges Vorstadtmädel zum erstenmal Champagner trinkt, war es sicher eher high als Braum mit Kokain.
Der zweite Grund, gesellig zu werden, lag in der Notwendigkeit, den Stoff endlich zu erwerben. Stephan wollte kein zweites Mal auf der Toilette eines fremden Lokals mit einem fremden Mann eine nicht weiter untersuchte harte Droge zu sich nehmen. Er wollte das Zeug zu Hause haben und genau kennen. Er wollte die Dosierung selbst bestimmen. Er wollte vorher entscheiden, welche Situationen er im Rausch durchleben würde. Um zu erfahren, an welchen Orten gedealt wurde, traf er sich mit Thomas Draschan, dem großen und erfolgreichen Bruder des kleinen verkifften Stefan Draschan.
Diesmal benutzte Braum den eigenen Wagen. Er besaß einen neuwertigen japanischen Hybrid-Toyota, den er aber seit Beginn des letzten Winters in der Garage gelassen hatte. Das Auto war geräumig, aber, wie Braum dachte, nicht mehr geräumig genug für seinen stets anschwellenden Körper, und außerdem war seine Fahrtüchtigkeit durch die vielen Tabletten nicht mehr gewährleistet. Die Bullen hätten ein armes Schwein wie ihn natürlich nie in die Mangel genommen, aber bei einem Unfall eben schon. Die Tabletten bewirkten auch eine gravierende Nachtblindheit, so daß er manchmal noch ein Ziel anfahren, Stunden später aber nicht mehr zurückfahren konnte. Jetzt aber war es ihm egal. Er wollte schnell zu Thomas Draschans Vernissage. Dort wollte er ihn unauffällig zur Seite ziehen und befragen. Dieser Mann war außerordentlich intelligent und allwissend. Es gab keine Frage, die er nicht sofort beantworten konnte. Er war das Gegenteil seines kleinen Bruders.
Braum parkte den Toyota Prius direkt vor der angesagten Edelgalerie in der Neustiftgasse, im strengen Halteverbot. Er durfte das, denn auf der Heckscheibe klebte deutlich sichtbar das Behindertenzeichen. Er griff nach der Gehhilfe, zwängte sich aus der Limousine und streckte seinen Körper, auf den Stock gestützt, langsam nach oben. Jetzt raste doch wieder sein Herz. Aber die Vorfreude war stärker.
»Professor Braum!« rief Thomas schmetternd durch die Halle. Sie waren früher echte Freunde gewesen, ohne sich jemals wirklich nahegekommen zu sein. Ganz offenbar freute sich der Künstler über den Besuch des spröden Norddeutschen. Er hatte ihn vielleicht schon aufgegeben gehabt.
»Du auf einer Vernissage? Das hat es doch Jahre nicht mehr gegeben! Geht es dir jetzt besser?«
»Danke, ja.«
Er humpelte an den Bildern vorbei, die er dennoch genau musterte. Es war eine alte Angewohnheit von ihm, erst die Werke und dann erst den Meister zu würdigen. Später suchte Draschan immer wieder seine Nähe, plapperte vergnügt auf ihn ein. Braum kam das fast verdächtig vor. Warum redete sein alter Freund soviel? Warum ließ er ihn nie zu Wort kommen? War auch er Kokainist? Er glaubte es nicht, denn gerade dieser Künstler hatte die geistige Klarheit zu seinem Markenkern erkoren. Draschan trank noch nicht einmal Bier oder Kaffee. In seiner Studentenzeit hatte er allerdings alles genommen, was der Drogenmarkt hergab. Deshalb wollte Braum ihn sprechen. Da er aber nicht zu Wort kam, gab er das Vorhaben auf. Er wurde einer berühmten Kulturredakteurin vorgestellt, der gutaussehenden Ann-Kathrin Grotkasten. Schon wieder brach seine alte Krankheit auf, die Soziophobie.
»Ann-Kathrin kommt aus Frankfurt, das kennst du doch auch? Bist du nicht in Frankfurt gewesen? Ann-Kathrin mag Frankfurt überhaupt nicht!«